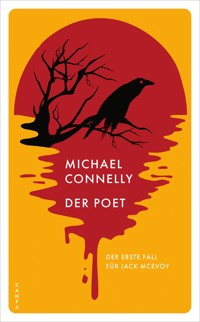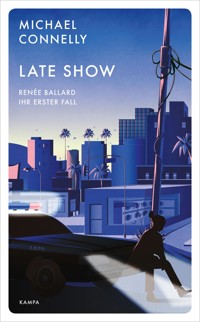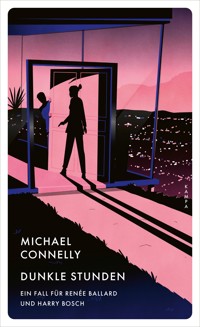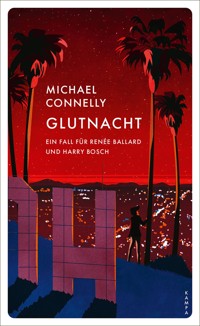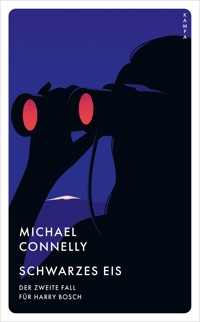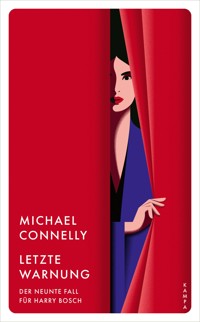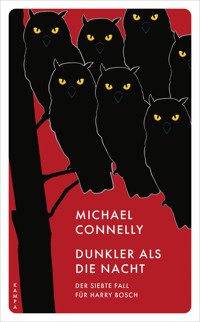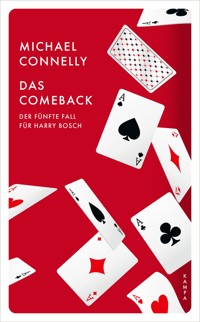Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Jack McEvoy ahnt schon, was ihm blüht, als er ins Büro seines Chefs bei der L.A. Times zitiert wird. Auch ihm wird aus Kostengründen gekündigt werden. Zwei Wochen darf er noch bleiben - um seine blutjunge Nachfolgerin Angela Cook einzuarbeiten. Jack willigt ein, denn er will noch einen letzten Scoop landen, eine letzte große Geschichte schreiben: Ein schwarzer Jugendlicher steht unter Verdacht, eine Tänzerin brutal ermordet zu haben. Doch McEvoy hält Alonzo Winslow für unschuldig. Bei seinen Recherchen stößt der Polizeireporter auf einen ganz ähnlichen Mord in Las Vegas, den Alonzo nicht begangen haben kann. Auch diese Frau wurde mit einer Plastiktüte erstickt und ihre Leiche im Kofferraum eines Wagens verstaut. McEvoy ist sicher, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Seine neue Kollegin versucht er aus den Ermittlungen heraushalten, aber Angela will sich profilieren und bringt sie so beide in tödliche Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Connelly
Die Vogelscheuche
Der zweite Fall für Jack McEvoy
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Für James Crumley,
für Der letzte echte Kuss
1Die Farm
Carver ging im Kontrollraum auf und ab und wachte über die vorderen Vierzig. Die Türme standen in exakt ausgerichteten Reihen vor ihm. Sie summten ruhig und effizient, und trotz allem, was er wusste, musste Carver staunen, was die Technik zustande gebracht hatte. So viel auf so engem Raum. Kein Rinnsal, sondern ein wilder, reißender Datenstrom, der Tag für Tag an ihm vorbeirauschte. In hohen Stahlschloten vor ihm wuchs. Alles, was er tun musste, war hineinzugreifen, zu schauen und auszuwählen. Es war wie Goldwaschen.
Nur einfacher.
Er sah auf die Temperaturanzeigen. Im Serverraum lief alles nach Plan. Er senkte den Blick auf die Monitore auf den Arbeitsplätzen vor ihm. Seine drei Techniker arbeiteten gemeinsam am aktuellen Projekt. Ein dank Carvers Können und Wachsamkeit abgewehrter Angriff. Jetzt die Abrechnung.
Der Möchtegern-Eindringling war nicht durch die Mauern des Farmhauses gekommen, hatte aber überall seine Fingerabdrücke hinterlassen. Grinsend beobachtete Carver, wie seine Männer die Brotkrumen auflasen, die IP-Adresse durch die Datenverkehrsknotenpunkte aufspürten, eine Hochgeschwindigkeitsjagd zurück zum Ursprung. Bald würde Carver wissen, wer der Eindringling war, welcher Firma er angehörte, wonach er gesucht und welchen Vorteil er sich davon erhofft hatte. Und Carver würde Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, die den glücklosen Kontrahenten vernichten würden. Carver kannte keine Gnade. Niemals.
Über ihm begann der Alarm der Sicherheitsschleuse zu summen.
»Monitore«, sagte Carver.
Gleichzeitig gaben die drei jungen Männer an den Arbeitsplätzen Befehle ein, die ihre Arbeit vor den Besuchern verbargen. Die Tür des Kontrollraums ging auf, und McGinnis kam mit einem Mann herein, den Carver noch nie gesehen hatte.
»Das ist unser Kontrollraum, und durch die Fenster dort sehen Sie die ›vorderen Vierzig‹, wie wir sie nennen«, sagte McGinnis. »Hier sind alle unsere Colocation-Dienste zusammengefasst. Dort würden die Daten Ihrer Firma hauptsächlich untergebracht werden. Wir haben da drinnen vierzig Türme, die an die tausend dedizierte Server fassen. Und selbstverständlich ist noch Platz für mehr. Der Platz wird uns nie ausgehen.«
Der Mann nickte. »Wegen des Platzes mache ich mir keine Sorgen. Uns geht es um die Sicherheit.«
»Natürlich, und deswegen sind wir hierhergekommen. Ich wollte Sie mit Wesley Carver bekanntmachen. Wesley ist hier unten sozusagen unser Mädchen für alles. Er ist sowohl unser Technology Officer als auch unser leitender Sicherheitsingenieur und nicht zuletzt der Mann, der das Rechenzentrum geplant und entworfen hat. Er kann Ihnen alle Fragen beantworten, die Sie zur Colocation-Sicherheit haben.«
Die übliche Zirkusnummer. Carver schüttelte dem Mann die Hand. Er wurde ihm als David Wyeth von der Anwaltskanzlei Mercer & Gissal aus St. Louis vorgestellt. Hörte sich nach gebügelten weißen Hemden und feinem Tuch an. Carver sah, dass Wyeth einen Soßenfleck auf der Krawatte hatte. Wenn Kunden in die Stadt kamen, ging McGinnis immer in Rosie’s Barbecue mit ihnen essen.
Carver zog seine übliche Nummer ab und erwähnte dabei alles, was der schnieke Anwalt hören wollte. Wyeth würde nach St. Louis zurückkehren und berichten, wie beeindruckt er gewesen war. Er würde den Kollegen erzählen, dass das die Richtung sei, die sie einschlagen müssten, wenn die Kanzlei mit den sich ändernden Technologien und Zeiten Schritt halten wollte.
Und McGinnis würde einen weiteren Auftrag erhalten.
Während er sprach, dachte Carver die ganze Zeit an den Angreifer, den sie gejagt hatten. Er war irgendwo da draußen und ahnte noch nicht, dass er prompt die Quittung erhalten würde. Carver und seine jungen Schüler würden seine Bankkonten abräumen, seine Identität annehmen und Fotos von Männern, die sich an achtjährigen Jungen vergingen, auf seinem Bürocomputer verstecken, bevor sie ihn mit einem Virus lahmlegten. Wenn es dem Angreifer nicht gelänge, ihn zu entfernen, würde er einen Fachmann hinzuziehen. Die Fotos würden entdeckt und die Polizei verständigt. Der Angreifer wäre unschädlich gemacht. Eine weitere Bedrohung, die von der Vogelscheuche abgewendet worden war.
»Wesley?«, sagte McGinnis.
Carver wurde aus seinem Tagtraum gerissen. Der Anzug hatte eine Frage gestellt. Seinen Namen hatte Carver bereits wieder vergessen.
»Ja, bitte?«
»Mr. Wyeth wollte wissen, ob das Colocation-Zentrum jemals geknackt wurde.«
McGinnis lächelte wissend, denn er kannte die Antwort bereits.
»Nein, Sir, das ist noch niemandem gelungen. Obwohl es, ehrlich gestanden, schon einige versucht haben. Aber alle Angriffe sind fehlgeschlagen – mit verheerenden Folgen für diejenigen, die es versucht haben.«
Der Anzug nickte ernst. »Wir vertreten die Crème de la Crème von St. Louis. Die Unantastbarkeit unserer Akten und unserer Mandantenliste steht bei allem, was wir tun, an erster Stelle. Deshalb bin ich persönlich hierhergekommen.«
Deswegen und wegen des Stripklubs, in den dich McGinnis ausgeführt hat, dachte Carver, ohne es zu sagen. Stattdessen lächelte er, aber in seinem Lächeln war keine Wärme. Er war froh, dass ihn McGinnis an den Namen des Anzugs erinnert hatte.
»Keine Angst, Mr. Wyeth«, sagte er. »Auf dieser Farm wird Ihre Ernte in guten Händen sein.«
Wyeth erwiderte das Lächeln.
»Genau das wollte ich hören.«
2Der Samtsarg
Jedes Augenpaar im Newsroom folgte mir, als ich aus Kramers Büro kam. Es wurde ein langer Weg. Die rosa Zettel wurden immer freitags verteilt, und alle wussten, dass ich gerade einen erhalten hatte. Nur hießen sie nicht mehr rosa Zettel. Neuerdings nannte man sie PA-Formulare – von Personalabbau.
Alle verspürten einen schwachen Schauder der Erleichterung, dass es nicht sie getroffen hatte, und einen schwachen Schauder der Besorgnis, weil ihnen klar war, dass sich niemand in Sicherheit wiegen konnte. Jeder von ihnen konnte als Nächster dran sein.
Ich wich allen Blicken aus, bis ich unter dem Lokalredaktionsschild durchging und endlich meine Koje erreichte. Ich ließ mich auf meinen Schreibtischstuhl sinken, wo ich wie ein Soldat, der in einem Schützenloch verschwindet, nicht mehr zu sehen war.
Im selben Moment läutete mein Telefon. Auf dem Display sah ich, dass es Larry Bernard war. Er saß nur zwei Abteile weiter, wusste aber, wenn er mich persönlich aufsuchte, wäre dies für andere in der Redaktion das Zeichen, sich um mich zu scharen und das Offensichtliche zu fragen. In Rudeln arbeiten Reporter am liebsten.
Ich setzte mein Headset auf und nahm den Anruf entgegen.
»Hallo, Jack«, sagte er.
»Hi, Larry«, sagte ich.
»Und?«
»Was und?«
»Was wollte Kramer?«
Er sprach den Namen des leitenden Redakteurs wie Crammer aus, der Spitzname, den Richard Kramer vor Jahren verpasst bekommen hatte, als er sich als Deskredakteur mehr für die Quantität als die Qualität der Meldungen, die er seine Reporter für die Zeitung hatte produzieren lassen, interessiert hatte. Im Lauf der Zeit waren sein vollständiger Name oder Teile davon auch noch auf andere Weise verballhornt worden.
»Du weißt doch, was er wollte. Er hat mir gekündigt. Ich bin raus.«
»Im Ernst? Er hat dich gefeuert?«
»Richtig. Aber wie du weißt, nennt man das jetzt ›Personalabbaumaßnahme‹.«
»Musst du deinen Schreibtisch sofort räumen? Warte, ich helfe dir.«
»Nein, zwei Wochen habe ich noch. Bis zum Zweiundzwanzigsten, dann ist endgültig Schluss.«
»Zwei Wochen noch? Warum zwei Wochen?«
Die meisten PA-Opfer mussten ihren Arbeitsplatz auf der Stelle räumen. Dazu war man übergegangen, nachdem einer der ersten Empfänger eines Kündigungsschreibens noch so lange hatte bleiben dürfen, wie ihm sein Gehalt gezahlt worden war. Daraufhin sahen ihn die Leute in der Redaktion an jedem seiner noch verbleibenden Tage mit einem Tennisball. Er tippte ihn auf, warf ihn hoch, drückte ihn. Niemandem fiel auf, dass es jeden Tag ein anderer Ball war. Und jeden Tag spülte er in der Herrentoilette einen Ball hinunter. Etwa eine Woche, nachdem er weg war, verstopfte das Rohr, mit verheerenden Folgen.
»Sie haben mir die zwei Wochen zugestanden, wenn ich mich bereit erkläre, meinen Nachfolger einzuarbeiten.«
Larry blieb eine Weile still, als er darüber nachdachte, wie demütigend es war, seinen eigenen Nachfolger anlernen zu müssen. Aber für mich waren zwei Wochen Gehalt zwei Wochen Gehalt, das ich nicht bekäme, wenn ich mich nicht darauf einließe. Und außerdem konnte ich diese zwei Wochen nutzen, um mich von denjenigen in der Redaktion und im Revier, die es verdient hatten, zu verabschieden. Die Alternative, nämlich von einem Security-Mann mit einer Schachtel mit meinen persönlichen Dingen zum Ausgang begleitet zu werden, hielt ich für noch demütigender. Ich war mir sicher, dass sie darauf achten würden, dass ich keine Tennisbälle zur Arbeit mitbrachte, aber in dieser Hinsicht brauchten sie sich keine Sorgen zu machen. So etwas war nicht meine Art.
»Und das war alles? Mehr hat er nicht gesagt? Zwei Wochen und dann ist Schluss?«
»Er hat mir die Hand geschüttelt und gesagt, ich würde doch ganz gut aussehen, ich sollte es beim Fernsehen versuchen.«
»Also echt, Mann. Da steht heute Abend aber ein gewaltiges Besäufnis an.«
»Auf jeden Fall.«
»Das ist einfach nicht in Ordnung, Mann.«
»Die ganze Welt ist nicht in Ordnung, Larry.«
»Wer ist denn dein Nachfolger? Immerhin einer, der weiß, dass er vorerst nichts zu befürchten hat.«
»Angela Cook.«
»Passt. Die Cops werden begeistert sein.«
Larry war ein Freund, aber im Moment war mir nicht danach, über das alles mit ihm zu reden. Ich wollte über meine Alternativen nachdenken. Ich erhob mich ein wenig und spähte über die 1,20 hohen Wände meiner Koje. Niemand schaute mehr in meine Richtung. Ich ließ meinen Blick zu den verglasten Büros der Redaktionsleiter schweifen. Das von Kramer war ein Eckbüro, er stand hinter der Glasscheibe und schaute in den Newsroom hinaus. Als unsere Blicke sich plötzlich trafen, wandte er sich schnell ab.
»Was willst du jetzt machen?«, fragte Larry.
Ich ließ mich wieder in meinen Stuhl sinken. »Ich hab mir noch keine Gedanken gemacht, aber damit werde ich jetzt anfangen. Wohin gehen wir, ins Big Wang’s oder ins Short Stop?«
»Ins Short Stop. Im Wang’s war ich erst gestern Abend.«
»Bis dann also.«
Ich wollte gerade auflegen, als Larry mit einer letzten Frage herausplatzte.
»Noch etwas. Hat er gesagt, welche Nummer du bist?«
Er wollte natürlich wissen, wie seine Chancen standen, diesen jüngsten betrieblichen Aderlass zu überstehen.
»Als ich zu ihm reinging, fing er an, dass ich es fast geschafft hätte und wie schwer es wäre, die letzten Entscheidungen zu treffen. Er sagte, ich wäre Nummer neunundneunzig.«
Zwei Monate zuvor hatte die Zeitung angekündigt, dass einhundert Redaktionsstellen gestrichen werden müssten, um die Kosten zu senken und unsere Firmengötter milde zu stimmen. Während ich Larry kurz darüber nachdenken ließ, wer Nummer einhundert sein könnte, schaute ich wieder zu Kramers Büro. Er stand immer noch hinter der Glasscheibe.
»Wenn du meinen Rat hören willst, Larry, dann zieh mal lieber den Kopf ein. Der Sensenmann steht am Fenster und sucht gerade Nummer hundert.«
Ich drückte die Trenntaste, behielt aber das Headset auf. Das würde hoffentlich jeden in der Redaktion davon abhalten, mich anzusprechen. Mir war klar, dass Larry den anderen Reportern erzählen würde, dass ich ausgemustert worden war und dass sie anrücken würden, um mich zu bedauern. Ich musste mich allerdings darauf konzentrieren, eine kurze Meldung über die Festnahme eines Verdächtigen in einem Auftragsmord zu Ende zu schreiben, der von der Robbery Homicide Division des Los Angeles Police Department aufgedeckt worden war. Dann konnte ich mich aus der Redaktion verdrücken und in einer Bar das Ende meiner Laufbahn im journalistischen Tagesgeschäft begießen. Denn das würde es werden. Für einen Polizeireporter über vierzig gab es auf dem gegenwärtigen Zeitungsmarkt keinen Job mehr. Nicht, wenn ihnen ein unerschöpflicher Vorrat an billigen Arbeitskräften zur Verfügung stand – Babyreporter wie Angela Cook, von der USC und Medill und Columbia Jahr für Jahr frisch ausgespuckt, technologisch auf dem neuesten Stand und bereit, praktisch umsonst zu arbeiten. Wie die Papier-und-Druckerschwärze-Presse war auch ich ein Auslaufmodell. Jetzt war das Internet angesagt. Stündliche Uploads in Online-Ausgaben und Blogs. Fernseh-Tie-ins und Twitter-Updates. Jetzt schrieb man Meldungen mit seinem Handy, anstatt sie mit seiner Hilfe an die Redaktion durchzugeben. Die Tageszeitung hätte sich genauso gut Tägliche Nachbetrachtungen nennen können. Alles, was darin stand, war schon in der vorangegangenen Nacht ins Netz gestellt worden.
Mein Telefon läutete, und ich war geneigt anzunehmen, es wäre meine Ex-Frau, die im Washingtoner Büro bereits davon gehört hatte, aber auf dem Display stand Velvet Coffin. Ich muss zugeben, ich war schockiert. Ich wusste, so schnell konnte Larry es nicht herumerzählt haben. Gegen mein besseres Wissen ging ich dran. Wie nicht anders zu erwarten, war der Anrufer Don Goodwin, selbst ernannter Wachhund und Chronist des Innenlebens der L.A. Times.
»Hab’s gerade erfahren«, sagte er.
»Wann genau?«
»Jetzt gerade.«
»Und wie? Ich weiß es selbst erst seit fünf Minuten.«
»Jetzt hören Sie mal, Jack, Sie wissen genau, dass ich das nicht preisgeben darf. Aber ich habe meine Wanzen in Ihrem Laden. Sie sind gerade aus Kramers Büro gekommen. Sie haben es auf die Dreißigerliste geschafft.«
Die »Dreißigerliste« bezog sich auf all jene, die im Lauf der Jahre im Zug des Personalabbaus der Zeitung hatten dran glauben müssen. »Dreißig« war das traditionelle Pressekürzel für »Ende der Story«. Goodwin stand selbst auf dieser Liste. Auch er hatte bei der Timesgearbeitet und war als Redakteur auf der Überholspur gewesen, bis ein Besitzerwechsel in eine neue Finanzstrategie mündete. Als er sich weigerte, für weniger mehr zu tun, wurde er kühl abserviert und nahm schließlich die Abfindung an, die man ihm anbot. Das war noch zu einer Zeit gewesen, als man allen, die freiwillig ausschieden, einen ordentlichen Batzen Geld hinterherwarf – und bevor das Medienunternehmen, dem die Times gehörte, Gläubigerschutz beantragte.
Goodwin nahm seine Abfindung und stieg mit einer Website und einem Blog ins Geschäft ein, die alles aufdeckten, was sich bei der Times intern abspielte. Zur grimmigen Erinnerung an das, was die Zeitung einmal gewesen war, nannte er sie thevelvetcoffin.com: ein Samtsarg, in dem es sich so angenehm arbeiten ließ, dass man sich einfach hineinlegte und blieb, bis man starb. Infolge des ständigen Wechsels von Besitzer und Management und wegen des Personalabbaus und des kontinuierlichen Belegschafts- und Budgetschwunds wurde die Zeitung allerdings mehr und mehr zu einer Holzkiste. Und Goodwin war da, um jeden Schritt und Fehltritt ihres Niedergangs zu dokumentieren.
Sein Blog wurde fast täglich aktualisiert und von jedem in der Redaktion heimlich, aber aufmerksam gelesen. Ich war nicht sicher, ob sich die Welt außerhalb der dicken, bombensicheren Mauern der Times groß dafür interessierte. Die Times ging den Weg allen Journalismus, das war nichts Neues. Sogar die New York Times spürte das Zwicken, das der Richtungswechsel zum Internet hin verursachte, den die Gesellschaft in Sachen Nachrichtenwesen und Werbung gerade durchlief. Der Bagatellkram, über den Goodwin berichtete und dessentwegen er mich anrief, kam etwa einem Umstellen der Deckstühle auf der Titanic gleich.
Aber in zwei Wochen würde mich das alles nicht mehr groß kümmern. Ich blickte nach vorn und dachte bereits an den halbherzig angefangenen Roman, den ich in meinem Computer hatte. Sobald ich nach Hause kam, würde ich dieses Lieblingsprojekt hervorkramen. Ich wusste, ich konnte noch mindestens ein halbes Jahr lang meine Rücklagen anzapfen, und danach konnte ich mich, wenn nötig, mit dem Eigenkapitalanteil an meinem Haus über Wasser halten – je nachdem, was davon nach der Wirtschaftskrise noch übrig war. Außerdem konnte ich in Sachen Auto abspecken und Benzinkosten sparen, indem ich mir eine dieser Hybrid-Blechbüchsen zulegte, die seit Neuestem jeder in der Stadt fuhr.
Ich begann meinen Schubs zur Tür hinaus bereits als Chance zu sehen. Im Grunde seines Herzens möchte ja jeder Journalist ein Romanautor sein. Es ist der Unterschied zwischen Kunst und Handwerk. Jeder Schreiberling will als Künstler angesehen werden, und jetzt würde ich es darauf ankommen lassen. Der halbe Roman, der zu Hause auf mich wartete – ich konnte mich nicht mal mehr richtig an seinen Plot erinnern –, war mein Einstieg.
»Müssen Sie Ihren Schreibtisch sofort räumen?«, fragte Goodwin.
»Nein. Wenn ich meinen Nachfolger anlerne, bekomme ich noch zwei Wochen. Ich habe mich dazu bereit erklärt.«
»Wie nobel von ihnen. Gestehen sie einem jetzt nicht mal mehr das letzte Restchen Würde zu?«
»Was wollen Sie eigentlich? Es ist auf jeden Fall besser, als gleich heute mit einer Schachtel abzuziehen. Zwei Wochen Gehalt sind zwei Wochen Gehalt.«
»Aber finden Sie das etwa fair? Wie lang sind Sie jetzt schon bei denen? Sechs, sieben Jahre, und sie geben Ihnen zwei Wochen?«
Er versuchte, mir einen verbitterten Kommentar zu entlocken. Ich war Reporter. Ich wusste, wie das lief. Er wollte eine gesalzene Bemerkung, die er in den Blog stellen konnte. Aber ich biss nicht an. Ich gab Goodwin zu verstehen, dass ich keinen weiteren Kommentar für Velvet Coffin hätte, jedenfalls nicht, solange ich hier nicht endgültig meine Zelte abgebrochen hätte. Mit dieser Antwort gab er sich nicht zufrieden und versuchte weiter, mir einen Kommentar zu entlocken, doch dann ertönte das Anklopfzeichen. Ich schaute auf die Anrufererkennung, dem XXXXX auf dem Display entnahm ich, dass der Anruf von der Zentrale durchgestellt worden war und nicht von jemandem kam, der meine Durchwahl hatte. »Tut mir leid, Don, ich muss jetzt Schluss machen. Da kommt gerade ein Anruf rein.«
Ich drückte auf die Trenntaste. »Hier Jack McEvoy«, sagte ich nach dem Umschalten.
Stille.
»Hallo, hier spricht Jack McEvoy. Was kann ich für Sie tun?«
Halten Sie mich meinetwegen für voreingenommen, aber mir war sofort klar, dass die Person, die schließlich antwortete, weiblich, schwarz und ungebildet war.
»McEvoy? Wann werden Sie endlich die Wahrheit sagen, McEvoy?«
»Mit wem spreche ich bitte?«
»Sie verbreiten Lügen, McEvoy, in Ihrer Zeitung.«
Ich wünschte, es wäre meine Zeitung.
»Entschuldigung, Ma’am, aber wenn Sie mir vielleicht erst mal sagen würden, wer Sie sind und worüber Sie sich beschweren wollen, werde ich mir das gern anhören. Andernfalls muss ich …«
»Jetzt behaupten Sie auf einmal, Mizo ist schon ein Erwachsener, und das ist ja nun totaler Scheiß. Er hat dieses Flittchen nicht umgebracht.«
Mir war sofort klar, dass es einer dieser Anrufe war. Einer dieser Anrufe zur Verteidigung »Unschuldiger«. Die Mutter oder Freundin, die mir unbedingt klarmachen musste, wie falsch meine Meldung war. Derartige Anrufe bekam ich ständig, aber nicht mehr allzu lange. Ich fand mich damit ab, diesen Anruf so schnell und höflich wie möglich zu erledigen.
»Wer ist Mizo?«
»Zo. My Zo. Mein Sohn Alonzo. Er hat nichts gemacht, und er ist noch nicht erwachsen.«
Sie haben nie etwas getan. Niemand ruft einen an, um einem zu sagen, dass man die Sache richtig sieht oder dass die Polizei die Sache richtig sieht und dass ihr Sohn oder Ehemann oder Freund zu Recht angeklagt wird. Niemand ruft einen aus dem Gefängnis an, um einem zu sagen, dass er es getan hat. Alle sind unschuldig. Das Einzige an dem Anruf, was ich nicht verstand, war der Name. Ich hatte über niemanden etwas geschrieben, der Alonzo hieß – daran hätte ich mich erinnert.
»Ma’am, sind Sie bei mir auch an der richtigen Stelle? Ich glaube nicht, dass ich etwas über Alonzo geschrieben habe.«
»Klar haben Sie das. Hier steht doch Ihr Name. Sie haben gesagt, er hätte sie in den Kofferraum gepackt, aber das ist totaler Quatsch.«
Jetzt fiel bei mir der Groschen. Der Kofferraummörder von letzter Woche. Es war ein Fünfzehn-Zeilen-Kurzbeitrag gewesen, weil sich in der Redaktion niemand groß dafür interessiert hatte. Jugendlicher Drogendealer erwürgt eine seiner Kundinnen und packt die Leiche in den Kofferraum ihres Autos. Es war zwar eine sogenannte Schwarz-gegen-Weiß-Straftat, aber weil das Opfer Drogen genommen hatte, hatte sich in der Redaktion trotzdem niemand dafür interessiert. Sowohl sie als auch ihr Mörder waren von der Zeitung marginalisiert worden. Wenn man anfängt, Ausflüge nach South L.A. zu machen, um Heroin oder Crack zu kaufen, dann kann so etwas schon mal passieren. Da braucht man von der grauhaarigen Lady in der Spring Street kein Mitgefühl zu erwarten. Für so was ist in der Zeitung nicht viel Platz. Fünfzehn Zeilen irgendwo im Innenteil, das ist auch schon alles.
Mir wurde klar, dass mir der Name Alonzo deshalb nichts sagte, weil ich ihn nie erfahren hatte. Der Verdächtige war sechzehn Jahre alt, und die Namen festgenommener Minderjähriger rückte die Polizei nicht heraus.
Ich wühlte in dem Zeitungsstapel auf meinem Schreibtisch, bis ich den Lokalteil vom Dienstag vor zwei Wochen fand. Ich blätterte ihn durch und überflog die Meldung. Sie war nicht lang genug, um unter der Überschrift eine Byline zu haben. Aber immerhin hatte der Redakteur meinen Namen daruntergesetzt. Sonst hätte ich den Anruf nicht erhalten. Ich Glücklicher!
»Alonzo ist also Ihr Sohn«, sagte ich. »Und er wurde Sonntag vor einer Woche wegen Mordes an Denise Babbit verhaftet, ist das richtig?«
»Ich hab Ihnen doch gesagt, das ist ausgemachte Scheiße.«
»Schon, aber das ist die Meldung, über die wir hier reden. Richtig?«
»Richtig. Und wann werden Sie endlich die Wahrheit schreiben?«
»Die Wahrheit, nehme ich mal an, ist, dass Ihr Sohn unschuldig ist.«
»Allerdings. Das stimmt alles hinten und vorn nicht, und jetzt heißt es sogar, er wird wie ein Erwachsener behandelt, aber dabei ist er doch erst sechzehn. Wie können sie einem Jungen so was antun?«
»Wie heißt Alonzo mit Nachnamen?«
»Winslow.«
»Alonzo Winslow. Und Sie sind Mrs. Winslow?«
»Nein, bin ich nicht«, sagte sie ungehalten. »Wollen Sie jetzt etwa auch noch meinen Namen mit einem Haufen Lügen in die Zeitung bringen?«
»Nein, Ma’am. Ich will nur wissen, mit wem ich spreche, mehr nicht.«
»Wanda Sessums. Ich will nicht, dass mein Name in die Zeitung kommt. Ich will nur, dass Sie die Wahrheit schreiben, mehr nicht. Sie ruinieren seinen Ruf, wenn Sie ihn einfach so als Mörder hinstellen.«
Ruf war ein Reizwort, wenn es darum ging, Falschmeldungen einer Zeitung auszubügeln, aber ich hätte fast laut losgelacht, als ich die Meldung überflog, die ich geschrieben hatte.
»Hier steht, dass er wegen Mordes verhaftet wurde, Mrs. Sessums. Das ist keine Lüge. Das ist richtig.«
»Verhaftet wurde er schon, aber getan hat er es nicht. Der Junge tut keiner Fliege was zuleide.«
»Laut Aussagen der Polizei hat er ein stattliches Vorstrafenregister. Er hat schon mit zwölf Drogen verkauft. Ist das auch falsch?«
»Er hat immer an den Straßenecken gestanden, das schon, aber das heißt noch lange nicht, dass er jemanden umgebracht hat. Die wollen ihm das nur anhängen, und Sie mischen kräftig dabei mit, dabei haben Sie doch keine Ahnung.«
»Die Polizei sagt, er hat gestanden, die Frau umgebracht und ihre Leiche in den Kofferraum gepackt zu haben.«
»Alles erstunken und erlogen! So etwas hätte er nie getan.«
Mir war nicht klar, ob sie sich damit auf den Mord oder das Geständnis bezog, aber es spielte auch keine Rolle. Ich musste sie loswerden. Ich schaute auf den Bildschirm und stellte fest, dass sechs E-Mails eingegangen waren, seit ich aus Kramers Büro zurückgekommen war. Ich wollte dieses Telefonat hinter mich bringen und diese Geschichte und alles andere Angela Cook überlassen. Sollte die sich mit diesen ganzen verrückten Anrufern herumschlagen. Sollte die doch die Suppe auslöffeln.
»Also gut, Mrs. Winslow, ich …«
»Ich heiße Sessums, habe ich Ihnen doch gesagt! Sehen Sie jetzt selbst, wie Sie immer alles durcheinanderbringen?«
Da hatte sie nicht ganz unrecht. Ich überlegte kurz, bevor ich sagte:
»Entschuldigung, Mrs. Sessums. Ich habe mir hier alles notiert und werde mich der Sache annehmen, und wenn es etwas gibt, worüber ich schreiben kann, werde ich Sie auf jeden Fall anrufen. Bis dahin alles Gute und …«
»Nein, werden Sie nicht.«
»Was werde ich nicht?«
»Bei mir anrufen.«
»Ich habe doch gerade gesagt, ich rufe Sie an, sobald ich …«
»Sie haben mich doch gar nicht nach meiner Nummer gefragt! Es interessiert Sie einen feuchten Dreck. Sie sind genauso ein mieser Scheißkerl wie alle anderen auch, und mein Junge kommt für etwas ins Gefängnis, was er gar nicht getan hat.«
Sie hängte ein. Eine Weile saß ich reglos da und dachte über das nach, was sie über mich gesagt hatte, dann warf ich den Lokalteil auf den Zeitungsstapel zurück. Ich schaute auf das Notizbuch vor meiner Tastatur. Natürlich hatte ich mir keine Notizen gemacht, und auch in diesem Punkt hatte mich die vermeintlich ignorante Frau durchschaut.
Ich lehnte mich zurück und betrachtete die Einrichtung meiner Koje. Ein Schreibtisch, ein Computer, ein Telefon und zwei Regale voll mit Akten, Notizbüchern und Zeitungen. Ein rotes ledergebundenes Wörterbuch, so alt und oft benutzt, dass das Webster’s auf dem Rücken nicht mehr zu erkennen war. Meine Mutter hatte es mir geschenkt, als ich ihr gestand, dass ich schreiben wollte.
Das war alles, was mir nach zwanzig Jahren Journalismus geblieben war. Und alles, was mir etwas bedeutete und was ich nach Ablauf der zwei Wochen mitnehmen würde, war dieses Wörterbuch.
»Hi, Jack.«
Ich riss mich von meinen Gedanken los und schaute in das reizende Gesicht von Angela Cook. Ich kannte sie nicht, aber ich wusste, was sie war: ein Frischling von einer Eliteschule, ein sogenannter Mojo – ein mobiler Journalist, für den es die natürlichste Sache der Welt war, seine Berichte mittels der verfügbaren elektronischen Kommunikationsmittel direkt vor Ort an die Redaktion zu übermitteln: Text und Fotos für die Website oder die Zeitung, Video- und Audiomaterial für Fernseh- und Radiopartner. Für das alles war sie ausgebildet, aber in Wirklichkeit war sie noch total grün hinter den Ohren. Wahrscheinlich bekam sie fünfhundert Dollar die Woche weniger als ich, und das war ihr eigentliches Plus. Ungeachtet der Meldungen, die ihr entgehen würden, weil sie keine Quellen hatte. Ungeachtet der vielen Male, bei denen sie von der Polizei, die sich keine Gelegenheit für so etwas entgehen ließ, ausgetrickst und für ihre Zwecke eingespannt würde.
Außerdem bliebe sie wahrscheinlich nur kurze Zeit bei der Zeitung. Sie würde ein paar Jahre Erfahrungen und vorzeigbare Artikel sammeln und sich dann höheren Aufgaben zuwenden, einem Jurastudium oder einer Karriere in der Politik, vielleicht auch einer Stelle beim Fernsehen. Larry hatte jedenfalls recht. Sie sah richtig gut aus mit ihrer blonden Mähne, den grünen Augen und vollen Lippen. Die Cops würden begeistert sein, es würde keine Woche dauern, bis sie mich vergessen hatten.
»Hallo, Angela.«
»Mr. Kramer meinte, ich sollte zu Ihnen kommen.«
Sie verloren wirklich keine Zeit. Keine fünfzehn Minuten war es her, dass ich meine Kündigung erhalten hatte, und schon klopfte meine Nachfolgerin an die Tür.
»Wissen Sie was, Angela«, sagte ich. »Es ist Freitagnachmittag, und ich wurde gerade gefeuert. So viel Zeit muss schon noch sein. Setzen wir uns einfach Montagmorgen zusammen, ja? Wir gehen einen Kaffee trinken, und dann nehme ich Sie ins Parker Center mit und stelle Sie ein paar Leuten vor. Einverstanden?«
»Aber sicher, klar. Und, äh, tut mir wirklich leid, ja?«
»Danke, Angela, aber das ist schon okay. Am Ende wird sich, glaube ich, sowieso herausstellen, dass es das Beste für mich war. Wenn ich Ihnen aber trotzdem noch leidtue, könnten Sie heute Abend im Short Stop vorbeischauen und mir einen ausgeben.«
Sie versuchte, ihre Verlegenheit mit einem Lächeln zu überspielen, denn wir beide wussten, dass es dazu nicht kommen würde. Die junge Generation verkehrte mit der alten weder in der Redaktion noch außerhalb. Und schon gar nicht mit mir. Ich gehörte zum alten Eisen, und sie hatte weder Zeit noch Lust, sich mit den Ausgemusterten abzugeben. An diesem Abend ins Short Stop zu kommen, wäre wie ein Besuch in einer Leprastation.
»Na ja, vielleicht ein andermal«, sagte ich rasch. »Dann also bis Montagmorgen, ja?«
»Montagmorgen. Und der Kaffee geht auf mich.«
Sie lächelte, und mir wurde klar, dass sie diejenige war, die Kramers Rat beherzigen und es beim Fernsehen versuchen sollte.
Sie wandte sich zum Gehen.
»Ach, Angela?«
»Ja?«
»Nennen Sie ihn nicht Mr. Kramer. Das hier ist eine Zeitungsredaktion, keine Anwaltskanzlei. Und die meisten Typen, die hier was zu sagen haben, verdienen es nicht, mit Mister angesprochen zu werden. Behalten Sie das im Gedächtnis, und Sie kommen hier gut zurecht.«
Sie lächelte wieder und ließ mich allein. Ich zog mir den Stuhl an den Schreibtisch und öffnete ein neues Dokument. Ich hatte noch eine Mordmeldung fertig zu schreiben, bevor ich die Redaktion verlassen und meinen Kummer in Rotwein ersäufen durfte.
Nur drei andere Reporter erschienen zu meiner Totenwache. Larry Bernard und zwei Typen aus der Sportredaktion, die allerdings auch unabhängig von mir ins Short Stop gekommen sein könnten. Wäre Angela Cook aufgetaucht, wäre es peinlich gewesen.
Das Short Stop war am Sunset Boulevard in Echo Park. Es lag nicht weit vom Dodger Stadium, weshalb sein Name vermutlich mit der Nähe zum Baseball zusammenhing. Es war auch nicht weit zur Los Angeles Police Academy, weshalb es ursprünglich eine Polizistenkneipe gewesen war. Es war die Sorte Bar, wie man sie aus Romanen von Joseph Wambaugh kennt, in die Cops mit ihresgleichen und mit den Groupies, die nicht über sie urteilten, kamen. Aber diese Zeiten waren längst vorbei. Echo Park änderte sich. Es entwickelte sich in Richtung Hollywood-Chic, und die Cops wurden von den Yuppies, die in die Gegend zogen, aus dem Short Stop gedrängt. Die Preise gingen rauf, und die Cops suchten sich andere Kneipen. An den Wänden hingen zwar immer noch Utensilien aus der Polizeiarbeit, aber ein Cop hatte sich schon lange nicht mehr hierher verirrt.
Trotzdem mochte ich den Laden, denn er lag nicht weit von Downtown und auf dem Weg zu meinem Haus in Hollywood.
Es war noch früh, wir konnten uns die Hocker an der Bar aussuchen. Wir nahmen die vier direkt vor dem Fernseher; ich, Larry, dann Shelton und Romano, die zwei Sportreporter. Weil ich die beiden nicht besonders gut kannte, war es mir nur recht, dass Larry zwischen uns saß. Sie sprachen die ganze Zeit über ein Gerücht, demzufolge die meisten Sportressorts neu sortiert werden würden, und sie hofften, ein Stück vom Dodgers- oder Lakerskuchen abzubekommen, den begehrtesten Ressorts bei der Zeitung, dichtauf gefolgt von Football und Basketball. Die Kunst der Sportberichterstattung erstaunte mich immer wieder von Neuem. In neun von zehn Fällen kennen die Leser den Ausgang der Geschichte bereits, wenn sie zu lesen beginnen. Sie wissen, wer gewonnen hat, und wahrscheinlich haben sie das Spiel sogar gesehen. Trotzdem lesen sie darüber, und man muss eine Möglichkeit finden, Einblicke zu vermitteln, die das Ganze neu und spannend machen.
Ich mochte das Polizeiressort, weil ich hier dem Leser in der Regel eine Geschichte erzählen konnte, die er nicht kannte. Ich schrieb über die schlimmen Dinge, die passieren können. Über das Leben in seinen Extremen. Über die Unterwelt, mit der unsere Leser, die bei Toast und Kaffee am Frühstückstisch saßen, in der Regel nie etwas zu tun bekamen. Was jedoch nicht hieß, dass sie nicht trotzdem darüber Bescheid wissen wollten. Das gab mir einen gewissen Kick, und wenn ich abends nach Hause fuhr, fühlte ich mich wie der Größte.
Und jetzt, wo ich hier über einem Glas billigem Rotwein saß, wusste ich, dass mir das am meisten fehlen würde.
»Weißt du, was ich gehört habe«, sagte Larry zu mir.
»Nein, was?«
»Dass bei einer dieser Entlassungen in Baltimore ein Typ seine Abfindung eingestrichen und an seinem letzten Arbeitstag einen Beitrag abgeliefert hat, der von A bis Z erfunden war. Er hat sich das Ganze einfach ausgedacht.«
»Aber es wurde gedruckt?«
»Klar, das konnten sie ja nicht ahnen, bis am nächsten Tag massenhaft empörte Anrufe eingingen.«
»Worum ging es?«
»Keine Ahnung. Jedenfalls war das sein ›Leckt mich am Arsch‹ ans Management.«
Ich nahm einen Schluck Wein und dachte darüber nach.
»Nicht wirklich«, sagte ich schließlich.
»Wieso nicht? Natürlich war es das.«
»Ich glaube eher, im Management haben sie sich darauf nur beifällig zugenickt und es als Bestätigung gesehen, dass sie den Richtigen losgeworden sind. Wenn man denen wirklich ›Leckt mich am Arsch‹ sagen will, sollte man etwas tun, was ihnen das Gefühl vermittelt, dass es eine Riesendummheit von ihnen war, einen rauszuschmeißen. Etwas, was ihnen klarmacht, dass sie lieber nicht jemand anders hätten einstellen sollen.«
»Ach so. Ist es das, was du vorhast?«
»Nein, Mann, ich werde mich einfach in aller Stille verdrücken. Ich werde einen Roman veröffentlichen. Das wird mein ›Leckt mich am Arsch‹ sein. Das ist übrigens auch der Arbeitstitel: Leck mich am Arsch, Kramer.«
»Genau!«
Bernard lachte, und wir wechselten das Thema. Doch während wir uns über andere Dinge unterhielten, dachte ich weiter über das große »Leckt mich am Arsch« nach. Ich dachte über den Roman nach, den ich weiterschreiben und zu Ende bringen würde. Am liebsten wäre ich sofort nach Hause gefahren, um damit zu beginnen. Ich glaubte, es würde mir helfen, die nächsten zwei Wochen zu überstehen, wenn mich diese Arbeit jeden Abend zu Hause erwarten würde.
Mein Handy läutete, meine Ex-Frau. Mir war klar, dass ich das hinter mich bringen musste. Ich rutschte von meinem Barhocker und ging auf den Parkplatz hinaus, wo es leiser war.
In Washington waren sie uns drei Stunden voraus, bei ihr war es also fast zehn Uhr. Dennoch war die Nummer im Display die ihres Büros.
»Keisha, du arbeitest immer noch?«
»Ich hetze gerade der Post mit einer Story hinterher und warte auf Rückrufe.«
Der Segen und der Fluch, für eine Westküstenzeitung zu arbeiten, war, dass der letzte Abgabetermin drei Stunden nach dem Zeitpunkt lag, zu dem die Washington Postund die New York Times – die schärfsten Konkurrenten – Feierabend machten. Das hieß, dass die L.A. Times immer die Chance hatte, ihre Knüller zu übernehmen oder sogar zu toppen. Am Morgen danach konnte die L.A. Times bei einer wichtigen Meldung mit den aktuellsten und besten Informationen als Sieger aus dem Rennen hervorgehen. Außerdem wurde es in den heiligen Hallen der Regierung, dreitausend Meilen von L.A. entfernt, ein Muss, die Online-Ausgabe der L.A. Times zu lesen.
Und als einer der dienstjüngsten Reporter im Washingtoner Büro hatte Keisha Russell die Spätschicht. Häufig fiel es ihr zu, Meldungen nachzugehen und die neuesten Einzelheiten und Entwicklungen beizusteuern.
»Ganz schön nervig«, sagte ich.
»Nicht so schlimm wie das, was dir heute passiert ist.«
Ich nickte.
»Ja, ich wurde abgebaut, Keish.«
»Das tut mir wirklich leid, Jack.«
»Ich weiß. Tut es jedem. Danke.«
Mir hätte klar sein müssen, dass ich auf der Abschussliste stand, als sie mich zwei Jahre zuvor nicht mit ihr nach Washington geschickt hatten, aber das war eine andere Geschichte. Zwischen uns tat sich ein Schweigen auf, und ich versuchte, daraufzutreten.
»Ich werde meinen Roman wieder rausholen und zu Ende schreiben«, sagte ich. »Ich habe einige Rücklagen, und im Haus müsste auch noch Geld stecken. Ich müsste also noch mindestens ein Jahr über die Runden kommen. Wahrscheinlich heißt es: jetzt oder nie.«
»Auf jeden Fall«, sagte Keisha mit gespieltem Enthusiasmus. »Das schaffst du bestimmt.«
Ich wusste, dass sie, als wir noch zusammen waren, das Manuskript eines Tages gefunden und gelesen hatte. Allerdings hatte sie es nie zugegeben, weil sie mir sonst hätte sagen müssen, was sie davon hielt. Sie wäre nicht in der Lage gewesen, mit ihrer Meinung hinterm Berg zu halten.
»Wirst du in L.A. bleiben?«, fragte sie.
Das war eine gute Frage. Der Roman spielte in Colorado, wo ich aufgewachsen war, aber ich mochte die Energie von L.A. und wollte nicht weg.
»Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich will das Haus nicht verkaufen. Der Markt ist noch zu schlecht. Lieber nehme ich, wenn nötig, eine Hypothek darauf auf und bleibe hier. Abgesehen davon möchte ich mich vorerst noch nicht mit so was beschäftigen. Im Augenblick feiere ich gerade das Ende.«
»Bist du im Red Wind?«
»Nein, im Short Stop.«
»Wer ist alles da?«
Jetzt war ich blamiert.
»Ach ja, du weißt schon, die üblichen Kandidaten. Larry und ein paar Typen aus der Lokalredaktion, zwei Sportreporter.«
Es verstrich der Bruchteil einer Sekunde, bevor sie etwas sagte, und mit diesem Zögern verriet sie, dass sie wusste, dass ich übertrieb, wenn nicht sogar rundweg log.
»Und du denkst, du kriegst das hin, Jack?«
»Klar, auf jeden Fall. Ich … ich muss mir nur darüber klar werden, was …«
»Entschuldige, Jack, da kommt gerade einer meiner Rückrufe rein.«
Sie hörte sich nervös an. Falls sie den Anruf verpasste, käme möglicherweise kein zweiter.
»Geh ran!«, sagte ich rasch. »Wir reden später.«
Ich drückte die Trenntaste, froh, dass mir irgendein Politiker in Washington die zusätzliche Peinlichkeit erspart hatte, über mein Leben mit meiner Ex-Frau zu sprechen, mit deren Karriere es Tag für Tag aufwärtsging, während meine gerade den Bach hinunterging. Als ich mein Handy in die Tasche steckte, fragte ich mich, ob sie den eingehenden Anruf nur vorgeschützt hatte, um der Peinlichkeit auch für sich ein Ende zu machen.
Ich ging in die Bar zurück und beschloss, Nägel mit Köpfen zu machen. Ich bestellte einen Irish Car Bomb. Ich trank ihn rasch, und der Jameson’s brannte auf dem Weg nach unten wie heißes Fett. Meine Laune sank vollends in den Keller, als ich mit ansehen musste, wie die Dodgers zu einem Match gegen die verhassten Giants antraten und schon im ersten Inning deklassiert wurden.
Romano und Shelton waren die Ersten, die das Handtuch warfen, und im dritten Inning hatte sich sogar Larry Bernard genügend volllaufen und genügend an die düstere Zukunft des Zeitungsgeschäfts erinnern lassen. Er rutschte von seinem Hocker und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Da geh ich nun, und sei’s auch nur dank Gottes Gnade«, sagte er.
»Was?«
»Es hätte auch mich treffen können. Es hätte jeden in der Redaktion treffen können. Aber sie haben dich ausgesucht, weil du das dicke Gehalt kassierst. Du bist vor sieben Jahren zu uns gekommen, Mr. Bestseller und Larry King und was sonst noch alles. Sie mussten dir damals ganz schön viel zahlen, um dich zu kriegen, und deshalb bist du jetzt auf die Abschussliste gekommen. Ehrlich gestanden, wundert es mich, dass du dich überhaupt so lang halten konntest.«
»Na ja, egal warum. Das macht die Sache nicht einfacher.«
»Ich weiß, aber sagen musste ich es dir trotzdem. Ich gehe dann mal. Was ist mit dir?«
»Einen genehmige ich mir noch.«
»Lieber nicht, Mann, du bist schon mehr als voll.«
»Nur noch einen. Und notfalls nehme ich mir ein Taxi.«
»Lass dich bloß nicht in dem Zustand am Steuer erwischen. Das würde dir jetzt gerade noch fehlen.«
»Was sollen sie schon groß machen? Mich feuern?«
Er nickte, als hätte ich gerade ein schlagendes Argument vorgebracht, dann klatschte er mir eine Spur zu fest auf den Rücken und schlurfte aus der Bar. Ich blieb allein sitzen und sah mir weiter das Spiel an. Bei meinem nächsten Drink sparte ich mir das Guinness und den Bailey’s und ging zu Jameson’s auf Eis über. Davon trank ich dann statt dem einen noch zwei oder drei mehr. Und ich dachte darüber nach, dass ich mir das Ende meiner Karriere eigentlich etwas anders vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, zu diesem Zeitpunkt Zehntausend-Wörter-Beiträge für Esquire und Vanity Fair zu schreiben. Ich hatte mir vorgestellt, dass sie zu mir kommen würden und nicht ich zu ihnen. Dass ich mir aussuchen könnte, worüber ich schreiben wollte.
Ich bestellte noch einen, und der Barkeeper schlug mir einen Deal vor. Er wollte mir nur Whiskey auf meine Eiswürfel gießen, wenn ich ihm meinen Autoschlüssel gäbe. Das hörte sich nach einem guten Geschäft für mich an, und ich ging darauf ein.
Während dann der Whiskey von unten meine Kopfhaut ansengte, dachte ich an Larry Bernards Geschichte von dem Kerl aus Baltimore und dem ultimativen ›Leckt mich am Arsch‹. Ich glaube, ich nickte mir ein paarmal selbst zu und prostete der lahmen Ente von Journalist zu, der diese Nummer abgezogen hatte.
Und dann brannte sich eine andere Idee durch und sengte einen Abdruck in mein Hirn. Eine Variante des Baltimore-›Leckt mich‹. Eine mit einer gewissen Integrität und so unauslöschlich wie ein in einen Glaspokal gravierter Name. Den Ellbogen auf den Tresen gestützt, hob ich das Glas erneut. Aber diesmal auf mich selbst.
»Der Tod ist mein Metier«, flüsterte ich. »Davon lebe ich. Darauf baue ich meinen Ruf als Journalist.«
Worte, die schon zuvor gesprochen worden waren, aber nicht als meine eigene Grabrede. Ich nickte mir selbst zu und wusste, wie ich mich verabschieden würde. Ich hatte im Lauf der Jahre bestimmt tausend Mordstorys geschrieben. Ich würde noch eine mehr schreiben. Eine Story, die als Grabstein auf meiner Karriere stehen würde. Eine Story, die sie an mich erinnern würde, wenn ich nicht mehr war.
Das Wochenende war ein Nebel aus Alkohol, Wut und Erniedrigung, in dem ich mich mit einer neuen Zukunft herumschlug, die keine war. Am Samstagvormittag öffnete ich in einer kurzen Ausnüchterungsphase die Datei mit meinem in Arbeit befindlichen Roman und begann zu lesen. Ich sah bald, was meine Ex-Frau vor langer Zeit gesehen hatte. Was ich schon lange hätte sehen sollen. Es war nichts, und ich machte mir etwas vor, wenn ich glaubte, es wäre was.
Ich müsste wieder bei null anfangen, und der Gedanke daran war lähmend. Als ich mir ein Taxi zurück zum Short Stop nahm, um meinen Wagen zu holen, endete das damit, dass ich blieb und den Laden am frühen Sonntagmorgen als Letzter verließ, zusah, wie die Dodgers erneut verloren, und im Suff wildfremden Menschen erzählte, wie verrottet die Times und das ganze Zeitungsgeschäft waren.
Ich brauchte bis Montagvormittag, um mich wieder zu berappeln. Nachdem ich es endlich geschafft hatte, meinen Wagen im Short Stop abzuholen, trudelte ich 45 Minuten zu spät zur Arbeit ein, und ich konnte immer noch den Alkohol riechen, der aus meinen Poren drang.
Angela Cook saß bereits an meinem Schreibtisch, auf einem Stuhl, den sie sich aus einer der leeren Kojen geholt hatte. Davon gab es inzwischen einige.
»Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, Angela«, sagte ich. »Es war gewissermaßen ein verlorenes Wochenende. Angefangen bei der Party am Freitag. Sie hätten kommen sollen.«
Sie lächelte zurückhaltend, als wüsste sie, dass es keine Party gewesen war, sondern eine Ein-Mann-Totenwache.
»Ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht, aber wahrscheinlich ist er inzwischen kalt«, sagte sie.
»Danke.«
Ich griff nach dem Becher, auf den sie gedeutet hatte, und er war in der Tat kalt. Aber das Gute an unserer Cafeteria war, dass man kostenlos Nachschub holen konnte – wenigstens das hatten sie noch nicht abgeschafft.
»Wissen Sie was«, sagte ich. »Ich schau mal kurz bei der Ressortleitung rein, ob sich irgendwas tut, und wenn nicht, holen wir uns frischen Kaffee und überlegen uns, wie wir die Übergabe gestalten.«
Damit ließ ich sie allein und ging zum Schreibtisch des Ressortchefs. Auf dem Weg dorthin machte ich an der Telefonzentrale halt. Sie stand, erhöht wie ein Wasserwachtausguck, mitten im Newsroom, damit die Telefonistinnen den ganzen Raum im Blick hatten und sehen konnten, wer an seinem Platz war und Anrufe entgegennehmen konnte. Ich blieb seitlich davon stehen, sodass eine der Telefonistinnen nach unten schauen und mich sehen konnte.
Es war Lorene, die am Freitag Dienst gehabt hatte. Sie hob einen Finger, um mir zu verstehen zu geben, ich solle warten. Sie stellte kurz zwei Anrufe durch, dann zog sie die linke Seite ihres Headsets von ihrem Ohr.
»Ich habe nichts für Sie, Jack«, sagte sie.
»Ich weiß. Ich habe nur wegen Freitag noch eine Frage. Sie haben am späten Nachmittag eine Frau zu mir durchgestellt, eine Wanda Sessums. Haben Sie vielleicht noch ihre Telefonnummer? Ich habe vergessen, sie danach zu fragen.«
Lorene schob ihr Headset wieder zurück und kümmerte sich um einen weiteren Anrufer. Dann sagte sie mir, ohne das Headset wieder abzunehmen, dass sie die Nummer nicht habe. Sie habe sie nicht notiert, und die Telefonanlage speichere nur die letzten fünfhundert eingegangenen Anrufe. In der Zentrale würden täglich allerdings an die tausend Anrufe eingehen. Ob ich es schon bei der Auskunft versucht hätte.
Ich hatte die Auskunft bereits von zu Hause aus angerufen und wusste, dass es keinen Eintrag für eine Wanda Sessums gab. Ich dankte ihr und ging zum Tisch der Lokalredaktion weiter.
Im Moment war Dorothy Fowler die Leiterin der Lokalredaktion. Es war einer der unsichersten Posten bei der Zeitung, eine Stellung, die sowohl politische als auch praktische Komponenten hatte und unausweichlich einen Schleudersitz eingebaut zu haben schien. Fowler war eine enorm gute Hauptstadtkorrespondentin gewesen und versuchte sich erst seit acht Monaten darin, die Lokalreportertruppe zu befehligen. Ich drückte ihr ehrlich die Daumen, wusste aber auch, dass es angesichts der Budgetkürzungen und der vielen leeren Kojen in der Redaktion sehr schwer sein würde, erfolgreich zu arbeiten.
Fowler hatte zwar ein kleines Büro in der Reihe aus Glas, doch normalerweise war sie an einem Schreibtisch an der Spitze der Formation aus Tischen anzutreffen, an denen die ganzen Aces saßen, die Assistant City Editors, die stellvertretenden Leiter der Lokalredaktion.
Alle Reporter der Lokalredaktion waren einem Ace zugeteilt, der ihr nächsthöherer Vorgesetzter in Sachen Richtungsvorgaben und Planung war. Mein Ace war Alan Prendergast, der für die Polizei- und Gerichtsreporter zuständig war. Aus diesem Grund hatte er eine relativ späte Schicht und kam in der Regel nicht vor Mittag in die Redaktion, weil die Nachrichten aus dem Polizei- und Justizsektor in den meisten Fällen erst spät am Tag eingingen.
Das hieß, dass ich mich zu Beginn meines Arbeitstags normalerweise zuerst bei Dorothy Fowler oder ihrem Stellvertreter, Michael Warren, meldete. Ich versuchte immer, Fowler zu erwischen, weil sie die Ranghöhere war und ich mit Warren nicht auskam. Lange, bevor ich zur Times gekommen war, hatte ich in Denver bei der Rocky Mountain News mit Warren um eine interessante Story konkurriert. Weil er sich damals nicht korrekt verhalten hatte, vertraute ich ihm nicht mehr.
Dorothys Blick klebte am Bildschirm, und ich musste sie beim Namen rufen, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Weil wir seit meiner Kündigung noch nicht miteinander gesprochen hatten, schaute sie sofort mit einem mitfühlenden Stirnrunzeln zu mir auf, mit dem man sonst vielleicht jemanden bedächte, von dem man gerade erfahren hatte, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte.
»Kommen Sie kurz zu mir rein, Jack.« Sie stand auf und ging in ihr selten benutztes Büro. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch, aber ich blieb stehen, denn ich wusste, es würde nicht lang dauern.
»Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie uns hier sehr fehlen werden, Jack.«
Ich nickte zum Dank.
»Angela wird meinen Platz sicher problemlos übernehmen.«
»Sie ist sehr gut, und sie ist hoch motiviert, aber sie hat nicht das nötige Format. Noch nicht jedenfalls, und genau das ist das Problem. Die Zeitung sollte der Wachhund der Allgemeinheit sein, und jetzt überlassen wir diese Aufgabe den Küken. Nehmen Sie doch nur mal die journalistischen Glanzleistungen, die wir zu unseren Lebzeiten gesehen haben. Die aufgedeckte Korruption, der Nutzen für die Öffentlichkeit. Wer soll das künftig gewährleisten, wenn jede Zeitung des Landes personell immer mehr gestutzt wird. Die Regierung? Dass ich nicht lache. Das Fernsehen, die Blogs? Nie im Leben. Ein Freund von mir, der sich in Florida hat abfinden lassen, unkt schon die ganze Zeit, dass die Korruption die neue Wachstumsbranche wird, wenn die Zeitungen nicht mehr nach dem Rechten sehen.«
Sie machte eine Pause, wie um über diese traurigen Zustände nachzudenken.
»Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, Jack. Ich bin nur deprimiert. Angela ist super. Sie wird gute Arbeit leisten, und in drei, vier Jahren wird sie dieses Ressort ausfüllen, wie Sie es jetzt ausfüllen. Aber die Sache ist doch die: Wie viele Storys wird sie bis dahin verpassen? Und wie viele davon wären Ihnen nicht entgangen?«
Ich zuckte nur mit den Achseln. Das waren Fragen, die nur noch sie betrafen, aber nicht mehr mich. In zwölf Tagen stand ich auf der Straße.
»Tja«, sagte sie nach längerem Schweigen. »Es tut mir wirklich leid. Ich habe immer gern mit Ihnen gearbeitet.«
»Ein bisschen Zeit bleibt mir ja noch. Vielleicht stoße ich ja zum Abschied noch auf was richtig Gutes.«
Sie lächelte strahlend.
»Das wäre super!«
»War heute schon irgendwas?«
»Nichts Weltbewegendes«, sagte Dorothy. »Auf dem Overnote habe ich gerade gesehen, dass sich der Polizeichef mit Schwarzenführern trifft, um wieder über rassisch begründete Kriminalität zu sprechen. Aber das haben wir schon zu Tode geritten.«
»Dann werde ich Angela ins Parker Center mitnehmen und sehen, ob sich dort etwas ergibt.«
»Gut.«
Wenige Minuten später füllten Angela Cook und ich unsere Kaffeebecher nach und setzten uns in der Cafeteria an einen Tisch. Sie befand sich im Erdgeschoss, dort, wo sich jahrzehntelang die alten Rotationsmaschinen gedreht hatten, bevor die Herstellung ausgelagert worden war. Die Unterhaltung mit Angela war steif. Ich hatte sie nur flüchtig kennengelernt, als sie vor sechs Monaten eingestellt worden war und Fowler sie in der Redaktion herumgeführt hatte. Seitdem hatte ich mit ihr weder an einem Beitrag gearbeitet noch zu Mittag gegessen oder Kaffee getrunken oder sie in einer der Bars gesehen, die von den älteren Redaktionsmitgliedern frequentiert wurden.
»Woher kommen Sie ursprünglich, Angela?«
»Aus Tampa. Ich habe an der University of Florida studiert.«
»Gute Uni. Journalismus?«
»Ja, den Master.«
»Haben Sie schon mal als Polizeireporterin gearbeitet?«
»Bevor ich auf die Uni zurück bin, um meinen Master zu machen, habe ich zwei Jahre in St. Pete gearbeitet. Eines davon im Polizeiressort.«
Ich nahm einen Schluck Kaffee, und ich brauchte ihn. Mein Magen war leer, denn ich hatte vierundzwanzig Stunden lang nichts bei mir behalten können.
»In St. Petersburg? Wie muss man sich das vorstellen? Ein paar Dutzend Morde im Jahr?«
»Mit viel Glück.«
Sie lächelte angesichts der Ironie. Ein Polizeireporter wünscht sich immer einen guten Mord, über den er schreiben kann. Das Glück des Reporters ist jemand anderes Pech.
»Tja«, sagte ich. »Wenn es hier in L.A. unter vierhundert sind, sprechen wir von einem guten Jahr. Einem wirklich guten. Los Angeles ist die Stadt, wenn man als Polizeireporter arbeiten will. Wenn man Mordstorys erzählen will. Wenn Sie das allerdings nur als Übergangslösung betrachten, bis Sie das nächste Ressort zugeteilt bekommen, wird es Ihnen wahrscheinlich nicht gefallen.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich spekuliere nicht auf das nächste Ressort. Ich will das und nichts anderes machen. Ich will Mordstorys schreiben. Ich will Bücher über das alles schreiben.«
Sie hörte sich aufrichtig an. Sie hörte sich an wie ich – vor langer Zeit.
»Gut«, sagte ich. »Dann nehme ich Sie jetzt mal ins Parker Center mit und stelle Sie dort ein paar Leuten vor. Hauptsächlich Detectives. Sie werden Ihnen helfen, aber nur, wenn sie Ihnen trauen. Wenn sie Ihnen nicht trauen, bekommen Sie nichts als die Presseerklärungen.«
»Wie stelle ich das an, Jack? Wie bringe ich sie dazu, mir zu trauen?«
»Ganz einfach. Seien Sie fair, seien Sie genau. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Vertrauen fußt auf Leistung. Was Sie vor allem beachten müssen, ist, dass die Cops in dieser Stadt über ein erstaunliches Netzwerk verfügen. Die Einschätzung eines Reporters spricht sich schnell herum. Wenn Sie fair sind, werden es alle schnell erfahren. Wenn Sie einen von ihnen linken, werden es ebenfalls alle erfahren und Sie überall außen vor lassen.«
Meine Direktheit schien ihr peinlich zu sein. Wenn sie mit Cops zu tun hatte, würde sie sich daran gewöhnen müssen.
»Und noch etwas«, fuhr ich fort. »Sie haben eine verborgene innere Würde. Natürlich nur die guten. Wenn Sie das in Ihren Storys berücksichtigen, bringen Sie sie auf jeden Fall auf Ihre Seite. Halten Sie also nach den entsprechenden Hinweisen Ausschau, nach den kurzen Momenten, in denen diese Würde aufblitzt.«
»Okay, Jack, das werde ich.«
»Dann werden Sie gut fahren.«
Als wir im Polizeipräsidium im Parker Center unsere Runde machten, schnappten wir in der Abteilung Offen-Ungelöst eine nette kleine Mordstory auf. Die zwanzig Jahre zurückliegende Vergewaltigung und Ermordung einer älteren Frau war aufgeklärt worden, nachdem DNA-Spuren, die 1989 am Opfer gefunden worden waren, im Archiv ausgegraben und in die nationale Datenbank für Sexualverbrechen eingegeben worden waren. So eine Übereinstimmung nannte man einen kalten Treffer. Die am Opfer gefundene DNA stammte von einem Mann, der wegen versuchter Vergewaltigung in Pelican Bay einsaß. Die Ermittler in dem kalten Fall würden die nötigen Beweise zusammentragen und Anklage erheben, bevor der Kerl auf eine vorzeitige Entlassung plädieren konnte. Weil der Übeltäter bereits hinter Gittern saß, war das Ganze nicht so wahnsinnig aufregend, aber einen Dreißigzeiler gäbe es schon her. Die Leute lesen gern Meldungen, die ihnen das Gefühl vermitteln, dass böse Menschen nicht auf ewig ungestraft davonkommen. Vor allem in wirtschaftlich schlechten Zeiten, wenn es so einfach ist, zynisch zu sein.
Als wir in die Redaktion zurückkamen, bat ich Angela, die Meldung zu schreiben – ihren ersten Beitrag im neuen Ressort. Währenddessen versuchte ich, Wanda Sessums ausfindig zu machen, meine aufgebrachte Anruferin vom vergangenen Freitag.
Weil ihr Anruf bei der Times nicht registriert worden war und eine Anfrage bei der Auskunft ergeben hatte, dass es in ganz L.A. keinen Eintrag auf eine Wanda Sessums gab, rief ich Detective Gilbert Walker vom Santa Monica Police Department an. Er leitete die Ermittlungen im Mordfall Denise Babbit, die zur Verhaftung Alonzo Winslows geführt hatten. Es war eine Art ›kalter‹ Anruf, denn ich hatte keine Beziehung zu Walker. Santa Monica, eine relativ sichere Küstengemeinde zwischen Venice und Malibu, tauchte auf meinem Nachrichtenradar nicht allzu oft auf. Es gab dort sehr viele Obdachlose, aber kaum Morde. Die Polizei ermittelte jedes Jahr lediglich in einer Handvoll Mordfällen, von denen die meisten wenig oder gar keinen Nachrichtenwert hatten. Oft handelte es sich dabei um Leichenbeseitigungen wie bei Denise Babbit. Der Mord wurde irgendwo anders begangen – zum Beispiel in South L.A. –, und die Strand-Cops durften die Sauerei dann wegmachen.
Mein Anruf erreichte Walker an seinem Schreibtisch. Seine Stimme hörte sich durchaus freundlich an, bis ich mich als Reporter der Times zu erkennen gab. Dann wurde sie kalt. Das passierte oft. Ich war sieben Jahre in diesem Ressort und kannte viele Polizisten in vielen Departments, die ich als Quellen und sogar als Freunde betrachtete. Wenn ich in der Klemme steckte, konnte ich durchaus jemanden um Hilfe bitten. Aber man kann sich nicht immer aussuchen, wen man um Hilfe bittet. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass man nie alle auf seiner Seite haben kann. Die Medien und die Polizei waren sich noch nie besonders grün. Die Medien betrachten sich als Wachhund der Öffentlichkeit. Und niemand, die Polizei eingeschlossen, lässt sich gern über die Schulter schauen. Zwischen den zwei Institutionen bestand eine tiefe Kluft, und in die war das Vertrauen schon lange gefallen, bevor ich auf den Plan getreten war. Das machte dem kleinen Reporter, der lediglich ein paar Fakten brauchte, um einen Beitrag auszuschmücken, die Sache natürlich nicht leichter.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Walker kurz angebunden.
»Ich versuche, Alonzo Winslows Mutter zu erreichen, und da dachte ich, ob Sie mir vielleicht weiterhelfen könnten.«
»Und wer ist Alonzo Winslow?«
Ich wollte schon sagen, Jetzt hören Sie aber mal, Detective, als mir einfiel, dass ich den Namen des Verdächtigen gar nicht hätte wissen dürfen, denn die Preisgabe der Identität minderjähriger Straftäter war verboten.
»Ihr Verdächtiger im Fall Babbit.«
»Woher haben Sie diesen Namen? Ich bestätige diesen Namen nicht.«
»Das ist mir sehr wohl klar, Detective. Ich bitte Sie nicht, den Namen zu bestätigen. Ich weiß den Namen. Seine Mutter hat mich am Freitag angerufen und mir den Namen genannt. Das Problem ist, sie hat mir ihre Telefonnummer nicht gegeben, und ich versuche gerade, mich wieder mit ihr in …«
»Einen schönen Tag noch«, unterbrach mich Walker und hängte ein.
»Arschloch«, brummte ich und lehnte mich in meinen Schreibtischsessel zurück. Ich trommelte mit den Fingern auf dem Schreibtisch herum, bis mir ein neuer Plan einfiel – der, den ich von Anfang an hätte befolgen sollen.
Ich rief einen Detective an, der zu meinen Quellen im South Bureau des Los Angeles Police Department gehörte und an der Winslow-Festnahme beteiligt gewesen war. Ihren Anfang hatten die Ermittlungen zu dem Fall deshalb in der City of Santa Monica genommen, weil das Opfer auf einem Parkplatz in der Nähe des Piers im Kofferraum ihres Autos gefunden worden war. Als jedoch die Suche nach dem Tatort zu Alonzo Winslow in South L.A. führte, schaltete sich auch das LAPD ein.
Wie in solchen Fällen allgemein üblich, verständigte Santa Monica Los Angeles, und ein Team vor Ort, das bestens mit dem Terrain vertraut war, erhielt den Auftrag, Winslow ausfindig zu machen, festzunehmen und an Santa Monica zu überstellen. Einer der Ermittler des South Bureau war Napoleon Braselton. Ihn rief ich jetzt an und schenkte ihm sofort reinen Wein ein. Na ja, fast.
»Erinnern Sie sich noch an die Festnahme vor zwei Wochen?«, fragte ich ihn. »Dieses Mädchen im Kofferraum?«
»Ja, aber dafür ist Santa Monica zuständig«, sagte er. »Wir haben nur ein bisschen ausgeholfen.«
»Schon klar, ich weiß. Sie haben Winslow für Santa Monica festgenommen. Das ist die Sache, deretwegen ich anrufe.«
»Es ist immer noch deren Fall, Mann.«
»Ich weiß, aber ich kann Walker in Santa Monica im Moment nicht erreichen, und sonst kenne ich dort niemanden. Aber Sie kenne ich. Und ich habe auch nur eine Frage zu der Festnahme, nicht zum Fall selbst.«
»Was, steht da etwa Ärger an? Wir haben den Jungen nicht angefasst.«
»Nein, Detective, nichts dergleichen. Meines Wissens war es eine korrekte Festnahme. Ich versuche bloß herauszufinden, wo der Junge gewohnt hat. Will mir einen Eindruck von seinem Umfeld verschaffen, vielleicht mit seiner Mutter reden.«
»Ist ja alles wunderschön, außer dass er bei seiner Großmutter gelebt hat.«
»Wirklich?«
»Den Informationen zufolge, die wir bei der Einsatzbesprechung erhalten haben, hat er bei seiner Großmutter gelebt. Wir waren die bösen Wölfe, die über Großmutters Haus hergefallen sind. Von einem Vater weit und breit keine Spur und die Mutter ohne festen Wohnsitz, lebt auf der Straße. Drogen.«
»Meinetwegen, dann rede ich eben mit der Großmutter. Wo wohnt sie?«
»Sie wollen da mal eben so vorbeifahren und Guten Tag sagen?«
Er sagte es in einem ungläubigen Ton, und ich wusste, das lag daran, dass ich weiß war und in Winslows Viertel wahrscheinlich nicht sehr freundlich aufgenommen würde.
»Keine Angst, ich werde jemanden mitnehmen. Zwecks zahlenmäßiger Überlegenheit.«
»Na, dann viel Glück. Aber warten Sie möglichst bis vier damit, sich abknallen zu lassen; dann habe ich nämlich Dienstschluss.«
»Ich werde mein Bestes tun. Also, wie war die Adresse, erinnern Sie sich noch?«
»Irgendwo in Rodia Gardens. Augenblick.«
Er legte das Telefon beiseite, um die genaue Adresse nachzusehen. Rodia Gardens war ein riesiger Sozialbaukomplex in Watts, eine eigene kleine Stadt. Eine gefährliche Stadt. Benannt war sie nach Simon Rodia, dem Künstler, der eins der Wunder der Stadt geschaffen hatte. Die Watts Towers. An Rodia Gardens war jedoch nichts Wundervolles. Es war die Sorte Viertel, in der seit Jahrzehnten Armut, Drogen und Kriminalität grassierten. Mehrere Generationen von Familien lebten dort und schafften den Absprung nicht. Viele waren dort aufgewachsen, ohne jemals am Strand oder in einem Flugzeug oder auch nur in einem Kino gewesen zu sein.
Braselton kam wieder ans Telefon und gab mir die vollständige Adresse, aber eine Telefonnummer hatte er nicht. Als ich ihn darauf nach dem Namen der Großmutter fragte, nannte er mir den Namen, den ich bereits hatte, Wanda Sessums.
Na also! Meine Anruferin. Entweder hatte sie gelogen, als sie sich als die Mutter des jungen Verdächtigen ausgab, oder die Angaben der Polizei stimmten nicht. Jedenfalls hatte ich jetzt eine Adresse und würde hoffentlich bald ein Gesicht mit der Stimme verbinden können, die mich am Freitag beschimpft hatte.
Nach dem Telefonat mit Braselton machte ich mich auf den Weg in die Bildredaktion. Dort fragte ich Bobby Azmitia, einen der Bildredakteure, ob gerade irgendwelche Springer auf Achse waren. Er sah auf sein Log und nannte mir zwei Fotografen, die in ihren Autos unterwegs waren und nach wild wachsender Kunst Ausschau hielten – nach Fotos, die nichts mit irgendwelchen nachrichtenwürdigen Ereignissen zu tun hatten, sondern nur dazu dienten, etwas Farbe ins Blatt zu bringen. Ich kannte beide Springer, und einer von ihnen war schwarz. Ich fragte Azmitia, ob sich Sonny Lester loseisen könne, um mit mir den Freeway 110 runterzufahren, und er erklärte sich bereit, mir den Fotografen zur Verfügung zu stellen. Wir vereinbarten, dass er mich in fünfzehn Minuten vor der Globe Lobby abholen würde.
Wieder zurück im Newsroom, ging ich mit Angela ihre Offen-Ungelöst-Story durch, dann ging ich zu meinem Ace. Prendergast war gerade dabei, das erste Storybudget des Tages zu schreiben. Bevor ich den Mund aufmachen konnte, sagte er: »Angela hat bereits eine Zusammenfassung geliefert.«
Damit waren der Ein-Wort-Titel und die knappe Inhaltsangabe eines Beitrags für das Storybudget gemeint, anhand dessen die Ressortleiter bei der täglichen Redaktionskonferenz überblicken konnten, welche Beiträge für die Online- beziehungsweise die Printausgabe der Zeitung eingeplant waren, und so entscheiden konnten, welche Nachrichten wichtig waren und welche nicht und wie sie am besten platziert wurden.
»Ja, sie hat die Sache schon ganz gut im Griff«, sagte ich. »Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass ich mit einem Fotografen nach South L.A. runterfahre.«
»Was steht an?«
»Vorerst noch nichts. Aber später kann ich Ihnen vielleicht mehr erzählen.«
»Okay.«
Prendo und ich waren immer gut miteinander ausgekommen. Er ließ den Reportern immer viel Spielraum, und er war kein Radfahrer. Ich musste meinen Zeitaufwand belegen und womit ich mich gerade befasste, aber er ließ mich immer alles mehr oder weniger zu Ende bringen, bevor ich ihn einweihen musste.
Ich marschierte zu den Aufzügen.
»Kleingeld eingesteckt?«, rief mir Prendergast hinterher.
Ohne mich umzusehen, hob ich die Hand und winkte. Das rief mir Prendergast immer nach, wenn ich die Redaktion verließ, um für eine Meldung zu recherchieren. Es war ein Spruch aus Chinatown. Ich benutzte keine Münztelefone mehr – kein Reporter tat das –, aber die Botschaft war klar. Lass von dir hören.