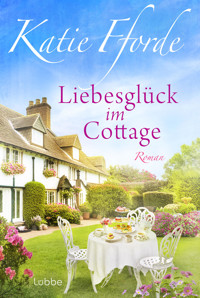5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sophie will es immer allen recht machen, vor allem ihrer Familie. Als sie von einer Freundin eine Einladung in die USA erhält, genießt sie die ungewohnte Freiheit in New York in vollen Zügen. Bei einem Fest macht sie zahlreiche Bekanntschaften, nicht zuletzt die einer bezaubernden älteren Dame namens Mathilda, die sich schließlich mit einem ungewöhnlichen Auftrag an sie wendet: Sophie soll für sie ein Haus in ihrer Heimat Cornwall finden. Bei der Suche kommt Sophie auch Mathildas forschem Enkel Luke näher, dessen undurchsichtiges Verhalten sie ein ums andere Mal verwirrt ...
Eine romantische Liebesgeschichte mit himmlischem Ende, von Bestsellerautorin Katie Fforde.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Dank
Über dieses Buch
Sophie will es immer allen recht machen, vor allem ihrer Familie. Als sie von einer Freundin eine Einladung in die USA erhält, genießt sie die ungewohnte Freiheit in New York in vollen Zügen. Bei einem Fest macht sie zahlreiche Bekanntschaften, nicht zuletzt die einer bezaubernden älteren Dame namens Mathilda, die sich schließlich mit einem ungewöhnlichen Auftrag an sie wendet: Sophie soll für sie ein Haus in ihrer Heimat Cornwall finden. Bei der Suche kommt Sophie auch Mathildas forschem Enkel Luke näher, dessen undurchsichtiges Verhalten sie ein ums andere Mal verwirrt …
Über die Autorin
Katie Fforde hat bereits zahlreiche Romane veröffentlicht, die in Großbritannien allesamt Bestseller waren. Ihre romantischen Beziehungsgeschichten werden erfolgreich für die ZDF-Sonntagsserie »Herzkino« verfilmt. Katie Fforde lebt mit ihrem Mann, drei Kindern und verschiedenen Katzen und Hunden in einem idyllisch gelegenen Landhaus in Gloucestershire, England.
Offizielle Website: http://www.katiefforde.com/
Katie Fforde
DAS GLÜCKÜBER DENWOLKEN
Roman
Aus dem Englischen vonKatharina Kramp
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Katie Fforde Ltd.
Titel der englischen Originalausgabe: »A Perfect Proposal«
Originalverlag: Century, London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © Thinkstock
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Datenkonvertierung eBook: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4810-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für meine Familie, alle Generationen, jung und alt, die alle bei diesem Buch geholfen haben.
Und für die Romantic Novelists’ Association,
1. Kapitel
»Und wer war jetzt noch mal dieser ›böse Onkel Eric‹? Ich bin sicher, du hast es mir bereits erzählt, aber ich komme mit meiner eigenen Verwandtschaft schon durcheinander, ganz zu schweigen von der anderer.«
Sophie legte den Teelöffel auf die Untertasse und blickte nachdenklich über den Tisch auf Amanda, eine ihrer zwei besten Freundinnen. »Er ist ein Verwandter von Dad, Mands, aber da ich ihm noch nie begegnet bin – oder falls doch, so jung war, dass ich mich nicht daran erinnern kann –, ist es kaum überraschend, dass du ihn vergessen hast. Ich bin auch gar nicht sicher, ob er wirklich mein Onkel ist oder nur ein älterer Cousin. Es hat da mal einen Streit gegeben, der aber inzwischen beigelegt ist.«
Sie saßen in ihrem Lieblingscafé an ihrem Lieblingstisch am Fenster, von dem aus sie die Passanten beobachten und gegebenenfalls über deren Klamotten lästern konnten. Sophie wischte aus Gewohnheit etwas verschütteten Kaffee mit der Serviette auf.
»Und warum sollst du hinfahren und auf ihn aufpassen? Du bist doch erst zweiundzwanzig. Nicht wirklich alt genug, um als alte Jungfer zur Beaufsichtigung eines unverheirateten männlichen Verwandten abgeschoben zu werden.« Amanda malte mit so heftigen Bewegungen Muster in den Milchschaum ihres Cappuccinos, dass ihre Missbilligung offensichtlich war.
Sophies Augen wurden in gespielter Entrüstung schmal. »Du hast zu viele historische Romane gelesen, Mandy, obwohl ich zugeben muss, dass es wirklich ein bisschen so klingt, als würde die unverheiratete Tochter zum reichen Onkel geschickt, weil alle hoffen, dass dieser ihr dann sein ganzes Geld hinterlässt.« Sie runzelte die Stirn. »Aber so ist es nicht.«
Ihre Freundin hob skeptisch die Augenbrauen.
»So ist es nicht!«, protestierte Sophie.
»Dann musst du für deine Familie also nicht – mal wieder – das Mädchen für alles spielen? Während diese andere Verwandtenaufpasserin im Urlaub ist?«
Sophie zuckte mit den Schultern. »Sie ist keine Aufpasserin! Sie ist eine Haushälterin oder Pflegerin oder so etwas. ›Aufpasserin‹ klingt furchtbar.«
Amanda sah Sophie in die Augen. »Warum du? Warum nicht jemand anders aus deiner Familie? Deine Mutter zum Beispiel.«
»Oh, Amanda! Du weißt, warum! Niemand sonst will es machen, und um ehrlich zu sein, habe ich ja auch gerade sonst nichts zu tun.« Sophie war bewusst, dass ihre Freundin sich sehr viel mehr darüber aufregte, dass sie sich um einen alten Verwandten kümmern sollte, als sie selbst. Vielleicht ließ sie sich von ihrer Familie wirklich zu viel herumschubsen. »Ich lasse mich von ihm bezahlen.«
»Und du denkst, das macht er? Er könnte jemanden von einer Vermittlung kommen lassen, wenn er das wollte. Dann würde er doch nicht darauf bestehen, dass ein Mitglied der Familie einspringt. Er muss gemein sein. Deshalb nennen sie ihn auch ›böse‹.«
Sophie überlegte. »Na ja, wie ich schon sagte, ich bin ihm noch nie persönlich begegnet, aber meine Eltern behaupten, er sei schrecklich geizig. Offenbar haben sie ihn während einer finanziellen Krise um ein Darlehen gebeten, und er hat sie aus dem Haus gejagt und dabei Stellen von Shakespeare über Schuldner und Kreditgeber zitiert und geschimpft, dass er keiner sei.« Sophie lachte bei dem Gedanken, wie wütend ihre Eltern gewesen sein mussten. »Das ist aber schon viele Jahre her.«
»Er muss ein Pfennigfuchser sein, wenn er dich bittet, ihn zu pflegen, obwohl er sich auch eine professionelle Hilfe leisten könnte.«
Sophie biss sich auf die Lippe. Sie wollte Amanda nicht sagen, dass es ihre Mutter gewesen war, die Sophies Dienste angeboten hatte, vermutlich, um den Onkel milde zu stimmen, jetzt, da er dem Tod so viel näher stand als noch vor Jahren. Er wollte ihnen vielleicht kein Geld leihen, hinterließ ihnen jedoch vielleicht welches, vor allem, da es offenbar nicht viele andere Verwandte zu geben schien. Und Sophies Familie war schon immer sehr knapp bei Kasse gewesen.
Amanda kannte Sophie jedoch schon seit der Grundschule und wusste nur zu gut, wie ihre Freundin von ihrer Familie behandelt wurde. »Jetzt sag nicht, das war die Idee deiner Mutter.«
»Okay, dann sage ich es nicht!« Sophie zwinkerte Amanda über ihre Kaffeetasse hinweg zu. »Schon gut! Ich weiß, du glaubst, dass sie mich alle schrecklich herumschubsen, doch ich bekomme meinen Willen öfter, als ihnen bewusst ist. Wenn einen die Leute für dumm halten – selbst die eigene Familie –, dann verleiht einem das eine gewisse Macht, weißt du.« Sie hatte das Gefühl, ihren fehlenden Zorn erklären zu müssen. »Ich weiß, es wirkt, als bürdeten sie mir immer viel auf, aber ich tue nie etwas gegen meinen Willen.«
Amanda seufzte. »Wenn du meinst. Doch ich verstehe wirklich nicht, warum deine Familie dich für dumm hält.«
Sophie zuckte mit den Schultern. »Ich schätze, weil ich keine Akademikerin bin wie alle anderen und weil ich die Jüngste bin und so. Es ist zum Teil Gewohnheit, und zum Teil liegt es daran, dass sie meine Stärken nicht für nützlich halten.« Sie seufzte. »Obwohl sie davon profitieren. In meiner Familie zählen leider nur die Buchstaben, die man vor oder hinter den eigenen Namen setzen kann.«
Amanda schnaubte. »Ich würde gern wissen, was Milly dazu meint.«
Milly, die dritte des Trios, das in der Schule nur »Milly-Molly-Mandy« genannt worden war – unfairerweise, wie Sophie fand, denn sie wollte keine »Molly« sein –, lebte in New York. Sie war zwei Jahre älter als die anderen beiden und die Anführerin der drei und sagte noch öfter und noch offener ihre Meinung als Amanda.
»Ich habe Mills noch nichts davon erzählt, obwohl ich sie eigentlich anrufen wollte. Aber jetzt muss ich wirklich los. Ich muss noch ein paar Plastikbecher für die Kinder besorgen. Die Leute kommen schon gegen eins.« Sie verzog das Gesicht. »Meine Mutter besteht darauf, oben im alten Spielzimmer einen eigenen Raum für die Kleinen einzurichten. Sie sagt, dann haben sie mehr Spaß, aber ich glaube, sie will einfach nicht, dass Kinder auf ihrer Party herumrennen und laut sind.«
»Siehst du! Da hast du es! Du hilfst deiner Mutter bei ihrer Party und wirst trotzdem wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt.«
Sophie kicherte. »Es geht nicht um Klasse, Schatz, sondern um Grips! Ersteres besitze ich unstrittig, aber meine Abschlussnoten lassen darauf schließen, dass mir Letzteres eher fehlt.«
»Du klingst genau wie deine Mutter!«
»Wirklich? Das ist nicht gut.«
»Es ist unausweichlich. Und um fair zu bleiben, muss ich zugeben, dass deine Mutter recht hat, was das Kinderzimmer angeht. Die Partys von Erwachsenen können unglaublich langweilig sein, wenn man noch klein ist. Und dein Vater wird vermutlich wieder alle fragen, ob sie Latein können – auch die Kinder.«
Sophie hob eine Augenbraue. »Die Partys meiner Eltern sind auch noch langweilig, wenn man einen Meter fünfundsechzig groß ist, was ja auch der Grund ist, warum du nicht kommen willst. Anders als letztes Jahr. Und Dad fragt dich nicht mehr nach deinen Lateinkenntnissen. Er weiß, dass du auf dieselbe Schule gegangen bist wie ich und kein Latein hattest.«
Amanda hatte jetzt offensichtlich ein schlechtes Gewissen. »Willst du wirklich, dass ich komme? Dann tue ich das. Wir hatten doch immer Spaß auf den Festen deiner Eltern.«
»Als wir drei uns noch mit Kinderschminke angemalt und mit dem Schlauch im Garten gespielt haben.« Sie seufzten beide bei der Erinnerung, dann fuhr Sophie fort: »Nein, schon gut. Ich schaffe das auch ohne dich. Schließlich bin ich meine schreckliche Familie gewohnt. Ich werde mit ihnen fertig.« Sie runzelte ein wenig die Stirn. Sie war nicht ganz ehrlich zu Amanda gewesen. Obwohl sie ihre Stellung in ihrer Familie stets zu akzeptieren schien, störte es sie in letzter Zeit immer häufiger, wie sie behandelt wurde. Vor allem in diesen harten Zeiten, in denen sie für ihre Fähigkeit, Schäbiges in Schickes zu verwandeln, gern auch mal ein Schulterklopfen bekommen hätte.
Sophie fand den Laden, der Partyzubehör führte, in einer Seitenstraße im alten Teil der Stadt. Da dort gerade ein Räumungsverkauf stattfand, fügte sie ihrer Liste noch einige Dinge hinzu: Wunderkerzen, Schminkstifte und ein paar Lametta-Perücken. Dann lief sie den Hügel zu dem großen alten viktorianischen Haus hinauf, in dem sie wohnte.
Sie hatte schon oft gedacht, dass ihre Eltern in eine kleinere Wohnung hätten ziehen oder einen Teil des Hauses hätten vermieten können, wenn sie ihre notorische Geldknappheit wirklich gestört hätte. Die Ausgaben für den Einbau eines zusätzlichen Badezimmers und einer Küchenzeile auf dem Dachboden hätten sich schnell rentiert. Mit einer solchen Baumaßnahme hätten ihre Eltern sich auf Jahre ein zusätzliches Einkommen sichern können. Doch stattdessen breiteten sich die Familienmitglieder, die noch im Haus wohnten – Sophie, ihr älterer Bruder Michael und ihre Eltern –, überall aus, stritten sich um das einzige Badezimmer und füllten alle leer stehenden Räume mit Sperrmüll.
Sophies Mutter, die ihren Beruf als Lehrerin aufgegeben hatte, um Künstlerin zu werden, benötigte am meisten Platz für ihr Atelier und zur Lagerung ihrer Bilder. Ihr Vater, ein Akademiker, war ein notorischer Büchersammler. Er brauchte ein Arbeitszimmer und eine Bibliothek. Michael, der ebenfalls Akademiker war, ebenso. Sophie hatte einmal vorsichtig nachgefragt, ob Vater und Bruder sich die Bibliothek nicht teilen könnten, damit sie den frei werdenden Raum vielleicht als Nähzimmer nutzen konnte, doch diese Bitte war herablassend abgeschmettert worden. »Kunst« war »künstlerisch«, während Nähen entweder »Flicken« oder überhaupt völlig albern war. Da Sophies Schwester Joanna zu Hause ausgezogen war, als Sophie fünfzehn gewesen war, hatte sie ihre Nähmaschine und alles, was sie für ihre Kreationen brauchte, in deren ehemaligem Zimmer unterbringen können.
Jetzt waren die Räume im Erdgeschoss für die Party ihrer Eltern hergerichtet, wozu Sophie viel von ihrem Improvisationstalent hatte einsetzen müssen. Das Haus war elegant und charmant, aber die Teppiche fadenscheinig. Es gab außerdem feuchte Flecken an den Wänden, die Sophie hinter riesigen Blumenarrangements versteckt hatte, und über den Tischen lagen jetzt Tischdecken, um die von achtlosen Akademikern verursachten Ringe zu verstecken. Diese Leute mussten ihre Teetassen einfach überall abstellen.
Die Küche war von den beiden Caterern Linda und Bob in Beschlag genommen worden, für die Sophie oft kellnerte. Sie war groß und mit der Art von frei stehenden Möbeln bestückt, die heutzutage so modern waren, einfach weil niemand in diesem Haus sie ausgetauscht hatte, als Einbauküchen in Mode gekommen waren. Sophie überlegte manchmal, die Utensilien als »kultige Küchensachen« zu verkaufen, sie durch neuere zu ersetzen und dabei eine schöne Summe Geld zu machen. Aber neue Dinge passten nicht in ihr langsam verfallendes Heim.
Sie stellte ihre Tasche auf die Arbeitsfläche. »Okay, Zitronen, Limetten, Chips und Sachen für die Kinder. War da noch was?«
»Ich glaube nicht«, meinte Linda und nahm die Zitronen und die Limetten entgegen. »Die Salate sind angerichtet, und ich habe den Lachs und die Platten mit dem kalten Braten verziert. Die warmen Speisen sind im Ofen, also liegen wir ganz gut in der Zeit, denke ich.«
»Und was kann ich noch erledigen?« Sophie konnte Körpersprache gut deuten und sah, dass ihre Freundin etwas brauchte, wenn nicht sogar sehr viel, und Sophie half immer aus, wenn ihre Familie ein Fest veranstaltete. Sie half immer aus, Punkt. Sophie machte sich sehr gern nützlich, anders als die männlichen Mitglieder der Familie, die jede noch so kleine Bitte, im Haushalt zu helfen, als persönlichen Angriff verstanden. Ihre Mutter fühlte sich offensichtlich nicht verpflichtet, ihre Hilfe anzubieten: Sie lag derzeit in der Badewanne, weil sie sich bei der Umgestaltung des Gartens völlig verausgabt hatte. (Die sensible Künstlerin konnte eine bestimmte Farbkombination nicht ertragen.)
»Könntest du die Gläser ins Esszimmer stellen? Und sie vielleicht ein bisschen polieren? Dein Bruder hat sie beim Weinhändler abgeholt, aber ich habe sie mir angesehen, und ich finde nicht, dass sie besonders sauber aussehen.«
»Okay.« Sophie suchte sich ein sauberes Trockentuch und warf es sich über die Schulter, dann trug sie die Kartons mit den Gläsern ins Esszimmer. Von hier führten die Terrassentüren hinaus in den Garten; da das Oktoberwetter das schönste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, hofften sie, die Türen später öffnen und die Leute auf die Terrasse und von dorthinaus in die Wildnis des Gartens entlassen zu können.
Der Garten war wie das Haus wunderschön, wenn man nicht so genau hinsah. Es gab zahlreiche riesige Büsche – seit Jahren ungestutzt – und breite Streifen mit spät blühenden grell pinkfarbenen Phlox vor orangefarbenen Schwertlilien – sie waren der Auslöser für die kurzfristige Spatenattacke ihrer Mutter Sonia gewesen.
Sonia Apperly kam jetzt, strahlend und rosig von ihrem Bad, zu Sophie ins Esszimmer, die die Gläser über eine Schüssel mit heißem Wasser hielt und polierte.
»Oh, Liebling, lass das! Die sind doch sauber. Kümmere dich lieber um die Blumenarrangements im Flur. Der schreckliche feuchte Fleck direkt gegenüber der Haustür war mir noch gar nicht aufgefallen. Eine große Vase mit Blumen würde ihn verstecken. Noch eine von deinen verrückten Kreationen – genau das, was wir brauchen.«
»Hm, dann muss ich zuerst einen Tisch finden, auf den ich die Vase stellen kann. Oh, ich weiß! Oben steht noch ein stabiler Karton. Dann brauche ich nur noch ein bisschen Stoff. Überlass das mir, Mum.«
»Danke, Liebling«, sagte ihre Mutter, schob sich eine Strähne ihres lockigen Haares hinter das Ohr und ging wieder nach oben, vermutlich um sich wieder ihrem Schönheitsprogramm zu widmen.
Sophie machte sich auf die Suche nach der Gartenschere.
Nachdem sie den größten Raum im Dachgeschoss für die Kinder hergerichtet hatte – womit alle unter fünfundzwanzig gemeint waren –, musste Sophie eine kleine Krise (keine sauberen Handtücher) nach der anderen (kein Toilettenpapier) bewältigen, sodass ihr selbst nur wenig Zeit blieb, sich für die Party zurechtzumachen. Sie zog einfach eine weiße Bluse an, die sauber war, und einen kurzen schwarzen Rock, weil der ihrer Mutter besser gefallen würde als eine Jeans. Dann lief sie runter, um ihren Eltern und ihrem Bruder dabei zu helfen, den Gästen Getränke anzubieten. Nicht, dass ihr Bruder sich tatsächlich nützlich machte. Sobald jemand kam, mit dem er sich unterhalten wollte, stellte er seine Aktivitäten als Gastgeber ein; er sorgte noch dafür, dass er und sein »Opfer« volle Gläser hatten, dann führte er es in sein Arbeitszimmer, um dort in Frieden das Gespräch zu führen.
Bald kam die Party in Gang; das Essen wurde serviert, die Leute standen auf der Terrasse, und Sophie wünschte sich, sie wäre oben bei den Kindern.
Sie war es leid zu erklären, dass sie, ja, sehr viel jünger war als ihre klugen älteren Geschwister und dass sie, nein, nicht studierte und auch kein Studium beginnen würde; sie war zufrieden mit dem, was sie machte, dank der Nachfrage. (Sie war sehr höflich.)
Manchmal hätte sie ihren Gesprächspartnern gern erklärt, dass sie eigentlich am liebsten Schneiderin geworden wäre, aber dass ihre Eltern das nicht für einen angemessenen Beruf hielten und außerdem meinten, das Schneidern würde ihr »bald langweilig werden«, und sie deshalb keine entsprechende Ausbildung begonnen hatte. Langsam kochte sie jedoch innerlich, etwas, über das sich Milly und Amanda sehr gefreut hätten, hätten sie es gewusst.
Sophie fragte sich gerade, ob sie nicht eine ganze Schüssel Mousse au Chocolat stibitzen und mit nach oben nehmen sollte, als eine Bekannte ihrer Mutter – sie hatten denselben Malkurs besucht – ihr auf die Schulter klopfte.
»Bringen Sie mir ein sauberes Glas! Dieses hier ist schmutzig.«
Die Frau fügte ihrer Bitte kein Lächeln hinzu, ganz zu schweigen von einem »Bitte« oder einem »Danke«, und Sophie, die persönlich alle Gläser poliert hatte und sich nicht vorstellen konnte, in welchem dunklen Schrank dieses gelauert haben konnte, war beleidigt. Die Frau merkte davon jedoch nichts, weil Sophie nur kurz lächelte und das fleckige Glas entgegennahm. Sie ging in die Küche, spülte es, trocknete es ab und brachte es dann der Bekannten ihrer Mutter zurück.
»Oh, und Weißwein bitte. Keinen Chardonnay«, meinte die Frau. »Irgendetwas Anständiges.«
Erst als die Gute den Wein in der Hand hielt, den sie wollte, und sich dazu herabgelassen hatte, Sophies Hilfsbereitschaft mit einem Kopfnicken zu quittieren, beschloss Sophie, dass sie es leid war, die unbezahlte Kellnerin zu sein, und floh.
Sie nahm eine Schüssel Mousse au Chocolat und ein Dutzend Löffel mit, weil sie wusste, dass es im Kinderzimmer Pappteller gab. Sie würde die Schokoladencreme an alle verteilen, die sich da oben aufhielten, die Kleinen mit einem Spiel beschäftigen und dann Milly in New York anrufen.
»Und dann«, fuhr Sophie fort, das Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt, während sie Spielkarten mischte, »hat mich so eine bösartige alte Schachtel auch noch für die Kellnerin gehalten! Auf der Party meiner Eltern! Dabei bin ich ihr schon ganz oft begegnet! Das wurde mir zu viel, deshalb bin ich nach oben geflohen. Hier ist es viel lustiger.«
»Das ist ja furchtbar.« Auf der anderen Seite des Atlantiks klang die Stimme ihrer Freundin heiser.
»Oh, tut mir leid, Milly! Habe ich dich geweckt? Ich wollte dich schon seit einer Ewigkeit anrufen und habe nicht an den Zeitunterschied gedacht.«
»Schon gut, jetzt bin ich wach. Ich wollte mal ausschlafen, aber egal.« Es entstand eine kurze Pause, in der Sophie fast hören konnte, wie ihre Freundin sich die Augen rieb und sich für ein Pläuschchen zurechtsetzte. »Also ist niemand Nettes auf der Party?«
»Nicht, wenn du damit Männer meinst, nein. Es ist die alljährliche Sommerparty meiner Eltern – diesmal etwas verspätet. Weißt du noch, Amanda und du wart doch früher auch immer da –, das ganze Haus ist voller Verwandter und alter Freunde. Ich bin nach oben ins Dachgeschoss gegangen, wo die Kinder sind. Ich habe es satt, wie eine Angestellte behandelt zu werden. Meine Familie ist schlimm genug, aber wenn jetzt schon die Gäste damit anfangen …«
»Soph, fairerweise muss man sagen, dass du tatsächlich kellnerst.«
»Ich weiß! Und ich bin stolz darauf, eine Kellnerin zu sein. Doch diese Frau war so unhöflich, ich hätte mich sogar darüber aufgeregt, wenn ich tatsächlich hier angestellt wäre. Also habe ich die Kinder überredet, genug Kartenspiele zusammenzusuchen, damit wir ›Racing Demon‹ spielen können, und wir werden jede Menge Spaß haben.«
Millys fehlende Zustimmung, was die Menge an »Spaß« anging, war beinahe hörbar. Es herrschte einen Moment Stille, man hörte Bettzeug rascheln, und dann sagte Milly: »Hör mal, warum kommst du nicht nach New York? Ich weiß, das frage ich immer, aber jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Du arbeitest nicht mehr als Kindermädchen, oder? Du hast doch Zeit? Im Moment ist es hier wunderschön, und nächsten Monat ist Thanksgiving.«
»Das klingt himmlisch! Doch ich möchte kein Geld ausgeben. Ich spare für einen Kurs.«
»In was?«
»Ich kann mich nicht entscheiden. Entweder Schneidern oder einen Grundkurs in Betriebswirtschaft. Was immer mir mehr nützt, wenn ich mal zu Geld komme, schätze ich.«
»Bezahlen denn deine Eltern nicht für deine Ausbildung?« Milly versuchte erst gar nicht, ihre Verärgerung zu verstecken. »Du warst nicht auf der Uni, also hast du ihnen doch einen Haufen Geld gespart.«
»Na ja, schon, aber sie bezahlen nichts für ›Hobbys‹ wie Buchbinden oder Tiffany-Glasmalerei, und ich fürchte, Schneidern fällt für sie unter diese Rubrik. Kunst ist etwas anderes«, fügte sie schnell hinzu, weil sie wusste, was ihre Freundin dachte. »Und das mit der Gründung eines eigenen Geschäfts sagt ihnen auch nichts. Sie verstehen Leute nicht, die sich selbstständig machen wollen.« Sie seufzte. »Obwohl ich fairerweise zugeben muss, dass sie auch nicht viel Geld haben.«
»Dann komm nach New York! Das muss ja nicht teuer sein. Du kriegst den Flug sicher sehr günstig, und du kannst bei mir wohnen.«
»Äh …« Sophie hatte es vor sich hergeschoben, es Milly zu gestehen; sie würde genauso reagieren wie Amanda. Doch es zahlte sich aus, zu Freunden ehrlich zu sein; Milly würde es ja doch irgendwann aus ihr herauskitzeln. »Ich muss zu einem älteren Verwandten fahren und mich um ihn kümmern. Aber das ist in Ordnung. Er bezahlt mich dafür!« Sie kreuzte die Finger, weil sie das noch gar nicht sicher wusste.
Wie erwartet rauschte Millys (schlechte) Meinung über die Familie ihrer Freundin über den Atlantik. »Oh, Sophie! Du solltest dich von deinen Eltern nicht zu etwas drängen lassen, das ihnen nützt und dir nicht. Du weißt doch, wie sie sind.«
»Niemand weiß das besser als ich.«
»Sie erwarten immer, dass du dich ihnen anpasst, und lassen dir gar keinen Freiraum, um deine eigenen Träume auszuleben. Es wird Zeit für dich, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und deinem Stern zu folgen!«
Sophie zögerte. »Hast du das aus einem Selbsthilfebuch oder einer inspirierenden Fernsehsendung?«
Sophie konnte sich Millys verlegenen Gesichtsausdruck vorstellen. »Na gut, okay, daher habe ich es wahrscheinlich, aber selbst wenn es ein Klischee ist, stimmt es trotzdem.«
»Ich weiß. Und ich werde versuchen, mich zusammenzureißen und kein Fußabtreter mehr zu sein.«
»Du bist kein Fußabtreter, Soph, doch sie sind herrisch, und du bist ein bisschen hilfsbereiter und entgegenkommender, als dir guttut. Ich werde jedenfalls versuchen, dir hier einen Job zu besorgen, für den du keine Greencard brauchst.«
»Danke, Milly. Ich werde über die Tatsache hinwegsehen, dass du jetzt herrisch bist. Und wie bist du damals überhaupt an eine Greencard gekommen?«
»Mein Boss hat das geregelt. Ich habe eben einzigartige Fähigkeiten.«
»Oh. Wie zum Beispiel, herrisch zu sein?«
»Aber ich bin es in diesem Fall nur, weil ich dein Bestes will!«, beharrte Milly.
»Das sagen sie alle.«
»Sophie!«, rief einer der Zwölfjährigen, der geduldig darauf wartete, dass sie die Karten austeilte. »Die Kleinen verlieren langsam die Lust. Können wir jetzt spielen?«
»Sicher«, erklärte Sophie. »Mills, ich muss jetzt Schluss machen. Ich werde hier gebraucht.«
»Und ich schaue mal, ob ich dir nicht einen Job besorgen kann. Wir hätten so viel Spaß zusammen. Ich zeige dir alle Sehenswürdigkeiten – die besten Läden –, das wird großartig! Ich schicke dir eine Mail«, meinte Milly, die jetzt hellwach klang.
»Cool! Und danke fürs Zuhören. Wie viel Uhr ist es bei euch?«
»Kurz vor zehn Uhr morgens. Aber heute ist Sonntag.«
»Oh, dann brauche ich ja kein schlechtes Gewissen zu haben.«
Sophie beendete das Gespräch mit ihrer Freundin mit einem Seufzen und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder ihren verschiedenen Cousins und den Kindern der Freunde ihrer Eltern zu. »Okay, Leute, hat jetzt jeder einen Packen Karten?«
Eines der älteren ›Kinder‹ hatte zwei Weinflaschen nach oben geschmuggelt, und Sophie stellte fest, dass ihr Glas gefüllt war. Sie gehörte vielleicht zu den »nicht so schlauen« (niemand sprach tatsächlich das Wort »dumm« aus) Mitgliedern der Familie Apperly, aber sie war hübsch und bei Weitem die Netteste. Deshalb saß sie auch jetzt hier im Schneidersitz auf dem Boden, die karamellfarbenen Haare zu einem Knoten hochgesteckt. Nachdem man sie für eine Kellnerin gehalten hatte, hatte sie den kurzen schwarzen Rock und die weiße Bluse gegen eine Jeans und einen Pullover mit V-Ausschnitt getauscht, an dessen Halsbündchen sie Perlmuttknöpfe – ein echtes Schnäppchen vom Flohmarkt – genäht hatte.
»Gehen wir noch mal die Regeln durch, ja?«, meinte sie jetzt.
Da einige das Spiel noch nicht kannten, benötigten sie viele Erklärungen, wie es gespielt wurde. Die erfahrenen »Racing Demon«-Spieler mussten auf die Jüngeren und Unerfahrenen Rücksicht nehmen und bekamen besondere Strafen. Dann begann das Spiel. Hände und Karten flogen, verärgertes Kreischen und Jubelrufe übertönten sich gegenseitig. Als die erste Runde vorbei war, tröstete Sophie den jüngsten Spieler.
»Dieses Mal«, erklärte sie und legte den Arm um den Sechsjährigen, der mit den Tränen kämpfte, »musst du nur zehn Karten rauslegen und alle anderen zwölf, und dein großer Bruder sogar vierzehn, weil er gewonnen hat.«
»Sophie«, beschwerte sich der ältere Bruder, um den es ging, »ich glaube, du erfindest einfach neue Regeln.«
»Genau. Ich darf das.«
Einige stöhnten, aber da Sophie ihre Lieblingscousine war und alle ein kleines bisschen in sie verliebt waren, kam es nicht zur Meuterei.
»Okay, füllt die Gläser wieder auf! Toby, du kannst dir etwas Wein in deine Limonade mischen, aber nur ich darf ihn pur trinken.«
»Das ist nicht fair!«, sagte Tony, unterstützt von den anderen.
»Ich weiß.« Sophie nickte gespielt betrübt. »Hart, oder?« Sie würde nicht zulassen, dass ihre jungen Cousins es mit dem Wein übertrieben und ihnen schlecht wurde.
Sophie spielte weiter, bis der jüngste Spieler mit nur noch fünf Karten auf dem Haufen vor sich schließlich gewann. Nach dieser Ehrenrettung erhob sie sich, fuhr über ihre Jeans und ging zurück nach unten, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass sich kein Alkohol mehr in Reichweite ihrer Cousins befand.
Wie sie gehofft hatte, waren nur noch die Verwandten da und standen in kleinen Grüppchen verteilt im Haus. Die Caterer räumten auf. Sophie sammelte Gläser ein, teilweise aus Gewohnheit, teilweise, weil sie wusste, dass es niemand sonst aus der Familie für nötig befinden würde.
»Schatz!«, rief ihre Mutter, gut aussehend, künstlerisch begabt und jetzt ein kleines bisschen beschwipst, und legte ihrem jüngsten Kind im Vorbeigehen den Arm um die Schulter. »Ich habe dich kaum gesehen. Hast du dich um die Kleinen gekümmert?«
»Ein paar von ihnen sind inzwischen schon ziemlich groß«, meinte Sophie, »aber ja.«
»Du bist ein so liebes Mädchen!« Sophies Mutter streichelte ihr über das Haar, wodurch es sich aus der Spange löste. »Du hast ein Händchen für Kinder.«
»Stets zu Diensten«, erwiderte Sophie und versuchte, sich nicht indirekt kritisiert zu fühlen. »Ich glaube, ich helfe Linda und Bob in der Küche.«
»Dann sieh mal nach, ob noch eine Flasche Sekt da ist, wenn du schon dabei bist«, erklang eine forschere Stimme aus der Halle. »Ich musste mit ein paar langweiligen Freunden von Dad reden und habe seit einer Ewigkeit nichts mehr getrunken.«
Ihre ältere Schwester Joanna war Sophie von all ihren Geschwistern die liebste. Obwohl alle Sophie behandelten, als wäre sie ein bisschen minderbemittelt, war Joanna zumindest klar, dass sie nicht länger ein Kind war.
Sophie besorgte eine Flasche Sekt und zwei saubere Gläser und ging wieder zurück zu ihrer Schwester, die unten im Wintergarten heimlich eine Zigarette rauchte. »Soll ich die Flasche für dich aufmachen?«
»Ich habe schon vor deiner Geburt Sektflaschen geöffnet«, erklärte Joanna und trat die Zigarette aus.
»Was, schon so früh? Ich bin schockiert!«
Joanna ließ das unkommentiert. »Trinkst du ein Glas mit?«
»Ich helfe nur noch schnell beim Aufräumen. Die beiden Caterer sind sehr müde, und sie müssen heute Abend noch woandershin.« Sophie zögerte, nicht sicher, ob sie das, was sie eben erlebt hatte, erzählen wollte. »Weißt du was? Diese alte Kuh, die zusammen mit Mum in diesem Malkurs war, hat mich für die Kellnerin gehalten! Befahl mir, ihr ein sauberes Glas zu holen, und verlangte dann auch noch eine bestimmte Sorte Wein.«
Joanna zuckte mit den Schultern. »Na ja, du rennst ja auch ständig im Hilfsbereit-Modus durch die Gegend. Ich hebe dir ein Glas Sekt auf. Die Cousins und Cousinen gehen gleich mit ihrer Brut. Dann legen wir die Füße hoch und unterhalten uns ein bisschen. Ich kann nicht glauben, dass sie dich wirklich überredet haben, dich um den bösen Onkel Eric zu kümmern.«
Da es Sophie ebenso ging, zog sie sich in die Küche zurück; je früher alles aufgeräumt war, desto eher konnte sie mit ihrer Schwester etwas trinken und sich entspannen.
2. Kapitel
Doch nicht allen stand der Sinn nach einem gemütlichen Glas Sekt. Obwohl alle Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen nach Hause gefahren waren, zeigten sich Sophies Geschwister streitlustig. Das passierte oft, und Sophie war nie sicher, ob es am Alkohol lag oder daran, dass sie einfach von Natur aus streitlustig und eifersüchtig waren und sich nicht die Mühe machten, das zu verheimlichen, wenn nur die Familie zusammen war.
Zuerst stürmte Sophies ältester Bruder in den Wintergarten. Stephen arbeitete für eine Umweltschutzorganisation, und Sophie fand, dass er für diese Organisation, die sich die Rettung des Planeten zum Ziel gesetzt hatte, nicht eben ein Aushängeschild war. Er hielt ständig Moralpredigten, war aufgeblasen und langweilig. Wütend über die Entdeckung, dass seine Kinder Poker spielten, suchte er nach jemandem, den er dafür zur Rechenschaft ziehen konnte. Der leichte Zigarettengeruch, der zwischen dem Jasmin und dem Ficus hing, feuerte seine Wut noch weiter an.
»Also wirklich, Jo, du hast Sophie doch nicht rauchen lassen, oder?«, fragte er aufgebracht.
Sophie reagierte nicht. Es hatte keinen Zweck, ihren Bruder daran zu erinnern, dass sie alt genug war und selbst entscheiden konnte, ob sie rauchte oder nicht.
»Natürlich nicht«, erwiderte Joanna spöttisch, die, auf dem Sofa ausgestreckt, weiter an ihrer Zigarette zog. »Und ich habe ihr auch nur ein halbes Glas Sekt gegeben.«
»Ich habe das gesetzliche Mindestalter für den Kneipenbesuch seit vier Jahren erreicht, Stephen«, erklärte Sophie, die mit angezogenen Füßen in einem Sessel saß, fast verdeckt vom Jasmin.
Er ignorierte ihre Bemerkung. In seinen Augen war Sophie zu jung, um irgendetwas zu unternehmen, was auch nur im Entferntesten mit Spaß verbunden war, aber durchaus alt genug, um als Sündenbock herzuhalten. Stephen baute sich vor ihr auf, die Hände in die Hüften gestemmt. »Hast du die Kleinen zum Kartenspielen verführt? Ich habe gerade meine beiden beim Pokern erwischt!«
»Sie haben nur um Streichhölzer gespielt«, verteidigte sich Sophie. »Die Armen mussten sich doch mit irgendetwas beschäftigen. Es ist schrecklich langweilig, als Kind auf einer Erwachsenenparty zu sein, weißt du. Vor allem, wenn die Gäste so spießig sind.«
»Die arme alte Soph ist für eine Kellnerin gehalten worden«, erklärte Joanna und goss sich den Rest aus der Flasche in ihr Glas.
»Ich dachte, du solltest dich um die Kinder kümmern?«, polterte ihr Bruder weiter, der entschlossen zu sein schien, sich zu streiten, und seine jüngste Schwester offenbar für ein leichtes Opfer hielt.
»Ich habe mit allen eine Weile ›Racing Demon‹ gespielt, aber dann bin ich wieder runtergegangen«, erklärte Sophie. »Sie müssen weiter Karten gespielt haben, nachdem die anderen mit ihren Eltern gegangen waren. Es sind deine Kinder, weißt du. Du hast die Verantwortung für sie, nicht ich.«
Er bekam ein schlechtes Gewissen, genau wie beabsichtigt. Stephen nahm Verantwortung sehr ernst. »Ich war nur nicht begeistert, meine Kinder beim Glücksspiel zu ertappen …«
»Bei dem Streichhölzer der Einsatz waren«, sagten Joanna und Sophie gleichzeitig.
»Wo ist Hermine?«, fragte Sophie und meinte damit Stephens Frau.
»Sie unterhält sich mit Myrtle und Rue über die Gefahren des Glücksspiels.«
Sophie und Joanna sahen einander vielsagend an.
»Ich bin sicher, ihr findet das sehr komisch«, fuhr Stephen fort, der die Blicke der Schwestern richtig deutete, »aber wir arbeiten sehr hart daran, unseren Kindern einen anständigen Moralkodex mitzugeben. Wir wollen nicht, dass das alles an einem Nachmittag ruiniert wird.«
»Dann solltet ihr eure Kinder entweder selbst beaufsichtigen«, erwiderte Joanna, die solche kleinen Dispute mit ihrem Bruder liebte, »oder darauf vertrauen, dass sie den Moralkodex bereits verinnerlicht haben – zusammen mit dem selbst gemachten Müsli und dem Joghurt.«
»Nur weil wir uns für einen nachhaltigen Lebensstil entschieden haben, brauchst du dich nicht darüber lustig zu machen!«
»Doch, Schatz, das muss ich.«
»Soll ich uns Tee kochen?«, fragte Sophie, die fünf Minuten allein sein wollte. Wenn ihre ganze Familie zusammen war, dann brauchte sie immer Tee. Sekt machte Joanna streitlustig, aber da sie nicht oft nach Hause kam und es bei den Apperlys noch seltener Sekt gab, vergaß Sophie immer, dass es besser war, ihr keinen zu trinken zu geben. Tee half ihr vielleicht auch. Manchmal hatte sie das Gefühl, bei der Geburt möglicherweise vertauscht worden zu sein, weil sie so anders war als der Rest ihrer Familie. Aber da sie ihrer Mutter sehr ähnlich sah, musste sie akzeptieren, dass ihr Charakter und ihre Fähigkeiten wohl von irgendeinem Vorfahren stammten. So etwas übersprang manchmal eine Generation.
Die Caterer hatten die Küche makellos sauber hinterlassen, aber Sophie nutzte die Zeit, die das Wasser zum Kochen brauchte, um die Spülmaschine auszuräumen. Als sie fertig war und Tee aufgebrüht hatte, kehrte sie damit und mit ein paar Keksen in den Wintergarten zurück. Michael und ihre Eltern hatten sich zu den anderen gesellt, und die Stimmung stieg – sie war inzwischen geradezu bösartig.
Sophie wandte sich sofort auf dem Absatz um, murmelte: »Mehr Becher«, und zog sich zurück.
Sie kehrte mit zusätzlichen Teebechern und mehr heißem Wasser zurück, und da die anderen viel zu sehr mit Streiten beschäftigt gewesen waren, um die Kanne zu bemerken, goss sie jetzt allen ein.
»Möchte jemand Zucker?«, fragte sie laut, um sich Gehör zu verschaffen.
Plötzlich herrschte Stille. »Das müsstest du doch inzwischen wirklich wissen«, meinte Stephen, »aber die Antwort ist nein. Und ich will auch keine Kuhmilch.«
»Oh, Schatz«, sagte seine Mutter, »wir haben nur Kuhmilch.«
»Der Verzehr von Kuhmilch ist noch grausamer als der von Fleisch«, erklärte Hermine. Ihre beiden Kinder, Myrtle und Rue, hatten die Hände in den Taschen ihrer handgewebten Kleidung vergraben und waren noch ganz kleinlaut von der Strafpredigt, die sie gerade zu hören bekommen hatten. Ob die beiden dankbar dafür waren, vor einer Sünde bewahrt worden zu sein, oder man ihnen befohlen hatte, die Finger in die Taschen zu graben, konnte Sophie nicht sagen. Ihre Nichte und ihr Neffe taten ihr jedenfalls leid; den herrischen Stephen als Vater und die selbstgerechte Hermine als Mutter zu haben konnte nicht sonderlich lustig sein.
»Kekse?« Sophie reichte ihnen den Teller.
»Nein danke!«, lehnte Hermine für beide ab. »Die sind voller Zucker und Trans-Fettsäuren.«
»Also, die enthalten vielleicht Zucker, aber ich habe sie selbst gebacken – mit Butter«, erwiderte Sophie.
»Tatsächlich?«, fragte ihre Mutter. »Mit Butter? Das klingt sehr extravagant.«
»Ich nehme einen«, meinte Michael, der zweitälteste der Geschwister. »Soph backt leckere Kekse.«
Sophie lächelte.
»Du musst das wissen«, meinte Joanna. »Du isst sie ja immer alle. Wird es nicht langsam Zeit, dass du ausziehst?«
»Nein«, erklärte Michael. »Ich würde Sophies Backkünste zu sehr vermissen.«
»Schatz«, wandte ihre Mutter sich jetzt an Joanna, die diese Frage jedes Mal stellte, wenn sie zu Hause war. »Ich habe dir schon hundert Mal gesagt, dass es doch nichts bringt, wenn er irgendwo Miete zahlen muss, wo wir doch hier genug Platz für ihn haben.«
»Ich zahle Miete«, sagte Sophie leise. Sie wusste, dass es von ihrer Mutter und ihrem Vater nicht fair war, doch sie wollte sich lieber wohl in ihrer Haut fühlen, als ihren Eltern auf der Tasche zu liegen. Als sie ihrer Mutter zum ersten Mal Geld für ihre Unterbringung und Verpflegung angeboten hatte, war die Erwiderung ihrer Mutter wie immer ein vages »Danke, Schatz« gewesen. Sie hatte das Geld anschließend in eine Dose auf der Anrichte gesteckt und bat tatsächlich nie darum, aber Sophie steckte die gleiche Summe dennoch jede Woche in die Dose. Und nahm sich auch oft wieder etwas Geld heraus, um davon Glühbirnen oder Klopapier oder andere Dinge des täglichen Lebens zu kaufen.
»Das ist etwas anderes«, meinte Michael. »Du hast ja keinen richtigen Job so wie ich.«
»Aber das ist furchtbar ungerecht!« Joanna sprang ihrer Schwester zu Hilfe, allerdings eher, um ihren Bruder zu provozieren als um Sophies willen. »Sie verdient nur ein Taschengeld verglichen mit dir, und doch lebst du hier völlig umsonst!«
»Aber sie hat doch nur Jobs!«, erklärte Michael und ignorierte wie Joanna die Tatsache, dass Sophie anwesend war. »Ich mache Karriere!«
»Und sie gibt ihr Geld nur für unnützes Zeug aus«, meinte Stephen, der immer mit Michael gegen Joanna zusammenhielt. »Seht sie euch doch an! Sie sieht aus wie eine ›Wig‹ oder ›Wag‹ oder wie das heißt.«
Sophie, die sich ihre Flohmarkt- und Secondhandladen-Funde individuell herrichtete und ihr gutes Auge für Details mit ihren Nähkünsten verband, war genervt und erfreut zugleich, mit den schicken Frauen und Freundinnen der englischen Fußballstars verglichen zu werden. Sie fragte sich auch, ob ihr knappes Budget reichen würde, um ihrer Nichte Myrtle ein Abo des Heat-Magazins zum Geburtstag zu schenken. Es würde ihren Bruder in den Wahnsinn treiben, dieses »Symbol von allem, was mit dem einundzwanzigsten Jahrhundert nicht stimmt« jede Woche ins Haus geschickt zu bekommen. Joanna konnte sich das leisten – vielleicht würde sie also diese Idee weitergeben.
»Es heißt ›Wag‹, Steve«, erklärte Joanna, die wusste, wie sehr er es verabscheute, wenn jemand seinen Namen abkürzte. »Es bedeutete ›Wives and Girlfriends‹. Wenn sie uns nichts verschwiegen hat, dann gehört Sophie nicht zu diesen Frauen.«
»Ich sagte nur, dass sie wie eine ›Wag‹ aussieht, nicht, dass sie eine ist.« Stephen langte nach einem Keks, weil er in seiner Wut vergessen hatte, dass er nichts aß, das nicht organisch und aus Vollkorn war.
»Was ehrlich gesagt beweist, dass sie nicht mal schmückende Dekoration ist«, meinte Michael. »Selbstgebackenes mag vielleicht lecker sein, aber Backen ist nicht wirklich nützlich.«
»Vor allem nicht, wenn die Produkte aus Weißmehl und Raffinerie-Zucker hergestellt sind«, mischte sich Hermine ein. »Wir benutzen immer Honig statt dem ›schneeweißen und tödlichen Zucker‹. Und natürlich essen wir nur Vollkornmehl, Vollkornreis, Vollkornnudeln, gar nichts Veredeltes.«
»Eure Zahnarztrechnungen müssen horrende sein!«, meinte Joanna, die wie der Rest der Familie Hermines Ausführungen über ihre perfekte Ernährung schon zu oft hatte hören müssen.
»Wieso?«, fragte Hermine. »Es ist der Zucker, der die Zähne verrotten lässt, weißt du.«
»Ich meinte nicht, dass deine Zähne Füllungen brauchen«, erklärte Joanna. Sie hasste Hermine und gab sich nicht oft die Mühe, das zu verbergen. »Ich meinte nur, dass ständig Stücke davon abbrechen müssen, wenn ihr versucht, die zementharten Sachen zu essen, die bei euch auf den Tisch kommen.«
Sophie sah, wie ihr Bruder unbewusst mit der Zunge seine obere Zahnreihe abtastete, was zu belegen schien, dass Joanna recht hatte. Aber Sophie hatte das Gefühl, für Frieden sorgen zu müssen. »Glaubt ihr nicht, wir sollten mit dem Zanken aufhören?«, sagte sie. »Wir sind nicht oft zusammen, wir sollten uns nicht streiten.«
»Das Problem mit dir, Sophie«, entgegnete Michael, »ist, dass du den Unterschied zwischen Zanken und einer wichtigen Diskussion nicht erkennen kannst.«
»Doch, das kann ich«, gab sie sofort zurück, »und was ihr macht, nennt man ›zanken‹.«
»Ach, du hast doch von nichts eine Ahnung«, erklärte Stephen und sprang seinem Bruder zur Seite, jetzt, da die Kochkünste seiner Frau nicht länger in der Kritik standen. »Du sagst doch nie irgendetwas von Belang.«
»Das war eine ziemlich gemeine Bemerkung!«, widersprach Joanna, die hinter einer Pflanze eine halbe Flasche Wein gefunden und sich das meiste davon in ihr Glas geschüttet hatte.
»Sophie weiß, dass ich es nicht so meine. Und wir wissen alle, dass es die Wahrheit ist«, sagte Michael und klang sehr selbstgerecht. »Sophie ist ein süßes Mädchen, eine tolle Köchin, aber nicht besonders helle im Kopf.«
»Ich habe mich immer gefragt«, murmelte Sophie, »warum ihr eigentlich nie Geld habt, wo ihr doch alle so verdammt clever seid. In dieser Familie strotzen alle nur so vor Intelligenz, doch sie sind arm wie die Kirchenmäuse.«
»Das ist nicht wirklich etwas Schlechtes«, erklärte Hermine. »Materieller Wohlstand bedeutet gar nichts.«
»Es sei denn, man muss Rechnungen bezahlen«, sagte Sophie, deren Friedfertigkeit zunehmend dahinschwand.
»Wir halten unsere Ausgaben gering«, meinte Hermine und lächelte selbstgefällig. »Man kommt auch mit wenig aus, wenn man nicht süchtig nach dem Materialismus des modernen Lebens ist.«
»Ich glaube nicht, dass ich besonders materialistisch bin«, entgegnete Sophie, »aber ich denke, ihr alle seid es schon.«
Sophies Eltern und Geschwister sahen sie entsetzt an, abgesehen von Joanna, die amüsiert und erfreut über ihre Widerworte wirkte.
»Und wie kommst du darauf, Schatz?«, fragte Sonia Apperly.
»Warum sonst schickt ihr mich zum bösen Onkel Eric?«
Alle atmeten erleichtert auf. »Du weißt, warum, Schatz«, fuhr ihre Mutter fort, als müsste sie einem Kind etwas erklären, »seine Pflegerin hat Urlaub, er braucht jemanden, und du hast Zeit.«
»Verwechsle bitte nicht ›Zeit haben‹ mit ›Einspringen‹, Mum«, erklärte Sophie. »Ich werde mich dafür bezahlen lassen, und wenn es nur ein Fünfer die Woche ist. Doch das ist nicht der wahre Grund, warum ich hinfahren soll, oder?«
Als Antwort rutschten alle unbehaglich auf ihren Plätzen hin und her und sahen in ihre leeren Becher.
»Ihr schickt mich hin, weil ihr hofft, dass ihr dadurch an sein Geld kommt.«
Noch immer vermieden die anderen es, sie anzusehen.
»Es ist wahr!«, beharrte Sophie. »Ihr seid alle hinter seinem Geld her.«
Joanna holte eine Zigarette aus ihrer Tasche. »Ich glaube, der korrekte technische Ausdruck dafür ist ›Umverteilung von Geldern‹.«
»Das hat keine egoistischen Gründe, Schatz«, erklärte ihre Mutter freundlich. »Wir brauchen Geld, um das Dach zu reparieren, und Onkel Eric hat jede Menge davon.«
»Das wisst ihr nicht«, protestierte Sophie und hoffte, dass nicht von ihr erwartet wurde, in seinen Bankunterlagen herumzuschnüffeln.
»Doch, wissen wir wohl«, sagte ihr Vater, der sich bis jetzt herausgehalten, seinen Whiskey getrunken und die Darbietung leicht amüsiert verfolgt hatte. »Ich kenne das Testament seines Vaters. Der alte Mann ist stinkreich.«
»Und hat niemandem, dem er das Geld hinterlassen könnte.«
»Abgesehen davon, dass es möglich ist, dass Eric das ganze Vermögen seines Vaters ausgegeben hat, finde ich, dass ihr warten könntet, bis er tot ist, um es in die Hände zu kriegen«, fuhr Sophie fort. »Obwohl ich ihn nicht für euch vergiften werde, nehme ich mal an, dass er nicht mehr allzu lange leben wird.«
»Wir können nicht sicher davon ausgehen, dass er der Familie Geld hinterlässt«, meinte Sonia. »Er vererbt es vielleicht einem Heim für streunende Katzen oder so etwas.«
»Das ist sein Vorrecht«, erwiderte Sophie und beschloss sofort, ihrem Verwandten verschiedene gute Zwecke vorzustellen und ihn darin zu bestärken, ihre geldgierige Familie zu enterben.
»Wir brauchen das Geld dringender als ein Katzenheim«, erklärte Stephen.
»Ich dachte, du …«, setzte Sophie an.
»Oh, sei nicht albern! Ich will mit dem Geld eine eigene natürliche Kläranlage für unser Haus bauen«, fuhr ihr Bruder sie an.
»Igitt!«, rief Joanna.
»Ja, Sophie, sei nicht albern«, fügte ihre Mutter hinzu und ignorierte Joanna. »Und es ist sehr egoistisch von dir, dass du deiner Familie nicht helfen willst.«
»Oh, Herrgott noch mal!« Sophie sortierte ihre Beine und stand von ihrem Platz auf dem Boden auf. »Ihr seid unglaublich! Ihr macht euch über mich lustig, weil ich nur einen ›kleinen Halbtagsjob‹ habe; ihr beschwert euch, dass die Sachen, die ich backe, nicht ›nützlich‹ sind, obwohl ihr euch alle sehr gern damit vollstopft – selbst du, Stephen. Keiner von euch will auch nur einen Finger krumm machen, um Onkel Eric zu helfen …«
»Na ja, er wird ja auch nicht umsonst ›böse‹ genannt«, fiel Joanna ihr ins Wort.
»Und ihr erwartet von mir nicht nur, dass ich mich um ihn kümmere, sondern auch noch, dass ich ihm für euch Geld aus der Tasche ziehe.«
»Sehen wir den Tatsachen ins Auge«, sagte Michael. »Du hast doch sonst nichts zu tun.«
In diesem Moment beschloss Sophie, dass sie etwas anderes zu tun haben würde. Sobald sie sich nicht mehr um Onkel Eric kümmern musste, würde sie nach New York fliegen und Milly besuchen. Das hatte sie schon immer tun wollen; und ihre Familie hatte es gerade sozusagen zu einer Notwendigkeit gemacht.
»Das könnte sich ändern«, erklärte sie und zog, während sie das Zimmer verließ, ihr Handy aus der Tasche.
»Milly? Du hast doch gesagt, dass du mir in New York vielleicht einen Job besorgen kannst? Könntest du das wirklich? Aber selbst wenn du es nicht schaffst, komme ich! Ich glaube, wenn ich nicht bald von meiner Familie wegkomme, werde ich noch verrückt!«
3. Kapitel
Der Zug fuhr vielleicht nur nach Worcester, doch während der gesamten Fahrt zu Onkel Eric dachte Sophie darüber nach, wie es sein würde, nach New York zu reisen. Sie, Milly und Amanda hatten sich immer zusammen Friends und Sex and the City angesehen und davon geträumt, solche Schuhe zu tragen wie die Heldinnen, in solchen Läden einzukaufen und in solchen Bars etwas zu trinken. Sie hatten auch darüber spekuliert, solche Männer zu treffen, aber da die Heldinnen in beiden Serien nur mit Typen auszugehen schienen, die attraktiv waren, jedoch auch irgendein Handicap hatten, wie schwul zu sein, hatten die drei Freundinnen ihre Tagträume auf materiellere Fantasien beschränkt.
Und seit Milly in New York arbeitete (ohne Sophie und Amanda! Wie konnte sie es wagen!), hatten die beiden Daheimgebliebenen einen Besuch dort geplant, um ihren Traum – wenn auch nur für ein paar Tage – zusammen auszuleben.
Aber Geldknappheit, andere Verpflichtungen und vermutlich gesunder Menschenverstand hatten sie immer davon abgehalten, tatsächlich zu fliegen. Doch nach ihrem Arbeitsauftrag bei Onkel Eric würde sie das Geld für den Flug haben.
Es würde ihrer Familie guttun, mal ohne sie auskommen zu müssen, beschloss sie und sah aus dem Zugfenster, ohne die dahinfliegende Landschaft wirklich zu registrieren. Sie hielten ihre Hilfe für völlig selbstverständlich. Erst wenn sie nicht mehr da war, um all die vielen Aufgaben zu erledigen, die im Haushalt anfielen (wie das Austauschen von Glühbirnen, die kleineren Reparaturen, die Botengänge), würde ihren Eltern und Michael klar werden, was sie an ihr hatten. Und sie würde etwas aus ihrem Leben machen, damit sie endlich sahen, dass sie nicht nur ein hübsches Gesicht hatte und gut mit Nadel und Faden umgehen konnte!
Sophie dachte nach. Es würde besser sein, wenn sie es nach New York schaffte, ohne gleich all ihre Ersparnisse ausgeben zu müssen. Sonst würde sie nach dem Urlaub wieder ganz von vorn anfangen müssen mit dem Sparen für ihren Kurs.
Sie konnte sich noch immer nicht entscheiden, welcher Kurs es sein würde. Idealerweise sollte er sowohl Nähen als auch Zuschneiden beinhalten und zusätzlich Modetrends und Buchführung behandeln, damit sie sich tatsächlich aus dem, was sie liebte – Artikel vom Flohmarkt in spleenige, interessante Klamotten zu verwandeln –, eine Existenz aufbauen konnte. Eines Tages würde sie ihre Familie dazu bringen, zuzugeben, dass sie sehr intelligent war und dass ihre praktischen Fähigkeiten viel nützlicher waren als all die akademischen Fähigkeiten ihrer Eltern und Geschwister zusammen.
Als der Zug in den Bahnhof rollte, war Sophie voller Elan – sie würde nach New York gehen, nur einmal an sich selbst denken und ihrer Familie Zeit zum Nachdenken geben. Sie schulterte den Rucksack, blickte auf die Karte, die sie aus dem Internet ausgedruckt hatte, und machte sich, wild entschlossen, sich zu bessern, auf den Weg zu Onkel Erics Haus.
Zu ihrer beider Überraschung war es bei Sophie und Onkel Eric fast Liebe auf den ersten Blick. Onkel Eric hatte angenommen, Sophie würde wie der Rest ihrer Familie sein, die er für faul und geldgierig hielt. Er hatte Sophie nur als Urlaubsvertretung für seine Haushälterin akzeptiert, weil es ihm die Mühe ersparen würde, nach einer besser geeigneteren Kandidatin zu suchen.
Sophie war davon ausgegangen, dass er schrullig, festgefahren in seinen Angewohnheiten und »böse« sein würde, so wie ihre Familie ihn beschrieben hatte, obwohl sie sich schon bald fragte, wieso sie das geglaubt hatte. Ihre Familie lag bei Dingen, die wirklich zählten, extrem oft falsch. Doch schon in dem Moment, in dem der alte Mann Sophie, die eine enge Jeans trug und ihr Haar zu einer Art Nest nach oben gesteckt hatte, die Tür öffnete, erkannte sie, dass er vielleicht eingefahren und möglicherweise auch ein bisschen gelangweilt, jedoch ganz sicher nicht böse war. Sophie, die eine Kombination aus Fagin und Scrooge, den beiden bekannten Figuren von Charles Dickens, erwartet hatte, sah einen freundlichen alten Mann in einer schäbigen, aber gut sitzenden Anzughose, einer Strickjacke mit einem Loch und einer Krawatte, die dringend gebügelt werden musste. Sie wollte dieses Loch sofort stopfen – wenn nicht im wörtlichen, dann doch im emotionalen Sinne. Onkel Eric brauchte ihre praktischen Fähigkeiten, und sie beschloss, dass er in ihren Genuss kommen würde.
Er führte sie ins Wohnzimmer und reichte ihr ein Weinglas voll mit Sherry. »Das wirst du brauchen, meine Haushälterin wird dir eine lange Liste mit Anweisungen geben, wie ich meinen Tagesablauf gern organisiert habe.« Er seufzte. »Ich bin aber nicht sicher, ob sie das wirklich weiß.«
Sophie nahm einen Schluck Sherry, der ihr, wie sie feststellte, schmeckte, und suchte dann nach Mrs. Brown, die ihr, wie vorausgesagt, einen Stundenplan und eine mehrseitige Liste mit Instruktionen gab.
Sophie überflog die Seiten und blickte dann auf. »Hier ist gar nicht von Bewegung die Rede. Kann mein Onkel das Haus verlassen? Ohne Hilfe laufen?«
Mrs. Brown nickte. »O ja, aber er liest lieber die Zeitung und hört Radio. Und er mag einfaches Essen. Nichts Aufwendiges. Gute Hausmannskost, so wie ich sie ihm immer zubereite. Ich weiß, was alte Leute gernhaben.«
Sophie hatte keine Ahnung, was alte Leute gernhatten, doch sie wusste, dass sie ein so eingeschränktes Leben nicht gern führen würde. Vielleicht brauchte Onkel Eric ein bisschen Abwechslung. Sie nahm versuchsweise noch einen Schluck Sherry.
Man zeigte ihr ein Schlafzimmer mit einem Bett, über dessen Federbett eine Paisley-Decke gebreitet war. Es gab ein Bücherregal voller alter Bücher von Autoren, von denen Sophie noch nie gehört hatte: Ethel M. Dell, Jeffery Farnol und Charles Morgan. Ein silbernes Schminktischset, zu dem ein Handspiegel, eine Bürste, eine Kleiderbürste und ein Kamm gehörten, lag vor einem dreiteiligen Spiegel, an dem ein kleines Papphütchen hing, das Sophie als Haarfänger erkannte – etwas, in das man die Haare stecken konnte, die man aus der Bürste entfernte. Es war hübsch und gefiel Sophie, die altmodische Dinge liebte, vielleicht weil sie selbst auch irgendwie altmodisch war. Als sie schlafen ging, kuschelte sie sich in das Bett, das nicht die bequemste Matratze hatte, und fing an, eines der Bücher zu lesen. Nach zwei Zeilen beschloss sie, doch lieber direkt zu schlafen.
Mrs. Brown kam am Morgen noch einmal vorbei, um sicherzugehen, dass Sophie auch wirklich wusste, was sie zu tun hatte.
Sie erklärte, offensichtlich schuldbewusst, weil sie den lange überfälligen Urlaub nahm: »Ich arbeite schon sehr lange für Mr. Kirkpatric, aber als meine Tochter mich bat, sie zu besuchen, wollte ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Meine Tochter meint, dass zwei Wochen eigentlich nicht lang genug wären, doch mir reicht es. Ich lasse Ihren Onkel nicht gern allein.«
»Wir kommen schon zurecht«, erklärte Sophie entschieden. »Genießen Sie Ihre Reise. Ich verspreche, dass ich mich um ihn kümmere und Sie ihn in perfektem Zustand zurückbekommen.«
»Er bekommt Porridge zum Frühstück.«
»Ich weiß. Das steht auf der Liste. Sie haben mich ganz hervorragend instruiert. Onkel Eric und ich schaffen das schon.«
Mrs. Brown war noch nicht überzeugt. »Die Nummer der Agentur steht unten auf der letzten Seite. Ich wollte eigentlich gern jemanden mit einer entsprechenden Ausbildung kommen lassen, doch Mr. Kirkpatric wollte die Agentur und das Gehalt nicht zahlen. Er ist sehr sparsam.«
Da ihre Familie ihn als einen gemeinen alten Geizkragen beschrieben hatte, überraschte Sophie das nicht. »Wir kommen sicher zurecht. Ich bin auch sparsam.« Es gelang ihr, Mrs. Brown hinauszukomplimentieren, und winkte ihr fröhlich von der Haustür aus nach.
Sie betete leise, dass nichts schiefging und Onkel Eric nicht stürzte und sich den Oberschenkelhals brach oder so etwas. Dann ging sie zu ihrem Onkel, um mit ihm zu sprechen.
Porridge (mit Wasser gekocht, kein Zucker, nur ein bisschen Milch, er darf nicht nachsalzen!) Laut Liste sollte Sophie ihm das vorsetzen, aber als sie es Onkel Eric erzählte, der bereits die Zeitung im ganzen Wohnzimmer verteilt hatte, wirkte er nicht begeistert.
»Lieber Müsli? Ich habe was mitgebracht.«
»Großer Gott, Kind! Willst du mich umbringen? Müsli wurde von Zahnärzten erfunden, um das Geschäft anzukurbeln! Da sind diese verdammten Nüsse drin, die die stärksten Zähne zerbrechen. Verfüttere das Zeug an die Vögel!«
»Okay, was möchtest du dann? Toast? Vielleicht mit Rührei?«
Ein sehnsüchtiger Ausdruck huschte über Onkel Erics faltiges Gesicht. »Gekochte Eier mit Brotstreifen zum Eintauchen?«
Sophie verzog das Gesicht. »Ich versuche mein Bestes, aber es ist sehr schwer, die Eier genau richtig zu kochen. Sollten sie doch zu hart werden, können wir ja Eiersandwiches zum Abendbrot essen.«
Da es Sophie gelang, die beiden Frühstückseier für Onkel Eric genau richtig zu kochen, gab es von da an jeden Morgen gekochte Eier mit Brotstreifen.
Sophie musste ihrem Onkel vier kleine Mahlzeiten am Tag zubereiten, dafür sorgen, dass er seine Medikamente nahm, und ein bisschen putzen, aber das dauerte nicht den ganzen Tag. Wenn das Wetter gut war, erkundete sie die Gegend und suchte nach Secondhandläden und Cafés; wenn nicht, räumte sie, einfach weil es ihr Spaß machte, ein bisschen das Haus auf. Begleitet von Radio Four – dem einzigen Radiosender, den Onkel Eric erlaubte –, ging sie die versteckten Ecken des Hauses durch, räumte Schränke aus, wusch und sortierte, säuberte und ordnete die Sachen neu. Am Ende der ersten Woche hatte sie alle Schränke auf Vordermann gebracht und genug Nippes gefunden, um damit einen kleinen Laden auszustaffieren. Da Onkel Eric ihr nicht erlaubte, die Sachen auf dem Flohmarkt zu verkaufen, wollte sie sich als Nächstes seinen chaotischen Schreibtisch vornehmen.
Sie war bereits seine Garderobe durchgegangen, hatte seine Lieblingsstrickjacke gestopft (und hatte betont, dass sie eine der ganz wenigen Frauen ihrer Generation war, die wusste, wie man Kleidung und Wäsche ausbesserte), die Tasche wieder an seinen Bademantel und ein Fleecefutter in seine Hausschuhe genäht.
Abends beim Essen unterhielten sie sich, und auch danach saßen sie immer noch zusammen. Sophie wollte von ihrem Onkel alles »von früher« wissen, bis es ihm zu langweilig wurde zu erzählen; dann befragte er sie über ihr Liebesleben.
»Also, junge Sophie, du siehst ziemlich gut aus, deshalb nehme ich an, dass du einen Burschen hast?«
Sophie brauchte einen Moment, bis ihr klar wurde, was er meinte. »Oh, du willst wissen, ob ich einen Freund habe? Nein, im Moment nicht. Gott sei Dank.« Sie dachte einen Augenblick lang an Doug, ihren besonders anhänglichen Ex, schob den Gedanken jedoch schnell wieder beiseite.
»Ich dachte, Frauen würden sich gern von Männern zum Tanzen oder zu einem Picknick und solchen Dingen ausführen lassen.«
»Na ja, das würde ich, aber meine bisherigen Freunde haben so etwas leider nie getan. Wenn überhaupt bekam ich ein halbes Bier in irgendeiner düsteren Kneipe.« Sie seufzte. »Ich scheine furchtbar langweilige Kerle anzuziehen.« Dann dachte sie nach. »Obwohl meine Freundinnen meinen, es läge daran, dass ich zu weich bin und den Männern nicht sage, sie sollen sich verpi … dass ich sie nicht zum Teufel schicke. Wenn sie mich zu irgendetwas einladen, sage ich immer Ja und gehe mit, ob ich will oder nicht.«
»Das klingt völlig verrückt! Und verdammt langweilig!«
»Ja, das war es. Schrecklich langweilig. Deshalb werde ich auf jeden Fall erst einmal Single bleiben. Ich habe viel mehr Spaß mit meinen Freundinnen als mit den meisten Männern, die ich kenne.«
»Dann kennst du offensichtlich nicht die richtigen.«
»Ja, so wird’s sein. Du bist nicht der Erste, der das sagt.«
»Hm. Und was tun dein Vater und deine Brüder dagegen? Sorgen Sie dafür, dass du die ›richtigen‹ Männer triffst?«
Sophie hätte vor Entsetzen und Hysterie beinahe laut aufgelacht, als sie sich vorstellte, dass einer ihrer männlichen Verwandten vielleicht versuchen könnte, einen passenden Partner für sie zu finden. Sie nahm einen großen Schluck Tee, um sich zu beruhigen.
»Das war dann wohl ein Nein, oder? Tja, da hast du ja noch mal Schwein gehabt!«
»Onkel Eric!« Sophie schmunzelte. »Das ist eine ziemlich saloppe Formulierung!«
Onkel Eric sah sehr zufrieden aus. »Ich versuche, mit der Zeit zu gehen.«
»Nein, tust du nicht!«, sagte Sophie und tätschelte seine Hand. »Du schockierst die Leute nur gern, genau wie ich.«
»Ich habe alle Sachen, die auf dem Kaminsims stehen, geputzt und wieder hingestellt«, meinte Sophie später, nachdem Onkel Eric von seinem »Verdauungsschläfchen«, wie er es nannte, aufgewacht war. »Was kann ich jetzt noch tun?«
»Mein Gott, Kind, du musst ständig unterhalten werden! Was ist los mit dir? Mrs. Dings muss nicht andauernd irgendetwas tun!« Onkel Eric versuchte, verärgert zu wirken, aber Sophie ließ sich nicht täuschen. Er genoss es, dass sie sein eintöniges Leben durcheinanderwirbelte. Sophie war erst eine Woche hier, doch der Effekt war bereits sichtbar, sowohl an Onkel Eric als auch im Haus.
»Mrs. Dings – ich meine, Mrs. Brown – kann Langeweile offenbar gut aushalten.«
Dieses Mal sah er verletzt aus. »Einige Leute empfinden es als sehr befriedigend und erfüllend, sich um einen älteren Gentleman zu kümmern. Es ist ein Privileg, in meinem wunderschönen Haus zu wohnen! Das solltest du übrigens umsonst tun!«
»Natürlich ist es ein Privileg, deine Pillen abzuzählen und dafür zu sorgen, dass du es mit dem Kaffee am Abend nicht übertreibst und nicht die Treppe hinunterfällst, doch mir reicht das nicht. Und dein Haus ist groß, aber es ist nicht wunderschön! Du solltest mir mehr bezahlen, weil ich immer so weite Wege habe. Und da du das nicht tun willst, solltest du nichts dagegen haben, wenn ich mir noch eine Beschäftigung suche.« Sie hielt inne. »Ich könnte deinen Schreibtisch aufräumen, wenn du willst.«
»Nur über meine Leiche! Ich werde auf gar keinen Fall zulassen, dass ein junger Irrwisch meine wertvollen Dokumente durcheinanderwirft, der dessen Bedeutung gar nicht versteht!«
Sophie blieb gelassen. »Ich werde nichts wegwerfen. Ich sortiere alles und lege es auf Stapel. Dann kannst du die Papiere durchsehen und sie aufheben oder wegwerfen oder sogar verbrennen.« Sie lächelte ihm aufmunternd zu. »Das wäre vermutlich gar keine schlechte Idee. Dann hast du es warm, bis du deinen Heizkostenzuschuss erhältst.« Ihr Großonkel zog ein Gesicht, das sie ermutigte weiterzureden. »Schließlich kann da ja nichts Aktuelles liegen, da die Papiere alle mit Staub bedeckt sind. Und der Rest des Zimmers ist ziemlich aufgeräumt. Der Schreibtisch stört das Gesamtbild.«
Er räusperte sich, runzelte die Stirn und schnaubte, aber dann sagte er: »Oh, also gut, Kind, wenn’s sein muss. Doch du musst mir versprechen, dass du die Papiere nicht liest, sondern nur sortierst.«
Onkel Eric trug an diesem Abend eine Strickjacke mit zahlreichen Mottenlöchern, die Sophie wirklich gern weggeschmissen hätte, aber von der er sich partout nicht hatte trennen wollen. Als sie diese jetzt betrachtete, weckte das ihren Widerspruchsgeist. »Ich kann sie nicht sortieren, wenn ich sie nicht lesen darf. Sei nicht albern, liebster Onkel Eric.« Sie benutzte den Kosenamen, den sie ihm gegeben hatte, damit sie ihn nicht aus Versehen »böser Onkel Eric« nannte.
Er seufzte, da er seinen symbolischen Protest schon aufgegeben hatte. »Mach doch, was du willst, Kind, genau wie immer.«
»Ich habe meinen iPod für dich aufgegeben, oder nicht?«, meinte Sophie. »Ich höre inzwischen nur noch Radio Four.« Sie genoss es inzwischen sogar, weil sie dabei Dinge aufschnappte, die sie sonst niemals erfahren hätte, aber das wollte sie ihm nicht gestehen. Ihr Spiel bestand darin, auf dem jeweiligen Standpunkt zu beharren.
»Du meinst diese Maschine, die so komisch summt? Du solltest mir dankbar sein.«
»Mein iPod summt nicht, wenn man die Kopfhörer im Ohr hat, dann hört man Musik. Vielleicht sollte ich dir einen besorgen?«
Eric schnalzte abschätzig mit der Zunge. »Ich werde jetzt schlafen gehen und vielleicht noch ein Kreuzworträtsel beenden.«
»Soll ich dir den Heizlüfter anstellen?«
»Ich bin durchaus in der Lage, einen Schalter umzulegen«, fuhr er sie an. »Ich bin noch nicht senil.«
Sophie schenkte ihm das strahlende Lächeln, auf das er wartete. »Oh, gut. Wenn ich hier fertig bin, helfe ich dir bei den Lösungen.«
»Ha!«, meinte Onkel Eric verächtlich und trottete hinaus.