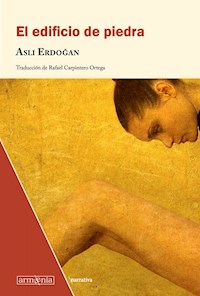14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Aslı Erdoğans wichtigster Roman endlich auf Deutsch
»Haus aus Stein« ist nicht nur der wichtigste Text im Werk der gefeierten türkischen Schriftstellerin Aslı Erdoğan. In diesem symphonisch komponierten Roman über Gefangenschaft und den Verlust aller Sicherheiten nimmt sie auch auf erschütternde Weise die eigene Gefängniserfahrung vorweg. »Was hatte ich hier zu suchen? Was war übrig von einem Ich?«, fragt einer der Protagonisten. Ein anderer wird freigelassen, doch was in der Haft geschehen ist, bleibt unsagbar, und er verfällt allmählich dem Wahnsinn. Aslı Erdoğan folgt mit ihrer poetischen dunklen Sprache den tiefen Narben, die eine Begegnung mit dem »Haus aus Stein« hinterlässt. Ihren in der Türkei bereits 2009 erschienenen Roman ergänzt sie durch einen eigens für diese Ausgabe verfassten Essay über die Monate, die sie 2016 nach dem gescheiterten Militärputsch willkürlich im Frauengefängnis Bakırköy-Istanbul inhaftiert war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Ähnliche
»Haus aus Stein« ist nicht nur der wichtigste Text im Werk der gefeierten türkischen Schriftstellerin. In diesem symphonisch komponierten Roman über Gefangenschaft und den Verlust aller Sicherheiten nimmt sie auch auf erschütternde Weise die eigene Gefängniserfahrung vorweg. Erdoğan folgt in ihrer poetischen, dunklen Sprache den tiefen Narben, die eine Begegnung mit dem »Haus aus Stein« hinterlässt. Den in der Türkei 2009 erschienenen Roman ergänzt ein eigens für diese Ausgabe verfasster Beitrag der Autorin über die Monate, die sie 2016 nach dem gescheiterten Militärputsch willkürlich im Frauengefängnis Bakırköy-Istanbul inhaftiert war.
Aslı Erdoğan, geboren 1967 in Istanbul, ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der Türkei und weltweit Symbolfigur für den Widerstand gegen die Willkürherrschaft in ihrer Heimat. Ihre literarischen Werke (u. a. »Die Stadt mit der roten Pelerine«) sind in über 20 Sprachen übersetzt, Erdoğans Arbeit wurde mit einer Vielzahl von Preisen geehrt: 2010 erhielt sie den bedeutendsten Literaturpreis der Türkei, 2017 den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis und 2018 den Prix Simone de Beauvoir.
»Eine außergewöhnlich feinfühlige und scharfsichtige Autorin, ihre Romane sind Meisterwerke.« Orhan Pamuk
»Asli Erdogan hat eine wunderbare überbordende Vorstellungskraft. Sie ist ein Ausnahmetalent und lehrt uns alle, was schriftstellerischer Mut bedeutet.« Ian McEwan
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
ASLIERDOĞAN
Das Hausaus Stein
Roman
Aus dem Türkischen von Gerhard MeierMit einem Vorwort der Autorin zur deutschen Erstausgabe
DIEMASKENDESOSIRIS
Vorwort zur deutschen Erstausgabe von »Das Haus aus Stein«
Um Polemiken und Schadenersatzforderungen vorzubeugen, schützen sich Filmproduzenten gerne durch folgenden Satz im Abspann: »Die Personen und die Handlung dieses Films sind frei erfunden.« Bei mir könnte als Fußnote stehen: »Die Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Nur das Haus aus Stein ist echt. Nur die Hölle ist echt.«
Buchenwald, 2008. Mir ist sehr kalt. Ich bibbere in meiner dünnen Samtjacke. In Deutschland ist der Winter noch nicht vorbei, und in Buchenwald schneit es. Mir ist, als würde mir eine ganz besonders heimtückische Kälte das Rückenmark hinaufkriechen und mich mit Eiswürfeln anfüllen. Um sechzehn Uhr, auf die Minute genau, schließt das Museum, und im Schneegestöber verlassen sowohl Museumsangestellte als auch Besucher geradezu fluchtartig die Gedenkstätte. Ich stelle mich an der Tür unter, will weder gehen noch bleiben, und starre auf das riesige, rasch im Dunkel versinkende Gelände. Im Schnee erblicke ich einen hochgewachsenen Mann, mit einem Gesicht wie eine zerfasernde Papiermaske, seine Lippen zittern, wortlos steht er da. Als hätten seine Augen die Fähigkeit zu sehen verloren, jedoch eine andere, tiefere Fähigkeit gewonnen, blickt er ins Leere, ins triste Dunkel. Vielleicht sind hier Angehörige von ihm ums Leben gekommen. Als ich mir eine Zigarette anzünde, bemerkt er mich, wendet sich mir zu, als wollte er mir zu verstehen geben, dass das hier verboten sei. Er sieht mir in die Augen, als blickte er in einen Spiegel, dann zündet auch er sich eine Zigarette an.
Wenn im Gefängnis ein neuer Morgen heraufzog, der nichts anderes versprach als wieder Schläge, wieder Demütigungen, wieder Qual, nichts als die Wiederholung des Tages davor, das endlose Gekrächze aus dem Lautsprecher, das Durchzählen und Schlüsselgeklirr, kamen wir im Hof zusammen, ein paar Frauen, bald nass vom Regen, der von oben durch den elektrischen Stacheldraht tropfte, rückten an einer Mauer ganz nah aneinander, und ohne zu reden rauchten wir die erste Zigarette des Tages. Unsere geleerten Aschenbecher gleichenden Augen waren mal auf den Steinboden gerichtet, mal auf den leeren Himmel. Tief atmeten wir ein. Als sögen wir reinen Sauerstoff ein, oder reinen Tod.
Als ich zu Anfang der Achtzigerjahre zum ersten Mal das furchtbarste Folterzentrum von Istanbul betrat, das berüchtigte Sansaryan Han, saßen dort nicht mehr nur politische Gefangene ein. Man schaffte nun auch hartgesottene Kriminelle dorthin, blutig geschlagen meist, nachdem man sie auf dem Polizeirevier weder durch Prügel noch durch Stromschläge zu einem Geständnis hatte bringen können. Als ich den mit Stacheldraht umgebenen Hof und die Jugendlichen sah, die man soeben auf die Fußsohlen geschlagen hatte, war ich selbst noch fast ein Kind (ein Kind aber, das Dostojewski las). Keine der »härteren« Erfahrungen, die ich später im Leben machte, weder die rosenfarbene Polizeistation, die ich in »Die Stadt mit der roten Pelerine« beschrieb, noch die Zellen im Gefängnis von Bakırköy erfüllten mich mit solchem Entsetzen wie das Sansaryan Han. Es war gewiss nicht meine erste Begegnung mit dem »Furchtbaren«, aber zum ersten Mal gewahrte ich voller Beschämung, dass das »Furchtbare« vollkommen »echt« sein konnte.
In seiner frühen Entstehungsphase, als der Ich-Erzähler sich allmählich zu einem bestimmten Charakter, einem Opfer nämlich, entwickelte, war »Das Haus aus Stein« eine Erzählung von gerade mal drei Seiten. Das Haus umfasste, wie das Sansaryan Han, vier Stockwerke. In den folgenden zehn Jahren erfuhr das Gefängnis in meinem Kopf eine Aufstockung um eine Etage, ähnlich wie sich auch in Primo Levis Gedächtnis die Baracken von Auschwitz wandelten.
Schwer, noch einmal davon zu reden. Nach all den Zellen, den vielen Schlägen, den Verlusten des Lebens. Aus der bitteren, harten, qualvollen Erfahrung heraus zu sprechen, dass man zum Schweigen gebracht wurde. Das scharfe, unsichtbare Messer, das die Worte aushöhlt, hat ihnen auch die Zungen abgeschnitten und die Augen ausgestochen. Sie wissen von Anfang an, dass sie auf dem Weg, auf den man sie gesetzt hat, verloren gehen werden, und so ziehen sie durch die Kreise, die Zellen, die Verluste des Lebens und kehren an den einzigen Ort zurück, an den sie noch zurückkehren können.
Worte: trocken und nackt. Ein Gefäß, eine Maske. Eine Handvoll Erde, genau wie in meinem Inneren.
Vielleicht müsste ich mich aufrichten, mich aus dem Brunnen des Gedächtnisses herausziehen, einen Schritt auf die Geschichte zugehen, die auf mich wartet. Sie wartet stumm auf mich, sieht mich aus nur halb geöffneten Augen an. Als blickte sie in einen Spiegel. Um auf sie zugehen zu können, muss ich auf schwarzen Schnee treten.
»Das war mein letztes Blatt. Ich möchte aber noch mehr schreiben.« (Aus dem Brief eines Häftlings.) Wer ins Gefängnis kommt – oder »fällt«, wie es im Türkischen wörtlich heißt –, hat diesen ersten Wunsch, und es ist auch der letzte Wunsch des zum Tode Verurteilten: ein Blatt Papier und ein Stift.
Der Mensch, die sprechende Materie. Das erzählende Wesen. Das Wesen, das unentwegt Sinn produziert, Worte, Geschichten. Dazu verurteilt, in sich nach einem Wort, einem Bild zu suchen. Seit ihm der Horizont durch das Bewusstsein um seine Sterblichkeit vermauert ist, sucht der Mensch nach dem ersten verlorenen Wort und bemüht sich, in seiner eigenen Geschichte zu existieren.
Der »Ich-Erzähler« im »Haus aus Stein« erzählt von zwei Enden her, die ineinander übergehen. Der gedächtnislose »A.«, dem seine Geschichte gestohlen wurde, appelliert an die »Menschheit«, die ihn aus dem Menschheitspanorama fortgewischt hat. Indem er in ein Schaufenster steigt, sich dort verkleidet und Reden schwingt, ist er eine Metapher für das Schreiben. Der sämtliche Figuren in sich vereinende Schriftsteller wiederum ist aus der Welt, von der er erzählt, vertrieben worden, aus der Welt der »Verdammten«, aus seiner eigenen Geschichte also.
Von sich selbst erzählen … Bedeutet dies hartnäckiges Reden, auf der Suche nach einem »Ich«, in dessen dunklen Riesenschatten wir uns flüchten können? Bedeutet es den Verlust der Unschuld, einen hinausgeschobenen Selbstmord, eine Provokation gegenüber der Welt? Befreiung, oder vielmehr Gefangenschaft, die den Wunsch nach Freiheit erst weckt?
Diese Fragen stelle ich dem leeren Grabmal, das ich aus Worten gebildet habe.
(Dieses Buch ist ein aus Worten geschaffenes Grabmal, eine Klage um einen wirklichen Toten, ein stets unvollendet bleibender Abschied.)
Wer war der Tote? Und auf welcher Seite des Todes steht die Schreibende?
Man-selbst-Sein ist gleichbedeutend mit sterben. Erst durch den Tod werden wir »einzig«, werden auf unabänderliche Weise zu unserer eigenen Geschichte. Der Augenblick absoluter Vereinigung ist auch der Augenblick absoluten Zerfalls. Das Verschmelzen des Ich mit dem anderen, des Erzählers mit dem Erzählten, des Bildes mit dem Blick darauf.
Der Text muss dem Tod gegenüber stets eine Maske tragen.
»Ich bin alles, was gewesen ist und was sein wird, und kein Sterblicher hat je mein Gesicht ohne Maske gesehen« steht in einem Osiris-Tempel. Osiris ist der Gott des Todes und der Wiederauferstehung, wie Dionysos. Auch Dionysos trägt stets eine Maske und erscheint mal als Mann, mal als Frau. Er ist der Gott des Wahnsinns, der stets stirbt und stets wiederaufersteht. Beides sind gestürzte Götter.
Worte: zerkaut, zerfasert, von Dunkel und Schweigen geknetet. Brausend, furchtbar …
Worte, die einander zum Echo werden, einander wiederholen, verleugnen. Der Schmerz, der nach seiner Stimme sucht, die Stimme, die nach ihrem Bild sucht. Die Stimme, die an eine Welt appelliert, die längst verloren oder noch gar nicht geboren ist, an zahllose Welten. Linien und Kreise, die spitze Winkel vereinen und das Schicksal der Menschen bilden, Tausende von Geschichten, ein Tod, der nicht gezählt wird … Blut, das aus den Grenzen des Körpers austritt und in der Sprache dahinfließt … Ein Text, der so lange ans Nichts schlägt, bis er zerbirst … Dann geduldig die Teile von Neuem zusammensetzen … Von vorne anfangen, es noch einmal versuchen. Einen Schritt auf das Unerzählbare hin tun, wieder einen Schritt zurücktreten, die Flugbahn ändern, wieder einen Kreis zeichnen … Bis ein Widerhall ertönt …
Ich ging meinen Weg weiter. Wie ein Phantom, das entschlossen ist, in der Wirklichkeit Gestalt anzunehmen, tastete ich mich im Dunkel zwischen Trümmern voran. Ich musste bis zum Ende dieses Verderbens, dieser Einsamkeit gelangen. Eine Karte brauchte ich nicht mehr, mit schlafwandlerischer Sicherheit fand ich nacheinander die Baracken, die Semprun in seinen Romanen beschrieben hatte. Jene Baracken, vor etwa sechzig Jahren abgerissen, heute nur in Umrissen zu erkennen, voller Gedenksteine. Ich zog meine Kreise, ging auf und ab, ermaß das riesige Lager von einem Ende zum anderen, als würde ich mit jedem Schritt mehr zu einer Gefangenen, die Buchenwald nicht mehr verlassen kann. Um herauszukommen, musste ich das Ich, das ich dort fand, zurücklassen, der Nacht überlassen.
Ein Wort, das ich nur verwende, weil ich mir anders nicht zu helfen weiß: »Ich«. Ein Gefäß, eine Maske, mehr nicht. Ein Zahn, an den die Töne schlagen, um herauszukommen, ein dünnes, hartes Häutchen, ein Knochen. Ein endlos weites Schlachtfeld, auf dem das Gesagte mit dem Tod des Ungesagten kämpft. Wo die Stehengebliebenen ebenso still verrotten wie die zu Boden Gestürzten. Wo der Mensch zu Staub wird und der Staub zu Mensch.
»Die anderen« kann ich zu dieser Hölle nicht sagen …
Als ich zur Haltestelle ging, um den letzten Bus zu nehmen, spürte ich die Kälte nicht mehr. Die innere und die äußere Temperatur schienen identisch zu sein. Falls ich das stundenlange Herumrennen im Schnee lediglich mit einer Lungenentzündung bezahlen sollte, durfte ich mich glücklich schätzen. Die Tür des mit grellen Scheinwerfern eintreffenden Busses öffnete sich für die letzte Besucherin des Lagers. Und schloss sich wieder.
Als ich erneut hinfuhr, hatte ich nur ein Ziel: die Rampe. Jorge Semprun warnt in seinem Buch »Die große Reise« die Leser mehrmals: »Ihr habt aber noch nichts gesehen. Ihr habt nämlich die Rampe noch nicht gesehen. Die Reise der jüdischen Kinder habe ich noch nicht erzählt.« Falls auf der Karte oder im Katalog über die Rampe etwas stand, musste ich es übersehen haben, doch wusste ich, dass ich sie auch so finden würde. Den Ort, für dessen Ruf ich ganz und gar Ohr war, die Rampe, an der die Züge aus Auschwitz hielten. Die Schienen waren herausgerissen worden, und die Natur hatte im Verlauf von sechzig Jahren die letzten Spuren verwischt. Aber ich war dort, das merkte ich, noch bevor ich das Schild sah.
Der Zug aus Auschwitz hält, die Waggontüren werden aufgerissen, niemand springt heraus. Die Häftlinge finden ein paar Kinder vor, die inmitten von Tausenden aneinandergeklammerten Toten bei dreißig Grad unter null zehn Tage lang irgendwie überlebt haben, ohne etwas zu essen und zu trinken. Niemand weiß, was geschehen soll, man wartet auf einen Befehl von oben. Die Kinder ahnen, was ihnen bevorsteht, und versuchen mit letzter Kraft, irgendwohin davonzulaufen. Hier, auf diese Kiefern laufen sie zu, auf das Zentrum des Lagers. Ein Kind nach dem anderen wird ermordet. Zwei bleiben übrig, sie laufen, so schnell sie können, doch einer gerät im Schnee ins Straucheln, der andere, Größere, bleibt stehen, kehrt zum Jüngeren zurück, hält ihm die Hand hin. Ende März 2008 höre ich in Buchenwald, wie vor etwas mehr als sechzig Jahren an der Rampe ein paar Schüsse ertönen.
Manchmal gerät man durch ein Wort in einen Strudel, wird zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod umhergewirbelt. Die Welt steht Kopf, Gestern und Heute gehen ineinander über, alles wird zerschlagen und neu zusammengesetzt: »Schicksal«. Auf Türkisch nennt man das Schicksal auch »Stirnschrift«, denn unsichtbar, doch unauslöschlich, steht das Schicksal uns auf die Stirn geschrieben.
Gleich am folgenden Tag stach mir in den linken Arm ein Schmerz, wie ich ihn noch nie erlebt hatte, und er strahlte bald in Rücken und Hals aus. Bei meiner Rückkehr nach Istanbul hatte ich mich gleichsam in Quasimodo verwandelt; innerhalb einer Woche war ich bucklig geworden! Ein MRT brachte rasch Aufklärung, es wurden Wirbelschädigungen und Hernien festgestellt, doch mussten diese schon vor langer Zeit entstanden sein. Sie stammten wohl aus meiner Jugend, hatten ein und dasselbe Trauma zur Ursache, doch all die Zeit über waren keinerlei Symptome aufgetreten. (Ich hatte stets klassisches Ballett betrieben und tanzte noch immer.) Eine sogenannte Gewalterfahrung, von der ich niemandem berichtet hatte, nicht einmal mir selbst, weil mir das einfach nicht recht gewesen wäre, und die ich in all ihren Details so gut wie vergessen und aus meinem Lebenslauf quasi gestrichen hatte, war nach so vielen Jahren mit voller Wucht über mich hereingebrochen und hatte mich im Schnee von Buchenwald daran erinnert, dass ich ein »Opfer« war, ein auf unwiderrufliche Weise geschädigtes Opfer. Eine still in mir schwärende, nie verheilende Wunde hatte sich schließlich meiner bemächtigt. Wunden sprechen nur selten, aber sie können auch nicht lügen.
»Das Haus aus Stein«, mittlerweile eine längere Erzählung, sollte damals gerade in Druck gehen, doch ich zog sie zurück. Etwa anderthalb Jahre lang, in denen ich mich einer schmerzhaften Behandlung unterziehen musste, rührte ich den Text nicht an, dann nahm ich ihn mir wieder vor. Der Schmerz und die ganz »unliterarische« körperliche Einschränkung hatten mir einen verrückten Übermut verliehen, aus dem heraus ich mich in ein Labyrinth wagte, in das ich bisher nur scheue Blicke geworfen hatte. Ich versuchte, in A.s Gedächtnis vorzudringen, in seine Sprache. Sätze, auf deren Poesie ich bis dahin vertraut hatte, stutzte ich rücksichtslos zu und versetzte sie in das einzige Kapitel, in dem Grausamkeit offen zutage tritt, in die Verhörszene. Das Schlüsselkapitel wiederum – in dem die Frau, die den einzigen Menschen, den sie retten möchte, verrät und den geliebten Mann somit dem Tod ausliefert, mit dem auf der Straße lebenden Wahnsinnigen konfrontiert wird – strich ich ganz, damit Verräter und Verratener, Überlebender und Sterbender, Erzähler und Erzähltes sich in unauflöslicher Weise vermischen und ineinander übergehen.
Ein einsamer Schrei, dunkles Gelächter. Ein Grabstein, eine Totenklage, eine verfluchte Melodie, vom Zufall komponiert, interpretiert von einem maskierten Chor, der auch noch weitersingt wie aus einem Mund, als er sich bereits aufgelöst hat. Eine gottverlassene Hölle, ein Spiegel, in dem man verzweifelt das Bild sucht, das man in sich behalten will. (»Des Menschen Herz ist ein Spiegel«, besagt ein alter Spruch.) Ein Hof, ein letztes Land, in dem nur das Rauschen des Windes zu hören ist. Auf Steinen eine Skizze, zu der jeder Blick etwas beitragen und sie somit in ein Bild verwandeln kann. Die erzwungene Hochzeit von Blut und Traum. Ein langes, eindringliches Gespräch, das das Ich und der andere, die Toten und die Lebenden, die Verräter und die Verratenen miteinander führen, ohne einander zu hören. Eine Geschichte, in der das Furchtbare und das Heilige nebeneinanderstehen, ineinanderfließen, sich einander anverwandeln. Eine Geschichte, deren »Geschichte« gestohlen wurde. Eine Heimat aus einem Herzen voller Steine.
Was in dem Roman erzählt wird, ist natürlich frei erfunden. Erfunden aber hat es die Wirklichkeit.
»Das Haus aus Stein« ist ein Text ohne Anfang, ohne Ende und ohne Mittelpunkt, dazu verurteilt, unvollendet zu bleiben. Er zieht Kreise um das »Unerzählbare«, gibt also seine Hilflosigkeit zu. Sowohl der Erzählerin als auch den Lesern enthält er den Trost des erzählerischen Zusammenhangs vor. Wie ihn in einem Rahmen dargebotene Gemälde bieten, bunte, lebendige Bilder, handzahme, zur Identifizierung einladende Charaktere, ein Tor zur Freiheit, das über die Tragödie hinausweist, eine Katharsis. Der Text lässt einen unheilvollen Ruf ertönen, versucht verzweifelt, die Stimmen zu übermitteln, die nie aus dem Haus aus Stein dringen. Und was Worte im Grunde nicht passieren lassen, überlässt er doch wieder Worten.
Und natürlich wird durch ihn die dunkle Vorhersage wahr. Er verwandelt mich in alles, was ich geschrieben habe, in STEIN.
Das Polizeirevier des Stadtteils Esenler. Eine Zelle, ein Käfig. Tag und Nacht brennt das Licht. Kein Wasser, keine Toilette. In dem sechs, sieben Quadratmeter großen Käfig sind wir vier Frauen. Zwei schmale Holzbänke, auf denen die eine, schon sehr schwache Frau sich etwas hinlegen kann. Zwei schmuddelige Decken, durchdrungen vom Schweiß unzähliger Menschen. Vier Frauen sind wir, und eine von uns wird sich in der dritten Nacht die Pulsadern aufschneiden.
Ich habe noch gar nichts erzählt. Denn ich habe noch nicht von der Rampe erzählt.
(Diese Bemerkungen scheinen aus zwei verschiedenen Federn zu stammen. Von der Autorin Geschriebenes und von einem früheren Häftling Geschriebenes. Ich glaube nicht, dass die beiden sich hören können.)
Es ist ganz natürlich, dass mir eines Tages selbst zustoßen sollte, was ich erzählte und schrieb. Das Haus aus Stein würde sich eines Tages auch für mich konkretisieren, so wie es anderen schon ergangen war. Die Charaktere, die Situationen, alles sollte körperliche Gestalt annehmen. Schreie hörte ich auf dem Polizeirevier nicht, aber ein Schlagen und Wimmern. Im Käfig nebenan waren jugendliche Häftlinge, sie waren von den Schlägen auf die bloßen Fußsohlen verschont geblieben, und sie machten den Polizisten ziemlich zu schaffen. Eine Frau weinte. Alle Frauen weinten. Eine Frau hörte ich achtundvierzig Stunden lang unaufhörlich weinen. Es gab auch Verrat; Denunzianten und Denunzierte. Sterbende. Nur der »Engel« war nicht da.
In der zweiten Nacht wurde ich erst ins Krankenhaus und dann wieder zurück gebracht. Als die durch eine Spritze verursachte »Versteinerung« etwas nachließ, kam mir das »Haus aus Stein« in den Sinn. Ich dachte mir, dass ich wohl nie wieder die Unschuld aufbringen würde, um ein solches Buch zu schreiben.
In der dritten Nacht aber, der schlimmsten, begriff ich, dass man den Engel nur »Augenblicke« lang existieren lassen konnte. Um das zu tun, musste man erst begreifen, dass es ihn nicht gab.
Ein Spiegel … Als ich im Spiegel des Hauses aus Stein, in den schmutzigen Scheiben des Polizeireviers von Esenler, zum ersten Mal mein Gesicht sah, erkannte ich es nicht.
Jetzt, 2019, hier in Deutschland, der Versuch zu erzählen. Die drei Tage und drei Nächte in einem sechs Quadratmeter großen Käfig, der Durst, der einen wahnsinnig macht, die stinkende Zelle, das Bett mit den Urinflecken, die vom Staatsanwalt geforderte lebenslängliche Strafe, der Gefängnishof, auf den es durch den elektrischen Stacheldraht tropft … Das meiste habe ich eigentlich vergessen. Die Geschehnisse, die Demütigungen, die Namen, die Details … Wer weiß, um welchen Preis ich das alles vergessen habe. (Mein Gedächtnis ist vom vielen Vergessen ganz müde.) Nur ein paar Bilder sind mir geblieben, grobe Skizzen, wie in harten Stein gehauen. Bilder, die ich nicht loswerde, so sehr ich mich auch bemühe. Schwarz-weiße, graue, herzfarbene, vorhöllenfarbene Bilder. (Tagsüber mag es mir gelingen, diesen Bildern zu entkommen, doch Nacht für Nacht schicken mich meine Albträume wieder in das »Haus aus Stein«.) Um diese unauslöschlichen Bilder herum wabert nebliger Schein. Ein Aufblitzen, Wassertropfen, Träume und Albträume, ein anschwellender Fluss, ein alles zu Asche klumpender Blitzschlag, eine dichte, unentrinnbare Wolke.
Nur die äußere Wirklichkeit neu zu erschaffen, also die Fakten zu erzählen, bietet eine Möglichkeit, ja die einzige Möglichkeit, der inneren Wirklichkeit zu entkommen; das weiß ich nun seit einer Weile.
Es ist 16 Uhr. Das Museum schließt. Die Nacht beginnt erst jetzt.