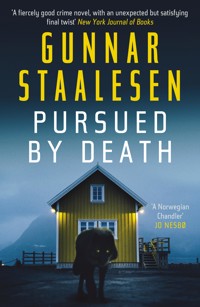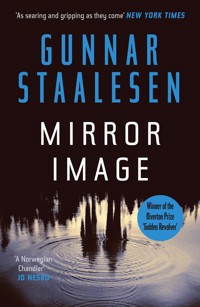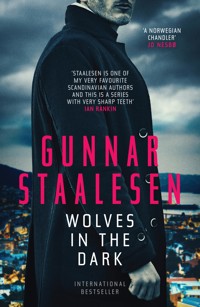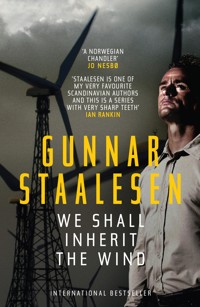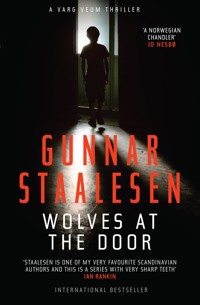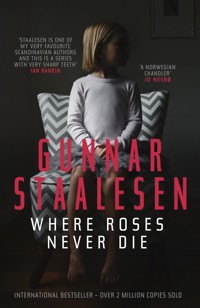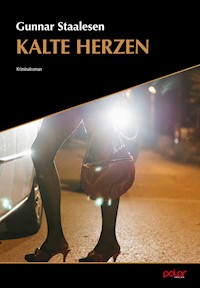8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Varg Veum
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dieser Titel gehört zu einer Romanreihe, auf der die bekannte Krimifernsehserie ›Der Wolf‹ um den Privatdetektiv Varg Veum basiert. Die Erstausstrahlung der beiden Staffeln erfolgte in Deutschland 2008 bei Das Erste und 2013/2014 beim ZDF. Scheidungssachen nimmt er nicht an, deshalb läßt Privatdetektiv Varg Veum den angesehenen Anwalt Moberg abblitzen, der seine junge Frau beschatten lassen möchte. Als kurz darauf ein besorgter Bruder für den im Sterben liegenden Vater die verlorene Tochter finden will und gleich einen ordentlichen Vorschuß auf den Tisch des Hauses blättert, wittert Veum leicht verdientes Geld und nimmt den Auftrag an. Denn beide Männer haben ihm ein Foto der gleichen Frau gezeigt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Ähnliche
Gunnar Staalesen
Das Haus mit der grünen Tür
Krimi
Aus dem Norwegischen von Kerstin Hartmann
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Originalausgabe erschien 1977 unter dem Titel Bukken til havresekken bei Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
1
Am Anfang war das Büro, und im Büro saß ich. Ich hatte die Beine auf dem Schreibtisch. Der Schreibtisch war aufgeräumt und übersichtlich. Links lag ein Stapel Rechnungen. Rechts, was ich an Bargeld hatte: zwei Kronen und dreißig Øre. Daneben stand ein Telefon und zerbrach sich den Kopf, wie es mir das Geld abluchsen könnte. In einer Ecke des Zimmers stand ein grauer Aktenschrank. Er war leer. An einer Wand stand mein Wandsafe. Er enthielt meinen gesamten Besitz: ein Sparbuch mit einem Notkontostand von 503,75 Kronen. Die Doppeltür zum leeren Wartezimmer stand einen Spalt offen. Aber es sah niemand herein.
Das Büro lag am Ende eines langen staubigen Korridors. Ich hatte es von einem Arzt für Allgemeinmedizin übernommen, der gegen seinen eigenen Tod kein Rezept ausschreiben konnte. Die Luft im Raum war noch immer stickig und schwer von den Sorgen und Nöten eines ganzen Lebens. Das Büro lag im dritten Stock eines Hauses am Strandkai, und das einzige, was mich daran hinderte, an Langeweile zu sterben, war die Aussicht. Wenn ich mich erhob und ans Fenster ging, konnte ich auf das wimmelnde Marktleben des Torget hinuntersehen. Wenn ich sitzenblieb, sah ich den ganzen Fløien vor mir. Am Berghang konnte ich den Wechsel der Jahreszeiten verfolgen. Jeden Winter lag dort vierzehn Tage lang Schnee. Wenn es auf den Frühling zuging, krümmten die nackten Bäume den Rücken und stemmten sich gegen den Boden. Mitte bis Ende Mai wurde der Berghang grün, und dann räkelte er sich in der Sonne bis mit Regen und grauem Wetter der Juli begann. Langsam wechselte er die Farbe, wenn es Herbst wurde: von grün zu gelb und rot und schließlich braun. Nur die immergrünen, dunklen Fichten und die üppigen Kiefern wahrten ihr Gesicht, wenn es auf den Winter zuging. Es war einer der letzten Tage im Oktober, und der Berg hatte schon vorsichtig begonnen, sich auf den Winter einzustellen. Es war ein grauer Tag, und noch kein Schnee gefallen. Das einzige Ereignis war die ewige Pendelfahrt der Fløienbahn. Auf und ab. Auf und ab. Und das sah ich nicht zum ersten Mal.
Ich gähnte. Um sicher zu gehen, daß keine von ihnen sich unbemerkt in Wohlgefallen aufgelöst hatte, zählte ich die Rechnungen. Lichtrechnung, Miete, Versicherung, eine fällige Kreditrate von 1000 Kronen, eine Abzahlung alter Schulden, eine Rechnung einer Firma für Bürobedarf. Sie waren alle da.
Da klingelte das Telefon.
Ich sah es erschrocken an. Dann nahm ich den Hörer ab und sagte: „Veum.”
Eine klangvolle Stimme sagte: „Hier ist William Moberg. Der Anwalt.”
Ich sagte: „Ach, Sie sind’s.”
Es entstand eine kleine Pause. Dann war die Stimme wieder da. „Wie bitte?”
Ich schielte auf den Stapel mit den Rechnungen und sagte: „Zu Diensten.”
„Ach so. Sie sind V. Veum, der Privatdetektiv?”
„Der bin ich.”
„Ich – habe einen Auftrag für Sie. Könnten Sie in meinem Büro vorbeikommen?” Er nannte die Adresse, zu Fuß zwei Minuten entfernt.
„Worum geht es?”
„Das möchte ich höchst ungern am Telefon diskutieren. Wann passt es Ihnen?”
„Jederzeit. Ich bin frei und ungebunden.”
„In einer Stunde?”
„In einer Stunde paßt gut.”
„Gut. Dann reden wir weiter.”
„Das wird sich kaum vermeiden lassen.”
„Wiederhören.”
„Wiederhören.”
Ich blieb noch eine Weile sitzen, aber der Friede war gestört. Ich war unruhig. Ich ging ins Wartezimmer, setzte mich auf einen Stuhl und begann in einer Wochenzeitschrift zu blättern. Sie war zwei Jahre alt. Ich hatte sie von dem Arzt geerbt und kannte sie schon auswendig.
Die Tür zum Wartezimmer hatte eine geriffelte Glasscheibe. Auf der Scheibe standen mein Name und Beruf gemalt, mit feinen, frischen Buchstaben.
Mein vollständiger Name ist Varg Veum. Um eventuelle Kunden nicht zu verschrecken[1], hatte ich ihn abgekürzt, so daß da nur stand:
V.Veum
Privatdetektiv
Vorläufig hatte sich das als ausreichend erwiesen.
Nachdem ich einen ungemein interessanten Artikel über die Fortpflanzungsmethoden des Mistkäfers gelesen hatte, stand ich auf, ging ins Büro zurück und gab den Dingen dort die Anweisung, zu bleiben, wo sie waren. Ich zog meine Jacke an, verschloß die Tür und machte mich auf den Weg zu meinem Rendezvous mit William Moberg, dem Anwalt.
2
William Moberg, der Anwalt, hatte eine Sekretärin. Sie hatte eine Haarfarbe, die mich an den Schnee auf dem Kilimandscharo denken ließ. Die Augen waren groß und blau, und es war keine Wolke darauf zu sehen. Sie saß neben einem perlgrauen Telefon und schrieb auf einer perlgrauen elektrischen Schreibmaschine. Ihr Kleid war grün und braun und hatte seine Karriere offenbar einstmals als Wurstpelle begonnen. Ich stellte mich vor, und sie sah mich skeptisch an. Sie sagte: „Veum? Sind Sie angemeldet?”
Ich nickte.
Sie sah nicht weniger skeptisch drein, hob aber jedenfalls den Telefonhörer ans Ohr, wählte eine Nummer und sprach hinein. „Ein Herr – Veum. Er sagt, er wäre angemeldet.”
Ich sah mich um. Es war ein Vorzimmer wie viele andere. Ein Schreibtisch, eine Reihe von Aktenschränken, selbstverständlich inhaltsreicher als meiner, ein paar Stühle, zwei große Landschaftsbilder an den Wänden und ein Safe, der nach seiner Größe zu urteilen, den gesamten Goldbestand von Norges Bank fassen konnte.
Die Sekretärin legte den Hörer auf und schenkte mir ein strahlendes Lächeln, ganz umsonst. „Sie können gleich hineingehen, Herr Veum,” sagte es.
Ich bedankte mich und ging gleich hinein.
William Mobergs Büro war groß und geschmackvoll eingerichtet. Die Wände waren dunkelbraun, der Teppich grün, und der Schreibtisch so groß, daß man darauf hätte Tischtennis spielen können. Er war aus Mahagoni.
William Moberg erhob sich und kam auf mich zu. Er war ein drahtiger kleiner Mann um die Fünfzig. Das Haar war fast weiß, aber um die Ohren und im Nacken voll, was ihm, unterstützt durch den kurzen Pony, ein jugendliches Aussehen gab. Das Gesicht war breit und maskulin, und er hielt den Rücken gerade wie ein alter Turner. Er ergriff meine Hand und pumpte sie ein paarmal auf und ab.
Seine Kleidung gab mir mehr Aufschluß über sein Konto, als die sorgfältige Untersuchung eines ganzen Monats erbracht hätte. Der Anzug war grau mit einem vagen Schimmer von moosgrün, und der Schnitt hätte von einem Herzchirurgen sein können. Er trug ein hellgrünes Hemd, und an dem breiten, blaugrünen Schlips funkelte eine goldene Kravattennadel.
„Setzen Sie sich hierher, Veum,” sagte er. Ich ließ mich auf den Stuhl sinken, den er mir angewiesen hatte, und er selbst nahm wieder hinter dem Schreibtisch Platz. Es war ein sehr bequemer Stuhl, und wir saßen einen Moment lang da und sahen einander an, ohne etwas zu sagen.
Er räusperte sich. „Sagen Sie, habe ich Sie irgendwo schon mal gesehen, Veum?”
Ich nickte. „Als ich beim Jugendamt war. Ich war Zeuge bei ein paar Rauschgift-Prozessen. Sie waren der Verteidiger bei einigen davon.”
Er nickte, sichtlich zufrieden mit sich. „Ja, das stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Veum, ja. Tja, ich – hatte vielleicht Glück – bei einigen. Prozessen. Aber jetzt sind Sie also in eine andere – Branche übergewechselt?”
„Nicht ganz. Aber ich bin einem Dealer ein bißchen zu nah getreten. Er lag danach drei Monate im Krankenhaus. Das Jugendamt entschied, ich sei nicht reif genug für den Job und kündigte mir.”
„Ich verstehe. Aber – dieser Beruf – können Sie wirklich davon leben?”
„Das entscheiden die Klienten. Bis jetzt hab ich’s geschafft. Sie würden sich wundern, wenn Sie wüßten, wieviele Leute Hilfe brauchen von jemandem mit ein bißchen Erfahrung mit Polizeiarbeit. Ich habe ein paarmal sowohl mit dem Rauschgiftdezernat als auch mit der Kripo sehr eng zusammengearbeitet. Ich bin schon fünf Mal in Kopenhagen gewesen, um Kinder zu suchen, die von zu Hause abgehauen waren. Ist Ihr Problem vielleicht ein ähnliches?”
„Nein, nicht direkt.” Er räusperte sich. „Mein Problem ist auch ein Kind, aber ein etwas älteres. Meine Frau.”
Er hielt inne, nahm ein gerahmtes Foto, das auf dem Schreibtisch stand, sah es einen Augenblick lang forschend an, als wolle er es um Rat fragen, dann beugte er sich vor, um es mir zu geben.
Ich sah es mir an. Sie war ein äußerst erfreulicher Anblick. Irgendwann einmal, wenn ich nichts anderes mehr zu tun hatte, als im Altersheim zu sitzen und auf den Tod zu warten, hätte ich gern ein Fenster mit einer Aussicht wie dieser. Sie hatte schöne, regelmäßige Züge und langes, glattes Haar mit einem Mittelscheitel. Das Bild war schwarz-weiß, aber das Haar schien braun zu sein, oder vielleicht rot. Entweder war sie viel jünger als ihr Mann, oder das Bild war alt.
Ich tippte auf das erstere.
Moberg sagte: „Sie betrügt mich.”
Ich sagte: „Und Sie wollen, daß ich …”
Er nickte. „Beschatten Sie sie. Finden Sie heraus, wen sie – trifft. Ich will Klarheit haben.”
„Sie wollen – sich scheiden lassen?”
Er nickte stumm.
Ich erhob mich, ging zum Schreibtisch und gab ihm das Foto zurück. „Mit vielem Dank zurück. Und auf Wiedersehen.” Ich ging zur Tür.
„Was soll denn das bedeuten? Warten Sie, Veum, warten Sie.” Der Stuhl stieß gegen die Schreibtischkante, als er sich erhob. Ich drehte mich um. Er kam schnell auf mich zu. Er sagte: „Wenn es das Geld ist, …” Er gab mir zu verstehen, daß Geld keine Rolle spielte.
Ich sagte: „Ich bin kein reicher Mann, Moberg. Ich habe einen Stapel unbezahlter Rechnungen zu Hause, ein Barvermögen von zwei Kronen und dreißig Öre und ein Notkonto mit etwas über fünfhundert Kronen. Aber ich übernehme keine Scheidungssachen.”
„Und warum nicht, wenn ich fragen darf?”
„Das ist zu schmutzig.”
Sein Gesicht wurde langsam rot. „Zu schmutzig? Kann etwas zu schmutzig sein für jemand so schmieriges wie einen Privatdetektiv? Davon lebt ihr doch: vom Herumschnüffeln in anderer Leute Privatleben. Und ist das vielleicht nicht schmutzig, was sie treibt? Was?” Er hatte mich am Jackenkragen gepackt.
Ich faßte seine Handgelenke, schob seine Hände fort und sagte: „Ich habe nicht viele Prinzipien, aber an denen, die ich habe, halte ich fest. Was Eheleute in ihrer Freizeit treiben, ist meiner Meinung nach ihre Privatsache. Meine Erfahrung ist, daß in den meisten Fällen von Untreue die Schuld eher beim betrogenen Teil liegt, als bei dem, der betrügt. Wie groß ist der Altersunterschied zwischen Ihnen und Ihrer Frau?”
Er öffnete den Mund und schnappte nach Luft. Er setzte an, etwas zu sagen, schluckte es aber hinunter. Dann kniff er die Lippen zusammen und wurde langsam wieder blaß. Ich konnte sehen, wie er sich zusammennahm. Als Verteidiger war er ein geübter Schauspieler. Er brachte sogar etwas zustande, das wohl ein Lächeln darstellen sollte und sagte: „Ich bedaure, Ihre wertvolle Zeit in Anspruch genommen zu haben. Das war alles. Auf Wiedersehen.” Er nickte zur Tür und war schon wieder auf dem Weg zum Schreibtisch.
„Auf Wiedersehen,” sagte ich und ging.
Die Sekretärin saß noch genauso da wie vorher. Sie schenkte mir noch eins ihrer berühmten Lächeln. Ich legte meine Handflächen auf ihren Schreibtisch, beugte mich vorsichtig vor und sagte: „Kommt es vor, daß Sie mit fremden Männern Essen gehen?”
Aus irgendeinem Grund errötete sie. Sie sagte: „Nein.”
Ich richtete mich wieder auf. „Das hatte ich befürchtet.”
Ich ließ kurz meine Zähne aufblitzen, grüßte und ging meines Weges. Lade niemals ein Mädchen Ende Oktober zum Essen ein. Warte bis April.
Ich ging zurück zu meinem Büro. Es hatte sich nichts verändert. Das Wartezimmer war leer.
3
Ein paar Tage vergingen, ohne besondere Spuren zu hinterlassen. Ein neuer Monat hatte begonnen. Es waren ein paar Rechnungen dazugekommen auf dem Stapel links auf meinem Schreibtisch. Der Barbetrag rechts war von zwei Kronen und dreißig Øre auf zwölf Kronen und fünfzig Øre gestiegen. Dies war allerdings nur ein scheinbares Anwachsen meines Vermögens. Die Ursache war, daß mein Notkonto von 503,75 Kronen auf 353,75 Kronen reduziert worden war. Der Fußboden war eine Spur dreckiger geworden und das Wetter draußen war noch immer grau und trist.
Ich saß da und zählte die Nägel meiner rechten Hand, als ganz plötzlich eine totale Veränderung in mein Dasein trat. Ich bekam einen Klienten. Oder jedenfalls: die Tür vom Korridor zu meinem Wartezimmer wurde geöffnet.
Die Tür zum Wartezimmer stand einen Spalt offen, und ich sah neugierig auf die schmale Öffnung. Nichts geschah. Alles war wieder still. Ich beruhigte mich damit, daß es wohl nur eine akustische Täuschung gewesen war. Oder es war ein Patient des Zahnarztes von nebenan, der sich aus einem unbewußten Wunsch heraus in der Tür geirrt hatte. Ich spielte gerade schon mit dem Gedanken, die Füße vom Tisch zu nehmen und für alle Fälle einmal nachsehen zu gehen, als im Wartezimmer ein dünnes Räuspern ertönte. Es war ein bescheidenes Räuspern, so wie sich jemand räuspert, um andere darauf aufmerksam zu machen, daß er da ist. Ich nahm die Füße vom Tisch, stand auf, ging zur Tür und öffnete sie ganz.
Auf einem der Stühle saß ein Mann. Er hielt eine der alten Wochenzeitschriften in den Händen und blätterte ziellos darin herum. Als er mich entdeckte, legte er die Zeitschrift schnell beiseite, erhob sich und kam nervös auf mich zu. Seine Stimme war leise, fast ein Murmeln. Er sagte: „Ve – Veum?”
Ich nickte, und er reichte mir eine kalte Hand. „Ragnar Veide.” Seine r’s ließen drauf schließen, daß er von einem Ort an der Møre-Küste kam.
Ich wies ihn in mein Büro, wischte pflichtschuldigst ein bißchen Staub vom Klientenstuhl und bat ihn, sich zu setzen. Ich selbst setzte mich auf die andere Seite des Schreibtisches und betrachtete ihn genau. So sah das also aus. Ein Klient.
Ragnar Veide war schwer einzuordnen. Seine Kleidung war gewöhnlich: grauer Mantel, brauner Anzug, weißes Hemd mit beigem Schlips, braune Schuhe, ein Rotary-Abzeichen auf dem Jackenaufschlag. Das Gesicht war blaß, die Augen blau. Die Nase war eine Nase: weder groß noch klein, weder häßlich noch hübsch. Das Haar war dunkelblond und glatt nach hinten gekämmt, was die hohe Stirn und die tiefen Geheimratsecken betonte. Auf einer Seite der Stirn pulsierte eine Ader.
Seine Augen wirkten nervös. Sein Blick flackerte rastlos in meinem Büro umher, ohne an etwas Interessantem hängenzubleiben, und er war sehr glasig, als hätte er Fieber.
Ich sagte: „Na, womit kann ich dienen?”
Er leckte sich die Lippen und sagte: „Ich habe Sie im Telefonbuch gefunden. Sie waren der einzige. Ich habe noch nie … Es ist das erste Mal, daß ich – einem Detektiv begegne.”
Er wartete einen Augenblick, wie um zu hören, ob ich protestieren wollte. Aber das wollte ich nicht. „Wieviel,” sagte er. „Wieviel kostet es – Sie zu engagieren?”
„Das kommt auf die Art des Auftrags an – und auf den Auftraggeber. Wir haben einen Satz für Privatpersonen, und einen anderen für Firmen und Organisationen.”
Er nickte. „Ich verstehe. Ja, ich bin privat hier. Und diese – Sätze?” Er sah mich fragend an.
Ich gab ihm eine kleine Karte, die das ganze offizieller erscheinen ließ. Er nahm die Karte und las laut. Das wäre nicht nötig gewesen. Ich kannte sie auswendig. Es war meine Lieblingslektüre. „Feste Sätze,” las er. „Fünfzig Kronen pro Stunde. Vierhundert Kronen pro Tag. Zweitausend Kronen Pro Woche. Fünftausend Kronen pro Monat. Mindestsatz: fünfhundert Kronen. Zuzüglich Spesen.” Er hob den Kopf und sah mich an. Ich errötete nicht. „Das ist nicht gerade wenig,” sagte er.
„Es ist auch nicht gerade viel. Nicht, wenn du im Monat einen Auftrag hast – und es dich eine Stunde kostet, ihn auszuführen.”
„All das mit den Stunden und Tagen und …” Er hob resigniert die Hände.
Ich sagte: „Das ist ganz einfach. Der Mindestsatz sind fünfhundert Kronen. Die müssen Sie in jedem Fall bezahlen. Das entspricht zehn Arbeitsstunden. Wenn der Auftrag nicht mehr Zeit braucht, dann bezahlen Sie auch nicht mehr. Wenn es zwölf Stunden dauert, bezahlen Sie sechshundert Kronen. Wenn es mehrere Tage sind, dann bezahlen Sie vierhundert Kronen pro Tag, plus fünfzig Kronen pro Stunde, die über die Anzahl Tage hinausgeht. Die Sätze gehen aus von einem acht-Stunden-Tag, aber ab und zu sind ja – wie soll ich es nennen – Überstunden erforderlich. Dann bezahlen Sie fünfzig Kronen pro Überstunde. Wenn der Auftrag ausgeführt ist, erhalten Sie eine genaue Abrechnung. Okay? Je länger Sie mich engagieren, umso billiger wird es. Nur fünftausend Kronen für einen ganzen Monat: das nenne ich ein Angebot!”
„Aber,” sagte er. „Wie kann ich kontrollieren, daß Sie die Anzahl Stunden oder Tage arbeiten, die Sie angeben?”
Ich sah ihn kühl an. „Das können Sie nicht. So einfach ist das. Sie müssen mir vertrauen. Oder zu einem anderen gehen. Und einen anderen gibt es nicht, hier in der Stadt jedenfalls nicht. Sie haben also keine Wahl.” Er sah aus, als dächte er darüber nach, und ich fügte hinzu: „Es kommt ja darauf an, wie wichtig Ihrer Meinung nach der Auftrag ist.”
Er nickte langsam. Dann sagte er: „Tja, das Geld spielt eigentlich keine so große Rolle. Ich komme heute aus Ålesund.”
Ich verstand den Zusammenhang nicht ganz. Ich sagte: „Soso, wollen wir zur Sache kommen? Worum geht es überhaupt?”
Veide sagte: „Ich weiß nicht recht, wie ich es formulieren soll. Es – es dreht sich um – eine Familienangelegenheit. Mein Vater, Bjarde Veide, ist ein kranker, alter Mann. Er – kurz gesagt: er liegt im Sterben. Er ist Hauptaktionär in einer der größten Fischfabriken im Nordwesten, und er verwaltet ein – tja – ein nicht geringes Vermögen. Es gibt zwei Erben – mich und meine Schwester. Und das ist das Problem.”
„Daß es zwei Erben gibt?”
„Naja, nicht ganz, aber – meine Schwester. Meine Schwester ist das Problem. Margrete Veide.” Er sprach ihren Namen langsam aus, mit Betonung auf jeder Silbe, damit er sich mir auch gut einprägte. Das tat er. „Sie – Margrete und mein Vater – sie haben sich irgendwie zerstritten vor – ja, ungefähr fünf-sechs Jahren. Vater schmiß sie raus, und sie verließ Ålesund ohne zu sagen, wohin sie fuhr. Ich wollte sie ausfindig machen, aber Vater verbot mir, irgendetwas zu tun. Laß die Hure fahren, sagte er. Sie ist es nicht wert. Er verbot uns, ihren Namen jemals wieder zu erwähnen.”
„Ein altmodischer Vater,” sagte ich. „Aber trotz allem nicht ganz ungewöhnlich. Was war die Ursache für den Bruch?”
Veide wiegte den Kopf hin und her. Seine Stimme war noch immer gedämpft, als hätte er Angst, jemand im Nachbarzimmer könnte hören, was er sagte. „Das Übliche. Männer. Sie kam abends spät nach Hause. Ab und zu – ab und zu blieb sie die ganze Nacht weg.”
Ich nickte. Mir lag ein Witz auf der Zunge, aber mit einem Blick auf den Stapel Rechnungen und dem Gedanken an die fünfhundert verkniff ich ihn mir. Besonders gut war er auch nicht. Ich sagte: „Und Sie wollen, daß ich …”
„Sie suchen. Ja. Wissen Sie, jetzt, wo er krank ist … Vater hat Gewissensbisse. Er will sie noch einmal sehen, bevor er stirbt. Um Entschuldigung bitten. Und wenn er erst tot ist, dann müssen wir sie ja sowieso benachrichtigen. Wegen des Erbes. Ich dachte …”
Ich nickte. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, was er dachte. Ich sagte: „Aber Sie haben keine Ahnung, wohin sie gegangen ist? Haben Sie nie von ihr gehört? Und warum kommen Sie zu mir – nach Bergen?”
„Tja, weil Bergen – das ist die einzige Spur, die ich habe. Vor zwei Jahren bekam ich plötzlich eine Karte von ihr, von hier. Sie schrieb kurz und knapp, daß sie jetzt ein paar Jahre hier gelebt hätte, und daß sie heiraten würde. Sie bat mich, Vater nichts zu erzählen und zu vergessen, daß sie überhaupt existierte. Durch die Heirat bekäme sie einen anderen Namen, eine neue Identität und ein ganz neues Leben, schrieb sie. Auf Wiedersehen und Gruß, Margrete.”
„Haben Sie die Karte noch?”
Er schüttelte den Kopf. „Nein. Ich habe sie verbrannt. Niemand bekam sie zu sehen. Nicht einmal meine Frau. Sie wollte es so. Margrete.”
„Und sie gab keine Adresse an?”
„Nein.”
Ich sagte: „Tja. Das ist nicht gerade viel als Ausgangspunkt. Wann war diese Karte abgestempelt?”
„Im August, vor zwei Jahren.”
„Und seitdem haben Sie also nichts gehört?”
„Nichts. Absolut nichts.”
„Gut, wenn sie hier in der Stadt geheiratet hat, dann sollte es trotzdem nicht so schwer sein, sie zu finden. Aber ich möchte Sie warnen, Veide. Es kann dauern. Und dann wird es teuer.”
„Das Geld ist nicht so wichtig. Mein Vater lebt nicht mehr lange.” Der Anflug eines Lächelns huschte über sein langes Gesicht. Diesmal verstand ich den Zusammenhang.
Ich sagte: „Ich gehe davon aus, daß Sie ein Bild von ihrer Schwester haben?”
Er sagte: „Ja, ich habe ein paar mitgebracht.” Er zog einen braunen Umschlag aus einer Jackentasche und gab ihn mir. „Sie sind ein paar Jahre alt, aber ich vermute, daß sie sich nicht sehr verändert hat.”
„Wie alt ist sie?”
„Sie ist – äh – achtundzwanzig.”
„Und als sie von zu Hause wegging?”
„Zweiundzwanzig.”
Ich öffnete den Umschlag und schüttelte vier schwarz-weiße Amateurfotos heraus. Ich legte die vier Bilder nebeneinander auf den Schreibtisch und betrachtete sie. Dann hob ich den Blick wieder zu Veide. Ich sah ihn scharf an. Er strich sich mit der rechten Hand über den Haaransatz und das glatte Haar. Sein Blick war nervös. Ich sagte: „Soll das hier etwa ein Witz sein?”
„Äh – ein Witz? Was meinen Sie?” Er sah verständnislos drein.
Ich sah wieder auf die Bilder. Vier Bilder. Eins davon zog sofort meine Aufmerksamkeit auf sich. Darauf kniete sie irgendwo auf einem Felsen. Im Hintergrund sah man das Meer und ein kleines Motorboot, das in einer Bucht vertäut lag. Sie trug einen Bikini, und es war das Jahr, in dem am Stoff gespart wurde. Sie saß mit leicht vorgebeugtem Oberkörper und sah lächelnd zum Fotografen auf. Sie schien sich nicht gerade häßlich zu fühlen. Das fand ich auch nicht. Die drei anderen Bilder waren weniger beeindruckend. Zwei waren Nahaufnahmen ihres Gesichts: gute und natürliche Nahaufnahmen. Sie war schön, aber ohne Ausdruck. Das vierte war ein gestelltes Bild, auf dem sie in einem langen Kleid mit einer kleinen Tasche in der Hand dastand. Das Haar war aufgesteckt. Wahrscheinlich war sie auf dem Weg zu einem Ball oder etwas Ähnlichem. Vier Bilder. Sie war etwas jünger, das war richtig. Aber sie war schon damals ein schöner Anblick gewesen. Das Komische war, daß mir erst vor ein paar Tagen jemand ein Bild von ihr gezeigt hatte. Wenige Tage vorher, im Büro des Anwalts Moberg.
4
Bevor ich weitersprach, gab ich dem Rechnungsstapel einen beruhigenden Klaps, damit er wußte, daß ich ihn nicht im Stich lassen würde. Ich sagte: „Also, bevor ich Weiteres tun kann, wäre da das Mindesthonorar, Veide.”
„Ja, ja, richtig.” Er griff nach seiner Brieftasche. Sie steckte in seiner linken Innentasche, und einen Augenblick lang glaubte ich, er griffe sich ans Herz. Der Anblick von fünf Hundertern beruhigte mich. Die fünf wechselten den Besitzer, und ich fühlte mich im Nu besser als seit Tagen.
Ich sagte: „Das war wahrscheinlich das gesamte Honorar.”
Er sah mich fragend an. „Was meinen Sie?”
„Der Fall ist bereits gelöst.”
Er öffnete den Mund und schloß ihn wieder. Er sagte: „Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?” Er sah aus, als bedauere er, die fünf Blauen aus der Hand gegeben zu haben.
„Die Sache ist die,” fuhr ich fort, „daß mir vor ein paar Tagen ein anderer Mann ein Bild derselben Frau gezeigt hat. Ein Anwalt. William Moberg. Ihre Schwester Margrete ist die Frau des Anwalts William Moberg.” Vom Rest der Geschichte erzählte ich nichts.
Veide sagte: „Frau Anwalt William Moberg? Aber – aber – haben Sie auch ihre Adresse?”
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Die habe ich nicht. Aber ich habe ein Telefonbuch, das ich Ihnen vollkommen kostenlos anbieten kann. Leihweise, wohlgemerkt. Dort finden Sie die Adresse.”
Ich gab ihm das Telefonbuch. Er nahm es mit einer Ehrfurcht entgegen, als wäre es eine historische Bibel. Er blätterte es durch. Ich beobachtete ihn stumm. Er fand die richtige Seite. Er ließ den Finger die Spalten entlanggleiten. Schließlich ließ er sich an einer Stelle nieder.. „William Moberg, Anwalt. Natland Terrasse,” las er. Er sah fragend zu mir auf.
Ich sagte: „Natland Terrasse. Das ist ein Ort im südlichen Teil der Stadt mit Stereo-Aussicht und Grundstücken der Hunderttausender-Klasse.”
Er nickte. Er hatte plötzlich etwas Gezwungenes an sich, als wüßte er nicht recht, wie er reagieren sollte. Er sagte: „Hören Sie ‚ Veum. Es wirkt vielleicht ein bißchen merkwürdig, aber … Das kam etwas zu plötzlich. So einfach nach sechs Jahren des Schweigens zu hören, daß sie mit einem Anwalt verheiratet ist. Ich kann nicht einfach hinfahren und an der Tür klingeln und sagen: guten Tag Margrete, Vater liegt im Sterben.”
Ich sagte: „Sie können ja anrufen.” Ich wies mit dem Kopf zum Telefon.
„Nein, nein, Sie verstehen das nicht. Das Ganze ist zu – ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.” Wenn er es selbst nicht wußte, konnte ich ihm auch nicht helfen, also ließ ich ihn noch eine Weile nachdenken. Schließlich sagte er: „Hören Sie, ich engagiere Sie weiter. Ich werde bis Anfang nächster Woche hier in der Stadt bleiben. Ich habe ein paar Geschäfte zu erledigen. Könnten Sie nicht … Margrete, ich möchte, daß Sie sie beschatten. Sie nur ein paar Tage beschatten. Ich will wissen, wie sie lebt, was sie tut. Ich möchte Vater etwas Konkretes erzählen können, wenn sie – wenn sich zeigen sollte, daß sie trotz allem nicht nach Hause fahren will. Etwas Handfestes, wenn Sie verstehen.”
Ich sah wieder auf die vier Fotos. Handfest sah sie jedenfalls aus. Von den Fotos glitt mein Blick automatisch zum Rechnungsstapel. Ich hatte keine anderen Aufträge. Ich hatte keine guten Gründe, nein zu sagen. Ganz im Gegenteil, ich hatte einen Stapel guter Gründe, ja zu sagen. Ich sagte ja. „Wo wohnen Sie, Veide?”
Er nannte den Namen eines kleinen Hotels im Zentrum. Es war bei weitem nicht das beste Hotel der Stadt, aber es gab noch schlechtere. Er reichte mir wieder seine kalte Hand, bedankte sich und bat mich, ihn im Hotel anzurufen, sobald ich etwas zu berichten hätte.
Dann verließ er das Büro, und ich war wieder allein. Ich versuchte zu spüren, was es für ein Gefühl war, einen Job zu haben. Aber es war kein großer Unterschied. Wenn nicht fünf Blaue einen großen Unterschied ausmachen. Und das tun sie wohl, nehme ich an.
5
Ich rief Paul Finckel an, einen Journalisten, den ich kenne. Ich nannte ihm den Namen William Moberg und bat ihn, ein bißchen darauf herumzukauen. Er kaute. Dann sagte er: „Was willst du wissen?”
„Ach, nur so allgemein.”
„Strafverteidiger der Mittelklasse. Nicht zu gut und nicht zu schlecht. Vor ein paar Jahren erzielte er einige aufsehenerregende Resultate in ein paar Rauschgiftverfahren, die ihn eine Zeit lang zu einer lokalen Berühmtheit machten. Aber das alles weißt du wohl selbst. Er hat ein paar feine Klienten aus renommierten Betrieben und Organisationen. Hilft ihnen dabei, die Steuer zu hinterziehen, davon kannst du ausgehen. Ich bilde mir ein, daß er etwas Vermögen besitzt. Überhaupt – der hat ausgesorgt. Ist aber kein Perry Mason-Typ. Dafür ist er zu praktisch veranlagt. Mehr fällt mir so auf die Schnelle nicht ein.”
„Wie stets mit dem Privatleben?”
„Davon hab ich keine Ahnung. Hab nie was gehört.”
„Er soll eine junge, schöne Frau haben.”
„Einige können sich das leisten. Ich dachte, daß du solche Sachen nicht annimmst, Veum.”
„Das tue ich auch nicht. Das hier ist was anderes.”
„Ach soooo. Ist sie so schön?”
„Du verstehst mich miß.”
„Das tu ich immer. Verkohl’ mich ruhig weiter, Veum. Aber über ihn weiß ich jedenfalls nicht mehr.”
„Tja, okay, danke dir.”
„Tschüß. Und viel Glück.”
Ich bedankte mich, aber er hatte schon aufgelegt. Flott und fröhlich, wie alle Journalisten.
Als nächster Punkt der Tagesordnung schlug ich selbst das Telefonbuch auf und notierte mir die Nummer des Hauses auf der Natland Terrasse. Damit war der Schreibtischteil des Auftrages erledigt. Der nächste Teil erforderte Bewegung. Ich stand auf, sammelte die vier Bilder zusammen und steckte sie in die Innentasche meiner Jacke, fegte den Barbetrag in eine Hosentasche und verließ das Büro.
Draußen war es kalt und eklig, und ich schlug den Jackenkragen im Nacken hoch. Ich ging hinauf zum Rathaus, wo ich vorhin mein Auto geparkt hatte. Ich fahre einen kleinen Morris, 71er Modell, grau. Solch ein unscheinbares kleines Ding, das man nicht sieht, bevor man darüber stolpert. Er beschleunigt schlecht und läuft auch nicht sonderlich schnell. Aber wenn ich ab und zu den Auftrag habe, Leute zu beschatten in einer Stadt, die in Verkehrsproblemen erstickt, bin ich darauf angewiesen, ein Auto zu haben, das ich zur Not in die Tasche stecken kann. Also ist er für meinen Bedarf gerade richtig.
Die starke Steigung zur Natland Terrasse kostete den Kleinen viel Kraft, aber schließlich kamen wir oben an. Zwischen dem grauen Himmel und dem grauen Meer lag eine langgestreckte Stadt, umgeben von schweren, grauen Bergen, die in graubraunem Smog badete. Und für den Ausblick bezahlten sie nun hunderttausend Kronen, allein für das Grundstück.
Mobergs Haus lag etwas im Inneren des Gebiets der Natland Terrasse, oben auf einem kleinen Felshügel. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen ein paar Reihenhäuser, rechts und links neben Mobergs Haus zwei weitere Einfamilienhäuser, in respektvollem Abstand. Eine Treppe und ein Schotterweg führten zum Haus hinauf. Die Garage hatte eine Seitentür zur Treppe hin.
Das Haus war für einen Schuppen zu groß und für ein Schloß zu klein. Ich hätte nicht viel dagegen gehabt, es zu Weihnachten geschenkt zu bekommen, aber ich hätte wohl kaum fünfhunderttausend Kronen dafür bezahlt. Es war blaugrau gebeizt und hatte eine schneeweiße Grundmauer, darin vier Fenster und eine Tür. Die Fenster im Hauptgeschoß waren groß und boten zweifellos Ausblick auf ein ungeheueres Panorama. Mehrere Fenster waren erleuchtet. Sonst gab es keine Spur von Leben.
Unten auf dem Weg standen fünf-sechs Wagen, und ich stellte mich fein säuberlich zwischen zwei von ihnen. Dann ließ ich mich in den Vordersitz sinken – soweit man das auf dem Vordersitz eines Minis kann, machte das Autoradio an und holte die vier Fotos wieder hervor. Besonders eins betrachtete ich eingehend.
Ein paar Stunden vergingen. Das Leben auf der Natland Terrasse an einem gewöhnlichen Wochentag Anfang November verlief still und beschaulich. Hier oben gab es keine Geschäfte, also waren auch keine Hausfrauen mit schweren Einkaufsnetzen unterwegs. Dagegen aber nicht wenige Hausfrauen in kleinen, hübschen Autos. Nicht nur die Autos waren ein angenehmer Anblick.
Es war fast zwei Uhr, als sich Mobergs Haustür plötzlich öffnete. Sie trug einen großen Pelz, aber ich hatte keinerlei Zweifel, wer sie war. Der Pelz war braun und der modische grüne Mantel hatte am unteren Rand einen entsprechenden Pelzbesatz. Ich versuchte, mich unsichtbar zu machen, was mir nicht sonderlich gut gelang. Ihr Haar war tatsächlich rot, ich konnte es unter dem Hut erkennen. Sie blieb am Briefkasten stehen und sah hinein, fischte ein paar Briefe und eine Zeitschrift heraus, aber nichts davon schien nach ihrem Geschmack zu sein, denn sie legte alles sofort wieder zurück. Dann verschwand sie in der Garage, durch die Seitentür. Wenige Augenblicke später schwang das Garagentor auf, und sie glitt heraus, am Steuer eines schnittigen kleinen Opel Kadett in einem Rot, das ganz sicher mit der Farbe ihres Lippenstiftes übereinstimmte. Der Wagen lief wie eine heiße Katze, und ehe ich meinen Mini überhaupt angeschmissen hatte, war sie schon weit die Straße hinunter. Eine Staubwolke stob hinter mir auf. Ich hatte nicht gerade meinen diskreten Tag.
In den Kurven zum Natlandsvei hinunter holte ich sie wieder ein, und unten auf der Straße hängte ich mich mit ein paar Wagen Abstand hinter sie. Sie hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, 50, und ich hatte keine Schwierigkeiten, ihr zu folgen.
Sie fuhr ins Zentrum. Von der Kong Oscarsgate bog sie in die Lille Øvregate ein. Sie hatte Glück und fand einen Parkplatz auf der Korskirkealmenning. Sie war schon aus dem Wagen, bevor ich einen Parkplatz hatte. Ich stellte meinen Wagen halb auf dem Bürgersteig ab und betete zum Himmel, daß kein Schupo auftauchen möge. Unauffällig wie ein grüner Gorilla heftete ich mich an ihre Fersen. Sie schien allerdings tatsächlich nicht den geringsten Verdacht zu haben, daß hinter ihr etwas vor sich ging. Ihr Gewissen war demnach weiß wie Schnee. Sie sah sich nicht ein einziges Mal um, sondern ging mit geradem Rücken und federnden, leicht wiegenden Bewegungen. Sie sah in keiner Weise aus wie eine Frau, die ihre Vergangenheit in Ålesund hinter sich gelassen hatte, und deren Mann glaubte, sie sei ihm untreu.
Außerdem hatte sie auch nichts Bestimmtes vor. Ich weiß nicht, wie Anwaltsfrauen normalerweise ihren Alltag verbringen. Vielleicht sitzen sie zu Hause und häkeln große Tücher für Wohltätigkeitsbasare. Vielleicht lernen sie Spanisch mit einem Linguaphon-Kurs. Oder sie wechseln vielleicht alle eineinhalb Monate den Liebhaber und trinken drei Flaschen Portwein die Woche. Diese Anwaltsfrau tat nichts dergleichen. Jedenfalls nicht an diesem Wochentag im November. Sie machte einen Einkaufsbummel.
Shopping ist keine erfreuliche Beschäftigung. Es kann zur Not angehen, wenn man dabei mit einer Frau zusammen ist, die man sehr mag. Es kann auch zur Not noch angehen, eine schöne Frau dabei zu beobachten. In gewissen zeitlichen Grenzen. Frau Margrete Moberg einkaufsbummelte zwei geschlagene Stunden, und soo schön war sie nicht. Nicht auf Distanz. Sie probierte Schuhe, kostete um die zehn verschiedene Lippenstifte, durchpflügte die Regale von zwei Buchhandlungen und drei Parfümerien, kurz gesagt: sie genoß ihre Freizeit.
Als sie nicht mehr tragen konnte, kehrte sie – mit ebenso geradem Rücken, ebenso federnd wie vorher – zum Auto zurück. In ihrem Schlepptau hatte sie einen erschöpften, nervösen Privatdetektiv. Es war ein Schupo dagewesen. Er hatte einen liebevollen Gruß hinter meinen Scheibenwischer geklemmt. Noch eine Rechnung. Sie würde sich nicht einsam fühlen.
Frau Moberg bog wieder hinunter in die Kong Oscarsgate und fuhr direkt nach Hause. Ich beobachtete, wie sie ihr Auto in die Garage fuhr. Das Garagentor schwang automatisch auf, auf ein Signal. Sie kam aus der Garage, öffnete den Briefkasten und nahm den Inhalt mit ins Haus. Ich sah sie die Treppe hinauf, den Schotterweg entlang und ins Haus gehen. Und an dem Tag kam sie nicht wieder heraus. Jedenfalls nicht vor acht Uhr abends. Um sieben Uhr kam Moberg. Als nach einer Stunde noch nichts geschehen war, machte ich Feierabend, notierte mir zwei Überstunden und fuhr nach Hause.
6
Am Tag darauf war ich früh zur Stelle: um acht. An diesem Morgen herrschte mehr Leben als am Tag vorher. Die Hausherren mußten zur Arbeit, die Kinder in die Schule. Niemand ging zu Fuß. Alle hatten einen Wagen. Man mußte einen Wagen haben, wenn man hier oben wohnte. Die Natland Terrasse liegt auf einem kleinen Bergkamm, der vom Landåsfjell ausgeht und Mannsverk vom Sædal trennt. Vor ein paar Jahren war hier oben noch ein wunderbares Erholungsgebiet. Jetzt zerschnitten Straßen das gesamte Gebiet und zwischen Blaubeersträuchern und Heidekraut schossen Häuser wie von Architekten gezeichnete Pilze aus dem Boden. Die Häuser auf den schönsten Grundstücken hatten einen Ausblick sowohl hinunter auf die Stadt als auch hinüber nach Fana. Und den höchsten Grundstückspreis.
Um fünf vor halb neun hielt ein Taxi vor dem Aufgang zu Mobergs Haus. Moberg kam aus dem Haus und stieg ein, und das Taxi fuhr davon. Wahrscheinlich hatte er selbst keinen Führerschein. Oder sein Wagen war in der Werkstatt. Frau Mobergs roten Opel Kadett durfte er nicht benutzen. Der stand dekorativ in der Garage. Und so verging der Vormittag.
Es wurde ein Uhr bevor Frau Moberg sich zeigte, gekleidet wie am Tag zuvor, zusätzlich trug sie eine grüne Umhängetasche. Sie sah kurz in den Briefkasten, fuhr den Wagen aus der Garage und dann weiter in Richtung Stadt. Ich heftete mich in gebührendem Abstand an ihre Stoßstange und sammelte Kräfte für eine neue Shopping-Runde. Aber ich wurde angenehm überrascht. Sie ging nicht in ein einziges Geschäft.
Sie ging langsamer an diesem Tag. Sie hatte Zeit. Sie sah in Schaufenster, oder hinauf zum Himmel, spiegelte sich in den Scheiben der Autos, an denen sie vorbeiging. Ich folgte ihr, und ich spiegelte mich nicht. Solche Schocks vertrage ich nicht auf nüchternen Magen.
Sie ging die Strandgate und die Füßgängerzone entlang. Am Ende, auf der Holbergsalmenning kaufte sie an einem Kiosk ein paar Zeitschriften. Dann ging sie wieder zurück in Richtung Zentrum. Ich kaufte eine Zeitung und folgte ihr, treu wie ein Sommerschnupfen.
Gegen halb drei ging sie in ein Café. Ich überlegte einen Moment, ob ich ihr folgen oder draußen warten sollte. Mein Magen plädierte dafür, ihr zu folgen, die Vernunft dagegen. Der Magen siegte. Ich fand einen freien Tisch in einer Ecke auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, bestellte am Tresen ein warmes Frikadellenbrötchen, setzte mich an den Tisch und breitete die Zeitung vor meinem Gesicht aus. Es war die Tageszeitung, aber ich las sie höchst oberflächlich. So oberflächlich, daß ich nicht einmal umblätterte. Ich beobachtete Frau Moberg.
Sie hatte sich eine Mischung von Fleischklößen und Gemüse bestellt. Sie aß gemächlich. Ich bekam mein Brötchen, schlang es hinunter und versteckte mich wieder hinter der Zeitung. Frau Moberg beendete die Mahlzeit, schob den Teller zur Seite, goß Kaffee aus einer glänzenden Kanne in eine kleine, weiße Tasse und ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. Ich duckte mich hinter der Zeitung. Als ich wieder aufsah, sah sie auf die Uhr.
Eine Frau kam herein. Sie hatte dunkles Haar, war auf eine synthetische Weise puppenhaft schön und trug einen braunschwarzen Pelz. Sie ging lächelnd auf Frau Moberg zu, beugte sich vor und sagte etwas, ging zum Tresen und bestellte, kam zurück und setzte sich.
Sie redeten. Ich saß zu weit entfernt, um auch nur ein einziges Wort zu hören, aber sie redeten. So viel konnte ich beobachten. Sie redeten, verzehrten Kekse und tranken Kaffee. Die Dame im Pelz aß ein Napoleontörtchen. Nach einer Stunde standen sie auf und gingen. Ich ihnen nach, wie ein folgsamer Hund.
Auf dem Weg nach draußen bemerkte ich etwas Seltsames. Die Dame im Pelz trug eine grüne Umhängetasche, die, soweit ich erkennen konnte, mit der identisch war, die Frau Moberg trug. Vielleicht ein Sonderangebot für Freundinnen: zwei zum halben Preis. Vielleicht war es aber auch nur ein Zufall.
Die Frau mit dem dunklen Pelz hatte einen Wagen an einer Parkuhr gleich um die Ecke stehen. Als sie Frau Moberg die Tür öffnete, wurde mir kalt bis unter die Schuhsohlen. Ich hatte schon begonnen, mich nach etwas so seltenem wie einem freien Taxi umzusehen, als Frau Moberg den Kopf schüttelte, in Richtung Korskirkealmenning zeigte und etwas sagte. Sie redeten noch ein wenig, während die Frau im Pelz sich in den Wagen setzte. Es war ein weißer Ford Escord. Ich notierte die Nummer. Als sie sich hinsetzte, streckte sie ihre hübschen Beine weit auf den Bürgersteig, so daß alle, die wollten, sie bewundern konnten.
Die beiden Frauen winkten einander zu wie Frauen einander zuwinken. Der weiße Wagen glitt auf die Straße, hupte wütend einen Fußgänger an, der zwanzig Meter vor einem Zebrastreifen die Straße überquerte, bog um die Ecke und verschwand. Frau Moberg ging zurück zur Korskirkealmenning. Ich folgte ihr.
An diesem Tag fuhr sie nicht direkt nach Hause. Erst sammelte sie Moberg vor seinem Büro auf – und dann fuhren sie nach Hause. Es war mitten in der Hauptverkehrszeit. Wir brauchten eine Viertelstunde von der Torgalmenning bis Betanien, aber danach lief der Verkehr flüssig. So flüssig es eben geht, wenn man sich in einer Schlange befindet, die sich mit Tempo 30 vorwärtsbewegt.
Ich hielt jetzt reichlich Abstand, und oben auf der Natland Terrasse parkte ich weit hinter ihnen. Ich hatte keine Lust, mit Moberg zusammenzutreffen. Ich hatte keine gute Begründung dafür, warum ich seine Frau trotzdem beschattete – nachdem ich sein Angebot ausgeschlagen hatte.
Da saß ich nun also wieder: in einem kalten Auto, mit knurrendem Magen und im großen und ganzen nichts zu tun. Außer dasitzen und warten. Ich sah das Haus schon im Schlaf vor mir. Den Schornstein, die Büsche im Garten rundherum, die Farbe der Gardinen, die Stehlampe rechts im großen Wohnzimmerfenster, die Blumen auf der Fensterbank. Sogar das Bild von Frau Moberg hatte den Reiz des Neuen verloren. Außerdem sah sie im Wintermantel und mit tief ins Gesicht gezogener Pelzmütze beträchtlich anders aus, als im Bikini, das Gesicht offen wem auch immer zugewandt.