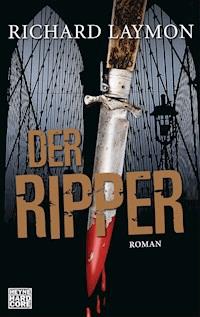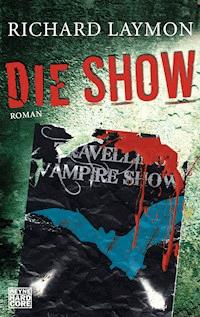2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Halloween. In der amerikanischen Kleinstadt Ashburg gibt es dieses Jahr eine große Party. Geladen wird ins Sherwood- Haus. Ein ganz besonderes Haus. Vor vielen Jahren ist dort eine Familie bestialisch ermordet worden. Seitdem wird es gemieden. Doch trotz dieser finsteren Vorboten öffnen sich am Abend die Tore. Das blutige Spiel beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Zum Buch
Halloween. In dem netten amerikanischen Städtchen Ashburg gibt es dieses Jahr eine große Party. Geladen wird ins Sherwood House. Ein ganz besonderes Haus. Vor vielen Jahren wurde dort eine Familie bestialisch ermordet. Seitdem mieden es die Leute. Doch trotz dieser finsteren Vorboten öffnen sich am Abend die Tore des Sherwood-Hauses. Das blutige Spiel beginnt …
Mit einem ausführlichen Verzeichnis aller im Wilhelm Heyne Verlag erschienenen Werke von Richard Laymon.
Zum Autor
Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und studierte in Kalifornien englische Literatur. Er arbeitete als Lehrer, Bibliothekar und Zeitschriftenredakteur, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete und zu einem der bestverkauften Spannungsautoren aller Zeiten wurde. 2001 gestorben, gilt Laymon heute in den USA und Großbritannien als Horror-Kultautor, der von Schriftstellerkollegen wie Stephen King und Dean Koontz hoch geschätzt wird.
Besuchen Sie auch die offizielle Website über Richard Laymon unter www.rlk.stevegerlach.com
RICHARD LAYMON
DAS HAUS
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Urban Hofstetter
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe
ALLHALLOW’S EVE
erschien bei New English Library, London.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das kompletteHardcore-Programm sowie den monatlichen Newsletter.Weitere News unter facebook.com/heyne.hardcore
Vollständige deutsche Erstausgabe 04/2016
Copyright © 1985 by Richard Laymon
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Published in arrangement with Lennart Sane Agency AB
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,Dominic Wilhelm
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-15977-1V001
www.heyne-hardcore.de
1
Im letzten Haus an der Oakhurst Road wohnte Clara Hayes. Seit ihr Ehemann einen Herzinfarkt erlitten hatte, lebte sie dort allein.
Er hatte auf dem oberen Treppenabsatz gestanden, als es passierte, war die Stufen heruntergefallen und direkt vor ihren Füßen gelandet. Doctor Harris hatte gesagt, der Genickbruch habe ihn noch vor dem Herzstillstand getötet. Das war nun elf Jahre her.
Ohne diesen launischen alten Mistkerl war sie besser dran.
Außerdem war Alfred ein viel besserer Gefährte, auch wenn er sich den größten Teil des Tages auf dem Friedhof hinter dem Haus herumtrieb.
Die 22-Uhr-Nachrichten fingen an – für Clara das Zeichen, dass es Zeit war, Alfred hereinzuholen. Also nahm sie die Fernbedienung und schaltete den Fernseher aus. Dann hinkte sie auf ihren Stock gestützt in die Küche, wo sie die Hintertür entriegelte.
Ein kühler Wind blies ihr ins Gesicht. Tief atmete sie die frische Oktoberluft ein und blickte über den Garten hinweg in die Nacht.
»Aaaalfred!«
Clara lauschte. Das leise Klingeln der Erkennungsmarken an seinem Halsband würde zu hören sein, bevor sie ihn sehen konnte. Doch sie vernahm nur das Rascheln der trockenen Blätter an den Friedhofsbäumen.
»Aaaalfred!«
Auf ihrem Weg die drei Holzstufen in den Garten hinunter achtete sie sorgsam darauf, nicht hinzufallen. Im Jahr zuvor hatte sie wegen einer gebrochenen Hüfte ganze fünf Monate lang still liegen müssen. Über den mondbeschienenen Rasen ging sie bis zum Rand ihres Blumenbeets, von wo sie durch die Stangen des Friedhofszauns spähte. Es war so dunkel dort drüben, wo die Bäume den Mond verdeckten.
»Aaaalfred!«, rief sie erneut. Viel zu laut. Clara stellte sich vor, wie die Leichen in ihren Särgen die Köpfe hoben und ihrem Ruf lauschten. Deutlich leiser lockte sie: »Komm hierher, miezmiezmiez.«
Sie suchte die Finsternis ab und erblickte nicht weit hinter dem Friedhofszaun eine einsame Gestalt.
Erschrocken wich sie zurück, rutschte auf dem taunassen Gras aus und hielt das Gleichgewicht nur dank ihres Stocks, den sie beherzt in die Erde rammte.
»Du meine Güte«, murmelte sie und blickte erneut zu der dunklen Silhouette hin – einem Steinengel, der zu einem Grabmal gehörte und den sie schon Tausende Male zuvor bei Tageslicht gesehen hatte. Bei Dunkelheit sah der Friedhof ganz anders aus. Sie mochte ihn nicht, kein bisschen. Sie hätte in der Tür stehen bleiben und Alfred von dort aus rufen sollen, so wie sie es nach Einbruch der Nacht sonst auch immer tat.
»Dann bleib halt draußen, wenn du unbedingt meinst.«
Mit diesen Worten kehrte sie dem Gräberfeld den Rücken zu und machte sich auf den beschwerlichen Weg zurück zur offenen Küchentür. Clara beschleunigte ihre Schritte, da sie spürte, wie ihr Gänsehaut den Nacken hochkroch, und wusste, dass sie nicht vom Wind herrührte.
Ich bin doch nicht ganz bei Trost, dachte sie. Dieser Friedhof ist vollkommen sicher. Was bin ich nur für ein Angsthase.
Noch nie zuvor war eine Leiche aus ihrem Grab gekrochen, um Jagd auf die Lebenden zu machen. Und es würde wohl auch kaum heute Nacht zum ersten Mal geschehen.
Plötzlich spürte sie, wie etwas Haariges an ihren Beinen entlangstrich, und schrie auf.
Alfred huschte die Verandastufen hinauf, blieb an der Tür stehen und blickte über die Schulter zu ihr zurück.
»Du Halunke.« Zitternd holte Clara Atem und presste sich eine Hand auf die Brust. »Du hast mich zu Tode erschreckt.«
Gerade als sie begann, die Stufen weiter hochzusteigen, vernahm sie ein gedämpftes Klirren. Wie von einer Brechstange, die auf einen hölzernen Boden fiel. Clara starrte Alfred an und wagte kaum noch zu atmen.
Der Kater hingegen wandte sich gelangweilt ab und verschwand in der Küche. Clara beeilte sich, hinter ihm ins Haus zu gelangen, dann machte sie rasch die Küchentür zu und schob den Riegel vor.
Alfred setzte sich derweil vor den Kühlschrank und sah sie erwartungsvoll an.
»Jetzt nicht«, flüsterte Clara. Sie löschte das Küchenlicht und humpelte an der Aufsatzkommode vorbei ins Esszimmer. Obwohl es hier dunkel war, ging sie sehr vorsichtig von der Seite an das Fenster heran, damit sie von draußen nicht zu sehen war.
Was gäbe sie jetzt für eines dieser Periskope aus Pappkarton, wie das, mit dem Willy immer gespielt hatte. Obwohl man durch dieses Ding eigentlich nie wirklich etwas hatte sehen können.
Clara verlagerte das Gewicht auf den Gehstock und beugte sich dicht an die Fensterscheibe. Vorsichtig zog sie die weiche Gardine auf und sah hinaus.
Das Sherwood House nebenan sah nicht anders aus als sonst auch. Das alte, im Kolonialstil errichtete Gebäude wirkte schrecklich düster und verlassen: Die Einfahrt und die Wiese waren zugewuchert, die Fassade schrie nach einem neuen Anstrich, und die Fenster waren vernagelt.
Obwohl sie den Vordereingang von hier aus nicht sehen konnte, wusste sie, dass er verriegelt war; ebenso wie die Hintertür. Und die einzigen Schlüssel zu dem Haus hatte der Immobilienmakler Glendon Morley.
Vielleicht war er ja aus irgendeinem Grund hineingegangen. Doch das hielt Clara für wenig wahrscheinlich. Seit Juli war er nicht mehr mit Kaufinteressenten vorbeigekommen. Vermutlich hatte er inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass ihm irgendwer jemals diese Immobilie abkaufen würde. Und wer würde in dem Haus auch wohnen wollen, nach dem, was damals dort geschehen war?
Aber wenn nicht Glendon, wer mochte sich dann dort drüben herumtreiben?
Vielleicht Teenager. So wie vor ein paar Jahren. Sie waren eingebrochen und wie Schreckgespenster schreiend und heulend durch alle Räume gerannt.
In jener Nacht hatte sie Dexter angerufen, der kam und die Einbrecher schließlich in Handschellen abführte.
Der Gedanke, Dexter zu dieser späten Stunde wegen etwas zu stören, das vermutlich nur ihrer Einbildung entsprungen war, gefiel Clara allerdings überhaupt nicht. Es konnte außerdem ja auch sein, dass das Geräusch, das sie gehört hatte, gar nicht vom Sherwood House gekommen war.
Allerdings hätte sie jeden Eid darauf schwören können, dass es so gewesen war. Und sie war sich ganz sicher, dass sie die ganze Nacht kein Auge zumachen würde, weil sie wusste, dass jemand in dem finsteren alten Kasten war, durch die dunklen Zimmer streifte und sehr wahrscheinlich nichts Gutes im Schilde führte.
Vielleicht war es ja sogar der Mörder. Schließlich hatte man nie herausgefunden, wer die arme Familie Sherwood auf dem Gewissen hatte. Er könnte nach all den Jahren zurückgekehrt sein …
Bei dem Gedanken durchlief sie ein Schauer.
»Also gut.« Sie seufzte und ließ die Gardine zurückfallen. Dann trat sie vom Fenster weg und humpelte aus der Dunkelheit in das beruhigende Licht des Wohnzimmers. Dort ließ sich Clara auf der Couch nieder und nahm das Telefon auf den Schoß. Als sie die Null wählte und wartete, sprang Alfred auf die Couch und kuschelte sich in ihre Armbeuge.
»Vermittlung«, meldete sich eine ausdruckslose Stimme.
»Verbinden Sie mich bitte mit Dexter Boyanski in der Jefferson Street.«
»In welcher Stadt bitte?«
»Ashburg.«
Sie kraulte Alfred im Nacken, was ihm ein lautes Schnurren entlockte.
»Die Nummer lautet 432-6891.«
»Ich bin blind«, log sie. »Würden Sie mich bitte durchstellen?«
»Sehr gern.«
Gleich darauf hörte sie das Freizeichen am anderen Ende der Leitung, dann Dexters Stimme: »Ja?«
»Hallo, Dexter. Ich bin’s, Clara.«
»Wie geht es dir?«
»Im Großen und Ganzen funktioniert alles, vielen Dank«, antwortete sie mit einem leisen Lachen.
»Das freut mich zu hören. Betty sagte, du bist in letzter Zeit nicht beim Bingo gewesen.«
»Und da werde ich auch nicht mehr hingehen. Nicht solange Winky Simms die Zahlen ausruft. Er ist so langsam, dass mir beim Warten Moos in den Ohren wächst. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum sie ihn das noch immer machen lassen. Der arme Mann stottert doch wie eine zerkratzte Schallplatte.«
»Na, was soll ich …?«
»Aber deswegen habe ich dich ja gar nicht angerufen. Weißt du, ich bin vorhin draußen gewesen, um meine Katze reinzuholen. Und da habe ich ein Geräusch aus dem alten Sherwood House gehört. Ich hab’s mir jetzt eine Zeit lang angesehen. Es wirkt zwar genauso tot wie immer … aber man kann natürlich auch nicht viel erkennen, so rundum vernagelt, wie es ist. Ich trau mich nicht nachzusehen, ob es immer noch verschlossen ist, aber ich möchte wetten, dass es offen steht. In dem Haus ist irgendjemand, Dexter.«
»Ich komme rüber und sehe mal nach.«
»Das wäre wunderbar.«
Erst kurz vor Claras Anruf war Dexter aus der Dusche gestiegen und trug einen Bademantel. Da er sich sowieso anziehen musste, beschloss er, seine Uniform anzulegen.
Es war einfach zu riskant, Polizeiarbeit in Zivil zu erledigen.
Kurz dachte er darüber nach, auf der Wache anzurufen. Jeder der Männer, die dort Nachtschicht schoben, konnte diese Angelegenheit genauso gut erledigen wie er. Aber Clara war eine alte Freundin. Wenn sie Chet oder Berney von der Wache gewollt hätte, hätte sie dort angerufen. Vermutlich hoffte sie, dass er anschließend noch auf ein kleines Schwätzchen vorbeikommen würde.
Dexter schlüpfte in seine Dingo-Stiefel. Auf dem Weg zur Vordertür hinaus und zu seinem Wagen schnallte er sich den Pistolengürtel um.
Als Clara ein Motorengeräusch hörte, ging sie zum Wohnzimmerfenster und blickte hinaus. In die Einfahrt zum Sherwood House bog ein Auto und parkte. Es war zwar kein weißer Streifenwagen mit roten Signallichtern auf dem Dach, wie Clara erwartet hatte, aber der kräftige Mann in Uniform und mit dem Stetson-Hut sah zu ihr herüber und hob grüßend die Hand. Ganz eindeutig Dexter. Sie winkte zurück und beobachtete, wie er sich umdrehte und durch das kniehohe Gras stapfte. Er stieg die Stufen zum Eingangsbereich hinauf und verschwand hinter den Säulen der Veranda. Gleich darauf tauchte er für einen kurzen Moment wieder auf und ging in die Nische, die die Vordertür vor ihren Blicken verbarg.
Er war nur ein paar Sekunden nicht zu sehen, bevor er heraustrat und die Stufen wieder hinunterging.
Er kam auf sie zu und schüttelte den Kopf. An der Hausecke bog er ab und ging an der Seite des Gebäudes entlang.
Mit dem Gesicht ganz nahe an der Scheibe behielt Clara ihn im Auge, bis er um die nächste Ecke bog.
Er wird ein bisschen Zeit brauchen, um die Hintertür zu überprüfen, dachte sie. Wenn sie ordentlich verriegelt war, würde er wahrscheinlich um die andere Seite des Hauses herum wieder nach vorne gehen und dann zu ihr kommen. Sie hörte ihn schon sagen: »So sicher verschlossen wie ein Safe, Clara.«
»Ich weiß, dass ich etwas gehört habe.«
»Vielleicht kam es ja von den Horners.«
Als sie angespannt aus dem Fenster schaute, hoffte sie plötzlich, das Geräusch wäre wirklich aus dem Haus der Horners gekommen. Sie mochte sich nicht vorstellen, wie Dexter die Hintertür aufgebrochen vorfand und dann das Haus betrat, in dem solche schrecklichen Dinge geschehen waren.
Jetzt wünschte sie, sie hätte ihn nicht angerufen.
Sie hätte stattdessen auch auf der Wache Meldung machen können, und dann wäre einer der anderen Beamten gekommen. Es würde ihr nicht so viel ausmachen, wenn andere Polizisten in dieses Haus gingen.
Sie waren nicht ihre Freunde.
Es wäre nicht so schlimm, wenn sie nie mehr herauskämen.
Das Vorhängeschloss am Hintereingang war an seinem Platz, aber jemand hatte die vier Schrauben vom Türbeschlag entfernt. Dexter drehte den Türknopf und stieß die Tür auf.
Er zog seinen Revolver aus dem Holster und leuchtete mit der Taschenlampe in die Küche hinein. Ihr Lichtschein schälte den Linoleumboden, die geschlossene Tür zum Flur und die Lücke, in der der Kühlschrank gestanden hatte, aus der Dunkelheit.
Dexter erinnerte sich an jene Nacht vor so langer Zeit. An die weiße Tür des Kühlschranks, die von blutigen Handabdrücken besudelt war. Hester Sherwoods Handabdrücken. Sie musste sich in die Küche geschleppt haben in der Hoffnung, dort eine Waffe zu finden. Da war sie bereits halb tot. Sie stützte sich am Kühlschrank ab und hinterließ diese grotesken dreifingrigen Abdrücke ihrer rechten Hand. Später fand man ihre abgetrennten Finger im oberen Stockwerk, auf dem Teppich im Schlafzimmer. Irgendwie hatte sie es geschafft, so weit zu kommen, bevor der Killer sie einholte. Gerade weit genug, um diese deformierten Abdrücke auf dem Kühlschrank zu hinterlassen, bevor er sie niederwarf und den Rest erledigte.
In diesem Moment wünschte Dexter, er hätte das Haus nicht betreten. Er wollte nicht die zwei oder drei Schritte machen, bis er die Stelle auf dem Fußboden sah, wo sie Hester gefunden hatten.
Sie nackt gefunden hatten.
Er hatte einmal mit ihr getanzt – bei dem Ball, bei dem sie beide die Aufsicht gehabt hatten, ein Jahr vor den Morden. Er hatte sie in seinen Armen gehalten, gefühlt, wie sich ihre von einem steifen Büstenhalter umfangenen Brüste an seine Brust drückten. Alles unter ihrem weich fließenden Abendkleid war wie in einen Panzer eingehüllt gewesen, der ihre Haut vor Berührungen schützen sollte. Sie trug sogar ellenbogenlange weiße Handschuhe.
Und dann hier auf dem Fußboden, ganz ohne Schutzpanzer. Das Fleisch entblößt, die Brüste …
Rasch ging er in die Küche, um den Strom der Erinnerungen zu unterbrechen. Er schwenkte die Taschenlampe über die Küchenschränke, den Ofen, die Spüle. Vermied es, auf den Boden zu blicken. Trat schnell hinaus in den Flur.
Der mit einem flauschigen roten Läufer ausgelegt gewesen war. Nun war hier nur nackter Holzboden. Er öffnete eine Tür zu seiner Linken und ging ins Esszimmer. Seine Lampe wanderte über die Wand, auf die Jugendliche vor ein paar Jahren ihre Namen geschrieben hatten. Sie waren dort noch immer zu lesen: »John + Kitty« – umrahmt von einem Herz. Unschuldig und völlig unpassend in diesem Haus, das eine Gruft war.
Dexter bemerkte rote Spritzer über dem gemalten Herz.
Er ließ seine Taschenlampe die Wand hochwandern und stöhnte.
Wer zum Teufel …?
Jemand hatte über das Herz eine große Hand gemalt, eine Hand, an der zwei Finger fehlten. Aus den Stümpfen tropfte Blut. Die Farbe schimmerte im Licht der Lampe. Er trat näher an die Wand heran, klemmte sich die Taschenlampe zwischen die Oberschenkel und berührte die Farbe.
Noch feucht.
Er packte die Taschenlampe und wirbelte herum, suchte schnell die anderen Wände ab, die Zimmerdecke. Keine weiteren Malereien. Gott sei Dank.
Aber wer immer das getan hatte, die Hand gemalt hatte – der kranke Mistkerl konnte immer noch im Haus sein. Eilig lief Dexter durch den leeren Raum. Die Doppeltüren zur Vorhalle standen offen. Er ging hindurch und ließ das Licht rasch vom Vordereingang über die Esszimmertür bis zum Treppenaufgang auf seiner rechten Seite wandern.
Das obere Stockwerk würde er sich bis zum Schluss aufheben.
So leise wie möglich ging er am Treppengeländer vorbei. Er blickte den schmalen Flur hinunter, der zurück zur Küche führte. Dann überquerte er ihn und betrat das Wohnzimmer.
Als er sich schnell um die Achse drehte, schnitt sein Licht einen Kreis in die Dunkelheit. Hier war niemand außer ihm.
Und doch war da etwas, das nicht hierhergehörte.
Es lehnte an der Wand.
Er ging näher heran, unsicher, was er da sah. Es sah aus wie ein Käfig oder …
Verdammt!
Fenstergitter. Ein halbes Dutzend.
Irgendjemand, vielleicht Glendon Morley, hatte wohl vor, das Haus wieder herzurichten. Die Bretter von den Fenstern zu nehmen. Und stattdessen die Eisengitter zu befestigen, um die Vandalen draußen zu halten.
Im Schein der Taschenlampe sah er, dass an drei Fenstern auf der einen Seite des Wohnzimmers bereits Gitter angebracht waren.
Auf der anderen Seite dagegen …
Was für ein Idiot …?
Hinter Dexter knarrte ein Dielenbrett.
Er wirbelte herum, schnappte nach Luft und riss seine Pistole hoch.
Clara beugte sich noch immer dicht an das Fenster und starrte durch die Scheibe. Sie machte sich schreckliche Sorgen.
Dexter musste das Haus offen vorgefunden haben, genau wie sie es befürchtet hatte. Andernfalls wäre er schon längst wieder aufgetaucht.
Er war da drin, jetzt, in dieser Sekunde. Obwohl ihre Augen weit offen standen, sah Clara Bilder von Dexter vor sich, wie er diese lange, dunkle Treppe hinaufging und in das Schlafzimmer, wo man James Sherwood gefunden hatte. Es hieß, seine Augen seien herausgeschnitten worden. Von offizieller Seite war wenig zu hören gewesen, doch sie vermutete, dass die meisten Gerüchte der Wahrheit entsprachen. Armer Dexter. Nicht für eine Million Dollar hätte sie einen Fuß in dieses Haus setzen wollen.
Wie konnte er bloß da hineingehen? Es war allein ihre Schuld. Sie hatte ihn darum gebeten.
Verdammt! Sie wünschte, sie hätte den Notruf und nicht Dexters Nummer gewählt.
Oh, Gott sei Dank!
Sie stieß einen tiefen, erleichterten Seufzer aus, als sie ihn von der anderen Seite kommen und um die Veranda herumgehen sah.
Er war allein.
Es muss also doch falscher Alarm gewesen sein. Aber warum hatte er dann so lange gebraucht? Die Hintertür stand wohl offen, und er ist ins Haus gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Wer immer das Geräusch verursacht hatte, war vermutlich schon weg, als Dexter eintraf. Entweder das, oder er hatte ein gutes Versteck gefunden. Darüber wollte sie gar nicht weiter nachdenken.
Er winkte ihr zu.
Clara machte ihm ein Zeichen, er solle zu ihr herüberkommen.
Er nickte, den Stetson tief ins Gesicht gezogen, und Clara verließ ihren Platz am Fenster. Sie humpelte durch das Wohnzimmer, öffnete die Vordertür und machte einen Schritt nach draußen, um das Fliegengitter für ihn aufzuhalten.
Dexter ging langsam und mit gesenktem Kopf durch die Dunkelheit.
»Du hast ihn wohl nicht gefunden, was?«
Dexter gab keine Antwort. Er blickte auch nicht auf.
»Dexter, was ist los?«
Er schüttelte den Kopf.
Als er die Stufen zum Eingang hochstieg, beugte Clara sich zur Wand und schaltete das Licht an.
Blut! Überall auf seinem Uniformhemd und seiner Hose, als ob ihm ein ganzer Kübel davon über den Kopf gekippt worden wäre.
»O Gott!«, keuchte Clara. Sie hielt sich die Hand vor den Mund.
Dexter nahm den Stetson ab und grinste sie an. Im ersten Moment glaubte sie, dass er eine Halloweenmaske trug, um sie zu erschrecken. Doch dann erkannte sie, dass es gar keine Maske war. Und es war auch nicht Dexter, der in dieser blutdurchtränkten Uniform steckte.
Ein nackter Fuß trat ihr den Stock weg.
Leise ächzend fiel sie gegen den Mann, der sie ins Haus schleuderte.
Ihr Kopf knallte hart auf den Boden.
Wimmernd schlug sie die Augen auf.
Die Eingangstür fiel ins Schloss, und der Mann stand über ihr.
2
In dieser Nacht erwachte Eric Prince vom starken Druck in seiner Blase. Er stieg aus dem Bett und ging zur geschlossenen Zimmertür.
Unter dem Türknopf klemmte ein Stuhl mit gerader Lehne. Eine Vorsichtsmaßnahme, die er immer ergriff, wenn er allein im Haus schlief. Obwohl er mit fünfzehn Jahren eigentlich zu alt war, um sich im Dunklen zu fürchten, mochte er das sichere Gefühl, seine Tür verrammelt zu haben.
Als er den Stuhl wegzog, fragte er sich, ob seine Mutter wohl schon zu Hause war. Er hatte keine Ahnung, wie spät es war. Als er die Tür aufzog, sah er jedoch, dass das Flurlicht noch brannte.
Mum hätte es ausgeschaltet.
Sie musste noch aus sein. Und damit kehrte das unruhige Gefühl zurück, das ihn immer befiel, wenn Mum zu einer Verabredung ging – die Angst, dass er am Morgen aufwachte und sie noch immer weg war. Er stellte sich vor, wie er wartete und wartete, doch sie kam nie mehr zurück.
Vielleicht war sie mit einem gut aussehenden Fremden durchgebrannt, den sie in einer Bar getroffen hatte. Eric würde eine Postkarte erhalten, eine Woche später, aus einer weit entfernten Stadt.
Oder sie kam bei einem Autounfall ums Leben.
Oder am allerschlimmsten – diese Angst hatte er seit der Lektüre eines alten Taschenbuchs namens Auf der Suche nach Mr. Goodbar: Sie lernte bei einer ihrer Verabredungen einen bösen Mann kennen und wurde von ihm ermordet.
Chief Boyanski würde zu ihrem Haus kommen. »Junge, ich fürchte, ich habe schlimme Neuigkeiten für dich.«
Dann wäre Eric einsam und verlassen. Eine Waise. Niemand auf der ganzen Welt würde sich seiner annehmen. Er wäre dann wie Das Mädchen am Ende der Straßeund würde ganz allein in dem Haus leben …
Diese Gedanken wühlten ihn so sehr auf, dass er hellwach war, als er die Badezimmertür öffnete und einen nackten Mann pinkeln sah. Eric wich zurück und fing an zu schreien. Der Mann zuckte zusammen.
Er rannte zu seinem Zimmer und krampfte die Muskeln zusammen, damit er sich nicht einnässte. Er war beinahe an seiner Tür angelangt, als seine Mutter in den Flur trat.
Gegen die Helligkeit anblinzelnd, verknotete sie den Gürtel ihres fadenscheinigen Flanellbademantels. Ihr Haar war zerzaust, und sie sah verwirrt aus. »Eric, warum bist du wach?«
»Da ist ein Mann auf dem Klo!«
»Oh. Das ist nur Sam.« Sie schenkte ihm ein trauriges Lächeln. »Er hat dich wohl ziemlich erschreckt, oder?«
Eric nickte.
Vom anderen Ende des Flurs erklang die Toilettenspülung.
»Hört sich an, als wäre er gleich draußen«, meinte Mum.
»Wer ist er?«
»Ein Freund.«
Sie ist nackt unter diesem Bademantel.
Eric wandte sich von ihr ab. »Nacht.« Er ging in sein Zimmer, schloss die Tür hinter sich und blieb reglos in der Dunkelheit stehen.
»O verdammt«, hörte er den Mann sagen. »Das tut mir so leid.«
»Ist schon okay«, erwiderte Mum. Sie klang bedrückt. »So etwas musste früher oder später ja passieren.«
Er hörte, wie sich ihre Schritte entfernten.
»Vielleicht sollte ich besser gehen«, sagte der Mann.
»Nein, bitte bleib.«
»Möchtest du nicht mit ihm sprechen?«
»Das kann warten. Es wäre jetzt auch kein guter Zeitpunkt.«
Er vernahm das leise Klicken einer Tür, die geschlossen wurde. Falls sie noch immer miteinander sprachen, konnte Eric sie nicht mehr hören.
Er öffnete die Tür. Der Flur lag verlassen und unbeleuchtet vor ihm. Eric schlich sich ins Badezimmer und schloss sich ein, für den Fall, dass der Mann zurückkam. Mit heruntergezogener Hose stellte er sich vor die Toilettenschüssel und begann zu urinieren.
Der Mann hatte genau hier gestanden, nackt. Ganz so, als ob ihm das Haus gehörte. Und er hatte so ein großes Ding. Hatte er das in seine Mum … Natürlich hatte er das getan. Von dem Gedanken wurde Eric schlecht, und er fühlte sich, als ob er zu schnell einen Milchshake getrunken hätte.
Nachdem er die Spülung betätigt hatte, ging er zurück zu seinem Zimmer. Er öffnete die Tür und zog sie gleich darauf, ohne hineinzugehen, wieder ins Schloss. Das Geräusch durchdrang die Stille.
So leise er konnte, verließ er das Haus durch die Hintertür. Von dort lief er durch das kühle, nasse Gras an der Hauswand entlang bis zur Einfahrt. Dort stand Mums VW. Ein größeres Auto parkte am Straßenrand.
Eric starrte das Auto eine ganze Weile an und dachte über den Mann nach, dem es gehörte und der genau in diesem Augenblick im Bett seiner Mutter lag. Der sie fickte. Ficken. Das klang so schmutzig und aufregend – wie sich einen runterholen, nur hundertmal besser. Er träumte sehr oft davon, es zu tun. Und er malte sich aus, dass es die tollste Sache der Welt sein musste, besonders wenn das Mädchen jemand so Hübsches wie Ms. Bennett oder Aleshia Barnes war. Und selbst wenn das Mädchen nicht hübsch war, wäre es wundervoll, sie nackt zu sehen, ihre Brüste berühren zu dürfen. Er konnte sich kaum vorstellen, wie es war, Brüste anzufassen. Sie mussten so weich sein …
Er sah an sich hinunter. Sein Penis ragte steif aufgerichtet aus dem Schlitz der Pyjamahose. Zitternd ließ er seine Finger an ihm entlanggleiten. Dann bedeckte er sich hastig. Dies war nicht der richtige Moment, um geil zu werden.
Er lief zum VW und ging neben ihm in die Hocke. Ein Blick über die Motorhaube zeigte ihm, dass die Fenster zum Schlafzimmer seiner Mutter dunkel waren. Nachdem er zum Heck des Wagens gekrochen war, kauerte er sich wieder hin. Er sah nach links und rechts: Auf der Straße regte sich nichts. Und auch in den nahe gelegenen Häusern schien alles ruhig zu sein.
Es gab keinen Grund, noch länger zu warten.
Über den Asphalt rannte er zum Heck des anderen Autos und duckte sich hinter den Kofferraum. Auf Händen und Knien kauernd, durchwühlte er den Dreck im Rinnstein. Seine Finger stießen auf durchweichtes Laub, Zweige und etwas Glitschiges, das sich ihm entwand. Dann ertastete er schließlich eine dreieckige Glasscherbe von einer zerbrochenen Flasche.
Genau das, was er suchte.
Er hielt die Scherbe fest umklammert, presste sie auf den Kofferraumdeckel und machte einen langen Kratzer in den glänzenden Lack. Es klang, als ob jemand mit Fingernägeln über eine Tafel schabte, und das Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Aber es hielt ihn nicht davon ab, weiterzumachen.
Er ritzte ein großes X in das Blech. Als er fertig war, strich er mit dem Finger eine der beiden Furchen entlang und lächelte.
3
Sam Wyatt wachte auf. Das Schlafzimmer lag in grauem Dämmerlicht, und es war kühl. Doch unter der Decke war ihm warm. Er rollte sich zu Cynthia herum und sah, dass ihre Augen offen waren. Sie drehte ihm den Kopf zu und lächelte traurig.
»Hast du gar nicht geschlafen?«, fragte er.
»Ein wenig schon, glaube ich.«
»Machst du dir Sorgen um Eric?«
Sie nickte. »Ich fühle mich so verdammt mies.« Beim letzten Wort zitterte ihre Stimme, und sie presste die Lippen fest aufeinander. Es schien, als würde sie nur mühsam die Tränen zurückhalten.
Sam legte eine Hand auf Cynthias Bauch und bemerkte, wie heiß ihre Haut sich anfühlte. Sie streichelte seinen Handrücken.