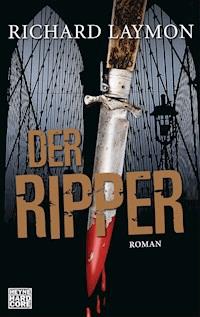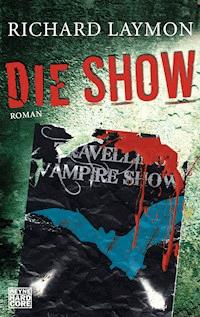8,99 €
8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach der Katastrophe beginnt das Grauen
Ein schweres Erdbeben erschüttert Los Angeles. Im darauf folgenden Chaos versucht Clint, zu seiner Familie zurückzukehren. Mit der cleveren Em muss er sich der plündernden und mordenden Horden erwehren, die L. A. heimsuchen. Er muss sich beeilen, denn seine Frau ist unter den Trümmern ihres Hauses verschüttet – und ihrem psychopathischen Nachbarn Stanley hilflos ausgeliefert.
Ultraharter Horror vom heimlichen Meister des Schreckens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2010
3,8 (50 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ZUM BUCH
DER AUTOR
LIEFERBARE TITEL
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Copyright
ZUM BUCH
Ein schweres Erdbeben sucht Los Angeles heim. Sobald die Erschütterungen vorbei sind, bricht das eigentliche Chaos in der zerstörten Stadt aus. Clint Banner wird von dem Beben in seinem Büro überrascht. Er will so schnell wie möglich zu seiner Familie, doch auf den Straßen herrscht Anarchie. Gemeinsam mit einer hysterischen Frau und der cleveren, erst dreizehn Jahre alten Em macht er sich auf eine Odyssee durch das von Plünderern heimgesuchte L. A. Und die Zeit drängt: Clints Frau Sheila ist unter den Trümmern ihres Hauses verschüttet und kann sich nicht aus eigener Kraft befreien. Was ihr Nachbar, der psychopathische Stanley, gnadenlos ausnutzt.
Wenn Menschen zu Bestien werden - Richard Laymons gnadenlos überdrehter Höllenritt durch ein apokalyptisches L. A. ist nichts für schwache Nerven.
DER AUTOR
Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und studierte in Kalifornien englische Literatur. Er arbeitete als Lehrer, Bibliothekar und Zeitschriftenredakteur, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete und zu einem der bestverkauften Spannungsautoren aller Zeiten wurde. 2001 gestorben, gilt Laymon heute in den USA und Großbritannien als Horror-Kultautor, der von Schriftstellerkollegen wie Stephen King und Dean Koontz hoch geschätzt wird.
Richard Laymon im Internet: www.rlk.cbj.net
LIEFERBARE TITEL
Rache - Die Insel - Das Spiel - Nacht - Das Treffen - Der Keller - Die Show - Die Jagd - Der Regen - Der Ripper - Der Pfahl
Dieses Buch ist Mike Bailey gewidmet - einem Herausgeber, wie ihn sich alle Autoren wünschen, aber selten finden.
Danke, Mike.
1
Zwanzig Minuten vor dem Beben stand Stanley Banks an seinem Wohnzimmerfenster. Er hielt den Sportteil der L. A. Times auf Brusthöhe vor sich, aber tat nur so, als ob er darin las. So machte er es jeden Morgen. Für den Fall, dass Mutter ins Zimmer rollte und ihn am Fenster erwischte.
Meistens blieb sie in der Küche, trank Kaffee, qualmte ihre Zigaretten und hörte Radio.
Manchmal jedoch tauchte sie überraschend auf, und da bot die Tageszeitung eine gute Deckung.
Mittlerweile wusste sie, dass Stanley sich angewöhnt hatte, am Fenster im Morgenlicht die Titelseite des Sportteils zu studieren.
Das hatte er ihr oft genug erklärt.
Natürlich war das nicht die Wahrheit.
In Wahrheit stand er dort, um den Bürgersteig zu beobachten.
Gerade spähte er über den oberen Rand der Zeitung.
Er hoffte, dass er sie nicht verpasst hatte.
Er schaute auf seine Armbanduhr. Punkt acht. Innerhalb der nächsten fünf Minuten müsste sie am Haus vorbeigerannt kommen.
»Stanley!«, rief seine Mutter. »Stanley, sei so gut und hol mir ein paar Streichhölzer.«
Stanley spürte, wie sich seine Kehle zuschnürte.
»Gleich«, rief er.
»Bitte tu, was ich dir gesagt habe.«
Ich werde sie verpassen!
Vielleicht nicht. Wenn ich mich beeile.
Er warf die Zeitung auf den Beistelltisch, schritt durch das kleine Wohnzimmer zum Kamin, griff sich eine Handvoll Streichholzbriefchen aus dem Bastkorb auf dem Sims und eilte durch das Esszimmer in die Küche. Er warf die Streichholzbriefchen vor seiner Mutter auf den Tisch, wo sie hart aufprallten und in alle Richtungen davonstoben. Ein Briefchen fiel auf den Boden neben ihren Rollstuhl.
Stanley fuhr herum. Er hatte einen einzigen Schritt aus der Gefahrenzone geschafft, als eine strenge Stimme verlangte: »Bleib sofort stehen!«
»Mut-terrr.«
»Sieh mich an, wenn ich mit dir rede.«
»Jawohl, Ma’am.« Stanley sah sie an.
Alma Banks schielte ihn durch ihre pink gerahmte Brille an, schob sich eine Virginia Slims zwischen die Lippen und riss ein Streichholz an. Sie sog die Flamme durch ihre Zigarette heran, inhalierte und stieß zwei graue Rauchwolken durch ihre Nasenlöcher.
»Ich hatte dich um Streichhölzer gebeten, junger Mann, nicht um einen Wutausbruch.«
»Es tut mir leid. Wenn du nur ein paar Minuten länger gewartet hättest …«
»Ist deine Zeit zu kostbar, um deiner eigenen Mutter einen kleinen Gefallen zu erweisen?«
»Nein«, sagte er, »tut mir leid.«
Ich werde sie verpassen!
»Streichhölzer, mehr wollte ich nicht. Streichhölzer. Verlange ich denn so viel von dir? Du bist ein erwachsener Mann. Du bist zweiunddreißig Jahre alt. Du lebst in meinem Haus. Du isst mein Essen. Ist es da zu viel verlangt, wenn du alle Jubeljahre mal etwas für mich erledigen sollst? Ist es das?«
»Nein. Es tut mir leid. Kann ich jetzt gehen?«
»Ob du jetzt gehen darfst?«
»Darf ich? Bitte.«
»Geh!« Ein Wedeln ihrer Hand brachte Bewegung in die Rauchwolke vor ihrem Gesicht.
»Danke, Mutter.« Er ging zurück zum Wohnzimmer und zwang sich, nicht zu hetzen. »Ich bin in ein paar Minuten zurück und spüle das Geschirr. Ich will nur den Sportteil fertiglesen.«
»Du und dein Sportteil. Der läuft dir doch nicht weg, oder?« Sie gab keine Ruhe, aber sie folgte ihm nicht. Von ihrem Rollstuhl war kein Geräusch zu hören. Anscheinend reichte es ihr, ihn mit ihrer Stimme zu verfolgen. »Deine kostbare Sportseite löst sich nicht in Luft auf, das weißt du doch? Die ist nachher auch noch da.«
Aber Stanley stand schon am Fenster.
»Kann der Sportteil nicht mal zwei Minuten warten, damit du deiner Mutter ein paar Streichhölzer suchst?«
»Ich habe dir Streichhölzer geholt«, rief er.
»Vor mich hingeknallt hast du sie.«
»Tut mir leid.«
»Das sollte es auch.«
Er blickte auf seine Armbanduhr: drei Minuten nach acht.
Wenn ich sie verpasst habe …
»Ich werde nicht für immer da sein, das weißt du doch?«, erinnerte ihn Alma.
Gleich würde sie auf die Tränendrüse drücken.
Stanley war selbst zum Heulen zumute. Für heute hatte er seine Chance verpasst, darum betrogen durch die egoistischen Launen seiner …
Und dann erschien sie.
Mein Gott, dachte Stanley.
Ganz egal, wie oft und wo er sie sah, und ganz egal, was sie trug: Der Anblick von Sheila Banner versetzte seinem Herz immer wieder einen Schlag, ließ ihn nach Luft ringen und seinen Penis auferstehen.
»Oh, Sheila«, flüsterte er.
Sie tauchte hinter dem Oleander an der linken Seite des Rasens auf. Die langen Beine gestreckt, schwang sie ihre Arme anmutig und entspannt. Ihre Schuhe und Söckchen waren so weiß wie in der Sonne glänzender Schnee. Ihre goldbraunen Beine leuchteten lebhaft im Spiel der Muskeln. Bis zum goldenen Rand ihrer Shorts waren sie unbedeckt.
Die königsblauen Shorts schimmerten, als sie lief. Stanley konnte spüren, wie sie Sheila von den Oberschenkeln über den Hintern in fließenden Bewegungen umschmeichelten und sich samtig und warm zwischen ihren Beinen rieben.
Sie trug ein altes verwaschenes blaues T-Shirt, das ihr zu groß war. Ihre Oberkörper hob und senkte sich mit dem Hüpfen ihrer Brüste. An ihrem beständigen Rhythmus konnte Stanley erkennen, dass sie einen BH trug.
Sie lief niemals ohne BH.
Tatsächlich konnte Stanley ihn sehen, als sie ihren rechten Arm zurückzog. Er blitzte in der Ärmelöffnung des T-Shirts auf. An diesem Morgen trug sie einen weißen BH.
Das Ärmelloch gewährte Stanley einen großzügigen Einblick.
Wenn sie doch bloß keinen BH tragen würde. Dann hätte er den größten Teil ihrer Brust durch die Ärmelöffnung sehen können. Und so wie das T-Shirt an der Hüfte abgeschnitten war und von ihren Brüsten herabhing, hätte er dann von unten hineinspähen und beide Brüste sehen können. Ihre weichen runden Unterseiten …
Sicher, dachte er, aber dazu müsste ich auf dem Bürgersteig liegen.
Nachdem er festgestellt hatte, dass sie heute - wie immer - einen BH trug, lenkte Stanley seinen Blick auf ihr Gesicht. Ein herrliches Gesicht: gleichzeitig weich und hart, zierlich und kraftvoll, Samt und Granit, unschuldig und welterfahren. Und trotzdem so wunderschön - das Gesicht eines Filmstars und einer Kriegergöttin, vereint in der atemberaubenden, unglaublichen Sheila Banner.
Wie ein üppiges Goldbanner wehte denn auch ihr Haar im Wind. Es war das Letzte, was Stanley von ihr sah, als sie die Hecken am anderen Ende der Einfahrt passierte.
Zitternd holte er tief Luft.
Dann griff er sich wieder den Sportteil und ging zum Polstersessel in der Ecke des Zimmers. Nachdem er sich gesetzt hatte, drückte er sich gegen die Rückenlehne, so dass sie nach hinten kippte und die Fußablage hochschwang. Er starrte die Zeitung an.
Er stellte sich vor, wie er Sheila verfolgte.
Wie er auf den Bürgersteig hinausrannte, nachdem sie vorbeigelaufen war, und ihr zu folgen begann - selbstverständlich in diskretem Abstand.
Es wäre nicht gegen das Gesetz.
Warum tue ich es nicht?, fragte er sich. Warum tue ich es nicht einfach, anstatt nur hier zu sitzen und davon zu träumen?
Dann müsste sie auf mich aufmerksam werden.
Und dann?
Ja, dann. Dann würde sie Stan the Man sehen, die kompletten Einmeterachtundachtzig, sämtliche 140 Kilo, wie sie rot angelaufen und verschwitzt hinter ihr herstolperten. Sie würde nicht gerade vor Zuneigung dahinschmelzen. Sie wäre entweder angeekelt oder verängstigt. Oder beides.
Vielleicht sähe sie auch, aus welchem Haus ich gekommen bin, und ändert ihre Route. Dann hätte ich sie zum letzten Mal gesehen.
Vielleicht merkt sie dann auch, dass mein Haus direkt an ihren Gartenzaun anschließt, und macht sich Gedanken darüber, was ich sonst noch anstellen könnte … Vielleicht wird sie dann vorsichtiger, lässt die Vorhänge nicht mehr so weit aufstehen, zeigt sich nicht mehr so oft im Hof. Vielleicht warnt sie dann auch ihre Tochter vor mir.
Auch ein schönes Mädchen. Aber nicht annähernd in der gleichen Liga wie ihre Mutter. Für Stanley kam niemand an sie heran. Sheila Banner spielte in ihrer eigenen Liga.
Er wünschte, er hätte Fotos von ihr, aber er traute sich nicht, ein paar heimliche Aufnahmen mit seiner guten Minolta zu machen. Er müsste den Film entwickeln lassen. Die Leute im Fotolabor würden den Film sehen. Sie könnten Verdacht schöpfen. Am Ende wäre einer gar noch ein Freund von Sheila.
Das konnte Stanley nicht riskieren.
Stanley hatte mal eine Polaroidkamera. Er hatte sie kurz nach dem Wiedereinzug in das Haus seiner Mutter gekauft, vor zehn Monaten. Er musste einfach Fotos von der unglaublichen Frau haben, die jeden Morgen an seinem Fenster vorbeilief, die direkt hinter ihm lebte.
Leider hatte er den Fehler begangen, die neue Kamera seiner Mutter zu zeigen. Bevor er überhaupt die Gelegenheit bekam, sie einzusetzen.
Sie hatte die Polaroid hin und her gedreht und inspiziert. Dann hatte sie die Augen zusammengekniffen. »Glaubst du auch nur eine Sekunde, dass ich nicht weiß, wofür das ist?«
Er war puterrot angelaufen.
»Wovon redest du?«, platzte es aus ihm heraus.
»Als ob du das nicht wüsstest. Von wem willst du deine schmutzigen Bilder machen? Von mir?«
»Nein!«, schrie er.
Dann konnte er nur noch zusehen, wie Mutter die Sofortbildkamera Richtung Kamin schleuderte, wo sie an den Steinen zerbrach. Plastikstücke und Glas spritzten wie Schrapnells durch die Luft. Die Reste der zerstörten Kamera krachten nach kurzem Flug auf die Kamineinfassung.
»Das lasse ich nicht zu«, informierte sie ihn. »Nicht in meinem Haus. Nicht jetzt. Niemals. Ich schäme mich für dich.«
Im Gedenken an das Schicksal seiner Polaroid entfuhr Stanley ein Seufzer.
Ich bin so ein Feigling, dachte er.
Ich hätte mir am nächsten Tag eine neue Kamera kaufen können. Ich könnte mir heute eine kaufen.
Was Mutter nicht weiß, macht sie nicht heiß.
Aber wenn sie mich erwischt …
Wenn sie mich erwischt.
Stanley wünschte, er hätte den Mumm, den kleinen Refrain zu ignorieren. Wenn sie mich erwischt. Oh, was er schon alles getan hätte, wenn das nicht so wäre. Was er alles hätte erleben können. Die ganzen großen Möglichkeiten …
Er war zweiunddreißig Jahre alt und schien sein ganzes Leben verpasst zu haben.
Er hatte es verpasst, weil es immer eine Frau gab, die über ihn wachte wie eine Gefängniswärterin. Erst war es Mutter gewesen, dann seine Frau Thelma und nun wieder Mutter.
Ich hätte nicht hier einziehen dürfen, sagte er sich. Das war so was von dämlich.
Mutter hatte ihn nach Thelmas Tod angebettelt, zu ihr zu ziehen. So schlecht erschien ihm die Idee damals nicht. Zum einen besaß Mutter ein gewisses Maß an Wohlstand und ein kleines Stuckhaus, das fast 400 000 Dollar wert war. Zum anderen hatte Stanley mit Thelma auch seinen Job verloren.
Thelma war die einzige Frau gewesen, die sich je etwas aus ihm gemacht hatte. Deshalb hatte er sie trotz ihres Alters, ihres Gewichts und ihres Gesichts zwei Wochen nach seinem High-School-Abschluss geheiratet. Zu der Zeit war sie bereits eine einigermaßen erfolgreiche Kinderbuchautorin gewesen und verdiente genug Geld für zwei. Ohne eigenen Jobzwang hatte Stanley begonnen, für seine Frau zu arbeiten: Er beantwortete ihre Fanpost, fotokopierte und versandte ihre Manuskripte und so weiter. Er war so etwas wie ihr Sekretär - und noch nicht mal ein besonders guter.
Mit Thelmas Tod waren Stanleys Aussichten auf einen halbwegs anständigen Job in weite Ferne gerückt. Dass er von ihren Tantiemen leben konnte, war höchst zweifelhaft.
Deshalb hatte er sich bereiterklärt, zu seiner Mutter zu ziehen.
Und damit seine Chance auf ein Leben in Freiheit verpasst.
Er war wie ein Gefangener, dessen Wächter im Dienst tot umgefallen war und die Zelle offen gelassen hatte. Er hätte fliehen können. Es hätte nur eines Quäntchens Mumm bedurft. Stattdessen hatte er wie ein vorbildlicher Häftling darauf gewartet, dass ein neuer Bewacher auftaucht.
Aber man hat eine tolle Aussicht von dieser Zelle, sagte er sich und grinste.
Sheila.
Sonst hätte ich sie nie zu Gesicht bekommen.
Stanley warf einen Blick auf seine Uhr.
Sechzehn Minuten nach acht.
Sheila musste jetzt schon seit längerer Zeit wieder zu Hause sein. Bei all den Gedanken, die ihm im Kopf herumspukten, hatte er es verpasst, ihren Tagesablauf in seiner Fantasie nachzuverfolgen.
Er überlegte sich, so zu tun, als ob er nichts verpasst hätte. Das hatte er schon öfter getan, aber es war nicht das Gleiche. Der Kick lag darin, sie sich im gleichen Moment vorzustellen, in dem sie diese Dinge tat: ihr Lauftraining beenden, den Hausschlüssel herausholen …
Wo hatte sie ihn nur an diesem Morgen aufbewahrt? Vielleicht in eine Socke gesteckt? Das war ihr zu gewöhnlich. Nein, vielleicht in den Bund ihres Höschens geschoben? Vielleicht hatte sie ihn sicher im Körbchen ihres BHs untergebracht, wo er einen Abdruck auf einer Brust hinterließ. Es gab so viele Orte, an denen der Schlüssel sein konnte, ein warmes Geheimnis, das sich an ihre Haut schmiegte. Orte, an denen sie mit langen Fingern danach fischen musste …
Hör auf damit, ermahnte er sich. Du hast das alles verpasst. Du musst aufholen, damit ihr zeitgleich seid.
Mittlerweile hatte sie wahrscheinlich ihre durchgeschwitzten Klamotten ausgezogen.
Stanley liebte es, sich das vorzustellen. Wie sie mit einem Schuh begann, auf einem Bein balancierte, während sie das andere anhob, sich leicht vorbeugte und den Schuh mit …
Aufholen, aber schnell!
Ja. Genau. Was macht sie gerade in diesem Moment?
Stanley sah auf die Armbanduhr.
Acht Uhr neunzehn.
Wahrscheinlich stand sie bereits unter der Dusche und ließ den heißen Wasserstrahl an ihrem nackten Körper herabrieseln. Vielleicht hatte sie es sich auch in ihrer Badewanne bequem gemacht.
Stanley wusste nicht, ob sie Duschen oder Baden bevorzugte.
Zu ihrem athletischen Typ passte Duschen besser, aber ihre sinnliche weibliche Seite würde es genießen, sich in einem heißen Bad auszustrecken.
Also mochte sie beides, ganz wie es ihr in den Sinn kam.
Wie es mir in den Sinn kommt, korrigierte sich Stanley.
Heute schien ihm ein Tag zum Duschen zu sein.
Nachdem er den Sportteil zusammengefaltet und auf seinen Schoß gelegt hatte, schloss Stanley die Augen. Vor sich sah er durch aufsteigenden Wasserdampfnebel die Türen zur Duschkabine. Es waren Schiebetüren aus klarem Glas. Trotz des Dampfes waren sie nicht beschlagen. Er konnte hindurchsehen, als ob es sie gar nicht gab.
Er sah, wie Sheila nackt unter dem Duschkopf stand, ihren Rücken dem Wasserstrahl zugewandt, den Kopf zurückgelegt, die Ellenbogen erhoben, die Finger durchs nasse Haar fahrend. Ihr Gesicht glänzte vom Wasser. Strahlende Flüsschen perlten über ihre Brüste herab, die im Rhythmus ihrer Armbewegungen leicht erbebten. Wie flüssige Diamanten sammelten sich Tropfen an den Spitzen ihrer Nippel und fielen dann, einer nach dem anderen …
Stanleys Sessel begann zu wackeln. Erst dachte er, seine Mutter hätte irgendwie Wind von seinen schmutzigen Tagträumen bekommen und ihn mit ihrem Rollstuhl gerammt. Erwischt, du dreckiger Perversling!
Als er die Augen öffnete, wurde ihm jedoch klar, dass Mutter nichts mit dem beunruhigenden Stoß zu tun hatte.
Sie befand sich nicht im Zimmer, und das Zimmer wackelte so sehr hin und her, dass es vor seinen Augen verschwamm.
Neben ihm fiel die Lampe um.
Er warf die Zeitung beiseite, lehnte sich vor und schob die Fußablage nach unten. Er drückte sich aus dem Sessel und schrie: »Erdbeben!«
Natürlich wusste Mutter schon Bescheid.
Stanley konnte sie schreien hören, lauter als seine eigene Stimme, lauter als das Getöse des Bebens, das Klirren der Vorderfenster und den Krach der Dinge, die im ganzen Haus zu Boden gingen, zusammen.
Ein Gipsbrocken traf ihn an der Schulter, als er bereits auf halbem Weg zur Haustür war. Gips?
Die Decke!
Ich muss hier raus!
Er rüttelte und drehte am Türgriff. Da sich die Tür nicht öffnen wollte, fiel ihm ein, dass er den Sicherungsbolzen lösen musste. Er ließ den Griff los und versuchte den Türriegel zwischen Daumen und Zeigefinger aufzudrehen. Er entglitt ihm wieder und wieder.
»Scheißding!«, schrie Stanley.
Dann erwischte er den Knopf und drehte schnell den Bolzen. Im gleichen Moment bäumte sich das Haus wieder unter ihm auf. Er klammerte sich am Türgriff fest und konnte einen Sturz knapp vermeiden.
»Stanley!«, kreischte seine Mutter. »Hilf mir! Hilf mir!«
Er warf einen Blick zurück über die Schulter.
Und da kam Mutter auch schon. Vornübergebeugt rollte sie aus dem Esszimmer wie ein Sportler kurz vor der Ziellinie. Putz und Gipsbrocken fielen links und rechts von ihr zu Boden, als die Zimmerdecke brach. Weißer Staub senkte sich auf sie nieder.
»Stanley!«, heulte sie.
»Ich muss die Tür aufkriegen!«
Er drehte und zerrte am Türgriff. Die Tür fiel ihm entgegen. Er hatte vergessen, die Türkette auszuhängen, bemerkte den Fehler aber erst, als ihn das Schloss mitsamt Kette an der Stirn erwischte.
Er stolperte rückwärts und riss die Tür mit sich. Ihr Gewicht begann ihn seitwärts gegen das zerbrochene Fenster zu drücken. Er ließ den Türgriff los und fiel. Der Polstersessel fing seinen Sturz ab. Die Lehne klappte nach hinten, die Fußablage schoss hoch. Krachend kam der Sessel an der Wand zum Stehen.
Zurück auf Los!
Stanley verbarg den Kopf in den Armen und schrie.
Und er beobachtete seine Mutter.
Er hörte auf zu schreien.
So ernst die Situation auch war, das Ganze entbehrte nicht einer gewissen Komik. Komisch, dass es ihn wieder in den Polstersessel zurückgeworfen hatte. Noch komischer war, dass Mutter es aufgegeben hatte, zur Tür zu rollen - vielleicht war ihr Weg von Deckentrümmern versperrt? - und sich nun wie besessen im Kreis drehte. Mit Schreien hatte sie aufgehört. Um Stanleys Hilfe flehte sie ebenfalls nicht mehr.
Sie drehte wie eine Verrückte an den Speichenrädern ihres Rollstuhls, kreiselte herum und schrie, kreiselte und schrie: »Oh je, oh je, oh je, oh je.«
Ein tellergroßes Stück Putz fiel direkt vor ihr von der Decke. Entweder hatte sie die Gefahr gewittert oder nur gehöriges Glück gehabt, jedenfalls brachte sie ihren Rollstuhl noch rechtzeitig zum Stehen. Der Deckenputz fiel ihr genau vor die Füße. »Oh je, oh je, oh …«
»Hey, Ma«, brüllte Stanley, »der Himmel fällt uns auf den Kopf!«
Sie schien ihn nicht zu hören.
Irgendein anderer jedoch möglicherweise schon, denn in diesem Augenblick stürzte das Haus ein. Wenn auch nicht ganz.
Der Hausteil, in dem sich das Wohnzimmer befand, blieb vom Einsturz verschont.
Aus seinem zurückgeklappten Polstersessel konnte Stanley lediglich sehen, was bis zum Durchgang zum Esszimmer passiert war: Deckentrümmer hatten Tisch und Stühle zerschmettert und unter einem Berg von Schutt, Holz und Stuck begraben. Durch den dicken Staubnebel konnte Stanley sehen, wie die Sonne den Schutthaufen beschien.
»Heilige Scheiße«, murmelte er.
Ich schaffe besser schnellstens meinen Arsch hier raus, dachte er.
Er stellte sich vor, wie er auf dem Weg zur Eingangstür einen Umweg machen würde. Wie er Mutter aus dem Rollstuhl hob und mit ihr loslief, links und rechts auswich, wenn die Stützbalken um ihn herum fielen. Wie er es gerade noch aus der Tür schaffte, bevor der Rest des Hauses einstürzte.
Denk nicht so lange nach und TU endlich was!
Was ist, wenn ich sie zurücklasse?
Was, wenn ich sie zurücklasse und das Haus einstürzt?
Das wäre doch wirklich tragisch.
Schaff bloß deinen eigenen Arsch hier raus - aber schnell!
Als er sich vorbeugte und die Absätze gegen die Fußablage stemmte, brach das Beben ab.
Auf das Getöse folgte tiefe Stille.
In die Stille mischten sich nach und nach leise Geräusche. Stanley konnte hören, wie das Haus knarrte, als die Erschütterungen nachließen. Er hörte das ferne Aufheulen von Alarmanlagen in Autos und Häusern. Weit weg bellten Hunde.
Vom Rollstuhl seiner Mutter war nichts zu hören. Von ihrer Stimme auch nicht.
Er sah sie an.
Bewegungslos saß sie im Rollstuhl, immer noch vornübergebeugt, die Hände um die Felgen gekrampft.
»Mutter?«
Sie bewegte sich nicht.
»Mutter, alles in Ordnung?«
Stanley erhob sich aus dem Sessel.
»Mutter?«
Sie hob den Kopf. Weißer Staub und Gipsbrocken fielen ihr von Haar und Schultern, als sie sich aufrichtete. Die pinkfarbene Brille saß schief auf ihrer Nase. Sie richtete sie und blinzelte Stanley an. Ihr Kinn zitterte. Spucke rann ihr aus dem Mund und zog feuchte Spuren im Gipsstaub.
»Ist es vorbei?«, fragte sie mit zittriger dünner Stimme.
»Es ist vorbei«, bestätigte Stanley.
Er ging zu ihr.
»Was machen wir jetzt nur?«
»Keine Sorge«, sagte Stanley.
Er kniete sich neben ihrem Rollstuhl nieder und hob ein Stück Putz von der Größe eines Pflastersteins auf. Er hielt es über ihren Kopf.
An ihrem Gesichtsausdruck konnte er sehen, dass sie wusste, was kommen würde.
»Stanley!« Sie zuckte zurück und hob ihren Arm.
Der schwere Gipsbrocken brach entzwei, als er ihren Kopf traf. Es knackte. Sie grunzte. Ihre Brille rutschte bis zur Nasenspitze, fiel aber nicht herunter.
Stanley hielt die Hälfte des Gipsbrockens in der Hand. Die andere Hälfte prallte an Mutters rechter Schulter ab und fiel zu Boden.
Sie saß einen Augenblick still.
Stanley hob den Brocken.
Als er überlegte, ein weiteres Mal zuzuschlagen, sank ihr Kopf nach vorn. Langsam rutschte sie vor. Ihre Brille fiel auf ihren Rock und zog ein kleines Tal zwischen ihre Schenkel.
Sie beugte sich weiter und weiter vor, als hoffte sie, zwischen ihren Knien hindurchsehen zu können und etwas Wundervolles unter ihrem Rollstuhl zu entdecken.
Stanley trat einen Schritt zurück und betrachtete sie.
Sie rutschte so weit nach vorn, dass ihre Handknöchel den Schutt auf dem Boden berührten. Dann hob sich ihr Oberkörper aus dem Rollstuhl. Ihr Kopf prallte auf den Boden. Sie machte einen unbeholfenen, schiefen Purzelbaum, der mehr von ihrer grauen Strumpfhose entblößte als Stanley lieb war. Hart schlugen die Beine auf, und der Aufprall ihrer Absätze ließ die Scherben des eingeschlagenen Fensters aufspritzen. Sie bäumte sich auf, als ob sie sich setzen wollte, fiel dann wieder um und lag still.
Stanley trat mit der Schuhspitze seines Mokassins nach ihrer Hüfte.
»Mutter? Mutter, alles in Ordnung?«
Sie regte sich nicht. Sie gab keine Antwort.
Er versetzte ihr einen anständigen Tritt. Ihr Kopf wackelte.
Stanley sah Blut aus ihrem Ohr laufen.
»Das ist ein schlechtes Zeichen«, sagte er und musste lachen.
Dann verging ihm das Lachen.
Schuld daran war der Gedanke, dass Sheila Banner unter den Trümmern ihres Hauses begraben sein könnte.
2
Eine Minute vor Ausbruch des Bebens gähnte Clint Banner und blickte in seine leere Kaffeetasse.
Die Tasse zierte ein Porträt von John Wayne als Rooster Cogburn in Der Marshal, ein Geburtstagsgeschenk seiner Tochter Barbara, die darauf bestand, dass Clint »genau wie John Wayne als Hondo« aussah. Sie hatte keine Tasse mit Hondo finden können und sich mit Cogburn zufriedengegeben. Ich weiß, dass du nicht so aussiehst, hatte sie gesagt und dabei das Gesicht verzogen. Clint hatte ihr geantwortet, indem er Tonfall und Stimme des Duke nachahmte: »Gib mir noch ein paar Jahre und eine Augenklappe, kleine Lady.«
Er gähnte erneut.
Es war acht Uhr neunzehn am Freitagmorgen. Er war seit halb fünf auf den Beinen, das war sein Trick, dem System ein Schnippchen zu schlagen. Aus dem Bett springen, sich im Bad anziehen, damit er Sheila nicht weckte, und sich um Viertel vor fünf auf die fünfundvierzigminütige Fahrt durch die Dunkelheit machen. Würde er zu einer vernünftigen Zeit aufstehen, etwa gegen sechs, würde ihn die Fahrt doppelt so viel Zeit kosten. Er war immer früh auf der Arbeit, damit er das Büro ein paar Stunden für sich allein haben konnte. Das gefiel ihm. Außerdem konnte man so um zwei gehen, vor der nachmittäglichen Rushhour. Es gab viele Vorteile.
Aber es kostete auch eine Menge Kraft.
Clint gähnte ein weiteres Mal, nahm die leere Tasse, schob seinen Stuhl zurück und erhob sich vom Tisch. Er wollte sich nachschenken. Aber so weit kam er nicht.
Fast hätte er noch Zeit gehabt, sich zu fragen, was das für ein Getöse war.
Aber nach Sekunden wusste er Bescheid. Das war kein riesiger Laster und auch kein Güterzug, der auf das Gebäude zu donnerte. Keine Boeing 747, die gleich die Mauern einriss.
Das Geräusch kam aus dem Nichts, und noch bevor Clint nachdenken konnte, wusste er, dass es ein Erdbeben war.
Es hörte sich an wie ein Erdbeben. Es fühlte sich an wie ein Erdbeben. Er lebte schließlich in Südkalifornien, der Hochburg der Erdbeben, also war es wohl kaum eine 747, die in das Gebäude einschlug. Es war kein Tornado, kein Kometeneinschlag und keine Atomexplosion. All das mochte sich ähnlich anhören und -fühlen, aber dies war ein Erdbeben.
Zuerst dröhnte es.
Dann versetzte es Clint einen schweren Stoß.
Er stolperte zur Seite, blieb aber auf den Beinen.
So hart hatte ihn noch nie ein Beben erwischt.
Das ist ein Mordsding, dachte er. Ziemlich gut. Vielleicht 6,0. Vielleicht stärker.
Jetzt müsste es wieder nachlassen.
Das tat es nicht.
Es wurde stärker.
Das Beben schüttelte die Jalousien so heftig, dass sie zu klappern begannen und von der Wand fielen. Es ließ die Fenster splittern und riss die Neonröhren herunter. Es ließ die Wände wackeln und grapschte sich die Deckenverkleidung. Papierabfall, Akten, Stifte, Adressverzeichnisse, Hefter flogen durch die Luft. Schubladen und Aktenschränke sprangen auf. Computertastaturen und Monitore rutschten und fielen zu Boden. Stühle schossen auf ihren Rollen durch die Gegend.
Mein Gott, das ist der Große Knall! Diesmal wirklich!
Er fragte sich, ob sein letztes Stündlein geschlagen hatte.
Du musst es durchstehen, sagte er sich. Es wird schon wieder aufhören.
Aber es war nicht leicht, das durchzustehen. Der Büroboden bockte unter ihm und bäumte sich auf. Der Teppich schlug Wellen - sechzig Zentimeter hohe Brecher, die auf die Wand zurasten.
Das gibt es doch nicht.
Aber er sah sie mit eigenen Augen - die Bodenbrandung.
Clint tänzelte und hielt die Balance.
Es ist ein Wettbewerb, dachte er. Wer gibt zuerst nach, Erdbeben oder Gebäude?
Wenn das Beben gewinnt, bin ich am Arsch.
Er begann zum Treppenaufgang zu sprinten, die Knie hochgerissen, Arme über dem Kopf. Springen und Ausweichen.
Nichts wie raus hier!
Beim Rennen erinnerte er sich an all die Binsenweisheiten, die er die Jahre über von sich gegeben hatte. Seine Erdbebenwitze. Der Richterskalen-Humor. Sein Lieblingsspruch: »Es gibt keinen Grund, vor Erdbeben Angst zu haben. So ein Beben ist völlig harmlos und hat noch nie jemandem geschadet.« Kleine Kunstpause. »Es ist der Scheiß, der dir auf den Kopf fällt, der dich umbringt.«
Oder wenn man die Treppe runterstürzt, fiel es ihm plötzlich ein.
Oben an der Treppe griff er nach dem Geländer und verfehlte. Er streckte sich erneut. Dieses Mal erwischte er das Holzgeländer. Aber es wurde ihm aus der Hand gerissen.
Kein Halt.
Der Treppenschacht sah aus wie ein enger Tunnel. Ein steiler dazu. Wie eine Geisterbahnrutsche in die Grube. Die Treppe ruckelte und zuckte bis nach unten, wo kein Licht mehr zu sehen war. Treppenabsatz und Tür befanden sich irgendwo da unten in der Dunkelheit.
Versuch es bloß nicht, sagte sich Clint. Warte, bis es aufhört zu wackeln.
Na sicher.
Er spurtete die Treppe hinunter, nahm zwei Stufen auf einmal und warf sich dabei gegen die Wände, um seine Balance zu halten.
Wie ein Sprint den Berg hinunter - mit einer Lawine im Genick. Wahrscheinlich wirst du kopfüber abschmieren, aber das Risiko ist es wert. Du musst nur schneller sein, einen Vorsprung halten, damit du nicht verschüttet wirst. Um jeden Preis den Vorsprung halten.
Ich muss hier raus!
Lauter als das tosende Beben war sein eigenes Schreien.
Am Treppenende knallte er gegen die Wand. Er prallte ab, fiel auf die Treppenstufen, bog sich hoch und schlug nach der flatternden Tür, bis er deren Griff erwischte. Er drückte ihn nach unten. Er warf sich gegen die Tür. Licht aus dem Eingangsbereich blendete ihn.
Er hetzte aus dem Treppenschacht, rannte durch den Empfangsbereich, warf sich gegen die Eingangstür und rannte hinaus in die Morgensonne.
Die Erde schüttelte sich noch immer, das Beben toste weiter.
Mein Gott, dachte Clint, es wird nie wieder aufhören!
Er schützte seinen Kopf mit beiden Armen und rannte auf die Straße. Weg von fliegenden Glassplittern und Wänden, die einstürzen könnten.
Clint torkelte. Das zweistöckige Gebäude, in dem die Kanzlei von Haversham & Dumont, seinem Arbeitgeber, untergebracht war, schien zu tanzen. Clint wusste, dass das Gebäude solche Bewegungen auf keinen Fall aushalten konnte, ohne Schaden zu nehmen. Es hüpft, aber nicht halb so viel wie ich, dachte er.
Er blickte die Straße auf und ab.
Sah ein paar Autos.
Konnte aber nicht sagen, ob sie näher kamen oder geparkt waren.
Wahrscheinlich stehen sie, dachte er. Niemand würde bei diesen Bedingungen weiterfahren.
Die Wagen wurden geschaukelt wie Nussschalen auf rauer See. Sie schienen vor Angst zu schreien, da das Beben die Alarmanlagen aktiviert hatte.
Ein Geräusch wie das Reißen eines schweren Stoffes ließ Clint herumfahren. »Du meine Güte!«, murmelte er. Sekunden zuvor war die Front des Bürogebäudes bis auf ein paar eingeschlagene Fenster noch intakt gewesen. Jetzt sah es aus, als ob sich eine Eiche den Weg durch die Stuckwand gebrochen hätte.
Bin gerade noch rausgekommen.
Eine Hupe plärrte. Ihr Lärm vermischte sich mit dem der Alarmanlagen, dem Tosen des Bebens und einer Heerschar anderer Geräusche - ein wildes Chaos von Klappern und Krachen und Sirenengeheul -, weshalb ihr Clint keine größere Beachtung schenkte.
Bis er die plärrende Hupe direkt in seinen Ohren spürte, sich umdrehte und einen roten Toyota Pick-up direkt auf sich zuschießen sah.
»Scheiße«, entfuhr es ihm, bevor er in Richtung Bürgersteig hechtete.
Im Sprung dachte er noch, es sei ihm einigermaßen gelungen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Bastard würde ihn nicht umbringen, schlimmstenfalls seine Füße abscheren.
Aber bis zur Landung spürte er keinen Schmerz. Der Asphalt zerschrammte seine Hände und Knie, schlug auf seine Brust, nahm ihm die Luft. Für einen Moment fühlte es sich an, als ob er über eine Käsereibe rutschte. Dann blieb er liegen. Bastard!, dachte er und hob den Kopf. Er wollte dem verrückten Arschloch am Steuer des Toyota die Meinung geigen. Aber zum Schreien fehlte ihm die Luft.
Das Arschloch hatte einige der großen weißen Buchstaben auf der Heckklappe übermalt und damit den Namen des Fabrikats in TOY abgeändert.
Clint wurde bewusst, dass er das Wort TOY klar und deutlich lesen konnte.
Das Beben hat aufgehört!
Gott sei Dank!
Dann dachte Clint Oh mein Gott!, denn der rote Toyota hatte an der Kreuzung genauso wenig sein Tempo verlangsamt wie für ihn, doch war dieses Mal kein Mensch im Weg, sondern ein grauer BMW, der von links in die Kreuzung einfuhr.
Kurz bevor sich die Straßen trafen, zog der TOY scharf nach rechts. Vielleicht hatte der Fahrer gedacht, es sei besser, über Randstein und Bürgersteig zu schlittern als von einer BMW-Breitseite getroffen zu werden. Hatte er den Strommast nicht bemerkt? Vielleicht hatte er gedacht, der Mast würde beim Aufprall wie ein Zahnstocher brechen und eine vergnügte Weiterfahrt erlauben.
Der Strommast brach tatsächlich in der Mitte.
Aber der Fahrer ließ ihn nicht in einem Splitterregen hinter sich.
Der Mast zersplitterte kein bisschen.
Sein Stumpf bohrte sich in die Vorderfront des TOY.
Der TOY kam sehr schnell zum Stehen.
Clint konnte nicht sehen, was mit dem Fahrer passiert war.
Doch der Mann vom Beifahrersitz krachte kopfüber durch die Windschutzscheibe. Er trug eine blaue Baseballkappe, ein kariertes Hemd und Jeans. Offensichtlich war er nicht angeschnallt gewesen.
Der Mann flog über die zerdellte Motorhaube des TOY. Die Oberseite seiner Baseballkappe war eingedrückt. Ihr Schirm hing auf einer Seite lose herab und flatterte wie ein gebrochener Flügel. Seine Jeans hingen ihm auf Kniehöhe, als er am Mast vorbeischoss. Die Jeans rutschten weiter und verwickelten sich kurz vor dem Aufschlag an seinen Fußgelenken.
Mit quietschenden Bremsen kam ihm der BMW in die Quere.
Mit dem Kopf zuerst schlug er ins Beifahrerfenster ein.
Das Fenster zersplitterte.
Sein Kopf durchstieß das Fenster, sein Körper nicht. Sein Körper knickte zur Seite weg, schlug gegen die Heckklappe und plumpste zappelnd und kopflos zu Boden, während der BMW zum Stehen kam und der Mast auf die Straße krachte.
Der TOY, dessen eingedrücktes Dach das eine Ende des Strommasts stützte, sah aus wie eine billige Blechparodie der Kreuzigung - ein Jesus auf Rädern, dem auf halbem Weg zum Kalvarienberg die Luft ausgegangen war.
Die abgerissenen, unter Strom stehenden Leitungen zuckten und knisterten hoch über den Querträgern.
Clint raffte sich auf. Falls eine der Leitungen in seine Richtung ausschlug, wollte er auf den Beinen sein.
So unkontrolliert wie sie sich bewegten, konnte man nie wissen …
Dann war der Strom weg. Die Leitungen erschlafften, fielen in sich zusammen und klatschten auf den Boden.
Es ist vorbei, dachte Clint. Vorbei. Und ich lebe noch.
Er holte tief Luft und sah sich um.
Nichts wackelte mehr. Die meisten Gebäude entlang der Straße standen noch, aber im nächsten Block waren zwei eingestürzt und hatten die Straße in südlicher Richtung mit Schutt übersät.
Autos schienen keine mehr zu fahren.
Ich habe es geschafft, dachte er. Der Große Knall ist vorbei, und ich bin noch da. Hab höchstens ein paar Kratzer abgekriegt.
Er blickte auf seine aufgeschürften Handflächen und die durchgescheuerten Knie seiner Hosen.
Keine große Sache.
Das mit dem Erdbeben war überhaupt kein Problem, es war der Toyota, der mich fast um die Ecke gebracht hätte.
Er stellte sich vor, das zu Sheila und Barbara zu sagen. Einen solchen Spruch erwarteten sie von ihm, und er durfte nicht vergessen, ihn anzubringen, wenn sie alle zusammensaßen und sich ihre Erlebnisse erzählten.
Was, wenn die beiden was abgekriegt haben?
Sie haben das Erdbeben auch erlebt, du Schwachkopf. Das Beben war derart stark … Vielleicht war es drüben im Westen nicht so schlimm. Es waren mehr als vierzig Kilometer Entfernung.
Vielleicht war es dort schlimmer.
Was weißt du schon? Sheila oder Barbara könnten …
Er verbot es sich, das Wort zu denken, aber stellte sich dennoch vor, sie seien tot. Sheila zu Hause, Barbara in der Schule. Beide zermalmt und blutig und tot.
Clint lenkte seinen Blick auf den hinausgeschleuderten TOY-Beifahrer und entdeckte rote Schmiere zwischen dessen Schultern. Hose und Schuhe waren verschwunden. Clint sah schnell wieder weg, um sich weitere Details zu ersparen.
Vielleicht sehen sie aus wie er.
Nein. Es geht ihnen gut.
ICH MUSS NACH HAUSE. SOFORT!
Clint bückte sich. In Bodennähe hatte das Gebäude Schlitze wie schmale längliche Fenster. Er suchte sie ab, bis er seinen alten Ford Granada entdeckt hatte. Nur das Dach und die Frontscheibe konnte er erkennen.
Der Wagen sah gut aus.
Genau wie das Parkdeck. Dort war nichts eingestürzt.
Er war froh, dass er keine anderen Wagen entdecken konnte. Er hatte angenommen, dass niemand sonst im Büro war, als das Beben ausbrach, aber absolut sicher war er sich nicht gewesen. Manche der Leute, die meistens gegen halb neun kamen, arbeiteten im Erdgeschoss, und nicht immer hörte er sie kommen.
Wahrscheinlich stecken sie noch irgendwo im Stau.
Der Verkehr wird unerträglich sein. Besser, ich halte mich von den Freeways fern und nehme die Nebenstraßen.
Er rannte auf den Eingang zum Parkdeck zu und fummelte in der Tasche nach seinen Schlüsseln.
Er hastete die kurze Einfahrt hinab, blieb am Sicherheitsrolltor stehen und fand den Schlüssel, um es zu öffnen. Seine Hand zitterte stark. Er nahm die andere zu Hilfe, um das Schlüsselloch zu treffen. Dann drehte er den Schlüssel.
Nichts passierte.
»Komm schon, komm schon.«
Er drehte den Schlüssel ein weiteres Mal.
Unter leisem Summen und metallischem Klappern hätte das Rolltor sich öffnen und den Weg zur Einfahrt freigeben müssen.
Das Summen blieb aus.
Das Tor bewegte sich nicht.
Clint blickte über die Schulter zur Kreuzung. Die Ampeln waren weder rot noch gelb noch grün. Es war gar kein Licht zu sehen.
Er zerrte am Schlüssel, wollte das Tor zwingen aufzugehen. Doch er wusste, dass nichts passieren würde.
Nicht ohne Strom.
An seinen Wagen käme er relativ leicht. Aber das Tor versperrte den Weg nach draußen.
Mit dem Wagen durchbrechen?
Ja sicher.
»Film-Scheißdreck«, murmelte er. Das hier ist das echte Leben, und du kannst nicht einfach durch das Tor krachen und fröhlich weiterfahren. Selbst wenn du Glück hast und den Aufprall überlebst, geht dein Wagen dabei drauf. Nie im Leben klappt das.
Wenn er seinen Wagen mit so einem Stunt außer Gefecht setzte, käme er nicht mehr nach Hause.
Und das war das Einzige, was für Clint in diesem Moment zählte.
Er musste nach Hause. Musste sicher sein, dass es Sheila gutging. Und Barbara.
Wieder stellte er sich vor, wie sie zerquetscht dalagen.
So ein Beben ist völlig harmlos - es ist der Scheiß, der dir auf den Kopf fällt!
Lieber Gott, bitte mach, dass ihnen nichts passiert ist.
Clint riss den Schlüssel aus dem Schloss. Er trat gegen das Rolltor.
Verdammt nochmal!
Sein Auto war unversehrt, aber nutzlos! Eingeschlossen im gottverdammten Parkhaus wie in einem Gefängnis!
Was soll ich jetzt tun?, fragte er sich. Laufen?
Er kletterte die Einfahrt wieder hoch und überblickte die Autos, die am Straßenrand verstreut standen. Die Alarmanlagen heulten immer noch, aber keiner der Besitzer war zu sehen.
Einen Wagen klauen?
Wie wäre es mit einem kleinen Autodiebstahl?
Quatsch. Clint wusste nicht mal, wie man das anstellte. Reißt man die Zündung heraus? Überbrückt man ein paar Drähte?
Klar.
Welche Drähte überhaupt?
Missmutig betrachtete er den TOY-Pick-up. Den könnte er nehmen, da würde sich wohl keiner aufregen. Mit Sicherheit steckte auch der Zündschlüssel. Aber wie die Karre aussah, war sie genauso tot wie der Beifahrer, genauso tot wie der Fahrer, der irgendwo da drin noch unter dem eingedrückten Dach liegen musste.
Der BMW stand noch immer auf seiner Fahrspur rechts der Kreuzung.
In Ordnung!
Clint beugte sich vor und konnte die Fahrerin erkennen. Sie bewegte sich nicht. Ihr Kopf war Richtung Beifahrerfenster gedreht. Clint dachte, sie starre ihn an.
Ich bin Zeuge, wahrscheinlich will sie meinen Namen und so.
Er winkte ihr. Dann hetzte er auf sie zu. Seine Beine fühlten sich schwach und schwammig an. Sein Kopf dröhnte.
Zu viel Action, dachte er. Zu viel von allem. Aber ich bin noch da. Und sie auch.
Beinahe hätte er »Nicht wegfahren!« gerufen, biss sich aber auf die Zunge. Er wollte sie nicht auf irgendwelche Ideen bringen.
Doch sie bewegte sich nicht. Sie starrte nur.
Sie starrt irgendwohin, aber nicht zu mir, wurde Clint klar, als er dem Wagen näher kam. Ihr Blick war tiefer gerichtet. Auf den Beifahrersitz.
Plötzlich wusste Clint, warum.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte er.
Sie antwortete nicht. Sie starrte nur weiter, als ob der Anblick ihres seltsamen Begleiters sie verzaubert hätte.
Eine braune Locke fiel ihr in die Stirn. Ansonsten sah sie adrett und gepflegt aus in ihrer weißen Bluse und dem Ensemble aus grauem Blazer und Rock.
Clint vermutete, dass sie auf dem Weg zur Arbeit in einem Büro war.
Sie trug ziemlich wenig Make-up. Sie hatte es auch nicht nötig. Sie war zu jung und zu hübsch, um nachhelfen zu müssen. Vielleicht Anfang zwanzig.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte er wieder. »Es war nicht Ihre Schuld. Ich habe alles gesehen. Sie werden keinen Ärger kriegen, okay?«
Sie gab keine Antwort.
Von wegen okay, hier geht gar nichts.
Clint trat einen Schritt vor.
Der Kopf lag auf dem Beifahrersitz. Er trug noch immer die Baseballkappe, die jedoch Schild und ursprüngliche Farbe verloren hatte. Der Kopf lag mit dem Gesicht nach oben. Er war rot wie die Baseballkappe und starrte zur Decke. Der Halsstumpf wies auf die junge Frau.
Kein Wunder, dass sie durchgedreht ist, dachte Clint.
Er zog am Türgriff, aber die Tür war verriegelt. Statt Zeit zu verschwenden, indem er die junge Frau zum Öffnen bewegte, griff er durch das zerbrochene Fenster und fand die Türverriegelung. Er entriegelte die Tür, zog seinen Arm zurück, öffnete weit die Tür und hielt plötzlich zu seiner eigenen Überraschung inne.
Er hatte gedacht, er würde den Kopf ganz einfach vom Sitz wischen und ihn auf die Straße kullern lassen.
Aber er schaffte es nicht.
Das war kein Müll. Kein altes Sandwich oder eine dreckige Serviette. Es war der Kopf eines Mannes, der vor ein paar Minuten noch gelebt hatte.
Ein Mann, der wahrscheinlich Familie und Freunde und einen Job hatte. Ein Dodgers-Fan, der vielleicht gern mit seinen Kindern ins Stadion ging und Hot Dogs in der Sonne verspeiste … Der nichts Schlimmeres verbrochen hatte, als Beifahrer eines Mannes gewesen zu sein, den das Erdbeben offenbar hatte durchdrehen lassen.
Clint fasste den Kopf vorsichtig mit beiden Händen. Er war schwerer als erwartet.
Er trat zurück und hielt den Kopf ein gutes Stück von sich gestreckt, damit kein Blut auf seine Kleidung tropfte. Er trug den Kopf zum auf dem Bürgersteig ausgestreckten Torso und legte ihn dort Hals an Hals nieder. Dabei überkam ihn das dringende Bedürfnis, den Kopf irgendwie wieder mit dem Körper zu verbinden, festzukleben oder knoten oder …
Ich muss nach Hause!
Der Kopf rollte ein wenig zur Seite, als er ihn losließ. Nur ein paar Zentimeter.
Beim Aufrichten entdeckte Clint die Jeans des Toten mitten auf der Kreuzung. Er rannte hin und hob sie auf. Sie sahen sauber aus. Er wischte sich damit das Blut von den Händen und sprintete wieder zum BMW.
Die Fahrerin sah ihn an. Sie runzelte die Stirn.
»Alles okay«, sagte Clint. »Ich mache Ihnen nur eben den Dreck hier weg.«
Sie nickte.
Er lehnte sich in den Wagen und versuchte, so gut es ging, das Blut vom Sitzbezug zu wischen. Als er einigermaßen sauber aussah, warf er die Jeans weg und schwang sich auf den Sitz.
Er zog die Tür zu.
»Ich heiße Clint Banner«, sagte er und zwang sich, möglichst vertrauenswürdig zu sprechen. »Wie heißen Sie?«
Sie blinzelte ein paarmal und verzog das Gesicht. Ihre Lippen bewegten sich, aber kein Wort war zu hören.
»Ihr Name?«
»Mary«, flüsterte sie, »Davis.«
»Waren Sie auf dem Weg zur Arbeit, Mary?«
Ein kaum erkennbares Nicken.
»Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Sekretärin. Bei einer Werbeagentur.«
»Werbung.«
Sie nickte. Diesmal deutlicher.
»Okay, wenn das Ihr Job ist, dann fällt heute die Arbeit für Sie aus. Verstehen Sie? Wir hatten ein schwereres Erdbeben. Sie müssen nicht zur Arbeit. Sie müssen nach Hause.« Er betrachtete ihre Hände. Sie hatten sich in ihre Oberschenkel gekrampft, die ausgebreiteten Finger drückten sich fest in den grauen Rockstoff. Sie trug Ringe an beiden Händen, jedoch keinen Verlobungs- oder Ehering. »Haben Sie Familie?«
Weiteres Nicken.
»In L. A.?«
»Chicago.«
»Dann brauchen Sie sich keine Sorgen um sie zu machen. Was Sie tun müssen, ist schnell und sicher nach Hause kommen. Verstehen Sie das?«
»Ich … ich weiß nicht.«
»Wo wohnen Sie?«
»Santa Monica.«
»Klasse!«, entfuhr es ihm, und Mary zuckte zusammen. »Klasse«, sagte Clint noch einmal, diesmal sanfter. »Ich werde Ihnen helfen. Ich muss nach Hause zu meiner Frau und meiner Tochter, und mein Wagen ist … unbrauchbar. Ich wohne drüben in West L. A., das ist noch nicht mal ein Umweg für Sie. Sie brauchen mich bloß über die Berge zu bringen. Und ich werde Ihnen helfen. Es wird eine anstrengende Fahrt werden, mit einer Menge Verkehr zwischen hier und dort … Ampeln, die nicht mehr funktionieren … wahrscheinlich sind manche Straßen teilweise blockiert … Keiner kann sagen, was uns erwartet. Wir können uns gegenseitig helfen. Okay?«
»Was ist mit meinem Unfall?«
»Machen Sie sich darüber keine Sorgen.«
»Aber … das ist Unfallflucht.«
»Heute nicht«, sagte Clint. »Wahrscheinlich könnten Sie diesen Unfall nicht mal melden, wenn Sie es wollten. Und selbst wenn die Telefonleitungen funktionieren, hat die Polizei erst mal viel Dringenderes zu erledigen.«
»Ich … ich sollte wenigstens versuchen, es zu melden.«
Clint legte ihr die Hand auf die Schulter. Er drückte sie fest, aber nicht zu fest. »Wir dürfen keine Zeit verlieren, Mary. Wollen Sie heute noch nach Hause kommen?«
»Ja.«
»Das will ich auch. Ich will so sehr nach Hause, dass es wehtut. Wir werden also von hier verschwinden, und zwar schnell. Möchten Sie, dass ich fahre?«
»Ich … ja, vielleicht.«
3
Als das Beben ausbrach, wurde der Chevy Nova derart durchgeschüttelt, dass er nach links von der Fahrbahn abkam und über die durchgezogene Linie in der Straßenmitte ausscherte.
Barbara Banners Magen sprang im Dreieck.
Hinter ihr quietschte Heather, schrie Earl »Hey!« und murmelte Pete »Was zum Teu…«.
»Bremsen«, keuchte Mr. Wellen und hämmerte mit beiden Händen auf das Armaturenbrett.
Barbara stieg auf die Bremse, während sie das Lenkrad nach rechts riss. Der Wagen fand zurück auf den richtigen Fahrstreifen, kam aber dem Heck eines geparkten Wagoneer bedrohlich nahe.
»Du lenkst zu stark ein, Bar… Stopp!«
»Ich stehe doch schon längst!«, schrie sie ihren Fahrlehrer an.
»Tust du nicht!«, keifte Earl.
Barbara war sich sicher, den Wagen angehalten zu haben. Aber er bewegte sich weiter, ruckte und zuckte und kam der Heckstoßstange des Jeeps immer näher.
»Aufpassen!« Wellen rutschte über den Sitz, ergriff das Lenkrad mit einer Hand, hob sein linkes Bein und stampfte mit seinem Schuh fest auf Barbaras Fuß.
»AU!«
Barbara rammte ihm ihren Ellbogen in die Rippen.
Na toll, dachte sie. Was für eine Strafe steht wohl darauf, seinen Lehrer zu schlagen?
Zumindest hatte er aufgehört, ihren Fuß einzuquetschen.
»Das ist ein Erdbeben«, stellte Pete fest. Er klang dabei aufgeregt - ganz wie ein Schüler, der als Einziger in der Klasse eine komplizierte Frage des Lehrers beantworten konnte.
»Echt jetzt«, sagte Earl.
Ein Erdbeben! Die Hände fest ans Lenkrad geklammert und mit schmerzendem Fuß auf der Bremse nahm Barbara erst jetzt die Umgebung wahr, die sich nicht im unmittelbaren Gefahrenbereich für das Fahrschulauto befand. Sie bemerkte ein Stuck-Wohnhaus nicht allzu weit entfernt zu ihrer Rechten. Es war zwei Stockwerke hoch, und anstatt eines Vorgartens hatte es eine gepflasterte Zufahrt zu einem Parkdeck im Keller.
Das ganze Gebäude, das Pflaster drumherum und die Wagen, die dort in ein paar Parkbuchten standen, zuckten hin und her, als ob Barbara die Szenerie durch den Sucher einer Kamera betrachtete, die jemand während eines epileptischen Anfalls in den Händen hielt.
Sie blickte direkt in eines der hohen Fenster, als dessen Scheibe zerbrach und eine alte Frau mit dünnen weißen Haaren herausstürzte. In ihrem pfirsichfarbenen Bademantel hob sie sich kaum von der gleichfarbigen Stuckwand ab - bis auf den Kopf, ihre kleinen Hände und die nackten weißen Beine, die wie wild Richtung Himmel traten.
»Alle in Deckung!«, befahl Mr. Wellen.
Die Originalausgabe
QUAKE
erschien 1995 bei Headline Book Publishing Group, London
Deutsche Erstausgabe 07/2010
Copyright © 1995 by Richard Laymon Copyright © 2010 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
eISBN : 978-3-641-04795-5
www.heyne-hardcore.de
Leseprobe
www.randomhouse.de