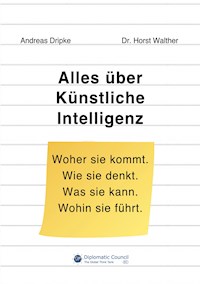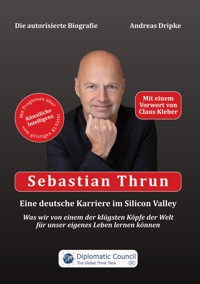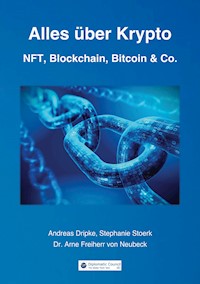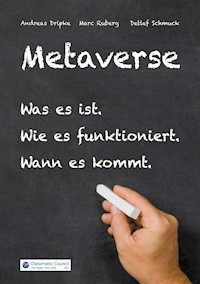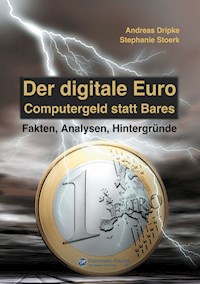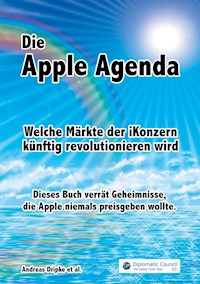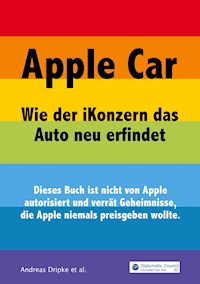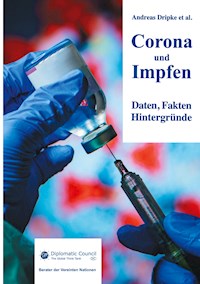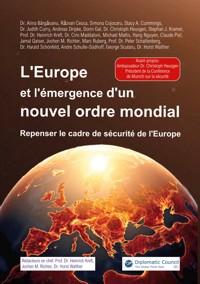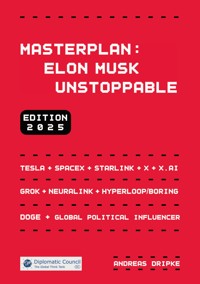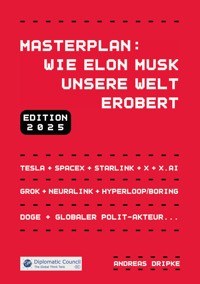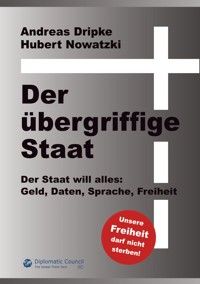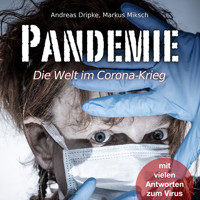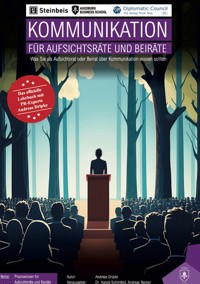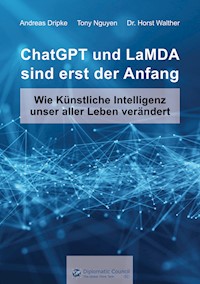Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Internet der Dinge - auch Internet of Things oder IoT genannt - gehört zu den am häufigsten unterschätzten Entwicklungen. Das ist fatal, weil die damit verbundene allumfassende Vernetzung zunehmend unseren beruflichen und privaten Alltag bestimmt. Die Autoren dieses Buches erklären, was das Internet der Dinge eigentlich ist, wie es funktioniert, und wie es mit anderen maßgeblichen Entwicklungen zusammen das Rückgrat unserer Informationsgesellschaft bildet. "Ein Buch über die Zusammenhänge hinter unserer Informationsgesellschaft" (Presse)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Das Internet der Dinge umschlingt uns
Alle Geräte auf der Welt mit Internet-Anschluss
Verlängerung des Internet in die reale Welt
1986 – Das Internet der Dinge geht los
Vom Arpanet zum Internet
Internet gehört uns allen
Wer im Internet etwas zu sagen hat
Daten sind die neue Währung
Rohstoff für die digitale Revolution
Speicher für alle Daten der Welt
Datenbasierte Geschäftsmodelle bringen Erfolg
Milliardenmarkt Big Data mit Risiken
Die Cloud – unsere Daten überall
Allianz: Internet der Dinge, Cloud und KI
Immer größere Datenzentren
Von der Cloud zum Internet der Dinge
Die USA hören, lesen und sehen alles
Die neue Smart World
Computeruhren und das neue Gesundheitswesen
Dr. Apple, Dr. Google und Dr. Amazon
Smart Home – unser Eigenheim wird überwacht
Smart City – Traum und Albtraum
Intelligente Infrastrukturen
Der Wunschtraum von der lebenswerten Stadt
Wie „dumme Dinge“ schlau gemacht werden
„Big Brother“ ist überall
Recht auf Persönlichkeit
Panoptismus: Gefangen in der Welt der Dinge
Neue Gefährdungslage durch IoT
Sicherheit in allen „Dingen“ von Anfang an
Herausforderung Software-Genetik
Connected Cars: Wie sicher sind künftig Autos?
Tesla lädt die Hacker ein
Künstliche Intelligenz voraus
Menschliches Denken automatisieren
Turing-Test für Intelligenz
Google telefoniert mit KI
Menschheitstraum von den arbeitenden Maschinen
Computerleistung bis zur Singularität
Quantenphysik verändert die Welt
Roboter: mehr als ein Ding
Vom „Ding“ zum Zwangsarbeiter
Industrieroboter gehören längst zum Alltag
UNO: KI und Robotik am wichtigsten
Serviceroboter aller Orten
Der Tesla Bot
Heimroboter Astro
Atlas – der „Robo Sapiens“
Spot – Roboterhund oder Hunderoboter
Polizei-Roboter stößt auf Ablehnung
Das Internet in unserem Körper
Vom Hund zum Menschen
Chip im Körper verursacht Gänsehaut
Wir haben schon künstliche Gegenstände im Körper
Chip unter der Haut verleiht uns eine Zauberhand
Chips im Körper werden zum Alltag
Der Chip-Mensch
Hautchips sind keine große Sache
„Ding“ im Kopf
e-Privacy: Datenschutz im IoT
Toaster mit Privatsphäre
Wann kommt das e-Privacy-Chaos?
Auf dem Weg ins Metaverse
Über die Autoren
Andreas Dripke
Wolfgang Odenthal
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Das Internet der Dinge gehört zu den am häufigsten unterschätzten Entwicklungen. Das ist fatal, denn in Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine der wichtigsten Zukunftstechnologien mit gravierenden Auswirkungen auf unser privates wie auch unser berufliches Leben.
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das Internet der Dinge massiv unterschätzt wird.
Erstens wird es in der Regel unter dem Begriff „Internet of Things“ bzw. dem Kürzel IoT als ein industrielles Internet verstanden wird, das eher in Produktionsbetrieben als in Privathaushalten zu finden ist. Das macht die Sache auf den ersten Blick für die Allgemeinheit weniger interessant.
Zweitens hat sich eine andere „Internet-Variante“ weit in den Vordergrund gedrängt, nämlich das mobile Internet, besser bekannt als Smartphone. Für das Internet der Dinge gibt es kein derartiges universelles Gerät, das mit dem Smartphone für das mobile Internet vergleichbar wäre. Vielmehr tragen die zahlreichen „Dinge“, die ans Netz angeschlossen werden, andere und in der Regel von den Herstellern geprägte Namen, etwa „Echo“ für die intelligenten Amazon-Geräte im Haushalt oder AirTag für Apples „Dinge-Finder“.
Drittens ist häufig unklar, dass auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Technologien wie Cloud Computing, Robotik, Künstliche Intelligenz (KI) oder Biochips ins „Reich der Dinge“ gehören oder dieses jedenfalls berühren. Auch das sogenannte Metaverse, die jüngste Zukunftsskizze für die Weiterentwicklung unserer digitalen Welt, benötigt das Internet der Dinge, um Realität zu werden.
Man muss verstehen, wie diese unterschiedlichen Technologien miteinander zusammenhängen, um die Bedeutung des Internet der Dinge für unsere Zukunft begreifen. Durch die Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln entsteht ein Bild, das sich aus den „Puzzleteilen der verschiedenen Technologien“ zusammensetzt und es wird deutlich, wohin die digitale Reise geht.
So entsteht die je nach eigenem Blickwinkel großartige oder erschreckende Vision, dass das Internet der Dinge unsere Umwelt, die Umgebung, in der wir leben, zu einem Computer machen wird, der uns permanent umgibt. Anders formuliert: Wir werden künftig nicht mehr einen Computer auf dem Tisch stehen haben oder in Form eines Smartphones in der Hand halten, sondern wir stehen, sitzen, schlafen, leben künftig im Computer, umgeben von „Dingen“, die alle miteinander vernetzt und mit einer Künstlichen Intelligenz verbunden sind.
Zu den „Dingen“ gehören Kameras, Mikrofone, Bildschirme oder Lautsprecher, aber auch eine Vielzahl von Sensoren, die unsere Umwelt und uns (!) ständig erfassen; die Sensoren in den Computeruhren zur permanenten Messung unserer Vitalwerte sind heute schon allgegenwärtig. In Zukunft zählen aber auch „Dinge“ dazu, die uns heute noch wenig geläufig sind oder die wir fälschlicherweise gar nicht dem Internet der Dinge zuordnen, etwa Roboter oder Chips, die wir in unseren Körper aufnehmen.
Doch es geht nicht nur um die „Dinge“, sondern ebenso sehr um die Daten – denn jedes „Ding“ erzeugt Daten. Im Internet der Dinge werden Unmengen an Datenströmen entstehen, die heute noch schwer vorstellbar sind. In der Auswertung und Nutzung dieser Daten liegt die Wertschöpfung. Anders ausgedrückt: Die mit dem Internet der Dinge erfassten Daten stellen einen wertvollen Rohstoff dar, den Staaten und Unternehmen zu nutzen werden wissen.
Alle diese Aspekte werden im vorliegenden Buch in Bezug auf das Internet der Dinge dargestellt. Indem die Puzzlestücke zusammengesetzt werden, entsteht das Bild einer völlig neuen Welt, in der wir künftig leben werden.
Andreas Dripke, Wolfgang Odenthal
An diesem Werk haben zahlreiche namhafte Mitglieder der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council mitgewirkt, vornehmlich durch politische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Ratschläge, Kommentare und Korrekturen. Das vorliegende Buch stellt in diesem Sinne ein Gemeinschaftswerk dar.
Das Internet der Dinge umschlingt uns
Das Internet der Dinge, selten IdD abgekürzt, gelegentlich auch umgangssprachlich „Allesnetz“ betitelt, aber am häufigsten mit dem englischen Begriff „Internet of Things“ (IoT) beschrieben, ist ein Sammelbegriff für Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, die es ermöglicht, physische und virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen. So lautet die Definition des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags.1 Das IdD bzw. IoT basiert, wie es der Begriff schon ausdrückt, auf dem Internet.
Alle Geräte auf der Welt mit Internet-Anschluss
Viele von uns haben „das Internet“ zunächst an einem Computerbildschirm erlebt. Heute greift die Mehrzahl der Menschen rund um den Globus mit einem Smartphone auf das Internet zu. Doch wir befinden uns schon mitten in der dritten Internetrevolution, dem Internet der Dinge. Die Vision ist gigantisch: Alle Geräte auf der Welt erhalten einen Internetanschluss und tauschen ihre Daten soweit sinnvoll direkt miteinander aus, ohne Umweg über den Menschen. Nur vereinzelt greifen wir Menschen noch in diese reibungslose Maschinen-mit-Maschinen-Kommunikation ein. Damit die „Dinge“ über das Netz etwas zu melden haben, werden sie mit Sensoren ausgerüstet. Druck, Verschleiß, Temperatur, Helligkeit, Schall, Feuchtigkeit, Beschleunigung, chemische Werte, Widerstand, Dehnung, Neigung, Magnetfelder, Funkstärken, Ultraschall, Laser… alles wird gemessen und in die Cloud weitergeleitet. Cloud Computing heißt das im Fachjargon, wobei die Cloud als Synonym für einen Verbund aus Computern und Datensilos steht, in dem Programme laufen, die die Daten analysieren und verarbeiten. Gelegentlich findet auch der Begriff „Cyber Space“ als Synonym für diesen intervernetzten Datenraum Anwendung.2
Verlängerung des Internet in die reale Welt
Das Internet of Things steht für eine Vision, in der das Internet in die reale Welt verlängert wird und viele Alltagsgegenstände ein Teil des Netzwerks werden. Dazu seien einige wenige Beispiele aufgeführt. Maschinen melden sich automatisch beim Ersatzteillager, wenn Verschleißteile bald ausgetauscht werden müssen. Die elektrische Zahnbürste verfügt über eine kleine Kamera, die das Gebiss beim Zähneputzen analysiert und den Befund automatisch an einen Zahnarzt unserer Wahl sendet. Ein kleines Gerät, das etwa im Wohnzimmer oder in der Küche steht, beantwortet auf Zuruf gängige Alltagsfragen.
Das Internet der Dinge wird sich in den kommenden Jahren massiv ausbreiten und für heute noch kaum vorstellbare Datenströme sorgen. Künftig wird jede Maschine, jedes Haushaltsgerät und so weiter mit dem Internet verbunden sein. Allein die Digitalisierung der Kraftfahrzeuge und die Verbreitung von mobilen Zahlungssystemen werden enorme Datenmengen produzieren. Wir reden nicht davon, dass das Auto eine Internetverbindung bereitstellt, wenn gelegentlich ein Mitfahrer surfen will, sondern davon, dass der Wagen im Millisekundentakt Informationen an den Hersteller und die Verkehrsinfrastruktur übermittelt, die Musik via Streaming ankommt und die Windschutzscheibe fortlaufend mit Virtual Reality aktualisiert wird. Im Jahr 2020 kamen Schätzungen zufolge rund zwei Milliarden Machineto-Machine-Internetverbindungen zustande.3
Um diese Entwicklung zu verstehen und vor allem sie extrapolieren zu können, ist zunächst ein Blick in die Vergangenheit hilfreich, wie dies im nächsten Kapitel geschieht.
1986 – Das Internet der Dinge geht los
Die Wurzeln des Internet der Dinge reichen bis in das Jahr 1968 zurück. Damals entwickelte eine kleine Forschergruppe unter der Leitung des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) und des US-Verteidigungsministeriums ein Advanced Research Projects Agency Network, kurz Arpanet. Ziel war die Errichtung eines Kommunikationsnetzes zwischen allen US-Universitäten, die für das Verteidigungsministerium forschten. Dabei handelte es sich um die University of Utah, die University of California Los Angeles und die University of California Santa Barbara.4
Vom Arpanet zum Internet
Das Arpanet enthielt von Anfang an die grundlegenden Aspekte und ist damit der direkte Vorläufer des heutigen Internet. Für damalige Verhältnisse war das Arpanet revolutionär, weil es erstmals das Konzept eines dezentralen Netzwerks realisierte. Statt eines zentralen Computers, über den die gesamte Kommunikation läuft, baute das Arpanet auf einem Geflecht von Computern auf. Der entscheidende Vorteil dabei lag in der Dezentralisierung: Wenn einer der Computer ausfällt, bricht nicht etwa das gesamte System zusammen, sondern seine Aufgaben werden automatisch von den anderen Computern übernommen. Dieser grundlegend dezentrale Aufbau ist bis heute erhalten geblieben und stellt eine wesentliche Grundlage für das Internet der Dinge dar – schließlich geht es dabei um „Dinge, die überall verteilt“ sind.
Die zweite maßgebliche Innovation des Arpanet war die Paketvermittlung. Jeder Datenstrom wird dabei in eine Vielzahl kleiner Datenpakete zerlegt, bevor er übertragen wird. So ist es möglich, dass beim Ausfall eines Computers die Datenpakete einfach über einen anderen Weg – also über andere Computer – ans Ziel übermittelt werden. Genau so funktioniert das Internet im Prinzip heute noch. Alle Daten werden in kleine Pakete zerlegt und finden ihren Weg zum Ziel über ein Netzwerk mit einer Vielzahl von Computern dazwischen. Dieser Aufbau ist auch entscheidend für die Funktionsweise im Internet der Dinge.
Natürlich sind die Internetknoten mittlerweile um ein Vielfaches leistungsfähiger. Auch die damalige Übertragung im Arpanet über Telefonleitungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Kbit pro Sekunde hat längst ein Ende gefunden.
Das Arpanet wurde am 28. Februar 1990 stillgelegt, doch es hat unsere Welt für immer verändert: erst mit dem Internet, dann mit dem mobilen Internet und nun mit dem Internet der Dinge.
Die dezentrale Netzstruktur, verbunden mit der Paketvermittlung der Daten, machten das Arpanet außerordentlich robust gegen Ausfälle einzelner Computer oder Datenleitungen. Selbst der Ausfall ganzer Teilnetze würde die Funktionalität der verbleibenden Netzinfrastruktur nicht lahmlegen. Das führte schon frühzeitig zu der Spekulation, dass das US-Verteidigungsministerium mit dem Arpanet eine Kommunikationsstruktur schaffen wollte, die selbst im Falle eines Atomkriegs noch funktionieren würde. Ob das richtig ist oder nur Spekulation, ließ sich im Nachhinein nicht mehr genau feststellen. Aber es ist eine plausible Geschichte und vermutlich stimmt sie. Es gibt nämlich eine Studie der RAND Corporation („Research AND Development), einer US-Denkfabrik, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 14. Mai 1948 gegründet wurde, um die Streitkräfte der Vereinigten Staaten zu beraten, die genau dieses Szenario anschaulich beschreibt. Diese RAND-Organisation gibt es übrigens heute noch mit immerhin 1.600 Beschäftigten.
Auf jeden Fall lässt sich mit Fug und Recht behaupten, das heutige Internet entstand aus der Militärforschung der Vereinigten Staaten von Amerika. Übrigens markiert der 1. Januar 1983 den Übergang vom Arpanet auf das Internet, denn bis zu diesem Stichtag waren alle Netzwerkrechner auf das Internet Protokoll umgestellt. Mit dem 1984 entwickelten „Domain Name System“ (DNS) wurde es erstmals möglich, sämtliche Rechner im Netz mit Namen zu versehen, denn zuvor waren sie ausschließlich über – unübersichtliche – Ziffernkombinationen erreichbar. Im Jahr 1990 verkündete die US-staatliche National Science Foundation, das Internet für kommerzielle Zwecke nutzbar machen zu wollen. Am 6. August 1991 veröffentlichte das Schweizer CERN – die Europäische Organisation für Kernforschung – die Grundlagen des World Wide Web, wie wir es heute täglich nutzen, wenn wir „www“ eintippen.5 Rasanten Auftrieb erhielt das Internet jedoch bereits, als im Jahr 1983 der erste grafikfähige Webbrowser mit Namen Mosaic angeboten wurde.
Heute lässt sich feststellen, das Internet führte die größte Veränderung des Informationswesens seit Erfindung des Buchdrucks herbei. Im Jahr 2013 erklärte der Bundesgerichtshof, das Internet gehöre zur Lebensgrundlage von Privatpersonen.6