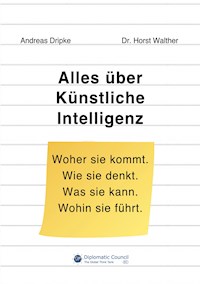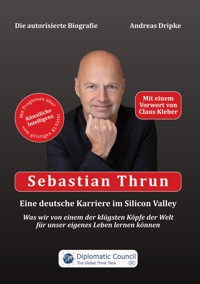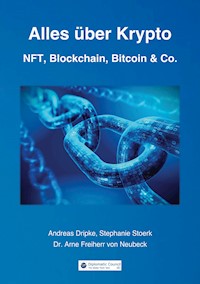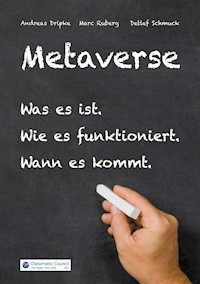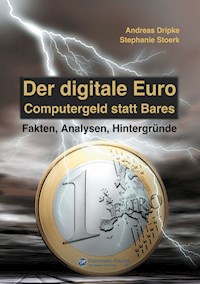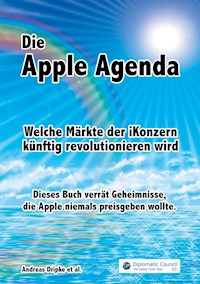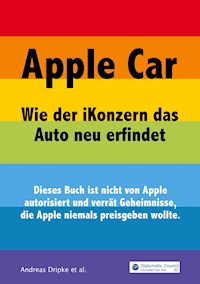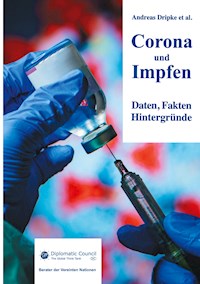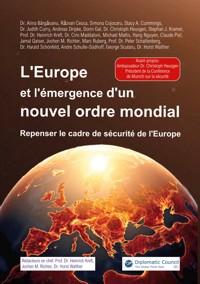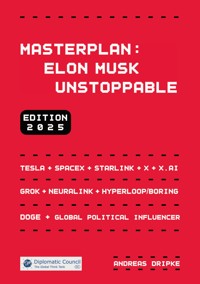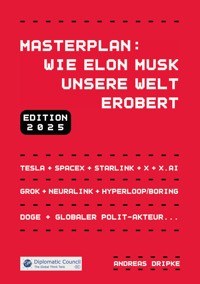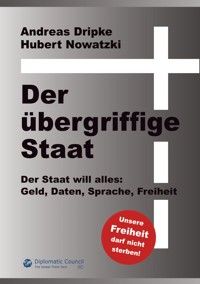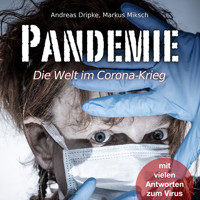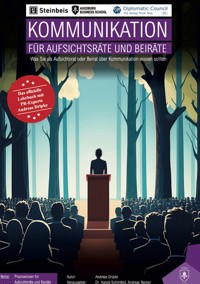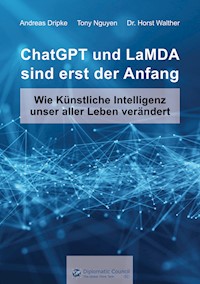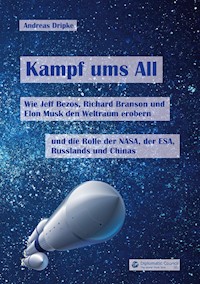
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Kampf ums All hat begonnen. Weit über bloßes Entdeckertum hinaus geht es beim Wettlauf in den Weltraum vor allem um politische, wirtschaftliche und militärische Macht. Die Supermächte USA, China und Russland sowie Europa kämpfen ebenso verbissen um die Vorherrschaft im All wie sich die Milliardäre Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk mit dem "Space Business" in den Stand der Billionäre zu katapultieren versuchen. Unter dem Begriff "New Space" ist die Schlacht um die Ökonomisierung des Weltalls in vollem Gange. Es geht um den Abbau von Rohstoffen auf anderen Planeten wie auch um den Milliardenmarkt Weltraumtourismus. Die Errichtung einer Mondstation und die Besiedlung des Mars sind ebenso geplant wie Raumschiffe mit gigantischen Ausmaßen. Zudem umschwirren Tausende von Satelliten unseren blauen Planeten, um das Geschehen auf der Erde zu beobachten und die Internetversorgung im entferntesten Winkel zu gewährleisten. Wir stehen am Beginn einer neuen Epoche. "Das Buch liest sich wie Science Fiction, aber es ist alles Realität", schreibt die Presse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Dieses Buch ist der internationalen Völkerverständigung gewidmet. Während der Wettlauf ins All in seiner ersten Phase vor allem von der aggressiven Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken gekennzeichnet war, kam es in seiner zweiten Phase nach dem Ende des Kalten Krieges zu einer internationalen Zusammenarbeit, um das wohl größte Abenteuer der Menschheit – den Aufbruch ins All – gemeinsam zu bewältigen. Die derzeitige dritte Phase ist indes leider abermals von Zwist und Zwietracht gekennzeichnet, von einem Kampf des Westens mit der Supermacht USA als Anführer gegen die immer weiter aufstrebende Großmacht China und das neu erstarkende Russland.
Eng damit verbunden ist die Ökonomisierung des Weltalls, häufig als „New Space“ bezeichnet. Die drei Milliardäre Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk stehen exemplarisch dafür, wie der Kampf ums All längst nicht mehr nur ein politischer, sondern vor allem auch ein wirtschaftlicher Wettbewerb geworden ist. Das vorliegende Werk trug zunächst den Arbeitstitel „Weltall der Billionäre“, um auszudrücken, dass sich die drei Milliardäre nicht nur auf den Weg gemacht haben, das All zu erobern, sondern auch sich selbst in die Sphäre der Billionäre zu katapultieren.
„Der Mensch wird vom Geist geleitet.“
Antoine de Saint-Exupéry, 1948
„Wer die Kontrolle über das Weltall besitzt, der hat auch die Kontrolle über die Erde.“
John F. Kennedy, 1960
„Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit.“
Neil Armstrong, 1969
„Träume groß. Wenn Dich Deine Träume nicht ängstigen, sind sie zu klein.“
Sir Richard Branson, 2017
„In sechs Jahren wird es uns möglich sein, Menschen auf den Mars zu bringen.“
Elon Musk, 2020
„In den nächsten Jahrhunderten werden immer mehr Menschen, vielleicht die meisten, im All geboren, das wird ihre Heimat sein. Sie werden auf die Erde wie zu einer touristischen Attraktion reisen.“
Jeff Bezos, 2021
Inhalt
Inhalt
Prolog
Ptolomäus, Kopernikus, Keppler, Galilei
Von Urknall bis zur unendlichen Ausdehnung
Das Weltall, der Kosmos, das Universum
Der Weltraum, unendliche Weiten
Der Mensch wird vom Geist geleitet
Gedanken, Filme und Bücher als Vorbilder
Eine Billion Galaxien im Universum
Immer neue Teleskope, immer mehr Erkenntnisse
Weltraumfahrt als Geschäftsmodell
Weltall der Billionäre
Neues Geschäftsmodell für Großprojekte
Nutzung der Atomkraft wie Eroberung des Alls
Digitalisierung, Genetik, Gesundheit
Geostrategische Machtbalance als Treiber
Milliardenmarkt Weltraumtourismus
Raketen sind keine neue Erfindung
Der fliegende Chinese
Raketenpionier Conrad Haas
Katzen und Menschen auf dem Weg ins All
Zeit der Pioniere
Von den Nazis zur NASA
Raketen, Raumschiffe, Raumstationen
„Die Amerikaner waren gar nicht auf dem Mond“
„Space Race“ – Wettlauf ins All
Die Ära des Space Shuttle
Von der Saljut-1 bis zur Mir
Die Internationale Raumstation ISS
Wohnen im Weltraum
Produktion im Weltall
Satelliten rund um den Erdball
Sensationsprojekt Starlink
Das Projekt Kuiper: gewaltig und lautlos
Gefährlicher Weltraumschrott
Asteroiden bedrohen die Erde
Spionage am Himmel
Staatsschnüffelei im All
Drohnen umschwirren uns
Jeff Bezos: Mit Blue Origin ins All
Weg vom blauen Planeten und zurück
Captain Kirk fliegt ins All
Private Raumstation Orbital Reef
Eine Billion Menschen leben im All
2074: Die Menschen leben in Weltraumzylindern
Richard Branson: Ältester im All
Wettlauf um die Antarktis und ums All
Der jungfräuliche Unternehmer
Branson und Musk prallen erstmals aufeinander
Auf dem Rücken eines Jumbos huckepack ins All
Elon Musk: SpaceX hat die Nase vorn
Wettrennen der Milliardäre auf dem Weg zur Billion
Serial Entrepreneur Elon Musk
„Urlaub machen bringt dich um“
Tesla: Ein Mensch lehrt einer Branche das Fürchten
Auto mit Raumfahrtantrieb
Firmenziel: Eine Kolonie auf dem Mars errichten
Von Falken und Drachen
Starship – die neue Generation
Die Ukraine verändert alles, auch für SpaceX
Astronauten, Touristen und Europäer
Astronauen, Kosmonauten, Taikonauten
Weltraumtouristen: Pioniere und Massenmarkt
Alltag im All – ein neuer Geschäftszweig erblüht
Space Launch: 4,1 Milliarden Dollar pro Start
Europas Raumfahrt-Versagen
Raumfahrer ohne Raumstation
Aufbruchsstimmung in Deutschland
Von Kleinsatelliten bis zur Venus
Laser-Strom aus dem All
Vereinigte Arabische Emirate, Türkei und Mexiko
Wettrüsten im Weltraum
Der Weltraumvertrag der UNO
Ronald Reagans Krieg der Sterne
Artemis Accords: Die USA regeln das Weltall
Die US Space Force hebt ab
Die Raumpatrouille der Orion
Geheimer „Space Plane“ X-37B
Das NATO-Bündnis gilt auch im All
China mischt mit
Himmlischer Palast im Weltraum
Mondgöttin trifft Jadehase
Chinas Raumfahrttraum ist größer als die Enterprise
Der Mond ist nicht genug: Der Griff zum Mars
Leben im All
Mein Vater erklärt mir sonntags den Nachthimmel
Galaxis – verschüttete Milch
Die NASA bestätigt mehr als 5.000 Planeten
Die Sonne ist nur 8,3 Lichtminuten von uns entfernt
Atomkraft im All
Leben auf dem Mond
Die USA sichern sich das Recht im Raum
Russland und China verbünden sich auf dem Mond
Wettlauf um den Südpol
Die Menschheit wird multiplanetar: Auf zum Mars!
Es menschelt im All
Leben auf dem Mars
Wasser für den Mars
Sterben auf dem Mars
Bauen mit lebendigen Materialien
Schneller als das Licht
Intelligentes Leben im All
Von H. G. Wells bis zu Erich von Däniken
Über zwei Millionen Beweise für Ufos
Sehnsucht nach Lebewesen aus dem All
Vom Universum zum Metaversum
Zerstört das „Gottesteilchen“ unser Universum?
Von Science Fiction in die Zukunft
Der Weltraum wie der Wilde Westen
Unsere Botschaft für die nächsten Jahrtausende
Über den Autor
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Prolog
„Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. …“ So beginnt das Gebet aller Gebete im Christentum, der mit 2,26 Milliarden Anhängern vor dem Islam und dem Hinduismus größten Religionsgemeinschaft auf Erden. 1 Das Vaterunser steht exemplarisch dafür, wie „der Himmel“ als das Symbol der Menschheit für im wahrsten Sinne des Wortes Überirdisches steht. Die Erde ist für die Menschen da, der Himmel für Gott. Wenn wir uns heute auf den Weg ins All begeben, geht das in seiner Bedeutung über einen technischen Vorgang hinaus. Dem Weltall haftet stets auch etwas Mystisches an. Das zeigt die Entwicklung der Weltbilder im Laufe der Jahrtausende.
Das Weltbild (lateinisch: imago mundi) bezeichnet die Vorstellung der erfahrbaren Wirklichkeit als Ganzes; es ist ein Modell der wahrnehmbaren Welt. Die Kirche zeichnete ihren Gläubigen ein sehr anschauliches Weltbild, wonach die Erde unbeweglich im Mittelpunkt des Universums stand, oben der Himmel, unten die Hölle und auf der Erde, als Herrscher über das gesamte Leben, der Mensch. Man nennt dies das geozentrische Weltbild, mit der Erde in der Mitte der Welt.
Die meisten großen Religionen, darunter auch das Christentum, glauben, dass eine höhere Macht das Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen hat. So heißt es in der Bibel im Ersten Buch Mose (Genesis): „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.“2
Ptolomäus, Kopernikus, Keppler, Galilei
Der griechische Mathematiker, Geograph, Astronom, Astrologe und Philosoph Claudius Ptolemäus (ca. 100 bis 160 n. Chr.) beschrieb in seinem Werk Mathematices syntaxeos biblia XIII dieses geozentrische Weltbild. Es basierte auf der Annahme, dass die Erde und damit auch der Mensch im Universum eine zentrale Position einnimmt, so dass alle Himmelskörper (Mond, Sonne, die anderen Planeten und die Fixsterne) die Erde umkreisen. Das geozentrische Weltbild entspricht dem unmittelbaren Augenschein und wurde schon im klassischen Altertum in Griechenland, insbesondere bei Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.), detailliert ausgearbeitet. Es war in Europa für etwa 1800 Jahre die vorherrschende Auffassung. Auch im alten China und in der islamischen Welt wurde ein geozentrisches Weltbild gelehrt.
Es war der 1473 geborene Nikolaus Kopernikus, der das damalige Weltbild revolutionierte. Die Erde, schrieb er in seinem Werk De revolutionibus orbium coelestium, befindet sich nicht im Mittelpunkt des Weltalls, sondern bewegt sich um die Sonne herum. Damit war die Basis der modernen Astronomie geschaffen. Ab dem 16. Jahrhundert wurde das geozentrische Weltbild mit der Erde als Mittelpunkt allmählich vom heliozentrischen Weltbild mit der Sonne als Nabel des Universums abgelöst.
Der 1571 geborene deutsche Astronom Johannes Kepler verfestigte das von Kopernikus vertretene heliozentrische Weltbild, nach dem sich die Erde um die Sonne und um sich selbst dreht. Kepler entdeckte die Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich Planeten um die Sonne bewegen. Sie werden nach ihm Keplersche Gesetze genannt. Diese besagen unter anderem, dass die Planeten in elliptischen Bahnen um die Sonne ziehen. 3 Kepler zählt damit zu den Begründern der modernen Naturwissenschaften.
Der italienische Universalgelehrte Galileo Galilei, 1564 in Pisa geboren und einer der wichtigsten Begründer der neuzeitlichen exakten Naturwissenschaften, beharrte auf der Richtigkeit des heliozentrischen Weltbildes, wonach die Sonne im Mittelpunkt des Universums steht und die Heimat des Menschen nur einer von vielen Planeten ist, der sie umkreist. Berühmt wurde er auch dadurch, dass die katholische Kirche ihn deswegen verurteilte; erst 1992, also mehr als 350 Jahre später, rehabilitierte sie ihn.4 Würde die moderne Weltraumforschung mit der Geschwindigkeit der katholischen Kirche vorankommen, würden also nicht nur Captain Kirk und die gesamte Crew des Raumschiff Enterprise verdammt werden, sondern die Serie würde wohl erst im Jahr 2550 statt 2200 spielen. Doch angesichts der zeitlichen Dimensionen, die wir dem Universum zuschreiben, kommt es auf ein paar Jahrhunderte mehr oder weniger ohnehin nicht.
Von Urknall bis zur unendlichen Ausdehnung
Der griechische Philosoph Aristoteles vertrat die Ansicht, die Welt existiere schon ewig und könne auch nie untergehen. Heute stellt hingegen die Urknall-Theorie die vorherrschende Vorstellung dar.
Demnach explodierte vor rund 13,8 Milliarden Jahren das damals noch unendlich kleine und unendlich heiße Universum innerhalb von Sekundenbruchteilen und dehnt sich seitdem mit unendlicher Geschwindigkeit aus. Diese Theorie basiert auf Beobachtungen, nach denen das Universum heute noch expandiert, allerdings immer langsamer. Rechnet man diese Expansion bis zu ihrem Anfang zurück, gelangt man zum sogenannten Ursprungspunkt zurück, an dem alle im Universum vorhandene Energie gebündelt gewesen sein muss. Physiker bezeichnen diesen Moment als singulären Zustand.
Kurz nach dem Urknall war das Universum demnach etwa zehn Billionen Grad Celsius heiß und es entstanden die ersten Elementarteilchen sowie nach einer fortwährenden Abkühlung bis auf rund 2.700 Grad Celsius die ersten Wasserstoffatome, Lithium und Helium. Nach 100 bis 200 Millionen Jahren bildeten sich die ersten Gaswolken – Sterne begannen zu leuchten. Unser Sonnensystem, in dem wir leben, entstand demnach vor etwa 4,6 Milliarden Jahren.5 2022 entdeckten Astronomen den am weitesten entferntesten einzelnen Stern und gaben ihm den Namen Earendel; das Wort aus dem Altenglischen bedeutet so viel wie „aufgehendes Licht“. Der „Morgenstern“, wie er sich auch übersetzen lässt, ist nach heutigem Stand der Wissenschaft rund 900 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden.6
Doch wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, dass dieser heutige Stand der Wissenschaft ebenso gut falsch sein könnte. Letzten Endes weiß bis heute kein Mensch, warum das Universum zu existieren begann, was vor diesem Beginn war, ob es ein Ende geben und was nach diesem Ende sein wird.
Das Weltall, der Kosmos, das Universum
Wenn wir heute vom Weltall, dem Kosmos oder dem Universum sprechen, meinen wir die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin. Davon zu unterscheiden ist das beobachtbare Universum, also die vorgefundene Anordnung aller Materie und Energie, angefangen bei den elementaren Teilchen bis hin zu den großräumigen Strukturen wie Galaxien und Galaxienhaufen. Die Kosmologie, ein Teilgebiet sowohl der Physik als auch der gegenwärtigen Philosophie der Naturwissenschaften, befasst sich mit dem Studium des Universums und versucht Eigenschaften des Universums wie beispielsweise die Frage nach den Naturkonstanten zu beantworten.
Die heute allgemein anerkannte Theorie zur Beschreibung der großräumigen Struktur des Universums beruht auf der allgemeinen Relativitätstheorie in Kombination mit astronomischen Beobachtungen. Auch die Quantenphysik hat wichtige Beiträge zum Verständnis speziell des frühen Universums der Zeit kurz nach dem Urknall geliefert. Die Materie in dem uns bekannten Teil des Universums besteht zu 75 Prozent aus Wasserstoff, 24 Prozent aus Helium und einem winzigen Anteil von ein Prozent an schwereren Elementen. Aber sowohl Theorien als auch Beobachtungen deuten darauf hin, dass das Universum große Mengen an sogenannter Dunkler Materie beinhaltet. Niemand weiß, um was es sich dabei handelt. Man kann daher sagen: Niemand weiß wirklich, woraus der Großteil des Universums besteht.7 Nach heutigem Verständnis sehen wir ohnehin bestenfalls fünf Prozent des Universums. 95 Prozent gelten als prinzipiell unbeobachtbar, nur indirekt zu erahnen und physikalisch bisher nicht zu erklären.8 Wahrscheinlich wird ein erweitertes Verständnis des Universums erst erreicht, wenn die Physik eine Theorie entwirft, die die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenphysik vereint. Diese theory of everything, „Theorie von Allem“ oder auch Weltformel genannte Theorie der Quantengravitation soll die vier Grundkräfte der Physik einheitlich erklären.9 Bis zum Erscheinen dieses Buches ist diese „Theorie von Allem“ noch nicht bekannt. Als einigermaßen gesichert gilt immerhin, dass sich der Urknall, also der Anfangspunkt der Entstehung von Materie, Raum und Zeit, auf etwa 13,8 Milliarden Jahre zurückdatieren lässt. 10 Seitdem dehnt sich das Universum aus – und zwar immer schneller. Die Wissenschaft geht davon aus, dass der leere Raum mit Dunkler Energie gefüllt ist, die die Ausdehnung des Universums beschleunigt.11 Dem „Big Bang“, dem „Urknall“, steht der „Big Rip“, der „Endknall“, gegenüber. Dieser wird indes frühestens in 30 bis 50 Milliarden Jahren erwartet. Andere Wissenschaftler erwarten „irgendwann“ den „Big Freeze“: Durch die Ausdehnung verliert das Weltall immer mehr Energie, bis alle Materie den absoluten Nullpunkt von minus 271,15 Grad Celsius erreicht. Dann wäre das All wie eingefroren. Oder es kommt zum „Big Crunch“: Sobald die Schwerkraft im All-Zentrum größer ist als die Beschleunigung der wegfliegenden Materie, schrumpft alles wieder auf einen Punkt zusammen und ein neuer Urknall legt los.12
Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte von den unvorstellbar kleinen Dimensionen in der Welt der Atome (und viel kleiner) auf der einen Seite und der ebenso unvorstellbaren Größe des Universums (jedenfalls des bekannten Teils davon), der sollte sich einmal die Webseite https://htwins.net/scale2/ zu Gemüte führen. Dort kann man auf einem PC-Bildschirm von 10 hoch minus 35 (einer Plancklänge) bis 10 hoch 26,9 (dem beobachtbaren Teil des Universums) hin- und herscrollen. Die Plancklänge, benannt nach dem deutschen Physiker Max Planck, markiert die Grenze der widerspruchsfreien Anwendbarkeit der bekannten Gesetze der Physik. Jedes materielle Objekt, das kleiner wäre als die Plancklänge, würde sofort zu einem sogenannten Schwarzen Loch kollabieren.13 Doch auch am anderen Ende der Größenskala, im Universum, gibt es zuhauf Schwarze Löcher. Genauer gesagt hat jede Galaxie im Weltraum ein eigenes Schwarzes Loch. Es heißt so, weil in ihm die Anziehungskraft so groß ist, dass ihm nichts entwischen kann, nicht einmal das Licht. Das größte bekannte Schwarze Loch im Weltall (Quasar) ist schätzungsweise 66 bis 70 Milliarden mal schwerer als unsere Sonne. In Hollywoodfilmen, Serien wie Deep Space 9 oder Science-Fiction-Romanen gibt es übrigens längst Verbindungen zwischen zwei Schwarzen Löchern, sogenannte Wurmlöcher. In Einsteins Theorie der Allgemeinen Relativität gibt es mathematische Lösungen, unter denen solche „Raumzeit-Tunnel“, wie die Wurmlöcher „offiziell“ heißen, existieren. Zwei Schwarze Löcher wären dabei durch einen Bereich verbunden, in denen die Raumzeit zwar extrem gekrümmt ist, aber man könnte – theoretisch – tatsächlich dadurch reisen. Der Eintritt in ein Wurmloch ist – anders als bei einem einzelnen Schwarzen Loch – nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit dem Ende der Existenz.14 Man muss weder Physiker noch Astronom sein, um intuitiv zu begreifen, dass unsere Welt von den kleinsten bis zu den größten Dimensionen für uns Menschen ein Buch mit sieben Siegeln ist. Umso bemerkenswerter und mutiger ist es, wenn wir uns einen kleinen Schritt in die eine oder andere Richtung wagen – in die Teilchenphysik mit ihren unvorstellbaren Kleinheit und in den Weltraum mit seiner ungeheuren Größe.
Der Weltraum, unendliche Weiten
„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“15
Mit diesen Worten begann jede Folge einer der legendärsten Fernsehserien aller Zeiten. Raumschiff Enterprise (englischer Originaltitel Star Trek) spielt im 23. Jahrhundert, zu einer Zeit, in der die Menschheit den Dritten Weltkrieg hinter sich hat und sich in friedlicher Koexistenz mit anderen außerirdischen Lebensformen zur Vereinigten Föderation der Planeten zusammengeschlossen hat.
Deren Forschungs- und Militärabteilung, die Sternenflotte, hat die Aufgabe, fremde Planeten und Galaxien zu erkunden, diplomatische Missionen durchzuführen und unbekannte Lebensformen kennenzulernen. Sie schickt ihr Raumschiff Enterprise unter der Leitung von Captain James T. Kirk (gespielt von William Shatner) mit einer Besatzung von 430 Männern und Frauen zu einer auf fünf Jahre angelegten Reise ins Weltall. Zusammen mit seinen engsten Crewmitgliedern, dem Vulkanier und Ersten und wissenschaftlichen Offizier Mr. Spock (Leonard Nimoy), Schiffsarzt Dr. Leonard „Pille“ McCoy (DeForest Kelly), Chef-Ingenieur Montgomery „Scotty“ Scott (James Doohan), Steuermann Lieutenant Hikaru Sulu (George Takei), Kommunikationsoffizier Lieutenant Nyota Uhura (Nichelle Nichols) und Navigator Pavel Andreievich Chekov (Walter Koenig) erlebt er die fantastischsten und kuriosesten Abenteuer.
In den USA kam die Serie erstmals 1965 ins Fernsehen, die deutsche Erstausstrahlung lief am 27. Mai 1972 im ZDF. Es war eine Mischung aus Science Fiction und einem märchenhaftem Abenteuertum, das Millionen von Menschen begeisterte. Rund 60 Jahre später bleibt festzustellen: Es ist immer noch Science Fiction, und sie erscheint aus heutiger Sicht reichlich kindisch, aber wir beginnen zu erahnen, dass diese Zukunftsvision tatsächlich irgendwann einmal in Realität umschlagen wird.
Zu dieser Erkenntnis trägt bei, dass mittlerweile vieles, was als Science Fiction begann, längst in unserem Alltag angekommen ist.
Der Mensch wird vom Geist geleitet
„Der Mensch wird vom Geist geleitet“, schrieb Antoine de Saint-Exupéry in seinem Brief an einen Ausgelieferten. Alles, was heute denkbar ist, hat auch die Chance, Realität zu werden. In der Tat wird die Zukunft in vielen Büchern und Filmen vorweggenommen. Bereits 1865 schoss der französische Autor Jules Vernes in seinem Roman De la Terre à la Lune (deutscher Titel Von der Erde zum Mond) die ersten Menschen zum Mond, mehr als 100 Jahre, bevor am 21. Juli 1969 der erste Mensch tatsächlich den Mond betrat – mit einer Rakete, die weniger Rechenleistung besaß als ein modernes Smartphone.
In der 1910 publizierten Anthologie Die Welt in 100 Jahren wurde die Idee eines „Taschentelefons“ geboren. In der damaligen Sammlung von visionären Aufsätzen von Schriftstellern, Journalisten, Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern zur mutmaßlichen Lebenswelt ein Jahrhundert später hieß es „Die Bürger dieser Zeit werden überall mit ihren drahtlosen Empfängern herumgehen, der irgendwo, im Hut oder anderswo angebracht sein wird“. Ins Bewusstsein der Bevölkerung rückten Handys erstmals, seit 1966 Raumschiff Enterprise ausgestrahlt wurde. Captain Kirk, Spock und Pille nutzten den Communicator regelmäßig, um mit der Enterprise zu kommunizieren. Motorola legte bei der Entwicklung des am 3. Januar 1996 vorgestellten revolutionären StarTec-Telefons (man beachte den Produktnamen) höchsten Wert darauf, die Gewichtsverteilung zwischen Ober- und Unterteil des weltweit ersten Klapphandys so hinzubekommen, dass es jedermann ebenso schwungvoll wie elegant mit einer Handbewegung aufklappen konnte wie Captain Kirk den Communicator. Die Idee einer virtuellen Welt, wie man sie heute mit Virtual-Reality-Brillen erleben kann, kam schon in Ray Bradburrys Geschichte The Veldt in den 1950er Jahren vor. Die bekannteste Darstellung der Virtuellen Realität dürften jedoch die Holodecks aus Star Trek – Das nächste Jahrhundert sein. Und wer sich bei heutigen 3D- Druckern an den „Replikator“ aus derselben Serie erinnert fühlt, täuscht sich nicht: Wir warten allerdings noch auf das Gerät, der unser Essen ausdruckt.
Gedanken, Filme und Bücher als Vorbilder
Videotelefonie zeigte schon 1927 Fritz Langs Meisterwerk Metropolis auf der Kinoleinwand. Ein Jetpack, das man sich wie einen Rucksack auf den Rücken schnallt, um fliegen zu können, war schon 1928 auf einem Cover des Comic-Magazins Amazing Stories zu sehen, danach bei James Bond, und ist heute für rund 100.000 Dollar zu kaufen. Der Begriff Roboter wurde weder von Wissenschaftlicher noch von Wirtschaftlern populär gemacht, sondern von einem Science-Fiction-Autor: Isaac Asimov. Er verwendete das Wort erstmals in seiner Kurzgeschichte Runaround (deutsch: Herumtreiber), die im März 1942 erschien. Die Lehre oder Wissenschaft dazu nannte er „Robotik“. Tablets waren bereits 1968 in Stanley Kubricks Film 2001: Odyssee im Weltraum zu sehen, 42 Jahre, bevor Steve Jobs am 3. April 2010 das erste iPad vorstellte. Und das vielleicht bekannteste sich selbst steuernde Auto war KITT aus der 1980er-Fernsehserie Knight Rider mit David Hasselhoff in der Hauptrolle.
Viele Erfindungen werden also lange, bevor sie erscheinen, gedacht. Vom Hoverboard, einer Art schwebenden Skateboard, darf man wohl zu Recht annehmen, dass es überhaupt erst erfunden wurde, weil es im Film Zurück in die Zukunft II aus dem Jahre 1989 zu sehen war. Andernfalls wäre bis heute vermutlich kaum jemand auf die Idee gekommen, die Entwicklung eines Hoverboards voranzutreiben.
Gedanken über die Folgen technischer Innovationen wurden ebenfalls häufig in Büchern und Filmen vorweggenommen. So malte Philip K. Dick in seiner Kurzgeschichte Minority Report vor rund 60 Jahren eine Welt aus, in der Verbrechen genau vorhergesagt werden können. 2002 wurde die Kurzgeschichte dann mit Tom Cruise in der Hauptrolle verfilmt. Heute beginnt die Verbrechensvorhersage („Predictive Policing“) zum festen Repertoire der Polizeiarbeit zu werden. Der vielfach ausgezeichnete Spielfilm Matrix aus dem Jahre 1999 erzählte die Idee einer völlig virtuellen Welt bis zum Ende durch. Der Filmheld Neo musste erfahren, dass es sich bei der Welt, in der er zu leben glaubte, lediglich um eine Simulation handelte, und er lediglich ein gefangener Sklave in dieser computergenerierten Traumwelt, der „Matrix“, war.
Was das alles mit unserer Zeit, unserer Zukunft und unserem Thema zu tun hat? Viel, weil sich daraus klare Erkenntnisse ergeben. Alles, was denkbar ist, wird – irgendwann einmal – auch machbar. Häufig verändern sich die Umstände und Ausführungen gegenüber dem originären Gedanken. Doch es deutet vieles darauf hin, dass eines Tages tatsächlich ein „Raumschiff Enterprise“ durch die Galaxis fliegen wird. Ob das im Jahr 2200 sein wird, bleibt allerdings ungewiss – möglicherweise schon deutlich früher. Und die „unendlichen Weiten“, die das filmische Raumschiff Enterprise durchkreuzt, sind verglichen mit den wahren Dimensionen des Weltalls nicht weiter als der Weg zum Bäcker um die Ecke, wie der nachfolgende Vergleich zeigt.
Eine Billion Galaxien im Universum
Unser Planet Erde ist – von der Sonne aus gesehen – der dritte im Sonnensystem. Eine kleine blaue Perle, umgeben von einer Wolke aus Weltraumschrott und einem für die Masse des Planeten relativ großen Mond.
Das Sonnensystem wiederum befindet sich am Rande einer Balken-Spiral-Galaxie, die wir „Milchstraße“ nennen. An der breitesten Stelle ist die Milchstraße 180.000 Lichtjahre breit. Das kommt umgerechnet etwa 55.000 Parsec gleich; eine Parallaxensekunde entspricht 3,26 Lichtjahren oder rund 30,9 Billionen Kilometern.16 Das ist immerhin so groß, dass Captain Kirk, wenn er „in Galaxien vordringt, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“, dabei die Milchstraße nicht einmal verlässt und sich in Wirklichkeit immer in unmittelbarer Nähe der Erde befindet. Schätzungen zufolge gibt es rund eine Billion Galaxien wie „unsere“ Milchstraße – jedenfalls in dem Teil des Universums, den die heutige Wissenschaft als „beobachtbar“ einstuft.17 2021 beobachteten Forscher erstmals, wie eine neun Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie zu „sterben“ begann. Warum Galaxien irgendwann keine neuen Sonnen mehr hervorbringen können und deshalb zum „Sterben“ verurteilt sind, ist unbekannt.18
Die älteste und am weitesten entfernte Galaxie wurde übrigens erst 2022 entdeckt. Die HD1 genannte Galaxie soll etwas mehr als 300 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sein. Trotz seines Alters ist HD1 äußerst lebendig: Dort entstehen etwa 100 neue Sterne pro Jahr. Die Masse von HD1 ist Einschätzungen zufolge rund zehn Milliarden Mal größer als unsere Sonne.19 Vor 2022 hatte die rund 100 Millionen Jahre jüngere GN-z11 als die älteste bekannte Galaxie gegolten. Sie ist zu einer Zeit entstanden, in der das Universum erst rund drei Prozent seines heutigen Alters hatte.20
Immer neue Teleskope, immer mehr Erkenntnisse
Die Neuentdeckung für uns Menschen unvorstellbar alter und entfernter Galaxien ist eine unmittelbare Folge immer neuer Teleskope, mit denen Wissenschaftler den Weltraum beobachten. Den Schlüssel dazu bilden Weltraumteleskope im All. Die NASA betreibt im Rahmen ihres Great Observatory Programms vier davon: Compton Gamma Ray Observatory, Chandra X-Ray Observatory, Spitzer und Hubble Space Telescope (HST). Das erste ernsthafte Konzept eines wissenschaftlichen Teleskops in der Erdumlaufbahn wurde von Lyman Spitzer im Jahre 1946 vorgelegt. Damit sollte es möglich werden, die Einschränkungen durch die Erdatmosphäre zu umgehen und bessere Bilder vom Weltall zu liefern. 1990 wurde das erste Weltraumteleskop im All ausgesetzt, benannt nach Erwin Hubble, dem Entdecker der Expansion des Universums, das Hubble-Teleskops.21 1991 kamen das Gamma Ray Observatory, 1999 das Chandra X-Ray Observatory, 2003 das Spitzer- und 2022 das James-Webb- Weltraumteleskop hinzu.22 Mit über 30 Jahren im All ist das Hubble-Teleskop mittlerweile in die Jahre gekommen und hat häufiger Störungen aufzuweisen. Ein möglicher Nachfolger könnte das von der NASA vorgeschlagene Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor-Weltraumteleskop (kurz: LUVOIR) sein. Es handelt sich dabei um ein Allzweckobservatorium, das in der Lage sein soll, im Unterschied zu den anderen Teleskopen mehrere Wellenlängen einschließlich infraroter, optischer und ultravioletter Strahlen zu beobachten. Doch selbst bei gesicherter Finanzierung könnte LUVOIR frühestens 2039 an den Start gehen.23 Bereits deutlich früher, 2023 oder 2024, plant China den Start eines Weltraumteleskops mit dem Namen Xuntian. Es soll ein Gebiet beobachten können, dass 300-Mal größer ist als das von Hubble.24
Der Nutzen von Weltraumteleskopen liegt auf absehbare Zeit vor allem bei der Wissenschaft. Langfristig ist eine kommerzielle Nutzung nicht auszuschließen. Die Weltraumfahrt ist auf diesem Weg von der Wissenschaft zur Wirtschaft längst weiter fortgeschritten, wie das nächste Kapitel zeigt.
Weltraumfahrt als Geschäftsmodell
Galt die Raumfahrt im letzten Jahrhundert als Domäne der Staaten, so ist abzusehen, dass der Weltraum im 21. Jahrhundert maßgeblich von der Privatwirtschaft erobert wird. Unternehmen bekannter Milliardäre wie Virgin Galactic (Richard Branson), Blue Origin (Jeff Bezos) und SpaceX (Elon Musk) haben sich seit Anfang der 2020er Jahre auf den Weg gemacht, den Weltraum zu kommerzialisieren. Sie wetteifern um das künftige Billionen-Geschäft mit Reisen ins All und möglicherweise irgendwann einmal mit einer Besiedlung fremder Himmelskörper.25
Weltall der Billionäre
Man darf unterstellen, dass es bei diesen zivilen Anstrengungen auch darum geht, die Gründer aus dem Stand der Milliardäre in die künftige Riege der Billionäre zu katapultieren. Aber ebenso wahrscheinlich werden die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Fortschritte in hohem Maße der künftigen Menschheit zuteil werden. Dabei ist eine Allianz der staatlichen und der privatwirtschaftlichen Weltraumnutzung unübersehbar. Schon 1997 hoben von den US-amerikanischen Weltraum-Startplätzen mehr kommerzielle als staatlich beauftragte Raketen ab.26
Bestes Beispiel für die neue „Space Generation“ ist die Crew Dragon von SpaceX. Das bemannte Raumschiff brachte im Juni 2020 mit einer Falkon-9-Rakete im Auftrag der NASA zwei Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS (International Space Station). Im November 2020 fand der erste reguläre Astronautenstart von SpaceX statt. Die November-Crew – Crew-1 – war die erste, die offiziell von der Crew Dragon zur ISS geflogen wurde, nachdem der bemannte Test im Frühjahr 2020 erfolgreich verlaufen war.27 Sie markierte den Beginn einer langen Reihe vieler weiterer geplanter kommerzieller Weltraumflüge in den 2020ern. Das US-amerikanische Modul der Internationalen Weltraumstation ISS soll bereits bis 2025 überwiegend in privatwirtschaftlicher Hand liegen.
Neues Geschäftsmodell für Großprojekte
Man kann ohne weiteres von einem neuen Geschäftsmodell für Großprojekte sprechen, die „in alten Zeiten“ durchweg vom Staat finanziert und durchgeführt wurden, aber seit einiger Zeit dabei sind, von der Wirtschaft übernommen zu werden. Die Weltraumfahrt stellt dabei den Musterfall dar, das Vorbild, angeführt vom Tausendsassa-Unternehmer Elon Musk und seiner Firma SpaceX.
Dieses Geschäftsmodell funktioniert wie nachfolgend erklärt. Ein oder gar mehrere äußerst finanzkräftige Unternehmer entwickeln eine großindustrielle Technologie bis zur Serienreife. Der Staat unterstützt diese Entwicklung gerne, weil er erstens