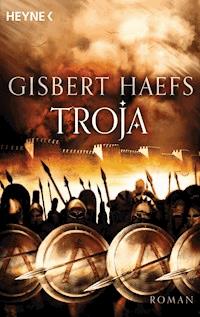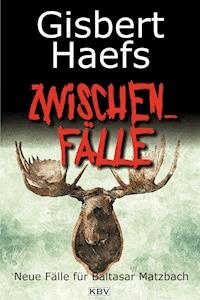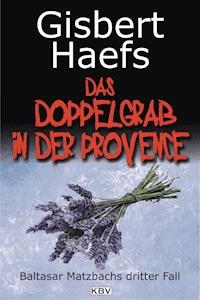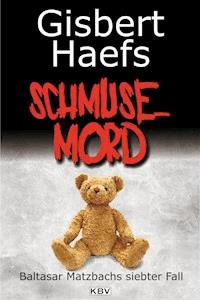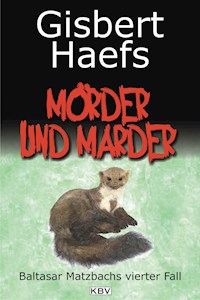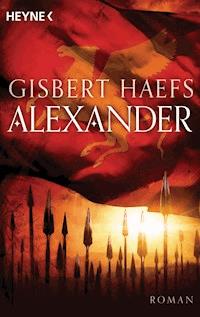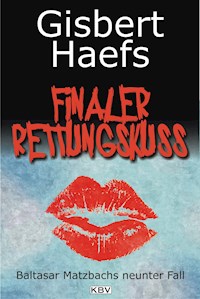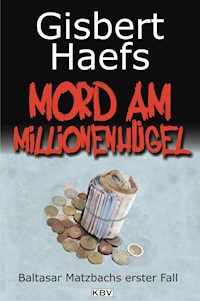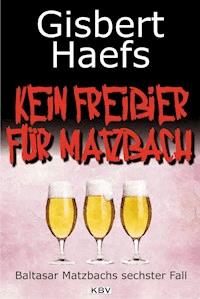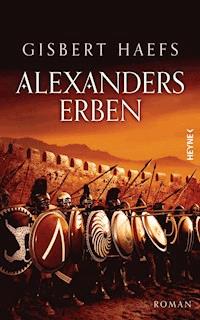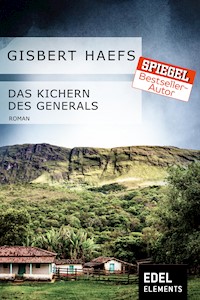
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mario Guderian
- Sprache: Deutsch
»Gisbert Haefs führt mitten hinein ins pralle, wüste Leben.« (Der Tagesspiegel) Der alte General, der dreieinhalb Jahrzehnte lang Paraguay wie seinen Privatbesitz geleitet hat, sitzt im Exil an der Küste Brasiliens und langweilt sich. Er möchte noch einmal schäbig kichern und noch einmal an den Strängen zupfen, die er selbst geflochten und gespannt hat. Schauplatz ist die Stadt Ciudad del Este im Dreiländereck Brasilien-Paraguay-Argentinien. Durch die Stadt verläuft eine der Hauptrouten des Narko-Handels, kontrolliert von Leuten des Cali-Kartells. In Ciudad del Este sitzt die Hizbollah, die von hier 1994 den blutigen Anschlag auf das jüdische Zentrum in Buenos Aires vorbereitete. Und deswegen ist auch der Mossad vertreten - ebenso wie CIA, DEA und die militärischen Geheimdienste der umliegenden Staaten. In diesen Teich voller Haie wirft der General als Köder eine Leiche – und Informationen, die alle Haie ganz unterschiedlich interpretieren. Geht es um Geld, Kokain, Waffen oder einen Putsch? Oder alles zusammen? Sicher ist nur: Der General wird kichern. Worüber, das weiß nur er...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © Gisbert Haefs 1996/2014 Der Roman erschien zuerst 1996 im Haffmans Verlag.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
eISBN 978-3-95530-446-1
Inhaltsverzeichnis
1.
Filiberto Anagnostópulos fuhr zusammen; die Hängematte zuckte in alle Richtungen nacheinander. Schreibblock und Füller (ein Montblanc Meisterstück), die auf seinem Bauch geruht hatten, klatschten ins Gras. Der Biograph rieb sich die Augen. Greifengebrüll? Das Krächzen des Vogels Roc? Artillerie? Er blinzelte in den Himmel außerhalb des Pinienschattens und suchte vergeblich nach Blitzen oder Gewitterwolken; auch war der fern rauschende Atlantik nicht hangauf gerast, Gischt wider die weißen Wälle der Estancia zu speien.
Anagnostópulos fuhr sich durch die Haare. Und stutzte. Die Nackenhaare standen starr: Struppen, Borsten, Arschgefieder des Stachelschweins. Da wußte er, noch ehe er sich erinnerte, was ihn geweckt hatte: das Kichern des Generals.
Es war ein gräßliches Geräusch. Abgebrochener Fingernagel an rissigem Perlmuttknopf. Alufolie, beim Auswickeln der Praline übersehen, am plombierten Backenzahn. Bimsstein an verkrusteten Hämorrhoiden. Wenn Karaí Guasú (der Große Alte) kichert, hatte es oft geheißen, rutschen im ganzen Land die Bestatter von ihren Frauen und zimmern hektisch Särge bis zum dritten Hahnenschrei.
Bei aller Disharmonie war das Kichern doch etwa so aufgebaut wie ein Akkord. Der Grundton kein Quarren, Murren, Rumpeln oder Geknarr, sondern das Knirschen und Malmen von Säurekieseln, die als Strudel die gereckte Hand des Erstickenden ätzen und schrappen. Darüber, Terz und Hauch, nicht scharfes Keuchen eines durch Emphyseme keineswegs am Beißen gehinderten Bluthunds, wie es el viejo general zugestanden hätte – eher das breiige Gurgeln und Summen, mit dem es der Ahnherr aller Krokodile in heiterer Gelassenheit genießt, wenn Sägeschnabelkolibris ihm Steinschleim aus den Zähnen raspeln. Die Quint schließlich hatte etwas Sonniges, eine Sommermelodie, munterer als Pájaro choguï, vom Zephyr gespielt auf Lanzenspitzen, Saurierknochen und den blutigen Ruinen eines Lustschlößchens.
»¡Ordene mi General!« Höchstens fünf Sekunden nach dem Geräusch stand Anagnostópulos neben der Matte, hellwach, bis zur Hirnhaut voll Adrenalin, die linke Hand an der Naht der gelben Bermudas, die rechte flach auf dem Herzen.
Erinnerungsfetzen, die Erzählung eines ehemaligen Adjutanten: Im Palast, im Büro des Präsidenten, klingelt eines der internen Telefone. EI viejo general unterbricht den Monolog, dem die engsten Berater gelauscht haben, geht zum schweren Schreibtisch, nimmt den Hörer, sagt ¿qué?, schneidet eine Grimasse und räuspert sich. »Nein, Señorita, da haben Sie sich verwählt. Hier ist das zentrale Sargdepot.« Dann hängt er auf. Und kichert. Drei Leute, die hätten verhindern müssen, daß diese Nummer von außen angewählt werden kann, wurden nie mehr gesehen.
Der Karaí Guasú saß auf der Terrasse, mit dem Obersten, der die Leibgarde befehligte, und dem neuen Adjutanten, in dessen fahlem erschreckten Gesicht die sonst kaum bemerkbare Narbe dunkelrot glomm. Der Oberst betrachtete mißmutig seine Hose, die den verschütteten Kaffee aufsog. Langsam stellte er die leere Tasse auf den Teaktisch.
Ein Winken, an dem höchstens drei Finger beteiligt waren. Der Alte, dreieinhalb Jahrzehnte lang Herr über Leben und vor allem Tod seines Volks, hatte in den fünf Jahren des brasilianischen Exils weder Autorität noch Stil verloren. Er mochte keinen Staat mehr als Privatbesitz leiten und war inzwischen 82 Jahre alt, aber er hatte die Dollarmilliarden, das Charisma, und auch an diesem Novembernachmittag 1994 trug er Anzug, weißes Hemd, tadellos gebundene Krawatte.
Anagnostópulos wagte nicht, Block und Füller aufzuheben; fast im Laufschritt legte er die zwanzig Meter zur Terrasse zurück.
»Setzen Sie sich, Añañú.«
Der Biograph gehorchte und atmete auf. Die Verwendung des Spitznamens war ein Zeichen für gute Laune.
»Ich habe nachgedacht.« Der General betrachtete seine gepflegten Fingernägel. Zum x-ten Mal fragte sich Anagnostópulos, welche Aufgaben die Mestizin mit dem Lutschmund sonst noch erfüllen mochte, neben Maniküre. Mit ihr redete der Alte immer Guaraní, und es gab tausend Geschichten über Frauen ...
»Da die Dinge sind, wie sie sind«, sagte der Karaí Guasú, »wollen wir ein bißchen an Fäden zupfen, die wir so lange gesponnen und gespannt haben. Mal schauen, was dabei herauskommt. Außerdem ist es gut gegen Langeweile, und man fühlt sich dann nicht mehr so nutzlos, alt und impotent.«
Alejandro Oribe hüstelte. Die Narbe auf seiner Wange war erloschen, das Gesicht hatte wieder die gewohnte Farbe. »Wir sind voll erregter Erwartung, mi general.« Da war keinerlei Spott; der Adjutant meinte jede Silbe ernst.
»Anfang der Fünfziger«, sagte der General, »hat es dem Hysteriker Perón, diesem Trottel, gefallen, einen alten deutschen General namens Kurt Tank und einen deutschen Kernphysiker ... ah, wie hieß er noch? Später hat er, glaube ich, für Nasser gebastelt. Egal. Also, die beiden sollten für Perón ein bißchen Spielzeug herstellen.«
Oberst Sepúlveda trug noch immer Abzeichen und Uniform der schweren Truppen (»Kavallerie«) des Staats, der nicht mehr Privatbesitz des alten Generals war. Allerdings hatte er sich der Uniformjacke entledigt, zweifellos nicht ohne vorher den Alten um Erlaubnis zu bitten. ›Er wird sanft‹, dachte der Biograph. ›Früher hätte es diese Formlosigkeit nicht gegeben. Nicht zu reden von Bermudas ... ‹
»Erlauben Sie, mi general«, sagte der Oberst.
Der Alte nickte.
»Wir hatten in den letzten Tagen den Eindruck, Sie seien mit Ihren Gedanken weit fort. Waren Sie da bei Perón und diesen Fäden, an denen Sie zupfen wollen?«
»Nein, coronel. Jedenfalls nicht bei Perón. Den erwähne ich nur als Beispiel. Die Geschichte von ihm und seinem Spielzeug ist ... eine Parabel.« Er schwieg, trank einen Schluck Kaffee.
»Warum haben Sie damals eigentlich Perón kein Asyl gewährt?« sagte der Biograph. »So weit sind wir zwar mit den Aufzeichnungen noch nicht, aber nun, da der Name gerade fällt ...«
»Sie wissen doch, ich habe immer mit allen gespielt«, sagte der General. »Solange es nützlich war.«
»Und Perón war nicht nützlich?« Anagnostópulos dachte an die beinahe legendären Manöver – als Australien (noch) keine Japaner einwandern lassen wollte, ließ der Karaí Guasú sie ins Land, plus eine Milliarde Dollar; und eine Milliarde von den Saudis für das Wegsehen bei bestimmten arabischen Projekten, und noch eine für die Kanalisierung des Mäanders amerikanischer Waffen, und etwas von Israel für Unterstützung in der UNO und und und.
»Er war lästig«, sagte der General. »Und es hätte die Beziehungen zur neuen argentinischen Regierung belastet. Gute Nachbarschaft, nicht wahr. Außerdem war er ein Hysteriker; ein Enthusiast, der an seine Mission geglaubt hat – also ein Trottel. Aber zurück zu der Geschichte. Die beiden aus der alten Heimat, der Offizier und der Physiker, haben sich auf der feinen großen Insel im Lago Nahuel Huapí niedergelassen, gegenüber von Bariloche. Nette Gegend – verschneite Berge, blaues Wasser. Ach ja. Auf der Insel saß bis vor ein paar Monaten noch die Leitung des Nuklearprogramms. Menem hat es ja angeblich liquidiert.« Er grinste, bleckte einen Moment die Zähne. Es waren die dritten, perfekt.
»Angeblich?« sagte der Biograph.
»Sagen wir: vorübergehend eingemottet. So, daß ein Nachfolger mit schlechteren Beziehungen zu den Yanquis alles wieder ausmotten kann. – Also, es wurde ein Schacht in die Tiefe getrieben, bis in seismisch interessante Schichten. Und dann hatte Perón den besten, oder einzigen guten, Einfall seines Lebens. Er hat sie angewiesen, da unten mit Knallerbsen zu werfen. Oder, falls es Tanks Idee war, was ich fast annehme, hat Perón klugerweise zugestimmt.«
»Knallerbsen?« Oberst Sepúlveda beugte sich ein wenig vor. »Welche Sorte Knallerbsen?«
»Einfache. TNT. Dynamit. Kordit. Von mir aus antike deutsche Handgranaten aus dem Ersten Weltkrieg. Es waren aber, wie gesagt, seismisch interessante Schichten am Osthang der Anden, und fünfzig Kilometer westlich haben die Chilenen und die Yanquis das sofort angepeilt. Und sie haben sich gesagt, kein Mensch fummelt in dieser Tiefe mit normalem Sprengstoff herum, vor allem nicht ein General Tank und – ¡ay caramba! Wie heißt denn der andere!?«
»Und?« sagte Oribe; wenn der Adjutant ein Hund wäre, dachte Anagnostópulos, hätte er jetzt die Ohren aufgestellt.
»Und«, sagte der Karaí Guasú, »dann haben die Chilenen sofort alle strittigen Grenzverträge mit Perón unterzeichnet. Dabei konnte er sonst gar nicht bluffen. War ein mieser Trucospieler; nicht mal Poker konnte er richtig.«
Anagnostópulos erinnerte sich an Geschichten – sagenhafte Pokerpartien, endlose Runden Tarock und Truco im Palast oder in wechselnden Armeequartieren. Oft hatte el viejo general gewonnen. Fast immer. Der Biograph begann sich vor dem »Fädenzupfen« zu fürchten; fast teilnahmslos registrierte er, daß seine Nackenhaare sich prophylaktisch aufstellten.
Oribe schien mit seinen Gedanken woanders zu sein. Oder? Hatte er schon eine Ahnung? »Es mag Ihren Plänen hilfreich sein, mi general, daß einer Umfrage zufolge die Menschen daheim Sie noch immer lieben.«
»Ach, tun sie das?« sagte der General. »Die Trottel.«
»Was haben Sie denn genau vor?« sagte Sepúlveda.
»Dazu brauche ich ein bißchen Hilfe. Sie, Caballeros, werden alle drei ein wenig reisen.«
Der General kicherte.
Danach redete er sehr lange.
Und danach lachte er.
2.
Über der Küste und dem Mittelmeer jenseits von Estepona lag noch grauer Dezemberdunst. In den Bergen schien schon die Sonne auf die nach jahrelanger Dürre öden Hangfelder und die bewässerten Grüns der Golfanlage; Andalusiens Wirklichkeit endete, wo der surreale Tagtraum der Reichen begann.
Guderian lief die zehn Kilometer um das Clubgelände, wie jeden Morgen seit fast 28 Monaten, mit den üblichen Unterbrechungen für Zauninspektion, Liegestütz und Sit-ups. Es war der letzte Morgen und eine Art Abschiedslauf, ohne besondere Vorkommnisse. An einer trockenen Zisterne tötete er zwei Vipern mit der mexikanischen Machete, vor Jahren in Pátzcuaro gekauft. Er wischte die Klinge an einem Klumpen Dörrgras ab, las zum tausendsten Mal (mit dem tausendsten schwachen Grinsen) die Inschrift Mi honor o la muerte und schob die Waffe zurück in die Scheide. Das gut befestigte Ensemble, das ihn beim Laufen nicht störte, trug er wie ein Samuraischwert über der linken Schulter.
Es war auch ein Abschiedslauf ohne besondere Regungen. Vielleicht half ihm die Bewegung, sich von seinen Gefühlen zu distanzieren; vielleicht waren die Gefühle ohnehin distanziert genug. Er dachte an Rosario, ihr Gesicht, ihren Körper; seit anderthalb Jahren hatten sie Arbeit und Bett geteilt, einander Wärme gegeben, aber kaum Nähe. Das Ergebnis langer Gespräche war, daß sie nicht mitkommen und er nicht bleiben wollte. Sie würde, vielleicht genau jetzt, den kleinen Honda starten und in die Stadt fahren, um nicht da zu sein, wenn er aufbrach. María, die Frau des Gärtners, wollte sie begleiten und »Dinge besorgen«.
Er lief weiter, locker, ohne zu keuchen. Nur mit einem kleinen Seufzer, als Erinnerungen neben ihm auftauchten, die er nicht abschütteln oder niederrennen konnte. Weniger Erinnerungen an die lebhaften Tage, wenn die Clubmitglieder (Topmanager aus Industrie, Dienstleistung und Verwaltung – alles, was zwischen Düsseldorf und Stuttgart gut und teuer war) mit Ehe- oder sonstigen Partnern, Sekretärinnen, seltener Kindern in den Club einfielen zu Erholung, Golf, Tennis, Planschen, Billard, Poker, Roulette und Bowling, zu Surf-, Segel- und Besichtigungstouren sowie generell zu exquisit miserablem Benehmen gegenüber den Domestiken. Die meisten Erinnerungen stammten aus den ruhigen Zeiten, wenn nur wenige oder gar keine »Gäste« da waren und Guderian zusammen mit Rosario, María und dem Gärtner Macedonio die Bungalows und Clubanlagen in Schuß hielt, ohne Zeitpersonal und ohne Hektik.
Dürstende Karnickel hatten ein Loch unter dem Zaun gegraben. Guderian blockierte den Durchschlupf mit einem schweren Stein, aber gegen die Erinnerungen gab es keinen Pfropfen. Ein Hauch aus der Sierra brachte den stechenden Geruch von versengter Erde und angekokelter Vegetation, der für Momente die Ausdünstung des feuchten Grases diesseits der Grenze überlagerte. Hoch im Westen, wo nachts die eisige Pracht des andalusischen Sternhimmels gelockt hatte, kreiste ein Geier.
Vor nicht ganz zweieinhalb Jahren hatten sie Guderian angeheuert, als »Sicherheitsberater« – de facto Mädchen für alles – des Millionärsclubs. Dessen Sicherheit war in der ganzen Zeit nur durch Wassermangel und ein paar Schlangen bedroht gewesen. Sie zahlten 6000 pro Monat, exterritorial, also netto, plus irgendwas an Versicherungen, die ihn nicht interessierten. Bei seinen Einsätzen als Golf- bzw. Tenniscoach und Barmann nahm er Trinkgeld an. Da er die meisten Bedürfnisse im Club stillen konnte, hatte er nicht viel ausgegeben; sein VISA-Konto bei einer britischen Bank wies ein Guthaben von fast 100.000 DM aus und wurde mit albernen 3,5 % verzinst. Sein Guthaben an Langeweile wuchs weit schneller. Vor ein paar Wochen hatte ihn der Clubsekretär, Fred Meininger, aus Wiesbaden angerufen und gefragt, ob er über die Jahreswende etwas in Paraguay zu erledigen bereit sei; Guderian hatte nach Details gefragt, gegrübelt, lange bittersüße Nachtgespräche mit Rosario geführt oder bestritten und dann beschlossen, nach Erledigung des Jobs in Südamerika zu bleiben.
Die meisten derartigen Entschlüsse hatte er aus Langeweile gefällt, nicht weil ihm das Neue (das er erst kennenlernen mußte) besonders überzeugend erschienen wäre. Er war 1959 geboren, hatte ein unauffälliges Abitur gebaut und mit den halblinken Eltern gebrochen, indem er sich freiwillig zu den Waffen meldete: Grenzschutz. Nach Sandkastenspielen mit der GSG 9 und Turnübungen (teils im östlichen Ausland) mit dem BND war er aus Langeweile ausgeschieden und zu einem privaten Personen- und Objektschutz gegangen, der ihn unter anderem als Bodyguard für edelblasierte ›Stern‹- und ›Spiegel‹-Reporter einsetzte, die in El Salvador und Nicaragua vorgefaßte Meinungen durch sogenannte Recherchen untermauern wollten. Nach Heimreise der Journaille sah er sich noch ein wenig um, beschaute vor allem die garstige Arbeit seiner amerikanischen Kollegen; eine junge Dame von der CIA ergänzte im Verlauf einer stürmischen Sechs-Wochen-Romanze (San Salvador – Managua – México D. F. – Guadalajara – Pátzcuaro – El Paso) seine undeutlichen Einzelheiten durch deutliche Anspielungen. Dann wieder heim ins größere Deutschland, zurück zur alten Firma, schließlich die Zeit als Babysitter für Millionäre und ihr andalusisches Spielzeug. Out, over, Roger. Und nun?
Macedonio, der ihn zum Flughafen Málaga fahren würde, stand vor einem der kreisförmig angeordneten Bungalows, nickte ihm zu (ein wenig verdrossen, wie es schien) und befestigte eben einen neuen langen Stiel am Käscher, mit dem er Insekten, Laub und Halme aus den Pools zu fischen hatte. Guderian ging ins »Domestikenquartier«, duschte, zog ein helles Hemd, Chinos und Lederslipper an, stopfte Rennklamotten und Machete in die größere Reisetasche, Waschzeug ins Handgepäck und ging hinüber ins Sekretariat.
Fred Meininger, vor zwei Tagen aus Deutschland zur Vorbereitung der Weihnachtshektik angereist, hockte hinter dem schweren Eichenschreibtisch und hantierte mit einer Maus. Guderian konnte den Bildschirm nicht sehen, nahm aber an, daß der Sekretär Schiffchen versenkte oder Vampire jagte. Für richtige Arbeit war es wohl noch zu früh. Meininger blickte auf, nickte, deutete auf das Tablett mit Kaffee und Zubehör und schaltete den PC aus.
»Morgen, Mario. Bedienen Sie sich. Alles fertig?«
Guderian hob die Schultern. »Ich reise leicht.« Er goß sich einen Becher voll Kaffee und zog einen Stuhl vor den Schreibtisch, um nicht in einem der Plüschsessel ertrinken zu müssen. Eher desinteressiert sah er zu, wie Meininger unterm Tisch die in grauem Flanell befangenen Beine kreuzte und imaginäre Flusen vom dunkelblauen Blazer zupfte. Auf der Platte lagen Papiere und ein mit dickem Gummi umwickeltes Bündel.
»Tja, also, haben Sie es sich noch mal überlegt?«
Guderian schüttelte den Kopf.
»Bedauerlich.« Meininger patschte sanft mit der rechten Handfläche auf das Bündel. »Ich habe mir trotzdem erlaubt, ein offenes Rückflugticket zu besorgen. Falls Sie Heimweh kriegen ...«
Guderian lachte. »Nett. Vielen Dank.« Er dachte an andalusische Nächte mit Barbecue und Fandango und großkotzigen Gästen, und an Rosario. Insgesamt war in alledem durchaus etwas von Heimat. Und Sicherheit. Und Knast.
»Málaga«, sagte Meininger. »Madrid. Buenos Aires – Iguazú, argentinische Seite. Ein Mitarbeiter namens Ramón Mendoza holt Sie da ab. Scheint einfacher zu sein als via Asunción. Das hier« – er schob das Bündel über den Tisch – »sind die Tickets und zehntausend Dollar. Spesen, Bestechungen derlei Notfälle. Im Camp ist noch eine Dame – uh, Claudia Guttenberg, Deutsch-Chilenin. Zuständig bis März einschließlich.«
Guderian deutete auf die Papiere. »Ist das auch noch für mich?«
»Ja. Alles, was Sie an Unterlagen brauchen – Namen von Gesprächspartnern, Adressen, Bankdaten, Inventarlisten und so weiter.«
Es ging um ein ebenfalls dem Club gehörendes Gelände im Osten von Paraguay, Anfang der Achtziger gekauft und ausgebaut, als die Mitglieder des Clubs befürchteten, die Bonner Regierung werde dem Druck der Straße nachgeben, aus der Nachrüstung aussteigen und Westeuropa erpreßbar machen: Wenn das Gleichgewicht der nuklearen Abschreckung ende, könne die überlegene Seite notfalls bis zum Angriff mit konventionellen Waffen gehen; man bilde sich nicht ein, irgendwo einen Atomkrieg aussitzen zu können, lege nur einfach keinen Wert darauf, unter einem sowjetischen Besatzungsregime zu vegetieren. Dann lieber in Dschungelbungalows. Für ein solches Refugium hatte es nirgendwo bessere Konditionen gegeben als im Reich von General Stroessner. Seit dem Ende des Ost-West-Antagonismus hatte man versucht, das Areal samt Bebauung wieder abzustoßen. Nun sollte ein von UNO und EU gefördertes Joint-Venture-Projekt dort Personal unterbringen, Labors einrichten und die pharmakologischen Möglichkeiten der tropischen Flora untersuchen. Ein Mittelsmann hatte den Verkauf arrangiert.
»Wieviel Zeit zum Abwickeln?« sagte Guderian.
»Wenn Sie Glück haben, geht’s in ein paar Tagen. Rechnen Sie lieber mit mehr. Bis dahin sind Sie angestellt, dann kriegen Sie noch Geld für Resturlaub.« Meininger zog mit spitzen Fingern ein Foto zwischen den Papieren hervor. »Da. Oder hatten Sie das schon gesehen?«
Guderian schüttelte den Kopf. Es war eine Luftaufnahme; sie zeigte einen kreisförmigen Bungalowkomplex mit zentralen Gebäuden, einem äußeren Rodungsring, hohen Zäunen und einer Zufahrt mit Schranke. Jemand hatte CAMPO ALEMÁN an den Rand geschrieben, mit Fettstift.
»Wer kümmert sich darum?«
»Dieser Mendoza und seine Frau.«
»Sonst niemand?«
Meininger grinste flüchtig. »Wenn jemand Ferien machen will, wird Zeitpersonal eingestellt. Mendoza soll den Dschungel stutzen und die Bungalows funktionsfähig halten – Strom, Wasser und so weiter. Der Kommandeur der nächstgelegenen Panzergarnison kriegt dreitausend Dollar pro Monat; dafür schickt er gelegentlich einen Jeep vorbei und verzichtet aufs Plündern.«
»Und diese Deutsch-Chilenin?«
»Claudia Guttenberg? Arbeitet eigentlich für ein Export-Import-Büro in Asunción, das einige unserer ehrenwerten Mitglieder gemeinsam betreiben. Kennt sich aus, hat gute Drähte – sagen wir, freiwillig abkommandiert für diese Abwicklung.«
»Haben Sie Fotos von denen? Mendoza und Frau und die Chilenin?«
Meininger runzelte die Stirn. »Ja. Wieso?« Er kramte, fand die gesuchten Bilder und schob sie Guderian hin.
»Falls jemand das Personal ... ausgetauscht hat.« Guderian versuchte, sich die Gesichter einzuprägen. Die Mendozas verfügten über reichlich Indioblut; beide waren klein und stämmig. Die Deutsch-Chilenin hatte ein ovales Gesicht mit feinem, fast zerbrechlichem Kinn, braune Haare, braune Augen.
»Mißtrauisch, was? Gut.« Meininger nickte nachdrücklich, wie zur Bestätigung einer soeben verkündeten ewigen Wahrheit. »Deshalb schicken wir Sie ja hin. Sie können Spanisch, Sie kommen von außen und sind wahrscheinlich resistent gegen Köder oder Drohungen.« Er seufzte. »Wäre alles ja nicht so kompliziert, wenn nicht doch manchmal jemand vom Club dagewesen wäre. Möbel gekauft, Kram hinterlassen – deshalb die Listen. Der eine will das haben, der andere jenes verkaufen. Na ja, Sie werden sehen.«
Guderian nickte.
Meininger faltete die Hände auf der Tischplatte und musterte die Nägel. Sie waren bestens manikürt. »Ich wiederhole mich, aber wir sehen Sie ungern scheiden, Mario. Bis Ostern müssen wir den Job hier neu besetzen. Wenn Sie es sich vorher anders überlegen ...«
Guderian stand auf. »Dann sag ich Bescheid.« Er klemmte sich Papiere und Bündel unter den linken Arm und reichte Meininger die Rechte.
»Ah, noch was.« Der Sekretär erhob sich; beim Händeschütteln sagte er: »Was ich immer schon mal fragen wollte. Sind Sie eigentlich mit dem Panzergeneral verwandt?«
»Ganz ehrlich? Auch wenn Sie enttäuscht sind? Na gut – nein, soweit ich weiß.«
Meininger ließ die Mundwinkel sinken. »Hab ich mir gedacht. Trotzdem schade.«
Kurz nach 15 Uhr stand Guderian am nächsten Tag in der schwülen Hitze vor dem Abfertigungsgebäude des Flughafens von Puerto Iguazú. Der Mann, der aus dem Landrover stieg und sich mit einem fragenden Grinsen näherte, war etwa 165 cm groß, 15 cm kleiner als Guderian; er trug Jeans, ein blaues T-Shirt ohne Aufdruck, einen dünnen Schnurrbart und ähnelte dem Kerl, den das Foto in den Unterlagen zeigte.
Die Formalitäten waren schnell erledigt. Sie bestanden daraus, daß Guderian ihm erklärte, er sei tú y Mario, nicht usted y Señor Guderian. Ramón Mendoza fragte nach dem großen General und war glücklich, als Guderian behauptete, ein Großneffe (Enkel des Bruders) zu sein.
Da der argentinische Pilot vor der Landung die obligatorische Schleife über den Wasserfällen absolviert hatte, lehnte Mario die angebotene Fahrt ins Naturschutzgebiet (mit längerem Wandern) dankend ab. Dreißig Minuten später überquerten sie den Rio Iguazú; die Argentinier ließen sich nicht blicken, ein brasilianischer Posten auf der anderen Seite der Tancredo-Neves-Brücke winkte sie durch.
Foz do Iguaçú wirkte wie eine wohlhabende Großstadt: gute Straßen, teure Häuser, moderne Hotels. Guderians Neugier hielt sich allerdings in Grenzen; er gähnte immer häufiger und mußte Schlieren wegblinzeln. Er nickte nur, als Mendoza etwas von »langer Flug, was?« und »müde, wie?« sagte.
Auf der mächtigen »Brücke der Freundschaft« über den Paraná war kaum Verkehr Richtung Paraguay; auf der anderen Seite dagegen staute sich alles. Mendoza sagte, Paraguay sei ärmer und billiger, deshalb kämen die Brasilianer aus dem reichen Foz nach Ciudad del Este zum Einkaufen und begönnen jetzt mit der Heimfahrt. Morgens staue sich alles Richtung Puerto.
»Puerto?«
Mendoza grinste und machte eine ausladende Geste mit dem Arm; der paraguayische Posten nahm das als Gruß und winkte zurück. »Puerto Presidente Stroessner, heute Ciudad del Este. Da hast du’s.«
Guderian gähnte wieder; es kostete Mühe, nach rechts und links zu blicken. Zu beiden Seiten der Brücke Tausende Verkaufsbuden zwischen Hochhäusern und Apartmentblocks sowie auf der Uferstraße; dann kamen sie zu einem weiten runden Platz und verließen das Zentrum. Die westlichen Gebiete wirkten unauffällig heruntergekommen.
»Netter Ort«, sagte er. Dann deutete er nach links; das letzte größere Gebäude protzte mit der Aufschrift Asociación cultural japonesa. »Japaner, hier?«
Mendoza kicherte. »Wenn das alles wäre ... Warte, bis du mehr siehst. Wenn Südamerika der Arsch der Welt ist und Paraguay das Arschloch, dann ist Ciudad del Este das fieseste Hämorrhoid.«
Guderian gluckste. Dann sagte er: »Wieso?« Mendozas langwierige Antwort hinderte ihn am Dösen und war ausreichend bizarr, so daß er sich fragte, ob nicht alles bereits Traum sei.
»Japaner«, sagte der Paraguayer. »Koreaner. Chinesen – Peking und Taiwan. Ah, auch beide Sorten Koreaner, klar? Araber. Die Hizbollah hat von hier aus dieses Attentat in Buenos Aires organisiert, das jüdische Zentrum, mit wieviel? Achtzig Toten? Egal. Deshalb ist auch der Mossad hier. Die CIA und der militärische Geheimdienst der Gringos. Und die Drogenbehörde, DEA. Das Cali-Kartell und das, was von den Medellín-Leuten übrig ist ... Die benutzen nämlich hier die Brücke und die Fähre und weiter oben den Stausee, um ihre Scheiße zu den brasilianischen Häfen zu bringen. Einen Teil jedenfalls; das meiste geht oben im Norden auf dem Landweg rüber – die Provinz Amambay gehört denen fast. Hab ich was vergessen? Unsere Polizei; aber ... na ja. Die militärischen Geheimdienste der Brasilianer und der Argentinier. Ziemlich sicher auch Russen, Franzosen und Briten. Beide Fraktionen der Armee – die Infanterie, untersteht General Anaya; korrupt, aber loyal. Und die caballería, also Panzer und so weiter, unter General Oviedo; sehr korrupt, macht angeblich jede Menge Geld, indem er die Cali-Leute eskortiert. Nicht loyal; man weiß nur nicht, ob er seine Pesos und Dollars jetzt sofort in einen Putsch oder demnächst in einen Wahlkampf stecken wird.«
»Ich glaube, hier gefällt’s mir«, murmelte Guderiaii.
3.
Eladio Montesinos verabredete sich gewöhnlich nicht in der Scheiße mit Freunden, aber Lorenzo war allenfalls ein Bekannter, kein Freund, und sie waren auch nicht verabredet. Außerdem war es ein besonderer Tag.
Eine Horde kreischender Vögel schoß hinüber nach Brasilien. Fahler Morgen, vor Sonnenaufgang; Eladio blickte nicht auf, um zu sehen, welche Sorte Vögel es war. Es interessierte ihn nicht sehr, und er befand sich gerade an einer steilen Stelle des Hangs. Lieber aufpassen, dachte er, als in dem Rinnsal landen, das der Damm vom Paraná übrigließ.
Er hätte nicht dort herumkraxeln müssen, um zwischen Kot, Kippen und Kondomen nach Gegenständen zu suchen, die vielleicht aus einer Tasche gerutscht waren und sich verkaufen ließen. Er hatte in dieser Nacht erstklassigen Umsatz gemacht, aber in solchen Nächten war Leonor meistens bis nach Morgengrauen beschäftigt, so daß er noch nicht heimgehen mochte, und guter Umsatz ist kein Grund, mit alten Gewohnheiten zu brechen.
Lorenzo de Kok kniete an einer flacheren Stelle zwischen drei Krüppelbüschen und zuckte zusammen, als Eladio lautlos neben ihm auftauchte.
»Ach du«, sagte er dann. »Ich dachte schon.«
»Lohnt sich nicht.« Eladio sah zu, wie die geschickten Finger des anderen kleine Gegenstände aufhoben und in die Plastiktüte steckten. Er wußte, daß sie bräunlich und glibberig waren, aber es war noch nicht hell genug, das zu sehen. »Gute Funde?«
Lorenzo schnaubte. »Vierzig, vielleicht ein paar mehr. Bis jetzt.« Er seufzte. »Eigentlich mach ich das ja nicht ...«
Eladio hockte sich auf die Fersen und hielt de Kok das Zigarettenpäckchen hin. Als beide rauchten, sagte er:
»Ich hab mich auch schon gewundert. Was Besonderes?«
»Ah, Marta hat ihre Tage.«
»Und deshalb krabbelst du hier rum? Junge ...«
Lorenzo schüttelte den Kopf. »Die kreischt dann immer im Schlaf, oder schmeißt mit Kissen. Da geh ich lieber erst ins Bett, wenn sie wieder wach ist. – Und du? Hier?«
»Alte Gewohnheit. Man weiß ja nie ... Die gehen aber immer an dieselben Plätze, was?«
Lorenzo blies die Wangen auf. »Wohin denn sonst? Ist doch viel zu steil.«
Sie rauchten schweigend zu Ende. Hundert Meter entfernt polterte ein Lkw über die Brücke der Freundschaft. Eladio musterte den untersetzten Halbindio, der da in schmierigen Klamotten kauerte, in der linken die Plastiktüte, in der Rechten die Kippe. Die Finger, die die Zigarette hielten, glitzerten feucht; Eladio sah zu, wie Lorenzo noch einen Zug nahm, und schüttelte sich unterdrückt, als etwas feucht Glitzerndes neben dem Mund hängenblieb. Vielleicht war es auch nur Einbildung.
»Na denn. Gute Jagd noch.« Er warf die Kippe weg und stand auf. »Irgendwas Größeres weiter drüben?«
Er hatte sich langsam von Norden nach Süden vorgearbeitet; de Kok schien im Süden begonnen zu haben, jenseits der Brücke.
»Zwei Leichen«, sagte Lorenzo. »Durchschnitt, was? Haben aber beide nix in den Taschen. Nix Lohnendes jedenfalls.«
Eladio nickte. »Wir sehen uns.« Er verließ den halbwegs ebenen Fleck zwischen den Büschen und suchte weiter, oft auf Händen und Knien. Die Beine – er trug unten nur zerfetzte Shorts und Sandalen – waren wie üblich verschmiert und zerkratzt. Leichter zu waschen als eine richtige Hose. Irgendwie kriegte er es immer fertig, die Fotografenweste mit den tausend Taschen sauberzuhalten. Viel war in diesem Morgengrau noch nicht in die Taschen geraten; jedenfalls nicht viel hier am Hang. Die anderen Geschäfte ... Er summte leise.
Die erste der beiden Leichen, ein Indiomädchen, lag zwischen groben Steinen. Vierzehn, dachte er, vielleicht fünfzehn; er blickte zur Uferstraße hinauf, wo die aus Holz, Plastik und Wellblech bestehenden Rückseiten der tausend Verkaufsbuden eine abweisende Front mit wenigen Lücken oder Ritzen bildeten. Vergewaltigt, erwürgt, hinabgestoßen. Sie trug eine dünne Synthetikbluse und einen bunten, zerrissenen Rock. Er seufzte, wandte den Blick von der herausgequollenen Zunge ab und kroch weiter.
Ein Schweizer Armeemesser. Ein paar Meter entfernt ein Schlüsselbund. Ein kleines Portemonnaie; es enthielt einen brasilianischen Führerschein, ein paar Kreditkarten und kleine Geldscheine. Mit klebrigen Fingern zählte Eladio. 36.000 Guaraní – nicht ganz zwanzig Pesos oder Dollars. Na ja. Er würde dem Sargento einen Besuch machen müssen, wie vereinbart. Eine geschäftliche Vereinbarung. Der Polizist sorgte dafür, daß die Kollegen Eladio nicht behelligten; dafür erhielt er alle »amtlich verwertbaren« Fundstücke wie Schlüssel und Papiere und einen allerdings sehr dehnbar definierten Zehnten. An guten Tagen versteckte Eladio regelmäßig den größten Teil der Beute, bevor er den Sargento besuchte, der manchmal, wenn er mürrisch war, zum Unglauben neigte und darauf bestand, alle Taschen zu untersuchen.
Nach einer halben Stunde hatte Eladio sich fast bis unter die Brücke vorgearbeitet. Es wurde hell, und ehe er sich der zweiten Leiche näherte, die kaum fünf Meter entfernt schon zu sehen war, wollte er noch eine Zigarettenpause machen. Bis zur Brücke, dachte er; dann Schluß für heute. Leonor mußte den letzten Kunden inzwischen bedient haben. Sie würde duschen und sich dann schlafen legen. Die Vorstellung interessierte ihn erheblich mehr als das steile Ufer und die wartende Leiche.
Während er langsam rauchte, starrte er hinüber auf die brasilianische Seite. Er dachte an seine Ausbildung in den Künsten der Fingerfertigkeit, zuerst in Santos, dann in Rio, und an die Heimkehr nach Asunción, von wo es ihn schnell nach Ciudad del Este gezogen hatte, zur Brücke und zu den Zehntausenden, die mit leichtsinnig eingesteckten Brieftaschen aus dem reichen Brasilien ins arme Paraguay zum Einkaufen kamen. Oder um sich zu amüsieren. In den letzten Monaten hatten Leonor und er immer wieder Alternativen erwogen; sie hatten genug Geld zusammen, um wegzugehen, die Geschäfte zu verlagern – aber wohin? Rio, Montevideo, Punta del Este, Buenos Aires?
Er schnippte die Kippe fort und kroch weiter, verschob das Denken auf später. Die Leiche, die Brücke, danach der Heimweg und die Reinigung und das Bett und Leonor.
Dann spürte er etwas wie eine eisige Hand nach seinem Magen greifen. Er kannte den Mann, der da unter der Brücke lag, nur mit einem Hemd bekleidet. Er wußte, wohin der Mann gehörte, den jemand mit einem Messer erledigt hatte. Genitalien und Kehle, vielleicht in dieser Reihenfolge. Er schaute nach oben, zur Brücke, dann wieder auf die Leiche. Zehn Meter vor der paraguayischen Grenzkontrolle. War es denkbar, daß ein Wagen gehalten hatte und der Mann über das Geländer geworfen worden war, mitten in der Nacht, ohne daß ein Grenzposten etwas sah? Oder ...
Aus der Brusttasche des Hemds ragten zwei Dinge. Ein Papierzipfel und die Kappe eines Füllhalters, der den Sturz unbeschädigt überstanden zu haben schien. Mit spitzen Fingern zupfte Eladio an dem Papier. Es war weiß und mehrfach gefaltet. Mit Schreibmaschine hatte jemand TRAIDOR darauf getippt.
»Verräter?« murmelte Eladio. »An wem?«
Er sah sich um. Ratten; sie hatten sich noch kaum um den Toten gekümmert, der also nicht lange dort gelegen haben konnte. Vögel. Die Brücke war leer; drüben in Brasilien waren sie eine Stunde voraus, aber selbst dann war es noch zu früh. Zu früh wozu? Er beobachtete Lorenzo de Kok, der jetzt unten am Paraná kauerte. Er hatte die Plastiktüte geleert und umgedreht und hielt sie ins Wasser, um sie auszuspülen; dann streifte er sich sorgsam seine Fundstücke über die Finger und hielt beide Hände wie in defekten Handschuhen ins Wasser. Eladio machte ein halblautes Würgegeräusch tief im Hals. Wieso hatte Lorenzo den Toten nicht erkannt?
Dann schüttelte er den Kopf. Lorenzo war von hier, hatte nie in Asunción gelebt, hätte vielleicht einen ermordeten Ex-Minister erkannt, aber ...
Eladio seufzte. Es war eine gute, ertragreiche Nacht gewesen, und heute sollte ein besonderer Tag sein. Es war sein zweiundzwanzigster Geburtstag. Er hatte den Touristen und Einkaufsbummlern an die 700 Dollars und Pesos abgenommen, in sämtlichen Währungen des Cono Sur; heimkehren, duschen, zu Leonor ins Bett, die ihm als erstes mehrerer Geburtstagsgeschenke orale Wonnen versprochen hatte »bis du schreist«. Und nun das.
Er verfluchte seine ersten vierzehn Lebensjahre, in Asunción. Ohne die Kenntnisse von damals hätte er heimgehen können. Ein Toter mehr, na und? Aber dieser Tote – lieber hätte Eladio eine scharfe Bombe gefunden; die mochte ihn und die Brücke zerreißen, aber nicht das halbe Land.
Er stand auf, langsam, wie ein alter Mann. Langsam kletterte er hoch und ging auf die Brücke, zum schläfrigen Posten.
»Da unten«, sagte er heiser, »liegt einer.«
Der Posten zuckte mit den Schultern. »Sag’s mir nicht. Wieso kümmerst du dich darum?«
Eladio starrte ihn an und nannte einen Namen. Den Namen des Toten. Und dessen letzte Stellung.
Der Posten mochte Ende zwanzig sein; er war alt genug, um bestimmte Namen noch zu kennen. Eladio sah, wie der Mann blaß wurde. Nur um die Nase herum, aber das genügte.
»Muß ich ...«
Der Posten nickte. »Nicht sofort. In ein paar Stunden. Wenn alle wach sind. Sonst holen wir dich.«
»Das hab ich befürchtet.« Eladio wartete, bis der Posten zum Telefon griff; dann ging er schnell über die breite Straße, kroch den Südsockel der Brücke hinunter, sobald es möglich war, und verschwand zwischen Holzbuden, Müllbergen und Gebäuden. Er machte einen kurzen Dauerlauf daraus. Noch einen Block nach Süden, dann rechts die steile Steigung der Straße hinauf. Erst als er, leicht keuchend, vor der Casa Taipei angekommen war, ging er wieder langsamer. Eigentlich fand er das Monstrum – drei Dutzend Stockwerke aus Glas, Metall und Beton – abstoßend, aber an diesem Morgen erschien es ihm als Vorbote des 21. Jahrhunderts, Garant einer fortgeschrittenen Zeit mit ordentlichen Institutionen und einem funktionierenden Staat. Und erschwerten Arbeitsbedingungen für Taschendiebe.
Noch war es nicht soweit. Zum Glück? Er schnitt eine Grimasse, als er mit der Sandale in einem der monströsen Fahrbahnlöcher hängenblieb. Die Moschee neben der Casa Taipei war noch immer nicht fertig, auch nicht das einem obskuren arabischen Fürsten geweihte künftige Hotel schräg gegenüber. Vor dem koreanischen Restaurant stand eine Pfütze von Abwässern; in ein paar Stunden würde die Sonne nur dehydrierten Schmutz übriggelassen haben. Die Sonne, die jetzt niedrig durch die Bäume am oberen Ende der Straße schielte. Vor dem vor allem von Gringos genutzten Hotel standen interessante Wagen, aber Eladio widerstand jeder Versuchung. Gegenüber dem großen Grillrestaurant bog er links in eine Nebenstraße, fast zwei Blocks bis zum kleinen Park der Stadtverwaltung, dann wieder rechts, überquerte die große Nord-Süd-Straße zum weitläufigeren Park, jenseits dessen die hohen teuren Apartmenttürme standen.
Er wohnte im zweiten. Zwanzig Etagen mit achtzig Wohnungen, die meisten behaust von aufstrebenden Bürgern der Stadt. In den anderen Türmen lebten mehr Araber, Koreaner und Japaner; Leonors Geschäfte hätten dort eher Anstoß ... vielleicht nicht gerade Anstoß, aber Aufmerksamkeit erregt. Die Wohnung kostete viel, klar, aber die bessere Kundschaft zahlte mehr, Leonor brauchte Dusche, Telefon und Getränkekühlschrank, und insgesamt –
Eladio gähnte, als er auf den Fahrstuhl wartete. Er gähnte schon wieder, als er die Tür zum Apartment öffnete, gähnte weiter, während er sich im Bad auszog und unter die Dusche ging, und dann gähnte er nicht mehr, als er sauber und frisch ins Schlafzimmer trat.
Leonor lag auf der Seite; sie hatte noch gelesen und lächelte. »Feliz cumpleaños, chico«, sagte sie kehlig, legte das Magazin weg, streckte ihm eine Hand entgegen und fuhr sich mit der Zunge über die Oberlippe.
Das Fenster war verdunkelt. Neben der Lampe auf dem Nachttisch lagen Dollarnoten – fünf Zwanziger und fünf Zehner (Gegenwert der Monatsmiete der Wohnung, oder fünf Jobs à 30 $; emsiger Abend), dazu ein Hunderter und ein Zettel. Darauf standen ein Name, Leonard Thompson, und eine lange Telefonnummer, mit den Vorwahlen für Brasilien und Foz do Iguaçú.
»Licht aus?« sagte Eladio.
»Ts ts. Dann siehst du doch nichts.«