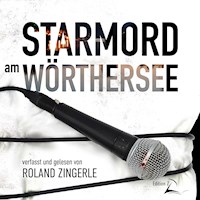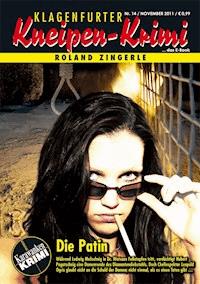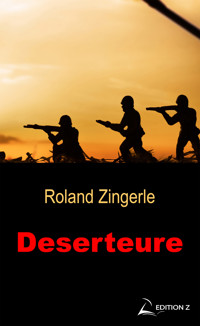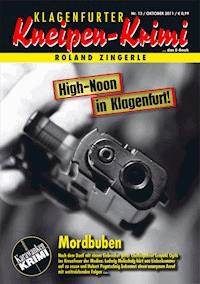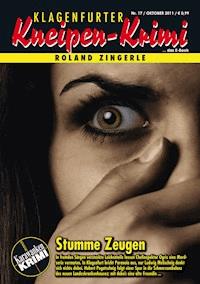Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Seit neun Jahrhunderten gilt das Parzival-Manuskript des provenzalischen Sängers Kyot als verschollen. Jetzt tauchen Hinweise auf, dass es in einem geheimen Kellerraum einer alten Wörtherseevilla liegt. Der Klagenfurter Detektiv Heinz Sablatnig, der diesen Raum vor fünfundzwanzig Jahren entdeckt hat, zeigt einer Handvoll Leuten den Zugang doch jeder, der den Raum betritt, wird danach ermordet.Sablatnig kann die Hintergründe der Morde nicht aufdecken, da jegliches Motiv zu fehlen scheint. Er ermittelt in der Vergangenheit des Kyot-Manuskripts, der Villa und ihrer Vorbesitzer. Doch der Mörder hat nicht vergessen, dass auch Sablatnig den geheimen Raum betreten hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
rolandzingerle.at
Für Elke
SEPTEMBER 1997
Kapitel 1
Dienstag, 8 Uhr
Das Maria Saaler G’läut hört man bis Sankt Veit ...
Heinz Sablatnig musste an dieses Kärntnerlied denken, als er von der Bushaltestelle zum Detektivbüro eilte. Was kein Wunder war, immerhin pulsierte die Luft in Maria Saal vom Glockenklang der Doppeltürme der Marienkirche. Nie hätte er gedacht, dass er einmal in Maria Saal arbeiten würde – und schon gar nicht als Detektiv. Sein Lebensplan hatte vorgesehen, nach der Matura Betriebswirtschaft zu studieren, doch das hatte sich als Fehler erwiesen.
Heinz erreichte den Wohnblock und eilte die Stiege hinauf.
Nach ein paar Semestern und dem katastrophalen Ende einer längeren Beziehung hatte er sich, um Abstand von allem zu bekommen, zu den UNO-Truppen gemeldet und war acht Monate lang Wachsoldat an der Grenze zwischen Israel und Syrien gewesen. Danach hatte er weiterstudieren wollen, doch das Studium hatte keinen Sinn mehr für ihn ergeben.
Er öffnete die Wohnungstür mit dem Schild Slama Investigations und ging schnellen Schrittes zum Büro von Pepo Slama, dem Inhaber der Agentur. „Guten Morgen Chef“, sagte er und sah, dass dieser gerade telefonierte.
Slama warf ihm einen stechenden Blick zu und deutete vorwurfsvoll auf die dicke, runde Uhr an seinem Handgelenk.
Heinz hob entschuldigend die Hand und flüsterte: „Der Bus hat sich verspätet. Ein Unfall in Rattendorf.“
Der Chef machte eine wegwerfende Geste und bedeutete Heinz mit derselben Bewegung, er solle das Büro verlassen.
Heinz ging, ließ die Bürotür aber offen, wie Slama es immer wollte.
Jetzt im Nachhinein konnte Heinz gar nicht mehr sagen, was den Ausschlag für seine Entscheidung gegeben hatte, es als Detektiv zu versuchen, doch es hatte sich von Anfang an richtig angefühlt. Auch wenn Pepo Slama ein schwieriger Mensch war, den die meisten wegen seiner ruppigen Art mieden, Heinz kam gut mit ihm zurecht.
Er ging in sein eigenes Büro, das im Bauplan sicherlich als „Abstellkammer“ ausgewiesen war, und zwängte sich hinter seinen Schreibtisch, der eher einem Beistelltisch ähnelte. Trotzdem, wenn er einmal saß, konnte Heinz gut hier arbeiten – zumindest, solange er nicht versuchte, die Beine auszustrecken, denn die Wand gegenüber schloss mit der Vorderkante des Tisches ab. Aber Heinz war ohnehin nicht hier, um die Beine auszustrecken. „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, sagte sein Vater immer, und spätestens nach seiner Zeit beim Militär war Heinz ohnehin anspruchslos, was Komfort anging.
Slama hatte ein großes, braunes Kuvert auf seinen Tisch gelegt, die Schnappschüsse der aktuellen Observierung, die Heinz auswerten musste. Er zog die Fotos heraus und sah sie durch.
Heinz war dreiundzwanzig Jahre alt und arbeitete seit einem knappen Jahr hier. Als er damals nach einer Detektei gesucht hatte, bei der er das Handwerk des Berufsdetektivs erlernen konnte, war Slama Investigations die einzige in Mittelkärnten gewesen, die einen Assistenten aufgenommen hatte. Eigentlich hatte Pepo Slama gar keinen Mitarbeiter gesucht, doch zu Heinz‘ Glück hatte er zu diesem Zeitpunkt so viel um die Ohren gehabt, dass ihm der Gedanke gefallen hatte, etwas Hilfe zu bekommen. Heinz war sich nach wie vor unsicher, ob sein Chef ihn auf Dauer behalten wollte, immerhin hatte dieser bis jetzt keine Notwendigkeit gesehen, den Firmensitz seiner Agentur aus dieser Sechzig-Quadratmeter-Wohnung weg und in echte Büroräume zu verlegen – mit einem echten Büro für Heinz. Vielleicht, doch das war nur eine Mutmaßung von Heinz, wartete Slama tatsächlich auf den Anruf aus den Vereinigten Staaten, der ihm einen Job in Chicago anbot. Der Chef sprach zwar immer davon, auch, dass er gute Kontakte dorthin habe, doch Heinz sah nichts in seiner alltäglichen Arbeit, das darauf hindeutete, dass Slama über besondere Fähigkeiten verfügte, die man in den USA dringend brauchte. Vermutlich war das einer dieser lebenslang gehegten Wunschträume, die man nicht aufgab, um nicht vor sich selbst zugeben zu müssen, dass man gescheitert war.
Die Fotos waren so nichtssagend, wie Heinz es erwartet hatte. Er und sein Chef arbeiteten an einer Observierung, die sich als kompliziert erwies. Die Ehefrau eines Holzindustriellen verdächtigte ihren Mann der ehelichen Untreue und hatte Slama Investigations beauftragt, Beweise dafür zu liefern, damit sie beim anstehenden Scheidungsverfahren besser ausstieg. Das war nicht so einfach, denn der Mann ging ungewöhnlich gerissen vor: Wann immer er die Privatwohnung einer Frau betrat – und derer gab es mehrere – hatte er auch einen geschäftlichen Grund dazu. Außerhalb von geschlossenen Räumen verhielt er sich gegenüber diesen Frauen nie so, wie es ein verheirateter Mann nicht sollte, und Beobachtungen durch die Fenster führten zu keinem Ergebnis.
Doch Slama hatte sich an dem Mann festgebissen wie eine Zecke. „Ich spüre es beim Brunzen (Pinkeln, Pissen), dass der Loter (kärntnerisch für „Typ, Kerl“) fremdgeht“, hatte er gesagt. Er meinte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der zu Überwachende sich die Blöße gab, die es brauchte, um ihn zu überführen.
Auf den Fotos, die Slama am Vortag geschossen hatte und die Heinz nun in Händen hielt, war jedoch nichts zu sehen außer Wohn- und Bürohäuser. Heinz nahm seine Lupe und suchte damit langsam die Fassaden ab. Auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich war, so bestand doch die Möglichkeit, dass der Industrielle in einem der Fenster zu sehen war, idealerweise in einer kompromittierenden Situation. Heinz schmunzelte regelmäßig bei dieser Tätigkeit, das Bild des Detektivs, der mit einem Vergrößerungsglas nach Spuren suchte, war schließlich längst nicht mehr zeitgemäß.
Als er das dritte Foto in Arbeit hatte, rief der Chef nach ihm. Heinz ging wieder in dessen Büro und setzte sich auf den knarrenden Holzstuhl vor dem Schreibtisch.
Pepo Slama war ein bulliger, kleiner Kerl mit Vollglatze und Stiernacken, ein Vollblut-Detektiv im schlimmsten Sinn des Wortes. Er war jähzornig und auf eine rücksichtslose Art unbesiegbar, denn auch wenn er einmal den Kürzeren zog, ließ er nicht locker, bis er aus seiner Niederlage zumindest einen kleinen Erfolg herausgekämpft hatte. Das machte Slama zu einem erfolgreichen und daher auch gefragten Detektiv, menschlich hingegen war der Mann eine Katastrophe. Heinz hatte nie herausgefunden, ob er tatsächlich so ein harter Einzelkämpfer war oder ob er diesen Eindruck nur vorschob, um seine große Einsamkeit zu verbergen. Denn was Frauen betraf, so hatte sich während der Zeit, in der Heinz für ihn arbeitete, eine gescheiterte Beziehung an die nächste gereiht, Slama schien da einen Dreimonatstakt zu haben. Und es waren durchwegs tolle Frauen, um die Heinz ihn beneidete.
Slama hatte das Telefonat beendet und lehnte nun entspannt in seinem wuchtigen Sessel, wobei er seine kleine Pfeife anzündete. Wenn er an dem geschwungenen Stiel sog, beugte sich die Flamme des Feuerzeugs in den Pfeifenkopf hinein, Heinz fand das jedes Mal wieder originell. Pepo Slama war kein Mensch, der besonderes Augenmerk auf Äußerlichkeiten legte, doch seinen Pfeifentabak ließ er sich etwas kosten, das roch man. Geld hatte er immerhin, die Detektei lief gut.
„Wir haben einen neuen Auftrag“, sagte Slama zwischen zwei Zügen, ohne von einem Bündel zusammengehefteter Papierblätter aufzusehen, das auf seinem Schoß lag. „Ein Ehepaar sucht nach einem geheimen Raum im Keller seines Hauses.“ Nun linste er doch kurz zu Heinz herüber. „Interessiert?“
Heinz kicherte. „Ein geheimer Raum im Keller des eigenen Hauses?“
Der Chef nickte.
„Was ist mit der Observierung?“
Jetzt schenkte er Heinz einen harten Blick unter seinen buschigen Augenbrauen hervor und sagte: „Erledige ich solo. Dem picke (kärntnerisch für „kleben“) ich so lange an den Fersen, bis ich ihn erwische!“
Heinz stutzte. „Du meinst ... der neue Fall gehört mir? Allein?“
Slama riss einen vollgekritzelten Zettel vom Notizblock neben dem Telefon und reichte ihn Heinz. „Du bist lange genug in der zweiten Reihe gestanden“, sagte er, „wird Zeit, dass du zeigst, was du bei mir gelernt hast.“
Heinz spürte, wie eine Gänsehaut seinen Körper überzog. „Danke, Chef“, wisperte er im Aufstehen, „ich werde dich nicht enttäuschen.“ Er nahm den Zettel und ging zurück in seine Abstellkammer.
„Das hoffe ich schwer“, rief Slama ihm hinterher.
Dienstag, 9 Uhr
Eine Dreiviertelstunde später lenkte Heinz den schwarzen Chevrolet Camaro seines Chefs durch den Ort und musste sich beherrschen, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Der Sportwagen war sicher schon zehn oder zwölf Jahre alt, doch er war cool. Außerdem war dieses Modell in Kärnten selten zu sehen, und es hatte mehr Pferdestärken unter der Haube als alle Autos, die Heinz jemals gefahren hatte. Für Slama war es kein Problem, Heinz den Wagen zu leihen. Für die Observierung war er zu auffällig, da griff Slama auf seinen Zweitwagen, einen VW Golf 2 zurück, und abgesehen davon war Slama recht locker, was diese Dinge anging.
Endlich kam die Ortstafel. Heinz schaltete einen Gang zurück und trat aufs Gaspedal. Der Motor röhrte auf, und die Beschleunigung presste ihn in den Fahrersitz, Heinz‘ Grinsen wurde breiter.
Maria Saal war nur wenige Kilometer von der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt entfernt, über die Schnellstraße brauchte Heinz keine fünf Minuten. Vor der Stadtgrenze führte die anderthalb Jahre zuvor eröffnete Nordumfahrung weg, die Heinz binnen weniger Minuten in den Westen der Stadt und damit nahe an sein Ziel gebracht hätte, doch er wählte die längere Route durch das Stadtgebiet. Nicht nur das, er fuhr sogar bis ins Zentrum und machte ein paar Umwege, um durch die am meisten frequentierten Straßen zu kommen. Der Himmel war zwar etwas bedeckt, doch es war hell genug, um die Verwendung einer Sonnenbrille zu rechtfertigen. Heinz setzte die Ray Ban General mit den goldenen Gläsern auf, die er bei seinem UNO-Auslandseinsatz für zweitausendsechshundert Schilling erstanden hatte. Und das war noch eine Okkasion gewesen, weil er sie steuer- und zollfrei bekommen hatte.
Heinz drehte die Musik lauter, die gerade im Radio gespielt wurde, und öffnete die Scheibe auf der Fahrerseite. So kutschierte er durch die Straßen, wobei er zwischendurch immer wieder einmal den Motor im Leerlauf aufbrüllen ließ. Mit geheucheltem Desinteresse an seiner Umwelt hielt er den Kopf etwas schräg an die Nackenstütze gelehnt, verrenkte sich aber hinter den verspiegelten Gläsern seiner Sonnenbrille fast die Augäpfel, um zu beobachten, wie die Leute auf ihn reagierten. Er genoss die neidischen Blicke der Männer, und noch mehr genoss er das angetörnte Staunen der jungen Frauen, auch wenn sie so taten, als fänden sie sein Verhalten peinlich und unreif.
Schließlich fuhr Heinz die Villacher Straße stadtauswärts und fühlte sich sauwohl. Er war ein waschechter Detektiv, der mit einer geilen Kutsche zur Arbeit fuhr – wie viele Menschen auf diesem Planeten konnten das von sich behaupten?
Nach der Bahnunterführung bog er rechts ab und überquerte die Steinerne Brücke, dann fuhr er geradeaus weiter bis zur Kreuzung mit der Sterneckstraße, in die er links einbog.
Vorhin im Büro hatte er noch mit seinem Auftraggeber telefoniert, ein Mann namens Adi Kröger, der eine seltsame Art zu sprechen hatte, welche Heinz nicht zuordnen konnte. Kröger hatte ihn zur Besprechung des Auftrags und zu einem Lokalaugenschein in sein Haus eingeladen, die Villa Elisabeth. Heinz hatte schon von dieser Villa gehört, wie er von vielen Villen am Wörthersee gehört hatte. Er war in Pörtschach aufgewachsen, wo er noch immer bei seinen Eltern wohnte, da kannte man sich am Wörthersee aus. Doch wie bei vielen anderen Villen hätte er weder sagen können, wo genau sie sich befand, noch wie sie aussah. Deshalb hatte er sich von Herrn Kröger eine Wegbeschreibung geben lassen, die er sich genau notiert hatte. Nach dem Telefonat hatte er den Stadtplan von Klagenfurt aus seinem Schreibtisch hervorgeholt.
Heinz hatte immer geglaubt, er kenne sich in der Kärntner Landeshauptstadt gut aus, immerhin war er schon als Kind mit seinen Eltern immer wieder hier gewesen, und seit seiner Jugend gehörte die Stadt zu dem Revier, das er mit seinen Kumpels an jedem Wochenende durchstreifte, um nach den feschesten Mädels Ausschau zu halten. Doch seit er für Slama Investigations arbeitete, hatte er den Unterschied zwischen Ich-weiß-wo-das-ist und Da-finde-ich-hin kennengelernt. Abgesehen davon gab es Straßen, von denen er nie zuvor gehört hatte. Mit dem Finger auf der Karte war er dem Straßenverlauf von Adi Krögers Beschreibung gefolgt und erstaunt gewesen, im Stadtteil Sankt Martin einen Weg zu entdecken, der in den Wald des Kreuzbergls hinauf und zur Villa Elisabeth führte.
Nun war er hier und fuhr zwischen dem Gasthof Müller und der Kirche Sankt Martin bergauf. An der Waldgrenze fand er tatsächlich eine schmale Straße, die zwischen den Bäumen verschwand. Heinz folgte ihr und holperte über ein paar Kilometer und Kurven bergauf, denn der Asphalt war bucklig und brüchig und immer wieder drang Gras aus seinen Rissen. Plötzlich, nach einer Biegung, stand die Villa Elisabeth direkt vor ihm. Der Weg endete bei dem vierstöckigen, schlossartigen Bau, der mit seinem großen, ummauerten Vorgarten raumgreifend mitten im Wald thronte. Wie für die Wörthersee-Architektur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert üblich, hatte die Villa einen offenen und lebensfrohen Charakter. Die sandfarbene Fassade war von zahlreichen Fenstern durchbrochen, die unterschiedlich breit, ein- oder mehrflügelig, eckig oder oben rund waren. Sie waren weiß gerahmt und ihre grünen Läden geöffnet. Auch das ziegelrote Giebeldach bildete keine durchgängige Fläche. Zum einen, weil es von Türmchen, Kaminen und Dachfenstern durchsetzt war, und zum anderen, weil es auf jedem der zweieinhalb Stockwerke, über die es verteilt war, unterschiedliche Neigungswinkel besaß. Die einzige ästhetische Ordnung, die der Architekt bei der Planung dieses bunten Durcheinanders von Bauelementen eingehalten zu haben schien, war die Symmetrie gewesen, doch die reichte aus, um dem Ganzen eine spielerische Harmonie zu geben.
Doch alle architektonische Schönheit und Leichtigkeit konnte nicht darüber hinwegtäuschen, wie sehr der Zahn der Zeit an dem Gebäude genagt hatte. Die Fassade hatte großflächige, dunkle Flecken, der Lack von Fensterrahmen und -läden war sichtlich abgeblättert, und auf dem Dach hatten sich Flechten angesiedelt. Als Heinz genauer hinsah, bemerkte er, dass auch ein paar Dachziegel fehlten, ebenso wie vereinzelte Brettchen in den Fensterläden.
Die beiden Flügel des riesigen, schmiedeeisernen Tores, das den einzigen Durchgang in der Gartenmauer bildete, standen offen und gaben den Blick auf ein großes Kiesbett frei, das die Auffahrt zur Villa bildete und in dem eine mächtige, hoffnungslos überwucherte Blumeninsel vor dem Eingang eine Art geräumigen Kreisverkehr schuf. Links an der Gartenmauer stand ein mächtiger Anbau, der ursprünglich ein Pferdestall oder eine Kutschenremise gewesen war, vermutlich beides. Heute diente er offenbar als Garage, zumindest der Teil, dessen Tore offenstanden, denn darin sah Heinz das Heck eines silbernen Mercedes‘ einer modernen Baureihe und, als ginge es darum, einen möglichst großen Kontrast herzustellen, das eines hellroten Fiat Cinquecentos.
Selbstbewusst parkte Heinz den Camaro direkt vor der Tür und stieg aus. Er hatte seine Schuhe gerade auf den mit Grünalgen beschlagenen Kies gesetzt, als mit einem krächzenden Quietschen die massive, hölzerne Eingangstür geöffnet wurde und ein Ehepaar mittleren Alters daraus hervorkam.
„Grüß Gott, Herr Sablatnig, schön dass Sie es so rasch einrichten konnten!“ Adi Kröger kam mit ausgebreiteten Armen auf Heinz zu, dabei schien es, als würden sich seine Beine nur durch die Gewichtsverlagerung seines runden Körpers abwechselnd nach vorne setzen. Mit seiner Größe von wenig mehr als einem Meter sechzig erinnerte er Heinz an den US-amerikanischen Schauspieler Danny DeVito, nur mit dem Unterschied, dass Krögers Rundlichkeit fest wirkte, als bestünde sie aus Muskelmasse. Den einzigen Kontrapunkt zu seinem drolligen Aussehen bildete ein Monokel, das in seinem rechten Auge klemmte und dessen Kette am Knopfloch im Revers des Sakkos seines sichtlich teuren Anzugs befestigt war. Er drückte Heinz die Hand, und dieser spürte die ungewöhnlich ausgeprägten Rundungen der Ballen, die so fest waren, wie Krögers Bauch aussah.
Ähnlich fühlte sich der Händedruck von Frau Kröger an. Sie schien überhaupt das weibliche Gegenstück ihres Mannes zu sein, denn sie hatte annähernd dieselbe Größe und dieselbe Kopf- und Körperrundlichkeit. Sogar ihr Lächeln glich seinem, es war, als stammten beide von einer anderen, gartenzwergartigen Menschen-Spezies ab. Der größte Unterschied zwischen ihnen war die Haartracht. Denn während er eine Glatze trug, hatte sie ihre schwarzen Haare zu einem Turm hochtoupiert, der Heinz an die charakteristische Frisur von Audrey Hepburn erinnerte. Das passte zwar nicht zu ihrem Typ, dafür aber zu ihrem schrulligen Äußeren.
„Willkommen auf Schloss Elisabeth“, sagte Frau Kröger getragen, machte eine ausladende Geste und lachte dann über sich selbst.
Heinz fand die beiden sympathisch. Wie um der Artikulation von Frau Kröger zu folgen, sah er zuerst zur Villa und dann in die entgegengesetzte Richtung – wo sein Blick überwältigt hängen blieb. Er war selbstverständlich davon ausgegangen, hier nur Wald vorzufinden, stattdessen tat sich ein unerwartetes Panorama auf. Am Horizont zerschnitt die gezackte Silhouette der Karawankengipfel den Himmel, darunter lag der bewaldete Sattnitz-Hügelzug. Rechts schob sich der Ostteil des türkisfarbenen Wörthersees in das Blickfeld, Heinz konnte bis Sekirn sehen.
„Die Bäume da vorne müssen wir noch stutzen“, meinte Frau Kröger, die Heinz‘ Reaktion richtig deutete, „dann sehen wir vielleicht die ganze Stadt.“
„Und wenn wir die paar Bäume da drüben abholzen, kriegen wir einen Blick bis nach Velden.“ Herr Kröger lachte über seine Übertreibung, und seine Frau stimmte mit ein.
Heinz sah die beiden schmunzelnd an. Sie waren einander sogar in ihrer eigenartigen Sprechweise ähnlich, die ihm schon am Telefon aufgefallen war. Sie redeten schriftdeutsch, mit dem Hauch eines norddeutschen Dialekts, doch es war, als begannen sie jedes Wort gehetzt und beendeten es langsam, außerdem nuschelten sie die S-Laute.
Frau Kröger – Heinz wusste von Slamas Aufzeichnungen, dass ihr Vorname Else lautete – bat ihn nach drinnen und ging voran.
Das Innere der Villa erwies sich als das krasse Gegenteil des Äußeren. Hier war alles blitzblank gereinigt und poliert, die Wände frisch verputzt, Heinz glaubte sogar, noch feuchte Wandfarbe zu riechen. Das Mobiliar in dem Vorzimmer, das gleichzeitig auch das Treppenhaus war, nahm sich hingegen etwas spärlich aus, in einem Eck sah Heinz halb ausgepackte Transportkartons stehen. „Sie sind gerade erst eingezogen?“, fragte er das Offensichtliche, um das Gespräch am Laufen zu halten.
„Vor zwei Wochen“, erwiderte Herr Kröger eifrig.
Seine Frau ergänzte: „Eigentlich wollten wir ja schon vor einem halben Jahr einziehen, aber wir wussten nicht, dass die Villa so renovierungsbedürftig war. Die Außenfassade – nun gut, das kann man machen, wenn man schon hier wohnt, aber innen! Das muss ordentlich sein, sonst fühle ich mich nicht wohl.“
Heinz schnitt offenbar ein verständnisloses Gesicht, denn Herr Kröger erklärte: „Sie müssen wissen, dass wir aus Argentinien eingewandert sind.“
Heinz zog die Augenbrauen hoch. „Aus Argentinien? Dafür sprechen Sie aber hervorragend deutsch.“
„Wir hatten eine starke deutsche Gemeinschaft dort“, erklärte Frau Kröger.
Und offenbar auch deutsche Vorfahren, dachte Heinz, Kröger war schließlich kaum ein lateinamerikanischer Name. Das erklärte die seltsame Sprechweise der beiden.
Die Krögers führten Heinz in den zweiten Stock, wo sie einen netten, kleinen Salon betraten, dessen breites Fenster einen noch schöneren Ausblick offenbarte als den vor der Tür. Heinz schätzte, dass die Villa Elisabeth etwa auf halber Höhe des Kreuzbergls lag. Frau Kröger bot ihm einen Platz an einem kleinen, runden, mit Spitzen gedeckten Biedermeiertischchen an. Der stilgleiche Sessel, auf den er sich setzen sollte, wirkte so filigran, dass Heinz befürchtete, er würde unter ihm zusammenbrechen – überraschenderweise knarrte er aber nicht einmal. Gleich darauf hörte er lauter werdendes Geklapper, und dann rumpelte ein uralter Servierwagen aus einem Nebenraum herein. Geschoben wurde er von einer jungen Frau, bei deren Anblick Heinz die Kinnlade nach unten sank. Sie war in seinem Alter, vielleicht etwas jünger, trug einen dunkelbraunen, etwas längeren Bob, und ihr entwaffnend hübsches Gesicht wurde von einem Lächeln verzaubert, als ihr Blick seinen traf. Ihr schlanker, soweit Heinz sehen konnte, perfekt proportionierter Körper steckte in einer schwarzen Zimmermädchen-Uniform mit weißer Schürze und kurzem Rock. Als Heinz ihren Beinen entlangblickte, die dunkle Strümpfe trugen, hatte er das Gefühl, irgendetwas in seinem Gehirn würde aushaken.
„Bekki, du Liebe, du hast ja schon alles vorbereitet“, flötete Frau Kröger, während sie sich links von Heinz niederließ. Ihr Mann setzte sich rechts von ihm.
„Grüß Gott“, sagte Bekki mit einer weichen Stimme und einem niedlichen Augenaufschlag.
„Kannst gerne Heinz zu mir sagen.“ Er schenkte ihr ein Lächeln, von dem er hoffte, dass es nicht zu dämlich ausfiel.
Bekki schlug die Augen nieder und leckte kurz über ihre Lippen, dabei schüttelte sie eigenwillig den Kopf. Dann fragte sie professionell: „Was darf‘s sein? Tee? Kaffee?“ Sie konnte offenbar nicht verhindern, dass ihre Stimme einen kecken Unterton bekam. „Zucker? Milch?“
Dich mit allem, hätte Heinz am liebsten erwidert, doch er nahm sich zusammen. Er war immerhin hier, um zu arbeiten, nicht um zu flirten. Leider. „Kaffee, bitte“, sagte er deshalb, konnte jedoch nicht anders, als hinzuzufügen: „schwarz wie meine Seele – und bitter wie mein Leben.“
„Oje, du Armer“, spöttelte Bekki.
Wie das Tischchen war auch der Servierwagen mit Spitzen gedeckt. Auf ihm standen schlanke, silberne Kannen und Tabletts mit einer Auswahl kleiner Brötchen und Kuchenstücke. Aus dem Fach darunter nahm die hübsche Serviererin nun eine Tasse und eine Untertasse aus feiner Keramik, das mit einem blauen Blumenmuster verziert war, sowie ein winziges, silbernes Löffelchen. Oben, auf einer dafür freigehaltenen Fläche, stellte sie die drei Gegenstände zu einer Einheit zusammen und goss Kaffee aus einer der Kannen in die Tasse.
„Darf es auch ein Brötchen sein“, fragte Frau Kröger indessen, „oder ein Stück Kuchen?“
Heinz ertappte sich, wie er darüber grübelte, welche Wahl Bekki am meisten imponieren würde, doch dann lehnte er dankend ab.
Bekki versorgte noch das Ehepaar Kröger mit Kaffee und Tee und verschwand wieder in den Nebenraum, aus dem sie gekommen war, den Servierwagen ließ sie stehen.
Heinz sah ihr hinterher und versuchte, sie per Gedankenübertragung dazu zu bringen, sich noch einmal zu ihm umzudrehen, doch sie widerstand seiner telepathischen Eingebung. Seufzend wandte er sich wieder dem Kaffeetisch zu und zuckte zusammen, als er Herrn Krögers Blick auf sich gerichtet sah.
„Sie sagen uns, wenn Sie bereit für uns sind?“ Er lächelte, doch Heinz verstand die Botschaft.
„Ja, selbstverständlich“, murmelte er, „bitte, jederzeit.“ Er spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg.
Else und Adi Kröger wechselten einen Blick, der alles verriet. Sie fragten sich, ob Heinz nicht zu jung, zu unreif sei, um ihr Problem zu lösen. Überhaupt wurde Heinz mit einem Mal bewusst, dass hinter dem skurrilen Äußeren der beiden eine ganze Menge stecken musste. Er brauchte nicht die Kombinationsgabe eines Detektivs, um zu wissen, dass diese argentinischen Einwanderer, die eine Villa am Wörthersee kaufen und renovieren und sich einen Mercedes und Personal leisten konnten, jede Menge Geld haben mussten. Und da Geld bekanntermaßen nicht auf Bäumen wuchs, verfügten sie über Fähigkeiten, die sehr gefragt waren. Freilich, das mochte interessant sein, ging ihn aber nichts an. Er war hier, um seinen ersten Auftrag alleine zu erledigen, und sich dabei nach Möglichkeit nicht zu blamieren. So, wie es im Moment aussah, war er jedoch auf dem besten Weg, genau das zu tun.
Heinz räusperte sich. „Beim Telefonat mit meinem Chef haben Sie von einem geheimen Raum im Keller Ihrer Villa gesprochen“, begann er, da hakte Adi Kröger auch schon ein:
„Ja, stimmt genau.“ Er nahm die alte Mappe, die am Tischchen bereitlag, und öffnete sie, indem er eine um einen Knopf gewickelte Schnur löste. „Wissen Sie, unsere Vorgänger in der Villa Elisabeth haben ihren gesamten Hausstand zurückgelassen. Der Großteil war natürlich zu entsorgen, aber die Dokumente, die wir gefunden haben, waren zum Teil sehr interessant. Zum einen, was die Familie angeht, vor allem aber, was die Geschichte des Hauses betrifft. Schauen Sie.“ Er hatte die Mappe geöffnet und kletzelte nun einen Packen kleinformatiger, teilweise vergilbter Schwarz-Weiß-Fotos mit breiten, weißen Rändern heraus, die er Heinz reichte.
Das erste Bild zeigte die Frontansicht der Villa, von der etwa ein Drittel auf der rechten Seite eingestürzt war. Auch die Gartenmauer war auf dieser Seite eingerissen, der Boden aufgewühlt. „Nanu, was ist denn da passiert“, fragte Heinz, „ein Erdbeben?“
„Nicht so wichtig“, Adi Kröger machte eine wegwerfende Handbewegung, „blättern Sie weiter.“
Auf den anderen Fotos waren mehrere Männer jungen und mittleren Alters in unterschiedlichen Gruppierungen zu sehen, die mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Sie trugen alle Seitenscheitel und weite, schlabbrige Hosen, einer hatte anstelle von Schuhen Stoffbandagen um die Füße gewickelt. Heinz schloss aus der Kleidung und der Haarmode, dass die Fotos aus den 1930er- bis 50er-Jahren stammten, Zweiter Weltkrieg oder kurz danach. Möglicherweise hatte eine Fliegerbombe die Villa getroffen? Die Arbeiten waren aus mehreren Winkeln aufgenommen worden, das Hauptmotiv war jedoch ein Loch im Boden. Heinz sah Herrn Kröger fragend an.
Dieser war jedoch auf die Fotos fixiert. Er schwitzte, und sein Monokel war angelaufen, das sichtbare Auge war plötzlich starr vor fanatischem Enthusiasmus. „Hier“, stammelte er, nahm Heinz die Bilder weg und blätterte vor ihm ein paar zurück. Als er die gesuchte Aufnahme fand, tippte er hektisch darauf.
Heinz sah sich das Foto nun genauer an: Ein Jugendlicher mit nacktem, verschwitztem Oberkörper stützte sich auf eine Schaufel und lachte offen in die Kamera. Vor ihm am Boden war dieses Loch zu sehen, hier recht groß, und als Heinz genauer hinschaute, stellte er fest, dass in dem Loch eine glatte Wand nach unten führte.
Adi Kröger gab ein keuchendes Lachen von sich und sah Heinz begeistert an, dann blätterte er zum nächsten Foto. Hier war das Loch noch größer abgebildet und aus einer anderen Perspektive, wodurch erkennbar war, dass es zu einem Kellerraum hinabführte. Ein Abschnitt eines gefüllten Bücherregals war dort zu sehen. Auch die nächsten Fotos zeigten den Zugang zu dem Raum sowie Männer, die dabeistanden, in die Kamera lachten oder mit dem Daumen nach oben zeigten, offensichtlich begeistert über ihren Fund.
„Der geheime Raum“, flüsterte Herr Kröger.
„Okay“, meinte Heinz langsam, „wenn ich das richtig verstehe, wurde während der Aufräumungsarbeiten ein Kellerraum entdeckt, von dem man nichts wusste.“
„Sehe ich auch so.“ Kröger nickte. „Und wie auf den Bildern zu sehen ist, war er nicht leer. Im Gegenteil, wenn Sie die Fotos mit einer Lupe ansehen, erkennen Sie, dass die Bücher uralte Folianten sind. Wissen Sie, was solche Bücher wert sein können? Und wer weiß, was sich noch alles in dem Raum befindet.“ Er lehnte sich zurück und grinste Heinz auffordernd an.
„Ich nehme an“, Heinz räusperte sich, „Sie und Ihre Frau haben bereits im Keller nach diesem Raum gesucht, ihn aber nicht gefunden?“
Herr Kröger nickte. „Deshalb brauchen wir die Hilfe eines Profis.“
„Was macht Sie so sicher“, begann Heinz, nachdem er kurz nachgedacht hatte, „dass dieser Raum nicht beim Wiederaufbau in den heute bestehenden Keller integriert worden ist?“
Herr Kröger rieb sein Monokel mit einem weichen Wischtuch ab und klemmte es wieder vor sein rechtes Auge. „Kommen Sie mit“, sagte er dann und stand auf, ohne auf Heinz‘ Reaktion zu warten. Er ging hastigen Schrittes voran zum zentral gelegenen Treppenhaus. Wie auch in den Stockwerken darunter war dies der Mittelpunkt eines Gangs, der durch die gesamte Breite der Villa verlief und an dem rechts und links Türen zu den Zimmern führten. Herr Kröger blieb stehen und wartete, bis Heinz und seine Frau nachgekommen waren. Er stellte sich so hin, dass sein Rücken in die Richtung zeigte, in der die Haustür lag, nach Süden, dann deutete er mit ausgestreckten Armen nach rechts und links in den Gang hinein. „Vergleichen Sie einmal die Architektur der beiden Haushälften“, forderte er Heinz auf.
Heinz tat, wie ihm geheißen, doch obwohl er wusste, worauf er zu achten hatte, fiel ihm kein Unterschied auf. Das hieß, ihm fiel schon auf, dass es irgendwie einen Unterschied gab, doch er konnte ihn nicht benennen.
Herr Kröger ließ ihm Zeit, während der er ihn forschend ansah.
„Ich ... ich komm nicht drauf“, musste Heinz schließlich passen.
„Sehen Sie sich den Plafond an.“
Jetzt erkannte es Heinz: Der Gang im linken Trakt hatte eine aufwendig und detailliert gestaltete Stuckdecke, wohingegen die Decke im rechten völlig ohne Zierrate war.
„Dieser Gebäudeteil“, Herr Kröger wies nach rechts, „war zusammengefallen und wurde neu aufgebaut. Offenbar hatte der damalige Besitzer nicht genug Geld für einen Künstler, der die originalen Zierelemente rekonstruiert hätte, oder er legte einfach keinen Wert darauf. Kommen Sie mit nach unten.“ Herr Kröger eilte wieder voraus, diesmal die Treppe hinunter, wobei er sowohl im ersten Stock als auch im Erdgeschoss stehen blieb und zeigte, dass auch hier im rechten Gebäudetrakt auf Zierrate verzichtet worden war. Anschließend öffnete er eine alte Holztür, die etwas unscheinbar neben dem Treppenaufgang lag, und ging gemeinsam mit seiner Frau voran die Kellerstiege hinunter.
Es war offensichtlich, dass auch der Keller noch auf seine Renovierung wartete. Das schummrige Licht verschmutzter Lampen verlor sich fast in der enormen Höhe der Räume. Von der Gewölbedecke hingen dicke, schwarze Spinnweben herab, und von den Wänden löste die Feuchtigkeit den groben, staubbehängten Putz in großen Blättern ab. Der Keller war in größere und kleinere Räume unterteilt, die meisten davon hatten einen Naturboden. Die Luft war kalt und feucht, es roch nach Moder und nasser Erde.
Die Krögers führten Heinz durch mehrere Räume, wobei sie zweimal die Richtung änderten, so dass Heinz schnell die Orientierung verlor. In einem großen Raum mit rechteckiger Grundfläche blieben sie stehen. Hier standen halbverrottete Holzregale an den Wänden, die offenbar vor sehr langer Zeit aus ungehobelten Brettern zusammengenagelt worden waren. Eines davon, es bedeckte die Schmalseite gegenüber dem Eingang, war mit großen Marmeladengläsern gefüllt, deren Deckel und Etiketten bis zur Unkenntlichkeit verschimmelt waren. Ein Regalbrett war durchgebrochen und von den darunter stehenden Gläsern aufgefangen worden, die Marmeladengläser, die das kaputte Brett getragen hatte, hatten sich im Herauspurzeln ineinander verkeilt, so dass nur wenige zu Boden gefallen und zerplatzt waren. Es sah aus, als wären Brett und Gläser einen Wimpernschlag nach dem Bruch eingefroren. Im Laufe der Jahre hatten viele Generationen von Spinnen das Stillleben als Jagdrevier genutzt.
An der Wand links davon waren, über ihre gesamte Länge hinweg, massive, senkrechtstehende Holzbohlen im Abstand von etwa einem Meter befestigt. Sie reichten vom Boden bis auf eine Höhe von rund zwei Metern. Den oberen Abschluss bildeten, ebenfalls über die gesamte Raumlänge hinweg, waagrecht an die Mauer genagelte oder geschraubte Bretter. An der Wand gegenüber fanden sich eine Tür zu einem weiteren Kellerraum sowie noch mehr vermoderte Regale, auf denen altes Gurtzeug, Leinensäcke, Holzkisten mit verrostetem Werkzeug und ähnliches Gerümpel gelagert waren.
„Hier muss noch aufgeräumt werden“, murmelte Frau Kröger entschuldigend, Heinz hörte an ihrer Stimme, dass ihr der Zustand des Kellers peinlich war.
Ihr Ehemann ignorierte das. Er streckte die Arme aus, drehte sich um seine Achse und sagte zu Heinz: „Sehen Sie sich um. Wir befinden uns unter dem neu errichteten Trakt. Was fällt Ihnen auf?“
Diesmal wusste Heinz, worauf Kröger anspielte: Auch wenn der Verputz von den Wänden bröselte, so war doch klar erkennbar, dass die Wände nicht glatt, sondern wellig waren. Das lag daran, dass sie nicht aus Ziegeln, sondern aus Natursteinen errichtet worden waren. Die Decke hatte ein Gewölbe, von dem in gleichmäßigen Abständen dicke Eisenringe an ebenso dicken Eisenstäben herabhingen, Stäbe und Ringe waren vollständig verrostet. Heinz kannte diese Kellerbauweise aus Häusern, die im 19. Jahrhundert errichtet worden waren. Wozu die herabhängenden Ringe gedient hatten, hatte ihm allerdings noch niemand erklären können. Er nickte. „Ich weiß, was Sie meinen: alte Bausubstanz.“
Herr Kröger starrte ihn an. „Alle Räume im Keller sind so wie dieser.“
„Sie meinen, der Keller ist nicht neu aufgebaut worden?“
„Anscheinend war er von dem Einsturz nicht in Mitleidenschaft gezogen worden“, erwiderte Kröger anstelle einer Antwort. „Und das bedeutet, der geheime Raum grenzt irgendwo außen an diese Wände an. Ihre Aufgabe ist es, die Tür zu finden, durch die wir ihn betreten können.“
„Aber was, wenn dieser geheime Raum damals leegeräumt und anschließend zugeschüttet worden ist?“, wand Heinz ein.
Herr Kröger machte ein missbilligendes Gesicht. „Ich gewinne den Eindruck, Sie wollen diesen Auftrag nicht.“
„Nein, nein“, wehrte Heinz hastig ab, „ich sage nur, was ich mir denke.“
„Herr Sablatnig, Sie dürfen mir glauben, dass meine Frau und ich all diese Gedanken auch schon diskutiert haben, plus solche, auf die Sie bis jetzt noch nicht gekommen sind. Denken Sie doch einmal nach: Was würde Sie dazu veranlassen, einen Raum zu errichten und zu verbergen?“
„Dass ich etwas verstecken möchte“, antwortete Heinz, ohne nachzudenken.
„Was würden Sie verstecken?“
„Etwas, von dem ich nicht will, dass es meine Mitmenschen sehen. Weil es mir peinlich ist oder verboten, oder ... weil ich nicht möchte, dass man es mir wegnimmt.“
„Einen Schatz, nicht wahr?“ Herrn Krögers linkes Auge hatte einen gierigen Blick, im Monokel vor dem rechten blitzte eine müde Reflexion des gelben Kellerlichts. „Schätze wurden doch schon immer vergraben. Warum sollte das in diesem Fall anders sein?“
„Meinetwegen“, lenkte Heinz ein, „aber der Schatz ist ja gefunden worden, vor zahlreichen Zeugen. Sie selbst haben gesagt, dass der zerstörte Teil der Villa möglicherweise deshalb ohne die alten Zierrate wiederaufgebaut worden ist, weil das Geld dafür gefehlt hat. Ist es da nicht logisch anzunehmen, dass der damalige Besitzer der Villa den ‚Schatz‘ zu Geld gemacht hat, um die Bauarbeiten zu bezahlen? Und hätte er nicht auch die Zierrate wiederherstellen lassen, wenn der Erlös dieses Schatzes dazu gereicht hätte?“
„Ich weiß nicht, was in diesem Fall logisch ist. Ich persönlich würde es nicht übers Herz bringen, einen Schatz, der aus jahrhundertealten Büchern und Ähnlichem besteht, wegzugeben, nur weil ich Geld brauche. Da würde ich lieber auf Zierrate verzichten.“
Heinz verkniff sich eine Erwiderung. Ohne das Ehepaar Kröger näher zu kennen, getraute er sich dennoch anzunehmen, dass die beiden nicht wirklich wussten, was es bedeutete, dringend Geld zu brauchen. Auf der anderen Seite gab er seinem Auftraggeber auch recht: Es war unmöglich, nur mit Hilfe der Logik herauszufinden, was der damalige Besitzer mit dem geheimen Raum angestellt hatte. Er mochte ihn geplündert und zugeschüttet haben, oder er hatte ihn renoviert und als eine Art geheime Schatzhöhle behalten. Für Heinz, als Detektiv, war ausschlaggebend, was sein Auftraggeber dachte. Und wenn Herr Kröger von dem Vorhandensein eines geheimen Raums überzeugt war, dann musste auch Heinz es sein, ansonsten brachte er nicht die Motivation auf, die nötig war, um den möglicherweise vorhandenen Zugang zu finden. „Gibt es noch andere Hinweise auf den Zugang zu dieser Schatzkammer?“, fragte er darum.
Herr Kröger schüttelte den Kopf. „Leider nein. Die Fotos sind der einzige Hinweis.“
„Können Sie mir die Fotos für eine genaue Auswertung mitgeben?“
„Ich gehe davon aus, dass ich sie unbeschädigt zurückerhalte?“ Kröger schenkte ihm einen kritischen Blick.
Heinz nickte. „Selbstverständlich.“
Kapitel 2
Als Heinz etwas später die Villa verließ, blieb er vor der Tür stehen, blickte zum See hinab und schnaufte tief durch. Alte Keller wirkten bedrückend auf ihn. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, ob das damit zusammenhing, dass er hier im Klagenfurter Becken aufgewachsen war, wo die Berge, die die Sicht begrenzten, in der Ferne lagen.
Er hörte Schritte im Kies, fuhr herum, und als er Bekki sah, die mit einem leeren Mülleimer in der Hand um die Ecke kam, schlug sein Herz höher.
Sie lächelte ihn an. „Na, Herr Detektiv, wie sieht’s aus? Fall gelöst?“
Heinz spürte, wie sich seine Mundwinkel nach oben krümmten. „Du traust mir ja eine Menge zu.“
„Sollte ich nicht?“ Sie war herangekommen und blieb vor ihm stehen.
Heinz versank im schelmischen Blick ihrer hellbraunen Augen. „Doch, durchaus“, antwortete er, „aber gut Ding braucht Weile.“
„Das heißt, ich muss dir bald wieder Kaffee servieren?“
Heinz schürzte die Lippen. „Kommt darauf an. Wir könnten uns auch heute Abend irgendwo treffen. Dann serviert ein anderer den Kaffee.“
Sie neigte den Kopf ein wenig zur Seite. „Am Abend trinke ich keinen Kaffee.“
„Ich kenne ein Lokal, da erfüllt man alle deine Wünsche.“
Nun senkte sie den Kopf und blickte ihn von unten her an. „Wirklich alle?“
Heinz spürte ein Kribbeln in seinem Bauch. „Welche hast du denn?“
Bekki zuckte mit den Achseln, schritt an ihm vorbei und sagte: „Du bist der Detektiv. Finde es heraus.“
Heinz drehte sich zu ihr um und sagte schnell: „19 Uhr, Moser Verdino?“ Er wollte mit etwas Elegantem punkten.
Sie hatte die Haustür aufgedrückt, hielt inne und sah ihn an. „Du meinst das Café für die alten Leute?“
„Für den Anfang?“
Bekki schmunzelte, betrat die Villa und meinte: „Wir werden sehen.“
Er rief ihr hastig nach: „Ja oder ja?“
Die Tür fiel ins Schloss, dann hörte Heinz ein gedämpftes: „Ja.“
Dienstag, 19.20 Uhr
Bekki sah hammermäßig aus! Die Haare hatte sie aufgeföhnt, die Augen mit schwarzem Lidschatten betont und die Lippen mit einem schimmernden, roten Gloss hervorgehoben. Ein rosafarbenes Seidentop akzentuierte ihre Brust und leicht glitzernde, weiße Strümpfe schmiegten sich an ihre durch Stiefeletten optisch verlängerten Beine.
Als Heinz sich erhob, um sie zu begrüßen, fragte er sich, ob er das aus Anstand tat, oder ob sein militärischer Drill dafür sorgte, dass er habachtstand, wenn ihm jemand begegnete, dem er Respekt zollte.
„Hi“, wisperte sie und hauchte Heinz einen Kuss auf die Wange.
Während der Wartezeit hatte er ein kleines Bier geordert und sich dann dazu gezwungen, es nicht zu schnell auszutrinken, sein erster Eindruck auf Bekki sollte nicht der falsche sein. Oder vielmehr der richtige, denn Heinz liebte Bier.
Egal, welche Erwartungen Heinz mitgebracht hatte, das Zusammensein mit Bekki übertraf sie. Die beiden verstanden sich prächtig, teilten denselben Humor und neckten sich permanent, wobei Bekki genauso wenig auf den Mund gefallen war wie er. Wie sich herausstellte, war sie zwanzig Jahre alt, ihr Einundzwanziger stand in wenigen Wochen bevor. Sie stammte aus Völkermarkt, wohnte aber in Klagenfurt, wo sie sich eine kleine Wohnung mit einer Studienkollegin teilte. Bekki studierte nämlich Germanistik und Romanistik im Lehramt, sie wollte Mittelschullehrerin für Deutsch, Italienisch und Französisch werden. Den Job bei den Krögers hatte sie erst in der vorherigen Woche bekommen, er passte zu ihrer bisherigen Ausbildung, denn sie hatte in der Tourismusschule in Villach maturiert. Der Betrieb an der Universität Klagenfurt bot ein gutes, gemeinsames Gesprächsthema, Heinz punktete aber vor allem mit seiner Arbeit als Detektiv und mit seinem Militärdienst im Nahen Osten. Er erzählte mit allen Ausschmückungen von seinen Erlebnissen in der Waffenstillstandszone, von Tausendfüßlern, die so groß waren wie junge Schlangen, und von mausgroßen Spinnen.
Bekki trank weiße Spritzer, Heinz Bier, und der leichte Alkohol intensivierte ihr Gespräch noch mehr. Als der Abend voranschritt, wechselten sie in eine Disco, wo sie tanzten, bis ihnen der Schweiß von der Stirn rann. Dann endlich wurde ein ruhigerer Song angestimmt, Something About the Way You Look Tonight von Elton John. Heinz zog Bekki zu sich und sie drehten sich langsam umeinander, Wange an Wange. Als er spürte, wie sie ihren Körper an seinen schmiegte, war das das Zeichen für ihn, die Initiative zu ergreifen. Mit einem tiefen Blick in ihre Augen holte er sich ihr unausgesprochenes Einverständnis ab und küsste sie. Auch als das Lied endete, blieben sie stehen, eng umschlungen mitten auf der Tanzfläche, und spürten dem Spiel ihrer Zungen nach. Nach Quit Playing Games With My Heart von den Backstreet Boys legte der DJ Blond von Rainhard Fendrich auf – und da war es an der Zeit, das Feld zu räumen.
„Ich möchte nach Hause“, raunte Bekki in Heinz‘ Ohr, fischte sich sein Ohrläppchen mit der Zunge und knabberte daran.
Heinz lief ein Schauer über den ganzen Körper, der nicht nur seine Haare aufstellte.
„Meine Studienkollegin ist heute Nacht nicht da“, fuhr sie fort, „dann ist es immer so einsam in der Wohnung.“
„Soll ich bei dir schlafen?“, raunte Heinz zurück.
Sie löste sich von ihm und sah ihm tief, tief in die Augen. „‚Bei‘ ist die falsche Präposition.“
Heinz suchte fieberhaft nach einer originellen Erwiderung, von wegen, dass sie gerne die ganze Nacht lang seine Grammatikkenntnisse aufbessern könne oder so, doch sein Unterbewusstsein war schneller: „Ich denke, wir beide werden die richtige Position finden.“
Mittwoch, 9 Uhr
Heinz saß an seinem Schreibtisch in der Abstellkammer und sah zum wer-weiß-wievielten Mal die verdammten Fotos von Kröger durch. Dass er keine neuen Erkenntnisse gewann, lag daran, dass er sich nicht konzentrieren konnte. Die vergangene Nacht war wundervoll gewesen, ach was, atemberaubend! Bekki und er waren in einer Harmonie ineinander verschmolzen, die Heinz so noch nicht erlebt hatte. Sie hatten sich Zeit gelassen, ihre Körper erforscht, waren weggedämmert, wieder aufgewacht und hatten weitergemacht. Die Nacht war eine nahtlose Fortsetzung des Abends davor gewesen, alles mit Bekki hatte sich so leicht und selbstverständlich angefühlt – und richtig.
Heinz stand auf und ging in die Küche, um sich noch eine Tasse Kaffee zu holen. Ja, er war unausgeschlafen, doch das störte nicht seine Arbeit. Was sie störte, war der Zustand, in dem er sich befand, dieses Gezwungensein, in der wirklichen Welt zu arbeiten, während seine Seele in einem glitzernden Wunderland schwebte, für das ihm nur das Wort „heilig“ einfiel. Es war das erste Mal gewesen, dass eine Frau ihn gefragt hatte, ob er mit ihr nach Hause käme, und das am ersten Abend. Bisher war das Mann-Frau-Spiel für Heinz ein anstrengendes Ritual gewesen, das viel zu selten zum Erfolg führte. Klar, um eine ernsthafte Beziehung aufzubauen, brauchte es Wochen des Einander-Kennenlernens, aber selbst im Erfolgsfall hatte sich die jeweilige Freundin noch einmal wochenlang geziert, bis sie bereit war, mit ihm zu schlafen. Wenn er es so bedachte, wirkte die Sache mit Bekki am Vorabend wie ein One-Night-Stand – obwohl sie gar nicht danach aussah: Er hatte bei ihr übernachtet, dann, kurz vor Sonnenaufgang, waren sie halb erwacht und hatten miteinander geschlafen. Dann hatte Heinz geduscht und gezwungenermaßen die Kleidung vom Vorabend für die Arbeit angezogen. Beim Frühstück hatten sie einander in die Augen gesehen wie zwei Menschen, die seit Jahren zusammenlebten. Es gab keine Reue in den Blicken, keine Peinlichkeit, nur reines Vertrauen.
Heinz seufzte und nahm einen Schluck Kaffee. Er fand, Bekki und er passten gut zueinander, soweit man das nach einem Tag und einer Nacht sagen konnte.
Zurück an seinem Schreibtisch schüttelte er den Kopf, verabreichte sich selbst zwei schallende Ohrfeigen und zwang sich zur Konzentration. Gestern Nachmittag hatte Slama ihm noch eine andere, schnell zu erledigende Aufgabe gegeben, deshalb widmete er sich erst jetzt den historischen Aufnahmen von der Villa Elisabeth. Sein Plan war, anhand der Fotos herauszufinden, nahe welcher der heutigen Außenmauern der Villa das Loch im Boden gelegen sein musste. Doch keines der Bilder gab Aufschluss darüber. Die Aufräumungsarbeiten waren am rechten Gebäudetrakt vorgenommen worden, was bedeutete, dass drei Mauern infrage kamen, doch die Fotos zeigten zu wenig von der näheren Umgebung, an der er sich orientieren hätte können. Auch die Rückseiten der alten Bilder waren nicht beschriftet, was aus seiner Erfahrung ungewöhnlich war.
Irgendwann kapitulierte Heinz und legte eine Pause ein. Er füllte seine Kaffeetasse ein weiteres Mal, und da er auch auf die Toilette musste, stellte er die Tasse im Vorbeigehen auf seinen Schreibtisch. Dabei streifte sein Blick das zuoberst liegende Foto, auf dem der Jugendliche mit dem verschwitzten Oberkörper zu sehen war. Das löste eine Gedankenkaskade in ihm aus. Als er an der Toilette stand und sich erleichterte, wurde ihm bewusst, was längst schon offensichtlich war: Die direkte Betrachtung der Fotos brachte ihn nicht weiter, er musste um die Ecke denken. Er musste Hinweise finden, die ihm zeigten, auf welcher Seite der Villa das Loch gelegen war, in welcher Himmelsrichtung ...
Noch nie in seinem Leben hatte Heinz ein Geschäft so schnell beendet wie dieses und sich noch nie so rasch die Hände gewaschen. Es ging um die Himmelsrichtung! Er zwängte sich hinter seinen Schreibtisch und nahm das oberste Foto. Der Schweiß auf dem Oberkörper des Jugendlichen glänzte in der Sonne, auf der linken Schulter mehr als auf der rechten. Die Sonne stand zum Zeitpunkt des Schnappschusses also links von dem jungen Mann, eher hinter als vor ihm, ansonsten hätte er die Augen zusammengekniffen. Diese waren aber – mit einem Ausdruck der Begeisterung – weit geöffnet. Wenn Heinz nun herausfand, um welche Uhrzeit das Bild gemacht worden war, konnte er anhand des Sonnenstandes die Himmelsrichtung feststellen.
Hastig blätterte er die Fotos durch. Jetzt, da er wusste, wonach er suchte, fielen ihm auch auf den anderen Fotos die Licht- und Schattenverhältnisse auf. Wenn er diese mit dem ersten Foto verglich und die Richtung mit einbezog, aus der das Loch jeweils fotografiert worden war, zeigte sich eine lückenlose Übereinstimmung. Das klärte zwar noch nicht die Himmelsrichtung, zeigte aber, dass alle Fotos um dieselbe Uhrzeit herum geschossen worden waren. Und das war gut, denn so konnte er die Erkenntnisse, die er von einem Foto gewann, auf alle umlegen.
Als Heinz die Totalaufnahme der Villa sah, stockte er – das war es! Die Villa stand da, so wie er sie bei der Hinfahrt zum ersten Mal gesehen hatte, nur dass eben der rechte Gebäudeteil eingestürzt war. Die baulichen Elemente, die aus der verbliebenen Fassade hervorragten, die Türmchen und Kamine, warfen klar erkennbare Schatten, und zwar nach rechts. Da die Fassade ziemlich genau nach Süden ausgerichtet war, musste die Sonne im Westen gestanden sein, es war offensichtlich Nachmittag gewesen.
Mit einem kleinen Jubelschrei sprang er auf, doch sein Sessel stand hinten an der Wand an, so dass Heinz sich die Oberschenkel an der Tischkante anschlug und wieder auf die Sitzfläche zurückfiel. Fröhlich pfeifend blätterte er dann die Fotos mit dem Loch durch und drehte die darauf abgebildeten Szenen in Gedanken so, dass sie zum ermittelten Sonnenstand passten. So erkannte er schließlich, wo der geheime Raum zu finden war: an der rechten Seite der Villa, nahe der Kante zur Front.
Mittwoch, 11 Uhr
Heinz hatte Adi Kröger angerufen und ihn über seine Erkenntnisse informiert. Dieser war außer Rand und Band gewesen und hatte ihn gebeten, möglichst rasch zu kommen, so dass sie gemeinsam den Zugang suchen konnten. Heinz hatte aber noch einen Abstecher bei sich zu Hause eingelegt, um einen Kompass zu holen. Herr Kröger konnte ihm zeigen, welcher Kellerraum unter der rechten vorderen Gebäudekante der Villa lag, doch Heinz wollte sich da unten orientieren können. Außerdem nahm er auch eine starke Taschenlampe mit, die Lichtverhältnisse in dem Keller waren schließlich nicht die besten. Und weil er schon zu Hause war, wechselte er auch gleich die Kleidung, damit er nicht nach kaltem Schweiß und Rauch stank, wenn er seine Auftraggeber traf.
Während all der Zeit konnte Heinz nur eines denken: Ich werde Bekki wiedersehen, ich werde Bekki wiedersehen! Am Vorabend hatte er sich für die Fahrt nach Klagenfurt den alten, roten Opel Astra seiner Schwester Sabine ausgeliehen, heute war er von Bekki direkt zur Arbeit gefahren. Somit hatte er ein Auto zur Verfügung und war flexibel. Was sich gut traf, da Pepo Slama irgendwo auswärts zu tun hatte und Heinz sich deshalb nicht den Chevrolet von ihm leihen konnte. Sabine war ziemlich sauer gewesen, als Heinz sie am Morgen angerufen und ihr erklärt hatte, er werde ihr den Wagen erst am Abend zurückbringen, doch es war kein echtes Problem für sie. Sabine lebte mit ihrem Ehemann ebenfalls in Pörtschach und arbeitete als Exekutivbeamtin im Landesgendarmeriekommando Krumpendorf, da konnte sie auch mit dem Bus zur Arbeit und zurück fahren. Sauer war sie gewesen, weil sie sich nach Heinz‘ Anruf hatte beeilen müssen, um den Bus noch zu erwischen. Doch Heinz und Sabine hatten ein gutes Verhältnis zueinander, immer schon gehabt. Sie war drei Jahre älter und hatte nie aufgehört, ihren kleinen Bruder mit besonderer Fürsorge zu behandeln.
Obwohl Heinz diesmal nur mit einem Opel vorfuhr, stellte er sich dennoch direkt vor die Tür der Villa Elisabeth. Bevor er diese betrat, wollte er sich den Flecken am Boden ansehen, unter dem sich der geheime Raum befinden musste, um ein Gefühl für dessen Lage zu bekommen. Er ging um die rechte Hauskante und betrat die ungepflegte Wiese einer nicht minder ungepflegten Parkanlage. Im Geist hörte er Else Kröger sagen, das müsse alles noch gemacht werden, und schmunzelte. Sein Schmunzeln verbreiterte sich, als er etwas weiter hinten den Verschlag einer Müllinsel sah. Bekki hatte ihm gestanden, dass sie am vergangenen Vormittag darauf gewartet habe, dass er sich anschickte, die Villa zu verlassen, und erst dann mit dem Müll hinausgegangen sei. So hatte sie sichergestellt, dass sie ihm noch einmal begegnete, bevor er fuhr. Heinz zog den Kompass und orientierte sich. Wie er schon angenommen hatte, war die Front der Villa fast genau nach Süden hin ausgerichtet. Der Eingang zum geheimen Raum musste demnach an einer Ostmauer des Kellers liegen.
Als Heinz zurückging und wieder das Kiesbett der Auffahrt betrat, sah er das Ehepaar Kröger vor der Eingangstür stehen und sich ratlos umsehen. Heinz machte auf sich aufmerksam und erklärte, warum er ums Haus verschwunden sei. Die beiden machten heute einen anderen Eindruck auf ihn als am Vortag. Zwar waren sie ähnlich gekleidet – er in einen piekfeinen Anzug mit Monokel, sie in ein elegantes Kostüm und mit ihrer hochtoupierten Audrey-Hepburn-Frisur –, doch wirkten sie nicht mehr drollig, sondern eher wie Geschäftsleute.
Da alle sehr aufgeregt und ungeduldig waren, gingen sie gleich in die Villa. Im Vorhaus trafen sie auf einen jungen Mann, den Herr Kröger als ihren Sohn Jochen vorstellte, ihr einziges Kind. Jochen war etwa in Heinz‘ Alter und hatte äußerlich wenig Ähnlichkeit mit seinen Eltern. Er war schlank und etwa zehn Zentimeter größer als diese, seine Gesichtszüge ähnelten, wenn überhaupt, eher der Mutter. Seine Art war jedoch dieselbe, denn ebenso wie die Alten war auch der Junge freundlich und wirkte aufgeschlossen.
Gemeinsam gingen die vier in den Keller, wanderten von einem Durchgang zum nächsten und gelangten schließlich in den großen Raum, in dem sie am Vortag schon Halt gemacht hatten. Herr Kröger erklärte, sie befänden sich hier unter der vorderen, von außen gesehen rechten Gebäudekante, wobei die Schmalseite des Kellerraums, an der das beschädigte Marmeladengläser-Regal stand, zur Front zeige.
Heinz wandte sich zu der Längsseite des Raums, an der die Holzbohlen angebracht waren, und erklärte: „Der geheime Raum liegt hinter dieser Mauer.“ Er ging näher an den Winkel des Raumes heran. „Hier irgendwo muss eine Tür versteckt sein.“ Heinz besah sich die Wand, fand jedoch keinen Hinweis. Er trat einen Schritt zurück und fragte sich, welchem Zweck wohl diese Bohlen gedient hatten. Sein erster Gedanke war, dass früher einmal Regalbretter daran angebracht gewesen waren, doch auf den zweiten Blick erschien das unlogisch. Zum einen waren die Bohlen zu nahe beieinander, zum anderen ragten dazwischen auf Hüfthöhe immer wieder Eisenstäbe mit Ringen aus der Wand, wie jene, die von der Decke hingen. Hätte man hier etwas gelagert, wären die Ringe im Weg gewesen.
Heinz zog seinen Kompass hervor, um die Himmelsrichtung zu überprüfen. Die Nadel zeigte zu der Tür, durch die sie gekommen waren, die Ausrichtung des Raums, die Herr Kröger angegeben hatte, stimmte also. In Gedanken drehte Heinz sich etwas zu der Wand und plötzlich begann die Kompassnadel zu zittern – und zeigte zur Wand. Heinz blickte auf und sah, dass er nahe an dem ganz rechts angebrachten Eisenring stand, vermutlich lenkte dieser den Kompass ab. Die Ringe hatten dieselben Abstände zueinander wie jene an der Decke, etwa drei Meter. Heinz schritt langsam zum nächsten, um zu bestätigen, dass es das Metall der Ringe war, das die Kompassnadel ablenkte. Doch diese verharrte zuerst in der Richtung des ersten Rings, und als Heinz beim zweiten war, schwenkte sie wieder zur Tür hin. Verwirrt hielt er inne. Er hielt den Kompass zum nächstgelegenen Ring, doch die Nadel reagierte nicht auf ihn. Er schüttelte das Gerät, doch das Ergebnis änderte sich nicht. Also ging er zurück zu dem Ring ganz rechts und wieder schwang die Kompassnadel zu diesem hin.
„Was ist los?“, fragte Herr Kröger.
„Ich weiß noch nicht“, murmelte Heinz. Er schwenkte den Kompass nun langsam nach rechts und nach links vom Ring weg und erkannte, dass die Nadel gar nicht auf diesen reagierte, sondern auf den gesamten Bereich zwischen den hier angebrachten Holzbohlen. Er spürte, wie sich die Haare auf seiner Haut sträubten und sich seine Mundwinkel hoben. Irgendetwas war in der Wand zwischen den beiden Bohlen, das die Kompassnadel anzog. „Ich habe den Eingang gefunden“, flüsterte er.
Die drei Krögers eilten zu ihm und starrten über seine Schulter. Heinz zeigte ihnen, was er meinte, woraufhin alle vier damit begannen, die Wand abzusuchen. Doch von einem Spalt, der auf eine Tür hingedeutet hätte, war nichts zu sehen.