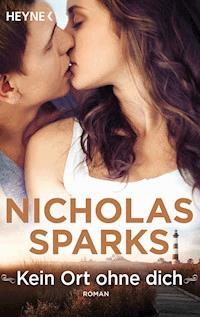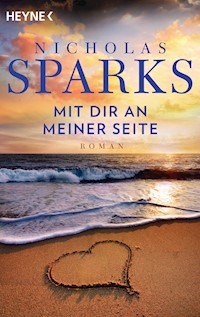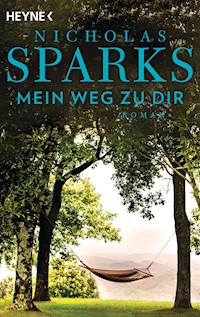9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adrienne Willis ist 45, als ihr Mann sie wegen einer jüngeren Geliebten verlässt. Adriennes Herz ist gebrochen, sie weiß nicht, wie die Zukunft für sie und ihre Kinder aussehen soll. Da bittet eine Freundin sie, ein paar Tage ihre abgelegene kleine Pension am Meer zu hüten. Adrienne sagt freudig zu, um Abstand zu gewinnen. Es hat sich auch nur ein einziger Gast fürs Wochenende angekündigt, Paul Flanner. Kurz nach seiner Ankunft zieht ein gewaltiges Unwetter auf. Mehrere Tage lang wird der Sturm Paul und Adrienne in der Pension einsperren, und diese Tage werden beider Leben von Grund auf verändern…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Adrienne ist 42, als ihre Welt zusammenstürzt: Ihr Mann verlässt sie wegen einer jüngeren Geliebten. Ihr Herz ist gebrochen, und sie kann sich nicht vorstellen, wie die Zukunft für sie und ihre Kinder aussehen soll. Als eine Freundin sie bittet, für ein paar Tage ihre kleine Pension in dem romantisch gelegenen Küstendorf Rodanthe zu hüten, sieht Adrienne eine Chance, ihre Gedanken neu zu ordnen und etwas Abstand von allem zu gewinnen. Nur ein einziger Gast, Paul Flanner, hat sich für das Wochenende angemeldet.
Als Jahre später der Mann von Adriennes Tochter stirbt und Amanda in tiefer Trauer versinkt, entschließt sich Adrienne, von ihrer damaligen schicksalhaften Begegnung zu erzählen. Und plötzlich sieht Amanda vieles – ihre Mutter, aber auch ihr eigenes Leben – in einem anderen Licht. »Sparks zeigt erneut seine Sensibilität für schwierige Menschen und sein Talent, schreibend Gefühle zu wecken.« Stern
Der Autor
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt mit seiner Frau und den fünf Kindern in North Carolina. Mit seinen gefühlvollen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in 46 Ländern erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt, im Jahr 2004 Wie ein einziger Tag.
Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen: Das Schweigen des Glücks – Weg der Träume – Nah und fern – Weit wie das Meer – Du bist nie allein – Ein Tag wie ein Leben – Zeit im Wind – Das Lächeln der Sterne – Die Nähe des Himmels – Die Suche nach dem verborgenen Glück.
Inhaltsverzeichnis
Die Originalausgabe NIGHTS IN RODANTHE erschien 2002 bei Warner Books, Inc., New York
Für Landon, Lexie und Savannah
EINS
An einem milden Novembermorgen im Jahr 1999 war Adrienne Willis zu der kleinen Familienpension zurückgekehrt. Auf den ersten Blick schien es ihr, als ob sich nichts verändert hatte, ganz so, als wäre das kleine Haus gegen Sonne und Sand und salzhaltigen Nebel unempfindlich. Die Veranda war frisch gestrichen, und in beiden Etagen wurden die Fenster mit den weißen Vorhängen von glänzend schwarzen Fensterläden eingerahmt, sodass es wie zwei Reihen von Klaviertasten aussah. Die Wände aus Zedernholz hatten die Farbe von schmutzigem Schnee. Auf beiden Seiten des Hauses nickte Strandhafer zur Begrüßung, und der Sand bildete eine geschwungene Düne, die mit jedem Tag unmerklich ihre Form veränderte, weil die einzelnen Sandkörner unablässig in Bewegung waren.
Die Sonne schien zwischen den Wolken zu schweben, und es sah so aus, als schwirrten kleine Lichtpartikel im Dunst. Das Ganze vermittelte Adrienne einen Augenblick lang das Gefühl, eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit gemacht zu haben. Doch als sie genauer hinsah, entdeckte sie Veränderungen, die auch kleine Schönheitsreparaturen nicht zu verbergen vermochten: der Ansatz von Schimmel an den Fensterrahmen, Rostspuren am Dach, Wasserflecken unter den Regenrinnen. Die Pension war vom Alter gezeichnet, und es stand nicht in Adriennes Macht, daran etwas zu ändern. Doch heute, drei Jahre später, wusste sie noch, dass sie die Augen geschlossen hatte, als könne sie mit einem Blinzeln das Haus wieder so erstehen lassen, wie es einst gewesen war.
Adrienne hatte vor wenigen Monaten ihren sechzigsten Geburtstag gefeiert. Jetzt stand sie in der Küche ihres eigenen Hauses und legte den Hörer auf.
Sie hatte gerade mit ihrer Tochter telefoniert. Sie setzte sich an den Tisch, sann über ihren letzten Besuch in der Pension nach und ließ noch einmal die Bilder von dem langen Wochenende, das sie vor vielen Jahren dort verbracht hatte, vorüberziehen. Trotz allem, was sich seitdem ereignet hatte, hielt Adrienne an ihrer Überzeugung fest, dass es allein die Liebe war, die das Leben so wunderbar machte.
Draußen fiel Regen. Adrienne lauschte dem gleichmäßigen Geräusch und war dankbar für das Gefühl von Beständigkeit und Vertrautheit, das es ihr gab. Die Erinnerung an jene Tage weckte jedes Mal die unterschiedlichsten Empfindungen in ihr – so etwas Ähnliches wie Wehmut oder Nostalgie, aber das war es nicht allein. Wehmütige Gefühle stellten häufig die Vergangenheit in einem verklärten Licht dar, doch es gab keinen Grund, die Erinnerungen zu verklären. Adrienne teilte sie mit niemandem. Die Erinnerungen gehörten ihr, und im Laufe der Jahre waren sie ihr zu einer Art Museum geworden, in dem sie sowohl die Kuratorin als auch die einzige Besucherin war. Und in gewisser Hinsicht war Adrienne zu der Überzeugung gelangt, dass sie in den fünf Tagen damals mehr gelernt hatte als in all den Jahren davor oder danach.
Sie lebte allein. Ihre Kinder waren erwachsen, ihr Vater war 1996 gestorben, und Jack und sie waren seit siebzehn Jahren geschieden. Ihre Söhne bedrängten sie manchmal, sich einen neuen Partner zu suchen, aber Adrienne verspürte kein Verlangen danach. Nicht, dass sie mit Männern nichts mehr zu tun haben wollte – ganz im Gegenteil, gelegentlich merkte sie, dass sie sich von jüngeren Männern angezogen fühlte, zum Beispiel, wenn ihr im Supermarkt jemand über den Weg lief. Da manche dieser Männer nur wenige Jahre älter waren als ihre eigenen Kinder, fragte sie sich, was sie wohl denken würden, wenn sie ihre Blicke bemerkten. Würden sie sich sofort abwenden? Oder würden sie ihr Lächeln erwidern und ihre interessierten Blicke reizvoll finden? Sie war sich nicht sicher. Sie wusste natürlich auch nicht, ob diese Männer trotz der ergrauenden Haare und der Falten erkennen konnten, wie sie früher einmal ausgesehen hatte.
Doch Adrienne bedauerte es keineswegs, dass sie älter wurde. Die Menschen sprachen fortwährend von dem Reiz der Jugend, aber sie sehnte sich nicht danach, wieder jung zu sein. Mittleren Alters vielleicht, aber nicht jung. Sicher, manches vermisste sie: Sie würde gern immer noch die Treppe zwei Stufen auf einmal nehmend hinaufrennen oder mehrere Einkaufstaschen gleichzeitig tragen können, und sie hätte gern noch ausreichend Energie gehabt, um mit ihren Enkeln Schritt halten zu können. Doch letzten Endes waren die Erfahrungen, die sie gemacht hatte, wertvoller, und die kamen nur mit dem Alter. Wenn sie auf ihr Leben zurückblickte, erkannte sie, dass sie kaum etwas anders machen würde, wenn sie noch einmal die Gelegenheit dazu hätte, und das war der Grund, warum sie nachts ruhig schlief.
Außerdem brachte das Jungsein viele Probleme mit sich. Adrienne erinnerte sich nicht nur an ihre eigene Jugend, sie hatte auch ihre Kinder begleitet, als diese mit den Ängsten der Pubertät und den Unsicherheiten und dem Chaos des frühen Erwachsenenlebens zu kämpfen hatten. Obwohl zwei von ihnen jetzt schon über dreißig waren und der Dritte fast dreißig, fragte sie sich manchmal, ob es wohl je eine Zeit geben würde, die nicht mehr von ihrer Rolle als Mutter bestimmt war.
Matt war zweiunddreißig, Amanda einunddreißig, und Dan war gerade neunundzwanzig geworden. Alle drei waren zum College gegangen, und darauf war Adrienne stolz, denn es hatte eine Zeit gegeben, als sie daran zweifelte, ob auch nur eines ihrer Kinder es schaffen würde. Sie waren ehrlich, freundlich und genügsam, und im Grunde genommen waren sie so geraten, wie sie es sich gewünscht hatte. Matt war Steuerberater, Dan Sportberichterstatter bei den Abendnachrichten, die aus Greenville gesendet wurden, und beide waren verheiratet und hatten schon eigene Kinder. Als ihre Söhne zu Thanksgiving bei ihr gewesen waren, hatte sie, so erinnerte sie sich, ein wenig abseits gesessen und zugesehen, wie die beiden von ihren Kindern auf Trab gehalten wurden. Adrienne hatte eine große Befriedigung verspürt bei dem Gedanken, wie gut sich das Leben ihrer Söhne entwickelt hatte.
Für ihre Tochter war alles – wie immer schon – ein wenig komplizierter.
Als Jack auszog, standen die Kinder am Anfang der Pubertät, und jedes hatte die Scheidung auf seine eigene Art verarbeitet. Matt und Dan hatten ihre Aggressionen auf dem Sportplatz rausgelassen und waren hin und wieder in der Schule aus der Rolle gefallen. Doch Amanda hatte es schwerer. Als das mittlere Kind zwischen zwei Brüdern war sie schon immer besonders empfindlich, und als Teenager hätte sie den Vater gebraucht, und sei es nur als Gegengewicht zu den besorgten Blicken der Mutter. Sie begann, sich in Lumpen zu kleiden – so empfand Adrienne es zumindest –, und schloss sich einer Gruppe von jungen Leuten an, die abends nur in der Gegend herumlungerten. Im Laufe der nächsten zwei Jahre behauptete Amanda mindestens ein Dutzend Mal, über die Maßen in irgendeinen Jungen verliebt zu sein. Wenn sie von der Schule nach Hause kam, hörte sie in ihrem Zimmer so laut Musik, dass die Wände wackelten, und ignorierte es, wenn ihre Mutter zum Essen rief. Es gab Phasen, da sprach Amanda tagelang kaum ein Wort, weder mit ihrer Mutter noch mit ihren Brüdern.
So ging das ein paar Jahre, aber schließlich fand auch Amanda ihren Weg und gestaltete sich ein Leben, das Adrienne merkwürdig an ihr eigenes früheres Leben erinnerte. Im College lernte Amanda Brent kennen. Die beiden heirateten nach dem Abschluss und bekamen in den ersten Ehejahren zwei Kinder. Wie bei vielen anderen Paaren auch war ihre finanzielle Lage angespannt, aber Brent plante alles mit Bedacht, was Jack nie getan hatte. Als das erste Kind zur Welt kam, schloss Brent vorsorglich sofort eine Lebensversicherung ab, obwohl keiner von beiden damit rechnete, sie in nächster Zeit in Anspruch nehmen zu müssen.
Sie hatten sich geirrt.
Brent war seit acht Monaten tot. Er war einer besonders bösartigen Form von Hodenkrebs zum Opfer gefallen. Adrienne hatte mit ansehen müssen, wie Amanda in eine tiefe Depression versank, aus der sie sich bisher nicht befreit hatte. Als sie am Tag zuvor ihre Enkelkinder, die ein paar Tage bei ihr gewesen waren, zu Amanda zurückbrachte, waren die Vorhänge im Haus ihrer Tochter zugezogen gewesen. Das Licht auf der Veranda brannte, und Amanda saß im Bademantel im Wohnzimmer und hatte den gleichen leeren Blick wie am Tag der Beerdigung.
In dem Moment wusste Adrienne, dass es an der Zeit war, ihrer Tochter von ihrer Vergangenheit zu erzählen.
Vierzehn Jahre. So lange war es inzwischen her.
In all den Jahren hatte Adrienne nur einem einzigen Menschen davon erzählt, aber ihr Vater hatte das Geheimnis mit ins Grab genommen.
Als Adrienne fünfunddreißig war, starb ihre Mutter. Zwar hatte sie eine gute Beziehung zu ihr gehabt, aber ihrem Vater hatte sie sich immer besonders nahe gefühlt. Er war einer von den beiden Männern, so dachte sie noch immer, die sie je richtig verstanden hatten, und sie vermisste ihn schmerzlich. Sein Leben war typisch für das Leben vieler Männer seiner Generation verlaufen. Er war nicht zum College gegangen, sondern hatte ein Handwerk gelernt und dann fünfzig Jahre in einer Möbelfabrik gearbeitet. Dort bekam er einen Stundenlohn, der sich jedes Jahr im Januar um wenige Pennys erhöhte. Er trug stets einen Filzhut, auch in den warmen Sommermonaten, und er hatte immer seine Brotdose mit den quietschenden Scharnieren dabei. Jeden Morgen verließ er pünktlich um Viertel vor sieben das Haus, um die anderthalb Meilen zur Arbeit zu gehen.
Abends nach dem Essen zog er sich eine Wolljacke über sein langärmeliges Hemd. Wegen der zerknitterten Hosen sah er immer etwas unordentlich aus, was sich mit den Jahren noch verstärkte, besonders nach dem Tod seiner Frau. Er saß gern in seinem Lehnstuhl, im gelben Lichtkegel der Lampe, und las Wildwestromane oder Bücher über den Zweiten Weltkrieg. In den letzten Jahren, bevor er mehrere Schlaganfälle erlitt, sah er wegen seiner altmodischen Brille, der buschigen Augenbrauen und der tiefen Falten im Gesicht eher wie ein pensionierter College-Professor aus und weniger wie der Fabrikarbeiter, der er gewesen war.
Am beeindruckendsten war die große innere Ruhe, die er besaß, und Adrienne hatte sich oft gewünscht, ihm in diesem Punkt ähnlicher zu sein. Er wäre ihrer Meinung nach ein guter Priester oder Geistlicher geworden. Den Menschen, die mit ihm zu tun hatten, vermittelte er den Eindruck, dass er mit sich und der Welt im Reinen war. Er war ein guter Zuhörer – er stützte das Kinn in die Hand und ließ den Blick nie von dem Menschen weichen, der sich ihm anvertraute. In seiner Miene spiegelten sich Mitgefühl und Geduld, Freude und Traurigkeit. Adrienne wünschte sich, dass er in dieser Zeit für Amanda da sein könnte. Auch er hatte den Ehepartner verloren, und Adrienne glaubte, Amanda würde ihn an sich heranlassen, ihm zuhören, und sei es nur, weil er wusste, wie hart ein solches Schicksal war.
Adrienne hatte sanft versucht, mit Amanda über die schwierige Zeit zu sprechen, die sie durchmachte, doch ihre Tochter war vom Tisch aufgestanden und hatte verärgert den Kopf geschüttelt.
»Es ist nicht wie bei dir und Dad«, hatte sie gesagt. »Ihr konntet keine Lösung für eure Probleme finden, deswegen habt ihr euch scheiden lassen. Aber ich habe Brent geliebt! Ich werde ihn immer lieben, und er ist mir genommen worden. Du weißt gar nicht, wie es ist, wenn einem so etwas passiert.«
Adrienne hatte nichts darauf erwidert, doch als Amanda aus dem Zimmer gegangen war, hatte Adrienne den Kopf gesenkt und ein einziges Wort geflüstert.
Rodanthe.
Adrienne empfand Mitleid mit ihrer Tochter, und gleichzeitig war sie besorgt um deren Kinder. Max war sieben und Greg vier, und in den vergangenen acht Monaten hatte Adrienne deutliche Veränderungen im Verhalten der Kinder beobachtet. Beide waren ungewöhnlich verschlossen und still. Im Herbst hatten sie nicht am Fußballtraining teilgenommen, und Max weinte jeden Morgen, wenn er in die Vorschule gehen sollte, obwohl er dort eigentlich gut zurechtkam. Greg nässte wieder das Bett ein und bekam bei der kleinsten Verärgerung einen Wutanfall. Einige dieser Veränderungen, das war Adrienne klar, hatten mit dem Tod des Vaters zu tun, aber sie waren auch eine Reaktion auf Amandas Verhalten, das sich seit dem letzten Frühjahr stark gewandelt hatte.
Weil Amanda durch die Lebensversicherung abgesichert war, brauchte sie nicht zu arbeiten. Aber Adrienne war in den ersten zwei Monaten nach Brents Tod trotzdem jeden Tag bei Amanda gewesen, hatte dafür gesorgt, dass die Rechnungen bezahlt wurden und die Kinder zu essen bekamen. Währenddessen hatte sich Amanda in ihr Zimmer zurückgezogen, wo sie entweder schlief oder weinend wach lag. Adrienne nahm Amanda in den Arm, wenn ihre Tochter es brauchte, sie hörte zu, wenn Amanda sich aussprechen wollte, und sie bestand darauf, dass ihre Tochter wenigstens ein oder zwei Stunden am Tag nach draußen ging. Sie hoffte, an der frischen Luft würde Amanda erkennen, dass auch für sie das Leben weiterging.
Adrienne war voller Hoffnung gewesen, dass ihre Tochter langsam über den Verlust hinwegkam. Als es Sommer wurde, hatte Amanda wieder gelächelt, erst selten, dann immer öfter. Sie machte einige Stadtbummel und begleitete die Kinder ab und zu auf die Rollschuhbahn, und allmählich zog sich Adrienne von den Aufgaben zurück, die sie bis dahin für ihre Tochter erledigt hatte. Sie wusste, wie wichtig es war, dass Amanda wieder die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernahm. Man konnte im gleichförmigen Ablauf des Alltags Trost finden, das hatte Adrienne selbst erfahren, und sie hoffte, dass Amanda dies auch erkennen würde.
Doch im August, an dem Tag, der ihr siebter Hochzeitstag gewesen wäre, öffnete Amanda die Tür zum Kleiderschrank im Schlafzimmer und sah, dass sich auf den Schultern von Brents Anzügen Staub gesammelt hatte. Von da an ging es nicht mehr weiter voran. Nicht, dass die Trauer sie wieder überwältigt hätte – es gab Momente, da war sie fast wie früher –, aber die meiste Zeit wirkte sie eigentümlich erstarrt. Sie war weder deprimiert noch glücklich, weder angeregt noch lethargisch, weder interessiert noch gelangweilt von dem, was um sie herum geschah. Amanda, so kam es Adrienne vor, war offenbar zu der Überzeugung gelangt, dass die Erinnerung an Brent verblassen würde, wenn sie nach vorn blickte, und hatte entschieden, das nicht zuzulassen.
Doch den Kindern gegenüber war es nicht fair. Sie brauchten die Führung und Liebe ihrer Mutter, sie brauchten ihre Zuwendung. Sie brauchten eine Mutter, die ihnen versicherte, dass sich alles zum Guten wenden würde. Ein Elternteil hatten sie bereits verloren, und das war schwer genug. In letzter Zeit kam es Adrienne oft so vor, als hätten sie auch ihre Mutter verloren.
Im sanften Schein der Küchenlampe sah Adrienne auf die Uhr. Auf ihre Bitte war Dan mit den beiden Jungen, Max und Greg, ins Kino gegangen, sodass Adrienne den Abend mit Amanda verbringen konnte. Wie Adrienne waren auch ihre beiden Söhne um Amandas Kinder besorgt. Sie hatten sich nicht nur bemüht, eine aktive Rolle im Leben der Jungen zu übernehmen, sondern Adrienne immer wieder um Rat gefragt, wie sie sonst noch helfen konnten. Heute hatte Adrienne Dan beruhigt und gesagt, sie werde mit Amanda sprechen. Dan hatte darauf skeptisch reagiert – hatten sie das nicht schon oft versucht? –, aber sie wusste, dass dieser Abend eine andere Wirkung haben würde.
Adrienne machte sich kaum Illusionen darüber, wie ihre Kinder sie sahen. Natürlich, sie liebten und respektierten sie als Mutter, aber Adrienne wusste, dass sie sie nicht wirklich kannten. In den Augen ihrer Kinder war sie gutherzig und durchschaubar, liebenswürdig und zuverlässig, eine freundliche Seele aus einer anderen Zeit, die ihren Weg ging und dabei ihre naive Weltsicht beibehalten hatte. Ihr Äußeres entsprach inzwischen dieser Sichtweise – die Fingerknöchel wurden mit der Zeit dicker, ihre schlanke Taille hatte sie eingebüßt, und die Brillengläser waren im Laufe der Jahre auch stärker geworden –, aber wenn sie bemerkte, wie ihre Kinder sie mit nachsichtigen Blicken ansahen, musste sie manchmal ein Lachen unterdrücken.
Zum Teil, das war Adrienne klar, lag der Irrtum ihrer Kinder in dem Wunsch begründet, dass sie ein bestimmtes Bild von ihrer Mutter haben wollten und Adrienne diesem Bild von einer Frau in ihrem Alter auch entsprechen sollte. Es war leichter – und auch bequemer, um ehrlich zu sein –, wenn sie ihre Mom für eine unauffällige ältere Frau halten konnten statt für eine wagemutige Frau; für eine Frau, deren Leben in normalen Bahnen verlief, statt für eine mit Erfahrungen, die sie, die Kinder, in Staunen versetzen würden. Und als die gutherzige, durchschaubare, liebenswürdige und verlässliche Mutter, die sie in den Augen ihrer Kinder war, hatte Adrienne nicht den Wunsch, diese Vorstellung zurechtzurücken.
Adrienne wusste, dass Amanda jeden Moment eintreffen würde, deshalb ging sie zum Kühlschrank und holte eine Flasche Pinot Grigio heraus. Da es seit dem Nachmittag im Haus kühler geworden war, drehte sie auf dem Weg ins Schlafzimmer den Thermostat hoch.
Früher hatte sie dieses Zimmer mit Jack geteilt, jetzt war es ihres, und seit der Scheidung war es bereits zweimal neu gestrichen worden. Adrienne trat an das Himmelbett, das sie sich schon seit ihrer Jugend gewünscht hatte. Unter dem Bett, nahe der Wand, stand eine kleine Briefschachtel, die sie jetzt hervorholte und auf das Kissen neben sich stellte.
Darin befanden sich lauter Dinge, die sie von damals aufbewahrt hatte: das einzelne Blatt Papier, das er in der Pension für sie zurückgelassen hatte, ein Foto von ihm, das in der Klinik aufgenommen worden war, und der Brief, den sie damals wenige Wochen vor Weihnachten erhalten hatte. Darunter lagen zwei zusammengebundene Stapel Briefe, Botschaften, die zwischen ihnen hin und her gegangen waren, und dazwischen eine Schneckenmuschel, die sie damals am Strand gefunden hatten.
Adrienne legte das Blatt zur Seite und zog einen Umschlag aus dem Stapel. Und gleich stellte sich die Erinnerung an das Gefühl wieder ein, das sie damals empfunden hatte, als sie den Brief bekam. Sie nahm ihn aus dem Umschlag. Er war dünn und brüchig geworden, und die Tinte war in den Jahren, seit er den Brief geschrieben hatte, verblichen. Dennoch waren die Worte deutlich lesbar.
Liebe Adrienne,
ich war nie ein guter Briefeschreiber, und ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich mich nicht sehr gut ausdrücke.
Ich kam heute Morgen auf einem Esel an, ob du das glaubst oder nicht, und nahm den Ort in Augenschein, an dem ich die nächste Zeit verbringen werde. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass es besser ist, als ich es mir vorgestellt habe, aber wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht. In der Klinik mangelt es an den meisten Dingen: an Medikamenten, Geräten und ausreichend Betten, aber ich habe mit dem Direktor gesprochen, und ich glaube, ich werde wenigstens einen Teil der Probleme lösen können. Es gibt zwar einen Generator, der Strom liefert, aber keine Telefone, sodass ich erst anrufen kann, wenn ich nach Esmeraldas komme. Es liegt zwei Tagesfahrten von hier entfernt, und die nächste Versorgungsreise findet erst in ein paar Wochen statt. Es tut mir Leid, aber in Wahrheit wussten wir wohl beide, dass es so sein würde.
Mark habe ich noch nicht gesehen. Er ist in einer Sozialstation in den Bergen und kommt erst heute Abend zurück. Ich werde dir berichten, wie es mit ihm läuft, aber am Anfang erwarte ich nicht allzu viel. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir müssen uns erst einmal kennen lernen, bevor wir uns den Problemen zwischen uns zuwenden können.
Ich kann nicht einmal aufzählen, wie viele Patienten ich heute behandelt habe. Über hundert, nehme ich an. Es ist schon lange her, dass ich Patienten auf diese Weise und mit dieser Art von Beschwerden behandelt habe, aber die Schwester war eine große Hilfe, auch dann noch, wenn ich nicht mehr weiterwusste. Ich glaube, sie ist dankbar, dass ich überhaupt da bin.
Seit ich abgereist bin, denke ich die ganze Zeit an dich. Ich weiß, dass meine Reise noch nicht vorüber und dass das Leben ein gewundener Pfad ist, und ich kann nur hoffen, dass er sich irgendwie zurück zu dem Ort schlängelt, an den ich gehöre. Zurück zu dir.
So denke ich jetzt darüber. Ich gehöre zu dir. Während der Fahrt und auch, als das Flugzeug in der Luft war, habe ich mir vorgestellt, ich würde dich bei meiner Ankunft in Quito erblicken. Du würdest in der Menge auf mich warten. Ich wusste, dass das nicht sein konnte, aber irgendwie war es so ein wenig leichter, dich zu verlassen. Fast, als wäre ein Teil von dir mitgekommen.
Ich möchte gern glauben, dass das wahr ist. Nein, falsch – ich weiß, dass es wahr ist. Bevor wir uns kennen lernten, war ich so verloren, wie ein Mensch nur sein kann. Und doch hast du etwas in mir gesehen, was mir eine neue Richtung gegeben hat. Wir wissen beide, warum ich nach Rodanthe gekommen war, aber ich kann mich nicht von dem Gedanken losmachen, dass größere Kräfte am Werk waren. Ich bin dorthin gefahren, weil ich ein Kapitel in meinem Leben abschließen wollte, in der Hoffnung, dass es mir helfen würde, meinen Weg zu finden. Doch ich glaube, du warst es, nach der ich die ganze Zeit Ausschau gehalten habe. Und du bist es auch, die jetzt hier bei mir ist.
Wir wissen beide, dass ich für eine Weile hier bleiben muss. Es ist ungewiss, wann ich zurück sein werde. Obwohl wir noch nicht lange getrennt sind, wird mir bewusst, dass ich dich mehr vermisse, als ich je einen Menschen vermisst habe. Ein Teil von mir würde am liebsten sofort in ein Flugzeug steigen und zu dir fliegen. Doch wenn das, was uns verbindet, so wahrhaftig ist, wie ich glaube, dann bin ich mir sicher, dass wir es schaffen werden. Und ich komme zurück, das verspreche ich dir. In der kurzen Zeit, die wir miteinander verbracht haben, ist uns das zuteil geworden, wovon die meisten Menschen nur träumen, und ich zähle die Tage, bis ich dich wiedersehen kann. Vergiss nie, wie sehr ich dich liebe.
Paul
Als Adrienne zu Ende gelesen hatte, legte sie den Brief zur Seite und griff nach der Muschel, die sie an jenem Sonntag vor langer Zeit gefunden hatten. Noch immer roch sie nach Seetang, nach der Zeitlosigkeit, dem ursprünglichen Geruch des Lebens selbst. Die Muschel war mittelgroß, perfekt geformt, ohne einen Riss – so etwas nach einem Sturm in der rauen Brandung an den Outer Banks zu finden, war fast unmöglich. Ein Omen, hatte Adrienne damals gedacht, und sie erinnerte sich, wie sie die Muschel ans Ohr gehalten und gesagt hatte, sie könne das Rauschen des Ozeans hören. Und wie Paul darauf gelacht und erklärt hatte, dass es in der Tat der Ozean sei, den sie da hörte. Er hatte seine Arme um sie gelegt und geflüstert: »Es ist Flut, ist dir das nicht aufgefallen?«
Adrienne strich mit den Fingern zart über die anderen Dinge in der Schachtel und nahm das heraus, was sie für ihr Gespräch mit Amanda brauchte. Sie wünschte, sie hätte noch mehr Zeit, sich den Rest genauer anzuschauen. Vielleicht später, dachte sie. Sie verstaute die Sachen in der untersten Schublade, weil sie wusste, dass Amanda sie nicht zu sehen brauchte. Dann nahm sie die Schachtel, stand vom Bett auf und strich sich den Rock glatt.
Gleich musste ihre Tochter kommen.
ZWEI
Adrienne hörte von der Küche aus, wie die Haustür auf- und zuging und wie Amanda das Wohnzimmer durchquerte.
»Mom?«
Adrienne stellte die Schachtel auf den Küchentisch.
»Ich bin hier!«, rief sie.
Als Amanda durch die angelehnte Tür in die Küche trat, sah sie ihre Mutter am Tisch sitzen, vor sich eine geschlossene Flasche Wein.
»Was ist denn los?«, fragte Amanda.
Adrienne lächelte und stellte wieder einmal fest, wie hübsch ihre Tochter doch war. Mit ihrem hellbraunen Haar und den haselnussbraunen Augen, die ihre hohen Wangenknochen betonten, war sie schon immer hübsch anzusehen gewesen. Obwohl sie zweieinhalb Zentimeter kleiner war als Adrienne, hatte sie die Körperhaltung einer Tänzerin und wirkte größer. Außerdem war sie dünn – ein wenig zu dünn, fand Adrienne, aber sie hatte gelernt, darüber keine Bemerkungen zu machen.
»Ich möchte mit dir sprechen«, sagte Adrienne.
»Worüber?«
Statt zu antworten, wies Adrienne auf einen Stuhl.
»Setz dich doch.«
Amanda ließ sich am Tisch nieder. Aus der Nähe sah sie angespannt aus, und Adrienne ergriff ihre Hand. Sie drückte sie schweigend und gab sie dann langsam wieder frei, während ihr Blick zum Fenster wanderte. Einen Moment lang war es ganz still in der Küche.
»Mom?«, fragte Amanda schließlich. »Geht es dir gut?«
Adrienne schloss die Augen und nickte. »Mir geht es gut, ja. Ich überlege nur, wie ich anfangen soll.«
Amanda wurde abweisend. »Hat es wieder mit mir zu tun? Wenn ja, dann ...«
Adrienne unterbrach sie mit einem Kopfschütteln. »Nein, es hat mit mir zu tun«, sagte sie. »Ich will dir etwas erzählen, das sich vor vierzehn Jahren zugetragen hat.«
Amanda legte den Kopf zur Seite, und in der vertrauten kleinen Küche begann Adrienne ihre Geschichte.
DREI
Rodanthe 1985
Paul Flanner kam aus dem Büro seines Anwalts. Der Morgenhimmel war grau. Flanner zog den Reißverschluss an seiner Jacke zu, ging zu seinem Leihwagen, einem Toyota Camry, setzte sich hinter das Steuerrad und hielt sich vor Augen, dass das Leben, das er ein Vierteljahrhundert lang geführt hatte, mit seiner Unterschrift unter den Verkaufsvertrag zu Ende gegangen war.
Es war Anfang Januar 1985, und im vergangenen Monat hatte er seine beiden Autos, seine Arztpraxis und jetzt auch, in einer letzten Zusammenkunft mit seinem Anwalt, sein Haus verkauft.
Er hatte nicht vorhersehen können, wie er sich bei dem Verkauf seines Hauses fühlen würde, aber als er den Zündschlüssel drehte, stellte er mit Erstaunen fest, dass er nichts Besonderes empfand, außer einer vagen Befriedigung angesichts der Endgültigkeit des Ganzen. Am Morgen war er ein letztes Mal durch das Haus gegangen und hatte gehofft, sich an Begebenheiten aus seinem Leben zu erinnern. Er hatte gedacht, er würde den Weihnachtsbaum noch einmal vor sich sehen und das Bild von seinem Sohn, der im Schlafanzug nach unten gestapft kam und die von Santa Claus gebrachten Geschenke bestaunte. Er versuchte sich der Essensgerüche an Thanksgiving oder an so manchem regnerischen Sonntag zu entsinnen, wenn Martha einen kräftigen Eintopf gekocht hatte, oder der Geräusche, die aus dem Wohnzimmer drangen, wenn er und seine Frau Gäste bewirteten – was oft geschah.
Aber als er so von Zimmer zu Zimmer ging, hier und da einen Moment verweilte und seine Augen schloss, wurden keine Erinnerungen in ihm wach. Das Haus, so wurde ihm bewusst, war nichts weiter als eine leere Hülle, und er fragte sich erneut, warum er so lange darin gelebt hatte.
Paul fuhr vom Parkplatz auf die Straße und schlängelte sich über Nebenstraßen zur Ausfallstraße, um den Pendlerverkehr aus den Vororten zu umgehen. Zwanzig Minuten später bog er auf den Highway 70 ein, eine zweispurige Straße, die in südöstlicher Richtung zur Küste von North Carolina führte. Auf dem Rücksitz lagen zwei große Seesäcke. Sein Flugticket und seinen Pass hatte Paul in der Ledertasche auf dem Vordersitz neben sich verstaut. Im Kofferraum befanden sich sein Arztkasten und verschiedene Medikamente, die man ihn gebeten hatte mitzubringen.
Der Himmel war jetzt wie eine Leinwand in Weiß und Grau – der Winter hatte wahrlich begonnen. Am Morgen hatte es eine Stunde lang geregnet, und bei dem nördlichen Wind fühlte sich die Luft kälter an, als sie wirklich war. Auf dem Highway herrschte mäßiger Verkehr. Paul stellte den Tempomat ein paar Meilen über der Geschwindigkeitsbegrenzung ein und überdachte noch einmal, was er am Morgen hinter sich gebracht hatte.
Britt Blackerby, sein Anwalt, hatte ein letztes Mal versucht, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Sie waren seit Jahren befreundet. Als Paul ihm vor sechs Monaten erzählte, was er vorhatte, hielt Britt das für einen Witz. Er hatte laut gelacht und gesagt: »Das ist doch nicht dein Ernst!« Erst als er Paul über den Tisch hinweg aufmerksam in die Augen sah, begriff er, dass es ihm durchaus ernst war.
Paul hatte sich natürlich auf die Besprechung vorbereitet. Dies war eine Angewohnheit, von der er sich nicht befreien konnte. Er schob drei Blätter Papier über den Tisch, auf denen er seine Preisvorstellung und sein Konzept für den Vertrag dargelegt hatte – sauber getippt natürlich. Britt starrte eine Weile auf die Blätter und sah ihn dann erneut an.
»Tust du das wegen Martha?«, fragte er.
»Nein«, hatte Paul geantwortet, »es ist mir einfach ein Bedürfnis.«
Paul drehte die Heizung im Auto an und hielt die Hand vor den Ventilator, damit die Heizungsluft seine Finger wärmte. Er warf einen Blick in den Rückspiegel, sah die Hochhäuser von Raleigh und fragte sich bei dem Anblick, ob er sie wohl einmal wiedersehen würde.
Er hatte das Haus an ein junges Paar mit aussichtsreichen Berufen verkauft – der Mann war Manager bei Glaxo Smith-Kline, die Frau Psychologin. Die beiden hatten es gleich am ersten Tag, als es zum Verkauf stand, besichtigt. Am nächsten Tag kamen sie wieder und unterbreiteten nach einem zweiten Rundgang sofort ein Angebot. Sie waren die ersten und einzigen Interessenten, die das Haus angesehen hatten.
Das überraschte Paul nicht. Er war dabei, als sie ihre zweite Hausbesichtigung machten und sich eine Stunde lang sehr gründlich umsahen. Zwar gaben sie sich alle Mühe, keine überschwängliche Reaktion zu zeigen, doch Paul wusste in dem Moment, als er ihnen gegenübertrat, dass sie das Haus kaufen würden. Er zeigte ihnen, wie die Alarmanlage funktionierte und wie man das hintere Tor öffnete. Er nannte ihnen den Gärtnereibetrieb, der immer für ihn gearbeitet hatte, und gab ihnen dessen Visitenkarte sowie die des Pool-Reinigungsdiensts, mit dem er einen Vertrag hatte. Er erzählte, der Marmor im Eingangsbereich sei aus Italien importiert und die Buntglasfenster seien von einem Künstler in Genf entworfen worden. Die Küche sei erst zwei Jahre alt, und der Kühlschrank mit Gefrierschrank und der Viking-Herd entsprächen immer noch dem höchsten Standard. Ja, sagte er, man könne hier ohne weiteres für zwanzig Gäste kochen. Er führte die beiden jungen Leute in das große Schlafzimmer, neben dem ein Badezimmer lag, dann in die anderen Schlafzimmer, und bemerkte, wie ihre Blicke an den Fensterbänken aus Marmor und den in Wischtechnik bemalten Wänden hängen blieben. Im Untergeschoss wies er auf die nach Maß gefertigten Möbel und den Kronleuchter aus Kristall hin und forderte die beiden auf, sich im Esszimmer den persischen Teppich unter dem großen Tisch aus Kirschholz genau anzusehen. In der Bibliothek bemerkte Paul, wie der Mann mit den Fingern über die Ahornvertäfelung fuhr und wie sein Blick auf der Tiffany-Lampe verweilte.
»Und der Preis«, fragte der Mann, »gilt für das Haus mit den Möbeln?«
Paul nickte. Als er die Bibliothek verließ, konnte er das gedämpfte, aufgeregte Flüstern der beiden hören. Sie folgten ihm langsam.
Später, als sie schon an der Tür standen und gehen wollten, stellten sie Paul die Frage, die er erwartet hatte.
»Warum wollen Sie das Haus verkaufen?«
Paul erinnerte sich, wie er den Mann angesehen hatte, denn hinter der Frage, das wusste er, steckte mehr als nur Neugier. An dem, was Paul hier tat, haftete etwas Geheimnisvolles, und der Preis, das war ihm klar, war viel zu niedrig angesetzt, selbst wenn er das Haus leer verkauft hätte.
Paul hätte sagen können, dass er jetzt, da er allein war, so ein großes Haus nicht mehr brauchte. Oder dass das Haus besser geeignet sei für jüngere Leute, denen das Treppensteigen nichts ausmachte. Oder dass er vorhabe, ein anderes Haus zu kaufen oder zu bauen und dass er eine andere Ausstattung wolle. Oder dass er in den Ruhestand treten wolle und das große Haus zu viel Arbeit bedeute.
Aber keiner dieser Gründe war zutreffend. Statt zu antworten, sah er dem Mann in die Augen.
»Warum möchten Sie es kaufen?«, fragte er ihn.
Er hatte in einem freundlichen Ton gefragt, und der Mann warf seiner Frau einen Blick zu. Sie war hübsch, eine zierliche Brünette, ungefähr so alt wie ihr Mann, vielleicht Mitte dreißig. Auch der Mann sah gut aus und machte offenbar eine steile Karriere. An Selbstvertrauen schien es ihm jedenfalls nicht zu mangeln. Einen Moment lang schienen die beiden die Frage nicht zu verstehen.
»Von einem solchen Haus haben wir immer geträumt«, sagte die Frau schließlich.
Paul nickte. Ja, dachte er, ich kann mich an das Gefühl erinnern. Bis vor sechs Monaten ging es mir auch so.
»Dann hoffe ich, dass es Sie glücklich macht«, sagte er.
Die beiden gingen davon, und Paul beobachtete, wie sie in ihr Auto stiegen. Er winkte ihnen zu, bevor er die Tür schloss, doch als er wieder im Haus stand, spürte er, wie es ihm die Kehle zuschnürte. Beim Anblick des Mannes, so wurde ihm bewusst, hatte er sich an das Gefühl erinnert, das er früher gehabt hatte, wenn er sich im Spiegel ansah. Und aus einem nicht ganz erklärlichen Grund standen ihm plötzlich die Tränen in den Augen.
Der Highway führte durch Smithfield, Goldsboro und Kinston, kleine Orte, zwischen denen meilenlang Felder lagen, auf denen Baumwolle und Tabak wuchsen. Paul war hier aufgewachsen, auf einer kleinen Farm außerhalb von Williamston, und kannte die Gegend gut. Er fuhr an windschiefen Tabakscheunen und Farmhäusern vorbei. In den hohen, kahlen Ästen der Eichen neben dem Highway sah er Mistelgesträuch. Lange dünne Reihen von Weihrauchkiefern wuchsen entlang der Grenzlinien zwischen den Anwesen.
In New Bern, einer hübschen Stadt am Zusammenfluss von Neuse und Trent, hielt Paul an, um sich etwas zum Essen zu kaufen. In einem Deli im historischen Stadtkern besorgte er sich ein Sandwich und einen Kaffee und setzte sich trotz des kühlen Wetters auf eine Bank vor dem Sheraton, von wo aus man einen Blick über den Sporthafen hatte. Jachten und Segelboote lagen vertäut an ihren Liegeplätzen und schaukelten sanft in der Brise.
Pauls Atem bildete kleine Wolken. Nachdem er das Sandwich gegessen hatte, entfernte er den Deckel von seinem Kaffeebecher. Während er zusah, wie der Dampf aufstieg, überdachte er erneut die Kette von Ereignissen, die ihn hierher gebracht hatte.
Es war eine lange Reise gewesen. Seine Mutter war bei seiner Geburt gestorben, und sein Vater, dessen einziger Sohn er war, verdiente seinen Lebensunterhalt als Farmer – Paul hatte es also nicht leicht gehabt. Statt mit Freunden Baseball zu spielen oder nach Flussbarschen oder Welsen zu angeln, verbrachte er seine Tage damit, Unkraut zu jäten und Baumwollkapselkäfer von den Tabakpflanzen zu lesen, zwölf Stunden am Tag, unter der glühenden südlichen Sommersonne, die seinem Rücken eine dauerhafte goldene Färbung verlieh. Wie die meisten Kinder in seiner Lage klagte er gelegentlich, aber meistens akzeptierte er, dass er arbeiten musste. Er wusste, dass sein Vater auf seine Hilfe angewiesen war. Und dass er ein guter Mensch war. Er war geduldig und freundlich, aber wie schon sein eigener Vater vor ihm sprach er selten, es sei denn, er hatte einen Grund. An den meisten Tagen war es in ihrem kleinen Haus so still wie in der Kirche. Abgesehen von den Standardfragen darüber, wie es in der Schule ging und was an Feldarbeiten anstand, wurde die Stille beim Essen nur durch das Klappern von Messer und Gabel auf den Tellern durchbrochen. Wenn der Abwasch gemacht war, setzte sich sein Vater ins Wohnzimmer und las Farmberichte, und Paul vertiefte sich in ein Buch. Sie hatten keinen Fernseher, und das Radio wurde meist nur angestellt, wenn sie den Wetterbericht hören wollten.
Sie waren arm. Zwar hatte Paul immer genug zu essen und ein warmes Zimmer, doch es war ihm manchmal peinlich, dass er verschlissene Kleidung trug und nicht das Geld hatte, in den Drugstore zu gehen, um ein Stück Kuchen oder eine Flasche Cola zu kaufen, wie es seine Freunde taten. Hin und wieder bekam Paul spöttische Bemerkungen zu hören, doch statt sich zu verteidigen vertiefte er sich in seine Schularbeiten, als wollte er beweisen, dass es ihm nichts ausmachte. Jahrein, jahraus brachte er die besten Noten nach Hause. Sein Vater war zwar stolz auf seine Leistungen, aber immer, wenn er Pauls Zeugnisse las, wurde er leicht melancholisch, als wüsste er, dass sein Sohn eines Tages die Farm verlassen und nie mehr zurückkommen würde.
Die Disziplin, die Paul bei der Feldarbeit erworben hatte, übertrug er auch auf andere Lebensbereiche. Er schloss nicht nur die Schule als Bester ab, er wurde auch ein ausgezeichneter Sportler. Als er an der Universität nicht ins Football-Team aufgenommen wurde, empfahl ihm der Trainer, es mit Geländelauf zu versuchen. Paul erkannte schnell, dass es nichts mit genetischer Veranlagung zu tun hatte, ob man aus Wettbewerben als Sieger oder als Verlierer hervorging, sondern mit dem Einsatz. So gewöhnte er sich an, morgens um fünf Uhr aufzustehen, damit er zwei Trainingsstunden in den Tag einbauen konnte. Sein Plan ging auf: Aufgrund seiner sportlichen Leistungen bekam er ein volles Stipendium für die Duke University und war vier Jahre lang der beste Läufer und zugleich ein erfolgreicher Student. Paul studierte Chemie und Biologie und schloss das Studium summa cum laude ab. In dem Jahr wurde er zudem als All-American ausgezeichnet, weil er im nationalen Geländelaufwettkampf als Dritter ins Ziel kam.
Nach dem Lauf übergab er seinem Vater die Medaille. Er sagte, dass er all dies nur für ihn getan habe.
»Nein«, widersprach sein Vater, »du bist für dich selbst gelaufen. Ich hoffe nur, du läufst auf etwas zu und nicht vor etwas weg.«
An jenem Abend lag Paul im Bett, starrte lange an die Decke und versuchte zu begreifen, was sein Vater gemeint haben könnte. Seiner Meinung nach lief er auf etwas zu – auf alles, was vor ihm lag. Auf ein besseres Leben. Auf ein Leben ohne Sorgen. Auf das Glück.
Als er im Februar seines letzten Studienjahrs erfuhr, dass er an der medizinischen Fakultät von Vanderbilt angenommen worden sei, besuchte er seinen Vater und überbrachte ihm die gute Nachricht. Sein Vater schien sich zu freuen. Aber später, zu einer Stunde, zu der sein Vater normalerweise längst schlief, sah Paul vom Fenster aus, wie er beim Zaunpfosten stand und über die Felder blickte. Eine einsame Gestalt.
Drei Wochen darauf starb sein Vater, während er die Felder für den Frühling pflügte, an einem Herzinfarkt.
Paul war völlig zerstört. Doch statt seiner Trauer Zeit und Raum zu geben, stürzte er sich noch tiefer in die Arbeit und vermied es, sich seinen Erinnerungen hinzugeben. Er schrieb sich vor Semesterbeginn an der Universität ein, nahm an einem Sommerkurs teil, um sich einen Vorsprung zu verschaffen, und im Herbst lud er sich zu seinem vollen Stundenplan zusätzliche Kurse auf. Von da an raste sein Leben nur so dahin. Er besuchte die Kurse, arbeitete im Labor und lernte bis in die frühen Morgenstunden. Jeden Tag lief er fünf Meilen, er stoppte immer die Zeit und versuchte sich jedes Jahr zu steigern. Er ging nie in Nachtclubs oder Bars, und er war auch nie dabei, wenn die Mitglieder des Sportteams zusammen ausgingen. Aus einer Laune heraus kaufte er sich einen Fernsehapparat, packte ihn aber nicht einmal aus und verkaufte ihn ein Jahr später wieder. Mädchen gegenüber war er schüchtern, aber jemand machte ihn mit Martha bekannt, einer freundlichen blonden jungen Frau aus Georgia, die in der Bibliothek der medizinischen Fakultät arbeitete. Und weil er sich nicht dazu durchringen konnte, sich mit ihr zu verabreden, machte sie den ersten Schritt. Angesichts des enormen Pensums, das Paul sich abverlangte, war sie zwar beunruhigt, nahm aber dennoch seinen Heiratsantrag an. Nach zehn Monaten traten sie zusammen vor den Altar. Da Pauls Prüfungen bevorstanden, blieb keine Zeit für die Flitterwochen, aber er versprach seiner Frau, eine schöne Reise mit ihr zu machen, sobald er das Studium abgeschlossen hatte.
Dazu kam es nie. Ein Jahr später wurde ihr Sohn Mark geboren, und in dessen ersten beiden Lebensjahren fand Paul nicht ein einziges Mal die Zeit, ihm die Windeln zu wechseln oder ihn in den Schlaf zu wiegen.
Stattdessen saß er am Küchentisch und lernte. Er studierte Tabellen menschlicher Physiologie oder entschlüsselte chemische Gleichungen. Er machte Notizen und erzielte in einer Prüfung nach der anderen die besten Ergebnisse. Nach drei Jahren schloss er seine medizinische Ausbildung als Bester seines Jahrgangs ab und zog mit der Familie nach Baltimore, wo er sein praktisches Jahr als Chirurg im John-Hopkins-Krankenhaus antrat.
Die Chirurgie, das wusste er inzwischen, war seine Berufung. In den meisten Fachrichtungen mussten die Ärzte kommunikativ sein und Trost spenden können – und das war nicht gerade Pauls Stärke. Aber in der Chirurgie war das anders. Hier waren die Patienten weniger an den kommunikativen Fähigkeiten des Arztes interessiert als vielmehr an seinem chirurgischen Können – und Paul besaß nicht nur genügend Selbstbewusstsein, um seinen Patienten vor einem Eingriff ein sicheres Gefühl zu geben, sondern auch großes Operationsgeschick. Dieses Betätigungsfeld entsprach ihm sehr. In den letzten beiden Jahren seiner praktischen Ausbildung arbeitete Paul neunzig Stunden in der Woche und schlief vier Stunden pro Nacht, zeigte aber erstaunlicherweise nie Spuren von Übermüdung.
Nach den Jahren im Krankenhaus absolvierte er eine Zusatzausbildung in Schädelchirurgie und Gesichtsplastik und zog mit seiner Familie nach Raleigh, wo er, kurz bevor die Bevölkerungsrate der Stadt sprunghaft anstieg, als Partner in eine Gemeinschaftspraxis eintrat. Da sie die einzigen Spezialisten auf diesem Gebiet waren, expandierte ihre Praxis. Mit vierunddreißig hatte Paul seine Schulden aus dem Studium zurückgezahlt. Als er sechsunddreißig Jahre alt war, pflegte er Verbindungen zu allen großen Krankenhäusern in der Gegend und arbeitete überwiegend mit dem Medical Center der University of North Carolina zusammen. Dort führte er gemeinsam mit Ärzten von der Mayo Clinic eine klinische Studie über Neurofibrome durch. Ein Jahr später wurde ein von ihm verfasster Artikel zum Thema Gaumenspalten im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Vier Monate darauf folgte ein zweiter Artikel über Hämangiome, der der chirurgischen Praxis bei Säuglingen eine neue Richtung wies. Pauls Ruf wuchs, und als er die Tochter von Senator Norton, deren Gesicht nach einem Autounfall durch Narben entstellt war, erfolgreich operierte, wurde auf der Titelseite des Wall Street Journal über ihn berichtet.
Doch Paul beließ es nicht bei wiederherstellender Chirurgie und war einer der ersten Ärzte in North Carolina, der seine Praxis gerade zu dem Zeitpunkt auf kosmetische Gesichtschirurgie ausdehnte, als dieser Bereich zu expandieren begann. Seine Praxis florierte, sein Einkommen vervielfachte sich, und er fing an, Besitz anzuhäufen. Er kaufte sich einen BMW, dann einen Mercedes, dann einen Porsche und wieder einen Mercedes. Er und Martha bauten sich das Haus ihrer Träume. Paul kaufte Wertpapiere und Obligationen und Aktien in verschiedenen Investmentfonds. Als ihm klar wurde, dass er die feinen Bewegungen des Marktes nicht überblickte, stellte er einen Vermögensverwalter ein. Danach verdoppelte sich sein Vermögen alle vier Jahre. Und als er schon mehr hatte, als er je in seinem Leben benötigen würde, verdreifachte es sich sogar im selben Zeitraum.
Dennoch arbeitete Paul immer weiter. Er operierte sogar samstags. Selbst die Sonntagnachmittage verbrachte er in seiner Praxis. Als er fünfundvierzig war, kapitulierte sein Partner vor dem Tempo, das Paul vorgab, trennte sich von ihm und trat in eine andere Gemeinschaftspraxis ein.
In den ersten Jahren nach Marks Geburt sprach Martha oft davon, dass sie sich ein zweites Kind wünschte. Nach einer Weile erwähnte sie es nicht mehr. Anfangs bestand sie darauf, dass er mit ihr zusammen Ferien machte, was er, wenn auch widerstrebend, tat. Doch nach einer Zeit fing sie an, mit Mark allein ihre Eltern zu besuchen. Paul fand nur bei den wichtigsten Ereignissen im Leben seines Sohnes die Zeit, zugegen zu sein, versäumte aber fast alles andere.
Er redete sich ein, dass er für die Familie arbeitete. Oder für Martha, die die knappen Jahre des Anfangs mit ihm durchgestanden hatte. Oder im Gedenken an seinen Vater. Oder für Marks Zukunft. Aber insgeheim wusste er, dass er nur für sich selbst arbeitete.
Wenn er etwas nennen sollte, was er an diesen Jahren am allermeisten bedauerte, dann war es die fehlende Beziehung zu seinem Sohn. Doch obwohl Paul im Leben seines Sohnes kaum eine Rolle gespielt hatte, entschied sich Mark zu Pauls großer Überraschung dazu, Arzt zu werden. Nachdem Mark an der medizinischen Fakultät angenommen worden war, erzählte Paul im Krankenhaus voller Stolz, dass sein Sohn in seinen Berufsstand eintreten werde. Jetzt würden sie, so stellte er sich vor, mehr Zeit zusammen verbringen, und er lud Mark zum Lunch ein, weil er hoffte, ihn für die chirurgische Laufbahn gewinnen zu können.
»Das ist dein Leben«, sagte Mark zu ihm, »und es interessiert mich überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, du tust mir Leid.«
Die Worte trafen. Die beiden gerieten in Streit. Mark machte Paul bittere Vorwürfe, Paul wurde wütend, und am Schluss stürmte sein Sohn aus dem Restaurant. Zwei Wochen lang weigerte sich Paul, mit ihm zu sprechen, und Mark machte keinen Versuch, sich mit seinem Vater auszusöhnen. Aus Wochen wurden Monate, dann Jahre. Obwohl Mark eine enge Beziehung zu seiner Mutter aufrechterhielt, vermied er es, nach Hause zu kommen, wenn er wusste, dass sein Vater da war.
Paul reagierte auf die weitere Entfremdung von seinem Sohn in der einzigen Art und Weise, die er kannte. Sein Arbeitspensum blieb das gleiche, er lief weiterhin seine fünf Meilen am Tag, und morgens las er den Finanzteil in der Zeitung. Aber er sah die Traurigkeit in Marthas Augen, und es gab Momente, in denen er überlegte, wie er den Bruch mit seinem Sohn heilen konnte. Er hätte gern zum Telefonhörer gegriffen und ihn angerufen, aber er konnte sich nie dazu durchringen. Mark, so hatte er von Martha erfahren, kam auch ohne ihn gut zurecht. Statt eine Ausbildung zum Chirurgen zu machen, wurde er praktischer Arzt, und nach einer Spezialausbildung, die ein paar Monate dauerte, ging er mit einer internationalen Hilfsorganisation ins Ausland. Einerseits war das eine edle Entscheidung, andererseits, dachte Paul unwillkürlich, hatte Mark vielleicht diesen Entschluss gefasst, um so weit fort von seinem Vater wie möglich zu sein.
Zwei Wochen, nachdem Mark abgereist war, reichte Martha die Scheidung ein.
Wenn ihn Marks Worte damals wütend gemacht hatten, so war er bei Marthas Worten wie betäubt. Paul versuchte, sie davon abzubringen, doch Martha unterbrach ihn sanft.
»Meinst du denn wirklich, du wirst mich vermissen? «, sagte sie. »Wir kennen uns doch kaum noch.«
»Ich kann mich ändern«, versprach Paul.
Martha lächelte. »Das weiß ich. Und ich glaube, du solltest dich auch ändern. Aber du solltest dich ändern, weil du es willst, und nicht, weil du glaubst, dass ich es will.«
Die nächsten zwei Wochen verbrachte Paul in einem Zustand der Benommenheit. Und einen Monat später geschah es, dass die zweiundsechzig Jahre alte Jill Torrelson aus Rodanthe, North Carolina, nach einer routinemäßigen Operation, die Paul an ihr vorgenommen hatte, im Aufwachzimmer starb.
Dieses schreckliche Ereignis, das so unmittelbar auf die anderen folgte, hatte ihn, so begriff Paul, auf den Weg geführt, den er jetzt einschlug.
Nachdem er seinen Kaffee ausgetrunken hatte, stieg Paul ins Auto und fuhr wieder auf den Highway. Nach einer Dreiviertelstunde erreichte er Morehead City. Er fuhr über die Brücke nach Beaufort und folgte den Wegweisern Richtung Down East und zum Cedar Point.
Der flache Küstenstreifen war von einer friedlichen Schönheit, und Paul fuhr langsamer, damit er den Anblick auf sich wirken lassen konnte. Das Leben war hier anders. Paul fuhr weiter und staunte über die Menschen in den entgegenkommenden Autos. Sie winkten. Und eine Gruppe älterer Männer, die auf der Bank vor einer Tankstelle saßen, hatte anscheinend nichts Besseres zu tun, als den vorüberfahrenden Autos nachzusehen.
Am Nachmittag nahm Paul die Fähre nach Ocracoke, einer Ortschaft am südlichen Ende der Outer Banks. Es waren nur vier weitere Autos auf der Fähre, und während der zweistündigen Fahrt unterhielt er sich mit einigen der anderen Passagiere. Er verbrachte die Nacht in einem Motel in Ocracoke und wachte auf, als sich der weiße Lichtball der Sonne über dem Wasser erhob. Er frühstückte bald und hatte dann noch Zeit, durch die ländlich wirkende Ortschaft zu wandern und zuzusehen, wie die Leute ihre Häuser für
2. Auflage Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 06/2006 Copyright © 2002 by Nikolas Sparks Enterprises Inc. Copyright © 2003 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co.KG, München
Copyright © 2006 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: EDV-Fotosatz Huber / Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
eISBN 978-3-641-06011-4
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe