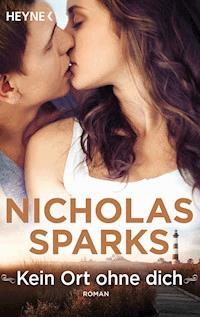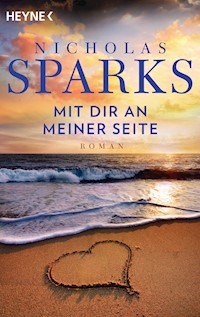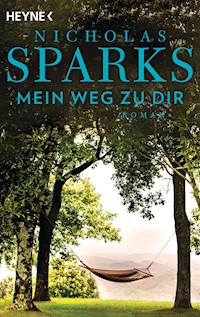9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Trevor ist 32 und an einer Wegscheide in seinem Leben angekommen. Da stirbt sein Großvater und hinterlässt ihm sein heruntergekommenes Cottage in North Carolina – samt riesigem wildwucherndem Garten und zwanzig Bienenstöcken. Trevor beginnt das Haus wieder instand zu setzen und kümmert sich mit Begeisterung um die Bienenvölker. Und er lernt zwei geheimnisvolle Frauen kennen, die ihn beide auf ganz unterschiedliche Weise in ihren Bann ziehen: die Polizistin Natalie, zu der er sich sofort hingezogen fühlt, die seine Gefühle auch zu erwidern scheint – und die sich doch nicht an ihn binden kann. Und die Jugendliche Callie, die sich ganz allein durchs Leben schlägt und offensichtlich mit schwerstwiegenden Problemen kämpft. Kann Trevor Callie retten und Natalie für sich gewinnen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch
Der 32-jährige Trevor Benson ist Arzt und steht in seinem Leben an einem Scheideweg. Da stirbt sein Großvater und hinterlässt ihm sein Cottage am Rande von New Bern, North Carolina. Trevor beginn das Haus instand zu setzen und kümmert sich mit Begeisterung um die zwanzig Bienenstöcke, die sich über den herrlichen alten Garten verteilen. Dabei fällt ihm eine junge Frau auf, Callie, die stets allein unterwegs ist, sehr traurig und verschlossen wirkt – und die offensichtlich ein schlimmes Geheimnis hütet. Und er bekommt eines Abends unerwarteten Besuch von einer Polizistin, die nach dem Rechten sehen will. Er fühlt sich sofort zu Natalie hingezogen, und auch sie scheint nach anfänglichem Zögern seine Gefühle zu erwidern. Gemeinsam verbringen sie wunderschöne Abende, unternehmen Ausflüge und kümmern sich um die Bienen. Doch auch Natalie verbirgt eine schreckliche Wahrheit vor ihm … Als Callies Situation eine dramatische Wendung nimmt, muss Trevor nicht nur für sein eigenes Glück kämpfen.
Zum Autor
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in über 50 Sprachen erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen, zuletzt »Wo wir uns finden«.
NICHOLAS
SPARKS
WENN DU
ZURÜCKKEHRST
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Astrid Finke
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel
THE RETURN bei Grand Central Publishing/
Hachette Book Group USA, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Willow Holdings, Inc.
Copyright © 2020 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Lüra – Klemt & Mues GbR
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München,
unter Verwendung von Getty Images/
Matteo Colombo; Finepic®
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-22806-4V003
www.heyne.de
www.nicholas-sparks.de
Für die Familie Van Wie
Jeff, Torri, Anna, Audrey und Ava
Prolog
2019
Die Kirche ähnelt einer Alpenkapelle, wie man sie in den Bergen um Salzburg findet, und die kühle Luft darin ist angenehm. Weil es August ist und ich mich im Süden befinde, ist es drückend heiß, noch verschlimmert durch meinen Anzug und die Krawatte. Im Alltag trage ich normalerweise keine Anzüge. Sie sind unbequem, und als Arzt habe ich gelernt, dass meine Patienten positiver auf mich reagieren, wenn ich leger gekleidet bin.
Ich bin wegen einer Hochzeit hier. Die Braut kenne ich seit mittlerweile gut fünf Jahren, wobei ich nicht sicher bin, ob sie uns als Freunde bezeichnen würde. Nachdem sie New Bern verlassen hatte, telefonierten wir über ein Jahr lang noch regelmäßig miteinander, seitdem allerdings beschränkt sich unser Kontakt auf ein paar Textnachrichten hier und da, mal von ihr initiiert, mal von mir. Doch zwischen uns besteht unbestreitbar ein Band, eines, dessen Wurzeln Jahre zurückreichen.
Manchmal fällt es mir schwer, mich an den Mann zu erinnern, der ich war, als unsere Pfade sich zum ersten Mal kreuzten, aber ist das nicht normal? Das Leben bietet uns immer wieder die Chance, eine neue Richtung einzuschlagen, und dadurch wachsen wir und verändern uns; wenn wir in den Rückspiegel sehen, erhaschen wir einen Blick auf ein früheres Ich, das wir womöglich zeitweise gar nicht mehr erkennen.
Manches ist gleich geblieben, mein Name zum Beispiel, aber mittlerweile bin ich siebenunddreißig und stehe am Anfang eines neuen Berufs, eines, den ich in den ersten drei Jahrzehnten meines Lebens nie in Betracht gezogen hatte. Früher spielte ich sehr gern Klavier, jetzt nicht mehr; aufgewachsen bin ich in einer liebevollen Familie, nun habe ich seit Langem keinen von ihnen gesehen. Dafür gibt es Gründe, aber dazu komme ich später.
Heute bin ich einfach froh, hier zu sein, und das rechtzeitig. Mein Flug aus Baltimore hatte Verspätung, und die Schlange am Mietwagenverleih war lang. Obwohl ich nicht als Letzter eingetroffen bin, ist die Kirche bereits mehr als halb voll, und ich suche mir einen Platz in der drittletzten Reihe, schleiche mich möglichst unauffällig hinein. In den Bänken vor mir sitzen lauter Frauen mit Hüten, wie man sie vom Kentucky Derby kennt, extravagante Kreationen aus Schleifen und Blumen, die Ziegen vermutlich schmackhaft fänden. Das bringt mich zum Lächeln, es ist eine Erinnerung daran, dass es in den Südstaaten immer wieder Momente gibt, in denen man in eine offenbar sonst nirgendwo existierende Welt eintauchen kann.
Wegen der Blumen wandern meine Gedanken zu Bienen. Bienen gehören zu meinem Leben, seit ich denken kann. Sie sind bemerkenswerte und wundervolle Wesen, für mich unendlich interessant. Im Moment betreue ich über ein Dutzend Stöcke, was weniger Arbeit bedeutet, als man sich vielleicht vorstellt, und mir geht durch den Kopf, wie nachhaltig die Bienen für uns alle sorgen. Ohne sie wäre menschliches Leben praktisch unmöglich, da wir für einen Großteil unserer Nahrungsmittelproduktion auf sie angewiesen sind.
Diesem Konzept wohnt etwas Unglaubliches inne, nämlich, dass das Leben, wie wir es kennen, von etwas so Einfachem abhängt wie dem Weg einer Biene von einer Pflanze zur nächsten. Es macht mich glauben, dass mein Hobby wichtig für das große Ganze ist, und gleichzeitig erkenne ich, dass die Bienenstöcke mich auch hierhergeführt haben, in diese Kleinstadt, weit entfernt von meiner Heimat. Natürlich handelt meine Geschichte – wie jede gute Geschichte – auch von Ereignissen und Umständen und anderen Menschen, einschließlich zweier alter Herren, die gern vor einem Gemischtwarenladen in North Carolina in Schaukelstühlen saßen. Vor allem ist es die Geschichte zweier unterschiedlicher Frauen, von denen eine damals eigentlich fast noch ein Mädchen war.
Mir fällt oft auf, dass andere dazu neigen, sich in ihren Geschichten als den Star darzustellen. Wahrscheinlich tappe ich in die gleiche Falle, allerdings möchte ich vorab darauf hinweisen, dass die meisten der Geschehnisse mir immer noch als Zufälle erscheinen; bitte denken Sie beim Lesen daran, dass ich mich nicht im Geringsten als Helden betrachte.
Was den Ausgang der Ereignisse betrifft, ist diese Hochzeit vermutlich eine Art Coda. Vor fünf Jahren hätte ich nur schwerlich einschätzen können, ob das Ende dieser miteinander verwobenen Vorgänge ein freudiges, tragisches oder bittersüßes werden würde. Und jetzt? Offen gestanden bin ich immer noch unsicher, da ich mich frage, ob die Geschichte auf eine verschlungene Art und Weise genau dort wieder aufgenommen wird, wo sie unterbrochen wurde.
Um zu verstehen, was ich damit meine, müssen Sie eine Zeitreise mit mir unternehmen, eine Welt besuchen, die trotz allem, was in den dazwischenliegenden Jahren passiert ist, mir immer noch zum Greifen nah erscheint.
Kapitel 1
2014
Zum ersten Mal bemerkte ich die junge Frau, als sie am Tag nach meinem Einzug an meinem Haus vorbeilief. Im Laufe der nächsten eineinhalb Monate schlurfte sie mehrmals pro Woche durch die Straße, mit gesenktem Kopf und hochgezogenen Schultern. Lange sagte keiner von uns ein Wort zum anderen.
Ich nahm an, dass sie noch keine zwanzig war – ihre Haltung ließ darauf schließen, dass sie mit der Doppellast von niedrigem Selbstwertgefühl und Zorn auf die Welt zu kämpfen hatte –, aber mit meinen zweiunddreißig war ich inzwischen in einem Alter, in dem ich das nicht mehr gut einschätzen konnte. Abgesehen davon, dass sie lange braune Haare und weit auseinanderstehende Augen hatte, wusste ich über sie nur, dass sie in der Wohnwagensiedlung am Ende der Straße lebte und gern zu Fuß ging. Besser gesagt wahrscheinlich zu Fuß gehen musste, weil sie kein Auto besaß.
Der Aprilhimmel war klar, die Temperatur lag um die zwanzig Grad, bei ausreichend Brise, dass der Duft von Blumen herangetragen wurde. Die Hartriegel und Azaleen im Vorgarten waren mehr oder weniger über Nacht voll erblüht und werteten nun die Kiesstraße vor dem Haus meines Großvaters bei New Bern, North Carolina, auf, das ich kürzlich geerbt hatte.
Und ich, Trevor Benson, rekonvaleszierender Arzt und kriegsversehrter Veteran, schüttelte gerade Mottenkugeln aus einer Schachtel vor die Veranda, missmutig über den bisherigen Verlauf meines Vormittags. Das Problem an Arbeiten im und um das Haus war, dass man nie genau wusste, wann man fertig war, da es immer noch mehr zu tun gab. Oder ob es überhaupt lohnte, den alten Kasten wieder in Schuss zu bringen.
Das Haus – den Begriff verwende ich im weiteren Sinne – machte äußerlich nicht viel her, und die Jahre waren nicht spurlos daran vorbeigegangen. Mein Großvater hatte es selbst gebaut, nachdem er aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt war, und obwohl er ein guter Handwerker war, hatte er nicht viel Talent für Design besessen. Es war ein Quader mit einer Veranda vorn und einer Terrasse hinten, zwei Schlafzimmern, Küche, Wohnzimmer und zwei Bädern. Die Zedernfassade war zu einem gräulichen Silber verblasst, passend zu den Haaren meines Großvaters. Das Dach war geflickt, die Fenster undicht und der Küchenboden mittlerweile so schräg, dass verschüttete Flüssigkeit in einem Rinnsal zur Terrassentür floss. Ich konnte mir gut vorstellen, dass es meinem Großvater, der die letzten dreißig Jahre seines Lebens allein dort gewohnt hatte, das Putzen erleichtert hatte.
Das Grundstück dagegen war etwas ganz Besonderes. Es umfasste knapp fünfundzwanzigtausend Quadratmeter, mit einer uralten, etwas schiefen Scheune und einem Imkerschuppen, in dem mein Großvater seinen Honig erntete, und es war übersät von so ungefähr jeder der Menschheit bekannten blühenden Pflanze, einschließlich Klee und Wildblumen. Den gesamten Frühling und Sommer hindurch ähnelte es einem bodennahen Feuerwerk. Außerdem lag es am Brices Creek, in dem dunkles Wasser so langsam floss, dass es den Himmel oft wie ein Spiegel reflektierte. Sonnenuntergänge verwandelten den Fluss in ein wildes Farbenspiel von Dunkelrot und Orange und Gelb, weil die schwindenden Strahlen das von den Ästen hängende Louisianamoos durchdrangen.
Die Honigbienen liebten den Garten, was auch die Absicht meines Großvaters gewesen war. Ich bin ziemlich sicher, dass er Bienen lieber mochte als Menschen. Auf dem Grundstück verteilt standen etwa zwanzig Stöcke; er war zeit seines Lebens Hobby-Imker gewesen, und oft fiel mir auf, dass diese Stöcke besser gepflegt waren als das Haus und die Scheune. Von Weitem hatte ich ein paarmal nach ihnen gesehen, und die Völker waren, das konnte ich feststellen, gesund.
Momentan vermehrten sie sich rasch, wie immer im Frühling – ich hörte sie tatsächlich schwirren, wenn ich horchte –, und daher überließ ich sie sich selbst. Stattdessen verbrachte ich den Großteil meiner Zeit damit, das Haus wieder bewohnbar zu machen. Ich räumte die Schränke aus, stellte ein paar Gläser Honig beiseite und warf einen Karton alter Cracker, ein halb volles Glas Erdnussbutter, ein fast leeres Marmeladenglas und eine Tüte verschrumpelter Äpfel weg. Die Schubladen waren randvoll mit abgelaufenen Coupons, halb abgebrannten Kerzen, Magneten und nicht mehr funktionierenden Stiften, was alles in den Müll wanderte. Der Kühlschrank war praktisch leer und eigenartig sauber, ohne die verschimmelten Reste oder widerlichen Gerüche, mit denen ich gerechnet hatte. Ich schaffte eine Tonne Trödel nach draußen – die meisten Möbel waren ein halbes Jahrhundert alt, und mein Großvater war ein latenter Messie gewesen – und beauftragte dann diverse Handwerker für die schwierigeren Arbeiten. Eines der Bäder ließ ich renovieren, den defekten Wasserhahn in der Küche reparieren, die Fußböden abschleifen und beizen, die Wände streichen und die Hintertür ersetzen. Die alte hatte einen Riss am Türpfosten, die Klinke hing heraus, und das Loch war mit einem Brett zugenagelt. Nachdem das Haus noch von einer Putzkolonne von oben bis unten gereinigt worden war, richtete ich das WLAN ein und bestellte Möbel für Wohn- und Schlafzimmer wie auch einen neuen Fernseher. Der meines Großvaters besaß noch eine Zimmerantenne und hatte die Größe einer Schatztruhe. Da die Heilsarmee die gebrauchten Möbel nicht annahm, trotz meines Einwands, man könne sie als Antiquitäten betrachten, landete alles auf der Deponie.
Veranda und Terrasse waren allerdings in relativ gutem Zustand, und dort hielt ich mich während der meisten Vormittage und Abende auf. Weshalb ich auch das mit den Mottenkugeln angefangen hatte. Frühling in den Südstaaten hieß nicht nur Blumen und Honigbienen und hübsche Sonnenuntergänge, vor allem nicht, wenn man an einem Fluss praktisch in der Wildnis wohnte – wegen des ungewöhnlich warmen Wetters in letzter Zeit waren die ersten Schlangen aus ihrer Winterruhe erwacht. Als ich an jenem Morgen mit meinem Kaffee nach draußen spaziert war, hatte ich eine große Schlange auf der Terrasse entdeckt. Vor lauter Schreck hatte ich mir den halben Kaffee aufs Hemd gekippt und war hastig zurück ins Haus geflohen.
Ich hatte keine Ahnung, ob die Schlange giftig oder welche Art es gewesen war. Ich war kein Schlangenexperte. Aber im Gegensatz zu anderen Leuten, meinem Großvater zum Beispiel, wollte ich sie auch nicht töten. Sie sollte sich nur von meinem Haus fernhalten und da hinten bleiben. Ich wusste, dass Schlangen Nützliches taten wie Mäuse jagen, die ich nachts an den Mauern entlanghuschen hörte. Das Geräusch war mir unheimlich; obwohl ich als Kind jeden Sommer in diesem Haus verbracht hatte, war ich nicht ans Landleben gewöhnt. Ich hatte mich immer eher als Stadtmenschen betrachtet, was ich auch gewesen war, bis zu der Explosion, die nicht nur meine ganze Welt, sondern auch mich in die Luft jagte. Weshalb ich mich auch in Rekonvaleszenz befand, aber dazu später.
Vorerst zurück zu der Schlange. Während ich mir ein frisches Hemd anzog, fiel mir ein, dass mein Großvater auf Mottenkugeln geschworen hatte. Er war davon überzeugt gewesen, dass Mottenkugeln magische Kräfte besaßen, um alle möglichen Tiere zu vertreiben, Fledermäuse, Nager, Käfer und Schlangen, und hatte daher das Zeug kistenweise gekauft. In der Scheune hatte ich gleich nach meiner Ankunft diverse Behälter entdeckt, und da ich davon ausging, dass mein Großvater nicht dumm gewesen war, hatte ich mir jetzt eine Packung geholt und verteilte die Kugeln großzügig um das Haus herum, zuerst hinten und seitlich, schließlich vorn.
Da entdeckte ich erneut die junge Frau auf der Straße. Sie trug Jeans und T-Shirt, und als ich den Kopf hob, muss sie meine Augen auf sich gespürt haben, denn unsere Blicke trafen sich. Sie lächelte nicht, winkte auch nicht, zog nur den Kopf ein, als hoffte sie, mich dadurch nicht grüßen zu müssen.
Mit einem Achselzucken machte ich mich wieder an die Arbeit, falls man Mottenkugeln auf den Boden zu werfen überhaupt als Arbeit bezeichnen konnte. Gleichzeitig musste ich an die Wohnwagensiedlung denken, in der sie lebte. Sie lag am Ende der Straße, etwa eineinhalb Kilometer entfernt. Aus Neugier war ich zu Anfang einmal dorthin gelaufen. Die Siedlung war erst nach meinem letzten Besuch entstanden, und ich wollte mir nur mal die Veränderungen ansehen. Mein erster Gedanke war, dass im Vergleich dazu das Haus meines Großvaters wie der Tadsch Mahal aussah. Sechs oder sieben uralte und klapprige Wohnwagen wirkten, als wären sie wahllos auf ein Stück Brachland geworfen worden. In der hinteren Ecke standen die Überreste eines weiteren, der in Brand geraten und von dem nur die verrußte, angeschmolzene Außenhaut übrig war. Zwischen den Wohnwagen hingen zwischen schiefen Pfosten einige Wäscheleinen. Dürre Hühner trippelten pickend über einen Hinderniskurs aus aufgebockten Autos und rostigen Haushaltsgeräten und wichen einem grimmigen Pitbull aus, der an einer abgefallenen Stoßstange festgebunden war. Der Hund hatte ein riesiges Gebiss und bellte mich so wild an, dass ihm Geifer aus dem schäumenden Maul spritzte. Kein liebes Hündchen, hatte ich gedacht und mich gefragt, warum irgendjemand an einem solchen Ort leben wollte. Aber ich kannte natürlich die Antwort. Auf dem Heimweg empfand ich Mitleid mit den Bewohnern und schalt mich innerlich dafür, so ein Snob zu sein, denn ich wusste, dass ich mehr Glück als die meisten anderen gehabt hatte, zumindest in Bezug auf Geld.
»Wohnen Sie hier?«, hörte ich jetzt eine Stimme.
Als ich aufsah, stand die junge Frau da. Sie hatte kehrtgemacht und war ein paar Meter vor mir stehen geblieben. Ganz eindeutig war sie darauf bedacht, Abstand zu halten, und gleichzeitig nah genug, dass ich die hellen Sommersprossen auf ihren sehr blassen, beinahe durchsichtigen Wangen erkennen konnte. An ihren Armen bemerkte ich einige blaue Flecke, als hätte sie sich gestoßen. Sie war nicht sonderlich hübsch und strahlte etwas Unfertiges aus, was mich wieder denken ließ, dass sie eigentlich noch ein Mädchen war. Ihr misstrauischer Blick ließ vermuten, dass sie wegrennen würde, sollte ich auch nur die kleinste Bewegung auf sie zu machen.
»Jetzt ja.« Ich lächelte. »Aber wie lange, weiß ich noch nicht.«
»Der alte Mann ist gestorben. Der früher hier gewohnt hat. Er hieß Carl.«
»Das weiß ich. Er war mein Großvater.«
»Ach so.« Sie schob eine Hand in die Gesäßtasche. »Er hat mir Honig geschenkt.«
»Das kann ich mir gut vorstellen.« Ich war mir nicht sicher, ob es stimmte, aber ich fand, das war die richtige Antwort.
»Er hat gern im Trading Post gegessen«, sagte sie. »Er war immer nett.«
Bei Slow Jim’s Trading Post handelte es sich um einen dieser maroden Gemischtwarenläden, wie sie in den Südstaaten allgegenwärtig waren, und es gab ihn schon länger, als ich auf der Welt war. Mein Großvater ging bei jedem meiner Besuche mit mir dorthin. Das Geschäft war so groß wie eine geräumige Doppelgarage, und es gab dort alles, von Benzin über Milch, Eier, Angelzubehör und lebendigen Ködern bis hin zu Autoteilen. Draußen standen altmodische Zapfsäulen – keine Kreditkartenzahlung – und ein Imbiss. Einmal fand ich eine Tüte Plastik-Spielzeugsoldaten eingeklemmt zwischen Marshmallows und Angelhaken. Bei den in Regalen oder an den Wänden angebotenen Waren war kein System zu erkennen, aber in meinen Augen war es immer einer der tollsten Läden aller Zeiten gewesen.
»Arbeiten Sie dort?«
Sie nickte und zeigte auf die Schachtel. »Warum legen Sie Mottenkugeln draußen aus?«
Jetzt erst fiel mir auf, dass ich sie noch in der Hand hielt.
»Heute Morgen war eine Schlange auf der Terrasse. Ich hab gehört, dass Mottenkugeln die vertreiben.«
Sie schob die Lippen vor und trat einen Schritt rückwärts. »Na dann. Ich wollte nur wissen, ob Sie jetzt da wohnen.«
»Ich heiße übrigens Trevor Benson.«
Sie starrte mich an. Nahm sichtlich ihren Mut zusammen, um das Offensichtliche zu fragen.
»Was ist mit Ihrem Gesicht passiert?«
Ich wusste, dass sie die dünne Narbe meinte, die von meinem Haaransatz bis zum Kinn verlief, was meinen Eindruck verstärkte, dass sie noch ziemlich jung war. Erwachsene sprachen mich normalerweise nicht darauf an, sondern taten, als bemerkten sie nichts. »Mörsergranate in Afghanistan. Vor ein paar Jahren.«
»Aha.« Sie rieb sich mit dem Handrücken die Nase. »Hat das wehgetan?«
»Ja.«
»Aha«, sagte sie noch einmal. »Dann gehe ich wohl mal.«
»Ist gut.«
Nach ein paar Schritten drehte sie sich plötzlich noch einmal um. »Das wird nicht funktionieren!«, rief sie.
»Was denn?«
»Das mit den Mottenkugeln. Den Schlangen sind die piepegal.«
»Wissen Sie das sicher?«
»Das weiß jeder.«
Sag das meinem Großvater, dachte ich. »Und was soll ich sonst tun? Wenn ich keine Schlangen auf der Terrasse haben will?«
Sie überlegte offenbar. »Vielleicht sollten Sie irgendwo wohnen, wo es keine Schlangen gibt.«
Darüber musste ich lachen. Sie war seltsam, ganz eindeutig, aber ich stellte fest, dass ich zum ersten Mal lachte, seit ich hierhergezogen war. Vielleicht zum ersten Mal seit Monaten.
»Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen.«
Ich sah ihr nach, überrascht, als sie sich langsam einmal im Kreis drehte. »Ich heiße Callie!«, rief sie.
»Hat mich gefreut, Callie.«
Als sie schließlich hinter den Azaleen aus meinem Blickfeld verschwand, war ich unschlüssig, ob ich weiter Mottenkugeln auslegen sollte. Ich hatte keine Ahnung, ob Callie recht hatte, doch letzten Endes beschloss ich, für diesen Tag aufzuhören. Ich hatte Lust auf Limonade und wollte mich auf die Terrasse setzen und entspannen, und wenn auch nur, weil mein Psychiater mir riet, mich zu entspannen, solange ich noch Zeit hatte.
Er sagte, es helfe, Die Dunkelheit abzuwehren.
*
Mein Psychiater benutzte gern blumige Ausdrücke wie Die Dunkelheit zur Beschreibung von PTBS, also Posttraumatischer Belastungsstörung. Als ich ihn nach dem Grund fragte, erklärte er, jeder Patient sei anders, und es gehöre zu seinem Job, Worte zu finden, die Stimmung und Gefühle des Betreffenden so widerspiegelten, dass er auf den mühsamen Pfad der Genesung geführt werde. Seit er mich behandelte, hatte er die PTBS schon als innerer Aufruhr, Probleme, Kampf, Schmetterlingseffekt, emotionale Dysregulation, Übererregbarkeit und eben Die Dunkelheit bezeichnet. Das hielt unsere Sitzungen interessant, und ich musste zugeben, dass Dunkelheit meine Empfindungen so zutreffend beschrieb wie jeder andere dieser Begriffe. Nach der Explosion war meine Stimmung tatsächlich sehr lange dunkel, so schwarz wie der Nachthimmel ohne Sterne und Mond, selbst wenn mir nicht ganz bewusst war, warum. Anfangs stritt ich die PTBS störrisch ab – wobei ich immer schon störrisch war.
Um es ganz offen zu sagen, meine Wut, die Depression und die Schlafstörungen leuchteten mir damals absolut ein. Jeder Blick in den Spiegel erinnerte mich an das, was am 9. September 2011 am Flughafen Kandahar passiert war, als eine Mörsergranate neben dem Eingang des Krankenhauses, in dem ich arbeitete, einschlug – nur Sekunden, nachdem ich das Gebäude verlassen hatte. Seitdem ist der Blick in den Spiegel in mehrfacher Hinsicht nicht mehr derselbe; ich bin nämlich auf dem rechten Auge blind, was bedeutet, mir fehlt die Tiefenwahrnehmung. Mich selbst zu betrachten kommt mir ein wenig vor, wie Fische auf einem alten Bildschirmschoner zu sehen, fast real, aber nicht ganz. Und selbst wenn ich mich damit abfinden könnte, springen meine anderen Wunden so ins Auge wie eine einsame Flagge auf dem Gipfel des Mount Everest. Die Narbe im Gesicht erwähnte ich ja bereits, aber von den Splittern ähnelt mein Oberkörper einer Kraterlandschaft wie auf dem Mond. Der kleine und der Ringfinger meiner linken Hand wurden abgerissen – besonders bedauerlich, da ich Linkshänder bin –, und mein linkes Ohr habe ich ebenfalls eingebüßt. Ob Sie es glauben oder nicht, das war die Verletzung, die mich im Hinblick auf mein Äußeres am meisten störte. Ein menschlicher Kopf sieht mit fehlendem Ohr einfach nicht natürlich aus. Ich wirkte seltsam schief, dabei hatte ich vor diesem Moment meine Ohren überhaupt nie richtig zu schätzen gewusst. Wenn ich überhaupt daran dachte, dann nur im Zusammenhang mit Hören. Aber versuchen Sie mal, mit nur einem Ohr eine Sonnenbrille zu tragen, dann verstehen Sie, warum ich den Verlust schmerzlich spürte.
Dazu kamen noch die Rückgratverletzung, wegen der ich neu laufen lernen musste, und die pochenden Kopfschmerzen, die monatelang andauerten. Dies alles machte mich körperlich zu einem Wrack. Aber die Ärzte im Walter Reed flickten mich wieder zusammen. Also, weitgehend jedenfalls. Sobald ich wieder aufrecht stand, wurde ich in das Krankenhaus meiner alten Alma Mater, der Johns Hopkins University, verlegt, wo die kosmetischen Operationen durchgeführt wurden. Jetzt habe ich eine Ohrprothese – der selbst ich kaum ansehe, dass sie nicht echt ist, so gut gemacht ist sie –, und mein Auge erscheint normal, auch wenn es zu nichts zu gebrauchen ist. In Bezug auf die Finger konnte man wenig machen, die waren mittlerweile Dünger in Afghanistan, ein plastischer Chirurg reduzierte aber meine Gesichtsnarbe auf eine dünne, weiße Linie. Man bemerkt sie, aber es ist nicht, als würden kleine Kinder schreiend vor mir weglaufen. Ich rede mir gern ein, dass sie mir mehr Charakter verleiht, dass unter der Oberfläche des souveränen und einnehmenden Mannes, den man wahrnimmt, ein eindringlicher und mutiger existiert, der echte Gefahr er- und überlebt hat. Oder so was in der Art.
Dennoch wurde mit meinem Körper auch mein gesamtes Leben gesprengt, einschließlich meiner beruflichen Laufbahn. Ich wusste nicht, was ich mit mir oder meiner Zukunft anfangen, wie ich mit den Flashbacks, der Schlaflosigkeit, den Wutausbrüchen und all den anderen verrückten Symptomen der PTBS umgehen sollte. Es wurde immer schlimmer, bis ich den Tiefpunkt erreicht hatte, als ich nach einem viertägigen Dauerbesäufnis in meinem eigenen Erbrochenen aufwachte und endlich begriff, dass ich Hilfe brauchte.
Ich fand einen Psychiater namens Eric Bowen, der Experte für KVT und DVT war, also Kognitive und Dialektale Verhaltenstherapie. Im Wesentlichen konzentrieren sich beide Verfahren auf Verhaltensweisen, um die Gedanken und Gefühle der Betroffenen kontrollieren und steuern zu helfen. Wenn man sich ausgenutzt fühlt, muss man sich gerade hinstellen; wenn man sich durch eine komplizierte Aufgabe überfordert fühlt, versucht man, diese Empfindung durch etwas Leichteres abzuschwächen, was man auf jeden Fall kann, zum Beispiel den ersten einfachen Schritt gehen und im Anschluss den nächsten machbaren.
Es kostet viel Mühe, sein Verhalten zu verändern, und KVT und DVT haben noch viele andere Aspekte, doch nach und nach kam ich wieder ins Gleis. Damit einher gingen Zukunftsgedanken. Dr. Bowen und ich besprachen verschiedene berufliche Möglichkeiten, und letzten Endes stellte ich fest, dass mir das Praktizieren als Arzt fehlte. Also setzte ich mich mit der Johns Hopkins University in Verbindung und bewarb mich um eine weitere Facharztausbildung. Dieses Mal in Psychiatrie. Ich glaube, Dr. Bowen fühlte sich geschmeichelt. Der langen Rede kurzer Sinn: Strippen wurden gezogen – vielleicht, weil ich schon einmal dort studiert hatte, vielleicht, weil ich kriegsversehrt war – und Ausnahmen gewährt. Ich wurde angenommen, und meine Weiterbildung zum Psychiater sollte im Juli beginnen.
Nicht lange nach dem positiven Bescheid von der Johns Hopkins erfuhr ich, dass mein Großvater einen Schlaganfall erlitten hatte. Und zwar in Easley, South Carolina, einer Stadt, die ich ihn noch nie hatte erwähnen hören. Man riet mir dringend, schnell ins Krankenhaus zu kommen, da ihm nicht mehr viel Zeit bleibe.
Ich hatte keinerlei Vorstellung, was er dort gewollt hatte. Meines Wissens hatte er New Bern seit Jahren nicht verlassen. Als ich endlich bei ihm im Krankenhaus eintraf, konnte er kaum sprechen, nur mühsam stieß er einzelne Wörter hervor. Und selbst die waren schwer verständlich. Er sagte einige Dinge zu mir, Dinge, die mich verunsicherten, auch wenn sie keinen Sinn ergaben. Trotzdem konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass er mir etwas Wichtiges mitzuteilen versuchte, bevor er starb.
Als einziger verbliebener Angehöriger musste ich mich um die Beerdigung kümmern. Ich war sicher, dass er in New Bern begraben werden wollte. Daher ließ ich ihn in seine Heimatstadt überführen und organisierte eine kleine Trauerfeier, an der mehr Menschen teilnahmen, als ich erwartet hatte.
In der Zeit wanderte ich viel durch sein Haus und über das Grundstück und rang mit meiner Trauer und meinem schlechten Gewissen. Da meine Eltern mit ihrem eigenen Leben beschäftigt gewesen waren, hatte ich als Kind den Sommer meistens in New Bern verbracht, und ich vermisste meinen Großvater so sehr, dass es einem körperlichen Schmerz glich. Er war lustig gewesen, weise und gütig, und er hatte mir immer das Gefühl gegeben, älter und klüger zu sein, als ich es wirklich war. Mit acht durfte ich einmal an seiner Maiskolbenpfeife ziehen. Er brachte mir Fliegenfischen bei und ließ mich helfen, wann immer er einen Motor reparierte. Er lehrte mich alles über Bienen und Imkerei, und als ich ein Teenager wurde, sagte er, eines Tages werde ich eine Frau kennenlernen, die mein Leben für immer verändern werde. Als ich ihn fragte, woran ich merken würde, dass es die Richtige sei, zwinkerte er und erklärte, wenn ich nicht sicher sei, solle ich lieber weitersuchen.
Und dann hatte ich mir nach all dem, was seit Kandahar passiert war, in den letzten Jahren nicht die Zeit genommen, ihn zu besuchen. Ich wusste, dass er sich um mich sorgte, hatte ihm aber nichts von den Dämonen erzählen wollen, mit denen ich rang. Ach verdammt, es war schon schwer genug, mit Dr. Bowen über mein Leben zu sprechen, und obwohl ich wusste, dass mein Großvater mich nicht kritisieren würde, erschien es mir leichter, Abstand zu halten. Dass er mir nun genommen wurde, bevor ich Gelegenheit gehabt hatte, wieder in Beziehung zu ihm zu treten, war niederschmetternd. Und dann erfuhr ich auch noch unmittelbar nach der Beerdigung von einem Anwalt, dass ich den Besitz meines Großvaters geerbt hatte, sodass mir auf einmal ebenjenes Haus gehörte, in dem ich als Kind so viele prägende Sommer verbracht hatte. In den Wochen nach der Beerdigung dachte ich sehr viel über all das nach, was ich dem Mann, der mich so bedingungslos geliebt hatte, nicht mehr hatte sagen können.
Darüber hinaus gingen mir unablässig die merkwürdigen Dinge durch den Kopf, die er kurz vor seinem Tod gestammelt hatte, und ich grübelte, warum er überhaupt in Easley gewesen war. Hatte es etwas mit den Bienen zu tun? Wollte er einen alten Freund besuchen? Hatte er eine Freundin gehabt? Die Fragen ließen mir keine Ruhe. Ich sprach mit Dr. Bowen darüber, und er schlug vor, ich sollte mich um Antworten bemühen.
Die Feiertage gingen vorbei, und zu Beginn des neuen Jahres beauftragte ich einen Makler damit, meine Eigentumswohnung zu verkaufen, in dem Glauben, es werde Monate dauern. Aber siehe da, innerhalb von Tagen bekam ich ein Angebot und unterschrieb im Februar den Kaufvertrag. Da ich bald für die Facharztausbildung nach Baltimore ziehen musste, schien es mir unsinnig, für die Zwischenzeit noch eine Wohnung zu mieten. Und da ich das Haus meines Großvaters in New Bern hatte, dachte ich mir: Warum nicht?
So kam ich aus Pensacola heraus, konnte vielleicht den alten Kasten zum Verkauf vorbereiten. Mit etwas Glück fände ich sogar heraus, warum mein Großvater in Easley gewesen war und was um alles in der Welt er mir hatte mitteilen wollen.
*
Ich trank nicht wirklich eine Limonade auf der Terrasse. So hatte mein Großvater vielmehr sein Bierchen genannt, und als ich klein war, fand ich es immer irrsinnig aufregend, ihm eine Limonade aus dem Kühlschrank zu holen. Seltsamerweise stand auf der Flasche immer Budweiser.
Ich bevorzuge Yuengling, aus Amerikas ältester Brauerei. Auf der Marine-Akademie machte mich ein älterer Kommilitone damit bekannt, ein Ray Kowalski. Er stammte aus Pottsville, Pennsylvania, Stammsitz der Yuengling-Brauerei, und überzeugte mich davon, dass es kein besseres Bier gab. Interessanterweise war Ray außerdem der Sohn eines Bergarbeiters, und mein letzter Stand ist, dass er auf der USS Hawaii dient, einem Atom-U-Boot. Vermutlich hat er von seinem Vater gelernt, dass Sonnenlicht und frische Luft bei der Arbeit überbewertet sind.
Ich fragte mich, was meine Eltern wohl von meinem Leben dieser Tage gehalten hätten. Immerhin arbeitete ich seit über zwei Jahren nicht. Dad wäre mit ziemlicher Sicherheit entsetzt gewesen; er war die Sorte Vater, die bei einer Eins minus eine Predigt hielt, und enttäuscht, dass ich mich für die Marineakademie und gegen Georgetown und Yale entschied, wo er Jura studiert hatte. Jeden Tag stand er um fünf Uhr auf, las beim Kaffee die Washington Post und die New York Times und fuhr dann nach D. C., wo er als Lobbyist für die jeweilige Firma oder Branche arbeitete, die ihn gerade engagiert hatte. Er war ein kluger Kopf und aggressiver Verhandler, lebte dafür, Deals abzuschließen, und konnte aus dem Gedächtnis ausgiebig aus der Abgabenordnung zitieren. Als einer von sechs Partnern, die mehr als zweihundert Anwälte unter sich hatten, waren seine Wände mit Fotos geschmückt, die ihn mit drei unterschiedlichen Präsidenten, einem halben Dutzend Senatoren und unzähligen Kongressabgeordneten zeigten.
Mein Vater arbeitete nicht einfach nur; arbeiten war sein Hobby. Siebzig Stunden die Woche verbrachte er im Büro, und an den Wochenenden spielte er mit Mandanten und Politikern Golf. Einmal im Monat gab er bei uns zu Hause eine Cocktailparty für noch mehr Mandanten und Politiker. Abends zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, wo es immer dringende Telefonate zu erledigen, Schriftsätze zu schreiben oder Pläne zu schmieden gab. Die Vorstellung, mitten am Nachmittag in aller Ruhe ein Bier auf der Terrasse zu trinken, wäre ihm absurd erschienen, etwas für Drückeberger, nicht für einen Benson. In seinen Augen gab es nichts Schlimmeres als Drückeberger.
Obwohl nicht der fürsorgliche Typ, war er kein schlechter Vater gewesen. Und der Gerechtigkeit halber muss man sagen, dass meine Mutter ebenfalls nicht gerade das Kuchen backende, engagierte Elternbeiratsmitglied gewesen war. Als Neurochirurgin hatte sie häufig Bereitschaftsdienst und passte mit ihrer Leidenschaft für die Arbeit gut zu meinem Vater. Mein Großvater sagte immer, so sei sie aus der Packung gekommen, und das trotz ihrer kleinstädtischen Herkunft und des Umstands, dass keiner ihrer Eltern studiert hatte. Dennoch zweifelte ich nie an ihrer Liebe zu mir oder an der meines Vaters, auch wenn wir uns jeden Abend Essen liefern ließen und ich als Halbwüchsiger an mehr Cocktailpartys als Campingausflügen teilnahm.
Für Alexandria war unsere Familie jedenfalls nicht ungewöhnlich. Jeder auf meiner Elite-Privatschule hatte beruflich ehrgeizige und wohlhabende Eltern, und das Streben nach Spitzenleistungen und Karriere übertrug sich auf die Kinder. Herausragende Noten wurden erwartet, und selbst das reichte nicht. Der Nachwuchs sollte sich auch im Sport oder in der Musik oder beidem hervortun und noch dazu möglichst beliebt sein. Ich gestehe, dass auch ich mich davon anstecken ließ; auf der Highschool spürte ich das Bedürfnis, genau wie sie zu sein. Ich war mit allseits beliebten Mädchen zusammen, schloss als Zweitbester meines Jahrgangs ab, gehörte in der elften und zwölften Klasse zur Auswahl-Sportmannschaft meines Staates und spielte sehr gut Klavier. Auf der Marineakademie trat ich die gesamten vier Jahre im Fußballteam an, schloss mit den Hauptfächern Chemie und Mathe ab und schnitt im Zulassungstest für Medizin so gut ab, dass ich an der Johns Hopkins University angenommen wurde, was meine Mutter stolz machte.
Leider waren meine Eltern nicht dabei, als ich mein Zeugnis erhielt. Der Unfall war etwas, woran ich nicht gern dachte und worüber ich nicht gern sprach. Die meisten wussten nicht, wie sie reagieren sollten, das Gespräch geriet ins Stocken, und normalerweise fühlte ich mich danach schlechter, als wenn ich geschwiegen hätte.
Doch manchmal fragte ich mich, ob ich die Geschichte einfach noch nicht dem richtigen Menschen erzählt hatte – oder ob es diesen Menschen überhaupt gab. Irgendjemand musste doch in der Lage sein, sich einzufühlen, oder? Eins allerdings hatte ich gelernt, nämlich, dass das Leben sich selten so entwickelte, wie man erwartete.
Kapitel 2
Ich weiß, was Sie wahrscheinlich denken: Wie kommt jemand, der sich in den vergangenen Jahren selbst als geistigen und emotionalen Totalausfall betrachtet hat, auch nur auf die Idee, Psychiater zu werden? Wie kann ich jemandem helfen, wenn ich mein eigenes Leben kaum im Griff habe?
Gute Frage. Was die Antwort betrifft … ach, keine Ahnung. Vielleicht würde ich nie jemandem helfen können. Was ich wusste: Meine Optionen waren begrenzt. Alles, was mit Chirurgie zu tun hatte, fiel weg, wegen der Teilblindheit und der fehlenden Finger und so weiter, und weder an einer Hausarztpraxis noch an innerer Medizin hatte ich Interesse.
Natürlich würde ich lügen, wenn ich sagte, ich vermisse das Operieren nicht. Ich vermisste das Gefühl in den Händen nach dem Schrubben, das Schnalzen der Handschuhe beim Anziehen. Ich liebte es, Knochen und Bänder und Sehnen zu flicken und genau zu wissen, was ich da tat. In Kandahar hatte es einen ungefähr zwölfjährigen Jungen gegeben, der sich beim Sturz von einem Dach ein paar Jahre zuvor die Kniescheibe gebrochen hatte, und die Ärzte vor Ort hatten die Operation derart verpfuscht, dass er kaum laufen konnte. Ich musste das Knie ganz neu wieder aufbauen, und sechs Monate später, als der Junge zur Nachuntersuchung kam, joggte er auf mich zu.
Dieses Gefühl genoss ich – dass ich ihn geheilt, ihm ermöglicht hatte, ein normales Leben zu führen, und ich fragte mich, ob die Psychiatrie mir jemals dieselbe Befriedigung verschaffen würde.
Denn wer ist je wirklich geheilt, wenn es um geistige oder emotionale Gesundheit geht? Das Leben verläuft alles andere als geradlinig, und Hoffnungen und Träume verändern sich in den unterschiedlichen Phasen eines Menschen. Am Tag vorher hatte mich Dr. Bowen via Skype (wir sprachen uns jeden Montag) noch mal daran erinnert, dass wir alle immer unfertig waren und blieben.
Über all das sinnierte ich, als ich abends bei im Hintergrund plätschernder Radiomusik an meinem Grill stand. Die Sonne ging gerade unter und erleuchtete einen Kaleidoskop-Himmel, während ich das Rumpsteak wendete, das ich beim Metzger auf der anderen Seite der Stadt gekauft hatte. In der Küche warteten bereits ein Salat und eine Ofenkartoffel, aber wenn Sie jetzt glauben, ich wäre ein guter Koch, irren Sie sich. Ich habe einen schlichten Gaumen und kann ganz vernünftig grillen, aber das war es auch schon. Seit meinem Umzug nach New Bern hatte ich drei- oder viermal den alten Weber meines Großvaters mit Kohle angefeuert. Es machte mich wehmütig nach all den Sommern meiner Kindheit, in denen er und ich fast jeden Abend grillten.
Als das Steak fertig war, legte ich es auf meinen Teller, holte die anderen Sachen aus der Küche und setzte mich an den Tisch auf der Terrasse. Mittlerweile war es dunkel, im Haus brannte Licht, und das Mondlicht spiegelte sich im ruhigen Wasser von Brices Creek. Das Steak war perfekt, die Ofenkartoffel leider schon etwas kalt. Ich hätte sie ja kurz in die Mikrowelle gestellt, nur gab es keine. Zwar hatte ich das Haus bewohnbar gemacht, mich aber noch nicht entschieden, ob ich die Küche renovieren oder lieber das Dach erneuern oder die Fenster abdichten oder auch nur den schiefen Küchenboden ausbessern lassen sollte. Falls ich verkaufte, würde der neue Eigentümer das alte Haus vermutlich ohnehin abreißen, um ein neues bauen zu können. Man brauchte kein Maklergenie zu sein, um sich auszurechnen, dass das Grundstück den eigentlichen Wert darstellte.
Nach dem Essen trug ich den Teller in die Küche und stellte ihn ins Spülbecken. Mit einem Bier kehrte ich auf die Terrasse zurück, um noch etwas zu lesen. Ich hatte einen Stapel Lehrbücher über Psychiatrie dabei, die ich vor meinem Umzug nach Baltimore durcharbeiten wollte, über Themen von Psychopharmaka bis hin zu Nutzen und Schattenseiten von Hypnose. Je mehr ich las, desto klarer wurde mir, wie viel ich noch zu lernen hatte. Was das Pauken betraf, war ich etwas eingerostet; manchmal hatte ich das Gefühl, mein alter Kopf wollte nichts Neues mehr aufnehmen. Als ich das aber mal zu Dr. Bowen sagte, forderte er mich mehr oder minder auf, das Jammern sein zu lassen. Zumindest fasste ich es so auf.
Ich hatte es mir im Schaukelstuhl bequem gemacht, die Lampe eingeschaltet und gerade mit meiner Lektüre begonnen, als ich eine Stimme vor dem Haus zu hören glaubte. Ich stellte das Radio leiser, wartete kurz und vernahm sie erneut.
»Hallo?«
Mit dem Bier in der Hand stand ich auf und beugte mich an das Geländer. Ich spähte nach vorn in die Dunkelheit. »Ist da jemand?«
Einen Moment später trat eine Frau in Uniform seitlich des Hauses ins Licht. Genauer gesagt, in der Uniform eines Deputy des Sheriffs. Der Anblick überrumpelte mich. Meine Erfahrungen mit Gesetzeshütern hatten sich bis dahin auf Autobahnpolizisten beschränkt, von denen zwei mich in jüngeren Jahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen angehalten hatten. Trotz Einsichtigkeit und Höflichkeit meinerseits hatten beide mir einen Strafzettel ausgestellt, und seither machte mich der Anblick von Vertretern der Strafverfolgungsbehörden nervös. Selbst wenn ich nichts angestellt hatte.
Ich schwieg, da ich noch zu sehr damit beschäftigt war zu überlegen, was ein Deputy wohl von mir wollte, und gleichzeitig verarbeiten musste, dass es sich um eine Frau handelte. Nennen Sie mich sexistisch, aber ich hatte einfach noch nicht häufig mit weiblichen Polizeibeamten zu tun gehabt, vor allem hier unten im Süden.
»Entschuldigen Sie, dass ich so um das Haus herumkomme«, sagte sie schließlich, »ich habe geklopft, doch Sie haben mich wohl nicht gehört.« Ihr Auftreten war freundlich, aber professionell.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«
Ihr Blick huschte zum Grill und zurück zu mir.
»Ich hoffe, ich störe Sie nicht beim Essen.«
»Gar nicht.« Ich schüttelte den Kopf. »Bin gerade fertig.«
»Ah, gut. Und entschuldigen Sie noch mal, Mr …«
»Benson. Trevor Benson.«
»Ich wollte nur kurz fragen, ob Sie ein rechtmäßiger Bewohner dieses Hauses sind.«
Ich nickte, auch wenn mich die Formulierung etwas erstaunte. »Kann man so sagen. Es gehörte früher meinem Großvater, aber er ist gestorben und hat es mir hinterlassen.«
»Sie meinen Carl?«
»Kannten Sie ihn?«
»Ein wenig. Und mein herzliches Beileid. Er war ein netter Mann.«
»Danke. Verzeihung, und Ihr Name war noch mal …?«
»Masterson. Natalie Masterson.« Sie machte eine Pause, und ich hatte den Eindruck, dass sie mich eingehend musterte. »Carl war Ihr Großvater, sagten Sie?«
»Mütterlicherseits.«
»Ich glaube, er hat Sie mal erwähnt. Sie sind Chirurg, richtig? Bei der Navy?«
»Früher ja, jetzt nicht mehr.« Ich zögerte. »Tut mir leid, aber mir ist noch nicht ganz klar, warum Sie hier sind.«
»Ach so.« Sie deutete auf das Haus. »Ich habe gerade Schichtende und war in der Gegend, und weil ich Licht bemerkte, wollte ich mal nachsehen.«
»Darf ich kein Licht anhaben?«
»Doch, doch.« Sie lächelte. »Offensichtlich ist ja alles in Ordnung, und ich hätte Sie nicht belästigen sollen. Nur, vor ein paar Monaten, nach dem Tod Ihres Großvaters, gab es Hinweise, dass im Haus Licht brannte. Ich wusste, dass es eigentlich leer stand, deshalb habe ich nachgesehen. Und auch wenn ich mir nicht ganz sicher war, hatte ich den Eindruck, dass jemand hier gewesen war. Abgesehen von der Hintertür war zwar nichts beschädigt, aber ich hatte das Gefühl, ich sollte das Haus im Auge behalten. Deshalb fahre ich ab und zu vorbei, nur um mich zu vergewissern, dass niemand hier ist, der hier nicht hergehört. Obdachlose, Halbwüchsige, die Partys feiern, Junkies, die ein Meth-Labor betreiben. Was auch immer.«
»Gibt es so was hier häufig?«
»Nicht häufiger als anderswo, denke ich. Aber genug, um uns auf Trab zu halten.«
»Nur damit Sie Bescheid wissen, ich nehme keine Drogen.«
Sie zeigte auf die Flasche in meiner Hand. »Alkohol ist eine Droge.«
»Sogar Bier?«
Sie lächelte wieder, und ich schätzte, dass sie ein paar Jahre jünger war als ich. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem unordentlichen Dutt gebunden, und ihre Augen waren so türkisblau, dass man sie in Flaschen abfüllen und als Mundwasser hätte verkaufen können. Sie war attraktiv, und was noch besser war: Sie trug keinen Ehering.
»Kein Kommentar«, sagte sie schließlich.
»Möchten Sie reinkommen und sich im Haus umsehen?«
»Nein, nicht nötig. Ich bin nur froh, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss. Ich mochte Carl. Immer wenn er auf dem Bauernmarkt Honig verkauft hat, haben wir uns ein Weilchen unterhalten.«
Ich wusste noch, dass ich mit meinem Großvater oft samstags an einem Straßenstand gesessen hatte, aber an einen Bauernmarkt erinnerte ich mich nicht. Andererseits gab es in New Bern inzwischen viel mehr Restaurants und Geschäfte als früher, auch wenn es nach wie vor eine Kleinstadtatmosphäre besaß. Alexandria, nur einer von mehreren Vororten von Washington, D. C., hatte fünf- oder sechsmal so viele Einwohner. Doch selbst dort hätte man sich vermutlich nach Natalie Masterson umgedreht.
»Was können Sie mir über die möglicherweise ungebetenen Besucher sagen?«, fragte ich.
Eigentlich war mir das ganz egal, ich wollte sie nur nicht gern wieder gehen lassen.
»Nicht viel mehr als das, was ich Ihnen schon erzählt habe.«
»Könnten Sie vielleicht netterweise hier hoch kommen?« Ich zeigte auf mein Ohr. »Damit ich Sie besser hören kann. Ich wurde in Afghanistan von einer Mörsergranate getroffen.«
Ich hörte übrigens wunderbar; mein Innenohr war bei der Explosion nicht beschädigt worden, obwohl die Muschel abgerissen wurde. Es ist nur so, dass ich mir nicht zu gut bin, die Mitleidskarte auszuspielen, wenn es mir opportun erscheint.
Ich ging zu meinem Schaukelstuhl zurück, in der Hoffnung, sie fragte sich nicht, warum ich sie gerade noch problemlos hatte verstehen können. Im Terrassenlicht sah ich, dass sie meine Narbe beäugte, bevor sie dann doch die Treppe hinaufstieg. Als sie den anderen Schaukelstuhl erreichte, drehte sie ihn zu mir um und zog ihn gleichzeitig etwas zurück.
»Vielen Dank«, sagte ich.
Sie lächelte, nicht sonderlich herzlich, was mir verriet, dass sie durchaus einen Verdacht bezüglich meines Gehörs hegte und noch unentschlossen war, ob sie bleiben sollte. Aber doch breit genug, um ihre weißen und vollkommen geraden Zähne zu entblößen.
»Wie schon gesagt …«
»Darf ich Ihnen was anbieten?«
»Nein danke. Ich bin im Dienst, Mr Benson.«
»Nennen Sie mich doch Trevor. Und erzählen Sie bitte von Anfang an.«
Sie seufzte, und ich hätte schwören können, dass sie ansatzweise die Augen verdrehte.
»In der Zeit nach Carls Tod gab es eine Reihe von Gewittern. Viele Blitze, und in der Siedlung am Ende der Straße schlug einer in einem Wohnwagen ein. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, ich auch, und nachdem der Brand gelöscht war, erwähnte einer der Feuerwehrmänner, dass er gern auf der anderen Flussseite auf die Jagd geht. Es war nur Small Talk.«
Ich nickte und erinnerte mich an den verkohlten Wagen, der mir in meiner ersten Woche hier aufgefallen war.
»Jedenfalls bin ich dem Mann ein paar Wochen später zufällig noch mal begegnet. Da erzählte er mir, dass ihm im Haus Ihres Großvaters Licht aufgefallen sei, und zwar nicht nur ein, sondern zwei oder drei Mal. Als würde eine Kerze am Fenster vorbeigetragen. Weil er relativ weit entfernt stand, war er nicht sicher, ob er sich das nur eingebildet hat, aber da es mehrfach vorkam und er wusste, dass Carl gestorben war, wollte er es mal angesprochen haben.«
»Und wann soll das gewesen sein?«
»Im letzten Dezember, vielleicht so Mitte des Monats. Ein oder zwei Wochen lang war es richtig kalt, deshalb würde es mich nicht überraschen, wenn jemand eingebrochen wäre, um im Warmen zu sein. Als ich das nächste Mal in der Gegend war, bin ich vorbeigefahren und habe festgestellt, dass die Hintertür kaputt und die Klinke fast abgefallen war. Ich hab mich kurz drinnen umgesehen, aber das Haus war leer. Abgesehen von der Hintertür konnte ich keine Anzeichen dafür finden, dass jemand dort gewesen war. Kein Müll, die Betten waren gemacht, und soweit ich das beurteilen konnte, fehlte auch nichts. Aber …« Sie stockte mit einem Stirnrunzeln.
Ich trank einen Schluck Bier und wartete darauf, dass sie fortfuhr.
»In der Küche fand ich zwei Kerzen mit angebranntem Docht und zusätzlich noch welche in einer halb leeren Schachtel. Außerdem fiel mir auf, dass am Tisch eine Stelle abgewischt war, als hätte jemand dort gegessen. Und auch einer der Sessel im Wohnzimmer war staubfrei, als einziges der Möbelstücke, und das Beistelltischchen daneben war freigeräumt. Beweisen konnte ich natürlich nichts. Für den Fall der Fälle habe ich die Hintertür dann mit ein paar Brettern aus der Scheune vernagelt.«
»Vielen Dank dafür«, sagte ich.
Obwohl sie nickte, merkte ich ihr an, dass die Sache ihr immer noch keine Ruhe ließ. »Hat vielleicht irgendwas gefehlt, als Sie eingezogen sind?«
Ich dachte kurz nach und schüttelte dann den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. Wobei ich außer zu der Beerdigung im Oktober seit Jahren nicht hier war. Und jene Woche ist in meinem Gedächtnis eher schemenhaft.«
»War die Hintertür da noch intakt?«
»Ich bin vorn reingegangen, und ich bin sicher, dass ich alle Türen überprüft habe. Wenn die hintere kaputt gewesen wäre, hätte ich das bemerkt, glaube ich. Jedenfalls war ich auch auf der Terrasse, das weiß ich.«
»Wann sind Sie eingezogen?«
»Ende Februar.«
Das ließ sie kurz sacken. Ihr Blick huschte erneut zur Hintertür.
»Sie glauben, dass tatsächlich jemand eingebrochen ist, oder?«, fragte ich schließlich.
»Gut möglich. Allerdings geht in solchen Fällen normalerweise etwas zu Bruch, und es liegt Müll rum. Flaschen, Plastikverpackungen und so weiter. Landstreicher machen in der Regel nicht das Bett, bevor sie gehen.« Sie trommelte mit den Fingern auf die Schaukelstuhllehne. »Sind Sie sicher, dass nichts fehlte? Waffen? Elektronische Geräte? Hatte Ihr Großvater Bargeld im Haus?«
»Soweit ich weiß, hatte er weder nennenswert Geld noch viele Geräte. Und seine Waffe war im Schrank, als ich kam. Ist sie übrigens immer noch. Es ist eine kleine Schrotflinte, er hat damit Mäuse und Ratten verscheucht.«
»Das macht es noch seltsamer, denn üblicherweise sind Waffen das Erste, was gestohlen wird.«
»Was schließen Sie daraus?«
»Weiß ich noch nicht«, sagte sie. »Entweder war niemand hier, oder Sie hatten Besuch vom ordentlichsten und ehrlichsten Landstreicher aller Zeiten.«
»Muss ich mir Sorgen machen?«
»Haben Sie seit Ihrem Einzug irgendjemanden um das Grundstück schleichen gesehen oder gehört?«
»Nein. Und ich bin nachts häufig wach.«
»Schlafstörungen?«
»Öfter mal. Aber es wird besser.«
»Gut«, war alles, was sie dazu sagte. Sie strich sich die Uniformhose glatt. »Jetzt habe ich Ihnen aber wirklich genug Zeit gestohlen. Mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht berichten.«
»Danke, dass Sie extra vorbeigekommen sind. Und dass Sie die Tür repariert haben.«
»Eine richtige Reparatur war es ja nicht.«
»Ausreichend«, sagte ich. »Als ich ankam, war sie noch dicht. Wie lange dauert Ihre Schicht noch?«
Sie sah auf die Uhr. »Tja, ob Sie’s glauben oder nicht, sie ist jetzt vorbei.«
»Möchten Sie dann nicht vielleicht doch etwas trinken?«
»Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Ich muss noch fahren.«
»Wie Sie meinen. Aber ehe Sie gehen, und da Sie nicht mehr im Dienst sind und ich neu in der Stadt bin: Erzählen Sie mir doch, was ich über New Bern wissen sollte. Ich war, wie gesagt, länger nicht hier.«
Sie zog eine Augenbraue hoch. »Warum sollte ich das tun?«
»Ist die Polizei nicht mein Freund und Helfer? Betrachten Sie es als helfen. Wie meine Tür zu reparieren.« Ich probierte es mit meinem gewinnendsten Lächeln.
»Empfangskomitee zu sein gehört, glaube ich, nicht zu meinen Kernaufgaben«, gab sie trocken zurück.
Kann sein, dachte ich. Aber noch bist du nicht gegangen.
»Also gut«, sagte ich. »Dann erzählen Sie mir, warum Sie Sheriff werden wollten.«
Auf meine Frage hin sah sie mich an. Vielleicht zum ersten Mal richtig, und erneut war ich wie gebannt von ihrer Augenfarbe. Sie wirkte wie das Wasser der Karibik in einem Hochglanz-Reisemagazin.
»Ich bin kein Sheriff. Dazu muss man gewählt werden. Ich bin Deputy.«
»Weichen Sie meiner Frage aus?«
»Mich würde interessieren, warum Sie das wissen wollen.«
»Ich bin ein neugieriger Mensch. Und ich sollte doch zumindest etwas mehr über die Frau wissen, die mir geholfen hat.«
»Irgendwie bekomme ich den Eindruck, dass Sie Hintergedanken haben.«
Nun, du bist offenbar nicht nur hübsch, sondern auch klug. Betont unschuldig zuckte ich die Achseln.
Sie musterte mich, bevor sie antwortete. »Erzählen Sie mir doch erst mal mehr über sich.«
»Von mir aus. Was möchten Sie wissen?«
»Ich schätze mal, die Mörsergranate ist der Grund, dass Sie nicht mehr bei der Navy sind und nicht mehr als Arzt praktizieren?«
»Richtig. Die Granate schlug genau in dem Moment ein, als ich das Krankenhaus verließ, in dem ich arbeitete. Glückstreffer. Beziehungsweise für mich eher Unglückstreffer. Ziemlich schwere Verletzungen. Letzten Endes stufte die Navy mich als arbeitsunfähig ein und entließ mich.«
»Ganz schönes Pech.«
»Kann man wohl sagen.«
»Und warum sind Sie in New Bern?«
»Nur vorübergehend«, sagte ich. »Im Sommer ziehe ich nach Baltimore. Ich fange eine Facharztausbildung zum Psychiater an.«
»Ehrlich?«
»Ja! Stimmt was nicht mit Psychiatrie?«
»Nein, nein. Das hatte ich nur nicht erwartet.«
»Ich kann gut zuhören.«
»Das glaube ich Ihnen sofort«, sagte sie. »Aber warum Psychiatrie?«
»Ich möchte mit Veteranen arbeiten, die an PTBS leiden. Heutzutage gibt es da Bedarf, denke ich, besonders, da Soldaten vier oder fünf Einsätze in Kriegsgebieten haben. So was schüttelt nicht jeder einfach ab.«
Es machte den Anschein, als versuchte sie, in meiner Miene zu lesen. »Ist Ihnen das so ergangen?«
»Ja.«
Sie zögerte und beobachtete mich weiterhin eingehend. »War es schlimm?«
»Gar keine Frage«, sagte ich. »Furchtbar. Und das ist es immer noch ab und zu. Davon erzähle ich aber wahrscheinlich besser ein anderes Mal.«
»Ja, wahrscheinlich. Jetzt, wo ich das weiß, muss ich zugeben, dass ich falschlag. Vermutlich sollten Sie genau das machen. Wie lange dauert denn eine Weiterbildung zum Psychiater?«
»Fünf Jahre.«
»So was soll ganz schön hart sein, hab ich gehört.«
»Nicht schlimmer, als von einem Auto über die Straße geschleift zu werden.«
Zum ersten Mal lachte sie. »Ach, das schaffen Sie schon. Aber ich hoffe doch, dass Sie bis dahin Ihren Aufenthalt in unserer Stadt genießen. Hier lässt es sich angenehm leben, und es gibt viele nette Menschen.«
»Sind Sie in New Bern aufgewachsen?«
»Nein«, antwortete sie. »Ich komme aus einem echt kleinen Städtchen. Eigentlich ein Dorf. Darf ich fragen, was Sie mit dem Haus vorhaben? Wenn Sie wegziehen?«
»Warum? Hätten Sie Interesse, es zu kaufen?«
»Nein. Und ich bezweifle, dass ich es mir leisten könnte.« Sie strich sich eine Strähne aus den Augen. »Woher kommen Sie denn ursprünglich? Erzählen Sie mir doch noch ein bisschen von sich selbst.«
Erfreut über ihr Interesse berichtete ich ihr kurz von meiner Herkunft: meiner Kindheit in Alexandria, meinen Eltern, meinen Sommerferien in New Bern. Schule, College, Studium und Facharztausbildung. Meine Zeit bei der Navy. Alles mit dem Hauch von bescheidener Übertreibung, die Männer einsetzen, wenn sie eine schöne Frau beeindrucken möchten. Beim Zuhören zuckten ihre Augenbrauen mehr als ein Mal, aber für mich war schwer zu sagen, ob sie fasziniert oder amüsiert war.
»Dann sind Sie also ein Stadtkind.«
»Mitnichten«, widersprach ich. »Ich bin aus der Vorstadt.«
Ihre Mundwinkel wölbten sich leicht nach oben, wenn ich auch nicht deuten konnte, warum genau.
»Was ich nicht verstehe, ist, warum Sie auf die Marineakademie gegangen sind. Wenn Sie so ein glänzender Schüler waren und auch nach Yale und Georgetown hätten gehen können.«
Glänzend? Habe ich tatsächlich dieses Wort benutzt?
»Ich wollte mir beweisen, dass ich es ohne die Hilfe meiner Eltern schaffe. Finanziell, meine ich.«
»Aber sagten Sie nicht, Sie wären reich?«
Ach ja, ich erinnere mich dunkel, auch das erwähnt zu haben.
»Wohlhabend wäre wohl passender.«
»Dann hatte es also was mit Stolz zu tun?«
»Und dem Wunsch, unserem Land zu dienen.«
Sie nickte knapp, ohne den Blick von mir abzuwenden. »Gut.« Dann ergänzte sie: »Hier in der Gegend wohnen viele aktive Soldaten, wie Sie vermutlich wissen. In Cherry Point, in Camp Lejeune. Einige von ihnen waren in Afghanistan und im Irak.«
Ich nickte. »Während meiner Auslandsstationierung habe ich mit Ärzten und Pflegern aus jedem Teil des Landes gearbeitet, aus allen möglichen Spezialgebieten, und unendlich viel von ihnen gelernt. Und wir haben auch viel Gutes getan. Zum größten Teil haben wir Einheimische behandelt, von denen einige noch nie bei einem Arzt gewesen waren, bevor das Krankenhaus eröffnet wurde.«
Sie schwieg für einen Moment. In der Stille erklang ein Grillenkonzert, bevor ich ihre Stimme wieder hörte.
»Ich weiß nicht, ob ich das, was Sie gemacht haben, gekonnt hätte.«
Ich legte den Kopf schief. »Was genau meinen Sie damit?«
»Die Schrecken des Krieges jeden Tag zu erleben. Und zu wissen, dass es Menschen gibt, denen zu helfen nicht in Ihrer Macht liegt. Ich glaube nicht, dass ich damit zurechtgekommen wäre. Zumindest nicht auf Dauer.«
Es wirkte, als würde sie mir etwas Persönliches mitteilen, obwohl ich das Gleiche auch schon vorher gehört hatte, sowohl in Bezug auf die Armee als auch den Arztberuf im Allgemeinen. »Bestimmt haben Sie als Deputy auch schon Furchtbares gesehen.«
»Ja, das stimmt.«
»Und trotzdem machen Sie weiter.«
»Ja«, sagte sie. »Wobei ich mich immer wieder frage, wie lange ich das noch kann. Manchmal träume ich davon, einen Blumenladen zu eröffnen oder so.«
»Warum tun Sie es nicht?«
»Wer weiß? Eines Tages vielleicht.«
Wieder verstummte sie. Da ich spürte, dass sie in Gedanken abschweifte, unterbrach ich sie mit einer unbekümmerten Aufforderung. »Wenn Sie mir schon nicht erzählen wollen, was es Besonderes in der Stadt gibt, verraten Sie mir wenigstens Ihren Lieblingsort.«
»Ach, so oft bin ich nicht unterwegs«, wehrte sie ab. »Außer samstagmorgens auf dem Bauernmarkt in der Innenstadt. Aber falls Sie auf der Suche nach hervorragendem Honig sind, haben Sie wahrscheinlich kein Glück.«
»Hier befindet sich gewiss noch reichlich.«
»Wissen Sie das nicht genau?«
»Im Schrank stehen noch ein paar Gläser, aber im Imkerschuppen habe ich noch nicht nachgesehen. Bisher war ich zu sehr damit beschäftigt, mich um das Haus zu kümmern. Ich meine, ein Palast wie dieser hält sich nicht allein instand.«
Dieses Mal lächelte sie tatsächlich, wenn auch eine Spur widerstrebend. Sie deutete mit dem Kopf Richtung Steg. »Waren Sie schon mit dem Boot draußen?«