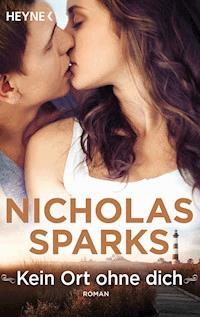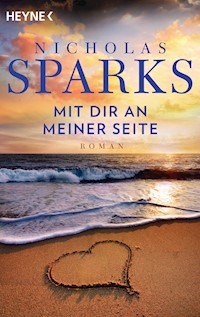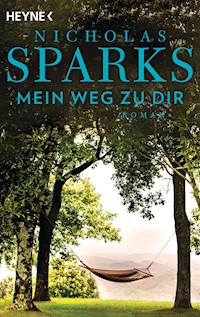9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Voller Erwartungen machen sich Nicholas Sparks und sein Bruder Micah 2003 auf eine Weltreise. Was als Urlaub beginnt, wird schon bald ein bewegendes Eintauchen in die Erinnerung – in die dramatische Geschichte ihrer Familie, die durch den tragischen Tod der Eltern und der Schwester allzu früh zerrissen wurde. Diese außergewöhnlichen Memoiren bieten einmalige Einblicke in das Leben des Bestsellerautors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Als Nicholas Sparks und sein Bruder Micah im Januar 2003 eine Weltreise antreten, blicken sie voller Erwartung auf einmalige Eindrücke und Erlebnisse. Doch die wertvolle gemeinsame Zeit wird weit mehr als nur ein Urlaub: Nicholas und Micah sind 37 und 38 Jahre alt, daheim in Amerika trennen sie Tausende Meilen, und sie sind die beiden einzigen lebenden Mitglieder ihrer Familie. So wird ihre Reise zu den Wundern der Welt auch eine Reise in die Erinnerung, und aus einem Reisebericht wird die bewegende Geschichte ihrer Familie, die eine tragische Serie von Schicksalsschlägen verkraften musste. Nicholas und Micah fühlen sich fern von zu Hause einander so nah wie nie zuvor, sie erinnern sich gemeinsam, geben sich Kraft – und genießen das Leben.
Mit seinen einzigartigen Memoiren gibt Nicholas Sparks einen außergewöhnlichen Einblick in seine Welt. Und er zeigt, wie er trotz Leid und Tod die Kraft fand, immer wieder aufzustehen und seinen Weg weiterzugehen. Ein Buch, so dramatisch und anrührend wie seine besten Romane.
»Für Sparks-Fans ein Muss und für alle anderen ein großartiges Leseerlebnis.« Booklist
Die Autoren
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt zusammen mit seiner Frau und fünf Kindern in North Carolina. Mit seinen insgesamt neun Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in 46 Ländern erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt, zuletzt Wie ein einziger Tag.
Micah Sparks ist ein Jahr älter als sein Bruder Nicholas und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Kalifornien.
Inhaltsverzeichnis
Für unsere Familie, in Liebe
Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren.
Sprüche Salomos 17, 17
PROLOG
Dieses Buch entstand, weil im Frühjahr 2002 ein Prospekt in meinen Briefkasten flatterte.
Es war ein typischer Tag im Hause Sparks. Den größten Teil des Morgens und des Nachmittags hatte ich damit verbracht, an meinem Roman Das Lächeln der Sterne zu arbeiten. Ich war aber nicht besonders gut vorangekommen und wollte den Tag einfach nur hinter mich bringen. Ich hatte längst nicht so viel geschrieben wie geplant und wusste beim besten Willen nicht, wie ich die Geschichte am nächsten Tag weiterführen sollte. Entsprechend schlecht war meine Laune, als ich gegen Abend den Computer endlich ausschaltete.
Mit einem Schriftsteller zusammenzuleben, ist nicht immer leicht. Ich weiß das so genau, weil meine Frau mich öfter darauf hinweist, und das tat sie auch an diesem Tag. Niemand hört so etwas gern. Man möchte sich sofort verteidigen, aber ich habe inzwischen begriffen, dass es nichts bringt, wenn ich mich rechtfertige und mit ihr darüber debattiere. Es hat keinen Sinn. Statt zu sagen »Stimmt doch gar nicht!«, ergreife ich lieber ihre Hände, blicke ihr tief in die Augen und sage die drei Zauberworte, die jede Frau am liebsten hört: »Du hast Recht, mein Schatz.«
Manche Leute glauben, nur weil ich ein relativ erfolgreicher Schriftsteller bin, fällt mir das Schreiben leicht. Sie stellen sich vor, ich notiere einfach alles, »was mir so einfällt«, arbeite ein paar Stunden am Tag, liege den Rest der Zeit entspannt mit meiner Frau am Swimmingpool und plane derweil mit ihr unsere nächste exotische Urlaubsreise.
In Wirklichkeit unterscheidet sich unser Leben kaum von dem einer durchschnittlichen Mittelschichtfamilie. Wir besitzen keinen Stab von Bediensteten, wir sind nicht ständig unterwegs. Zwar haben wir im Garten hinter dem Haus einen Pool mit mehreren Liegestühlen, das stimmt, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass diese Liegestühle je besonders intensiv genutzt worden wären. Weder meine Frau noch ich haben tagsüber genug Muße, um herumzusitzen und zu faulenzen. In meinem Fall liegt es an der Arbeit. Bei meiner Frau ist der Grund die Familie. Oder genauer gesagt: die Kinder.
Wir haben nämlich fünf Kinder, muss man wissen. Wenn wir Pioniere wären, fände kein Mensch diese Zahl besonders erstaunlich, aber heutzutage runzeln die Leute irritiert die Stirn. Letztes Jahr im Urlaub unterhielten meine Frau und ich uns mit einem anderen jungen Paar. Ein Thema ergab das andere, und schließlich landeten wir bei den Kindern. Die beiden hatten zwei Kinder, und nachdem sie uns gesagt hatten, wie diese heißen, rasselte meine Frau die Namen unserer Kinder herunter.
Einen Moment lang herrschte Schweigen, und man merkte, dass die andere Frau glaubte, sie hätte sich verhört.
»Sie haben fünf Kinder?«, fragte sie schließlich.
»Ja.«
Mitleidig lächelnd legte sie meiner Frau die Hand auf die Schulter. »Sind Sie verrückt?«
Unsere Söhne sind zwölf, zehn und vier, unsere Zwillingstöchter werden demnächst drei. Es gibt auf der Welt vieles, wovon ich nichts verstehe, aber eins weiß ich mit Sicherheit: Irgendwie schaffen es Kinder, die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Die beiden älteren wissen, dass ich mein Geld mit Romanschreiben verdiene, aber ich habe meine Zweifel, ob sie sich wirklich vorstellen können, was das bedeutet. Als zum Beispiel mein Zehnjähriger in der Schule nach dem Beruf seines Vaters gefragt wurde, warf er sich stolz in die Brust und erklärte: »Mein Vater sitzt den ganzen Tag am Computer und spielt!« Mein ältester Sohn hingegen sagt hin und wieder zu mir – und er meint es völlig ernst: »Weißt du, Schreiben ist kein Problem. Schwierig ist nur das Tippen!«
Ich arbeite zu Hause, wie viele andere Schriftsteller, aber da hört die Ähnlichkeit auch schon auf. Mein Arbeitszimmer ist kein unzugängliches Heiligtum im oberen Stockwerk, nein, die Tür führt direkt ins Wohnzimmer. Ich habe gelesen, dass manche Autoren absolute Ruhe benötigen, um sich konzentrieren zu können. Bei mir ist das zum Glück anders. Ich brauche diese Stille nicht, und das ist gut so, denn sonst hätte ich wahrscheinlich nie angefangen zu schreiben. Bei uns ist nämlich immer etwas los. Der Trubel beginnt praktisch in dem Moment, in dem meine Frau und ich morgens aufstehen, und Ruhe kehrt erst ein, wenn wir spät abends erschöpft in die Kissen sinken. Ein Tag bei uns zu Hause schafft selbst den stärksten Mann. Das können alle unsere Besucher bestätigen. Erstens platzen unsere Kinder schier vor Unternehmungslust. Jedes von ihnen verfügt über Unmengen von Energie, und wenn man diese mit fünf multipliziert, würde die Summe ausreichen, um ganz Cleveland mit Strom zu versorgen. Auf magische Weise tanken die Kinder beieinander Kraft, jeder profitiert vom anderen. Selbst unsere Hunde sind daran beteiligt, und oft hat man den Eindruck, als würde sogar das Haus bei diesem Energieaustausch mitmachen. Zum Standardprogramm eines ganz normalen Tages gehören: mindestens ein krankes Kind, Spielsachen, die im gesamten Wohnzimmer verstreut sind und wie von Zauberhand sofort wieder auftauchen, nachdem sie weggeräumt wurden, kläffende Hunde, lachende Kinder, ein pausenlos klingelndes Telefon, Berge von Post, Tränen, verschwundene Hausaufgaben, kaputt gegangene Geräte, Projektarbeiten für die Schule, die am nächsten Morgen abgegeben werden müssen und von denen die Eltern natürlich erst im letzten Moment erfahren. Baseballtraining, Gymnastik, Footballtraining, Taekwondo. Handwerker, die kommen und gehen und irgendetwas reparieren – oder auch nicht. Knallende Türen. Kinder, die den Flur entlangrennen und Gegenstände herumwerfen, Kinder, die sich gegenseitig ärgern, die etwas zu essen wollen oder schluchzen, weil sie hingefallen sind, Kinder, die einem auf den Schoß klettern und quengeln, weil sie SOFORT Zuwendung brauchen. Wenn meine Schwiegereltern wieder abreisen, nachdem sie uns eine Woche besucht haben, können sie jedes Mal gar nicht schnell genug zum Flughafen kommen. Sie haben dunkle Ringe unter den Augen und wirken wie benommen, als hätten sie gerade die Invasion in der Normandie überlebt. Statt »Auf Wiedersehen« zu sagen, schüttelt mein Schwiegervater immer nur den Kopf und flüstert: »Viel Glück. Das werdet ihr auch brauchen!«
Meine Frau nimmt das Chaos gelassen hin. Sie ist überhaupt ungeheuer geduldig und lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Die meiste Zeit genießt sie den Wirbel sogar, glaube ich. Meine Frau, das möchte ich noch hinzufügen, ist eine Heilige.
Entweder das – oder sie ist tatsächlich verrückt.
Ich bin für die Post verantwortlich. Jemand muss ja zum Briefkasten gehen, und irgendwie ergab es sich, dass mir diese Aufgabe zufiel.
Der Tag, an dem ich den Prospekt bekommen habe, war wie gesagt ein Tag wie jeder andere. Lexie, damals sechs Monate alt, hatte eine schwere Erkältung und wollte den ganzen Tag lang von meiner Frau umhergetragen werden. Miles hatte unseren Hund mit fluoreszierender Farbe angepinselt und führte ihn stolz vor, als hätte er eine tolle Leistung vollbracht. Ryan musste für eine Klassenarbeit lernen, hatte aber das Buch in der Schule liegen lassen und wollte das Problem dadurch lösen, dass er ausprobierte, wie viel Klopapier er die Toilette hinunterspülen konnte. Landon malte die Wände an – wie so oft –, und was Savannah machte, weiß ich nicht mehr, aber es war bestimmt etwas Außerplanmäßiges, denn mit ihren ebenfalls sechs Monaten hatte sie von ihren Geschwistern schon einiges gelernt. Dazu dröhnte der Fernseher, das Essen blubberte auf dem Herd, die Hunde bellten, das Telefon schrillte mal wieder, kurz, der allgemeine Lärmpegel hatte ein ohrenbetäubendes Niveau erreicht. Ich befürchtete, dass selbst meiner Frau in Kürze der Geduldsfaden reißen würde, Heiligenschein hin oder her. Also stieß ich mich mit meinem Stuhl vom Computertisch ab, atmete tief durch und stand auf. Dann ging ich ins Wohnzimmer, ließ meinen Blick über das Tohuwabohu schweifen, und mit meinem untrüglichen männlichen Instinkt wusste ich sofort, was zu tun war. Ich räusperte mich, lenkte dadurch für einen Moment die gesamte Aufmerksamkeit auf mich und verkündete mit ruhiger Stimme: »Ich seh mal nach, ob die Post schon da ist.«
Und schon war ich zur Tür hinaus.
Weil unser Haus ein Stück von der Straße zurückliegt, braucht man normalerweise fünf Minuten zum Briefkasten und zurück. Kaum hatte sich die Haustür hinter mir geschlossen, war das Chaos bereits vergessen. Ich schlenderte gemächlich und genoss die Stille.
Als ich zurückkam, sah ich, dass meine Frau die beiden Babys im Arm hielt und gleichzeitig versuchte, die zerkauten Kekskrümel wegzureiben, die ihr eins von ihnen aufs T-Shirt gespuckt hatte. Landon stand vor ihr und zupfte an ihrer Jeans, weil er irgendetwas von seiner Mutter wollte. Gleichzeitig half sie den beiden Älteren bei den Hausaufgaben. Mir wurde warm ums Herz vor Stolz, weil es ihr so mühelos gelang, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Ich hielt den Briefstapel hoch und rief: »Ich hab die Post geholt!«
Cat blickte auf. »Was würde ich nur ohne dich machen!«, sagte sie lächelnd.
»Aber das ist doch wohl das Mindeste, was ich tun kann – du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken.«
Wie alle anderen Leute bekomme ich jede Menge Werbemüll. Als Erstes musste ich also die wichtigen Briefe von den unwichtigen trennen. Brav bezahlte ich die Rechnungen, blätterte ein paar Zeitschriften durch, und als ich gerade den Rest in die Rundablage unter dem Schreibtisch werfen wollte, fiel mir eine Broschüre ins Auge, die ich ursprünglich als Junkmail klassifiziert hatte. Sie kam von der Organisation ehemaliger Studenten der University of Notre Dame und warb für eine »Reise in die Welten der Himmelsanbeter«. Der Untertitel lautete »Zwischen Himmel und Erde«, und die Reise sollte rund um den Globus gehen, drei Wochen lang, im Januar und Februar 2003.
Interessant, dachte ich und überflog den Text. Die Reise – in einem Privatjet, ganz schön nobel – führte zu den Ruinen der Maya in Guatemala, zu den Inka-Ruinen in Peru, den riesigen Steinfiguren auf den Osterinseln und zu den polynesischen Cook-Inseln. Ebenfalls auf dem Plan standen: ein Aufenthalt am Ayers Rock in Australien; Angkor Wat, die »Killing Fields« und das Tuol-Sleng Holocaust-Museum in Phnom Penh, Kambodscha; das Grabmal Tadsch Mahal und die Bergfestung Amber Fort in Indien; die Felsenkirchen in Lalibela, Äthiopien; das Hypogäum von Hal Saflieni und andere antike Tempel auf Malta. Und schließlich sollte es nach Tromsø in Norwegen gehen, eine Stadt rund fünfhundert Kilometer nördlich vom Polarkreis, wo man – sofern das Wetter es zuließ – das Nordlicht würde bewundern können.
Schon als Kind hatten mich alte Kulturen und ferne Länder fasziniert, und während ich die Beschreibungen der einzelnen Stationen las, dachte ich stets aufs Neue: »Dahin wollte ich schon immer mal fahren!« Dieses Programm bot die einmalige Gelegenheit, zu all den Orten zu reisen, die mich seit frühester Jugend beschäftigten. Mit einem abgrundtiefen Seufzer legte ich den Prospekt beiseite. Vielleicht irgendwann später …
Im Augenblick hatte ich dafür absolut keine Zeit. Drei Wochen ohne die Kinder? Ohne meine Frau? Ohne meine Arbeit?
Unmöglich! Hirnverbrannt, absurd! Ich brauchte gar nicht darüber nachzudenken. Weg damit! Ich schob die Broschüre unter den Stapel.
Das Problem war nur, dass mich der Gedanke an die Reise nicht losließ.
Eines steht fest: Ich bin Realist. Bisher hatte ich gedacht, dass Cat (so nenne ich Cathy oft) und ich es durchaus irgendwann mal schaffen würden, zum Tadsch Mahal und nach Angkor Wat zu reisen. Dass wir jedoch zu den Osterinseln, nach Äthiopien oder in den Dschungel von Guatemala fahren würden, hielt ich für eher unwahrscheinlich. Diese Orte waren so weit weg von allem, und außerdem gab es auf der Welt noch so viele andere Dinge zu sehen – da wusste ich, dass die Kategorie Vielleicht irgendwann später … gleichbedeutend war mit »am Sankt-Nimmerleins-Tag«.
Aber hier bot sich die Chance, alles in einem Schwung zu erledigen. Zehn Minuten später – nachdem der Lärm im Wohnzimmer genauso rätselhaft verstummt war, wie er begonnen hatte – stand ich mit meiner Frau in der Küche. Den Prospekt hatte ich auf die Arbeitsplatte gelegt, und wie ein kleiner Junge, der vom Sommerlager schwärmt, erzählte ich ihr von den Höhepunkten der Reise. Meine Frau, die sich längst an meine Schnapsideen gewöhnt hatte, hörte mir wie immer geduldig zu, und als ich fertig war, nickte sie.
»Mhm.«
»Ist das ein Ja-Mhm oder ein Nein-Mhm? Ich kann das bei dir bis heute nicht unterscheiden.«
»Keins von beidem. Ich habe mich nur gefragt, warum du mir diesen Prospekt zeigst. Für uns ist das doch auf keinen Fall machbar.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Aber irgendwie dachte ich, es würde dich interessieren.«
Meine Frau kennt mich besser als alle anderen Menschen auf der Welt, und sie spürte genau, dass mehr dahinter steckte.
»Mhm«, machte sie wieder.
Zwei Tage später unternahmen wir einen Spaziergang durch unser Wohnviertel. Unsere älteren Söhne gingen vor uns, die anderen drei saßen in ihren Buggys. Ich kam wieder auf das Thema Weltreise zu sprechen.
»Ich habe noch mal über den Prospekt nachgedacht«, sagte ich betont beiläufig.
»Welchen Prospekt?«
»Den über die Weltreise. Du weißt doch – ich hab ihn dir vorgestern gezeigt.«
»Und was hast du konkret gedacht?«
»Na ja …« Ich holte tief Luft. »Würdest du so was gern machen?«
Sie antwortete erst nach ein paar Schritten. »Natürlich würde ich das gern machen«, sagte sie. »Es klingt absolut verlockend, aber es ist unmöglich. Ich kann die Kinder nicht drei Wochen lang allein lassen. Was wäre, wenn etwas passieren würde? Nicht mal im äußersten Notfall könnten wir schnell zurückfahren. Wie oft muss man zum Beispiel das Flugzeug wechseln, um zu den Osterinseln zu kommen? Lexie und Savannah sind noch so klein, sie brauchen mich. Alle brauchen mich …« Sie verstummte für einen Moment. »Andere Mütter können so was vielleicht. Ich kann es nicht.«
Ich nickte. Im Grund hatte ich ihre Antwort schon im Voraus gekannt.
»Und wenn ich fahren würde?«
Sie warf mir einen kurzen Blick zu. Wegen meiner Arbeit war ich häufig unterwegs, zwei, drei Monate im Jahr auf Lesereisen, und das war für die Familie nicht einfach. Zwar bin ich nicht immer bereit, mich kopfüber ins allgemeine Kindergetümmel zu stürzen, aber völlig nutzlos und überflüssig bin ich im Alltag auch nicht. Cat hat viele Termine, derentwegen sie aus dem Haus geht: Sie verabredet sich mit ihren Freundinnen zum Frühstück, sie übernimmt ehrenamtliche Aufgaben in der Schule, sie geht ins Fitnessstudio, spielt mit ein paar Frauen Karten oder macht Besorgungen – wir wissen beide, dass sie das unbedingt braucht, damit ihr nicht die Decke auf den Kopf fällt. In solchen Situationen mausere ich mich dann zum allein erziehenden Vater. Aber während ich auf Reisen bin, wird es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich für sie, das Haus zu verlassen. Das ist nicht besonders gut für ihr Allgemeinbefinden.
Außerdem genießen es unsere Kinder, wenn wir beide anwesend sind. Solange ich weg bin, steigert sich das Chaos im Haus noch um ein Vielfaches – wie man sich mühelos vorstellen kann. Als müsste die durch meine Abwesenheit entstandene Lücke ausgefüllt werden. Daher brauche ich wohl kaum ausführlich zu erläutern, dass meine Frau diese Reisen nicht besonders schätzt. Sie weiß, dass sie zu meiner Arbeit gehören, und stellt sie nicht infrage, aber man könnte nicht behaupten, dass es ihr passt.
Deshalb hatte es mich einige Überwindung gekostet, diese Frage zu stellen.
»Ist es dir wirklich so wichtig?«, wollte sie wissen.
»Nein«, erwiderte ich ehrlich. »Wenn du dagegen bist, lass ich es sein. Aber Lust hätte ich schon.«
»Und würdest du allein reisen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich dachte an Micah.« Micah ist mein Bruder.
Eine Weile lang gingen wir schweigend weiter. Dann schaute Cat mir in die Augen und sagte: »Ich finde, das ist eine tolle Idee.«
Ich traute meinen Ohren nicht, aber sie meinte es ernst. Als wir von unserem Spaziergang zurückkamen, eilte ich gleich in mein Arbeitszimmer, um meinen Bruder in Kalifornien anzurufen.
Ich hörte das Telefon klingeln. Es klang weiter weg als bei anderen Leuten: Micah ging nie an seinen Festnetzapparat. Wenn ich mit ihm sprechen wollte, musste ich seine Handynummer wählen.
»Hallo, Nicky!«, rief er vergnügt. »Was gibt’s?«
Mein Bruder sieht am Display, wer anruft. Und er nennt mich immer noch so wie früher. Bis zur fünften Klasse hieß ich Nicky.
»Ich habe etwas gefunden, was dich bestimmt interessiert.«
»Schieß los!«
»Also, neulich habe ich einen Prospekt zugeschickt bekommen … ach, ich fall am besten gleich mit der Tür ins Haus: Ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest, im Januar mit mir eine Weltreise zu machen.«
»Was – eine Weltreise?«
Anhand der Broschüre schilderte ich ihm ausführlich die Highlights der Reise. Als ich fertig war, herrschte am anderen Ende der Leitung atemlose Stille.
»Ist das dein Ernst?«, fragte Micah schließlich. »Und Cat lässt dich gehen?«
»Ja – hat sie gesagt.« Ich zögerte. »Hör zu, ich weiß, das ist eine schwierige Entscheidung, die man nicht übers Knie brechen sollte, und du brauchst mir nicht sofort zu antworten. Ich wollte nur, dass du schon mal anfängst, darüber nachzudenken. Du musst es ja auch erst mit Christine besprechen. Drei Wochen sind eine lange Zeit.«
Christine war die Frau meines Bruders. Im Hintergrund hörte ich das niedliche Krähen ihrer neugeborenen Tochter Peyton.
»Sie findet das garantiert in Ordnung. Aber ich werde sie selbstverständlich fragen. Dann melde ich mich wieder.«
»Soll ich dir den Prospekt schicken?«
»Ja, klar – ich muss schließlich ganz genau wissen, wohin die Reise gehen soll, oder?«
»Ich schicke ihn heute noch ab«, sagte ich. »Und weißt du was, Micah?«
»Was?«
»Das wird die Reise unseres Lebens.«
»Das glaube ich auch, kleiner Bruder.« Ich konnte ihn genau vor mir sehen, sein breites Grinsen, seine blitzenden Augen. »Jede Wette.«
Wir verabschiedeten uns, und nachdem ich aufgelegt hatte, studierte ich die Familienfotos in meinem Arbeitszimmer. Es sind vor allem Bilder von meinen Kindern: als Babys, im Kindergarten, ein Weihnachtsfoto mit allen fünfen, das erst vor ein paar Monaten aufgenommen wurde. Daneben stand ein Porträt von Cathy. Spontan nahm ich es in die Hand. Dass sie zu solch einem riesigen Opfer bereit war!
Nein, begeistert war sie bestimmt nicht von der Vorstellung, dass ich drei Wochen fort sein würde und ihr nicht mit den Kindern helfen konnte. Sie konnte sich sicher etwas Schöneres vorstellen, als die ganze Last allein zu schultern, während ich um die Welt reiste.
Aber warum hatte sie dann zugestimmt?
Wie ich schon sagte – meine Frau versteht mich besser als irgendjemand auf der Welt. Sie wusste, dass mein Wunsch, diese Reise zu machen, nicht nur mit der Unternehmung selbst zusammenhing. Nein, viel wesentlicher war die Möglichkeit, mit meinem Bruder zu reisen.
Dieses Buch erzählt von zwei Brüdern.
Es ist die Geschichte von Micah und Nicholas. Und die Geschichte unserer Familie. Es ist eine Geschichte voller Tragik und Glück, voller Hoffnung und Hilfsbereitschaft. Es ist die Geschichte unserer Kindheit und Jugend, wie wir uns veränderten und verschiedene Wege einschlugen, uns aber doch immer näher kamen. Mit anderen Worten: Es ist die Geschichte zweier Reisen. Die eine Reise führte meinen Bruder und mich in ferne, unbekannte Welten, die zweite ist unsere Lebensreise, die uns zu guten Freunden werden ließ.
KAPITEL 1
Viele Geschichten beginnen damit, dass das Leben jemandem eine überraschende Lektion erteilt, und unsere Familiengeschichte bildet da keine Ausnahme. Aber ich will mich kurz fassen.
Am Anfang wurden wir gezeugt. Und die Lektion, die es dabei zu lernen gab, lautete, zumindest für meine katholische Mutter: »Denke immer daran, dass die Temperaturmethode nicht funktioniert, egal, was die Kirche behauptet.«
Als sie mir das eröffnete, war ich zwölf. »Soll das heißen, wir sind alle – Unfälle?«, fragte ich entsetzt.
»Ja. Alle miteinander.«
»Aber gute, stimmt’s?«
Sie lächelte. »Die allerbesten.«
Trotzdem war ich mir nicht sicher, was ich davon halten sollte. Einerseits schien meine Mutter es nicht zu bedauern, dass sie uns bekommen hatte. Andererseits tat es meinem Ego nicht gut, mich selbst als »Unfall« betrachten zu müssen. Hatte ich meine Existenz womöglich der Tatsache zu verdanken, dass meine Eltern ein Glas Sekt zu viel getrunken hatten? Allerdings begriff ich jetzt endlich, warum sie mit dem Kinderkriegen nicht länger gewartet hatten. Sie waren in ihrem Alter garantiert noch nicht reif dafür gewesen – vielleicht nicht einmal für eine Ehe.
Meine Eltern sind beide 1942 auf die Welt gekommen, das heißt, im Zweiten Weltkrieg. Meine beiden Großväter waren beim Militär. Der Großvater väterlicherseits war Berufsoffizier, mein Vater, Patrick Michael Sparks, zog als Kind von einer Militärbasis zur nächsten und wurde hauptsächlich von seiner Mutter erzogen. Er war der Älteste von neun Geschwistern und hochintelligent. Er besuchte ein Internat in England, ehe er einen Studienplatz an der Creighton University in Omaha, Nebraska, bekam. Dort lernte er meine Mom kennen, Jill Emma Marie Thoene.
Wie mein Vater war auch meine Mutter das älteste Kind in der Familie. Sie hatte drei jüngere Geschwister und wuchs vor allem in Nebraska auf, wo sie eine lebenslängliche Liebe zu Pferden entwickelte. Ihr Vater war Unternehmer und leitete im Laufe seines Lebens verschiedene Firmen. Zeitweilig führte er ein Kino in Lyons, einer winzigen Stadt mit ein paar Hundert Einwohnern, direkt an der Autobahnausfahrt, umgeben von lauter Farmen. Meine Mutter war damals ein Teenager, und wegen dieses Kinos musste sie aufs Internat gehen, behauptete sie später. Angeblich wurde sie nämlich dabei erwischt, wie sie dort mit einem Jungen herumknutschte. Als ich allerdings meine Großmutter deswegen fragte, bestritt sie diese Erklärung mit Vehemenz. »Deine Mutter war schon immer eine große Geschichtenerzählerin«, sagte sie. »Sie hat die unmöglichsten Sachen erfunden, nur um euch Kinder zu beeindrucken.«
»Warum habt ihr sie dann aufs Internat geschickt?«
»Wegen der vielen Morde«, antwortete meine Großmutter. »Damals sind in Lyons mehrere junge Mädchen umgebracht worden.«
Aha.
Jedenfalls besuchte meine Mom nach dem Internat ebenfalls die Creighton University, genau wie mein Dad, und ich vermute, die ähnlichen Lebenserfahrungen führten die beiden zusammen. Aber gleichgültig, warum – im zweiten Studienjahr verliebten sie sich ineinander und heirateten am 31. August 1963, noch vor ihrem letzten Collegejahr. Sie waren beide einundzwanzig.
Ein paar Monate später versagte die Temperaturmethode zum ersten Mal. Micah kam am 1. Dezember 1964 zur Welt. Aber meine Mutter weigerte sich offenbar, ihre Lektion zu lernen, denn im Frühjahr wurde sie schon wieder schwanger – ich folgte am 31. Dezember 1965. Als sich im darauf folgenden Frühjahr meine Schwester Dana ankündigte, beschloss Mutter dann doch, von nun an die Geburtenkontrolle selbst in die Hand zu nehmen.
Nach dem College-Examen wollte mein Vater an der University of Minnesota einen Master in Volkswirtschaft machen. Deshalb zog die Familie im Herbst 1966 in die Nähe von Watertown. Meine Schwester Dana hat genau wie ich am 31. Dezember Geburtstag, und meine Mutter blieb bei uns zu Hause, während mein Vater tagsüber seine Vorlesungen besuchte und zusätzlich abends als Barkeeper arbeitete.
Weil meine Eltern nicht viel Miete bezahlen konnten, wohnten wir einige Meilen außerhalb der Stadt in einem alten Farmgebäude, von dem Mutter steif und fest behauptete, es sei ein Geisterhaus. Jahre später erzählte sie mir, sie habe spät nachts ganz oft gespenstische Geräusche gehört – Schreie, Lachen, Geflüster –, aber immer, wenn sie aufstand, um nach uns zu sehen, sei alles verstummt.
Waren es tatsächlich Geister? Es ist eher anzunehmen, dass sie halluzinierte. Nicht, weil sie verrückt war – meine Mom ist der bodenständigste Mensch, den ich kenne –, sondern weil sie die ersten Ehejahre in einem Nebel der Erschöpfung verbracht haben muss. Ich meine nicht die Art von Erschöpfung, die man abschüttelt, wenn man ein paar Nächte richtig ausschlafen kann. Nein, ich meine die tiefe körperliche, geistige und emotionale Müdigkeit, die einen Menschen so aussehen lässt, als wäre er stundenlang am Ohrläppchen im Kreis herumgewirbelt worden und dann völlig desorientiert am Küchentisch gelandet. Moms Leben muss die Hölle gewesen sein. Sie war fünfundzwanzig und hockte mit drei schreienden Wickelkindern – damals verwendete man noch Stoffwindeln, wohlgemerkt – völlig isoliert auf dem Land. Nur ihre eigene Mutter kam gelegentlich zu Besuch. Sonst gab es weit und breit keine Familienangehörigen, von denen sie Unterstützung bekommen hätte. Wir wohnten mitten im Nichts. Mutter konnte nicht einmal in die nächste Stadt fahren, weil mein Vater das Auto brauchte, um in die Uni oder zur Arbeit zu kommen. Hinzu kam, dass in Minnesota in den Wintermonaten der Schnee buchstäblich bis zum Dach reichte und mein Vater nie da war, um ihr beizustehen. Wie unglücklich sie gewesen sein muss! Vater war ihr keine große Hilfe – dazu war er damals gar nicht fähig. Ich habe mich oft gefragt, warum er sich nicht um einen richtigen Job bemühte. Er ging in seine Vorlesungen und Seminare und jobbte nebenher, mehr nicht. Morgens verließ er in aller Frühe das Haus und kam erst zurück, wenn alle anderen längst schliefen. Bis auf die drei Kinder hatte meine Mutter niemanden, mit dem sie sich unterhalten konnte, keine Menschenseele. Oft vergingen Tage oder sogar Wochen, ohne dass sie mit einem Erwachsenen redete.
Weil Micah der Älteste war, bürdete meine Mom ihm Pflichten auf, die ihn absolut überforderten und die ich meinen eigenen Kindern niemals zumuten würde. Nebenbei bemerkt: Sie trichterte uns allen die traditionellen Wertvorstellungen des mittleren Westens ein. Aber mein Bruder bekam auch noch von klein auf zu hören: »Du musst dich um deinen Bruder und deine Schwester kümmern.« Das fing an, als er drei war. Micah musste mithelfen, mich und meine Schwester zu füttern, er badete uns, erzählte uns Geschichten und beaufsichtigte uns, wenn wir im Garten herumkrabbelten.
Im Familienalbum gibt es Fotos von Micah, wie er meiner Schwester die Flasche gibt oder sie in den Schlaf wiegt. Dabei war er kaum größer als sie. Ich glaube heute, dass es ihm letztlich gut getan hat. Verantwortungsbewusstsein muss man lernen. Man besitzt es nicht plötzlich eines Tages, nur weil man es braucht. Aber weil Micah wie ein Erwachsener behandelt wurde, hielt er sich schließlich selbst dafür und maßte sich schon lange, bevor er in die Schule kam, bestimmte Rechte und Privilegien an.
Eine meiner frühesten Erinnerungen dreht sich um meinen Bruder: Ich war zweieinhalb, Micah ein Jahr älter. Es war ein Wochenende im Spätsommer – das Gras stand etwa dreißig Zentimeter hoch, mein Dad wollte es schneiden und hatte den Rasenmäher schon aus dem Schuppen geholt. Micah fand dieses Gerät ganz toll, und ich erinnere mich diffus, wie er meinen Vater anbettelte, ihn doch bitte mitmachen zu lassen, obwohl er längst nicht genug Kraft hatte, um die schwere Maschine zu dirigieren. Dad sagte natürlich nein, aber mein Bruder – dieses dreißigpfündige Energiebündel – wollte der Logik seiner Argumente nicht folgen. Er hatte keine Lust, sich mit »so einem Quatsch« abzufinden, wie er mir später sagte.
»Da habe ich beschlossen wegzulaufen.«
Jetzt könnte man natürlich sagen: Er war dreieinhalb – wie weit sollte er da kommen? Mein Sohn Miles hat in dem Alter auch öfter gedroht, uns zu verlassen und abzuhauen. Meine Frau und ich haben dann geantwortet: »Bitteschön. Aber nicht weiter als bis zur Straßenecke.« Miles ist ein sanftes, eher ängstliches Kind. Er ging nie weiter als bis zur Ecke, wo meine Frau und ich ihn vom Küchenfenster aus sehen konnten.
Bei meinem Bruder war das allerdings anders. Er dachte sich das folgendermaßen: »Ich laufe ganz, ganz weit weg, und weil ich ja auf meinen Bruder und meine Schwester aufpassen muss, nehme ich die beiden einfach mit.«
Und das tat er dann auch. Er lud meine anderthalbjährige Schwester in den Leiterwagen, nahm mich an der Hand, und im Schutz der Hecke – damit unsere Eltern uns nicht sehen konnten – führte er uns in Richtung Stadt. Sie war drei Kilometer entfernt, und man konnte sie nur erreichen, indem man eine stark befahrene zweispurige Landstraße überquerte.
Wir hätten es beinahe geschafft. Wir marschierten durch Felder, auf denen das Getreide fast so hoch war wie wir. Ich sehe sie noch vor mir. Es war warm, Schmetterlinge flatterten durch die Sommerluft, und es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis wir endlich zur Straße kamen. Da standen wir an der Böschung – drei kleine Kinder, das älteste keine vier Jahre alt, das jüngste noch in Windeln. Riesige Fernlaster donnerten in rasendem Tempo vorbei, keinen Meter von uns entfernt, und die kräftigen Windböen hätten uns fast umgeworfen. Mein Bruder sagte zu mir: »Du musst ganz, ganz schnell rennen, wenn ich ›Los!‹ rufe.« Ich höre noch die gellenden Hupen und die quietschenden Reifen, nachdem er das Signal gegeben hatte und ich, so rasch ich konnte, hinter ihm her sauste.
Danach verschwimmen meine Erinnerungen. Ich war müde und bekam Hunger und kletterte schließlich zu meiner Schwester in den Wagen, während mein Bruder uns hinter sich her zog, wie Balto, der Schlittenhund, der sich in Alaska durch den Schnee kämpft. Aber ich weiß noch, wie stolz ich auf Micah war. Das war alles maßlos spannend, ein grandioses Abenteuer. Und trotz aller Strapazen fühlte ich mich bei Micah aufgehoben. Er würde für mich sorgen. Und hatte meine Mutter mir nicht immer befohlen: »Du musst tun, was dein Bruder sagt«?
Auch sonst tat ich meistens, was man mir sagte. Im Gegensatz zu meinem Bruder war ich ein eher braves, gehorsames Kind.
Etwas später überquerten wir eine Brücke und stiegen auf einen Hügel, wenn ich mich recht entsinne. Oben angekommen, konnten wir die Stadt unten im Tal liegen sehen. Erst viele Jahre später wurde mir klar, dass wir mehrere Stunden unterwegs gewesen sein müssen – kurze Beine können drei Kilometer nicht so schnell zurücklegen. Und ich erinnere mich vage daran, dass mein Bruder uns ein Eis versprach. Doch genau in dem Moment hörten wir aufgeregtes Geschrei, und als ich mich umdrehte, sah ich meine Mutter, die in absoluter Panik die Straße entlanggerannt kam. Sie schrie, wir sollten sofort stehen bleiben, und fuchtelte wie wild mit der Fliegenklatsche.
Damit bestrafte sie uns immer. Mit der Fliegenklatsche.
Mein Bruder hasste die Fliegenklatsche.
Er war ja auch zweifellos derjenige, der sie am häufigsten zu spüren bekam. Meine Mutter fand sie sehr praktisch: Man spürte zwar etwas, aber richtig weh tat es nicht. Und sie klatschte so schön laut, wie schon der Name sagt, wenn sie auf die Windel oder die Hose traf. Genau dieses Geräusch war es, was uns einschüchterte – es knallte, als würde ein Luftballon zerplatzen. Bis zum heutigen Tag empfinde ich eine merkwürdige Genugtuung, wenn ich bei uns im Haus Insekten klatsche.
Nicht lange nach dem ersten Fluchtversuch unternahm Micah einen zweiten. Er hatte mal wieder etwas ausgefressen, und diesmal griff mein Vater zur Fliegenklatsche. Micah hatte genug von diesen Strafmaßnahmen und erklärte trotzig: »Du darfst mich nicht mit diesem Ding da hauen.«
Mein Vater drehte sich für eine Sekunde weg, und schon rannte Micah los. Ich saß im Wohnzimmer und sah, wie mein vierjähriger Bruder schneller als ein geölter Blitz aus der Küche sauste, an mir vorbei und die Treppe hinauf. Mein Vater hinter ihm her. Oben gab es ein lautes Gepolter, weil mein Bruder im Schlafzimmer allerhand bisher unbekannte akrobatische Kunststücke vorführte. Gleich darauf kam er die Treppe wieder heruntergeflitzt, an mir vorbei, durch die Küche und zur Hintertür hinaus.
Mein Vater keuchte schon ziemlich – er hat sein Leben lang geraucht –, aber er gab die Verfolgung nicht auf. Ich sah beide für Stunden nicht mehr. Nach Einbruch der Dunkelheit, als ich schon im Bett lag, brachte meine Mom Micah in unser Zimmer. Sie deckte ihn zu und gab ihm einen Gutenachtkuss. Sobald Mutter draußen war, fragte ich Micah, was passiert sei.
»Ich hab ihm gesagt, er darf mich nicht hauen.«
»Und?«
»Er hat mich nicht gehauen – weil er mich nicht erwischt hat. Ich bin weggerannt, und dann hat er mich nicht gefunden.«
Ich grinste. Ich hab gewusst, dass du es schaffst, dachte ich.
KAPITEL 2
Ein paar Tage, nachdem ich Micah die Reiseinformationen zugeschickt hatte, klingelte das Telefon. Ich saß in meinem Arbeitszimmer am Schreibtisch und kämpfte mich wieder mal mühsam durch einen Schreibtag. Als ich den Hörer abnahm, legte Micah sofort los.
»Der Reiseplan klingt … sagenhaft!«, schwärmte er. »Hast du gesehen, wo wir überall hinfahren? Auf die Osterinseln und nach Kambodscha! Zum Tadsch Mahal! Und nach Australien, in den Outback.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Ist das nicht toll?«
»Es ist mehr als toll. Es ist unfassbar! Hast du gelesen, dass wir in Norwegen eine Hundeschlittenfahrt machen?«
»Ja, ich …«
»Und dass wir in Indien auf Elefanten reiten?«
»Ich weiß …«
»Und wir fahren nach Afrika! Afrika – kannst du dir das vorstellen?«
»Ich …«
»Das wird super!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!