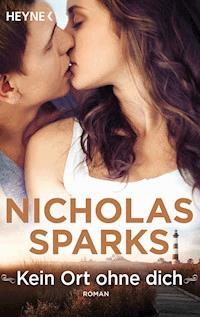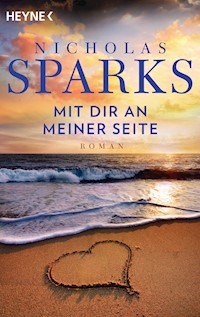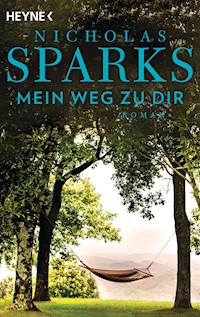17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur wenn du wirklich liebst, kann dein Herz brechen
Erst am Sterbebett seiner Großmutter erfährt Tanner Hughes den Namen seines Vaters. Er macht sich auf nach Asheboro, North Carolina, um ihn zu finden. Dort kreuzt sich sein Weg mit dem der alleinerziehenden Kaitlyn. Die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Doch schon bald muss Tanner beruflich zurück nach Kamerun, und beide fürchten, dass ihre Liebe keine Zukunft hat.
Währenddessen versucht der 83-jährige Jasper, in den Wäldern von Asheboro einen seltenen weißen Hirsch zu schützen. Eine Begegnung mit Wilderern endet in der Katastrophe. Können Kaitlyn und Tanner ihn retten – und damit auch sich selbst?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Tanner Hughes, der von seinen Großeltern aufgezogen wurde, lebt seit vielen Jahren im Ausland. Er liebt das Abenteuer und hat keinerlei Bedürfnis, sesshaft zu werden. Als er an das Sterbebett seiner geliebten Großmutter gerufen wird, ändert das alles für ihn: Sie verrät ihm nicht nur den Namen seines ihm bis dahin unbekannten Vaters, sondern sie trägt ihm auch auf, ihn zu finden. Er muss bald wieder zurück ins Ausland, doch seine Neugierde ist geweckt, und er sehnt sich danach, mehr über seine Wurzeln zu erfahren.
In Asheboro begegnet Tanner der alleinerziehenden Ärztin Kaitlyn. Sie fasziniert Tanner, und er spürt, dass Kaitlyn eine Tiefe hat, über die er mehr erfahren möchte. Kaitlyn wiederum findet ihn mysteriös und aufregend. Doch beide wissen, dass ihre Wege sich bald wieder trennen werden.
Ganz in ihrer Nähe lebt der 83-jährige Jasper mit seinem Hund Arlo zurückgezogen im Wald. Als er hört, dass ein weißer Hirsch in der Gegend gesichtet wurde und gejagt werden soll, setzt er alles daran, ihn zu retten. Eine Begegnung mit Wilderern endet in einer Katastrophe. Können Kaitlyn und Tanner ihn retten – und damit auch sich selbst?
Der Autor
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in über 50 Sprachen erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen, zuletzt „Im Traum bin ich bei dir“.
www.nicholas-sparks.de
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Astrid Finke
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel COUNTINGMIRACLES bei Random House / Penguin Random House LLC, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Willow Holdings, Inc.
Copyright © 2024 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lüra – Klemt & Mues GbR
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, unter Verwendung von FinePic®, München; Trevillion Images (David Keochkerian); Getty Images (Johner Images)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29340-6V001
www.heyne.de
www.nicholas-sparks.de
Für Dr. Eric Collins.Er weiß, warum.
Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen, und Wunder, die nicht zu zählen sind.
HIOB 9,10
KAPITEL EINS
1
März 2023
Tanner Hughes trat auf die Veranda des Häuschens, das einmal seinen Großeltern gehört hatte, und schloss die Tür hinter sich ab. In der einen Hand hielt er eine Reisetasche, in der anderen einen Kleidersack mit dem Anzug, den er fünf Wochen zuvor bei der Beerdigung seiner Großmutter getragen hatte.
Er sah auf und bemerkte eine einzelne Wolke, die in der Morgensonne weiß leuchtete. Ein weiterer Bilderbuchtag in Florida kündigte sich an, und erneut dachte Tanner, dass seine Großeltern sich einen guten Ort für ihren Ruhestand ausgesucht hatten. Die Gegend um Pensacola war schon immer vom Militär geprägt gewesen, und viele Soldaten ließen sich als Rentner dort nieder; vermutlich hatten seine Großeltern gut hierher gepasst, besonders sein Großvater als ehemaliger Armeemechaniker.
Tanner legte den Schlüssel für den Makler, der später vorbeikommen wollte, unter einen Blumentopf. Die Möbel waren bereits abgeholt worden, ein Maler bestellt, und der Makler hatte ihm versichert, dass sich das Haus schnell verkaufen würde. In den vergangenen Wochen hatte Tanner die Sachen seiner Großeltern sortiert und dabei die letzten Monate mit seiner Großmutter verarbeitet.
Jetzt sah er noch einmal Abschied nehmend über seine Schulter. Er vermisste sie, vermisste sie beide. Sie waren für ihn wie Eltern gewesen, da seine ledige Mutter wenige Minuten nach seiner Geburt gestorben war. Es war ein seltsames Gefühl, dass die beiden nicht mehr da waren, und das Wort »Waise« drängte sich auf. Seine Mutter hatte ja nur auf Fotos existiert, und über seinen leiblichen Vater hatte Tanner bis vor Kurzem überhaupt nichts gewusst. Auf ihre wortkarge Art hatten seine Großeltern durchblicken lassen, dass ihnen die Identität seines Vaters nicht bekannt sei, und Tanner hatte sich lange eingeredet, dass ihm das eigentlich auch egal war. Natürlich hatte er sich manchmal gewünscht, seine Eltern zu kennen, aber er war in einem liebevollen Heim aufgewachsen, und das war doch das Einzige, was zählte.
Er schob diesen Gedanken beiseite und ging zu seinem Auto. Sogar geparkt sah es schnell aus, fand er. Es war ein Nachbau eines 1968er Shelby GT500KR von Revology Cars, knallrot mit weißen Streifen, und obwohl er nagelneu war, glich er exakt denjenigen, die fünfzig Jahre früher vom Band gerollt waren. Es war das Extravaganteste, das er sich je geleistet hatte, und als der Wagen geliefert worden war, hatte Tanner sich gewünscht, sein Großvater hätte das noch erleben dürfen. Wie Tanner hatte er amerikanische Sportwagen geliebt, und da dieser kein Original war, gehörte er auch nicht in die Garage eines Sammlers, sondern wollte gefahren werden.
Wobei er ab dem Sommer trotzdem in einer Garage stehen würde.
Tanner quetschte die Taschen zu einem Karton mit Andenken an seine Großeltern in den Kofferraum. Sein Rucksack stand bereits auf dem Beifahrersitz. Der Motor sprang mit einem rauen Grollen an, und Tanner fuhr durch die Stadt Richtung Highway, vorbei an Filialen großer Ladenketten und Schnellrestaurants. In dieser Hinsicht, stellte er fest, unterschied sich Pensacola nicht sonderlich von anderen Städten in den USA, die er in letzter Zeit besucht hatte. Noch hatte er sich nicht ganz an die Gleichförmigkeit in weiten Teilen dieses Landes gewöhnt und fragte sich, ob er das Gefühl, ein Fremder zu sein, jemals verlieren würde.
Beim Fahren schweiften seine Gedanken zu den wichtigsten Etappen seines Lebens ab: eine auf diversen Militärstützpunkten in Deutschland und Italien verbrachte Kindheit, Grundausbildung in Fort Benning, Georgia, fast fünfzehn Jahre als Soldat. Die zahlreichen Einsätze im Nahen Osten und, im Anschluss an seine Armeezeit, seine Beschäftigung im Wachdienst für USAID, eine US-amerikanische Behörde für Entwicklungszusammenarbeit.
Und seitdem?
War er eigentlich immer unterwegs gewesen, allein schon, weil er nichts anderes kannte. Die vergangenen Jahre hatte er mehr oder weniger auf Reisen verbracht, quer durch die Vereinigten Staaten. Sein Handy war voller Fotos von Nationalparks und Sehenswürdigkeiten, er hatte sich mit Freunden getroffen, vor allem aber die Familien von verstorbenen Kameraden aufgesucht. Insgesamt konnte er dreiundzwanzig aufzählen, die gefallen waren oder ihrem Leben nach dem Ausscheiden aus der Armee selbst ein Ende gesetzt hatten. Mit ihren Witwen oder Eltern zu sprechen, kam Tanner irgendwie richtig vor, als näherte er sich einer Antwort an, die er bekommen wollte, selbst wenn er noch immer nicht ganz sicher war, wie eigentlich die Frage lautete.
Obwohl noch ein paar weitere Familien auf seiner Liste standen, hatte er seine Reise im vergangenen Oktober abbrechen müssen, weil es mit seiner Großmutter zu Ende ging. Ungeachtet regelmäßiger Telefonate und Textnachrichten hatte sie zu erwähnen versäumt, dass ein paar Monate zuvor eine unheilbare Lungenkrankheit bei ihr diagnostiziert worden war. Tanner war sofort nach Pensacola geeilt, wo er sie im Bett sitzend und von einer Pflegerin betreut vorgefunden hatte. Sein erster Gedanke war, dass sie kleiner als in seiner Erinnerung wirkte. Trotz der Sauerstoffflasche atmete sie schwer und konnte daher nur langsam und abgehackt sprechen. Sie in diesem Zustand zu sehen, war für ihn wie ein Schlag in die Magengrube, und in den kommenden Monaten wich er nur selten von ihrer Seite. Er übernahm einen Großteil ihrer Körperpflege, fütterte sie und schlief häufig auf einer Pritsche in ihrem Zimmer. Er bereitete kalorienhaltige Milchshakes für sie zu und pürierte ihr Essen, bis es weich genug war, wie für einen Säugling; er bürstete ihr zärtlich die dünnen Haare und strich Balsam auf ihre aufgesprungenen Lippen. Nachmittags, wenn sie nicht gerade schlief, las er ihr gern aus einem Gedichtband von Emily Dickinson vor, während sie den Blick aus dem Fenster richtete.
Da das Sprechen für sie immer schwieriger wurde, redete meistens er. Er erzählte ihr vom Grand Canyon, von Graceland, einem Eishotel im nördlichen Wisconsin und einem Dutzend anderen Orten, in der Hoffnung, sie würde sich von seiner Begeisterung anstecken lassen, doch die Besorgnis in ihrer Miene sprach Bände. Ich möchte dich nicht allein lassen, schien sie zu sagen, du bist so rastlos. Als er erneut zu erklären versuchte, dass seine jüngsten Reisen einen Weg für ihn darstellten, die verlorenen Kameraden zu ehren, schüttelte sie den Kopf. »Du brauchst ein … Zuhause«, krächzte sie und bekam prompt einen längeren Hustenanfall. Als sie sich wieder erholt hatte, bedeutete sie ihm, ihr den Block und den Stift von ihrem Nachttischchen zu geben. Such dir einen Ort, an dem du dich wohlfühlst, und lass dich dort nieder, schrieb sie.
Um sie nicht zu enttäuschen, erzählte er ihr nicht, dass Vince Thomas, ein alter Kollege von USAID, ihn im Januar kontaktiert hatte. Vince hatte demnächst einen neuen Einsatz in Afrika. Sie beide hatten bereits früher zusammen in Kamerun gearbeitet, und er hatte Tanner mitgeteilt, er brauche einen stellvertretenden Sicherheitschef, der mit dem Land und seiner politischen Situation vertraut sei. Da Tanner zu dem Zeitpunkt ohnehin nichts Besseres eingefallen war, hatte er das Angebot angenommen.
Nun war er zum ersten Mal seit Monaten wieder auf dem Highway, und die flache Landschaft des nördlichen Florida huschte an ihm vorbei. Tanner wollte einen kurzen Abstecher zu seinem besten Freund Glen Edwards in North Carolina machen und hatte dann vor, weiter nach Asheboro zu fahren, unsicher, was er dort wohl finden würde. Wenn überhaupt etwas.
Asheboro.
Den Namen dieser Kleinstadt hatte seine Großmutter auf den Block geschrieben, kurz bevor sie ins Koma gefallen war.
2
Wie Pensacola war auch das östliche North Carolina bei Veteranen beliebt, und nach seinem Dienst bei der Delta-Spezialeinheit hatte Glen sich dort erfolgreich eine Existenz aufgebaut. Er betrieb eine Firma, die taktische Spezialeinheiten der Polizei ausbildete, und wohnte mit seiner Frau Molly und den beiden Kindern in einem Haus in Pine Knoll Shores. Tanner war nicht überrascht, als Glen ihn mit einer Flasche Bier auf der Veranda empfing, sobald er aus dem Auto gestiegen war; sie hatten bei der Armee so viel zusammen erlebt, dass sie beinahe die Gedanken des anderen lesen konnten.
Das Haus hatte schöne hohe Decken, einen fantastischen Blick auf die Bogue-Lagune und vermittelte die übliche leicht chaotische Atmosphäre einer Familie, mit Schultaschen und Schuhen und Sportausrüstung gleich neben der Tür. Wenn die Kinder nicht gerade Glens Aufmerksamkeit beanspruchten, verlangten sie nach der von Tanner, zeigten ihm Videospiele oder wollten sich Filme mit ihm ansehen. Er liebte das, hatte die Kleinen schon immer gern gemocht. Und Molly mit ihrem freundlichen Lächeln und ihrer geduldigen Ausstrahlung war die Art von Frau, die das Beste in Glen hervorbrachte.
Drei Tage blieb Tanner dort. Sie gingen zum Strand und ins North Carolina Aquarium, und abends unterhielten sie sich auf der Terrasse unter dem Sternenhimmel. Molly zog sich meistens zuerst zum Schlafen zurück, und danach führten Tanner und Glen noch lange Gespräche.
Am ersten Abend berichtete Tanner von seiner Reise und den Sehenswürdigkeiten und beschrieb im Anschluss seine Besuche bei den Familien der Kameraden, die er verloren hatte. Glen hörte aufmerksam zu, denn viele davon hatte er ebenfalls gekannt. Am Ende gestand er, dass er nicht sicher war, ob er selbst zu solchen Besuchen in der Lage wäre.
»Ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte.«
Tanner konnte das gut nachvollziehen, auch für ihn war es nicht immer einfach gewesen, vor allem, wenn es um Soldaten ging, die Suizid begangen hatten.
Nachdem er Glen von seinem bevorstehenden Einsatz in Kamerun erzählt hatte, sprach er am Ende auch von den vergangenen Monaten in Pensacola, einschließlich der überraschenden Enthüllung seiner Großmutter, die seine Fahrt nach Asheboro erklärte.
»Moment mal.« Glen brauchte einen Moment, um diese Information zu verarbeiten. »Das hat sie dir nach all der Zeit einfach so mitgeteilt?«
»Zuerst dachte ich, sie wäre verwirrt, aber als sie es aufgeschrieben hat, war klar, dass sie es ernst meint.«
»Wie ging es dir damit?«
»Es war ein Schock, würde ich sagen. Vielleicht war ich auch ein bisschen wütend. Gleichzeitig weiß ich, dass meine Großeltern bestimmt dachten, es wäre besser, mir das zu verschweigen. Um mich zu beschützen. Und ich liebe sie ja trotzdem noch. Für mich waren die beiden meine Eltern.«
Glen presste die Lippen zusammen und schwieg.
Aber an ihrem letzten gemeinsamen Abend kam er noch einmal auf das Thema zu sprechen. »Ich hab ein bisschen über diese Sache nachgedacht, und ich muss zugeben, dass ich mir Gedanken um dich mache.«
»Weil du glaubst, dass es ein Fehler ist, nach Asheboro zu fahren?«
»Nein«, erwiderte Glen. »Dass du neugierig bist, leuchtet mir total ein. Verdammt, wenn mir jemand so was ohne Vorwarnung vor die Füße knallen würde, dann würde ich vermutlich genauso reagieren. Was mir Sorgen macht, ist, wie du seit deinem letzten Einsatz lebst. Ich meine, sich eine Auszeit zu nehmen, um zu reisen und Freunde zu besuchen, das verstehe ich, und auch, dass du dich um deine kranke Großmutter kümmern wolltest. Aber jetzt Asheboro? Und dann noch mal Kamerun? Das kapiere ich nicht. Mir kommt es vor, als würdest du dein Leben aufschieben, anstatt es tatsächlich zu leben. Oder vielleicht sogar einen Rückschritt machen. Ich meine, du hast noch nie eine eigene Wohnung gehabt, stimmt’s? Nervt es dich nicht langsam, immer unterwegs zu sein?«
Du klingst wie meine Oma, dachte Tanner, behielt es aber für sich und zuckte nur die Achseln. »Kamerun hat mir gefallen.«
»Das verstehe ich ja.« Glen seufzte. »Na, falls du dich doch irgendwann niederlassen möchtest, kannst du jederzeit bei mir arbeiten. Du könntest wohnen, wo du willst, dir deine Zeit frei einteilen und hättest ein paar von den alten Delta-Kameraden als Kollegen. Mollys Schwester ist im Übrigen gerade Single …« Er wackelte mit den Augenbrauen, woraufhin Tanner lachen musste.
»Danke.« Er trank einen Schluck Bier.
»Und was deine Suche betrifft …«
»Ich dachte, du kannst meine Neugier nachvollziehen?«
»Kann ich auch. Ich wollte nur fragen, ob du schon mal 23andMe ausprobiert hast oder eine andere von diesen Familienforschungs-Websites?«
»Ja, alle, die ich finden konnte. Aber abgesehen von ein paar entfernten Verwandten in Ohio und Kalifornien – also, um viele, viele Ecken – war da nichts dabei. Es muss wohl eine kleine Familie gewesen sein. Falls du jedoch Ideen hast, wie ich mir einiges an Lauferei ersparen kann: Ich bin ganz Ohr.«
»Leider nicht«, sagte Glen. »Und auch wenn dein Plan eher altmodisch ist, wer weiß? So hat man früher gesucht, also vielleicht hast du ja Glück.«
Tanner nickte, obwohl er sich insgeheim wieder einmal fragte, wie gut die Chancen wohl standen, jemanden nach über vierzig Jahren zu finden, besonders bei einem solchen Allerweltsnamen. Allein schon den Nachnamen gab es in den USA fast zwei Millionen Mal (das hatte er gegoogelt), und über einhundert Leute, die so hießen, wohnten in Asheboro.
Vorausgesetzt natürlich, das Gedächtnis seiner Großmutter war überhaupt noch verlässlich gewesen. In ihrer zittrigen, fast unleserlichen Schrift hatte sie notiert:
Dein Vater
Dave Johnson
Asheboro NC
Bitte verzeih
3
Die Fahrt von Pine Knoll Shores nach Asheboro dauerte vier Stunden, und als er in die Stadt kam, besorgte Tanner sich in einem Walmart eine Landkarte, ein Notizbuch und Stifte und fuhr dann in die Bücherei. Von der netten Bibliothekarin erfuhr er, dass es leider keine Telefonbücher aus den 1970ern und 1980ern mehr gab, aber immerhin trieb sie eines von 1992 für ihn auf. Das musste eben reichen.
Nächster Schritt: Seinen Vater finden, einen Mann, den er noch nie gesehen hatte.
An einem der Tische klappte er die Landkarte auf und teilte die Stadt in vier Quadranten ein. Dann schrieb er aus dem alten Telefonbuch sämtliche Johnsons heraus und markierte ihre Adressen auf der Karte; im Anschluss glich er sie per Handy mit denen im aktuellen Online-Telefonbuch ab und umkringelte diejenigen, die noch gleich waren. Wenn er schon von Tür zu Tür ging, wollte er zumindest so effizient wie möglich verfahren.
Er war noch nicht ganz fertig, als die Bücherei schloss, was bedeutete, dass er am Montag noch einmal zurückkehren musste. Zudem erwog er einen Abstecher ins Rathaus, da das Grundbuchamt ebenfalls hilfreich sein konnte, aber das musste auch bis nach dem Wochenende warten.
Nachdem er sein Gepäck in einem Hampton Inn abgestellt hatte, verspürte er das Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten. Tanner spazierte durch die Innenstadt, wo es einen Antiquitätenladen, einen Blumenhändler und eine Handvoll Boutiquen gab, untergebracht in Gebäuden aus der Zeit um 1900. Mitten in der Stadt entdeckte er einen hübschen Park, und auf den Bürgersteigen herrschte, obwohl sich bereits Wolken am Himmel ballten, ein reges Treiben von Passanten mit Hunden und Kinderwagen. Tanner fühlte sich wie in eine andere Epoche zurückversetzt und versuchte sich auszumalen, wie es gewesen wäre, hier aufzuwachsen. Hatte sein Vater seine Mutter wohl hier kennengelernt? Soweit er wusste, hatten seine Großeltern nie hier gewohnt, wie also hätten sich die Wege seiner Eltern kreuzen können?
Er schaffte es gerade vor den ersten Regentropfen ins Hotel zurück. Bis zum Abend las er in seinem Buch über den pazifischen Kriegsschauplatz im Zweiten Weltkrieg und dachte darüber nach, wie unterschiedlich dazu die moderne Kriegsführung war, wenn auch einige der verheerenden Auswirkungen auf die Soldaten gleich geblieben waren.
Als sein Magen zu knurren begann, suchte er sich im Internet eine Sportsbar heraus. Der Parkplatz des Coach’s war zu seinem Erstaunen voll, er musste zwei Runden drehen, ehe er eine Lücke fand. Im Inneren des Lokals wurde er vom Dröhnen mehrerer Fernseher und den jubelnden Fans des ausgestrahlten Basketballspiels empfangen. Dunkel erinnerte er sich, dass Glen etwas von der sogenannten March Madness erwähnt hatte, der nationalen College-Meisterschaft.
Tanner schob sich durch die Menge an die Theke, wobei er automatisch die Miene und Körpersprache der Anwesenden daraufhin checkte, ob jemand betrunken oder auf Streit aus war. Nicht weit von der Theke fielen ihm drei Männer an einem Stehtisch auf, die vermutlich Waffen bei sich trugen. Zumindest hatten sie alle am Rücken die verräterische Ausbeulung unter der Jacke, doch ihrem Haarschnitt und ihrer Haltung nach zu urteilen waren es Polizisten, die ein Feierabendbier tranken. Trotzdem suchte Tanner sich einen Platz an der Theke, von dem aus er sie im Auge behalten konnte. Alte Gewohnheiten ließen sich eben nur schwer ablegen.
Als der Barkeeper ihn endlich bemerkte, bestellte er sich einen Burger und ein Craftbier, lokal gebraut, was ihm beides gut schmeckte. Sein leerer Teller wurde abgeräumt, und Tanner sah sich geistesabwesend das Basketballspiel an, während er sein Glas austrank. Plötzlich brüllte die Menge auf, und Tanner erstarrte. Auf den Bildschirmen wurde die Wiederholung eines Drei-Punkte-Wurfs gezeigt. Tanner atmete auf, nahm aber im selben Moment ein anderes Geräusch wahr – eines, das nicht in den Rahmen passte.
Eine Stimme. Eine weibliche Stimme.
»Du sollst mich loslassen, hab ich gesagt!«
Er drehte sich um und erblickte eine junge Frau mit dunkelbraunen Haaren. Sie stand neben einem Tisch und versuchte, sich dem Griff eines jungen Mannes mit umgekehrt aufgesetzter Baseballkappe zu entwinden. Einschließlich der Dunkelhaarigen war es eine Gruppe von fünf Halbwüchsigen, drei Jungen und zwei Mädchen. Obwohl Tanner keine große Lust hatte, sich einzumischen, konnte er nie zulassen, dass Männer ihre körperliche Kraft verwendeten, um Frauen einzuschüchtern. Sollte der Junge sie noch einmal anfassen, entschied er, würde er eingreifen.
Zum Glück stürmte das Mädchen zur Tür. Ihre blonde Freundin stand hastig auf und folgte ihr, während die Jungen am Tisch lachten und den beiden etwas nachriefen.
Idioten.
Tanner wandte sich wieder dem Fernseher zu. Als nur noch wenige Schlucke Bier im Glas waren, schob er es weg und griff nach seiner Jacke. Dabei fiel sein Blick noch einmal auf den Tisch mit den jungen Leuten, und er stellte fest, dass der Typ mit der Baseballkappe nicht mehr da war, nur seine beiden Freunde.
Verdammt.
Er drängte sich zur Tür. Draußen sah er sich auf dem Parkplatz um, bis er den Jungen und die beiden Mädchen bei einem schwarzen SUV entdeckte. Selbst aus der Entfernung war klar ersichtlich, dass ein weiterer Streit im Gange war. Der Kerl hatte die Dunkelhaarige erneut am Arm gepackt, nur dass dieses Mal ihre Bemühungen, sich loszureißen, erfolglos blieben. Tanner ging auf sie zu.
»Gibt’s hier ein Problem?«, rief er laut.
Drei Augenpaare schnellten in seine Richtung.
»Wer zum Henker sind Sie?«, blaffte der Junge, ohne das Mädchen loszulassen.
Erst wenige Meter vor den dreien blieb Tanner stehen. »Lass sie los.«
Als der Junge nicht reagierte, trat Tanner noch näher. Sein von der Spezialeinheit gestählter Körper war in voller Alarmbereitschaft. »Das ist keine Bitte«, sagte er ruhig.
Der junge Mann zögerte noch eine Sekunde und gab dann den Arm des Mädchens frei. »Ich wollte nur mit meiner Freundin reden.«
»Ich bin nicht deine Freundin!«, schrie sie ihn an. »Wir waren ein einziges Mal zusammen aus! Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt hier bist!«
Tanner wandte sich ihr zu und bemerkte, dass sie sich den Arm rieb, als schmerzte er. »Möchtest du mit ihm reden?«
»Nein«, sagte sie leise. »Ich will einfach nur nach Hause.«
»Scheint mir ziemlich eindeutig«, sagte Tanner zu dem Jungen. »Warum gehst du nicht lieber wieder rein, bevor du dir noch Ärger einhandelst?«
Der Baseballkappentyp machte Anstalten, etwas zu erwidern, überlegte es sich aber anders. Er trat einen Schritt zurück und drehte sich schließlich um. Tanner sah ihm nach. Sobald er wieder im Lokal verschwunden war, sprach er die Dunkelhaarige an.
»Alles in Ordnung?«
»Ja«, murmelte sie, ohne ihn dabei anzusehen.
»Alles gut«, mischte sich ihre Freundin ein. »Sie hätten ihm keine Angst einjagen müssen.«
Kann sein, dachte Tanner. Oder eben doch. Er hatte gelernt, dass jemandes Stolz zu verletzen häufig sinnvoller war als die Alternative. Und jetzt konnte er es ohnehin nicht mehr rückgängig machen. »Dann noch einen schönen Abend.« Er nickte den beiden zu. »Fahrt vorsichtig.«
Er lief quer über den Parkplatz zu seinem Wagen, stieg ein und steuerte ihn durch die Reihen parkender Autos Richtung Ausfahrt. Als er an der Stelle vorbeikam, wo die drei jungen Leute gestritten hatten, waren die Mädchen nicht mehr da.
Weil er den Weg zu seinem Hotel nicht wusste, hielt er kurz an und beugte sich zur Seite, um das Handy aus der Gesäßtasche zu holen. Genau in dem Moment setzte der große schwarze SUV, der rechts von ihm parkte, mit vollem Tempo zurück. Ehe Tanner reagieren konnte, wurde sein Auto gerammt, sein Kopf schleuderte herum, und man hörte Metall knirschen. Und dann war es auch schon wieder vorbei.
Routiniert überprüfte er sich auf Verletzungen: Seine Arme und Beine fühlten sich normal an, er blutete nicht, und auch wenn er vermutlich am nächsten Tag leichte Schmerzen in Hals und Rücken haben würde, war es nichts Ernstes.
Sein Auto allerdings …
Er atmete tief durch und öffnete die Tür. Noch hoffte er, es wäre nicht so schlimm, wie es sich angefühlt und angehört hatte, rechnete allerdings vorsichtshalber mit dem Gegenteil. Der hintere Kotflügel des Shelby war so zerknautscht, dass er auf den Reifen drückte, das Rücklicht war zerschmettert, und vom Aufprall war der Kofferraum aufgesprungen. Als Tanner ihn zu schließen versuchte, rastete er nicht mehr ein.
Mein Auto!, schimpfte er innerlich. Mein neues Auto …
Vor lauter Wut brauchte Tanner einen Moment, um zu bemerken, dass der andere Fahrer noch gar nicht ausgestiegen war. Er atmete mehrmals tief durch, bis er sicher war, dass er nicht die Beherrschung verlieren würde, und trat dann an die Fahrertür des auf den ersten Blick unbeschädigten SUV. Im selben Moment wurde die Tür aufgestoßen, und zwei dünne, zittrige Beine kamen zum Vorschein. Es war die Dunkelhaarige von vorhin, stellte Tanner fest. Sie war bleich, hatte die Augen weit aufgerissen und machte ein ersticktes Geräusch, dann schlug sie sich die Hände vors Gesicht und brach in Tränen aus.
Du meine Güte, dachte Tanner. Das hab ich jetzt davon, dass ich nett sein wollte.
Er wartete etliche Sekunden. Aus ihrem Alter und ihrer Reaktion schloss er, dass es ihr erster Unfall war – immer ein traumatisches Erlebnis. Nach einer Weile beruhigte sie sich etwas und wischte sich die Nase mit dem Ärmel ab. Tanner presste die Lippen zusammen. Wenn er jetzt laut wurde, fing sie vermutlich gleich wieder an zu weinen, was das Letzte war, was er wollte.
»Also«, sagte er in demselben sachlichen Tonfall, den er vorher dem Jungen gegenüber verwendet hatte. »Kannst du mir zunächst mal sagen, wie du heißt?«
Es schien einen Moment zu dauern, bis die Frage zu ihr durchdrang. Benommen sah sie ihn an. »Meine Mutter bringt mich um«, sagte sie.
Na super, dachte Tanner. Zwar hatte sie seine Frage nicht beantwortet, aber immerhin konnte sie offenbar klar denken. »Ich muss mich vergewissern, dass du keine körperlichen Verletzungen hast. Kannst du den Kopf nach rechts und links drehen? Und kannst du nicken?«
Tanner machte es ihr vor, und mit einer kurzen Verzögerung kam sie seiner Aufforderung nach.
»Tut dir der Kopf oder der Hals weh? Und wenn auch nur ein bisschen?«
»Nein.« Sie schniefte.
»Was ist mit Armen, Beinen und Rücken? Kannst du dich drehen?«
Mit gerunzelter Stirn ließ sie die Schultern kreisen und drehte den Oberkörper herum. »Fühlt sich normal an.«
»Ich kann Erste Hilfe leisten, aber ich bin kein Arzt. Vielleicht solltest du dich trotz allem untersuchen lassen, nur zur Sicherheit.«
»Meine Mutter ist Ärztin«, sagte sie zerstreut.
Da Tanner merkte, dass die Hände des Mädchens immer noch zitterten, sprach er ruhig weiter. »Der Parkplatz ist Privatgelände, deshalb müssen wir wahrscheinlich nicht die Polizei rufen, aber kannst du mal deinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere holen?«
»Die Polizei?« Ihre Stimme klang leicht panisch.
»Nein, eben nicht …«
»Jetzt kriege ich bestimmt kein eigenes Auto«, fiel sie ihm ins Wort.
Tanner verdrehte die Augen. »Könntest du bitte mal im Auto danach suchen? Führerschein, Fahrzeugpapiere und Versicherungsschein?«
Sie blinzelte. »Das Auto gehört meiner Mutter.« Sie flüsterte fast. »Ich weiß nicht, wo die Fahrzeugpapiere sind. Oder der Versicherungszettel.«
»Probier’s doch mal mit dem Handschuhfach oder der Mittelkonsole.«
Leicht desorientiert wirkend, drehte sie sich um und stieg langsam wieder in den SUV. Unterdessen knipste Tanner aus verschiedenen Blickwinkeln Fotos von seinem Wagen. Als das Mädchen schließlich wieder herauskam, gab sie ihm die Unterlagen.
»Den Versicherungsschein finde ich nicht, aber meine Mutter weiß bestimmt, wo der ist.«
Tanner drehte den Fahrzeugschein um; auf der Rückseite standen der Name der Versicherungsgesellschaft und die Police-Nummer. »Hier ist alles drauf.« Er machte Fotos und gab ihr die Unterlagen zurück. Da sie ganz offensichtlich keine Ahnung hatte, was sie tun sollte, holte er seine eigenen Papiere.
»Hast du ein Handy?«
Sie starrte den Schaden an seinem Auto an. »Was?«
»Mach bitte Fotos von meinen Fahrzeugpapieren und dem Führerschein.«
»Mein Akku ist leer.«
Natürlich, was sonst. Seufzend knipste er mit seinem Handy die Schäden und die Papiere. »Der Wagen gehört deiner Mutter, richtig? Ich schicke die Fotos mit meinen Daten an sie und dich. Sag mir mal eure Nummern.«
»Können Sie die nicht nur an mich schicken? Damit ich erst mal erklären kann, was los ist, bevor sie Bilder von einer fremden Nummer kriegt?«
Tanner überlegte kurz. »Also gut. Aber gib mir trotzdem auch ihre Nummer. Nur für den Fall.«
Sie nannte ihm erst ihre eigene und dann die ihrer Mutter. Er speicherte beide und schickte ihr anschließend die Fotos. Als er wieder aufsah, kaute sie auf ihrer Lippe herum.
»Am besten rufst du deine Mutter an, damit sie dich abholt.« Er hielt ihr sein Handy hin. »Du stehst unter Schock und solltest lieber nicht selbst fahren.«
Sie starrte das Telefon an, ohne es anzunehmen. »Wir haben nur das eine Auto.«
»Und was ist mit deiner Freundin, ist die noch da?«
»Nein, die ist schon weg.«
»Kannst du denn sonst jemanden anrufen, eine andere Freundin?«
»Ich weiß die Nummern nicht auswendig.«
»Wieso das denn nicht?«
Jetzt sah sie ihn an, als wäre er beschränkt. »Weil ich die auf dem Handy habe und der Akku leer ist.«
Tanner schloss die Augen und stellte sich vor, er wäre Buddha. »Okay. Wie weit weg wohnst du denn? Vielleicht kann ich dich in eurem Auto nach Hause fahren.«
Sie musterte ihn skeptisch, als wollte sie einschätzen, ob er vertrauenswürdig war.
»Ja, das geht«, sagte sie schließlich. »Es ist nicht weit.«
»Gut. Kannst du noch mal ein Stück nach vorn fahren? Damit die Autos voneinander wegkommen.«
»Ich?«
»Schon gut, ich mach das. Steckt der Schlüssel?«
Immer noch schniefend wies sie Richtung Auto, was Tanner als Ja auffasste. Zum Glück startete der Motor auf Anhieb, und er fuhr behutsam vor. Im Anschluss inspizierte er die Stoßstange des SUV; abgesehen von ein paar Kratzern schien alles in Ordnung.
»Die gute Nachricht ist, dass bei euch nichts kaputt ist.« Er zeigte darauf. »Warte kurz, ja? Ich parke nur meinen Wagen.«
Tanner sprang in sein Auto und fand in der nächsten Reihe eine Lücke. Er fuhr sehr langsam und verzog das Gesicht bei dem unguten Geräusch von Metall, das auf Reifen schabte. Im Rückspiegel sah er den halb offen stehenden Kofferraumdeckel.
Er überlegte, ob er den Wagen nach Florida transportieren lassen musste oder die Reparatur vor Ort durchgeführt werden konnte. Aber erst einmal wollte er das Mädchen nach Hause fahren.
Als er zurückkam, lehnte sie missmutig, aber mit trockenen Augen an dem SUV. Wortlos stieg sie auf der Beifahrerseite ein. Tanner setzte sich ans Steuer und warf einen Blick auf das Handyfoto von ihrem Führerschein.
»Wohnst du immer noch in der Dogwood Lane?«
Sie nickte.
»Bei deinen Eltern?«
»Nur meine Mutter«, murmelte sie. »Die sind geschieden.«
Tanner gab die Adresse ins Navi ein und stellte fest, dass die Fahrt nur acht Minuten dauern sollte.
»Schnall dich bitte an«, sagte er und fuhr los. Sobald sie auf der Hauptstraße waren, sah er sie von der Seite an. Sie wirkte wie ein Häftling, der zu seiner Hinrichtung geführt wurde.
»Du heißt also Casey? Casey Cooper?«, fragte er. »Das steht auf deinem Führerschein.« Auf ihr Nicken hin fuhr er fort: »Ich bin Tanner Hughes.«
»Hallo«, stieß sie hervor und warf ihm einen unsicheren Blick zu. »Tut mir leid, dass Sie mich nach Hause fahren müssen.«
»Macht nichts.«
»Und es tut mir sehr, sehr, sehr leid, dass ich Ihr Auto angefahren habe.«
Das gilt für uns beide. Er erinnerte sich, was seine Großmutter gesagt hätte. »So was kommt eben vor.«
»Warum sind Sie so nett?«
Er dachte nach. »Wahrscheinlich, weil ich auch mal jung war.«
Sie schwieg einen Moment. »Meine Freundin hat gesagt, dass Sie tolle Augen haben. Camille meine ich. Die vorhin dabei war.«
Das hörte er nicht zum ersten Mal; seine Augen hatten ein helles Braun, das grün oder golden wirkte, je nach Licht. »Danke.«
»Und Ihre Tattoos fand sie auch cool.«
Daraufhin lächelte er nur.
Sie starrte eine Weile geradeaus, dann schüttelte sie den Kopf. »Meine Mom wird so sauer sein! Die wird ausflippen.«
»Es dauert vielleicht ein bisschen, aber dann wird sie sich schon wieder beruhigen«, sagte Tanner. »Sie ist bestimmt froh, dass dir nichts passiert ist.«
Darüber dachte das Mädchen offenbar noch nach, während sie in eine Wohnsiedlung mit großen Gärten und viel Grün einbogen. Die meisten Häuser waren zweistöckig, mit Backsteinfassaden, Kunststoffverkleidung an den Seiten und ordentlich gestutzten Hecken.
»Das da ist es.« Casey zeigte auf eines der hell erleuchteten Häuser. Es hatte eine schmale Veranda mit zwei Schaukelstühlen darauf, und als Tanner in die Einfahrt bog, sah er einen Schemen am Küchenfenster vorbeihuschen.
Er schaltete den Motor ab. Casey schien es mit dem Aussteigen nicht eilig zu haben.
»Soll ich hier warten? Während du deiner Mutter erzählst, was passiert ist?«
»Würden Sie das machen?«, fragte sie. »Falls sie noch Fragen an Sie hat …«
»Klar.«
Das schien ihr endlich den nötigen Mut zu geben. Während sie ins Haus ging, stieg Tanner aus und lehnte sich an die Wagentür.
Ungefähr fünf Minuten später trat eine Frau aus dem Haus, Casey im Schlepptau. Ihre Mutter, dachte Tanner, aber da sie erst zögerlich unter der Verandalampe stehen blieb, betrachtete er sie eingehender.
Sie trug eine ausgewaschene Jeans und eine einfache weiße Bauernbluse, die langen Haare zu einem lässigen Pferdeschwanz gebunden; die locker sitzende Kleidung konnte ihre kurvige Figur nicht verbergen. Auf den ersten Blick wirkte sie zu jung, um Caseys Mutter zu sein. Als sie die Hand hob, um sich eine dunkle Strähne aus dem Gesicht zu streichen, glaubte Tanner, eine Ungewissheit in ihrer Miene zu entdecken, eine Zaghaftigkeit, die vielleicht auf erlebte Enttäuschungen hindeutete.
Es war nur ein Bauchgefühl, eine Ahnung, aber als er sie die Schultern straffen und die Stufen heruntersteigen sah, die nackten Füße mit den roten Nägeln unter dem Jeanssaum hervorblitzend, dachte er unwillkürlich: Diese Frau hat eine Geschichte, und ich möchte sie erfahren.
KAPITEL ZWEI
1
Nachdem sie zum wiederholten Mal vergeblich versucht hatte, ihre Tochter zu erreichen, legte Kaitlyn Cooper das Telefon auf den Küchenschrank und starrte aus dem Fenster über dem Spülbecken. Der Halbmond hing zwischen den Wolken und warf einen silbrigen Schimmer auf den Vorgarten, und sie fragte sich, ob das Gewitter vorbei war oder nur eine kurze Atempause einlegte.
Eigentlich spielt es ja keine Rolle. Ohne Auto saß sie ohnehin im Haus fest, ganz egal, wie das Wetter war. Als sie sich zur Küche umdrehte, überkam sie das vertraute Grauen vor dem Aufräumen. Statt sich um das Geschirr zu kümmern, griff sie nach ihrem Weinglas. Es war noch ein Schlückchen übrig, und sie nippte daran.
An sich hätte sie Mitch bitten können zu helfen, mit seinen neun Jahren war er alt genug. Aber er saß im Wohnzimmer und baute gerade den Star Wars X-Wing Fighter von Lego zusammen, den sie ihm mitgebracht hatte, und sie wollte ihn nicht unterbrechen. Es war ein spontaner Kauf gewesen – das Letzte, was er brauchte, war noch mehr Lego, doch da ihr Exmann offenbar mit Geschenken bei den Kindern gut ankam, hatte sie zur Abwechslung auch einmal Pluspunkte sammeln wollen, statt immer die Böse zu sein. Außerdem sollte Mitch einfach ab und zu eine nette Überraschung haben. Er war gut in der Schule und zu Hause immer fröhlich, was Kaitlyn sehr schätzte, nicht zuletzt, weil sie bezweifelte, dass es von Dauer war. Seine ältere Schwester Casey war früher ebenfalls reizend, wenn auch eigensinnig gewesen. Und natürlich war sie immer noch ein Schatz, aber die Pubertät hatte sie von einem aufgeweckten, angenehmen Mädchen in eine junge Frau verwandelt, die Kaitlyn gelegentlich schwer erträglich fand. Auch wenn das natürlich ihrer Liebe zu ihrer Tochter keinen Abbruch tat.
Nur diese Launen, dieser Tonfall …
Obwohl Kaitlyn selbstverständlich wusste, dass es anderen Eltern von Halbwüchsigen ganz genauso ging, machte es das Leben mit Casey nicht einfacher. Je mehr sie sich in den vergangenen zwei Jahren bemüht hatte, eine verständnisvolle Mutter zu sein, desto aufsässiger schien Casey zu werden. Wie an diesem Abend zum Beispiel.
War es so schwer, einmal pro Woche mit der Familie zu essen? Durch Schule und Hausaufgaben und Caseys Cheerleader-Training, dazu Kaitlyns Arbeit in ihrer Praxis, war es unter der Woche praktisch unmöglich, abends gemeinsam am Tisch zu sitzen. Da Kaitlyn sonntagabends zusätzlich noch Hausbesuche machte, blieb nur der Samstag. Natürlich verstand sie, dass das nicht immer gelegen kam, aber sie erwartete ja nicht von Casey, sich lange aufzuhalten. Sie wünschte sich nur eine Stunde zwischen sechs und sieben, oder notfalls zwischen fünf und sechs, und danach konnte Casey tun und lassen, was sie wollte.
Und was hatte ihre Tochter stattdessen getan?
Sie hatte sich, ohne zu fragen, den Wagen genommen und stundenlang nicht auf Anrufe und Nachrichten ihrer Mutter reagiert. Höchstwahrscheinlich war sie bei ihrer Freundin Camille, allerdings war auch denkbar, dass sie sich heimlich mit Josh Littleton traf, einem jungen Mann, der bei Kaitlyn die Alarmglocken schrillen ließ. Als er Casey ein paar Wochen zuvor abgeholt hatte, war er ihr auf Anhieb unsympathisch gewesen, weshalb sie insgeheim erleichtert gewesen war, dass ihre Tochter hinterher erklärt hatte, sie sei nicht an ihm interessiert. Zwar ließ Josh offenbar nicht locker, doch um ihre Tochter nicht zu einer Trotzreaktion zu veranlassen, verkniff Kaitlyn sich jeden Kommentar.
Als sie Mitch dabei beobachtete, wie er die Lego-Anleitung durchlas, den Zettel dicht vor die Brille haltend, spürte sie einen Stich im Herzen. Sie wusste, dass ihn die Abwesenheit seiner Schwester bedrückte. Er hatte einen schönen Tag gehabt, den Nachmittag mit Jasper verbracht – einem netten alten Mann, der ihm das Schnitzen beibrachte –, und freute sich auf den Zoobesuch am nächsten Tag. Doch er vergötterte seine große Schwester und hatte mehrfach gebeten, mit dem Essen zu warten, bis Casey nach Hause kam. Am Ende, als klar war, dass sie nicht erscheinen würde, hatte er kaum noch geredet. Um seine Enttäuschung zu lindern, hatte Kaitlyn gescherzt, sie habe sich als Teenager auch nicht gern mit ihrer Mutter abgegeben, worauf er nur die Achseln gezuckt hatte.
Manchmal fragte sie sich, ob Caseys Verhalten mit der Scheidung zu tun hatte. Casey war zwölf gewesen, als Kaitlyn und ihr Mann sich getrennt hatten, und die folgenden Jahre waren für keinen von ihnen leicht. Casey vermisste ihren Vater, und für Mitch war George fast ein Superheld. Auch Kaitlyn hatte einmal geglaubt, Glück mit ihrem Partner gehabt zu haben. George war intelligent und fleißig, und als Kardiologe konnte er selbst in den schwierigsten Situationen ruhig bleiben. Tagtäglich rettete er Leben und war beruflich so erfolgreich, dass Kaitlyn sich, als die Kinder noch klein waren, hatte leisten können, nur in Teilzeit zu arbeiten, wofür sie immer noch dankbar war.
Außerdem hatte er perfekt in Kaitlyns Lebensplanung gepasst, die sie schon als Kind entworfen hatte und die heute schmerzlich naiv wirkte: gute Noten schreiben, Medizin studieren. Einen Freund haben, aber nichts Ernstes bis Mitte oder Ende zwanzig; danach einen klugen, ausgeglichenen Mann kennenlernen, sich verlieben und bis spätestens dreißig verheiratet sein. Zwei Kinder bekommen, ein schönes Haus kaufen, eine eigene Praxis führen und nebenbei zudem bedürftige Patienten behandeln. Happy End.
So viel dazu. Auch wenn die emotionale Überforderung der Trennungszeit zum Glück nachgelassen und sie George definitiv überwunden hatte, gab es Zeiten, in denen sie die Vertrautheit vermisste, die stillen Momente der Zweisamkeit. Heutzutage drehte sich ihr Leben ausschließlich um Arbeit und Kinder, für anderes blieb kein Raum, wofür dieser Abend wieder einmal ein erstklassiges Beispiel war.
Erneut wählte sie Caseys Nummer, hörte die Ansage der Mailbox und legte frustriert auf. Sie trank den letzten Schluck Wein und begann, die Küche aufzuräumen. Als sie gerade fertig war, bemerkte sie Scheinwerferlicht vor dem Haus. Sie erkannte das Brummen ihres Wagens, atmete tief durch und dachte: Na endlich!
Unsicher, wie sie mit Caseys Benehmen umgehen sollte, verließ sie die Küche. Ihre Tochter war die Königin der Ausreden, aber Gebrüll brachte gar nichts, weil Casey dann ebenfalls laut wurde und die Situation eskalierte, bis ihre Tochter schrie, dass sie alles hasste und in ihr Zimmer rauschte. Andererseits gab es nun einmal Regeln, und Kaitlyns Ansicht nach hatte die junge Dame einiges zu erklären.
»Casey ist da!«, rief Mitch. Er stand am Wohnzimmerfenster und sah durch die Vorhänge. »Sie fährt aber nicht selbst. Es ist noch jemand dabei.«
»Wie bitte?« Eigentlich durfte Casey niemand anderen ans Steuer des SUV lassen. Das war die vielleicht einzige Regel, gegen die sie noch nie verstoßen hatte, denn sie liebte Autofahren und würde niemals freiwillig den Schlüssel abgeben, außer …
Wut stieg in Kaitlyn auf. Außer natürlich, sie hat getrunken.
Sie war bereits auf dem Weg zur Haustür, als diese plötzlich aufgerissen wurde. Casey trat ein, und ein einziger Blick auf ihr fleckiges Gesicht und ihre großen Augen verriet, dass ihre Tochter völlig verstört war.
Sobald Casey die Tür geschlossen hatte, brach sie in Tränen aus. Kaitlyn nahm sie wortlos in die Arme, ihre Wut verflog schlagartig. Irgendwie nahm sie in diesem Wolkenbruch der Gefühle wahr, dass Casey überhaupt nicht nach Alkohol roch. Das war schon einmal gut, auch wenn eindeutig irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung war.
2
Es dauerte ein paar Minuten, bis Casey zu weinen aufhörte und in groben Zügen erklärte, was vorgefallen war: Sie habe auf dem Parkplatz den Wagen eines Mannes gerammt, sie wisse auch nicht, wie das passiert sei. Kaitlyn brachte sie zum Sofa und ließ sie ein paar tiefe Atemzüge machen. Mit ihren geröteten Augen und Wimperntuscherinnsalen auf den Wangen war sie ein Bild des Jammers.
»Jetzt noch mal ganz langsam«, sagte Kaitlyn schließlich. »Du warst mit Camille im Coach’s, und beim Ausparken bist du gegen einen anderen Wagen gefahren.«
Casey nickte. »Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Keine Ahnung, warum nicht.«
»Hast du dir wehgetan? Kannst du den Kopf bewegen?«
»Das hab ich alles schon mit dem gemacht.«
»Was?«
»Das Medizinische. Der hat mich untersucht.«
»Dich untersucht?«
»Du weißt schon, was ich meine.« Casey machte eine ungeduldige Geste. »Echt jetzt, Mom, er hat mich nicht angefasst oder so. Und mir geht’s gut. Er hat gesagt, unser Auto ist gar nicht kaputt.«
»Da bist du dir sicher?«
»Ich hab nachgesehen. Aber du kannst dich ja selbst davon überzeugen, wenn du mir nicht glaubst.«
»Es geht nicht darum, dass ich dir nicht glaube. Ich hab immer noch nicht so ganz verstanden, was passiert ist, okay?«
»Das hab ich dir doch gerade erzählt.« Casey schniefte. »Hast du nicht zugehört?«
Du warst ein bisschen schwer zu verstehen, Schatz, und mir fehlen noch diverse Details. Aber das sagte sie nicht. Sondern: »Wer war jetzt bei dir im Auto? Camille?«
»Nein, der Mann. Dessen Auto ich gerammt habe. Der mit den Tattoos. Er hat mir gesagt, wie er heißt, aber ich hab’s wieder vergessen.«
Tattoos? Kaitlyn blinzelte. »Du lässt dich von einem tätowierten Fremden nach Hause fahren?«
»Es ist ja nichts passiert.« Casey strich sich durch die Haare und suchte dann in ihren Hosentaschen nach einem Gummi.
»Warum ist er hier?«
»Er meinte, ich soll lieber nicht fahren, weil ich so durcheinander bin.« Sie band sich einen Pferdeschwanz und sah ihre Mutter an.
»Dir ist schon klar, dass du das nicht hättest tun sollen? Zu ihm ins Auto steigen, meine ich.«
»Was ist so schlimm daran?«
Zu einem fremden Mann ins Auto zu steigen? Ach, was soll dabei schon schiefgehen?
»So was ist gefährlich. Du kennst ihn ja gar nicht.«
Casey zuckte die Achseln. »Er macht einen netten Eindruck.«
Nett? »Dann sollte ich vermutlich mal mit ihm sprechen.«
Als Kaitlyn aufstand und zur Tür ging, krähte Mitch: »Ich will mit.«
»Bleib bitte einfach kurz bei deiner Schwester, ja?«
»Oh nein«, sagte Casey bestimmt. »Ich komme mit.«
»Warum?«
»Damit du nicht ausflippst.«
Gott steh mir bei, dachte Kaitlyn und konnte sich nur mit Mühe verkneifen, die Augen zu verdrehen.
Sie schaltete das Verandalicht und die Lampe über der Garage ein, bevor sie hinaustrat. Dann sammelte sie sich kurz und entdeckte einen an ihrem Wagen lehnenden Mann, dessen Arme mit farbigen Tätowierungen bedeckt waren. Er musste sie gehört haben, denn er drehte sich um, und ihre Blicke begegneten sich. Eine gefühlte Ewigkeit lang musterte er sie nur, als wollte er sie deuten. Doch als er kurz lächelte, durchfuhr Kaitlyn ein Schauer.
Er war etwas größer als der Durchschnitt und offensichtlich sportlich, die breiten Schultern unter dem schlichten schwarzen T-Shirt gut erkennbar. Selbst im künstlichen Licht der Garagenlampe fiel ihr die ungewöhnliche Farbe seiner Augen auf. Hohe Wangenknochen und ein kantiges Kinn erzeugten eindrucksvolle Schatten. Seine dichten dunklen Haare waren kurz geschnitten, zu einer beinahe militärischen Frisur, und um die Ohren herum bemerkte sie etwas Silbergrau. Die ausgeblichene Jeans und die Lederschuhe machten einen teuren Eindruck, und sein Lächeln strahlte Selbstbewusstsein aus. Trotz der Tattoos hätte es sie nicht überrascht, wenn er Informatiker oder Unternehmensberater oder sogar Arzt gewesen wäre. Und doch …
Und doch wusste sie, dass nichts davon zutraf. In seiner Körperhaltung lag eine Bereitschaft, eine beinahe knisternde Spannung. Nein, das war kein Mann, der am Schreibtisch arbeitete oder mit Zahlen jonglierte oder PowerPoint-Präsentationen zusammenstellte; seine schiere körperliche Präsenz erzählte eine andere Geschichte.
»Mom«, zischte Casey. »Was stehst du nur so da?«
Die Stimme ihrer Tochter brach den Bann, und sie stieg endlich von der Veranda. Während sie auf den Mann zuging, blieben seine Augen auf sie gerichtet.
»Guten Abend.« Er streckte ihr die Hand hin. »Tanner Hughes.«
Nach kurzem Zögern kam sie zu dem Schluss, dass sie ruhig höflich sein konnte.
»Kaitlyn Cooper«, sagte sie bemüht kühl. »Casey hat erzählt, sie beide hatten einen Unfall?«
»Ja, sie ist auf dem Parkplatz in meinen Wagen gefahren.«
»Und Sie hielten es für eine gute Idee, sie nach Hause zu fahren? Allein? Obwohl sie minderjährig ist?«
»Mom!«, stöhnte Casey.
»Schon gut«, sagte er verständnisvoll, wenn auch nicht entschuldigend. »An Ihrer Stelle wäre ich wahrscheinlich auch besorgt. Aber ich habe es nur gut gemeint. Meiner Ansicht nach wäre es gefährlich gewesen, wenn sie sich ans Steuer gesetzt hätte, und ihre Freundin war schon weg. Wir sind ohne Umweg hergekommen.«
»Das hab ich dir doch alles schon erzählt.« Man hörte Casey deutlich an, wie peinlich ihr das Ganze war.
»Dann sollte ich mich wohl bedanken«, sagte Kaitlyn.
»Keine Ursache. Die gute Nachricht ist, dass Ihrem Wagen praktisch nichts passiert ist. Sehen Sie ihn sich mal an.«
Er ging zur hinteren Stoßstange, und als sie neben ihm stand, leuchtete er mit der Handy-Taschenlampe auf die Stelle.
»Nur ein paar Kratzer. Er hat sich auch ganz normal gefahren.«
Kaitlyn musste genauer hinsehen, um die Kratzer zu erkennen, wobei theoretisch auch ein nicht sichtbarer Schaden hätte entstanden sein können. Sie nahm sich vor, ihn in die Werkstatt zu bringen, sollte ihr irgendetwas komisch vorkommen.
»Was ist mit Ihrem Auto?«, fragte sie.
»Das steht auf einem anderen Blatt.« Er rief die Fotos auf seinem Handy auf. »Hier sind mehrere Bilder, blättern Sie ruhig weiter.«
Seine Finger streiften ihre, als sie das Telefon entgegennahm. Zuerst wischte sie in die falsche Richtung und sah ein Foto von Tanner mit einem gut gekleideten Paar in ungefähr demselben Alter, offenbar auf einer Terrasse mit Blick auf ein Gewässer. Unwillkürlich dachte sie: Er hat nett aussehende Freunde mit freundlichem Lächeln, also ist er vermutlich normal.
Sich insgeheim für ihre Neugier tadelnd, wischte sie in die andere Richtung und riss die Augen auf. Sein Wagen sah aus wie ein sehr teurer Oldtimer aus den 1960ern, wahrscheinlich würde die Reparatur ein kleines Vermögen kosten. Als sie ihm das Handy zurückgab, hatte sie das eigenartige Gefühl, dass er sie mit Interesse musterte.
»Ich gebe meiner Versicherung Bescheid. Haben Sie alles von uns, was Sie brauchen?«
»Ja, Ihre Tochter war sehr kooperativ.«
»Tja, dann … ist es ja gut«, sagte Kaitlyn, überrascht, dass Casey gewusst hatte, was zu tun war. »Das mit Ihrem Wagen tut mir leid. Und Casey tut es auch leid.«
Er steckte sich das Handy in die Gesäßtasche zurück. »Danke.« Wieder begegneten sich ihre Blicke, und sie sahen einander lange an, bis Kaitlyn sich schließlich abwandte.
»Dann ist das wohl erledigt«, sagte er. »War nett, Sie kennenzulernen. Dich auch, Casey.«
»Danke, dass Sie mich nach Hause gefahren haben.« Casey winkte.
»Gern geschehen.« Er ging los.
»Moment!«, rief Kaitlyn, etwas überrumpelt vom plötzlichen Ende des Gesprächs. »Wo wollen Sie denn hin?«
Er drehte sich um, lief dabei aber rückwärts weiter. »Ins Hotel zurück. Ich rufe mir ein Taxi. Und wenn ich keines finde, gehe ich zu Fuß.«
Auf einmal pikste Casey sie in die Rippen. Als Kaitlyn sich zu ihr umwandte, schien sie wortlos zu fragen: Willst du ihn wirklich zurücklaufen lassen? Da hatte sie natürlich recht.
»Wo wohnen Sie denn?«, rief Kaitlyn ihm nach.
»Im Hampton Inn.«
»Kann ich Sie vielleicht zurückfahren?«
Nach kurzem Zögern fragte er: »Macht es denn wirklich keine Umstände?«
»Das ist das Mindeste, was ich tun kann.« Obwohl das Angebot ernst gemeint war, stellte sie fest, dass die Vorstellung, mit ihm allein zu sein, sie etwas nervös machte. »Ich hole mir nur schnell Schuhe und Autoschlüssel.«
»Der Schlüssel steckt noch«, sagte Tanner.
Klar, dachte sie. Das leuchtet ein. »Casey, Schatz, bring mir doch bitte schnell die Sandalen, die an der Tür stehen, ja?« Unterdessen bewegte sich Tanner bereits zur Beifahrertür.
Als Casey mit den Schuhen zurückkam, sagte Kaitlyn halblaut zu ihr: »Ich bin gleich wieder da. Passt du kurz auf Mitch auf?«
»Der kommt allein klar«, antwortete Casey. Kaitlyn widerstand dem Drang, ihre Bitte zu wiederholen. Gleichzeitig schweiften ihre Gedanken ab, und sie überlegte, wann sie zuletzt mit einem gut aussehenden Mann, den sie kaum kannte, in einem Auto gesessen hatte. In der Collegezeit vielleicht? Highschool? Überhaupt jemals?
Sie setzte sich ans Steuer und versuchte sich zu konzentrieren. Als sie den Motor anließ und zurücksetzte, horchte sie auf ein Scheppern oder Knirschen oder Klappern, aber da war tatsächlich nichts. Tanner sah aus dem Fenster.
»Sind Sie beruflich in der Stadt?«, fragte sie nach einer Weile.
»Privat.« Er sah sie von der Seite an und lächelte. Sie warf einen kurzen Blick zu ihm, wobei ihr auffiel, dass seine Zähne weiß und gleichmäßig waren. »Sie kennen nicht zufällig einen Dave Johnson, oder? Müsste meiner Schätzung nach so Ende fünfzig, Anfang sechzig sein?«
Sie dachte nach. »Nein, ich glaube nicht. Tut mir leid.«
»Macht nichts. Dachte ich mir schon, dass es nicht so leicht wird, ihn zu finden.«
»Sie wissen nicht, wo er wohnt?«
»Noch nicht.«
Sie beäugte ihn kritisch. »Ist er in Schwierigkeiten? Ich meine, sind Sie Kopfgeldjäger oder so was? Oder schuldet er Ihnen Geld?«
Er lachte. »Nein, nichts dergleichen. Ich bin weder Kopfgeldjäger noch Polizist, und er schuldet mir gar nichts. Sollte ich ihn tatsächlich finden, möchte ich nur mit ihm über etwas sprechen, was vor sehr langer Zeit passiert ist und mit meiner Familie zu tun hat. Mehr nicht.«
Seine mysteriöse Antwort machte sie neugierig, auch wenn Kaitlyn wusste, dass es sie nichts anging. »Dann viel Glück bei der Suche.«
»Danke.« Er drehte sich halb um. »Casey erwähnte, dass Sie Ärztin sind.«
»Ja, ich bin Internistin und habe eine Praxis hier in Asheboro.«
»Macht Ihnen das Spaß?«
»Was? Ärztin zu sein?« Auf sein Nicken hin legte sie kurz den Kopf schief, als dächte sie ernsthaft darüber nach. »Ja«, sagte sie. »Schon als kleines Mädchen wollte ich Ärztin werden.« Sie zog eine Augenbraue hoch. »Und was ist mit Ihnen? Was arbeiten Sie?«
»Momentan nicht viel. Ich bin vor drei Jahren mehr oder weniger ausgestiegen.«
»Okay.« Sie war nicht sicher, wie man auf eine solche Aussage reagieren sollte. »Und was haben Sie vorher gemacht?«
»Ich war vierzehn Jahre lang beim Militär, die letzten zehn davon bei der Delta Force. Danach habe ich noch gute sechs Jahre bei USAID gearbeitet.«
»Aha.« Die Armee erklärte die Tattoos und seine Körperhaltung, aber vermutlich wollte er über diese Zeit nicht ins Detail gehen. Nicht einer Fremden gegenüber jedenfalls, also stellte sie eine andere Frage. »Was ist USAID?«
»Das ist eine Bundesbehörde für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Die bieten Unterstützung im Bereich Landwirtschaft, Bildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen und so weiter an.«
»Dann haben Sie also in Washington, D. C. gearbeitet?«
»Nein. Dort ist zwar der Sitz, aber es gibt Einsätze auf der ganzen Welt. Ich war im Sicherheitsdienst im Ausland tätig.«
Das ließ sie kurz sacken. »Darf ich fragen, wo, oder ist das geheim?«
»Dürfen Sie. Es gibt Außenstellen in hundert Ländern, ich persönlich war in Kamerun, der Elfenbeinküste und am Ende in Haiti.«
»Wie kommt man denn an so einen Job? Haben Sie Internationale Beziehungen studiert oder so was?«
»Nein, nein. Nach meiner Entlassung habe ich mit meinem TAP-Berater überlegt, was ich machen soll. Da ich nicht in den privaten Militärsektor einsteigen wollte, schlug er USAID vor.«
»Was ist denn ein TAP-Berater?«
»Verzeihung. TAP steht für Transition Assistance Program, das soll Veteranen den Übergang ins zivile Leben erleichtern. Die Armee liebt Akronyme.«
Kaitlyn nickte nachdenklich. »Sind Sie nicht ein bisschen jung, um schon seit drei Jahren nicht zu arbeiten?«
»Kann sein«, räumte er ein. »Damals schien es mir das Richtige.«
»Und jetzt?«
»Es hat nicht vorgehalten. Im Juni fahre ich wieder nach Kamerun.«
»Mit USAID?«
»Nein, dieses Mal für das IRC.« Da er ihre nächste Frage schon vorausahnte, ergänzte er: »International Rescue Committee.«
Das war nachvollziehbar; er war noch relativ jung, und irgendwie musste man seine Lebenshaltungskosten decken, was bedeutete, dass jede Auszeit einmal ein Ende nahm.
»Darf ich fragen, wie lange Sie vorhaben, in Asheboro zu bleiben?«
»An sich bis ich den Mann gefunden habe, den ich suche, oder ich sicher bin, dass ich ihn hier nicht finde. Jetzt mit dem kaputten Auto hängt meine Planung allerdings ein bisschen in der Luft.«
Kaitlyn machte eine zerknirschte Miene. »Das tut mir ehrlich leid. Den Fotos nach gehört der Wagen eigentlich ins Museum. Beziehungsweise hätte es vor dem heutigen Abend gehört.«
»Es ist kein echter Oldtimer«, beruhigte er sie. »Nur ein Nachbau, erst ein paar Monate alt.«
»Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass meine Tochter ein richtig altes Auto zerbeult oder ein nagelneues.«
»Ich kann zumindest versichern, dass Letzteres nicht so spaßig ist.«
Der lockere Tonfall, in dem er das sagte, brachte sie zum Lächeln, und zum ersten Mal entspannte sie sich ein wenig.
»Also, sind Sie verheiratet?«, fragte sie.
»Nein, den Schritt habe ich nie gewagt.«
»Kinder?«
»Nicht dass ich wüsste.«
Sie lachte, aus unerfindlichen Gründen war sie leicht aufgedreht. »Und wo kommen Sie her? Ursprünglich, meine ich.«
»Europa, könnte man wohl sagen.«
Neugierig sah sie ihn an.
»Soldatenfamilie.« Er gab ihr einen kurzen Überblick über seine Kindheit.
»Und wo wohnen Sie jetzt?«
Beinahe entschuldigend hob er die Achseln. »Ich weiß nicht so genau, wie ich die Frage beantworten soll.«
»Sie haben keine Wohnung?«
»Noch nie gehabt. Bei der Armee habe ich entweder in der Kaserne gewohnt oder war im Auslandseinsatz, und bei USAID hatte ich Wohnungen, aber nur kurzfristig gemietet. Meine Freunde würden wahrscheinlich jetzt sagen, dass ich nicht gerade der sesshafte Typ bin.«
Vor ihrem geistigen Auge sah sie das Foto von ihm mit dem Paar, was sie auf einen anderen Gedanken brachte.
»Bevor ich Sie zum Hotel bringe – könnten Sie mir vielleicht Ihr Auto zeigen, damit ich noch ein paar Bilder machen kann? Falls meine Versicherung sie braucht?«
»Sicher doch«, sagte er sofort. »Wir waren im Coach’s. Kennen Sie das?«
»Ja.«
Sie bog ab, und ein paar Minuten später suchten sie auf dem immer noch überfüllten Parkplatz nach einer Lücke. Kaitlyn fragte sich, warum ganz Asheboro sich an diesem einen Ort versammelt zu haben schien.
»Die Basketball-Meisterschaft«, sagte Tanner, als hätte er ihre Gedanken gelesen.
Als sie vor dem Shelby standen, fiel Kaitlyn plötzlich ein, was sie vergessen hatte.
»Das werden Sie jetzt nicht glauben, aber ich habe mein Handy gar nicht dabei«, sagte sie verlegen.
Seine Augen blitzten erheitert auf. »Und Ihre Handtasche auch nicht, weshalb Sie vermutlich auch Ihren Führerschein vergessen haben.«
Ihre Lippen bildeten ein erschrockenes O, als sie erkannte, dass er recht hatte.
»Normalerweise bin ich nicht so schusselig.«