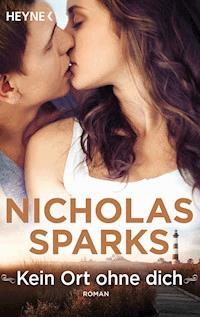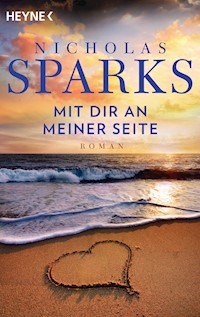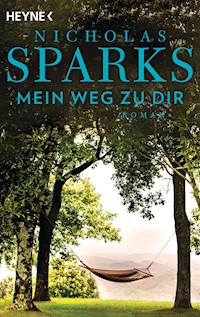9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Keiner schreibt über die Liebe wie Nicholas Sparks
Gibt es die ewige Liebe, die allen Widrigkeiten trotzt? John ist überzeugt davon. Nichts kann seine Beziehung zu Savannah gefährden, auch nicht der Umstand, dass er mehrere Jahre lang ins Ausland muss. Umso erschütterter ist er, als er ihren Abschiedsbrief empfängt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Als John Tyree Savannah begegnet, weiß er, dass er die Frau seines Lebens gefunden hat. Zum ersten Mal hat er ein klares Ziel vor Augen: so schnell wie möglich seinen Militärdienst ableisten, zu dem er sich aus reiner Orientierungslosigkeit gemeldet hatte, und dann mit Savannah eine Familie gründen. Doch alles läuft anders als geplant. Die Anschläge vom 11. September erschüttern Amerika schwer, und auch John kann sich dem verstärkten Gefühl der Verantwortung nicht entziehen. Daher verlängert er seinen Vertrag noch einmal, um seinem Land zu dienen. Aber der Preis ist hoch. Wenig später erhält er einen Brief von Savannah: Sie will nicht mehr länger auf ihn warten – denn sie hat sich in einen anderen verliebt. Doch John kann sie nicht vergessen. Als er endlich heimkehrt, sucht er sie auf. Sie ist verheiratet, aber sie hat die Vergangenheit noch nicht ganz hinter sich gelassen. Darf John jetzt noch um sie kämpfen?
Regisseur Lasse Hallström (Chocolat) verfilmte den Bestseller von Nicholas Sparks mit den Jungstars Amanda Seyfried (Mamma Mia!) und Channing Tatum (Krieg der Welten) in den Hauptrollen.
Der Autor
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt zusammen mit seiner Frau und fünf Kindern in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in 46 Ländern erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen. Besuchen Sie seine Website: www.nicholas-sparks.de.
Lieferbare Titel
Wie ein einziger Tag – Die Suche nach dem verborgenen Glück – Weit wie das Meer – Zeit im Wind – Das Schweigen des Glücks – Weg der Träume – Das Lächeln der Sterne – Du bist nie allein – Ein Tag wie ein Leben – Nah und fern – Die Nähe des Himmels – Das Wunder eines Augenblicks – Bis zum letzten Tag – Für immer der Deine – Mit dir an meiner Seite
Inhaltsverzeichnis
Für Micah und Christine
PROLOG
Lenoir, 2006
Was bedeutet es, jemanden wirklich zu lieben?
Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gedacht, ich weiß die Antwort auf diese Frage: Liebe bedeutet, dass Savannah mir wichtiger ist als ich selbst und dass wir den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen werden. Das konnte doch nicht so schwierig sein, oder? Sie hatte einmal zu mir gesagt, der Schlüssel zum Glück seien die Träume, die man verwirklichen kann, und ihre Träume seien nichts Außergewöhnliches. Ehe, Familie … sozusagen die Grundausstattung: ein guter Job für mich, dazu ein Haus mit weißem Lattenzaun, ein Geländewagen oder ein Kombi, groß genug, um unsere Kinder in die Schule, zum Zahnarzt, zum Fußballtraining und zur Klavierstunde zu fahren. Ob zwei oder drei Kinder, da war sie sich nicht ganz sicher, aber ich vermute, wenn es je so weit gekommen wäre, hätte sie vorgeschlagen, wir sollten der Natur nicht ins Handwerk pfuschen, sondern lieber Gott die Entscheidung überlassen. So war sie – so religiös, meine ich –, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, weshalb ich mich in sie verliebt habe. Aber ganz egal, was sonst noch in unserem Leben passieren würde – ich hatte damals immer dieses Bild vor Augen, wie wir spät am Abend im Bett liegen, ich nehme sie zärtlich in die Arme, wir reden leise miteinander und sind unendlich glücklich darüber, dass wir einander so nahe sein können.
Klingt nicht besonders anspruchsvoll, oder? Wenn zwei Menschen einander lieben, ist so etwas doch ganz selbstverständlich. Das hatte ich auch gedacht. Und während ein Teil von mir hofft, es könnte immer noch möglich sein, weiß mein Verstand längst, dass es niemals wahr werden wird. Wenn ich diesmal von hier weggehe, werde ich nie zurückkehren.
Aber jetzt sitze ich auf dem Hügel, schaue hinunter auf ihre Farm und warte darauf, dass sie kommt. Sie kann mich nicht sehen: Beim Militär lernt man, wie man sich unsichtbar macht und mit seiner Umgebung verschmilzt, und ich habe das sehr gut trainiert, weil ich keine Lust hatte, irgendwo in der irakischen Wüste zu sterben, mitten im Nichts. Ich musste unbedingt in dieses kleine Bergstädtchen in North Carolina zurückkehren, um in Erfahrung zu bringen, wie alles weiterging. Wenn man etwas in Bewegung setzt, möchte man wissen, was daraus geworden ist. Man empfindet ein diffuses Unbehagen, ja, es tut fast weh – bis man endlich die Wahrheit kennt.
Eines weiß ich jedoch mit Sicherheit: Savannah wird nie erfahren, dass ich heute hier bin.
Ich leide natürlich darunter, dass sie ganz in meiner Nähe ist und dennoch unerreichbar, aber ihre Geschichte und meine Geschichte gehören nicht mehr zusammen. Es ist nicht leicht für mich, diese Tatsache zu akzeptieren, denn früher waren unsere Leben eng miteinander verknüpft. Aber das ist sechs Jahre her. Dabei kommt es mir vor, als wären es schon tausend Jahre. Wir haben viele gemeinsame Erinnerungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Erinnerungen eine physische, fast greifbare Präsenz besitzen können, aber auch in dieser Hinsicht unterscheiden wir uns stark voneinander, Savannah und ich. Ihre Erinnerungen sind wie die funkelnden Sterne am Nachthimmel, während meine die verzweifelten, dunklen Stellen dazwischen sind. Und im Gegensatz zu ihr stehe ich immer vor den Fragen, die ich mir schon unzählige Male stellte, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben: Warum habe ich es getan? Und würde ich es wieder tun?
Man muss wissen: Ich bin derjenige, der den Schlussstrich gezogen hat.
Die Blätter an den Bäumen um mich herum verfärben sich langsam herbstlich, manche sind schon richtig rot, und wenn gleich die Sonne über den Horizont steigt, werden sie feurig glühen. Die Vögel haben ihr Morgenlied begonnen, die Luft duftet nach Kiefern und nach feuchter Erde – ganz anders als der salzige Meeresgeruch meiner Heimatstadt. Bald öffnet sich die Haustür, und dann werde ich sie sehen. Da ist sie. Trotz der Entfernung halte ich den Atem an, als sie in die Morgendämmerung tritt. Sie reckt und streckt sich, ehe sie die Verandastufen hinuntergeht zur Pferdekoppel hinter dem Haus. Das Gras schimmert wie ein grüner Bergsee. Savannah öffnet das Gatter. Ein Pferd wiehert laut zur Begrüßung, ein zweites stimmt mit ein, und mein erster Gedanke ist, dass sie doch eigentlich viel zu klein und zu zart ist, um sich so unbefangen zwischen den riesigen Tieren zu bewegen. Aber sie fühlte sich in deren Gegenwart schon immer ausgesprochen wohl, und das gilt umgekehrt auch für die Pferde. Sechs grasen beim Zaun; es sind vor allem die Quarter Horses, diese kräftigen amerikanischen Reitpferde. Midas, ihr schwarzer Araberhengst mit den weißen Fesseln, steht ein wenig abseits.
Ein einziges Mal bin ich mit Savannah ausgeritten. Ich kann von Glück reden, dass ich mir keine ernsthafte Verletzung zugezogen habe, denn es war ganz schön strapaziös. Ich weiß noch, wie ich dachte: Sie wirkt im Sattel so entspannt, als würde sie fernsehen.
Savannah begrüßt jetzt Midas. Sie reibt seine Nase, flüstert ihm irgendetwas zu und klatscht ihm auf den Schenkel. Als sie sich kurz darauf abwendet, stellt er horchend die Ohren auf. Dann verschwindet sie im Stall.
Kurz darauf erscheint sie wieder. Sie trägt zwei Eimer – Hafer, nehme ich an –, die sie jeweils an einen Zaunpfosten hängt, und sofort kommen die Pferde angetrabt. Savannah tritt einen Schritt zurück, um ihnen Platz zu machen. Durch die Bewegung wehen ihre Haare in der morgendlichen Brise. Sie holt Sattel und Zaumzeug und macht Midas für den Ausritt fertig, während er frisst. Ein paar Minuten später führt sie ihn von der Koppel zum Pfad in den Wald. Sie sieht noch genauso aus wie vor sechs Jahren. Ich weiß, dass es nicht stimmt – ich habe sie ja letztes Jahr aus der Nähe gesehen und die ersten feinen Fältchen um ihre Augen entdeckt –, aber für mich wird sie immer einundzwanzig sein. Und ich bleibe dreiundzwanzig. Ich war damals in Deutschland stationiert; Bagdad und Falludscha lagen noch vor mir, und ich hatte ihren Brief noch nicht bekommen, diesen Brief, den ich in den ersten Wochen des Krieges im Bahnhof von Samawah las, als ich noch nichts von den Entwicklungen ahnte, die mein Leben grundlegend verändern sollten.
Jetzt bin ich neunundzwanzig, und ich frage mich immer und immer wieder, warum ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe. Die Armee ist für mich heute die einzige Lebensform, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber ärgern oder mich freuen soll; ich denke mal so, mal so, es schwankt je nach Tagesform. Wenn mich die Leute fragen, sage ich ihnen, dass ich ein einfacher Soldat bin, und das meine ich ernst. Ich lebe immer noch auf einer Militärbasis in Deutschland, habe ungefähr tausend Dollar gespart und bin seit Jahren nicht mehr mit einer Frau ausgegangen. Ich surfe nicht mehr oft, nicht mal im Urlaub. An meinen freien Tagen fahre ich mit meiner Harley durch die Gegend, fahre einfach drauflos, ganz nach Lust und Laune. Die Harley ist das Beste, was ich mir je gekauft habe, obwohl sie mich da drüben in Europa ein Vermögen gekostet hat. Sie passt zu mir, seit ich so eine Art Einzelgänger geworden bin. Die meisten meiner Freunde sind längst aus der Armee ausgeschieden. Ich hingegen werde wahrscheinlich in ein paar Monaten wieder in den Irak geschickt. Jedenfalls kursieren auf dem Stützpunkt die entsprechenden Gerüchte. Als ich Savannah Lynn Curtis kennenlernte – für mich wird sie immer Savannah Lynn Curtis bleiben –, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass mein Leben einmal so aussehen würde, wie es jetzt aussieht, und ich hätte auch nie geglaubt, dass ich tatsächlich Berufssoldat werden könnte.
Aber eben weil ich sie getroffen habe, erscheint mir mein jetziges Leben so merkwürdig. Als wir zusammen waren, liebte ich sie, und in den Jahren, die wir getrennt waren, wurde diese Liebe nur noch tiefer. Unsere Geschichte besteht aus drei Teilen: Sie hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Eigentlich sind ja alle Geschichten so aufgebaut, und trotzdem kann ich es immer noch nicht fassen, dass unsere nicht einfach weitergeht, für immer und ewig.
Und während ich hier sitze und grüble, sehe ich unsere gemeinsame Zeit an mir vorüberziehen. Ich weiß noch ganz genau, wie alles begann. Und die Erinnerungen sind das Einzige, was mir geblieben ist.
TEIL I
KAPITEL 1
Wilmington, 2000
Ich heiße John Tyree. Ich wurde 1977 geboren und wuchs in Wilmington auf, einer Stadt, die stolz darauf ist, dass sie den größten Hafen von North Carolina hat und auf eine lange, interessante Geschichte zurückblicken kann, auch wenn es mir manchmal so vorkommt, als wäre die Stadt rein zufällig entstanden. Klar, das Wetter hier ist ideal, die Strände sind makellos, aber die Stadt war keineswegs auf den Ansturm von Rentnern aus den Nordstaaten vorbereitet, die für ihren Lebensabend einen Ort suchten, der nicht allzu teuer ist. Wilmington liegt auf einer relativ schmalen Landzunge zwischen dem Cape Fear River auf der einen Seite und dem Atlantik auf der anderen. Der Highway 17 in Richtung Myrtle Beach beziehungsweise Charleston führt quer durch die Stadt und bildet sozusagen die Hauptstraße. Als ich klein war, konnten mein Dad und ich vom historischen Viertel am Fluss in zehn Minuten zu dem Badeort Wrightsville Beach fahren, aber inzwischen gibt es auf dieser Strecke so viele Ampeln und Einkaufszentren, dass man je nach Verkehrslage eine ganze Stunde braucht – vor allem am Wochenende, wenn die Touristen kommen. Wrightsville Beach liegt am nördlichen Ende von Wilmington, auf einer Insel direkt vor der Küste, und gehört zu den beliebtesten Stränden von ganz North Carolina. Die Häuser in den Dünen sind astronomisch teuer, und die meisten werden den ganzen Sommer über vermietet. Die Outer Banks sind sicher romantischer, weil sie so abgeschieden liegen und weil es dort wilde Pferde gibt, und außerdem begannen die Brüder Orville und Wilbur Wright dort ihren berühmten Flug. Aber ich muss sagen, dass die meisten Leute, die ihre Ferien am Strand verbringen wollen, sich am wohlsten fühlen, wenn es in ihrer Nähe einen McDonald’s oder einen Burger King gibt, für den Fall, dass die lieben Kleinen die regionalen Gerichte nicht mögen; und die Erwachsenen möchten nicht nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl haben, wenn sie sich am Abend noch irgendwo vergnügen wollen.
Wie in allen Städten gibt es auch in Wilmington arme und reiche Viertel. Da mein Dad einen der sichersten und seriösesten Jobs der Welt hatte – er fuhr die Post aus –, ging es uns ganz gut. Nicht übertrieben, aber okay. Wir waren alles andere als wohlhabend, wohnten allerdings so nahe an einem vornehmen Bezirk, dass ich eine der besten Highschools in der Stadt besuchen konnte. Im Vergleich zu den Häusern, in denen meine Freunde lebten, wirkte unseres alt und klein; die Veranda war schon ziemlich schief, aber der Garten machte alles wett. Hinter dem Haus stand eine riesige Eiche, und als ich acht war, baute ich mir aus Holzresten, die ich an einer Baustelle aufgelesen hatte, ein tolles Baumhaus ganz ohne die Hilfe meines Dads (wenn er es schaffte, mit dem Hammer einen Nagel zu erwischen, konnte man das als Glückstreffer bezeichnen). Im selben Sommer brachte ich mir auch das Surfen bei. Ich hätte wahrscheinlich merken müssen, dass ich völlig anders war als mein Dad, aber mir fielen die Unterschiede gar nicht auf – woran man wieder einmal sehen kann, wie wenig man als Kind vom Leben kapiert.
Mein Dad und ich waren so verschieden, wie zwei Menschen nur sein können. Er war passiv und verschlossen, während ich stets in Bewegung sein musste und nicht gern allein war; er legte großen Wert auf Bildung, wohingegen für mich die Schule ein Ort war, an dem man Freunde traf und Sport trieb. Er hatte eine schlechte Körperhaltung und schlurfte ein bisschen, während ich immer hopste und rannte und ihn ständig bat, doch bitte die Zeit zu stoppen, die ich von einem Ende unserer Straße bis zum anderen brauchte. Schon in der achten Klasse war ich größer als er, und ein Jahr später besiegte ich ihn beim Armdrücken. Wir sahen einander auch überhaupt nicht ähnlich. Dad hatte helle Haare, haselnussbraune Augen und Sommersprossen, meine Haare und Augen waren dunkelbraun, und meine sowieso eher dunkle Haut war schon im Mai sonnengebräunt. Unsere Nachbarn fanden es komisch, dass es zwischen uns so wenig Familienähnlichkeit gab. Ihre etwas irritierte Reaktion war vor allem auch deshalb verständlich, weil Dad mich allein erzog. Als ich älter wurde, hörte ich manchmal, wie sie sich hinter vorgehaltener Hand darüber unterhielten, dass meine Mom sich aus dem Staub gemacht hatte, noch bevor ich ein Jahr alt war. Erst ziemlich spät kam mir der Verdacht, dass sie einen anderen Mann kennengelernt haben könnte, aber mein Vater hat diese Vermutung nie bestätigt. Er sagte immer nur, ihr sei klar geworden, dass es ein Fehler gewesen war, so früh zu heiraten. Sie sei einfach noch nicht reif dafür gewesen, Mutter zu sein. Dad sprach nie schlecht über sie, aber er sagte auch nie etwas Positives. Nein, er sorgte lediglich dafür, dass ich sie in mein Abendgebet einschloss, gleichgültig, wo sie war und was sie getan hatte. Bis zum heutigen Tag habe ich kein einziges Wort mit ihr gewechselt, und ich möchte es auch gar nicht mehr.
Ich glaube, mein Dad war ganz zufrieden mit seinem Leben. Ich drücke mich bewusst so vorsichtig aus, weil er seine Gefühle nie richtig zeigte. Als ich klein war, kam es nur selten vor, dass er mich in den Arm nahm und drückte, und wenn er es ausnahmsweise doch einmal tat, hatte ich immer den Eindruck, dass er sich irgendwie dazu verpflichtet fühlte und es kein inneres Bedürfnis war. Ich weiß, dass er mich geliebt hat, weil er sich immer sehr gewissenhaft um mich kümmerte. Aber er war schon dreiundvierzig, als ich auf die Welt kam, und ich habe oft gedacht, dass es besser zu meinem Dad gepasst hätte, wenn er Mönch geworden wäre und nicht Vater. Überhaupt war er der ruhigste Mensch, den ich kannte. Er erkundigte sich ganz selten nach meinen Erlebnissen und geriet nie außer sich. Besonders lustig oder gar übermütig war er allerdings auch nie. Er führte ein unglaublich geregeltes Leben. Jeden Morgen machte er für mich Rührei, Toast und Speck, und beim Abendessen, das er auch immer selbst kochte, hörte er mir zu, wenn ich von der Schule erzählte. Die Zahnarzttermine vereinbarte er schon zwei Monate im Voraus, er bezahlte immer am Samstagmorgen seine Rechnungen, die Wäsche wusch er nur am Sonntagnachmittag, und in der Frühe ging er exakt um 7 Uhr 35 aus dem Haus. Im Umgang mit anderen Menschen war er etwas ungeschickt und schüchtern. Er verbrachte ja den größten Teil des Tages allein und steckte Päckchen und Briefe in die Briefkästen. Mit Frauen verabredete er sich nie, und er spielte auch nicht am Wochenende mit Freunden bis tief in die Nacht Poker. Es konnte passieren, dass unser Telefon wochenlang nicht klingelte. Und wenn es dann doch einmal schrillte, war der Anrufer entweder falsch verbunden, oder jemand wollte uns etwas verkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es für meinen Vater schwer war, mich allein zu erziehen, aber er klagte nie, auch nicht, wenn ich ihn enttäuschte.
Die Abende verbrachte ich meistens ohne ihn. Wenn die Alltagspflichten erledigt waren, zog sich Dad in sein Arbeitszimmer zurück, um sich seinen Münzen zu widmen. Münzen waren die große Leidenschaft seines Lebens. Am glücklichsten schien er, wenn er in seinem Zimmer saß, den Münzhändler-Rundbrief studierte, der sich lustigerweise Greysheet, also Graublatt, nannte, und sich überlegte, welche Münze er als nächste für seine Sammlung kaufen könnte. Mein Großvater hatte die Münzsammlung begonnen, und sein großes Vorbild war ein Mann namens Louis Eliasberg gewesen, ein Banker aus Baltimore. Eliasberg war der einzige Mensch, der sämtliche Münzen der Vereinigten Staaten besaß, alle Daten und Prägungen. Eliasbergs Sammlung konnte es mit der des Smithsonian Museums aufnehmen, wenn sie nicht sogar noch besser war, und als meine Großmutter 1951 starb, kam mein Großvater auf die Idee, gemeinsam mit seinem Sohn auch eine solche Sammlung anzulegen. Sie wurde zu einer richtigen Besessenheit. Im Sommer fuhren mein Großvater und mein Vater immer mit dem Zug zu verschiedenen Münzereien, um die neuesten Prägungen gleich an Ort und Stelle zu erwerben, und sie ließen kaum eine Münz-Messe im Südosten der USA aus. Nach und nach knüpften sie Kontakte zu Münzhändlern in ganz Amerika, und mein Großvater gab im Laufe der Jahre ein Vermögen dafür aus, seine Sammlung zu vergrößern. Im Gegensatz zu Louis Eliasberg war mein Großvater jedoch nicht reich – er führte eine kleine Gemischtwarenhandlung in Burgaw, die leider pleiteging, als am anderen Ende der Stadt ein Piggly Wiggly aufmachte. Trotzdem wurde jeder Extradollar für Münzen gespart. Großvater trug dreißig Jahre lang dasselbe Jackett und fuhr sein ganzes Leben denselben Wagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Dad bei der Post anfing, statt aufs College zu gehen, weil keine zehn Cent übrig waren, um eine Ausbildung zu bezahlen, die über die Highschool hinausging. Granddad war ein komischer Kauz, das muss man sagen. Genau wie mein Vater. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie es so schön heißt. Und bevor der alte Mann starb, legte er in seinem Testament fest, man solle sein Haus verkaufen und mit dem Geld weitere Münzen erwerben – was mein Dad vermutlich sowieso getan hätte.
Als Dad die Sammlung übernahm, war sie schon ziemlich wertvoll. Dann ging die Inflationsrate rapide nach oben, bis die Unze Gold 850 Dollar kostete, und die Sammlung war auf einmal ein kleines Vermögen wert. Mein Dad hätte problemlos in den Ruhestand gehen können. Aber weder mein Großvater noch mein Vater sammelten die Münzen des Geldes wegen; was sie reizte, war die Jagd, und sie genossen es, dass das gemeinsame Interesse sie so eng miteinander verband. Sie fanden es beide unglaublich spannend, nach einer bestimmten Münze zu fahnden, sie nach langen Mühen endlich aufzuspüren und dann noch einen guten Preis auszuhandeln. Manchmal konnten sie sich eine Münze leisten, manchmal nicht, aber jedes einzelne Stück, das sie der Sammlung hinzufügten, war für sie ein Schatz. Mein Dad hoffte, dass ich seine Leidenschaft teilen und wie er die Opfer, die diese Leidenschaft forderte, bereitwillig auf mich nehmen würde. Als Kind musste ich mich mit Wolldecken als Bettzeug begnügen, und ich bekam jedes Jahr höchstens ein Paar neue Schuhe; es war nie genug Geld für Kleidungsstücke da, es sei denn, sie stammten von der Heilsarmee. Dad besaß nicht einmal einen Fotoapparat. Das einzige Bild, das es von uns gibt, wurde bei einer Münz-Messe in Atlanta aufgenommen. Ein Händler machte einen Schnappschuss von uns und schickte ihn uns zu. Jahrelang stand das Foto auf dem Schreibtisch meines Vaters: Er legt mir den Arm um die Schulter, und wir strahlen beide über das ganze Gesicht. Ich halte einen 1926-D Buffalo-Nickel in der Hand, eine Fünfcentmünze in erstklassigem Zustand, die mein Dad gerade gekauft hat. Bei dieser Münze handelt es sich um einen der seltensten Buffalo-Nickel, die es gibt, und wir aßen einen ganzen Monat lang nur Hotdogs und Bohnen, weil das gute Stück viel mehr gekostet hatte, als in Dads Budget vorgesehen war.
Diese Einschränkungen störten mich nicht weiter – jedenfalls nicht in den ersten Jahren. Als mein Dad mir die Münzsammlung zum ersten Mal zeigte (ich muss damals in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sein), redete er mit mir wie mit einem Gleichberechtigten. Wenn man als kleines Kind von einem Erwachsenen so behandelt wird, ist man extrem stolz und sonnt sich in dieser Aufmerksamkeit. Ich sog alle Informationen gierig auf. Es dauerte nicht lange, bis ich genau wusste, wie viele Saint-Gaudens Double Eagle 1927 im Verhältnis zu 1924 geprägt wurden und warum ein Barber Dime von 1895, der in New Orleans geprägt wurde, zehnmal so wertvoll war wie die Zehncentmünze, die im selben Jahr in Philadelphia entstand. Solche Details weiß ich übrigens bis heute. Doch im Gegensatz zu meinem Dad verlor ich mit der Zeit das Interesse an der Sammlung. Für ihn gab es eigentlich kein anderes Thema, über das er gern redete, und nachdem ich sechs oder sieben Jahre lang die Wochenenden immer nur mit ihm verbracht hatte, statt mit Freunden wegzugehen, gab es für mich nur noch ein Ziel: Ich wollte ausbrechen. Wie die meisten Jungen fing ich an, mich für andere Dinge zu interessieren: für Sport und für Mädchen, für Autos und für Musik. Mit vierzehn war ich eigentlich kaum noch zu Hause. Ich wurde immer unzufriedener und wütender. Die Unterschiede zwischen unserer Art zu leben und dem Lebensstil meiner Freunde fielen mir verstärkt auf. Meine Freunde hatten genug Geld, um ins Kino zu gehen oder um sich eine schicke Sonnenbrille zu kaufen, während ich in den Sofaritzen nach Münzen graben musste, um mir wenigstens bei McDonald’s einen Hamburger kaufen zu können. Nicht wenige meiner Kumpel bekamen zum sechzehnten Geburtstag ein Auto geschenkt; mir überreichte mein Dad einen Silberdollar, einen 1883 Morgan, der in Carson City geprägt worden war. Risse im Bezug unseres alten Sofas wurden mit einer Wolldecke kaschiert, und wir waren die einzige Familie weit und breit, die kein Kabelfernsehen und keine Mikrowelle hatte. Als unser Kühlschrank kaputtging, kaufte Dad einen gebrauchten, der scheußlich grün war und überhaupt nicht in unsere Küche passte. Mir war es immer peinlich, wenn meine Freunde zu uns kamen, und die Schuld dafür gab ich meinem Vater. Ich weiß, das war nicht besonders souverän von mir – wenn mich der Geldmangel dermaßen störte, dann hätte ich eben für die Nachbarn den Rasen mähen oder andere kleine Jobs erledigen müssen. Aber darauf bin ich damals gar nicht gekommen. So war ich eben. Ich war blind wie ein Maulwurf und dumm wie ein Esel, aber selbst wenn ich heute meine mangelnde Reife bedaure, kann ich doch die Vergangenheit nicht ändern.
Mein Dad spürte, dass ich mich von ihm entfernte, aber er wusste nicht, was er tun sollte. Er versuchte, so gut er konnte, unser Verhältnis wieder ins Lot zu bringen. Für ihn gab es nur eine Methode der Kontaktaufnahme, und es war die gleiche Methode, die schon sein Vater angewandt hatte: Er redete über Münzen – nur darüber konnte er ungehemmt sprechen. Nach wie vor bereitete er für mich das Frühstück und das Mittagessen zu. Trotzdem entfernten wir uns immer weiter voneinander. Ich verlor auch die Verbindung zu den Freunden, die ich seit meiner frühen Kindheit kannte. Sie teilten sich in verschiedene Cliquen auf, je nachdem, welche Filme sie sahen oder welche Markenklamotten sie im Shoppingcenter kauften – und ich stand immer abseits. Sie können mich alle mal, dachte ich. In der Highschool findet jeder seinen Platz, und so kam es, dass ich mich mit den falschen Leuten anfreundete. Es waren die Jungs, denen alles gleichgültig war, und schon bald war auch mir alles egal. Ich schwänzte den Unterricht, ich rauchte und wurde wegen Schlägereien drei Mal vom Unterricht suspendiert.
Ich trieb auch keinen Sport mehr. Ich hatte Football und Basketball gespielt und war ein guter Langstreckenläufer gewesen, jedenfalls bis zur zehnten Klasse. Obwohl sich Dad manchmal, wenn ich nach Hause kam, nach den Ergebnissen der Wettkämpfe erkundigte, war er doch nie besonders begeistert, wenn ich ausführlich berichtete, weil er von Sport absolut nichts verstand. Er hatte noch nie im Leben in einer Mannschaft gespielt. Und er kam nur ein einziges Mal zu einem Basketballspiel. Das war während des zehnten Schuljahres. Er saß auf der Tribüne, ein sonderbarer älterer Mann mit schütterem Haar, in einem abgetragenen Sportsakko und Socken, die nicht zusammenpassten. Er war zwar nicht dick, aber seine Hose spannte an der Taille, als wäre er im dritten Monat schwanger. Ich wollte nichts mit ihm zu tun haben. Schon sein Anblick war mir peinlich, und nach dem Spiel ging ich ihm aus dem Weg. Ich bin nicht stolz auf mein Verhalten, aber so war ich eben.
Es kam noch schlimmer. Im letzten Schuljahr erreichte meine Rebellion ihren Höhepunkt. Meine Noten waren seit zwei Jahren kontinuierlich schlechter geworden, aber eher aus Faulheit und Desinteresse als wegen mangelnder Intelligenz (bilde ich mir jedenfalls ein). Mehr als einmal erwischte mich mein Vater dabei, wie ich mitten in der Nacht und mit einer ziemlichen Alkoholfahne nach Hause kam. Gelegentlich wurde ich auch von der Polizei nach Hause gebracht, weil ich bei einer Party aufgegriffen worden war, auf der eindeutig Drogen und Alkohol konsumiert wurden. Und als Dad mich mit Hausarrest bestrafen wollte, bekam ich einen Tobsuchtsanfall: Ich schrie, das gehe ihn nichts an, und zog für ein paar Wochen zu einem Freund. Als ich wieder nach Hause kam, sagte Dad kein Wort; stattdessen warteten morgens wie immer Rührei, Toastbrot und Speck auf mich, als wäre nichts geschehen. Mit Mühe und Not schaffte ich meinen Schulabschluss, aber ich glaube, ich bekam mein Zeugnis nur, weil man mich loswerden wollte. Ich weiß, dass sich mein Vater große Sorgen um mich machte, und hin und wieder versuchte er auf seine scheue Art, das Thema College anzusprechen, aber das war für mich längst abgehakt – ich hatte mich entschlossen, nicht weiterzumachen. Ich wollte einen Job, ich wollte ein Auto, ich wollte all die materiellen Dinge, auf die ich achtzehn Jahre lang hatte verzichten müssen. Von meinen Plänen erzählte ich Dad nichts, bis zum Sommer nach dem Schulabschluss, und als er erfuhr, dass ich mich gar nicht fürs College beworben hatte, zog er sich für den Rest des Abends in sein Zimmer zurück. Am nächsten Morgen beim Frühstück – es gab wie immer Rührei mit Speck – sagte er auch nichts, doch am Ende des Tages versuchte er, mich in eine Diskussion über Münzen zu verwickeln. Er wollte irgendwie die alte Nähe zwischen uns wiederherstellen.
»Erinnerst du dich, wie wir nach Atlanta gefahren sind und du den Buffalo-Nickel entdeckt hast, nach dem wir jahrelang gefahndet hatten?«, fing er an. »Es war der Nickel, mit dem wir dann fotografiert wurden, weißt du noch? Du hast dich so gefreut – das werde ich nie vergessen. Ich musste daran denken, wie das mit meinem Vater und mir war.«
Ich schüttelte ungeduldig den Kopf, und die ganze Frustration, die sich während des Zusammenlebens mit meinem Dad aufgestaut hatte, brach aus mir heraus. »Ich habe es endgültig satt, mir dauernd diesen Münzen-Quatsch anzuhören!«, schimpfte ich los. »Die verdammten Münzen hängen mir zum Hals raus. Meinetwegen kannst du dir die Sammlung sonst wohin stecken!«
Dad erwiderte nichts, aber ich werde nie den gequälten Gesichtsausdruck vergessen, mit dem er sich schließlich abwandte und in sein Zimmer trottete. Ich hatte ihn zutiefst verletzt. Ich redete mir zwar ein, ich hätte es nicht so böse gemeint, aber im Grunde wusste ich, dass ich mir etwas vormachte. Dad sprach nie wieder mit mir über seine Münzsammlung, und ich mied das Thema ebenfalls. Zwischen Dad und mir klaffte ein Abgrund, wir hatten einander nichts mehr zu sagen. Ein paar Tage später fiel mir auf, dass das einzige Foto von uns verschwunden war, als hätte Dad Angst, ich könnte schon den geringsten Hinweis auf die Münzsammlung unerträglich finden. Vielleicht stimmte das damals sogar, denn es machte mir nicht einmal etwas aus, dass ich annehmen musste, er habe das Bild weggeworfen.
Als Kind hatte ich nie daran gedacht, zum Militär zu gehen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Im Osten von North Carolina gab es zwar sehr viele militärische Einrichtungen, mehr als irgendwo sonst in den Staaten – von Wilmington aus konnte man mit dem Auto innerhalb weniger Stunden insgesamt sieben Militärstützpunkte erreichen –, aber ich hatte immer gedacht, das Soldatenleben sei nur etwas für Versager. Wer wollte schon freiwillig sein Leben damit verbringen, sich von irgendeinem Idioten mit kahl rasiertem Schädel herumkommandieren zu lassen? Ich nicht! Und außer ein paar Unverbesserlichen gab es an meiner Highschool kaum jemanden, der zur Armee wollte. Die Schüler mit den guten Noten bewarben sich an der University of North Carolina oder an der North Carolina State University, während die weniger erfolgreichen in Wilmington blieben, sich von einem miesen Job zum nächsten hangelten, Bier tranken, in den Kneipen herumhingen und allem aus dem Weg gingen, was irgendwie nach Verantwortung roch.
Ich gehörte zur zweiten Gruppe. In den ersten beiden Jahren nach meinem Schulabschluss hatte ich alle möglichen Jobs: Ich arbeitete als Hilfskellner im Outback Steakhouse, im Kino als Kartenabreißer, ich räumte im Supermarkt Regale ein, bereitete im Waffle House Pfannkuchen zu und verdiente mein Geld als Kassierer in verschiedenen Souvenirläden, die den Touristen die Dollars aus der Tasche zogen. Was ich einnahm, gab ich sofort wieder aus, ich machte mir auch keine Illusionen, ich könnte irgendwo auf der Karriereleiter nach oben klettern und ins Management kommen. Außerdem wurde mir sowieso meistens irgendwann gekündigt. Eine Zeit lang ließ mich auch das völlig kalt. Ich lebte mein Leben, ging abends noch surfen, oft bis spät in die Nacht, und schlief morgens lang. Weil ich zu Hause wohnte, brauchte ich kein Geld für Miete, Essen, Versicherungen oder für die Altersvorsorge. Und meine Freunde machten auch nichts anderes als ich. Soweit ich mich erinnere, war ich gar nicht besonders unglücklich. Aber nach einer Weile fand ich mein Leben schlicht langweilig. Nicht das Surfen – 1996 brausten Hurrikan Bertha und Hurrikan Fran über die Küste und brachten die tollsten Wellen seit Jahren mit sich, aber wenn ich nach dem Surfen noch in Leroy’s Bar saß, nervte es mich plötzlich, dass ein Abend wie der andere war: Ich trank mein Bier und traf irgendjemanden, den ich noch von der Schule kannte, er fragte mich, was ich machte, ich fragte zurück, und es war immer ziemlich schnell klar, dass wir uns beide auf der Straße nach Nirgendwo befanden. Selbst wenn die anderen im Gegensatz zu mir eine eigene Wohnung hatten, glaubte ich ihnen nicht, wenn sie behaupteten, dass ihnen ihre Jobs beim Straßenbau, als Fensterputzer oder Campingtoilettenreiniger wirklich gefielen, weil ich genau wusste, dass es sich bei keiner dieser Arbeiten um die Art von Beschäftigung handelte, von der sie als Kinder geträumt hatten. Ich mochte in der Schule faul gewesen sein, aber dumm war ich nicht.
Während dieser Phase meines Lebens ging ich mit vielen Frauen aus. Es gab in Leroy’s Bar jede Menge weibliche Gäste, die sich gern ansprechen ließen. Die meisten dieser Beziehungen bedeuteten mir nichts. Ich nutzte die Frauen aus und ließ mich von ihnen ausnutzen. Meine Gefühle behielt ich für mich. Nur meine Beziehung mit Lucy dauerte länger als ein paar Monate, und bevor wir auseinandergingen, was unvermeidlich schien, dachte ich kurzfristig, ich würde sie tatsächlich lieben. Sie studierte an der University of North Carolina, war ein Jahr älter als ich und wollte nach dem College in New York arbeiten. »Du bist mir sehr wichtig«, sagte sie an unserem letzten gemeinsamen Abend. »Aber du und ich, wir wollen verschiedene Dinge vom Leben. Du könntest so viel aus dir machen, aber aus irgendeinem Grund bist du zufrieden damit, dich einfach nur treiben zu lassen.« Sie zögerte einen Moment, bevor sie weitersprach. »Und außerdem war ich nie sicher, was du wirklich für mich empfindest.« Sie hatte recht: Ich hatte ihr noch nie gesagt, wie viel sie mir bedeutete. Kurz darauf reiste sie ab, ohne sich von mir zu verabschieden. Ein Jahr später, nachdem ich von ihren Eltern ihre New Yorker Telefonnummer erfragt hatte, rief ich sie noch einmal an. Wir unterhielten uns etwa zwanzig Minuten lang. Sie sei mit einem Rechtsanwalt verlobt, erzählte mir Lucy, im Juni würden sie heiraten.
Das Telefongespräch ging mir näher, als ich erwartet hatte. An jenem Tag war ich gerade mal wieder gefeuert worden, also tröstete ich mich in Leroy’s Bar. Dort hingen dieselben Versager herum wie immer. Im Grunde hatte ich nicht die geringste Lust, noch einen sinnlosen Abend mit ihnen zu verbringen und so zu tun, als wäre mein Leben in Ordnung. Also kaufte ich mir einen Sixpack Bier, setzte mich an den Strand und schaute hinaus aufs Meer. Es war das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich ernsthaft darüber nachdachte, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Wie wär’s, wenn ich doch den Rat meines Vaters befolgen und einen College-Abschluss machen würde? Aber die Schule lag schon so weit zurück, dass mir die Vorstellung, wieder zu büffeln, absurd erschien. Man mag von Glück oder von Pech reden – jedenfalls joggten genau in dem Moment zwei Marines an mir vorbei. Sie waren jung, sie waren durch und durch fit, und sie strahlten ein enormes Selbstbewusstsein aus. Wenn die beiden es schaffen, dachte ich, dann kann ich es auch.
Ein paar Tage grübelte ich noch darüber nach, und letzten Endes gab mein Dad den Ausschlag. Ich redete nicht mit ihm über meine Gedanken, natürlich nicht – wir wechselten damals kaum ein Wort. Eines Abends ging ich von meinem Zimmer in die Küche und sah ihn im Vorbeigehen an seinem Schreibtisch sitzen. Und dieses Mal schaute ich richtig hin. Er hatte fast keine Haare mehr, und die wenigen, die noch übrig waren, schimmerten silbergrau. Bald würde er in den Ruhestand gehen. Ich erschrak. Ich hatte nicht das Recht, ihn immer wieder zu enttäuschen, nach allem, was er für mich getan hatte!
Also ging ich zum Militär. Zuerst wollte ich zum US Marine Corps, weil ich davon die konkreteste Vorstellung hatte: Der Strand von Wrightsville Beach war stets voller Marines (man nannte sie »Jarheads«, weil sie mit ihrem radikalen Kurzhaarschnitt aussahen wie umgedrehte Töpfe), die in Camp Lejeune oder Cherry Point stationiert waren. Aber als es so weit war, ging ich doch nicht zu dieser Elitetruppe, sondern ganz normal zum Heer. Der entscheidende Faktor war, dass der Werber für die Marines gerade Mittagspause machte, als ich vorbeischaute, während der für das Heer zuständige Typ – dessen Büro sich auf der anderen Straßenseite befand – gleich ansprechbar war. Die Entscheidung fiel also letzten Endes ziemlich spontan. Kurz entschlossen unterschrieb ich einen Vierjahresvertrag, aber als der Werber mir zum Schluss auf die Schulter klopfte und mir gratulierte, fragte ich mich dann doch, worauf ich mich da eigentlich eingelassen hatte. Das war Ende 1997, und ich war zwanzig Jahre alt.
Die Grundausbildung in Fort Benning war genauso furchtbar, wie ich es erwartet hatte. Das gesamte Training schien nur darauf angelegt zu sein, uns zu demütigen und uns einer Gehirnwäsche zu unterziehen, bis wir widerspruchslos auch noch die unsinnigsten Befehle befolgten. Ich fand mich allerdings schneller zurecht als viele andere. Nachdem ich die Grundausbildung hinter mir hatte, entschied ich mich für die Infanterie. In den folgenden Monaten fanden in Louisiana und in Fort Bragg verschiedene Übungsmanöver statt, bei denen wir vor allem zwei Dinge lernten: wie man Menschen tötet und wie man Objekte zerstört. Nach einer Weile wurde meine Einheit als Teil der ersten Infanteriedivision – auch bekannt als »the Big Red One« – nach Deutschland verlegt. Ich konnte kein Wort Deutsch, aber das war nicht weiter schlimm, weil fast alle Leute, mit denen ich zu tun hatte, Englisch sprachen. Anfangs war alles ganz locker und unkompliziert, bis dann das eigentliche Soldatenleben losging. Ich verbrachte sieben fürchterliche Monate auf dem Balkan – zuerst in Mazedonien, das war 1999, dann im Kosovo, wo ich bis Frühjahrsende 2000 blieb. Wir verdienten nicht viel, aber wir mussten ja keine Miete bezahlen, für unsere Ernährung war gesorgt, und es gab sowieso nichts, wofür wir unser Geld ausgeben konnten. Deshalb hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen Geld auf der Bank. Nicht viel, aber doch mehr als je zuvor.
Meinen ersten Urlaub verbrachte ich zu Hause und langweilte mich fürchterlich. Als ich das nächste Mal frei bekam, fuhr ich nach Las Vegas. Einer meiner Kumpel war dort aufgewachsen, und wir quartierten uns zu dritt bei seinen Eltern ein. Ich gab so ziemlich alles aus, was ich angespart hatte. In meinem dritten Urlaub, nach der Zeit im Kosovo, brauchte ich ganz dringend Erholung und beschloss deshalb, wieder nach Hause zu fahren, in der Hoffnung, dass die vorhersagbare Eintönigkeit mir dabei helfen würde, richtig abzuschalten und mich zu entspannen. Weil ich so weit weg war, telefonierten mein Dad und ich nur ganz selten, aber er schrieb mir öfter. Seine Briefe waren immer am ersten Tag des Monats abgestempelt und unterschieden sich deutlich von der Post, die meine Kumpel von ihren Müttern, Schwestern oder Frauen bekamen. Die Briefe enthielten keine persönlichen Mitteilungen, er schrieb nie über seine Gefühle und verlor auch kein Wort darüber, ob er mich vermisste. Nicht einmal die Münzen erwähnte er. Stattdessen erzählte er von den Veränderungen in unserem Stadtviertel und berichtete ausführlich über das Wetter. Als ich ihm einmal von einem ziemlich heiklen Feuergefecht schrieb, in das ich auf dem Balkan verwickelt wurde, antwortete er nur, er sei froh, dass ich überlebt hätte – mehr nicht. Seine Formulierung verriet mir jedoch, dass er lieber nichts über die Risiken wissen wollte, denen ich ausgesetzt war. Die Tatsache, dass ich in Lebensgefahr geraten könnte, ängstigte ihn, also verschwieg ich von da an sämtliche bedrohlichen Erlebnisse. Ich erzählte ihm lieber, es gebe nichts Stumpfsinnigeres auf der Welt, als nachts Wache zu schieben. Das Aufregendste in den letzten Wochen sei gewesen, dass ich versucht hätte zu schätzen, wie viele Zigaretten mein Kamerad im Laufe einer einzigen Nacht geraucht hatte. Dad schloss seine Briefe immer mit dem Versprechen, mir bald wieder zu schreiben, und daran hielt er sich auch – zuverlässig wie ein Uhrwerk. Schon seit Langem glaube ich, dass er ein viel besserer Mensch war, als ich es je sein werde.
Aber ich war in den ersten drei Jahren meiner Militärzeit richtig erwachsen geworden. Ja, ich weiß, ich bin ein wandelndes Klischee: Man geht als Junge hin und kommt als Mann zurück und so weiter. Beim Militär ist jeder gezwungen, erwachsen zu werden, vor allem wenn er wie ich bei der Infanterie ist. Du bist verantwortlich für eine Ausrüstung, die ein Vermögen kostet, die anderen müssen sich unbedingt auf dich verlassen können, und wenn du Mist baust, fällt die Strafe sehr hart aus – du wirst nicht nur ohne Abendessen ins Bett geschickt. Klar, es gibt trotz allem viel zu viel Bürokratie und Leerlauf ohne Ende. Alle rauchen wie die Schlote, keiner bringt einen vollständigen Satz heraus, ohne einen Fluch einzubauen, jeder hat kistenweise unanständige Zeitschriften unter dem Bett, und man muss jungen Offiziersanwärtern gehorchen, die frisch vom College kommen und denken, die einfachen Soldaten hätten einen IQ wie ein Neandertaler. Aber man ist gezwungen, die wichtigste Lektion zu lernen, die es im Leben zu lernen gibt: Man muss seine Pflicht erfüllen, Verantwortung übernehmen und seine Sache gut machen. Wenn man einen Befehl bekommt, darf man nicht widersprechen. Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass es oft um Leben und Tod geht. Eine falsche Entscheidung, und dein Kumpel muss sie womöglich mit dem Leben bezahlen. Genau das ist der Grund, weshalb die Armee funktioniert. Die meisten Leute wissen das nicht und fragen sich, wie Soldaten es fertigbringen, Tag für Tag ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Oder wie sie für etwas kämpfen können, wovon sie vielleicht selbst gar nicht überzeugt sind. Nicht jeder glaubt an das große Ziel. Ich habe mit Männern zusammengearbeitet, die völlig verschiedene politische Ansichten hatten. Ich habe Soldaten kennengelernt, die das Militär hassten, während andere sich keinen besseren Beruf vorstellen konnten. Ich habe Genies getroffen und Schwachköpfe, aber es läuft immer auf das Gleiche hinaus: Das, was wir tun, tun wir füreinander. Aus Kameradschaft. Nicht für unser Land, nicht aus Patriotismus, nicht weil wir programmierte Tötungsmaschinen sind, sondern für den Mann neben uns. Du kämpfst für den Freund, damit er überlebt, und umgekehrt kämpft er für dich, und auf dieser einfachen Voraussetzung basiert die gesamte Armee.
Wie gesagt – ich hatte mich verändert. Als ich Soldat wurde, war ich ein starker Raucher, und während der Grundausbildung hustete ich mir fast die Lunge aus dem Leib, aber im Gegensatz zu fast allen anderen in meiner Einheit gab ich das Rauchen auf. Ich reduzierte auch meinen Alkoholkonsum, sodass mir ein, zwei Bier in der Woche genügten, und manchmal verging ein ganzer Monat, ohne dass ich einen einzigen Schluck Alkohol trank. Mein Führungszeugnis war einwandfrei. Ich wurde vom Gefreiten zum Corporal befördert und ein halbes Jahr später zum Sergeant, und ich merkte, dass ich Führungsqualitäten besaß. Immer wieder führte ich bei Kampfeinsätzen die Männer an, und als einer der schlimmsten Kriegsverbrecher auf dem Balkan gefasst wurde, war meine Einheit daran beteiligt. Schließlich schlug mich mein Vorgesetzter für die Officer Candidate School vor, und ich überlegte mir ernsthaft, die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Aber als Offizier musste man sehr viel Zeit am Schreibtisch verbringen und massenhaft bürokratische Aufgaben übernehmen, und ich glaubte eigentlich nicht, dass mir das liegen würde. Bevor ich zum Militär ging, hatte ich jahrelang kaum Sport getrieben, wenn man einmal vom Surfen absah; aber als ich nun zum dritten Mal Urlaub bekam, hatte ich mir ordentlich Muskeln antrainiert, und mein Bauch war nicht mehr schlaff und wabbelig. Den größten Teil meiner Freizeit verbrachte ich damit, zu laufen, zu boxen und Gewichte zu stemmen, meistens gemeinsam mit Tony, einem Muskelprotz aus New York, der immer viel zu laut redete und behauptete, Tequila sei ein wirkungsvolles Aphrodisiakum. Tony wurde in unserer Gruppe mein bester Freund. Er überredete mich, mir auf jeden Arm ein Tattoo stechen zu lassen, genau wie er. Und so kam es, dass die Erinnerung an den Mann, der ich früher einmal gewesen war, mit jedem Tag weiter in den Hintergrund trat.
Außerdem las ich sehr viel. Beim Militär hat man jede Menge Zeit zum Lesen, die Leute tauschen ihre Bücher untereinander aus und leihen sich welche aus der Bibliothek, bis die Cover ganz zerfleddert sind. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich mich plötzlich in einen Intellektuellen verwandelt, denn das stimmt nicht. Ich interessierte mich nicht für Chaucer, Proust oder Dostojewski oder für sonst irgendeinen von diesen toten Dichtern; ich las hauptsächlich Krimis und Thriller und die Bücher von Stephen King. Und ich hatte eine ganz spezielle Vorliebe für Carl Hiaasen, weil er so wunderbar flüssig schreibt und mich immer zum Lachen bringt. Ich bin davon überzeugt, dass es auf der Welt viel mehr Leser gäbe, wenn man solche Bücher in der Schule besprechen würde.
Anders als meine Kumpel ging ich den Frauen weitgehend aus dem Weg. Das klingt seltsam, nicht wahr? Ich war jung, ich hatte einen testosterongesteuerten Job – was konnte da natürlicher sein, als bei jungen Frauen ein bisschen Entspannung zu suchen? Aber für mich war das nichts mehr. Während wir in Würzburg stationiert waren, verliebten sich ein paar Männer, die ich kannte, in Mädchen aus der Gegend und heirateten sie, aber ich hatte genug Geschichten gehört, um zu wissen, dass solche Ehen selten von Dauer waren. Die Zugehörigkeit zum Militär ist für Beziehungen nicht gerade förderlich – ich habe im Laufe der Zeit unzählige Scheidungen miterlebt. Klar, ich sehnte mich damals auch nach einem Menschen, der zu mir gehört, aber es sollte irgendwie nicht sein. Tony konnte das nicht verstehen.
»Komm doch mit«, forderte er mich immer wieder auf.
»Ich bin nicht in Stimmung.«
»Was soll das heißen, du bist nicht in Stimmung? Sabine sagt, ihre Freundin ist supernett. Groß und blond. Und sie liebt Tequila.«
»Frag Don. Er geht bestimmt mit.«
»Don Castelow? Nie im Leben. Sabine kann ihn nicht ausstehen.«
Ich schwieg.
»Wir wollen nur ein bisschen Spaß haben.«
Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich wollte lieber allein bleiben, als wieder der Mensch zu werden, der ich früher gewesen war. Andererseits – konnte es sein, dass ich irgendwann als Mönch enden würde, genau wie mein Vater?
Tony gab auf, bemühte sich aber nicht, seine Frustration zu überspielen. »Manchmal versteh’ ich dich nicht«, brummte er.
Als Dad mich am Flughafen abholte, erkannte er mich erst gar nicht und zuckte richtig zusammen, als ich ihm auf die Schulter tippte. Irgendwie kam er mir kleiner vor als früher. Er umarmte mich nicht, sondern schüttelte mir höflich die Hand und erkundigte sich nach meinem Flug. Danach wussten wir beide nicht mehr, was wir sagen sollten. Schweigend verließen wir das Flughafengebäude. Es war seltsam, wieder zu Hause zu sein – ich fühlte mich desorientiert und war irgendwie gereizt, genau wie bei meinem letzten Aufenthalt. Als ich auf dem Parkplatz mein Gepäck im Kofferraum verstaute, entdeckte ich auf Dads Stoßstange einen Aufkleber mit der Forderung UNTERSTÜTZT UNSERE TRUPPEN. Ich wusste nicht genau, was das für Dad bedeutete, aber irgendwie freute ich mich.
Zu Hause brachte ich meine Sachen gleich in mein Zimmer. Alles war genau wie immer, sogar die verstaubten Trophäen standen noch im Regal, und die halbleere Whiskeyflasche lag in der Schublade mit der Unterwäsche, wo ich sie damals versteckt hatte. Auch im Rest des Hauses hatte sich nichts verändert. Auf dem Sofa lag immer noch dieselbe Wolldecke, der grüne Kühlschrank verkündete grell, dass er nicht in diese Küche gehörte, und im Fernsehen kamen nur vier verschwommene Programme. Dad kochte Spaghetti. Freitags gab es immer Spaghetti. Beim Essen starteten wir einen erneuten Versuch, uns zu unterhalten.
»Es ist schön, mal wieder zu Hause zu sein«, sagte ich.
Dad lächelte. »Gut«, sagte er. Mehr nicht.
Er trank einen Schluck Milch. Zum Abendessen gab’s bei uns immer Milch. Dann konzentrierte er sich ganz auf seinen Teller.
»Erinnerst du dich an Tony?«, begann ich. »Ich glaube, in meinen Briefen habe ich ihn schon ein paarmal erwähnt. Also – stell dir vor, Tony hat sich verliebt. Denkt er jedenfalls. Die Frau heißt Sabine und hat eine sechsjährige Tochter. Ich habe ihn gewarnt und ihm gesagt, dass es keine besonders gute Idee ist, sich auf so etwas einzulassen, aber er hört natürlich nicht auf mich.«
Dad streute Parmesan auf seine Spaghetti und verteilte den Käse gleichmäßig. »Oh«, sagte er. »Verstehe.«
Danach schwiegen wir beide. Ich trank meine Milch und aß meine Spaghetti. Die Uhr tickte an der Wand.
»Ich wette, du freust dich, dass du dieses Jahr in den Ruhestand gehen kannst«, nahm ich schließlich noch einmal Anlauf. »Dann kannst du endlich mal richtig Urlaub machen und etwas von der Welt sehen.« Fast hätte ich gesagt, er könne mich ja in Deutschland besuchen, aber ich ließ es bleiben. Ich wusste intuitiv, dass er das nie tun würde, und ich wollte ihn nicht unter Druck setzen. Im Gleichtakt rollten wir unsere Spaghetti auf, während Dad sich zu überlegen schien, was er am besten antworten sollte.
»Ich weiß nicht recht«, sagte er nach längerem Zögern.
Nun gab ich meine Gesprächsversuche endgültig auf, und man hörte nur noch das Klappern des Bestecks. Nach der Mahlzeit ging jeder von uns in sein Zimmer. Erschöpft von dem langen Flug und der Zeitumstellung legte ich mich ins Bett, wachte aber jede Stunde auf, genau wie in der Kaserne. Als ich am nächsten Morgen aufstand, war Dad schon bei der Arbeit. Ich frühstückte, las die Zeitung und wollte einen meiner alten Freunde anrufen, erreichte ihn aber nicht. Also holte ich mein Surfbrett aus der Garage und trampte zum Strand. Die Wellen waren nicht besonders spektakulär, aber das spielte keine Rolle. Ich hatte seit drei Jahren nicht mehr gesurft und stellte mich am Anfang ziemlich ungeschickt an. Meine Gelenke waren richtig eingerostet. Trotzdem machte es mir so viel Vergnügen, dass ich wünschte, ich wäre irgendwo am Meer stationiert.
Es war Anfang Juni 2000. Wir hatten schon recht warmes Wetter, und das Wasser wirkte sehr belebend auf mich. Ich beobachtete die Leute, die ihr Gepäck in die Häuser gleich hinter den Dünen trugen. Wie gesagt, in Wrightsville Beach mieteten sich viele Familien für eine Woche oder länger eine Wohnung oder ein Haus; und manchmal kamen auch College-Studenten aus Chapel Hill oder Raleigh, um hier Ferien zu machen. Die Studenten interessierten mich natürlich mehr als die Familien. Und ganz besonders aufmerksam wurde ich, als ich eine Gruppe von Mädchen in Bikinis bemerkte, die es sich auf der Veranda eines der Häuser am Pier bequem machten. Doch selbst von diesem verlockenden Anblick ließ ich mich nur kurz ablenken, denn schon kam die nächste Welle, und ich musste mich wieder konzentrieren. Den Rest des Nachmittags verbrachte ich in meiner eigenen kleinen Welt.
Gegen Abend überlegte ich, ob ich in Leroy’s Bar gehen sollte, aber der Gedanke, dass sich – außer mir – vermutlich nichts und niemand verändert hatte, hielt mich zurück. Deshalb kaufte ich mir lieber in dem kleinen Laden an der Ecke eine Flasche Bier, setzte mich auf den Pier und genoss den Sonnenuntergang. Die meisten Angler hatten sich schon verabschiedet, und die wenigen, die noch da waren, inspizierten ihren Fang und warfen die Überschüsse ins Wasser. Die Farbe des Ozeans wechselte von Stahlgrau zu Orange und dann zu einem leuchtenden Gelb. In den Brechern hinter dem Pier konnte ich die Pelikane sehen, die auf den Rücken der Delfine durch die Wellen ritten. Heute war Vollmond, das wusste ich – meine Zeit in den Kriegsgebieten hatte mich gelehrt, so etwas instinktiv zu registrieren. Ich dachte an nichts Bestimmtes, sondern ließ meinen Gedanken freien Lauf. Und dass ich ausgerechnet jetzt jemanden kennenlernen könnte, wäre mir niemals in den Sinn gekommen.
Die Originalausgabe DEAR JOHN erschien bei Warner Books Inc., New York
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 05/2010
Copyright © 2006 by Nicholas Sparks
Copyright © 2007 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN 978-3-641-06006-0
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe