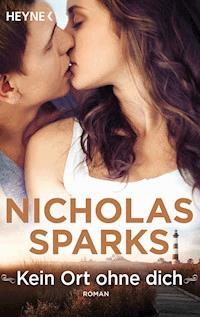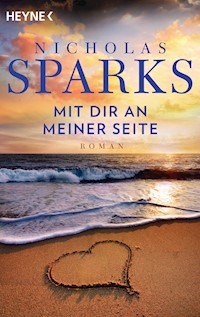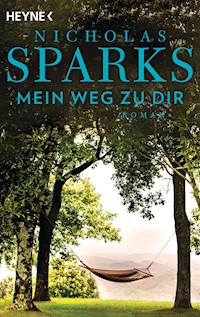9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit seiner Tante und seiner Schwester bewirtschaftet der 25-jährige Colby eine Farm in North Carolina. Bei einem Urlaub lernt er die Sängerin Morgan kennen. Beide fühlen sich sofort zueinander hingezogen, sie verbringen eine wunderschöne Zeit zusammen – und wissen doch, dass sie bald in kaum miteinander zu vereinbarende Lebenswelten zurückkehren müssen.
Zeitgleich flüchtet eine junge Frau namens Beverly vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Schließlich findet sie Unterschlupf in einem heruntergekommenen Haus in der Provinz. Doch sie ist immer noch in höchster Gefahr …
Auf brillante Weise verknüpft Nicholas Sparks die Schicksale der jungen Leute zu einer großen Geschichte über Familie, Trauma und Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Zum ersten Mal seit Jahren nimmt sich Colby eine Auszeit von der Familienfarm in North Carolina. Er tritt in Florida als Musiker auf, genießt die freie Zeit – und lernt die junge Sängerin Morgan Lee kennen. Es funkt schnell zwischen den beiden, sie teilen nicht nur die Liebe zur Musik, sondern bald auch tiefe Gefühle zueinander. Aber Morgans Pläne für die Zukunft passen überhaupt nicht zu Colbys Welt, die durch die Farm sehr festen Regeln unterliegt. Werden sie es schaffen, ihre Beziehung auch über den Urlaub hinaus zu retten?
Währenddessen hat eine junge Frau namens Beverly mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: In höchster Angst vor ihrem Ehemann verlässt sie bei Nacht und Nebel gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Tommie das Haus. Per Bus und Anhalter flieht sie quer durch Amerika, voller Panik, verfolgt zu werden. Schließlich findet sie in einem Haus in der Provinz Unterschlupf – aber ihr Alptraum ist noch lange nicht vorbei …
Als sich die Geschichten von Colby, Morgan und Beverly auf hochdramatische Weise verbinden, steht plötzlich die Zukunft von allen auf dem Spiel.
Der Autor
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in über 50 Sprachen erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen, zuletzt »Mein letzter Wunsch«.
Große Autorenwebsite unter www.nicholas-sparks.de
NICHOLAS
SPARKS
IM TRAUM
BIN ICH BEI DIR
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Astrid Finke
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel DREAMLAND bei Random House/Penguin Random House LLC, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Willow Holdings, Inc.
Copyright © 2022 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lüra – Klemt & Mues GbR
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München,
unter Verwendung von Gary Tognoni/Alamy Stock Foto
und Finepic, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29333-8V001
www.heyne.de
www.nicholas-sparks.de
Für Abby Koons, Andrea Mai und Emily Sweet
TEIL I
COLBY
1
Darf ich mich vorstellen: Mein Name ist Colby Mills, ich bin fünfundzwanzig Jahre alt und sitze an einem wunderschönen Samstag Mitte Mai auf einem Klappstrandstuhl am St. Pete Beach in Florida. In der Kühlbox neben mir liegen Bier und Wasser auf Eis, und die Temperatur ist nahezu perfekt durch die stetige Brise, die zudem noch stark genug ist, um die Moskitos fernzuhalten. Vom Pool des Don CeSar Hotels hinter mir, einem stattlichen Bau und einer Art rosa Version des Taj Mahal, weht Musik heran. Der Künstler, der gerade auftritt, ist nur okay; hin und wieder vermurkst er einen Akkord, aber ich bezweifle, dass sich jemand daran stört. Seit ich hier sitze, habe ich mehrmals einen Blick auf den Poolbereich geworfen und festgestellt, dass die meisten Gäste schon den gesamten Nachmittag Cocktails schlürfen, was bedeutet, dass ihnen wahrscheinlich so ungefähr alles gefallen würde.
Übrigens bin ich nicht von hier. Bis vor Kurzem hatte ich von diesem Ort noch nie gehört. Wenn die Leute zu Hause mich fragten, wo dieses St. Pete Beach denn liege, erklärte ich, es sei ein Städtchen an der Westküste Floridas, nicht weit von St. Petersburg und Clearwater, was allerdings auch nicht sonderlich weiterhalf. Für die meisten von ihnen steht Florida für Frauen in Bikinis an den Stränden von Miami und für die Freizeitparks in Orlando, und der Rest interessiert sie eigentlich nicht. Offen gestanden war für mich Florida früher einfach nur ein seltsam geformter Zipfel an der Ostküste der USA.
Das Beste an St. Pete Beach selbst ist ein fantastischer weißer Sandstrand, der schönste, den ich je gesehen habe. Direkt am Wasser befindet sich ein Mix aus schicken Hotels und weniger schicken Motels, aber der Großteil der Stadtteile scheint mir typisch Mittelschicht, bevölkert von Rentnern und Arbeitern, neben Familien, die hier günstig Urlaub machen. Es gibt die üblichen Fast-Food-Ketten und Einkaufsmeilen und Fitnessstudios und Krimskrams-Läden, aber trotz dieser sichtbaren Zeichen von Modernität wirkt die Stadt, als sei sie irgendwie in Vergessenheit geraten.
Dennoch muss ich zugeben, dass es mir hier gefällt. Streng genommen bin ich zum Arbeiten hier, aber in Wirklichkeit ist es mehr Urlaub. Drei Wochen lang trete ich viermal pro Woche in Bobby T’s Beach Bar auf, immer nur ein paar Stunden, was bedeutet, dass ich viel Zeit habe, um joggen zu gehen und in der Sonne zu sitzen und darüber hinaus einfach überhaupt nichts zu machen. An solch ein Leben könnte man sich gewöhnen. Die Gäste im Bobby T’s sind wohlwollend – und ja, trinkfreudig wie im Don CeSar –, und es gibt nichts Besseres, als vor einem dankbaren Publikum zu stehen. Vor allem, da ich im Grunde ein Nobody aus einem anderen Staat bin, der mehr oder weniger zwei Monate vor seinem Schulabschluss seinen letzten richtigen Auftritt hatte. In den letzten sieben Jahren habe ich zwar immer mal wieder bei Partys von Freunden oder Bekannten gespielt, aber das war es dann auch schon. Heutzutage betrachte ich die Musik als Hobby, wenn auch eines mit hohem Stellenwert. Nichts genieße ich mehr, als einen Tag lang Songs zu proben oder zu schreiben, auch wenn mir das richtige Leben kaum Zeit dafür lässt.
In den bisherigen zehn Tagen hier passierte allerdings etwas Seltsames. Die beiden ersten Konzerte waren so gut besucht, wie es offenbar im Bobby T’s zu erwarten ist. Es war ungefähr die Hälfte der Plätze besetzt, die Leute tranken Bier oder Cocktails, wollten den Sonnenuntergang genießen, sich dabei unterhalten und im Hintergrund Musik hören. Beim dritten Mal blieb jedoch schon kein Stuhl mehr frei, und ich erkannte Gesichter von den vorherigen Auftritten wieder. Als ich zum vierten Mal auf die Bühne stieg, waren nicht nur alle Sitzplätze belegt, sondern ein paar Leute nahmen in Kauf zu stehen, um mich zu hören. Kaum jemand beachtete den Sonnenuntergang, und es wurden sogar einige meiner eigenen Lieder gewünscht. Dass sich jemand Strandbar-Klassiker wie Summer of 69 oder American Pie oder Brown-eyed Girl wünscht, ist normal – aber von mir geschriebene Songs? Gestern Abend dann drängte sich das Publikum bis auf den Strand hinaus, Stühle wurden aus anderen Bars geschnorrt und die Lautsprecher so eingestellt, dass jeder mich hören konnte. Während des Aufbauens ging ich noch davon aus, es läge daran, dass Freitagabend war, aber der Agent, Ray, versicherte mir, das sei alles andere als die Norm. Im Gegenteil, sagte er, so viele Zuschauer habe er im Bobby T’s noch nie erlebt.
Darüber hätte ich mich freuen sollen, und das habe ich auch, zumindest ein bisschen. Trotzdem will ich es nicht überbewerten. In einer Strandbar angeheiterte Urlauber während der Happy Hour zu bespaßen, ist eine völlig andere Nummer, als im ganzen Land in ausverkauften Stadien zu spielen. Vor Jahren war es, wenn ich ganz offen bin, mein Traum, »entdeckt« zu werden; das geht vermutlich jedem so, der gern auf der Bühne steht. Dieser Traum verflüchtigte sich leider in der Realität nach und nach. Ich bin deshalb nicht verbittert. Die rationale Seite in mir weiß, dass das, was man will, mit dem, was man bekommt, in der Regel ziemlich wenig zu tun hat. Außerdem muss ich in zehn Tagen wieder nach Hause fahren und mein altes Leben weiterführen.
Das soll nicht negativ klingen. Mein echtes Leben ist nicht schlecht. In meinem Beruf bin ich sogar richtig gut, auch wenn die langen Arbeitstage einen isolieren können. Ich habe noch nie das Land verlassen, habe noch nie ein Flugzeug bestiegen und bekomme nur vage mit, was sonst passiert, hauptsächlich, weil Nachrichtensprecher mich zu Tode langweilen. Was in unserem Land oder auf der Welt so los ist – die Themen von großer politischer Bedeutung bekomme ich kaum mit. Auch wenn der ein oder andere daran Anstoß nehmen wird, gehe ich nicht einmal wählen, und den Nachnamen des Gouverneurs weiß ich nur, weil ich einmal in einer Bar namens Cooper’s in Carteret County aufgetreten bin, unweit der Küste North Carolinas, ungefähr eine Stunde von mir zu Hause entfernt.
Was das betrifft …
Ich wohne in Washington, einer Kleinstadt am Ufer des Pamlico River im östlichen North Carolina, die viele entweder Little Washington nennen oder Das originale Washington, damit es nicht mit unserer Hauptstadt ungefähr fünf Fahrstunden Richtung Nordosten verwechselt wird. Als wäre das überhaupt möglich. Washington und Washington, D. C., sind so unterschiedlich, wie es nur geht; die amerikanische Hauptstadt ist umgeben von Vororten und ein Machtzentrum, während mein Heimatort klein und ländlich ist, mit genau einem Supermarkt namens Piggly Wiggly. Er hat weniger als zehntausend Einwohner, und als Halbwüchsiger fragte ich mich oft, warum überhaupt jemand dort bleiben wollte. Mittlerweile bin ich allerdings zu dem Schluss gekommen, dass es schlimmere Orte gibt. Washington ist friedlich, und die Leute sind nett, von der Sorte, die vorbeifahrenden Autos von der Veranda aus zuwinken. Am Flussufer befinden sich mehrere ganz anständige Restaurants, und für diejenigen, die etwas für Kultur übrighaben, gibt es das Turnage Theater, in dem Einheimische sich von anderen Einheimischen aufgeführte Stücke ansehen können. Es gibt Schulen und einen Walmart und Fast-Food-Lokale, und wettermäßig ist es ideal. Es schneit vielleicht alle zwei oder drei Jahre mal, und im Sommer sind die Temperaturen deutlich gemäßigter als in Staaten wie South Carolina oder Georgia. Segeln auf dem Fluss ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung, und ich kann, wenn ich Lust dazu habe, spontan das Surfboard auf den Pick-up laden und schon die erste Welle erwischen, bevor ich meinen großen To-go-Kaffee geleert habe. Bis nach Greenville – einer relativ kleinen, aber richtigen Stadt mit Sportveranstaltungen und Kinos und einer größeren Auswahl an Restaurants – ist es nicht weit, über den Highway ungefähr fünfundzwanzig Minuten in gemächlichem Tempo.
Mit anderen Worten: Mir gefällt es dort. Normalerweise denke ich nicht einmal darüber nach, ob ich etwas Besseres oder Tolleres verpasse. Im Allgemeinen nehme ich die Dinge, wie sie kommen, und versuche, nicht zu viel zu erwarten. Das klingt vielleicht nicht unbedingt spektakulär, aber ich komme damit klar.
Es könnte gut mit meiner Kindheit zu tun haben. Als ich klein war, lebte ich mit meiner Mutter und meiner Schwester in einem kleinen Haus nicht weit vom Fluss entfernt. Meinen Vater kenne ich nicht. Meine Schwester ist sechs Jahre älter, und die Erinnerungen an meine Mutter sind vage, nach der langen Zeit verschwommen. Sie starb, als ich fünf war, weshalb meine Schwester und ich zu meiner Tante und meinem Onkel auf ihren Bauernhof am Stadtrand zogen. Meine Tante ist die viel ältere Schwester meiner Mutter, und auch wenn die beiden nie ein enges Verhältnis hatten, war sie eben unsere einzige lebende Verwandte. In der Vorstellung meiner Tante und meines Onkels taten sie einfach das Erforderliche, weil es außerdem das Richtige war.
Die beiden sind gute Menschen, aber da sie selbst keine Kinder haben, wussten sie vermutlich nicht so recht, worauf sie sich einließen. Den Bauernhof zu bewirtschaften nahm fast ihre gesamte Zeit ein, und meine Schwester Paige und ich waren als Kinder nicht ganz einfach, besonders zu Anfang. Mir passierten ständig Unfälle – damals schoss ich gerade in die Höhe und stolperte bei gefühlt jedem dritten Schritt. Außerdem weinte ich viel, wohl hauptsächlich, weil ich meine Mutter verloren hatte, wobei ich mich daran nicht mehr erinnere. Paige hingegen war frühreif im Hinblick auf pubertäre Launenhaftigkeit. Sie konnte schreien oder schluchzen oder Wutanfälle bekommen wie kaum eine Zweite und sperrte sich ganze Tage in ihrem Zimmer ein, heulte und verweigerte das Essen. Sie und meine Tante waren von Anfang an wie Feuer und Wasser, ich aber fühlte mich bei ihr immer geborgen. Obwohl meine Tante und mein Onkel sich alle Mühe gaben, müssen wir sie überfordert haben, sodass es nach und nach Paige zufiel, sich um mich zu kümmern. Sie schmierte mir meine Pausenbrote und brachte mich zum Bus, sie kochte mir Dosensuppen oder am Wochenende Käsenudeln aus der Packung und saß bei mir, wenn ich mir Zeichentrickfilme ansah. Und weil wir uns ein Zimmer teilten, war sie diejenige, mit der ich redete, bevor ich einschlief. Manchmal, aber nicht immer, half sie mir bei meinen Aufgaben im Haushalt, zusätzlich zu ihren eigenen. Paige war der Mensch, dem ich mit Abstand am meisten vertraute.
Sie war auch begabt. Sie zeichnete für ihr Leben gern und saß stundenlang an ihren Skizzen, weshalb es mich gar nicht sonderlich überraschte, dass sie letzten Endes Künstlerin wurde. Heutzutage arbeitet sie mit Glas, handgefertigte Nachbildungen von Tiffany-Lampen, die richtig Geld kosten und sehr gefragt sind bei teuren Innenausstattern. Sie hat sich ein ziemlich gut laufendes Onlinegeschäft aufgebaut, und ich bin stolz auf sie, nicht nur, weil sie mir in meiner Kindheit so viel bedeutet hat, sondern auch, weil sie ihr Leben trotz mehrerer Tiefschläge meistert. Es gab Zeiten, das muss ich ehrlich sagen, in denen ich staunte, dass sie überhaupt noch durchhielt.
Nicht, dass hier ein falsches Bild von meiner Tante und meinem Onkel entsteht. Auch wenn Paige sich um mich kümmerte, sorgten sie für das Wichtige. Wir hatten anständige Betten und bekamen jedes Jahr neue Kleidung für die Schule. Es gab immer Milch im Kühlschrank und etwas zu knabbern in der Speisekammer. Keiner der beiden war gewalttätig, sie wurden nur selten laut, und ich glaube, das einzige Mal, dass ich sie ein Glas Wein trinken sah, war an einem Silvesterabend während meiner Teenager-Jahre. Aber ein Bauernhof macht viel Arbeit; in gewisser Weise ist er wie ein forderndes, nie zufriedenzustellendes Kind, und die beiden hatten weder Zeit noch Energie, um Schulveranstaltungen zu besuchen oder uns zu Kindergeburtstagen zu fahren oder auch nur am Wochenende mit uns Ball zu spielen. In der Landwirtschaft gibt es kein Wochenende; Samstage und Sonntage sind wie jeder andere Tag. So ungefähr das Einzige, was wir als Familie gemeinsam machten, war das Abendessen um sechs Uhr, und ich habe das Gefühl, mich an jedes einzelne zu erinnern, vor allem wohl, weil sie alle genau gleich abliefen.
Wir wurden in die Küche gerufen, wo wir halfen, das Essen aufzutragen. Wenn wir saßen, erkundigte sich meine Tante, wie es in der Schule gewesen war, und zwar mehr aus Pflichtgefühl als aus echtem Interesse. Während wir berichteten, bestrich mein Onkel sich zwei Scheiben Brot mit Butter, egal, was es sonst gab, und nickte schweigend zu unseren Antworten, egal, was wir sagten. Danach hörte man nur noch das Klirren von Besteck auf Tellern. Manchmal unterhielten Paige und ich uns, aber meine Tante und mein Onkel konzentrierten sich auf ihre Mahlzeit, als wäre es ein weiterer Arbeitsgang, den sie zu erledigen hatten. Still waren sie normalerweise beide, allerdings trieb mein Onkel die Schweigsamkeit wirklich auf die Spitze. Manchmal vergingen ganze Tage, an denen ich ihn kein Wort sprechen hörte.
Doch er spielte Gitarre und sang. Keine Ahnung, wo er es gelernt hatte, aber er war gar nicht übel und besaß eine raue und dabei klangvolle Stimme, die einen fesselte. Er bevorzugte Songs von Johnny Cash und Kris Kristofferson, und ein- oder zweimal die Woche setzte er sich nach dem Abendessen auf die Veranda und spielte. Als ich Interesse zu zeigen begann – damals muss ich so sieben oder acht gewesen sein –, reichte er mir die Gitarre und half mir mit seinen schwieligen Händen, die Akkorde zu lernen. Ich war alles andere als ein Naturtalent, aber mein Onkel war verblüffend geduldig. Obwohl ich noch so klein war, begriff ich, dass ich meine Leidenschaft gefunden hatte. Paige hatte ihr Zeichnen, ich die Musik.
Ich übte zunehmend auch allein. Dazu begann ich zu singen, hauptsächlich die Lieder, die mein Onkel mochte, weil ich ja keine anderen kannte. Zu Weihnachten schenkten meine Tante und mein Onkel mir eine akustische Gitarre, dann im folgenden Jahr eine E-Gitarre. Ich brachte mir bei, nach dem Gehör die Stücke aus dem Radio nachzuspielen, ohne überhaupt Noten lesen zu können. Mit zwölf vermochte ich einen Song schon nach dem ersten Mal fast perfekt zu kopieren.
Als ich größer wurde, musste ich mehr mithelfen, was bedeutete, dass ich nie so viel Zeit zum Üben hatte, wie ich wollte. Jetzt hatte ich nicht nur morgens die Hühner zu füttern, sondern musste auch Bewässerungsrohre ausbessern oder stundenlang in der Sonne Raupen von den Tabakblättern lesen und zwischen den Fingern zerdrücken, was genauso ekelhaft ist, wie es klingt. Schon als Kind konnte ich alles Motorisierte fahren – Traktoren, Bagger, Mähdrescher, ganz egal – und verbrachte ganze Wochenenden damit. Außerdem lernte ich, alles, was kaputt war, zu reparieren, obwohl mich das bald langweilte. Da meine Aufgaben auf dem Hof und die Musik meine gesamte Zeit einnahmen, sackten meine Schulnoten ab. Mir war es egal. Das einzige Fach, für das ich mich wirklich interessierte, war Musik, besonders, da meine Lehrerin zufällig nebenbei selbst Stücke schrieb. Sie nahm mich unter ihre Fittiche, und mit ihrer Hilfe komponierte ich mit zwölf meinen ersten Song. Ab da war ich Feuer und Flamme und schrieb unentwegt, immer besser und besser.
Zu der Zeit arbeitete Paige bereits bei einem auf Buntglas spezialisierten Künstler in unserer Stadt. Während der Schulzeit hatte sie dort einen Halbtagsjob gehabt, und mittlerweile fertigte sie ihre eigenen Lampen im Tiffany-Stil. Im Gegensatz zu mir hatte sie immer gute Noten gehabt, aber sie wollte nicht aufs College. Stattdessen baute sie sich ihr eigenes Geschäft auf und lernte einen Mann kennen, in den sie sich verliebte. Sie verließ den Bauernhof, zog aus North Carolina fort und heiratete. In jenen Jahren hörte ich kaum von ihr; selbst nachdem sie ein Kind bekommen hatte, sprach ich nur ab und an mit ihr über FaceTime, wo sie müde wirkte und ihr weinendes Kind auf dem Arm hielt. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass niemand sich um mich kümmerte.
Wenn man das alles zusammennimmt – meine Tante und mein Onkel stets überarbeitet, mein mangelndes Interesse an der Schule, meine Schwester weit weg und die mir mittlerweile verhassten Pflichten auf dem Hof –, überrascht es wenig, dass ich zu rebellieren begann. In der Highschool lernte ich ein paar Jungs mit den gleichen Neigungen kennen, und wir stachelten uns gegenseitig auf. Anfangs waren es Kleinigkeiten, Steine durch die Fenster verlassener Häuser werfen, Telefonstreiche mitten in der Nacht, hier und da ein geklauter Schokoriegel. Aber nach wenigen Monaten stahl einer dieser Freunde eine Flasche Gin aus dem Schnapsschrank seines Vaters. Wir trafen uns am Fluss und reichten die Flasche herum. Ich trank viel zu viel und musste mich den Rest der Nacht übergeben, doch da ich gerade ehrlich bin, muss ich gestehen, dass ich daraus nicht unbedingt etwas lernte. Statt mich künftig vom Trinken fernzuhalten, verbrachte ich von da an zahllose Wochenenden benebelt. Meine Schulnoten blieben im Keller, und ich drückte mich zunehmend vor meinen Aufgaben auf dem Hof. Ich bin nicht stolz darauf, wie ich mich damals verhielt, aber man kann die Vergangenheit nun mal nicht ändern.
Unmittelbar nach dem Übertritt in die zehnte Klasse nahm mein Leben allerdings eine weitere Wende. Zu dem Zeitpunkt hatte ich kaum noch Kontakt zu meinen Loser-Freunden, und mir kam zu Ohren, dass eine Band in unserer Gegend einen neuen Gitarristen suchte. Ich dachte mir: Warum nicht? Ich war erst fünfzehn, und als ich zum Vorspielen auftauchte, bemerkte ich, dass die Bandmitglieder, alle schon über zwanzig, sich das Lachen verkniffen. Ohne sie zu beachten, steckte ich meine E-Gitarre ein und spielte Eddie Van Halens Solo aus »Eruption«. Jeder, der sich auskennt, wird bestätigen, dass das nicht so leicht ist. Der langen Rede kurzer Sinn: Am folgenden Wochenende stand ich mit der Band auf der Bühne, nachdem ich ihre Stücke bei unserer einzigen Probe vor dem Auftritt zum ersten Mal gehört hatte. Im Vergleich zu den anderen – mit ihren Piercings und Tattoos und entweder langen oder blond gefärbten kurzen Haaren – sah ich aus wie ein Chorknabe, deshalb wurde ich ganz hinten neben dem Drummer geparkt, selbst bei meinen Solos.
Falls die Musik vorher noch nicht alles andere an den Rand gedrängt hatte, wurde es jetzt schnell so. Ich ging nicht mehr zum Friseur, ließ mir Tattoos stechen, und nach einer Weile durfte ich vorn auf der Bühne stehen. Auf dem Bauernhof half ich praktisch überhaupt nicht mehr. Meine Tante und mein Onkel wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten, also beachteten sie mich gar nicht mehr, was die Konflikte auf ein Minimum beschränkte. Ich widmete noch mehr meiner Zeit der Musik, träumte davon, vor ausverkauften Hallen zu spielen.
Rückblickend hätte ich wahrscheinlich wissen müssen, dass daraus nie etwas werden würde, weil die Band nicht besonders gut war. Unsere Songs waren alle in diesem Post-Punk-Kreischstil, und obwohl es Leute gab, die sie wirklich mochten, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Großteil unseres Publikums im östlichen North Carolina wenig begeistert war. Dennoch hatten wir bis kurz vor meinem Schulabschluss an zwanzig bis fünfundzwanzig Wochenenden pro Jahr Auftritte, sogar in Kneipen in Charlotte.
Doch es gab Reibungen innerhalb der Band, und die verschlimmerten sich mit der Zeit. Der Sänger wollte unbedingt, dass wir nur die Songs spielten, die er geschrieben hatte. Das klingt vielleicht nicht sehr schlimm, aber das Ego einer Person hat schon mehr Bands zerstört als alles andere. Wir anderen wussten, dass die meisten seiner Stücke mittelmäßig waren. Irgendwann verkündete er, nach Los Angeles zu ziehen, um es allein zu schaffen, da keiner von uns sein Genie zu schätzen wisse. Sobald er abgerauscht war, hörte auch der Drummer auf, der mit siebenundzwanzig der Älteste war und dessen Freundin ihn schon seit geraumer Zeit drängte, häuslicher zu werden. Als er sein Equipment ins Auto lud, nickten wir anderen drei einander zu und packten ein, weil wir wussten, dass es vorbei war. Seit diesem Abend habe ich mit keinem von ihnen jemals wieder gesprochen.
Seltsamerweise war ich weniger deprimiert als einfach ratlos. So gern ich auch auf der Bühne gestanden hatte, es hatte einfach zu viel Stress gegeben und zu wenig positive Entwicklung, zu wenig Aussicht auf Erfolg. Gleichzeitig hatte ich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, also machte ich erst einmal weiter wie zuvor. Ich schaffte meinen Schulabschluss (wahrscheinlich hatten die Lehrer keine Lust, sich noch ein Jahr mit mir herumzuschlagen) und verbrachte viel Zeit in meinem Zimmer, wo ich Songs schrieb und auf Spotify, Instagram und YouTube einstellte. Niemand schien sie zur Kenntnis zu nehmen. Nach und nach half ich wieder mehr auf dem Hof, obwohl unübersehbar war, dass meine Tante und mein Onkel mich längst aufgegeben hatten. Vor allem aber machte ich eine Bestandsaufnahme meines Lebens. Nachdem ich so lange ausschließlich mit mir selbst beschäftigt gewesen war, sah ich jetzt, dass Tante und Onkel älter wurden und der Hof nicht mehr gut lief. Als ich zu ihnen gezogen war, hatten sie Mais, Baumwolle, Blaubeeren und Tabak angepflanzt und mehrere Tausend Hühner gehalten. All das hatte sich in den vergangenen Jahren geändert. Schlechte Ernten und schlechte Geschäftsentscheidungen und schlechte Preise und schlechte Kredite hatten dazu geführt, dass ein Gutteil ihres Grundbesitzes mit der Zeit entweder verkauft oder an die Nachbarn verpachtet worden war. Ich war erstaunt, wie mir das entgangen sein konnte; wobei ich eigentlich wusste, warum.
Dann, an einem warmen Augustmorgen, hatte mein Onkel einen schweren Herzinfarkt, als er gerade zum Traktor lief. Seine linke Herzkranzarterie war vollständig verstopft; wie uns erklärt wurde, nennt sich dieser Infarkt auch Witwenmacher, weil die Überlebenschancen unglaublich gering sind. Er starb, noch bevor der Krankenwagen eintraf. Meine Tante fand ihn, und ich habe nie jemanden so schreien und heulen hören wie sie an jenem Morgen.
Paige kam zur Beerdigung nach Hause und blieb ein Weilchen, obwohl sie ihr Kind bei ihrem Mann und der Schwiegermutter gelassen hatte. Ich hatte Sorge, dass ihre Rückkehr neuen Unfrieden stiften würde, aber meine Schwester erkannte offenbar, dass meine Tante innerlich gebrochen war. Da ich sie und meinen Onkel nie sonderlich zärtlich miteinander umgehen gesehen hatte, war ich davon ausgegangen, dass sie mehr Geschäftspartner gewesen waren als ineinander verliebt. Doch das stimmte ganz offensichtlich nicht. Ab da wirkte meine Tante wie eingesunken. Sie aß kaum und hatte immer ein Taschentuch bei sich, um den stetigen Tränenstrom zu trocknen. Paige hörte sich stundenlang altbekannte Geschichten an, machte den Haushalt und sorgte dafür, dass die Angestellten auf dem Hof sich an den Zeitplan hielten. Aber sie konnte nicht ewig bleiben, und als sie wieder weg war, versuchte ich unwillkürlich, mich genauso um alles zu kümmern wie sie.
Abgesehen davon, dass ich den Hof führte und aufpasste, dass meine Tante genug aß, sichtete ich die Stapel von Rechnungen und Quittungen auf dem Schreibtisch meines Onkels. Selbst meine rudimentären Mathekenntnisse verrieten mir, dass die Lage chaotisch war. Der Tabak warf zwar immer noch Profit ab, aber die Hühner, der Mais und die Baumwolle waren nach und nach zum Verlustgeschäft geworden. Um die drohende Insolvenz abzuwenden, hatte mein Onkel bereits in die Wege geleitet, noch mehr Land an die Nachbarn zu verpachten. Auch wenn das die unmittelbaren Probleme gelöst hätte, wusste ich, dass der Hof dadurch langfristig noch stärker leiden würde. Meine spontane Reaktion war, meiner Tante vorzuschlagen, den Rest auch noch zu verkaufen, damit sie ein Häuschen erwerben und sich zur Ruhe setzen konnte, doch das lehnte sie rundheraus ab.
Ungefähr um diese Zeit fand ich auch Artikel aus diversen Zeitschriften und Informationsblättern, die mein Onkel ausgeschnitten hatte und in denen es um den Markt für gesündere und ausgefallenere Lebensmittel ging. Dazu Notizen und bereits fertiggestellte Einnahmeberechnungen. Mein Onkel mag schweigsam und alles in allem kein guter Geschäftsmann gewesen sein, aber er hatte eindeutig über Veränderungen nachgedacht. Die besprach ich nun mit meiner Tante, und letzten Endes stimmte sie zu, dass die einzige Option für uns war, die Pläne meines Onkels umzusetzen.
Wir hatten nicht für alles sofort genug Geld, aber im Laufe der vergangenen sieben Jahre schafften wir mit gewaltiger Anstrengung, Risiken, Herausforderungen, finanzieller Unterstützung durch Paige, gelegentlichen Glücksfällen und viel zu vielen schlaflosen Nächten den Wechsel von Fleischhühnern hin zu Bio-Eiern aus Freilandhaltung, die wir an Supermärkte in North und South Carolina liefern und die eine viel höhere Gewinnspanne haben. Zwar bauen wir weiterhin Tabak an, auf den übrigen Flächen aber konzentrieren wir uns auf alte Tomatensorten, wie sie bei Nobelrestaurants und hochpreisigen Lebensmittelgeschäften beliebt sind. Auch dabei hat sich die Gewinnmarge als beträchtlich erwiesen.
Vor vier Jahren schrieb der Hof zum ersten Mal seit Ewigkeiten schwarze Zahlen, und mit der Zeit konnten wir unsere Schulden auf ein vertretbares Maß reduzieren. Wir haben sogar angefangen, ein paar der Pachtverträge mit den Nachbarn aufzulösen, sodass der Hof wieder wächst, und im letzten Jahr machten wir mehr Gewinn als je zuvor.
Wie gesagt, in meinem Beruf bin ich ziemlich gut.
Ich bin Farmer.
2
Ja, ich weiß. Meine berufliche Laufbahn kommt selbst mir unwahrscheinlich vor, erst recht, weil ich viele Jahre lang gegen so ungefähr alles, was mit Landwirtschaft zu tun hatte, einen Widerwillen hegte. Letzten Endes habe ich akzeptiert, dass man seinen Weg im Leben nicht immer selbst wählen darf; manchmal wird er für einen gewählt.
Außerdem bin ich froh, dass ich meiner Tante helfen konnte. Paige ist so stolz auf mich, und das weiß ich, weil wir einander jetzt sehr viel sehen. Ihre Ehe nahm ein schreckliches Ende – so ungefähr das schlimmste vorstellbare –, und vor sechs Jahren zog sie zu uns zurück. Eine Zeit lang wohnten wir wie früher alle zusammen im Haus, aber bald schon merkten Paige und ich, dass wir als Erwachsene kein Zimmer mehr miteinander teilen wollten. Also baute ich für meine Tante ein kleineres, leicht instand zu haltendes Haus auf der anderen Straßenseite, am Rand unseres Grundstücks. Jetzt wohnen meine Schwester und ich zusammen, was für manche vielleicht seltsam klingt, aber ich genieße es, weil sie immer noch meine beste Freundin auf der Welt ist. Sie hat ihre Glaswerkstatt in der Scheune, ich kümmere mich um den Hof, und wir essen mehrmals in der Woche gemeinsam.
Mit anderen Worten, mein Leben ist momentan ziemlich gut, aber die Sache ist die: Wenn ich Leuten erzähle, dass ich Farmer bin, legen die meisten den Kopf schief und mustern mich komisch. Oft wissen sie nicht, was sie darauf entgegnen sollen. Wenn ich dagegen sage, dass meiner Familie ein großer Bauernhof gehört, dann lächeln sie und stellen Fragen. Warum das so ein Unterschied ist, weiß ich nicht genau, aber es ist mir auch hier in Florida schon mehrfach passiert. Manchmal unterhält sich nach einem Konzert jemand mit mir, und wenn derjenige erfährt, dass ich nicht aus der Musikbranche bin, kommt die Sprache früher oder später darauf, was ich beruflich mache. Je nachdem, ob ich das Gespräch beenden möchte oder nicht, habe ich mir angewöhnt, entweder zu sagen, ich bin Farmer, oder, ich besitze einen Bauernhof.
Obwohl es die letzten Jahre so gut lief, kann der Stress auch ermüdend sein. Alltägliche Entscheidungen haben oft langfristige Auswirkungen, und jede ist mit einer anderen verknüpft. Bringe ich den Traktor in die Werkstatt, damit ich mehr Zeit für Kunden habe? Oder repariere ich ihn selbst, um die tausend Dollar zu sparen? Pflanze ich mehr unterschiedliche Tomatensorten an, oder spezialisiere ich mich auf wenige und suche mehr Abnehmer? Mutter Natur ist zudem launisch, gewisse Entscheidungen erscheinen im Moment richtig, und trotzdem kann hinterher etwas Schlimmes passieren. Werden die Heizgeräte gut funktionieren, damit die Hühner an den wenigen Tagen, an denen es schneit, nicht frieren? Wird der Hurrikan an uns vorbeiziehen, oder werden Wind und Regen die Ernte vernichten?
Jeden Tag bin ich dafür verantwortlich, gesundes Gemüse und gesunde Hühner zu züchten, und jeden Tag stehe ich vor irgendeiner Herausforderung. Während manches stetig wächst, verfällt anderes beständig, und ein perfektes Gleichgewicht zu erzielen, fühlt sich manchmal wie eine unmögliche Aufgabe an. Ich könnte vierundzwanzig Stunden am Tag arbeiten und trotzdem nie sagen: Das reicht. Mehr ist nicht zu tun.
Das alles erwähne ich nur, um zu erklären, warum diese drei Wochen in Florida meine erste echte Pause seit sieben Jahren sind. Paige, meine Tante und der Verwalter bestanden darauf, dass ich das Angebot annehme. Bevor ich hierherkam, hatte ich nie auch nur eine einzige Woche frei, und die Wochenenden, an denen ich mich zwang, mal abzuschalten, kann ich an einer Hand abzählen. Auch jetzt drängen sich andauernd Gedanken an den Hof auf; in der ersten Woche habe ich meine Tante bestimmt zehn Mal angerufen, um mich zu erkundigen, wie es läuft. Schließlich verbot sie mir, mich weiterhin zu melden. Sie und der Verwalter kämen schon mit allem zurecht. In den letzten drei Tagen habe ich überhaupt nicht angerufen, selbst wenn der Drang fast überwältigend wurde. Und auch mit Paige habe ich nicht telefoniert. Vor meiner Abreise bekam sie einen ziemlich großen Auftrag, und wenn sie so richtig im Arbeitsmodus ist, hebt sie ohnehin nicht ab. Das alles bedeutet, dass ich nicht nur im Urlaub, sondern zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit allein mit meinen Gedanken bin.
Meiner Freundin Michelle hätte diese entspannte und gesunde, nicht arbeitende Version von mir bestimmt gefallen. Besser gesagt, meiner Ex-Freundin. Michelle beklagte sich immer, dass ich mich mehr auf den Hof konzentriere als auf mein Leben. Wir kannten uns seit der Highschool, wenn auch nur flüchtig, da sie, das hübscheste Mädchen der ganzen Schule, mit einem der Football-Spieler zusammen und zwei Jahre älter als ich war. Aber sie war immer freundlich, wenn wir uns im Flur begegneten. Zwischendurch verschwand sie einige Jahre aus meinem Leben, bis wir uns bei einer Party trafen, nachdem sie das College abgeschlossen hatte. Sie war Krankenschwester geworden und hatte am Vidant Medical Center gearbeitet, war aber wieder bei ihren Eltern eingezogen, um Geld für eine Eigentumswohnung in Greenville zusammenzusparen.
Jenes erste Gespräch führte zu einem Date, dann einem zweiten, und in den zwei Jahren unserer Beziehung empfand ich mich als Glückspilz. Sie war klug und verantwortungsbewusst und hatte Sinn für Humor, aber ihre Nachtschichten und mein dauerndes Arbeiten sorgten dafür, dass uns wenig Zeit füreinander blieb. Wir hätten es vielleicht trotzdem schaffen können, doch nach einer Weile erkannte ich, dass ich sie nur mochte, nicht liebte. Ich bin ziemlich sicher, dass es ihr genauso ging, und als sie schließlich ihre Wohnung gekauft hatte, wurde es praktisch unmöglich, sich zu sehen. Es gab keine unschöne Trennung, keine Wut, keinen Streit, keine Beschimpfungen; wir schrieben und telefonierten einfach immer weniger, bis der Moment kam, an dem wir schon zwei Wochen nichts voneinander gehört hatten. Obwohl wir unsere Beziehung nicht offiziell beendet hatten, wussten wir beide, dass sie vorbei war.
Ein paar Monate später lernte sie einen anderen kennen, und vor ungefähr einem Jahr las ich auf ihrer Instagram-Seite, dass sie verlobt war. Um es uns beiden leichter zu machen, kappte ich die Verbindung über soziale Medien, löschte ihre Nummer aus meinem Handy und habe seitdem nichts mehr von ihr gehört.
Hier in Florida muss ich öfter als sonst an sie denken, vielleicht weil ich überall Paare sehe. Sie kommen zu meinen Auftritten, sie halten Händchen am Strand, sie sitzen einander im Restaurant gegenüber und sehen sich in die Augen. Es gibt natürlich auch Familien hier, aber nicht so viele, wie ich erwartet hatte. Ich weiß nicht, wann in Florida Ferien sind, wahrscheinlich sitzen die Kinder einfach noch im Klassenzimmer.
Allerdings fiel mir gestern eine Gruppe junger Frauen auf, ein paar Stunden vor meinem Auftritt. Es war früher Nachmittag, und ich ging nach dem Essen am Wasser spazieren. Weil es heiß und sonnig und leicht schwül war, hatte ich mein T-Shirt ausgezogen und wischte mir damit den Schweiß aus dem Gesicht.
Als ich mich dem Don CeSar näherte, tauchte hinter der Brandung kurz etwas Graues aus dem Wasser auf und verschwand wieder, und danach gleich noch einmal. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass es eine Schule Delfine war, die träge parallel zum Strand schwamm. Ich blieb stehen, um sie zu beobachten, weil ich noch nie welche in freier Natur gesehen hatte. Da hörte ich das Grüppchen näher kommen und ein paar Meter von mir entfernt stehen bleiben.
Die vier jungen Frauen unterhielten sich laut, und zu meinem Erstaunen stellte ich fest, wie verblüffend attraktiv sie allesamt waren, in ihrer bunten Badebekleidung und mit den ebenmäßigen Zähnen, die beim Lachen blitzten. Sie wirkten bereit für ein Fotoshooting. Ich schätzte sie auf ein paar Jahre jünger als ich, wahrscheinlich College-Studentinnen in den Ferien.
Gerade als ich mich wieder den Delfinen zuwenden wollte, stieß eine von ihnen einen kleinen Schrei aus und zeigte auch in die Richtung. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass alle sich dorthin drehten. Obwohl ich nicht absichtlich lauschte, waren sie schwer zu überhören.
»Ist das ein Hai?«, fragte eine.
»Wahrscheinlich ein Delfin«, antwortete eine andere.
»Aber er hat eine Rückenflosse.«
»Die haben Delfine auch.«
Insgeheim grinste ich und dachte, dass ich vielleicht gar nicht so viel verpasst hatte, indem ich nicht zum College gegangen war. Wenig überraschend stellten sie sich zu Selfies auf, versuchten, die Delfine mit auf die Fotos zu bekommen. Nach einer Weile zogen sie die üblichen albernen Gesichter, wie man sie aus den sozialen Medien kennt: den Kussmund, das ekstatische Wir haben so viel Spaß und das ernste Ich wäre gern Supermodel, das Michelle immer als Toter-Fisch-Miene bezeichnet hatte. Bei der Erinnerung prustete ich halblaut.
Eine der Frauen musste mich gehört haben, denn sie sah plötzlich in meine Richtung. Demonstrativ mied ich den Augenkontakt und sah starr den Delfinen nach. Als sie schließlich Richtung offenes Meer davonschwammen, wollte ich mich auf den Rückweg begeben. Ich machte einen kleinen Bogen um die Frauen, von denen drei immer noch mit ihren Selfies beschäftigt waren, aber diejenige, die sich zu mir umgedreht hatte, fing meinen Blick auf.
»Coole Tattoos«, sagte sie, als ich auf ihrer Höhe war, und ich muss zugeben, dass die Bemerkung mich überrumpelte. Es war nicht unbedingt Flirten, sie wirkte eher amüsiert. Einen Moment lang schwankte ich, ob ich anhalten und mich vorstellen sollte, ließ es aber bleiben. Man musste kein Astrophysiker sein, um zu kapieren, dass sie in einer ganz anderen Liga spielte als ich, also lächelte ich nur kurz und ging weiter.
Als sie über meine mangelnde Reaktion eine Augenbraue hochzog, hatte ich das Gefühl, dass sie genau wusste, was ich dachte. Sie wandte sich wieder ihren Freundinnen zu, und ich lief weiter, wehrte mich gegen den Drang, mich umzudrehen. Je mehr ich mich bemühte, desto schwerer wurde es; schließlich gestattete ich mir einen Blick über die Schulter.
Offenbar hatte sie genau darauf gewartet. Sie hatte immer noch diese belustigte Miene, und als sie mich wissend anlächelte, drehte ich hastig den Kopf nach vorn und beschleunigte den Schritt. Die Hitze, die mir dabei den Hals hinaufkroch, hatte nichts mit der Sonne zu tun.
3
Dort auf meinem Klappstuhl am Strand waren meine Gedanken unwillkürlich wieder zu der Begegnung mit dieser Frau abgeschweift. Ich hatte nicht im engeren Sinne nach ihr oder ihren Freundinnen gesucht, hätte aber auch nichts dagegen einzuwenden gehabt, sie zu treffen, weshalb ich überhaupt meine Sachen extra bis an den Strand geschleppt hatte. Bis dahin zwar ohne Erfolg, doch ich hatte so oder so einen schönen Tag gehabt. Nach einer Runde Joggen hatte ich ein paar Fisch-Tacos in einem Lokal namens The Toasted Monkey verschlungen. Da sonst nichts Dringendes angelegen hatte, war ich im Anschluss am Strand gelandet. Ich hätte mir natürlich auch etwas Produktiveres einfallen lassen können, als praktisch um Hautkrebs zu betteln. Ray meinte, im Fort De Soto Park könne man gut kajaken, und Paige hatte mir eingeschärft, mir das Dalí anzusehen, ein ausschließlich dem Werk Salvador Dalís gewidmetes Museum. Wahrscheinlich hatte sie das auf Tripadvisor gelesen, und ich nahm es mir auch vor, aber bisher übte es auf mich einen deutlich stärkeren Reiz aus, kaltes Bier zu schlürfen und den Privatier zu spielen.
Als die Sonne sich langsam senkte, klappte ich den Deckel der Kühlbox auf und holte mir mein zweites (und wahrscheinlich letztes) Bier für diesen Tag heraus. Ich hatte vor, es ganz langsam zu trinken, dabei noch den Sonnenuntergang anzuschauen, und dann ins Sandbar Bill’s zu gehen, einen coolen Laden am Strand, in dem es die besten Cheeseburger weit und breit gab. Was den Abend betraf, wusste ich noch nicht genau, worauf ich Lust hatte. Natürlich konnte ich ein paar Kneipen in St. Petersburg ausprobieren, aber samstags war es dort wahrscheinlich ziemlich voll, und dazu war ich nicht richtig in Stimmung. Was sonst? Einen Song schreiben? Eine Netflix-Serie sehen, wie Paige und ich es manchmal zusammen taten? Eins der Bücher lesen, die ich dabei, aber noch nicht angefangen hatte? Das wollte ich auf mich zukommen lassen.
Der Strand war immer noch so voll wie bei meiner Ankunft zuvor. Hotelgäste des Don CeSar aalten sich im Schatten von Schirmen auf Liegestühlen, näher am Wasser hatten Dutzende von Touristen bunte Handtücher ausgebreitet. Ein paar kleine Kinder bauten eine Sandburg, und weiter hinten ging eine Frau mit einem Hund spazieren, dessen Zunge ihm bis auf die Pfoten hing. Immer noch war die Musik vom Pool zu hören, ab und zu zuckte ich bei einer falschen Note zusammen.
Und so kam es, dass ich sie weder auf mich zukommen hörte noch sah. Ich merkte nur, dass plötzlich jemand vor mir stand und einen Schatten auf mein Gesicht warf.
»Hallo«, sagte die Frau vom Tag zuvor, ohne einen Hauch von Befangenheit. »Hast du nicht gestern Abend im Bobby T’s gespielt?«
4
Wahrscheinlich sollte ich noch etwas erklären. Obwohl ich ja gehofft hatte, die dunkelhaarige Schönheit am Strand wiederzutreffen, hatte ich für diesen Fall keinen weiteren Plan ausgearbeitet. Ich bin nicht schüchtern bei Frauen, nur außer Übung. Zu Hause gehe ich selten aus. Meine Ausrede lautet üblicherweise, dass ich zu müde bin. Offen gestanden ähnelt aber, wenn man sein gesamtes Leben am selben Ort verbracht hat, so ungefähr jede Feierabendbeschäftigung dem alten Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Man geht in genau dieselben Lokale und sieht dort genau dieselben Leute und macht genau dieselben Sachen – und wie oft kann man solch ein endloses Déjà-vu ertragen, ohne ins Grübeln zu kommen, was das Ganze eigentlich soll?
Was ich damit sagen will, ist, dass ich im Plaudern mit schönen Fremden etwas eingerostet war und die Frau deshalb wortlos angaffte.
»Hallo? Jemand zu Hause?«, fragte sie in die Stille. »Oder hast du die Kühlbox schon komplett geleert, was bedeuten würde, ich sollte besser auf der Stelle gehen?«
Das war eindeutig nicht ernst gemeint, aber ich reagierte nicht auf ihren Scherz, während ich sie betrachtete; sie trug ein weißes abgeschnittenes T-Shirt zu ausgeblichenen Jeans-Shorts, unter denen man einen verführerischen lila Bikini erkennen konnte. Sie sah aus, als wäre sie vielleicht zum Teil asiatischer Abstammung, und ihre dicken, welligen Haare waren auf eine lässig unordentliche Art vom Wind zerzaust, als hätte sie den Tag im Freien verbracht, wie ich. Ich hob meine Flasche leicht an.
»Das ist erst mein zweites heute«, brachte ich schließlich heraus. »Aber ob du wieder gehst, liegt an dir. Und ja, könnte sein, dass du mich gestern im Bobby T’s gehört hast, je nachdem, wann du da warst.«
»Außerdem warst du gestern hier am Strand der Typ, der meine Freundinnen und mich belauscht hat, oder?«
»Ich hab nicht gelauscht«, widersprach ich. »Ihr wart so laut.«
»Und du hast mich angestarrt.«
»Ich hab die Delfine beobachtet.«
»Hast du etwa nicht über die Schulter zurückgesehen, als du gegangen bist?«
»Nein, ich hab mir nur den Nacken gedehnt.«
Sie lachte. »Was machst du hier hinter dem Hotel? Wolltest du wieder aus Versehen meine Freundinnen und mich belauschen?«
»Ich bin hier, um den Sonnenuntergang zu genießen.«
»Du bist seit Stunden hier.«
»Woher weißt du das?«
»Weil ich dich habe vorbeilaufen sehen. Wir waren am Pool.«
»Du hast mich bemerkt?«
»Du bist schwer zu übersehen mit deinem ganzen Krempel. Und du hättest dich überall hinsetzen können. Falls es dir nur um den Sonnenuntergang ging, meine ich.« Ihre braunen Augen blitzten keck.
»Möchtest du ein Bier?«, konterte ich. »Da du ja offenbar hergekommen bist, um dich mit mir zu unterhalten?«
»Nein, danke.«
Ich zögerte. »Du bist doch alt genug zum Trinken, oder? Ich möchte hier nicht der schmierige Fünfundzwanzigjährige sein, der Minderjährigen Alkohol anbietet.«
»Ja, gerade einundzwanzig geworden. Ich hab auch schon einen College-Abschluss und alles.«
»Wo sind denn deine Freundinnen?«
»Noch am Pool.« Sie zuckte die Achseln. »Sie haben sich gerade Margaritas bestellt, als ich gegangen bin.«
»Klingt nach einem angenehmen Nachmittag.«
Sie deutete mit dem Kopf auf meinen Stuhl. »Darf ich mir dein Handtuch leihen?«
»Mein Handtuch?«
»Ja, bitte.«
Ich hätte fragen können, warum, stand aber einfach auf und gab es ihr.
»Danke.« Sie schlug es aus, legte es neben meinem Stuhl auf den Sand und ließ sich darauf nieder. Ich setzte mich wieder hin und beobachtete, wie sie sich auf die Ellbogen stützte, die langen, sonnengebräunten Beine vor sich ausgestreckt. Ein paar Sekunden lang schwiegen wir beide. »Ich heiße übrigens Morgan Lee«, sagte sie schließlich.
»Colby Mills.«
»Ich weiß. Ich hab ja deinen Auftritt gesehen.«
Ach ja. »Wo kommst du her?«
»Aus Chicago«, antwortete sie. »Genauer gesagt Lincoln Park.«
»Das sagt mir nichts. Ich war noch nie in Chicago.«
»Lincoln Park ist ein Viertel direkt am See.«
»Welchem See?«
»Lake Michigan natürlich.« Ungläubig zog sie eine Augenbraue hoch. »Einer der Großen Seen?«
»Lake Michigan der Große?«
Sie lachte über meinen miesen Witz, ein tiefes und kehliges Grollen, was bei einer so zarten Gestalt verblüffte. »Genau. Der ist wunderschön und riesig. Sieht so aus wie hier.«
»Gibt es Strände?«
»Ja. Nicht mit perfektem, weißem Sand oder Palmen, aber im Sommer ist dort gut was los. Manchmal sind sogar richtig hohe Wellen.«
»Warst du da auch auf dem College?«
»Nein. Ich war auf der Indiana University.«
»Und lass mich raten: Dieser Urlaub ist ein Geschenk deiner Eltern zum Examen, bevor du in die echte Welt rausmusst?«
»Beeindruckend«, sagte sie mit einem prüfenden Blick. »Das dürftest du zwischen gestern und heute ausgetüftelt haben, was wiederum bedeutet, dass du an mich gedacht hast, stimmt’s?«
Darauf brauchte ich nicht zu antworten. Ertappt.
»Aber ja, du hast recht«, fuhr sie fort. »Ich glaube, es tat ihnen leid, dass ich mich mit diesem ganzen Covid-Theater rumschlagen musste, was das Studium eine Zeit lang ziemlich vermiest hat. Und natürlich freuen sie sich extrem, dass ich meinen Abschluss habe, also haben sie für mich und meine Freundinnen die Reise gebucht.«
»Mich wundert, dass ihr nicht nach Miami wolltet. St. Pete Beach ist nicht gerade der Nabel der Welt.«
»Ich liebe es hier.« Sie zuckte die Achseln. »Früher haben wir jedes Jahr hier Urlaub gemacht und immer im Don gewohnt.« Sie musterte mich mit unverhohlener Neugier. »Und du? Wie lange wohnst du schon hier?«
»Gar nicht, ich wohne in North Carolina. Ich bin nur hier, weil ich ein paar Wochen lang im Bobby T’s auftrete.«
»Ist das dein Beruf? Reisender Musiker?«
»Nein, das mache ich zum ersten Mal.«
»Wie bist du dann hier gelandet?«
»Ich habe zu Hause bei einer Party gespielt, und durch einen komischen Zufall war der Künstleragent für das Bobby T’s gerade bei einem Freund von mir zu Besuch und hat mich gehört. Jedenfalls hat er mich hinterher gefragt, ob ich Lust hätte, hier ein paar Konzerte zu geben. Meine Reisekosten muss ich selbst tragen, aber es war eine Chance, mal nach Florida zu kommen. Ich glaube, er war überrascht, dass ich Ja gesagt habe.«
»Warum denn?«
»Na ja, wahrscheinlich mache ich nach Abzug der Reisekosten nicht mal ein Plus. Es ist einfach eine schöne Ausrede, um mal rauszukommen.«
»Dem Publikum hat deine Musik offenbar gefallen.«
»Ach, denen würde alles gefallen, glaube ich«, wehrte ich ab.
»Und ich glaube, du stellst dein Licht unter den Scheffel. Viele Frauen haben dich mit Kulleraugen angesehen.«
»Kulleraugen?«
»Du weißt schon, was ich meine. Als die eine nach dem Konzert mit dir geredet hat, dachte ich echt, die befummelt dich an Ort und Stelle.«
»Das möchte ich bezweifeln.« Ehrlich gesagt konnte ich mich kaum erinnern, nach dem Auftritt mit jemandem gesprochen zu haben.
»Und, wo hast du singen gelernt?«, fragte sie. »Hattest du Unterricht, oder hast du in einer Band gespielt oder was?«
»Während der Schulzeit war ich in einer Band.« Ich fasste kurz meine wenig glamouröse Phase mit den Post-Punkern zusammen.
»Hat der Sänger denn je den Durchbruch geschafft?« Sie lachte. »In Los Angeles?«
»Falls ja, habe ich davon nichts mitbekommen.«
»Hast du früher schon mal in so Läden wie dem Bobby T’s gespielt?«
»Nein. Stell dir eher schmuddelige Kneipen und Clubs vor, wo die Polizei gerufen wird, wenn die Leute sich prügeln.«
»Hattest du Groupies? So wie jetzt?«
Wieder zog sie mich auf, aber ich musste zugeben, dass es mir gefiel. »Es gab ein paar Mädels, die man wohl als Stammpublikum bezeichnen konnte, aber die haben sich nicht für mich interessiert.«
»Du Armer.«
»Sie waren auch nicht mein Typ.« Ich runzelte die Stirn. »Bei genauerer Betrachtung waren sie vermutlich niemandes Typ.«
Morgan grinste, wobei Grübchen entstanden, die mir bisher noch nicht aufgefallen waren. »Also, wenn du nicht in einer Band spielst und selten auftrittst, was machst du dann beruflich?«
Selbstverständlich sagte ich: »Meiner Familie gehört ein Bauernhof.«
Sie taxierte mich mit prüfendem Blick. »Du siehst gar nicht aus wie ein Farmer.«
»Das liegt daran, dass ich meine Latzhose und meinen Strohhut nicht anhabe.«
Wieder stieß sie dieses tiefe Lachen aus, und ich stellte fest, dass ich das Geräusch sehr mochte. »Was baut ihr so an?« Während ich unsere Produkte beschrieb und an wen wir sie lieferten, zog sie die Beine an und schlang die Arme darum. Ihr makelloser roter Zehennagellack funkelte. »Ich kaufe nur Eier von freilaufenden Hühnern«, sagte sie nickend. »Mir tun die Tiere, die ihr ganzes Leben in einem winzigen Käfig verbringen müssen, so leid! Aber Tabak verursacht Krebs.«
»Zigaretten verursachen Krebs. Ich baue nur eine grüne Pflanze an, deren Blätter ich ernte, trockne und verkaufe.«
Sie klimperte mit ihren langen, dunklen Wimpern und lächelte mich nachsichtig an. »Also gut, du Spezialist. Was genau ist mit alten Tomatensorten gemeint? Ich meine, im Prinzip ist mir das schon klar, aber was unterscheidet sie von den normalen Sorten, abgesehen davon, dass sie andere Farben oder Formen haben?«
»Die meisten Tomaten, die man im Supermarkt bekommt, sind Hybride, was bedeutet, sie sind genmanipuliert – in der Regel, damit sie den Transport besser überstehen. Die Kehrseite ist, dass Hybride weniger Geschmack haben. Die alten Sorten sind keine Hybride, deshalb hat jede ihr ganz eigenes Aroma.«
Natürlich gab es zu dem Thema noch viel mehr zu sagen, zum Beispiel, ob offene Bestäubung angewandt wurde oder nicht, ob Saatgut gekauft oder selbst gewonnen wurde, der Einfluss der Böden auf den Geschmack, das Klima. Aber nur Leute, die selbst Gemüse zogen, interessierten sich wirklich für solche Einzelheiten.
»Das ist ziemlich cool«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass ich schon mal einen Farmer kennengelernt habe.«
»Es gibt das Gerücht, dass wir fast als Menschen durchgehen können.«
»Ha, ha.«
Ich grinste und spürte mir etwas zu Kopf steigen, was eindeutig nicht das Bier war. »Was ist mit dir? Wie lange bleibst du hier?«
»Noch bis morgen in einer Woche. Wir sind gestern angekommen. Kurz bevor du uns am Strand gesehen hast, genauer gesagt.«
»Warum habt ihr nicht lieber ein Ferienhaus gemietet?«
»Ich bezweifle, dass meine Eltern überhaupt auf die Idee gekommen sind. Außerdem habe ich nostalgische Gefühle gegenüber dem Don.« Sie zog eine Grimasse. »Und keine von uns kocht gern.«
»Dann hast du vermutlich in der Schule das Kantinenessen genommen.«
»Stimmt. Und das hier soll ja auch Urlaub sein.«
Ich grinste. »Ich glaube nicht, dass ich dich und deine Freundinnen gestern bei meinem Auftritt gesehen habe.«
»Wir haben nur ungefähr die letzte Viertelstunde mitbekommen. Es war ziemlich voll, wir mussten draußen am Strand stehen.«
»Tja, Freitagabend eben. Alle feiern, dass Wochenende ist.« Weil mein Bier mittlerweile warm war, kippte ich den Rest in den Sand. »Möchtest du ein Wasser?«
»Sehr gern.«
Ich öffnete die Kühlbox. Das Eis war zwar inzwischen geschmolzen, die Flaschen waren aber noch kalt. Ich nahm eine für Morgan heraus und eine für mich.
Sie setzte sich auf und wedelte mit der Flasche zum Wasser hin. »Hey, ich glaube, die Delfine sind wieder da!«, rief sie und beschirmte sich die Augen mit der Hand. »Das muss wohl ihre normale Route sein.«
»Kann sein. Oder es ist eine andere Schule. Das Meer ist ja ziemlich groß.«
»Streng genommen ist hier nicht das Meer, glaube ich, sondern ein Golf.«
»Worin liegt der Unterschied?«
»Ich habe keine Ahnung«, gab sie zu, und dieses Mal war ich es, der lachen musste. Schweigend beobachteten wir die Delfine in den Wellen. Ich war immer noch nicht ganz sicher, warum Morgan mich angesprochen hatte, denn sie war hübsch genug, um sich jeden Mann aussuchen zu können. Beim Trinken betrachtete ich verstohlen ihr Profil mit der ganz leicht nach oben zeigenden Nase und den vollen Lippen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: