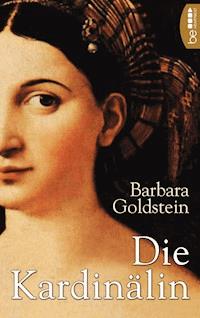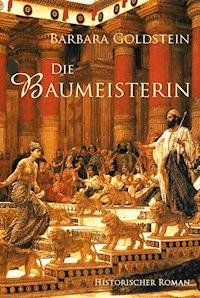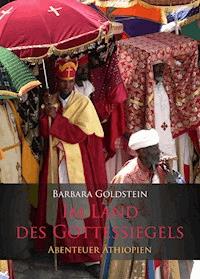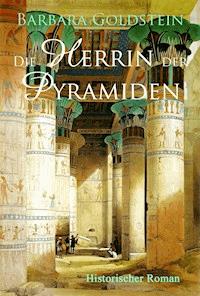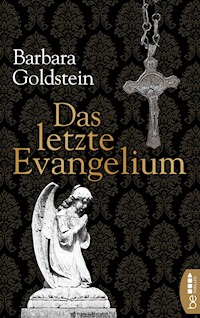
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alessandra d’Ascoli
- Sprache: Deutsch
Alessandra d'Ascoli auf der Jagd nach der Wahrheit
1453, eine verlassene Abtei in den verschneiten Abruzzen. Sie ist verletzt, erinnert sich an nichts. Nicht einmal an den Menschen, der ihr am nächsten stehen sollte: ihren Ehemann, der sich liebevoll um sie bemüht. Doch Alessandra traut ihm nicht, läuft vor ihm davon. Als sie auf ein Grab mit ihrem Namen stößt, beginnt für sie eine Reise in die Vergangenheit - eine Reise in die Hölle. Wer ist sie? Warum ist sie hier? Schatten huschen nachts durch die Abtei. Was suchen sie? Und wer ist der Tote, der in der Kapelle aufgebahrt liegt?
Auch in den folgenden weiteren historischen Romanen von Barbara Goldstein bei beTHRILLED löst Alessandra d'Ascoli spannende Rätsel:
Der vergessene Papst * Der Gottesschrein * Der Ring des Salomo * Das Testament des Satans.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumHinweisVorspannKarte von KonstantinopelPrologNoch zwei Tage …Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Intermezzo 1Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Intermezzo 2Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Noch ein Tag …Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Intermezzo 3Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60Kapitel 61Kapitel 62Kapitel 63Kapitel 64Kapitel 65Kapitel 66Kapitel 67Kapitel 68Kapitel 69Kapitel 70Kapitel 71Kapitel 72Kapitel 73Kapitel 74Kapitel 75Kapitel 76Kapitel 77Kapitel 78Kapitel 79Kapitel 80Intermezzo 4Kapitel 81Kapitel 82Kapitel 83Kapitel 84Kapitel 85Kapitel 86Kapitel 87Kapitel 88Kapitel 89Kapitel 90Kapitel 91Intermezzo 5Kapitel 92Kapitel 93Kapitel 94Kapitel 95Kapitel 96Kapitel 97Kapitel 98Kapitel 99Kapitel 100Kapitel 101Kapitel 102Kapitel 103Der letzte Tag …Kapitel 104Kapitel 105Kapitel 106Kapitel 107Kapitel 108Kapitel 109Kapitel 110Kapitel 111Kapitel 112Kapitel 113Kapitel 114Dramatis PersonaeGlossarÜber dieses Buch
Alessandra d‘Ascoli auf der Jagd nach der Wahrheit
1453, eine verlassene Abtei in den verschneiten Abruzzen. Sie ist verletzt, erinnert sich an nichts. Nicht einmal an den Menschen, der ihr am nächsten stehen sollte: ihren Ehemann, der sich liebevoll um sie bemüht. Doch Alessandra traut ihm nicht, läuft vor ihm davon. Als sie auf ein Grab mit ihrem Namen stößt, beginnt für sie eine Reise in die Vergangenheit - eine Reise in die Hölle. Wer ist sie? Warum ist sie hier? Schatten huschen nachts durch die Abtei. Was suchen sie? Und wer ist der Tote, der in der Kapelle aufgebahrt liegt?
Über die Autorin
Barbara Goldstein, geb. 1966, arbeitete zunächst in der Verwaltung von Banken und nahm dann ein Studium der Philosophie und der Sozialen Verhaltenswissenschaften auf. Später machte sie sich als Autorin historischer Romane selbstständig und nahm ihre Leser mit in die Welt von Alessandra d‘Ascoli, einer florentinischen Buchhändlerin. Barbara Goldstein verstarb im März 2014 nach langer Krankheit.
Barbara Goldstein
Das letzteEvangelium
beTHRILLED
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Copyright © 2011/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Lutz Steinhoff, München
Umschlaggestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: BusinessIllustrator | Squint Photography | Tonhom1009
Karte: Illustration aus der Schedel’schen Weltchronik,Blatt 129v / 130r (Konstantinopel)
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5301-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Ein Verzeichnis der handelnden Personen sowie ein Glossar finden sich am Ende des Buches.
»Was für ein erschreckendes Gefühl, wenn dein Lebenerst vor einer Stunde begonnen hat.Wenn du dich an nichts erinnern kannst,was vor diesem Erwachen war.«
Vom Tod ins Leben zurückgekehrt,hat sie ihr Gedächtnis verloren.Sie will wissen, wer sie ist. Und was sie getan hat.Und warum sie ermordet werden soll.Sie darf niemandem trauen, am wenigsten sich selbst.Ihre Suche nach der Wahrheit ist eine Reisein die eigene Vergangenheit.Und eine Reise in die Hölle.
Prolog
In einer verlassenen Abtei in den verschneiten Abruzzen22. Dezember 1453Kurz nach zehn Uhr morgens
»Auferstanden von den Toten«, hat er soeben gesagt.
Jetzt schlägt er mein Notizbüchlein auf und zeigt mir den letzten Eintrag. Mit dem Finger deutet er auf mein Gekritzel. »Hast du das geschrieben?«
Ich nicke.
»Was ist geschehen?«
Die Frage ist nicht, was geschehen ist, sondern was noch geschehen wird.
Ich blicke zum Fenster hinüber. Es schneit wieder in dicken Flocken. Wie spät ist es? Der Schrecken der letzten Stunden hat mir jedes Zeitgefühl geraubt. Die Ahnung einer drohenden Gefahr ist jedoch geblieben.
»Ich weiß es nicht«, gebe ich mit erstickter Stimme zu. Das Eingeständnis meiner Schwäche fällt mir schwer, weil ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. »Ich weiß nicht, was mit mir geschieht.«
Vom Tod ins Leben zurückgekehrt, habe ich mein Gedächtnis verloren. Ich will wissen, wer ich bin. Und was ich getan habe. Und warum ich ermordet werden soll.
O Gott, was für ein Schrecken!
Bedächtig mustert er die nahezu unleserliche Handschrift in meinem kleinen Notizbuch, dann die fünf Tage alte Wunde an meinem Kopf. Er gibt sich einfühlsam.
Als wüsste er, wie ich empfinde!
»Wieso hältst du dich für verrückt?«, fragt er schließlich.
»Ich kann tote Menschen sehen«, quäle ich hervor.
Er hebt die Augenbrauen und legt den Kopf schief. »Du meinst den Toten in der Abteikirche, den du gerade eben …?«
»Nein, ich meine Menschen, die schon lange tot sind«, sage ich. »Menschen, mit denen ich eben noch gesprochen habe, verschwinden spurlos, als wären sie nie da gewesen. Gegenstände, die ich eben noch in der Hand gehalten habe, sind plötzlich nicht mehr da. Spuren im Schnee verschwinden. Gräber lösen sich in Luft auf, und die Leichen darin auch. Ach ja, und da sind noch die Skizzen in meinem Notizbuch, die ich nicht gezeichnet haben kann, weil die Perspektive falsch ist.«
Er sieht mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Aber vielleicht habe ich das ja …
Mit einem Ruck, sodass der Stuhl beinahe umfällt, springe ich auf, beuge mich über den Tisch und entwaffne ihn. Mit seinem Dolch lasse ich mich zurück auf meinen Stuhl fallen. Entsetzt beobachtet er, wie ich mir die scharfe Klinge in den linken Unterarm bohre.
Der Schmerz schießt mir bis in die Schulter.
Ich muss mir selbst Schmerzen zufügen, um mir zu beweisen, dass ich noch am Leben bin und nicht unter Trugbildern leide. Ich habe das entmutigende Gefühl, vieles wieder zu verdrängen und zu vergessen, woran ich mich gerade erst erinnert habe. Die Wahrheit ist zu schrecklich, um sie anzunehmen. Das Gefühl, nicht zu wissen, wer du bist und was du getan hast, das Gefühl, dass du keine Macht über das hast, was um dich herum geschieht oder eben nicht geschieht, das Gefühl, immer wieder von vorn anzufangen, ist furchtbar wie die Hölle. Fast so schlimm wie die Qualen der letzten Stunden: Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindel, Schweißausbrüche, Ohnmachtsanfälle. Und eine lähmende Erschöpfung, körperlich und geistig.
Bin ich verrückt?
Diese Frage brauche ich ihm nicht zu stellen. Ich kenne doch die Antwort: O ja, und wie!
Er hebt beschwichtigend die Hände. »Bitte, leg den Dolch weg!«, fleht er mich eindringlich an und streckt die Hand danach aus. »Gib ihn mir zurück!«
»Nein!« Ich lege den Dolch vor mir auf den Tisch.
Wenn er nicht der ist, der zu sein er vorgibt, werde ich ihn töten. Und wenn es ihn gar nicht gibt, wie die anderen, die ich gesehen und mit denen ich gesprochen habe, dann ist es sowieso egal.
Fröstelnd ziehe ich meine verkrampften Schultern hoch. Es ist so kalt!
»Frierst du?«, fragt er fürsorglich und deutet auf den Kamin, wo ein Feuer prasselt. »Soll ich noch ein Scheit nachlegen?«
»Nein.« Die Kälte kommt von innen, aus der Leere in mir.
»Was ist geschehen?« Mit väterlicher Geste, die seine Verunsicherung überspielen soll, deutet er auf die offene Wunde an der rechten Seite meines Kopfes, auf den bleifarbenen Bluterguss auf meiner Wange, auf den verschorften Riss auf meiner Stirn, auf die anderen Wunden.
Er ist so entsetzt wie ich, als ich gestern zum ersten Mal in den Spiegel sah und mich selbst nicht erkannte. Eine Fremde blickte mir blass und erschöpft entgegen. Nur mühsam unterdrückte ich ein verzweifeltes Schluchzen. Mein ganzes Leben ist mir entrissen worden.
Er deutet auf mein wirres und blutverklebtes Haar. »Deine Verletzungen – wie ist das geschehen?«
Ich zögere einen Augenblick. »Das war ich selbst.«
Es ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere würde zu viele Fragen aufwerfen, die ich nicht beantworten kann. Noch nicht.
Nach einem langen Blick zieht er das Notizbuch zu sich heran, schlägt es auf und zeigt mir zwei leere Seiten in der Mitte, zwischen den Notizen, die ich am Anfang niedergeschrieben habe, und den Eintragungen, die ich vorhin am Ende des auf den Kopf gestellten Buches gemacht habe. Die beiden nähern sich von vorn und von hinten einander an. Was wird geschehen, wenn die Gegenwart in der Mitte des Büchleins auf die Vergangenheit trifft? Wenn ich mich endlich erinnern kann? Wenn ich begreife, was um mich herum vorgeht? Wenn ich weiß, was meine düsteren Vorahnungen bedeuten?
Ich betrachte die leeren Seiten und nicke.
Ja, so fühle ich mich, denke ich traurig. Wie eine unbeschriebene Seite, irgendwo zwischen der Vergangenheit, die sich mir entzieht, und der Gegenwart, die ebenso wenig greifbar ist. Weil ich verrückt bin. Oder auch nicht. Weil die Geschichte, in der ich feststecke, verrückt ist. Oder auch nicht. Meine Lebensgeschichte, die gestern erst begann, besteht aus wenigen hastig hingekritzelten Eintragungen in meinem Notizbuch. Sie handelt von Dingen, die gestern und heute geschehen sind. Oder auch nicht. Sie handelt von einer Frau, die allmählich den Verstand verliert. Kein ›oder auch nicht‹.
»Ich habe gelesen, was du vor einigen Stunden geschrieben hast. Erzähl mir, was dort nicht steht.«
Die längste kürzeste Lebensgeschichte aller Zeiten – aber bleibt mir noch so viel Zeit, um sie zu erzählen?
Wieder irrt mein Blick zum Fenster. Wie spät ist es? Wie lange war ich ohnmächtig? Wie viele Stunden sind vergangen, seit der andere fort ist? Und wenn er mit den beiden anderen, die vor ihm verschwunden sind, zurückkommt, um es zu suchen? Bisher haben sie es nicht gefunden. Aber sie wissen, dass ich es in mir trage. Nur dass ich mich nicht daran erinnern kann …
Ich bin in großer Gefahr. Und ich bin gefangen in diesem Kerker des Geistes, aus dem es kein Entkommen gibt.
Ich mustere den Mann, der mir gegenübersitzt. Seine mit Ringen geschmückten Finger hält er flach auf dem Tisch, damit ich sie sehen kann. Erst jetzt fällt mir der Siegelring auf. Das Wappen kann ich nicht erkennen.
Langsam atme ich aus. Kann er mir helfen, das Rätsel zu lösen, von dem mein Leben abhängt? Kann ich ihm vertrauen? Oder gehört er zu den anderen, die mein Leben bedrohen, die mich verwirren und verängstigen? Soll er mich dazu bringen, dass ich mich erinnere? Und das tödliche Wissen preisgebe, das ich in mir trage?
Nur diese Erinnerung hält mich noch am Leben. Auch wenn ich sie vergessen habe. Widersinnig? O ja, und wie!
Wenn ich mich ihm anvertraue, wenn ich ihm das Geheimnis offenbare, vertraue ich ihm mein Leben an, und davor fürchte ich mich. Die Vorstellung, mein Schicksal in die Hände eines anderen zu legen, den ich nicht kenne, den ich nicht einschätzen kann, dem ich nicht vertrauen kann, ist mir unerträglich. Aber habe ich denn eine Wahl?
Ja, die habe ich: Ich kann ihn töten.
Ich glaube, er spürt, wie aufgewühlt ich seit seinem plötzlichen Auftauchen in der Abteikirche immer noch bin. Denn er bedrängt mich nicht, sondern wartet geduldig ab, bis ich bereit bin, zu erzählen. Meine Hände, die neben dem Dolch auf dem Tisch liegen, lässt er nicht aus den Augen. Er hat doch gesehen, was ich mit dem Menschen in der Kirche gemacht habe, dessen Blut an meinen Händen klebt. Er weiß, dass ich ihn töten kann.
Ich atme tief durch, um mich zu beruhigen. »Ich traue meinen Erinnerungen nicht mehr.«
»Was meinst du damit?«, fragt er behutsam.
»Ich traue mir selbst nicht mehr.«
Er nickt versonnen. Er hat meine Notizen gelesen. Aber offensichtlich nicht verstanden.
»Ich muss von Anfang an erzählen, sonst begreifst du nicht, was in den letzten Tagen in dieser Abtei geschehen ist.«
Er lehnt sich zurück, faltet die Hände vor der Brust und blickt mich auffordernd an. »Ich bin gespannt.«
»Meine Geschichte beginnt mit ihrem Ende«, warne ich ihn. »Mit meinem Tod.«
Wie entsetzt er mich ansieht! Hielt er mich denn nicht auch für tot und begraben?
»Wie es ist zu sterben? Ich sage es dir. Sterben ist wie Schlafen. Wie Vergessen. Es gibt keine Worte, um dieses herrliche Empfinden zu beschreiben. Aber um das Gefühl wiederzugeben, das dich durchzuckt wie ein Schmerz, wenn jemand dich für tot erklärt, obwohl du noch lebst, atmest und fühlst, reicht ein einziges Wort: Hölle.«
Noch zwei Tage …
Alessandra
Kapitel 1
In der Zelle des Abtes21. Dezember 1453Nach dem Stundengebet der Laudes im Morgengrauen
Schlaf, dem Tode nah …
Die Finsternis des Vergessens umgibt mich wie ein undurchdringlicher Nebel. Zwei Hände ragen daraus hervor. Blut rinnt von ihnen herab. Sind es meine Hände? Eine Hand wühlt in Fleisch und Blut, die andere umklammert den blutigen Dolch. Jemand schluchzt und schreit. Bin das ich?
Und wer ist der andere, dessen Körper verdreht auf dem Marmorboden liegt? Was ich da vor mir sehe, wird auch mit mir geschehen.
Wie ein scharfer Schmerz durchzuckt mich die Ahnung der Gefahr, die hinter mir lauert. Mein Blut gefriert zu Eiskristallen. Mit dem Dolch in der Hand wirbele ich herum. Ein schwarzer Schemen, der die Finsternis in sich aufzusaugen scheint, kommt langsam und bedrohlich auf mich zu …
Mit einem Ruck werde ich fortgerissen. Wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Wieder nur Finsternis um mich herum. Und immer noch das zutiefst verstörende und doch befreiende Gefühl, keinen Körper mehr zu haben, der Schmerz empfinden kann, die Qualen des Todeskampfes oder die Wonnen der sinnlichen Vereinigung mit dem Geliebten.
Ist Sterben wie Einschlafen ohne Träumen? Aber was war das eben? Eine Erinnerung? Oder ein Albtraum?
»Komm zurück!«
Wie dieser Zustand angefangen hat? Es begann mit einem Schmerz, der mich durchzuckte und dann ganz plötzlich verschwand. Dann hatte ich das Gefühl, über einem finsteren Abgrund zu schweben, erfüllt von einem überwältigenden Empfinden von Wärme, Freude und Zufriedenheit. Ich kann mich erinnern, dass ich dachte, ich wäre tot.
»Komm zurück!«
Woher kommt die Stimme? Ich lausche, doch außer dem leisen Glockenläuten, das wie von einem Wind aus weiter Ferne zu mir herübergeweht wird, kann ich nichts hören. Abwartend schwebe ich in der schwarzen Leere.
»Komm zurück! Du kannst es, wenn du es willst!«
Da ist es wieder!
Eine tiefe, samtige Stimme. Eine tröstende Stimme, in die man sich einwickeln könnte wie in eine wärmende Decke, um sicher und geborgen darin zu sein.
Ein Mann, er ist ganz nah. Als ob er neben mir steht. Als ob er mich gleich berührt. Doch ich kann nichts spüren. Wo ist er? Ist er auch gestorben?
»Komm zurück zu mir!«
Wieder ein Ruck. Dann habe ich das Gefühl, aus großer Höhe zu fallen. Von panischem Schrecken ergriffen, denke ich: Ich stürze ab!
Der Schmerz des Aufpralls lässt mich aufstöhnen. Von den herrlichen Gefühlen von Frieden und Ruhe, die mich dort erfüllt hatten, bringe ich nichts mit zurück. Sie sind fort, geblieben sind nur die Schwere und der Schmerz.
»Dieu soit avec nous!«, ruft eine andere Stimme. Sie ist rau und durchdringend wie eine knarrende Tür aus altem Holz. »Fra Gil, sieh doch nur!«, wechselt er ins Lateinische. »Sie hat die Augen geöffnet!« Leise raschelt Stoff. Bekreuzigt er sich?
Wie kann er mich sehen?, frage ich mich verwirrt. Es ist doch noch immer finster um mich herum! Ich kann keinen Lichtschimmer erkennen. Ein leises Knacken und Knistern, der Duft von brennendem Holz und eine glühende Hitze lassen mich auf ein flackerndes Kaminfeuer schließen, das die eisige Winterkälte vertreiben soll. Das Gemäuer oberhalb meines Kopfes strahlt eine feuchte Kälte aus, die ein entsetzliches Gliederreißen verursacht. Ein eisiger Luftzug dringt vom Ende meines Bettes zu mir. Wo bin ich?
»Allahu akbar!«, flüstert die sanfte Stimme, die offenbar Fra Gil gehört. Wieder raschelt Stoff. Bekreuzigt er sich auch? Dann kann ich einen warmen Atem auf meinem Gesicht spüren. Jemand beugt sich über mich.
Seine Stimme klingt sanft und tröstend, doch ich spüre seinen Hass und seine Verachtung. Wieso hasst er mich? Was habe ich ihm getan? Panik steigt in mir auf, und ich atme tief durch, um mich zu beruhigen. Ich versuche mich zu bewegen, aber ich schaffe es nicht. Sind meine Hände gefesselt?
»Kannst du mich hören?«, fragt Fra Gil auf Kastilisch mit leicht maurischem Akzent. Woher kenne ich seine Stimme?
»Ja«, antworte ich und versuche zu nicken. »Wer bist …«
»Sie scheint mich nicht zu verstehen«, murmelt Fra Gil enttäuscht, jetzt wieder auf Lateinisch. Er klingt … angespannt? Ungeduldig? Beunruhigt? Und irgendwie hoffnungslos. Aber wieso? Ich verstehe nicht, was hier vorgeht!
»Doch, ich kann dich hören!« Ich will die Hand heben, aber ich schaffe es nicht. »Entzünde bitte eine Kerze, sei so gut. Es ist so dunkel hier. Ich kann nicht sehen, wo ich …«
»Aber ihre Augen sind doch offen!« Noch eine Stimme. Sie spricht Lateinisch mit italienischem Akzent. Wie viele Männer sind denn hier? Drei? Oder noch mehr?
»Ihre Pupillen reagieren nicht auf den Schein der Kerze. Es scheint, dass sie uns weder sehen noch hören kann.« Das ist wieder der Franzose. Der süße Geruch von heißem Bienenwachs dringt mir in die Nase. Die Hitze der Flamme kann ich auf meinen Wangen spüren. Offenbar leuchtet er mir ins Gesicht.
Wer sind die Männer? Wo bin ich? Was geht hier vor?
»Ich kann euch verstehen«, sage ich auf Lateinisch. Als ich keine Antwort erhalte, wiederhole ich den Satz etwas lauter, diesmal auf Italienisch. Keine Reaktion. Dann auf Französisch. Wieder nichts, obwohl ich schreie, so laut ich kann. Also auf Arabisch. Nichts.
»Ist sie tot?«, fragt der Italiener.
O Gott, was ist das für ein Albtraum?
»Nein, ich bin nicht tot!«
Verflucht, sie hören mich nicht!
Ein warmer Atem streicht mir über die Wange. Jemand scheint sich über mich zu beugen. »Sie sieht traurig aus.« Das ist wieder Fra Gil.
Seine Stimme kommt mir bekannt vor. Warum spricht er so leise? Fürchtet er, ich könnte ihn erkennen? Was habe ich ihm getan, dass er mich hasst? Wie hieß er, bevor er Fra Gil wurde? Wie lautete sein maurischer Name? Wenn ich doch sein Gesicht sehen könnte!
»Traurig?«, wiederholt der Italiener.
»Ich bin nicht traurig!«, rufe ich so laut ich kann. »Ich bin verzweifelt! Ich habe furchtbare Angst! Und so langsam werde ich wütend! Wieso hört ihr mich denn nicht?«
»Ihr Gesichtsausdruck hat sich verändert. Sieh doch selbst.«
Der weiche Untergrund, auf dem ich liege, schwankt ein wenig, als Fra Gil aufsteht und dem Italiener Platz macht. Liege ich im Bett? Stoff raschelt, als der Italiener sich über mich beugt. Ich kann seinen Geruch wahrnehmen: Schweiß, Metall, Leder, Pferd. Er riecht nicht so angenehm nach Moschus, Zimt und Pfeffer wie Fra Gil. Der Maure verströmt einen exotischen Duft, der mich an irgendetwas erinnert. An sinnliche Verführung? Oder an eine Person. Aber wer war das? So sehr ich mich auch bemühe, ich kann mich nicht entsinnen.
»Sie sieht nicht traurig aus«, sagt der Italiener. »Sondern verwirrt. Und ängstlich. Seht mal die Falte zwischen ihren Augenbrauen.« Ganz sanft berührt ein tastender Finger meine Stirn und fährt an den Augenbrauen entlang. »Woher mag diese Narbe stammen? Von einem Kampf? Sie reicht von der Augenbraue bis zum Haaransatz.«
»Fra Adrian! Du vergisst dich!«, ermahnt Fra Gil den Italiener in scharfem Ton. »Muss ich dich an deine Gelübde erinnern?«
Fra Adrian schnaubt wütend. »Fra Gil, wer von uns beiden hat sie entkleidet, um ihre Wunden zu versorgen? Wer von uns beiden hat ihr das Blut abgewaschen und sie dabei an ihren intimsten Stellen berührt? Wer von uns beiden war stundenlang mit ihr allein?«
»Fra Adrian! Ich …«
»Mon Dieu! Seht mal, jetzt sieht sie aus, als ob sie angestrengt zuhören würde. Als wollte sie uns etwas sagen«, wirft der Franzose ein.
»Versteht sie uns?« Als der andere nicht sofort antwortet, fragt Fra Gil nach: »Fra Lionel?«
»Ich weiß es nicht.«
Fra Gil, Fra Adrian, Fra Lionel. Ein Maure, der Kastilisch spricht. Ein Italiener. Ein Franzose. Alle drei sind Fratres, also Mönche. Aber von welchem Orden? Wo bin ich? In einer Abtei?
»Was hält sie da eigentlich in der Hand?«, fragt Fra Lionel.
»Wo?« Fra Adrian lehnt sich über mich. Ein leises Klirren lässt mich aufhorchen. Du lieber Himmel, was ist denn das? Es fühlt sich hart an. Und schwer. Trägt er ein Kettenhemd unter seinem Habit?
»In der linken Hand«, ertönt Fra Lionels knarrende Stimme.
Gar nicht so leicht, die drei Stimmen auseinanderzuhalten. Schon gar nicht, wenn ich zu verstehen versuche, worüber sie eigentlich reden.
»Das ist ein Schlüssel«, sagt Fra Gil. »Ich habe versucht, ihn ihr zu entwinden, aber sie hielt ihn fest, als hinge ihr Leben davon ab. Ich hätte ihr die Finger brechen müssen.«
Wovon, zum Teufel, redet er? Ich spüre nichts. Was für ein Schlüssel?, frage ich mich verwirrt. Und warum habe ich ihn in der Hand?
»Dio del Cielo – Gott im Himmel! Sie hat drei Tage lang den Schlüssel in der Hand gehalten?«
Drei Tage? Liege ich schon so lange hier?
Und vorher? Was war vor der undurchdringlichen Mauer aus Schmerz und Vergessen? Was war vor dem bestürzenden Gedanken, dass ich tot bin?
Drei Tage!
»Richtig.«
»Ist das der Schlüssel, den wir suchen?« Ich spüre den Schmerz, als Fra Adrian versucht, meine verkrampften Finger mit Gewalt aufzubiegen. Ich warte auf ein Knacken, wenn die Finger brechen, aber ich höre nichts. Dann lässt der Schmerz langsam nach.
»Ich weiß es nicht«, sagt Fra Gil. »Es ist ein Schlüssel dieser Abtei, so viel ist sicher.«
»Sie muss es hier versteckt haben.«
Was muss ich versteckt haben? Vor wem? Vor den drei Mönchen? Ich kenne sie doch nicht einmal! Oder doch? Sie scheinen allerdings zu wissen, wer ich bin …
Ich muss in Ruhe darüber nachdenken.
Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich kann mich nicht erinnern, an gar nichts. Wenn ich in die Zeit vor meinem Erwachen zurückblicken will, ist da nur Finsternis. Und Blut. Und Schmerz. Was habe ich getan? Habe ich jemanden getötet? Wieso bin ich hier? Und was habe ich versteckt?
Und was war dann?
Nichts. Keine Erinnerungen. Nur die Finsternis des Vergessens.
Ein scharfer Schmerz durchzuckt meine Hand, als Fra Adrian mir den Schlüssel mit Gewalt entreißt. Ich will die Finger bewegen, aber es gelingt mir nicht. Und die Füße? Ich versuche zu strampeln, um die Decke, die auf mir zu liegen scheint, wegzutreten, doch es geht nicht. Wie gelähmt liege ich auf dem Bett, auf dessen Rand die Fratres sitzen. Und der Kopf? Nein. Ich kann nicht einmal sagen, ob ich liege oder ob ich in den Kissen lehne.
Was ist geschehen?, denke ich entsetzt. Bin ich gestürzt? Habe ich mir das Genick gebrochen? Kann ich mich deshalb nicht bewegen? Fra Adrian sprach eben von Wunden, die Fra Gil versorgt hat, von Blut … und ich spüre auch Schmerzen, die wie Meereswogen immer wieder durch meinen Körper branden. Habe ich drei Tage lang in tiefer Ohnmacht gelegen? Bin ich erwacht? Oder träume ich? O Gott, lass es ein Albtraum sein, aus dem ich gleich erwache!
»Ein großer Schlüssel, wie zu einem Gewölbe.« Fra Adrian scheint den Schlüssel zu betrachten. Der Stoff seines Habits raschelt leise, als er ihn schließlich weiterreicht.
»Wir müssen es finden«, drängt Fra Gil. »Die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. Sie suchen bestimmt schon nach ihr.«
Wer sucht nach mir? Mein Vater? Ich denke angestrengt nach, doch außer ihm fällt mir niemand ein. Habe ich einen Ehemann? Ich weiß es nicht. Ein Fetzen Erinnerung formt sich zu einem Gesicht, das sich ständig verändert, als würde ich es in einem Spiegel betrachten, über den eine klare Flüssigkeit träge hinabrinnt, die die Gesichtszüge, die Augen, die Nase, die Lippen, die Haare verzerrt. Oder als wären es verschiedene Männer. Drei? Vier? Oder fünf? Gott, ist das enttäuschend!
Dann sehe ich plötzlich Blut, eine große Lache auf einem glänzenden Marmorboden. Daneben liegt ein Mann. Sein Gesicht kann ich nicht erkennen, aber ich weiß, dass er tot ist. Wer ist er? Einer meiner Ehemänner, an deren Gesichter ich mich nicht mehr erinnern kann? So viel Blut! Schluchzend weiche ich einen Schritt zurück, fahre mir mit einer blutnassen Hand über das Gesicht. Mit der anderen umklammere ich den Dolch, von dem das Blut tropft …
Dieselbe Erinnerung wie vorhin. Was habe ich getan?
»Wie kommst du darauf, dass sie nach ihr suchen?«, fragt Fra Lionel mitten hinein in meine verstörenden Visionen.
»Während des Schneesturms vor vier Tagen hat sie einen alten Schäfer nach dem Weg gefragt, nachdem sie und Fra Galcerán sich in den tief verschneiten Bergen um den Gran Sasso hoffnungslos verirrt hatten. Vielleicht hat er sie erkannt …«
Wir sind also in den Abruzzen. In einer Abtei unweit des Gran Sasso. Bis Rom sind es sechzig oder siebzig Meilen durch das verschneite Gebirge. Gut zu wissen. Wieso? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum Rom wichtig für mich ist. Wenn ich versuche, mir Rom vorzustellen, denke ich an einen Thronsaal und einen majestätisch wirkenden Mann in weißer Soutane, der mich mit väterlichem Gestus zu sich winkt und der mich mit einem verschwörerischen Augenzwinkern auf den Stufen zu seinem Thron auf einem purpurnen Samtkissen sitzen lässt. Wie alt war ich damals? Acht? Oder neun? Und wer ist der Mann? Mein Vater?
Und wer ist eigentlich Fra Galcerán? Ein vierter Mönch, dem Namen nach aus Aragón? Ist er auch hier? Ich lausche, aber ich kann nur drei Männer hören. Wo ist Fra Galcerán?
»Wie ärgerlich!« Fra Adrian knirscht mit den Zähnen. »Es kann sein, dass der Alte wusste, wer sie ist, auch wenn sie ohne ihre Eskorte bewaffneter Bravi unterwegs war. Die Abtei liegt auf ihrem Hoheitsgebiet.«
»Und Rom ist nur zwei Tagesritte entfernt«, ergänzt Fra Gil. »Ich möchte nicht wissen, was geschieht, wenn der Kardinal sie in diesem Zustand findet.«
»Er wird uns exkommunizieren«, prophezeit Fra Adrian düster.
»Mit päpstlichem Segen. Papst Nikolaus selbst wird ihm die Glocke, die Kerze und die Heilige Schrift reichen.«
»Der Großmeister wird uns aus dem Höllenfeuer retten!«, wendet Fra Adrian ein.
»Fra Jean Bonpart de Lastic?« Fra Gil lacht trocken. »Verehrter Bruder, diese Geheimoperation hat nie stattgefunden! Fra Diniz ist nicht in der Schlacht gefallen. Und Fra Galcerán ist nicht von ihr ermordet worden.« Er klingt verbittert.
Wen meint er? Von wem ist Fra Galcerán ermordet worden? Und wer ist Fra Diniz? Ein fünfter Mönch? Der Name klingt portugiesisch. Du lieber Himmel, welchem Orden gehören sie denn an? Sie tragen Kettenhemden unter ihren Habites. Sind die Tempelritter wiederauferstanden?
Was habe ich mit alldem zu tun? Der Schlüssel in meiner Hand … Was geht hier vor?
»Wie ärgerlich!«, wiederholt Fra Adrian.
»War der Einsatz in Konstantinopolis denn nicht vom Papst befohlen worden?«, fragt Fra Lionel verwirrt. »Ich dachte, der Großmeister hat …«
»Seine Heiligkeit weiß nichts davon«, gesteht Fra Gil.
Interessant! Ich vermute, dass die drei sich erst seit wenigen Stunden kennen. Hat Fra Gil die anderen um Hilfe gebeten? Es scheint so. Ist er in ein nahe gelegenes Ordenshaus geritten, nach Rom oder Orvieto oder Capua oder Atri oder wohin auch immer, um sie hierherzuholen? Fra Gil scheint zu wissen, worum es geht – die beiden anderen nicht. Nimmt Fra Gil einen höheren Rang im Orden ein? Trotz seiner maurisch-muslimischen Herkunft? Vorhin ist ihm das ›Allahu akbar!‹ herausgerutscht, und sein Kastilisch klingt, als stamme er aus Granada. Woher weiß ich das? Vielleicht habe ich ja dort gelebt?
»Allmächtiger Gott! Papst Nikolaus weiß nichts davon?«, stöhnt Fra Adrian. Seine Stimme klingt dumpf, als berge er das Gesicht in beiden Händen.
»Und was jetzt?«, fragt Fra Lionel. Seine Stimme klingt gepresst, als fürchte er den Zorn des Papstes. Wieso ich das denke? Ich habe das Gefühl, dass ich oft gezwungen bin, Menschen nach dem ersten Eindruck einzuschätzen. Dass ich ihnen vertrauen muss, ohne sie zu kennen.
»Wir machen weiter wie besprochen«, entscheidet Fra Gil resolut. »Wir müssen die Reliquie finden, bevor der Kardinal oder der Papst hier auftauchen.«
Schweigen.
»Und was heißt das?«, fragt Fra Lionel.
Jemand atmet langsam durch die Nase aus. Ist es Fra Gil?
»Sie ist tot«, sagt er schließlich leise. »Lasst sie uns begraben.«
Kapitel 2
In der Zelle des Abtes21. Dezember 1453Kurz nach halb acht Uhr morgens
Nein, das ist alles nicht wahr!, rede ich mir ein, um mich zu beruhigen. Das geschieht nicht wirklich!
Verzweifelt versuche ich mich gegen die Hände zu wehren, die mich jetzt packen und vom Bett hochheben. Ich höre das Rascheln des Lakens und frage mich, ob ich nackt bin. Nein, ich trage ein langes Gewand. Ein Nachthemd? Einen Habit? Hat Fra Gil ihn mir angezogen, nachdem er mich gewaschen hat?
Ich kenne seine Stimme. Ich weiß, ich bin ihm schon einmal begegnet. Aber wo? In Rom? Oder in Granada? Aber wer ist er? Ich kann mich nicht an sein Gesicht erinnern … oder doch? Kurz geschnittenes, in der Sonne hell schimmerndes Haar, gestutzter Bart, blaue Augen. Unverkennbar maurische Gesichtszüge. Trug er nicht eine Djellabiya aus saphirblauer Seide und einen weißen Turban? Sein Name war … Ich weiß es nicht, ich habe ihn vergessen. Wie ich mein ganzes Leben vergessen habe.
Das Gefühl, dass ich von ihm bedroht werde, wird immer greifbarer.
Gibt es denn kein Erwachen aus diesem Albtraum?
»Lasst mich in Ruhe!«, schreie ich. »Ich bin nicht tot! Ihr könnt nicht einfach so tun, als wüsstet ihr das nicht! Mein Herz schlägt! Ich atme! Ich empfinde! Ich spüre, was ihr mir antut! Ihr dürft mich nicht lebendig begraben! Legt mich zurück auf das Bett, sofort!«
Die Ohnmacht, dass ich mich nicht gegen sie wehren kann, und die rasende Wut lassen mich aufschluchzen. Heiße Tränen steigen in meine Augen. Ich will sie fortblinzeln, doch es geht nicht. Als ich hochgehoben werde, fließt eine Träne aus meinem Augenwinkel, rinnt über meine Schläfe hinunter bis in mein Ohr.
»Seht doch, sie weint.« Sanft berührt Fra Lionels Hand mein Gesicht und wischt die Spur der Träne fort. »Sie lebt.«
»Nein, sie ist tot.« Das ist Fra Gils Stimme, ganz nah. Ich glaube, er hält mich in seinen Armen.
Fra Lionel ergreift meine linke Hand, die kraftlos herabzuhängen scheint, und dreht sie um. »Als Fra Adrian ihr den Schlüssel gewaltsam abgenommen hat, hat er sie verletzt. Sie blutet, seht ihr? Ihr Herz schlägt. Sie ist nicht tot.« Er tritt so nah an mich heran, dass ich seinen Atem auf meinem Gesicht spüren kann. Er riecht nach Brot und Wein. »Kannst du mich hören?«
»Ja!«, rufe ich. »Ja, ja, ja!«
»Kein Lebenszeichen«, sagt Fra Gil.
Der französische Mönch packt meine Hand. »Wenn du mich hören kannst, dann drück meine Hand so fest du kannst.«
Mit aller Kraft drücke ich zu und warte auf sein gequältes Stöhnen. Nichts – er schnauft nicht einmal!
»Was habe ich gesagt?«, faucht Fra Gil. »Und jetzt geh mir aus dem Weg! Ich bringe sie in die Krypta der Kirche.«
Doch Fra Lionel gibt nicht auf. »Kannst du blinzeln?«, fragt er mich. »Wenn du mich verstehen kannst, dann blinzele.«
Ich weiß nicht einmal, ob meine Augen offen oder geschlossen sind. Wie soll ich da blinzeln?
»Sie sieht so schön aus, so voller Leben«, sagt Fra Adrian und streichelt meine Wange. Sein Ring zerkratzt mir das Augenlid.
»Na, seht ihr? Sie bewegt sich nicht«, nuschelt Fra Gil. »Kommt jetzt, in diesem Zustand nützt sie uns nichts. Sie kann uns nicht verraten, wo sie die Reliquie versteckt hat. Sie ist so gut wie tot. Was guckt ihr so? Ihr wisst doch, wer sie ist. Und ihr kennt ihren Rang. Sie muss verschwinden, bevor der Papst uns alle exkommuniziert.«
Das ist mein Todesurteil.
Kapitel 3
In einer Grabnische der Krypta der Abteikirche21. Dezember 1453Kurz nach Sonnenaufgang, gegen acht Uhr morgens
Das Erwachen ist schmerzhaft.
Wie schwer bin ich verletzt?
Wer hat mir die Wunden zugefügt?
So viel Blut! So viel Schmerz! So viel Trauer! So viel Leid! Wer war der Tote? Was habe ich getan?
Wann werde ich mich erinnern?
Wenn ich so weit bin …
Die Erkenntnis trifft mich schmerzhaft wie ein Hieb.
Wenn ich mich erinnern möchte …
Was ist denn nur geschehen? Ist das Vergessen all meiner Erinnerungen, der Verlust meines ganzen Lebens, durch ein verstörendes Erlebnis verursacht worden?
Mein Herz rast, als würde ich panisch vor irgendetwas fliehen, und ich zittere am ganzen Körper.
Ich muss tief durchatmen, um mich zu beruhigen. Wo bin ich? Ich kann immer noch nichts sehen. Ein Lufthauch weht mir ins Gesicht. Mein Atem?
Ich ahne, wo ich bin. Von Todesangst erfüllt, versuche ich, mich zu bewegen, mich aufzurichten, um zu fliehen. Es geht nicht.
Ich liege in einer engen Grabnische – ja, so muss es sein. Die Decke ist so niedrig, dass mir mein eigener Atem entgegenweht.
Ein Schauer läuft durch meinen Körper, als ich einen süßlich dumpfen Geruch wahrnehme. Es riecht nach faulendem Laub. Nach welkenden Blumen. Oder nach … Mein Gott, hilf mir!
Mein Herz pocht, meine Zähne klappern vor Kälte, mein Atem geht stoßweise, dieAngst kriecht mir den Rücken hoch.
Neben mir liegt eine verwesende Leiche!
Ich halte den Atem an, um die mit Moder und giftigem Schimmel verpestete Luft nicht einatmen zu müssen. Doch ich muss weiteratmen. Röchelnd ringe ich nach Luft.
Während ich versuche, mit den ausgestreckten Fingern der rechten Hand über den Boden der Grabnische zu tasten, stelle ich mir vor, worauf ich gleich stoßen werde: eine stark verweste Leiche. Die von Fäulnisgasen aufgequollene Haut ist vermutlich bläulich grün verfärbt. Und so durchscheinend wie weiches Wachs, durch das sich wie eine grüne Marmorierung das Geflecht der Adern zieht. Maden wimmeln in den Löchern der Haut. Milben haben sich in den Haaren gebildet. Während ich versuche, meine Hand zur Seite zu schieben, befürchte ich, jeden Augenblick die Feuchtigkeit aus verflüssigtem Fleisch zu ertasten, die sich unterhalb der Leiche in einer Lache sammelt. Aber – kann ich meine Hand überhaupt bewegen? Ich kann keine Bewegung spüren …
Das Blut rauscht in meinen Ohren und schwillt zu einem dumpfen Dröhnen an, wie von Hunderten Kirchenglocken, die zum Sturm geläutet werden. Und da ist noch ein anderes Geräusch. Ein lautes Donnern, wieder und immer wieder. Glockenläuten und Kanonendonner, so laut und durchdringend, dass es in meinen Ohren unaufhörlich sirrt.
Wo bin ich? In Helm und Harnisch und mit einem Schwert in der Hand stehe ich an der Brüstung einer Stadtmauer aus rotem Stein. Keine drei Schritte entfernt schlägt ein Felsbrocken mit Donnergetöse in die Mauer. Scharfkantige Steinsplitter fliegen durch die nach Feuer und Schwefel riechende Luft und prasseln auf mich herab. Schreiend werfe ich mich auf den Boden. Mein Helm und mein Harnisch dröhnen vom Aufprall der Bruchstücke. Steinstaub und unerträglicher Durst zwingen mich zum Husten. Neben mir kreischt ein Mann mit blutüberströmtem Gesicht und presst sich die Hände gegen Stirn und Augen – einer meiner Bravi?
Keuchend springe ich auf und sehe mich um. Vor mir wogt das Schlachtengetümmel, es ist ein Sturmangriff der Yeniçeriler. Die grellen Mündungsfeuer der Kanonen, die auf die Mauer gerichtet sind, blenden mich. Neben dem Purpurzelt des Padişah flattern Standarten im Wind. Bis zum Horizont nehme ich Feuer, Rauch, Getöse und Geschrei wahr. Dazwischen höre ich Trommeln und Trompeten, Pferdewiehern und Waffenklirren, gebrüllte Befehle und schrille Schmerzensschreie. Welch furchtbarer Anblick!
Und hinter mir die Stadt. Ich wende mich um. Die Glocken läuten Sturm, um uns Mut zu machen. Unter gewaltigem Kanonendonner, der die Luft um uns herum erzittern lässt, fliegen Felsbrocken über uns hinweg und prallen bis zu eine Meile entfernt auf Häuser, Paläste und Kirchen, deren Mauern zerbersten und einstürzen. Der Boden unter meinen Füßen bebt. Schwarze Rauchwolken von feuernden Kanonen und brennenden Häusern, Obstbäumen und Weinbergen rauben mir den Atem. Das ›Kyrie eleison‹ der blutüberströmt umherstolpernden Menschen und das Dröhnen der großen Glocken, die den Allmächtigen um Barmherzigkeit anflehen, machen diese Nacht zur Hölle …
Doch da ist plötzlich noch etwas anderes.
Leiser Psalmengesang? Lateinisch, nicht griechisch.
Nein, der Gesang gehört nicht zu meiner Erinnerung. Ich lausche angestrengt und ziehe meine Augenbrauen zusammen.
Jetzt kann ich es deutlicher hören!
»De profundis clamavi ad te Domine …«
Der 130. Psalm – das Totengebet!
Halten die Fratres das Stundengebet der Prim? Oder feiern sie schon meine Totenmesse, während ich noch in meinem Grab liege und darauf warte, dass sie mich lebendig einmauern?
Gott verfluche sie! Ich muss weg von hier – sofort!
Aber wie?
»Domine exaudi vocem meam fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae …«
Leise dringt der getragene Gesang der Mönche zu mir, ein unheilvoller Cantus choralis.
Von Todesangst erfüllt, versuche ich wieder, mich zu bewegen. Ich konzentriere mich auf meine linke Hand. Mit aller Kraft schiebe ich sie zur Seite, dorthin, wo ich die Öffnung der Grabnische vermute. Bewegt sich die Hand? Ja? Nein? Ich kann nichts spüren …
»Si iniquitates observabis Domine? Domine quis sustinebit?«
Noch einmal!
Meine Fingerspitzen bewegen sich nicht!
»Quia apud te propitiatio est propter legem tuam sustinui te Domine sustinuit anima mea in verbum eius.«
Noch einmal!
Angenommen, ich schaffe es, mich aus der Grabnische zu ziehen, dann werde ich aus drei oder vier Ellen Höhe hart auf die Steinfliesen fallen – und was dann? In welche Richtung soll ich wegkriechen? Ich muss mich an den Wänden entlangtasten, um das Gewölbe zu verlassen. Ich kann doch nichts sehen!
Nicht aufgeben! Und jetzt die Hand!
»A custodia matutina usque ad noctem speret Israel in Domino.«
Halt! Das kann nicht sein! Der Text stimmt nicht. Was ist aus dem ›Speravit anima mea in Domino‹ geworden? Meine Seele hofft noch auf den Herrn! Ich bin nicht tot!
»Quia apud Dominum misericordia et copiosa apud eum redemptio …«
Die Hand – ich muss mich konzentrieren!
Wieder nichts! Die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern. Gleich werden sie zurückkommen, um die Grabplatte vor die Nische zu schieben.
Lebendig begraben! O Gott, hilf mir doch!
»… et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius.«
Plötzlich wird es still. Das Gebet ist beendet.
Kurz darauf kann ich ihre Schritte durch die Abteikirche hallen hören. Sie kommen eine lange Treppe herunter in die Krypta, ein Gewölbe unterhalb der Basilika.
Panisch schiebe ich meine Hand zum Rand meiner Grabnische. Und ich erschrecke beinahe zu Tode, als ich plötzlich eine leise Berührung unter meinen Fingerspitzen spüre. Meine Hand hat sich bewegt!
Weiter! Beeil dich!
Da! Noch ein Fingerbreit in Richtung der Kante!
Trotz der sich rasch nähernden Schritte lächle ich triumphierend, ich kann nicht anders. Ich bin ja so froh, dass ich mich doch bewegen kann! Dass ich nicht ganz hilflos bin! Nicht ganz hoffnungslos!
Die Schritte hallen im Gewölbe der Krypta bedrohlich nahe wider – sie kommen!
Die Vorstellung, dass sie die Grabplatte einsetzen – o mein Gott!
Ich muss weg von hier, sofort!
Ich achte nicht auf die Schmerzen in meiner Schulter und in meinem Arm oder auf das Zucken meiner überreizten Nerven. Weiter. Nur weiter.
Da ist die Kante! Meine Finger gleiten darüber hinweg. Ganz deutlich kann ich spüren, wie der Stein senkrecht nach unten abfällt.
»Ich habe es geschafft!«, seufze ich erleichtert. »Ich habe es wirklich geschafft!«
Die Schritte hören auf. Erst bleibt einer der Männer stehen, dann die anderen.
»Was ist?«, fragt Gil angespannt.
»Was war das?« Lionels Stimme klingt beunruhigt.
»Was meinst du?«
»Das Stöhnen.«
»Ich habe nichts gehört«, wendet Adrian ein.
»Sie hat gestöhnt«, beharrt Lionel.
Er hat mich gehört? O nein!
»Dio mio!« Adrians Kettenhemd klirrt leise. Er scheint sich zu bekreuzigen. »Und jetzt?«
»Holt mich aus der Grabnische, sofort!«, schreie ich, aber keiner hört auf mich.
»Helft mir!«, bittet Gil die anderen. »Die Marmorplatte ist sehr schwer. Aber wenn wir sie gemeinsam hochwuchten, können wir sie in die Öffnung schieben.«
Wie sehr musst du mich hassen, um mir das anzutun!
»Ihre Augen sind geschlossen!« Lionel ächzt. »Vorhin waren sie offen!«
»Gib mir die Fackel!« Schritte kommen hastig näher. Ganz deutlich kann ich das Blaken der Fackel hören. »Ihre Augen sind tatsächlich geschlossen.« Adrian atmet tief durch. »Sie sieht aus, als ob sie schläft. Und sie lächelt.«
Schweigen. Dann poltern schwere Schritte auf mich zu. »Ihre Hand, sie hat ihre Hand bewegt!«, stöhnt Lionel. »Die Finger ragen über die Kante!«
»Schieb sie zurück, damit wir die Grabkammer versiegeln können!«, befiehlt Gil barsch.
Du kaltblütiger Mörder! Was habe ich dir getan, dass du mich so sehr hasst?
Ich spüre eine Berührung an meiner linken Hand, zuerst sanft, dann immer heftiger. Lionel zieht erschrocken die Luft ein, als ich mit aller Kraft dagegenhalte. Es gelingt ihm nicht, meinen erstarrten Arm in die Nische zurückzuschieben.
Gil stößt einen arabischen Fluch aus. Wütend fleht er mit den Worten der elften Sure Allah an, mich vom Höllenfeuer der Djahannam, der muslimischen Hölle, vernichten zu lassen.
Woher weiß ich, dass es die elfte Sure ist? Und woher kenne ich den lateinischen Text des Totengebets? Bin ich Christin oder Muslima? Ich weiß es nicht. In Gedanken sage ich den Text des Credo auf: ›Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.‹ Das christliche Bekenntnis zu dem einen Gott geht mir genauso leicht über die Lippen wie die muslimische Schahada: ›Ashadu an la ilaha illa-llah, wa Muhammadan rasulu-llah. Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist der Gesandte Gottes‹. Und das hebräische Schma Israel? ›Schma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre, Israel, Adonai ist unser Gott, Adonai unser Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.‹ Wieso weiß ich das alles?
Und warum spreche ich so viele Sprachen? Italienisch, Französisch, Kastilisch, Arabisch, Lateinisch, Hebräisch und Griechisch? Ich verstehe sogar ein paar Worte Englisch und ein bisschen Portugiesisch. Und ich kann Aramäisch lesen, die Sprache Jesu, das weiß ich genau! Und Türkisch? Ich weiß es nicht, mir fällt kein einziges türkisches Wort ein. Um Gottes willen, wer bin ich denn?
»Seht euch ihre Muskeln an!«, staunt Adrian. »Sie hat eine unglaubliche Kraft!«
Gils Fluch würde Allah erblassen lassen. »Sie hat mit ihren Bravi gegen die Türken gekämpft. Ich habe gesehen, wie sie mit einem einzigen kraftvollen Hieb einem Janitscharen den Kopf abgeschlagen hat. Er fiel direkt vor ihre Füße.«
»Dio mio! Und dann?«
»Im Blutrausch riss sie ihm die weiße Haube herunter, packte ihn an den Haaren und stopfte ihn in die Kanone. Dann gab sie den Befehl, Feuer an die Lunte zu legen. Der Kopf des Janitscharen zerfetzte die Purpurseide von Mehmeds Zelt einige hundert Schritte vor den Toren der Stadt und blieb den Gerüchten nach direkt vor seinem Thron liegen. Mehmed soll bleich geworden sein wie eine Hostie.«
Adrian stöhnt auf.
»An diesem Tag, einundzwanzig Tage vor der Eroberung der Stadt, gab er den Befehl, sie gefangen zu nehmen und zu ihm zu bringen. Er wollte zusehen, wenn sie hingerichtet wird. Er wusste, wer sie ist.«
Du warst also auch dort, Gil? Das ist ja interessant. Fast so spannend wie die Frage, wer eigentlich Mehmed ist.
»Dio mio!« Der Stoff von Adrians Habit raschelt. Er bekreuzigt sich.
»Ich hatte euch vor ihr gewarnt«, sagt Gil ernst. »Sie ist gefährlich. Und sie kennt keine Skrupel.«
Erschöpft liege ich in meinem Grab und versuche, meinen rasenden Herzschlag zu beruhigen.
»Los jetzt, die Grabplatte!«, befiehlt Gil.
Ächzend heben die drei Fratres die schwere Steinplatte an, die offenbar vor der Grabnische lehnte, und wuchten sie vor die Öffnung. Ich schreie auf vor Schmerz, als meine Finger eingequetscht werden.
Rasch ziehe ich die Hand zurück, als die Marmorplatte mit einem lauten Rumpeln eingesetzt wird – meine Finger brechen nicht!
Aber das Grab ist jetzt geschlossen.
Mit aller Kraft stemme ich die linke Hand von innen gegen die Platte. Sie bewegt sich nicht.
Langsam balle ich meine Hand zur Faust und schlage dagegen.
Zu schwach, zu leise.
Noch einmal, stärker!
Ich halte den Atem an und lausche in die Stille meines Grabes.
Kein Geschrei. Sie haben mich nicht gehört.
Noch einmal!
Nichts.
Noch einmal!
Wieder nichts.
Es hat keinen Sinn.
Mein Herz krampft sich schmerzhaft zusammen. Und ich ringe mit den Tränen.
Das ist also das Ende.
Was für ein erschreckendes Gefühl, wenn dein Leben erst vor einer Stunde begonnen hat. Wenn du dich an nichts erinnern kannst, was vor deinem Erwachen war.
Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Gefühl, dass mein Leben in einer Stunde schon wieder zu Ende sein wird – sobald die Luft in meiner engen Grabkammer aufgebraucht ist. Mein Atem weht mir ins Gesicht.
Tränen brennen hinter meinen Lidern. Ein Schluchzen entringt sich meiner Kehle, ein verzweifelter Aufschrei angesichts des nahen Todes. Als schließlich die Anspannung von mir abfällt, weine ich mit zuckenden Schultern.
Ich schaffe es, meine Augen zu öffnen.
Kein Licht. Nur Finsternis um mich herum.
Lebendig begraben!
Ich will schreien, meine ganze Hoffnungslosigkeit und meine Schmerzen hinausschreien!
»Ich lebe! Ich bin wach! Holt mich hier raus!«
Doch kommt überhaupt ein Laut über meine Lippen? Niemand kann mein Weinen hören …
Plötzlich erbebt die schwere Marmorplatte unter einem wuchtigen Hieb.
Ich erstarre.
Mit einem Krachen folgt der nächste Schlag. Dann ertönt ein unerträglich lautes Knirschen. Es schwingt durch meinen ganzen Körper, das Sirren in meinen Ohren wird immer lauter.
Ich ziehe mich in mich selbst zurück und versinke wieder im finsteren Abgrund des Vergessens, der so schön war und friedlich und still war. Ohne das Dröhnen von Kirchenglocken, die Sturm läuten, ohne den explosionsartigen Donner von Kanonen, ohne das Getöse einstürzender Mauern und ohne knirschende Marmorplatten, die mein Grab versiegeln.
Kapitel 4
In der Zelle des Abtes21. Dezember 1453Kurz nach elf Uhr morgens
»… zwischen Leben und Tod.«
Wer sagt das? Ich öffne die Augen. Wer schwebt zwischen Leben und Tod? Ich? O nein, ich lebe! Ich habe Schmerzen, also lebe ich!
»Sie hat die Augen geöffnet!«
Verwirrt starre ich zum Himmel. Schwarze Rauchwolken flackern im Schein lodernder Feuer. Der Gestank von heißem Pech dringt mir in die Nase.
Wann bin ich verwundet worden? Und wie?
»Haltet durch, Euer Gnaden!«, schreit mich jemand an, den ich nicht sehen kann, weil er hinter mir steht. Arme packen mich grob an Schultern und Knien und heben mich auf eine Trage an der Mauerbrüstung. Dann liege ich in meinem Blut, das unter meinem blutglänzenden Harnisch hervorrinnt. Zwei meiner Bravi tragen mich im Laufschritt zur Treppe. »Ihr seid schwer verletzt, Euer Gnaden. Ein Steinsplitter ist Euch in die Schulter gedrungen. Wir liegen immer noch unter schwerem Feuer. Es wird immer schlimmer. Federico Tannhäuser und ich – wir bringen Euch von hier weg«, keucht der Bravo. Als ich den Kopf zurücklege, sehe ich, dass der Schweiß ihm über das Gesicht rinnt.
Wo bin ich?
Ich sehe mich um. Eine Festungsmauer. Glockenläuten und Kanonendonner, Geschrei, Leichen, Feuer, Rauch, Blut. Eine Schlacht. Wie lange dauert sie schon? Welchen Tag haben wir?
Gedanken wirbeln durch meinen Kopf. ›Und ich sah, als das Lamm das vierte von den sieben Siegeln öffnete, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war: Der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach.‹
Der Tod sieht aus wie Mehmed. Wie lange noch, Gott, wie lange noch?
Um mich herum hasten Männer in Helm und Harnisch, mit eingezogenen Köpfen und Schultern, tief am Boden, in Deckung vor den Kanonenkugeln und den Brandpfeilen. Es sind meine Bravi. Sie fliehen nicht zu den Schiffen im Hafen, wie es so viele andere tun. Sie bleiben bei mir, trotz des schweren Feuers, mit dem uns die Türken auf diesem Mauerabschnitt unweit des Kaiserpalastes eindecken, trotz der aussichtslosen Lage, trotz des sicheren Todes.
Das verschwitzte, blut- und rußverschmierte Gesicht eines Mannes mit schulterlangem kastanienbraunen Haar taucht neben mir auf. Mit erhobener Hand hält er die Bravi an, dann beugt er sich über mich, streicht mir eine schweißnasse Strähne aus der Stirn und gibt mir einen zarten Kuss auf die Lippen. »Halte durch, mein Schatz!«
Ich knirsche mit den Zähnen und nicke nur.
Mit Donnergetöse explodiert etwas in unserer Nähe. Steinsplitter, Holz und Sand prasseln auf uns nieder.
Ungestüm wirft er sich auf mich und reißt mich mit der Trage zu Boden, während wieder eine Kanonenkugel in die Mauer kracht. Der Boden bebt. Ein Schwall heißer Luft fegt über uns hinweg.
Keuchend rappelt er sich auf. »Du musst weg von hier!« Wieder küsst er mich.
»Aber ich …«
»Du tust, was ich dir …!« Ein Kanonendonner übertönt ihn. »Ich bin dein Ehemann!«
»Bist du nicht! Noch nicht.«
»Aber heute Abend.« Er atmet tief durch. »Wie lange habe ich gehofft, dass du mich eines Tages heiratest. Unsere Hochzeitsfeier wird unvergesslich bleiben, glaub mir! Wer hat schon einen Kaiser als Trauzeugen? Und dann dieses Feuerwerk?« Hasserfüllt deutet er über die Mauer hinweg zum Purpurzelt vor den Toren der Stadt. »Konstantin ist heute Abend unser Gast. Was meinst du, sollten wir Mehmed der Form halber auch einladen?«
»Er kommt bestimmt.« Ich lächele matt.
Er grinst. »Das glaube ich auch. Er will dich kennenlernen. Er will wissen, wer ihm die Köpfe seiner Janitscharen vor die Füße schießt.« Dann wird er wieder ernst. »Du lässt dich jetzt in den Blachernen-Palast bringen und deine Wunden versorgen. Dann holst du die Reliquie und versteckst sie in unseren Räumen im Palast. Hast du den Schlüssel für den Schrein?«
Ich ziehe ihn unter dem Harnisch hervor und halte ihn hoch.
»Du kommst nicht zurück, hast du mich verstanden?«
»Und du?«
»Ich bleibe hier.«
Ein Bote stürmt heran. »Euer Gnaden?«
Der Condottiere des Papstes wendet sich zu ihm um, während ich mich mühsam auf der Trage aufrichte. »Ja?«, sagen wir beide gleichzeitig.
Der Junge blickt erst ihn verwirrt an, dann mich. »Der Kaiser ist verschollen, Euer Gnaden. Der Megadux sucht nach ihm. Der Kardinal ist auf der Seeseite, nahe der Akropolis. Und Giovanni Giustiniani ist verwundet. Eine Kanonenkugel hat ihm fast die Schulter weggerissen. Er blutet stark. Er hat die Mauer verlassen, damit er versorgt wird. Bei den Genuesen geht das Gerücht um, dass ihr Kommandeur überstürzt zu einer italienischen Galeere im Hafen geflohen ist, weil die Türken durchgebrochen sind«, stöhnt er. Dann besinnt er sich. »Nachdem der Kaiser verschwunden ist, habt Ihr …« Er wirft mir einen unsicheren Blick zu. »… ähm … Ihr beide das Kommando über die Verteidigung der Stadt. Gott steh uns allen bei!« Tränen rinnen ihm über das Gesicht. »Wie lange können wir noch standhalten?«
Ja, wie lange können wir noch leben im Schatten des Todes? Wie lange noch können wir Angst, Raserei, Erschöpfung und Schmerz ertragen? Diese unerträgliche Hoffnungslosigkeit, die wir alle hinter einem verbissenen Lächeln verbergen?
Was ist das?
Trotz des Lärms kann ich plötzlich leise Musik hören. Ich lausche angestrengt. Tatsächlich, eine schöne, tröstende Melodie dringt zu mir.
Ich schließe die Augen und versuche mich zu entspannen.
Schlafe ich? Träume ich? Hat der Medicus mir schon das Opium gegen die Schmerzen gegeben? Bin ich noch auf der umkämpften Stadtmauer, oder liege ich schon in meinem Bett im Kaiserpalast? Woher kommt diese wundervolle Musik? Von sehr weit her … von jenseits der Finsternis.
Langsam schwebe ich durch die Leere und folge der verlockenden Melodie. Woher kenne ich dieses arabische Lied?
Habe ich es im Garten der Alhambra gehört? Oder im Löwenhof, während eines Abendessens mit dem Sultan? Jemand, der neben mir auf einem Diwan hockt, singt. Ich versuche, sein Gesicht zu erkennen, aber es liegt im Schatten der Säulen.
Diese Stimme – ich kenne sie!
Ich blinzele in das düstere Licht. Verwirrt halte ich den Atem an und schließe wieder die Augen.
Der Gesang verstummt. Mein Bett schwankt.
»Auferstanden von den Toten. Hast du geträumt? Du warst in den letzten Stunden so unruhig. Ich habe so sehr gehofft, dass du die Musik hören kannst, damit du ruhiger wirst.«
Erschrocken zucke ich zusammen. Es ist Gils Stimme. Er redet Kastilisch. Er spricht langsam und ruhig, doch er wirkt angespannt, denn seine Stimme klingt gepresst.
Ein Gedanke durchzuckt mich schmerzhaft: Was ist geschehen? Wo sind die anderen – Adrian und Lionel?
Panisch bewege ich meine rechte Hand und kann grobes Leinen unter meinen Fingern spüren. Darunter pikst das Stroh der Matratze. Ich versuche den Arm zu heben, aber etwas hindert mich. Eine Bettdecke? Ich strecke die Beine aus. Auch dort habe ich das Gefühl von kühlem Leinen auf meiner Haut. Neben meinem Bett knackt und prasselt ein Feuer in einem Marmorkamin. Über mir erkenne ich ein weiß verputztes Tonnengewölbe, die groben Steinwände sind leicht nach innen geneigt. Die Stimmung in diesem Raum ist erdrückend, als ob das Gewölbe gleich auf mich herabstürzen und mich unter den Trümmern begraben würde.
»Wo bin ich?«, krächze ich. Ist das wirklich meine Stimme? Sie klingt so fremd in meinen Ohren. Wegen des Kastilischen? Wegen des weichen Akzents, mit dem ich spreche – ist er arabisch oder italienisch? Oder wegen des panischen Zitterns?
»Im Bett.« Gil streicht mir eine Strähne aus der Stirn und beobachtet mich aufmerksam. »Wie geht’s dir?«
»Ich lebe noch«, presse ich hervor, irgendwie erleichtert, dass er mich endlich hören kann.
»¡Gracias a Dios!«, seufzt er, bekreuzigt sich und küsst seine Fingerspitzen. Dann nimmt er einen Zinnbecher vom Nachttisch und hält ihn mir an die Lippen, damit ich trinken kann. »Du warst drei Tage lang wie tot. Und trotzdem scheinst du Träume oder Visionen gehabt zu haben, Erinnerungen, die dich zutiefst aufgewühlt haben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.« Er atmet tief durch. »Heute bist du zum ersten Mal aufgewacht.«
Ein kalter Lichtstrahl dringt durch einen Spalt des hölzernen Fensterladens und fällt auf sein Gesicht. Wieso wendet er es ab?
Ich trinke. Das Wasser ist kühl und frisch wie geschmolzener Schnee.
»Danke«, murmele ich.
»Schon gut.« Was geht in ihm vor?
Er ist mir viel zu nah!, denke ich plötzlich. Wie soll ich mich gegen ihn wehren? Ich bewege meine Hand unter der Decke. Aber da ist nicht wie sonst ein Dolch …
Woher ich das weiß? Vielleicht, weil ich mich ohne Waffe nackt und hilflos fühle.
Aber wenn ich das weiß, denke ich, und mein Herz beginnt zu pochen, dann muss ich auch noch andere Dinge von mir wissen. Ich muss mich nur daran erinnern.
»Bleib still liegen, du musst dich ausruhen«, ermahnt er mich. Wieso spricht er so leise, dass ich seine Stimme kaum hören kann? »Du bist schwer verletzt.«
Ich zögere einen Augenblick, dem Todfeind meine Schwäche einzugestehen, aber dann frage ich doch: »Was ist geschehen?«
Langsam dreht er sich zu mir um und wendet mir sein Gesicht zu. Kurz geschnittene Haare, gestutzter Bart, blaue Augen, sinnlich geschwungene Lippen. So wie ich ihn mir vorgestellt habe – nur dass der Mann, an den ich mich erinnere, einen anderen Namen hatte.
Gil trägt eine schwarze Jacke und enge Hosen in hohen Reitstiefeln, die seine schlanken Beine gut zur Geltung bringen. Seine Kleidung ist schlicht, aber sehr elegant. Und sie sieht neu aus, als habe er sie erst gestern gekauft. Kein Haar, kein Fussel, kein Staub hängt im schimmernden Samt. Das einzige Schmuckstück ist eine lange Kette mit einem gläsernen Anhänger, in dem ein winziger Holzsplitter steckt. In das Glas eingraviert ist das Gotteslamm. Der Holzsplitter scheint ein Stück vom Heiligen Kreuz zu sein.
»Erinnerst du dich nicht?«, fragt er leise.
Ich schüttele den Kopf.
Eine steile Falte bildet sich zwischen seinen Augenbrauen. Trotz seiner Anspannung wirkt er erleichtert. »Schlaf noch ein bisschen. Du bist erschöpft. Und du zitterst.«
»Sag mir erst, was geschehen ist.«
Er sieht mich lange an. »Das weiß ich nicht«, gesteht er, und ich glaube, er sagt die Wahrheit. »Im blutigen Schnee habe ich dich gefunden. Du warst verletzt, und ich dachte, du wärst tot, so wie Gal …« Er besinnt sich und schüttelt den Kopf. »Ich habe gehofft, du könntest mir sagen, was geschehen ist.«
»Nein.«
»Du hast einen schweren Schock erlitten, verursacht durch deinen Sturz und die Verletzungen an deinem Kopf. Oder durch etwas anderes …«
»Du denkst, ich verdränge etwas.«
»Etwas Schreckliches. Etwas, das du getan hast.«
»Aber was?«
Wie ein Blitz taucht plötzlich ein Bild vor mir auf: Ich sehe mich selbst im Schnee liegen, der von meinem Blut getränkt ist. Ich habe das Gefühl, über meinem Körper zu schweben. Schnee rieselt auf mich herab und legt sich wie ein weißes Leichentuch auf meine geschlossenen Lider und meine zu einem stummen Schrei geöffneten Lippen. Meine langen dunklen Haare bilden einen Fächer wie aus Pfauenfedern um meinen Kopf, aus dem das Blut in den frisch gefallenen Schnee sickert.
Blut und Schnee.
Und ein Schlüssel, den ich in meiner Hand halte.
»Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst?«, fragt Gil.
Soll ich mich ihm anvertrauen? Ich kenne ihn doch nicht. Und ich misstraue ihm. Er hat versucht, mich zu töten – lebendig zu begraben. Aber er hat mich auch ins Bett gebracht und meine Wunden versorgt. Das behauptet er!, ermahnt mich eine leise Stimme, das behauptet er! Woher weißt du, dass er dir die Verletzungen nicht beigebracht hat, als er dir den Schlüssel entreißen wollte? Woher weißt du, dass er dich nicht gestoßen hat, sodass du gestürzt bist? Ich weiß nicht, ob das, was er sagt, auch nur einen Funken Wahrheit enthält. Ich darf ihm nicht trauen, wenn ich überleben will. Ich darf nicht!
»Es war ein grauenhafter Schmerz. Und das Gefühl, zu sterben.«
Er hält den Atem an. »Und davor?«
»Nichts.«
Er atmet tief durch. »Dann weißt du nicht, wo wir sind? Und wieso?«
Ich schüttele den Kopf. »Könntest du bitte die Fensterläden öffnen? Es ist so dunkel.«
Und ich fürchte mich im Dunkeln, füge ich im Stillen hinzu. Ich habe Angst vor Bedrohungen, die ich nicht sehen kann.
Gil erhebt sich, geht zum Fenster am Fußende meines Bettes und klappt die Innenläden zurück. Graublaues Licht fällt ins Zimmer. Durch das bleigefasste Mosaik der Scheiben, auf denen Eisblumen blühen, kann ich schemenhaft einen dunkelgrauen Himmel erkennen. Es schneit in dicken Flocken.
Fröstelnd schmiege ich mich ins warme Bett.
Gil setzt sich wieder zu mir. Wie selbstverständlich legt er seine Hand auf mein Bein. »Sagt dir das Wort Mandylion etwas?«
Verwirrt schüttele ich den Kopf.
Er zieht einen zerknüllten Zettel aus seiner Jacke, faltet ihn auseinander und zeigt ihn mir. Er ist so oft zusammen- und wieder auseinandergefaltet worden, dass er an den Kanten schon brüchig wird und Risse aufweist. Eine Seite ist mit Blut getränkt, das sich beim Trocknen schwarz verfärbt hat. In griechischen Lettern steht dort:
Μανδηλιον
»Mandylion«, lese ich. »Was ist das?«
»Weißt du, was ein Acheiropoieton ist?« Gil dreht den Zettel um. Dort steht:
Αχειροποιητον
»Das ist Griechisch. Ein Acheiropoieton ist ein nicht von Menschenhand gemachtes Bild.«
Er nickt.
»Wer hat das geschrieben?«
»Du.«
Gil faltet den Zettel zusammen und will ihn wieder einstecken, doch ich lege ihm die Hand auf den Arm.
»Kann ich ihn haben?«
Gil zögert einen Augenblick, dann gibt er ihn mir. Während ich die Pergamentseite betrachte, die offenbar aus einem Notizbüchlein herausgerissen wurde, fragt er:
»Sagt dir der Name Fra Galcerán de Borja y Llançol de Romanì etwas?«
»Nein«, lüge ich.
Während eines Schneesturms vor vier Tagen haben Fra Galcerán und ich uns in den tief verschneiten Abruzzen hoffnungslos verirrt – das hat Gil vorhin seinen Freunden erzählt. Woher kamen wir? Wohin wollten wir? Warum ritten wir zusammen durch die verschneite Einsamkeit? Und warum wurde Fra Galcerán ermordet? Das muss kurz vor meinem Sturz gewesen sein. Hat es einen Kampf gegeben, bei dem ich verletzt wurde? Ging es um den Schlüssel, den ich während meiner Ohnmacht in der Hand hielt, als hinge mein Leben davon ab?
»Wer ist das?«, will ich wissen.