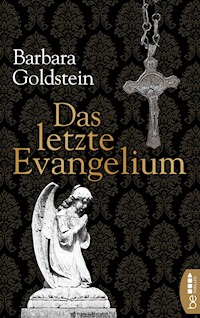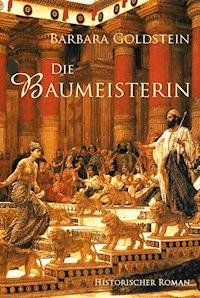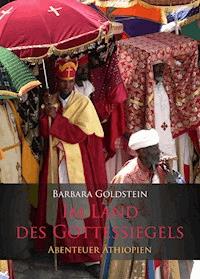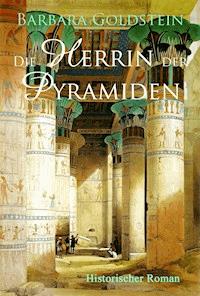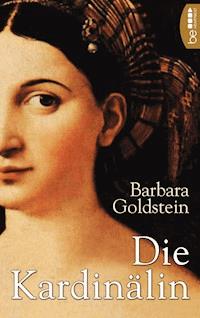
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Alchemie und Apokalypse: Ein historischer Roman aus dem Italien der Renaissance
Florenz 1491. Caterina, illegitime Tochter von Lorenzo il Magnifico, wird in die geheime Kunst der Alchemie eingeweiht. Als der fanatische Mönch Savonarola die Apokalypse über Florenz prophezeit, flieht Caterina nach Rom. Sie stürzt sich in eine leidenschaftliche Affäre mit Cesare Borgia, dem Sohn des Papstes. Ihr roter Alchemistentalar und ihre enge Beziehung zu den Borgia machen sie in Rom als "Kardinälin" bekannt. Doch schließlich muss sie vor den Intrigen der Borgia erneut fliehen. In Mailand sucht sie verzweifelt nach dem al-Iksir, dem Lebenselixier der Alchemisten, um ihr eigenes Leben zu retten. Wird es ihr gelingen, das geheimnisvolle Elixier zu erschaffen und die Liebe ihres Lebens zurückzugewinnen?
Weitere historische Romane von Barbara Goldstein bei beHEARTBEAT:
Die Evangelistin * Der Fürst der Maler.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1190
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumZitatKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Die handelnden PersonenÜber dieses Buch
Zwischen Alchemie und Apokalypse: Ein historischer Roman aus dem Italien der Renaissance
Florenz 1491. Caterina, illegitime Tochter von Lorenzo il Magnifico, wird in die geheime Kunst der Alchemie eingeweiht. Als der fanatische Mönch Savonarola die Apokalypse über Florenz prophezeit, flieht Caterina nach Rom. Sie stürzt sich in eine leidenschaftliche Affäre mit Cesare Borgia, dem Sohn des Papstes. Ihr roter Alchemistentalar und ihre enge Beziehung zu den Borgia machen sie in Rom als »Kardinälin« bekannt. Doch schließlich muss sie vor den Intrigen der Borgia erneut fliehen. In Mailand sucht sie verzweifelt nach dem al-Iksir, dem Lebenselixier der Alchemisten, um ihr eigenes Leben zu retten. Wird es ihr gelingen, das geheimnisvolle Elixir zu erschaffen und die Liebe ihres Lebens zurückzugewinnen?
Über die Autorin
Barbara Goldstein, geb. 1966, arbeitete zunächst in der Verwaltung von Banken und nahm dann ein Studium der Philosophie und der Sozialen Verhaltenswissenschaften auf. Später machte sie sich als Autorin historischer Romane selbstständig und nahm ihre Leser mit in die Welt von Alessandra d‘Ascoli, einer florentinischen Buchhändlerin. Barbara Goldstein verstarb im März 2014 nach langer Krankheit.
Barbara Goldstein
Die Kardinälin
beHEARTBEAT
Vollständige E-Book-Ausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2013/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Einbandgestaltung: Manuela Städele
Titelbild: © akg-images/André Held
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5291-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Und Gott sprach zum Menschen:
»Ich habe dich geschaffen,
damit du dich frei, aus eigener Macht,
selbst modellierend und bearbeitend,
zu der von dir gewollten Form ausbilden kannst.
Du kannst in die Unterwelt der Tiere entarten.
Und du kannst, wenn du es willst,
dich in die Welt des Göttlichen erheben.«
Giovanni Pico della Mirandola
Über die Würde des Menschen
Kapitel 1
Ich bin der ich bin
Was werde ich sagen, wenn ich ihm gegenüberstehe?, fragte ich mich wohl zum hundertsten Mal an diesem Morgen. Und: Wird man mich überhaupt mit ihm sprechen lassen? Oder werde ich schon am Tor von einem Schreiber abgewiesen, wenn ich um eine Audienz bitte? Ich konnte ihm doch nicht einmal meinen Namen nennen – ich meine: meinen wirklichen Namen. Er würde mich auslachen oder mit Gewalt aus dem Palazzo entfernen. Eine zweite Chance würde ich dann nicht mehr bekommen …
Ungeduldig und – ich gestehe – zitternd vor Anspannung wartete ich auf der Steinbank neben dem großen Portal des Palazzo Medici, dass der Portier die Torflügel öffnete und die Besucher in den Innenhof einließ. Immer wieder zupfte ich an den Ärmeln meines Samtkleides herum, korrigierte ich den Faltenwurf des weiten Rocks, als wollte ich hier noch stundenlang sitzen und mich anstarren lassen. An diesem Septembermorgen des Jahres 1491 hatte ich mein bestes Kleid angezogen – aber was war diese Maskerade mehr als ein lächerlicher Versuch, meinen Worten bei Lorenzo de’ Medici mehr Nachdruck zu verleihen! Was ich ihm zu sagen hatte, würde ausreichen, ihn zu beeindrucken.
Die neugierigen Blicke der anderen Besucher – Geschäftspartner und Freunde des Magnifico – ignorierte ich. Sie warteten wie ich seit Sonnenaufgang, saßen in Gruppen auf der Steinbank, unterhielten sich angeregt über Savonarolas letzte Predigt, verglichen die Zinssätze der Kredite der Banca Medici und ihre Gewinne aus dem Seidenhandel, spazierten die Via Larga auf und ab, bis das Tor geöffnet wurde – wie jeden Morgen. Aber an diesem Morgen war etwas anders: Ich, Caterina, saß neben ihnen und wartete.
Immer wieder streiften mich ihre neugierigen Blicke. Wer ist die junge Frau?, fragten sie sich. Was will sie im Palazzo Medici? Sie ist fünfzehn oder sechzehn Jahre alt. Warum lässt sie sich in ihren Anliegen nicht vom Vater, Bruder oder Cousin vertreten? Oder, wenn es nicht um persönliche, sondern um geschäftliche Angelegenheiten geht, von einem bekannten Notar wie Piero da Vinci?
Ich sprach mit keinem der Wartenden. Weder über mein Anliegen bei Lorenzo de’ Medici, meine Ängste und meine Hoffnungen, noch über Bankkredite, Seidenlieferungen oder über den Seehandel, obwohl ich mich darin fast so gut auskannte wie Amerigo. Seit Monaten hatten wir bei den Mahlzeiten selten ein anderes Thema als Amerigos Arbeit im Medici-Kontor.
Ich sprach mit keinem von ihnen, weil ich auf keine ihrer Fragen eine Antwort wusste. Warum war ich hier? Was versprach ich mir von einer Audienz bei Lorenzo – falls er überhaupt geruhte, mich zu empfangen? Nach allem, was in den Jahren seit der Pazzi-Verschwörung und der Ermordung seines Bruders Giuliano zwischen unseren Familien vorgefallen war: Hass, Verfolgung, Verbannung. Und falls er mir zuhörte – würde er mir glauben?
Wie oft hatte ich in den vergangenen Monaten vor dem Portal des Palazzo Medici gestanden – seit ich ahnte, wer ich wirklich war. Wie oft hatte ich vor diesem Schritt gezögert. Wie oft war ich abends in das Haus nahe der Kirche Santa Trinità zurückgekehrt, wo ich mit Amerigo wohnte – dem Cousin meines Stiefvaters und Freund des Mannes, den ich für meinen Vater hielt.
In diesem Augenblick wurde das schwere Tor des Palazzo Medici aufgeschoben und der Portier trat hervor, um die Wartenden in den Hof des Palastes zu bitten. Ich sprang auf und eilte zum Portal hinüber. Die Besucher drängelten am Eingang, als wollten sie die besten Plätze beim Palio auf der Piazza Santa Croce ergattern.
Dann stand ich zwischen den kleinen Lorbeerbäumen unter den Arkaden des Innenhofs und schaute zu den Fenstern im ersten Stock hinauf. Unzählige Kerzen funkelten durch die Glasscheiben. Welch eine Pracht! Selbst der Palazzo della Signoria wirkte bescheiden neben dem Palast des Magnifico.
Dem Portal gegenüber bewachte ein marmorner Herakles das Tor zum Garten. Unter den Arkaden des Hofes fand ich den Eingang zu einer Schreibstube, in der ein paar bewaffnete Leibwächter des Magnifico Karten spielten. Ein Schreiber sprach mit den Besuchern, die um einen Termin bei Francesco Sassetti baten, dem Generaldirektor der Banca Medici und Leiter des Handelskontors, die mit Piero da Vinci wegen eines Rechtsstreits verhandeln oder Rechnungen für Fleisch, Fisch, Brot, Obst, Gemüse, Schuhe, Handschuhe oder Schmuckstücke beglichen haben wollten.
»Ihr wünscht?«, fragte der Schreiber, als ich endlich vor seinen Tisch trat.
»Eine Audienz bei Seiner Exzellenz«, sagte ich selbstbewusst.
Er steckte die Feder ins Tintenfass und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Was wollt Ihr von ihm?«, fragte er, während er sich die von der Tinte geschwärzten Finger an einem Tuch abwischte.
Das war die befürchtete, alles entscheidende Frage: Wer bist du, und was willst du? Die Frage, die über mein Leben und meine Zukunft entschied. Die Frage, die mich in den Abgrund stürzen konnte oder die Treppe hinauf zu Lorenzo de’ Medici brachte. »Nichts«, sagte ich zu seiner Verblüffung. »Ich will nichts von ihm – außer einer Antwort.«
»Und Ihr glaubt, dass er die Frage hören will, auf die er antworten soll?«, zweifelte der Schreiber. Er gab den Versuch auf, die Tinte von seinen Fingern zu wischen, und warf das Tuch auf seinen Schreibtisch.
»Ja«, lächelte ich verschmitzt. »Er weiß es nur noch nicht.«
Der Schreiber lachte über meine Schlagfertigkeit. »Nun, dann sollten wir Seine Magnifizenz wissen lassen, dass Ihr ihn zu sprechen wünscht.« Er griff zur Feder und zog ein unbeschriebenes Pergament zu sich heran. »Wie ist Euer Name?«
»Caterina.«
»Caterina – und weiter?« Die Hand mit der Feder schwebte abwartend über dem Pergament, und als ich nicht sofort antwortete, sah er ungeduldig auf. Ein Tropfen schwarzer Tinte fiel von der Federspitze auf das Pergament hinter meinen Namen. Ein ungewollter Tintenklecks: Das war mein Name! Unbeabsichtigt und unerfreulich – wie meine Geburt. »Wie ist Euer Name?«
»Das ist die Antwort auf meine Frage an Lorenzo de’ Medici«, erklärte ich mit rätselhaftem Lächeln.
Der Schreiber starrte mich verblüfft an und zog die Stirn in Falten. Die Frage, ob er mich vorlassen sollte, stand ihm ins Gesicht geschrieben. Doch dann winkte er seinen Adlatus heran, der dem Sekretär des Magnifico das Pergament mit meinem Namen überbringen sollte. Mochte der entscheiden, ob ich von Lorenzo empfangen wurde oder nicht.
»Geht die Treppe auf der rechten Seite der Hofarkaden hinauf bis zum ersten Stock, Madonna Caterina. Ihr werdet in einen Warteraum geleitet werden.« Ich nickte und wollte mich schon abwenden, als er mir »Viel Glück!« wünschte.
Dankend verließ ich mit seinem Adlatus die Schreibstube. Rechts neben dem Eingangsportal des Palazzo befand sich ein schmiedeeisernes Gitter, das von mehreren Bewaffneten bewacht wurde. Plötzlich verstand ich, warum Amerigo den Palazzo die Fortezza – die Festung – nannte: Niemand kam unbemerkt mit einem verborgenen Dolch hinein … oder lebendig wieder heraus.
Zwei Wachen traten mir entgegen, als ich mich dem Treppenaufgang näherte: »Waffen?«
»Nur mein Lächeln«, antwortete ich schlagfertig. »Und das wird den Magnifico nicht umbringen.«
Ich zog meinen Dolch aus dem Ärmel und reichte ihn den Leibwächtern. Dann durfte ich die Stufen zum ersten Stock hinaufsteigen. Der Gehilfe des Schreibers geleitete mich in einen Saal, wo bereits zwei Dutzend Männer warteten.
Der Warteraum war so groß wie ein Bankettsaal. Auf einer Tafel in der Mitte des Raumes waren silberne Obstschalen mit Äpfeln und Trauben, getrockneten Feigen und süßem Mandelgebäck arrangiert worden, daneben standen Karaffen mit gewürztem Wein und Zinnbecher. An den Wänden und um den großen Tisch herum gruppierten sich Stühle mit Lederpolsterung, die gemütlicher aussahen als Amerigos Lesesessel in seinem Studierzimmer.
»Wie lange wird es dauern, bis ich von Seiner Exzellenz empfangen werde?«, fragte ich den jungen Mann, der mich die Treppe hinaufbegleitet hatte.
Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht bis nach dem Mittagessen, vielleicht bis nach Sonnenuntergang.« Er wies mit einer weit ausholenden Geste auf die Wartenden im Raum. »Diese Signori wollen vor Euch mit ihm sprechen – falls er sie empfängt.«
»Falls er sie empfängt?«, fragte ich.
»Seine Exzellenz hatte gestern einen sehr schmerzhaften Gichtanfall, sodass er das Bett nicht verlassen konnte. Heute Morgen ist er noch nicht aufgestanden. Ich weiß nicht, ob er heute überhaupt Besucher empfängt.« Der Adlatus verschwand und brachte das Pergament mit meinem Namen zu Lorenzos Sekretär.
Die endlose Wartezeit verbrachte ich lesend: Paolo Toscanellis Manuskript seines unveröffentlichten Buches Imago Mundi. Der berühmte Astronom hatte es seinem Schüler Amerigo geschenkt, der es mit unzähligen Marginalien versehen hatte: in Worte gegossene Träume von einer Seereise nach Westen, um Indien zu finden. Im Westen! Amerigos Visionen waren fast so verrückt wie meine eigenen.
Zwei Stunden vergingen, bevor der erste Bittsteller in das Arbeitszimmer Seiner Exzellenz geführt wurde. Nach einer Stunde erschien der Adlatus erneut und rief den nächsten Namen auf. Wie lange würde ich mich gedulden müssen? Würde er mich überhaupt empfangen? Ich hatte ja nicht einmal meinen Namen genannt … oder was ich mir von ihm erhoffte. Unruhig rutschte ich auf dem Sessel herum. So viel hing für mich von diesem Treffen ab!
Das dreigängige Mittagessen, das der Magnifico seinen Gästen servieren ließ, um ihnen die Wartezeit zu verkürzen, war köstlich: Agnelotti mit Lammfüllung, gebratene Flusskrebse in Weinsauce, Pasteten, Torten, Obst und Marzipankonfekt. Mit einem Zinnbecher Wein zog ich mich nach dem Mahl in meinen Sessel zurück und blätterte in einer Handschrift der Divina Commedia, die auf einem der Tische gelegen hatte.
Die Stunden verwelkten im Licht der untergehenden Sonne wie Herbstlaub. Es war später Nachmittag und der Magnifico hatte erst sechs der Bittsteller zu sich rufen lassen, als sein Sekretär den Saal betrat: »Seine Magnifizenz empfängt heute nicht mehr. Er bittet die Signori, ihn zu entschuldigen und morgen erneut um eine Audienz nachzusuchen.«
Enttäuschung: Das war es, was ich in diesem Augenblick empfand – ein schmerzhaftes Gefühl und die Erkenntnis, mich einer Illusion hingegeben zu haben. Lorenzo de’ Medici hatte die Signori nicht empfangen, obwohl er wusste, wer sie waren und was sie von ihm wollten. Warum sollte er mich zu sich bitten, da er doch nicht einmal meinen Namen kannte?
Alles vergebens: all die Hoffnungen, all die Ängste! Ich hatte die weiteste Reise angetreten, die ein Mensch machen kann, weiter als die Seereise, die Amerigo plante: den Weg in den Palazzo Medici, den Weg in ein anderes, glücklicheres Leben, eine Reise ohne Wiederkehr. Ich war nach wenigen Schritten gescheitert, musste umkehren und dorthin zurückgehen, woher ich gekommen war.
Ich erhob mich zusammen mit den Signori, die unwillig murmelnd aus dem Raum strömten.
Der Sekretär winkte mich zu sich. »Bitte folgt mir, Madonna Caterina«, murmelte er leise und ging voran.
»Wohin?«, fragte ich verwirrt.
»Zu Seiner Exzellenz: Er wird Euch empfangen.«
»Aber er hat doch alle Signori wegschicken lassen«, wandte ich überrascht ein, während ich ihm durch den Palazzo folgte.
»Seine Magnifizenz war neugierig, als ich ihm berichtete, dass eine junge Madonna, die ihren Namen nicht nennen wollte, ihn zu sprechen wünscht. ›Bringt diese geheimnisvolle Caterina zu mir‹, befahl er mir.« Der Sekretär öffnete eine Tür und ließ mich eintreten. »Bitte wartet hier, Madonna Caterina! Seine Exzellenz spricht noch mit Generaldirektor Francesco Sassetti und den Filialleitern der Banca Medici in Rom, Mailand und Lyon. Sobald die Unterredung beendet ist, wird er Euch hier in seinem Studierzimmer empfangen.«
Er schloss die Tür hinter sich und ließ mich allein. Im Allerheiligsten des Medici-Imperiums! Ich konnte ein triumphierendes Lächeln nicht unterdrücken: Lorenzo de’ Medici würde mich empfangen! In wenigen Minuten würde ich ihm gegenüberstehen. Meine Knie zitterten vor Aufregung.
Da ich sowieso nicht stillsitzen konnte, sah ich mich im Studierzimmer um. Die Kerzen waren wegen der herabsinkenden Dämmerung bereits entzündet worden und tauchten den Raum in ein geheimnisvolles Licht. In der Luft hing ein feiner Duft nach kostbaren Pergamenten, nach Tinte und eleganter Gelehrsamkeit.
Vor dem Fenster bog sich ein Schreibtisch mit wertvollen Intarsienarbeiten unter einem Berg von Pergamentrollen, illustrierten Handschriften, Briefen, Gedichten und hingekritzelten Notizen, einem Tintenfass, Federn, Siegelwachs und einem Petschaft mit dem Wappen der Medici. Davor stand ein mit rotem Leder bezogener Stuhl.
Ein Stapel Bücher lag auf dem Lesepult neben dem Kamin. Mein Blick glitt über die Buchrücken, doch meine Griechisch-Kenntnisse reichten gerade aus, um den Titel auf Platons Apologie des Sokrates zu entziffern. Einige der anderen Werke, wie Senecas Schrift über das glückliche Leben, kannte ich aus Amerigos Bibliothek. Der dickste Foliant auf dem Lesepult, halb verborgen unter einem chaotischen Haufen anderer Werke, war Giovanni Pico della Mirandolas Conclusiones. Von diesem geheimnisvollen Werk hatte ich bisher nur durch die Buchhändler gehört. Die Conclusiones waren vor vier Jahren von Papst Innozenz als häretisches Werk verboten worden. Also gab es doch noch Exemplare, die nicht verbrannt wurden! Lorenzo de’ Medici besaß eines – Giovanni Pico war einer seiner besten Freunde.
Eine lebensgroße Bronzebüste von Giuliano de’ Medici lächelte mir ermutigend zu. Seine Augen funkelten im Licht des Kaminfeuers, als wüsste er eine Antwort auf die Frage, die ich seinem Bruder stellen wollte. Mit den Fingern strich ich sanft über seine Wangen und die sinnlichen Lippen. Einen solchen Mann zu lieben, ihm nahe zu sein … Ich ließ die Hand sinken und wandte mich ab.
Gegenüber dem purpurfarbenen Sessel hing ein Gemälde an der Wand: Sandro Botticellis Geburt der Aphrodite. Wie oft hatte ich von diesem herrlichen Bild gehört und von der wundervollen Gestalt der Frau, die als nackte Göttin der Liebe in der Muschel zu sehen war.
Wie schön die junge Frau mit den im Wind fliegenden roten Haaren war! Schöner, als ich sie mir vorgestellt hatte. Wie jung! Kaum älter als ich. Verzaubert stand ich vor der Geburt der Aphrodite, als sich die Tür des Studierzimmers öffnete und Lorenzo de’ Medici den Raum betrat.
Ich fuhr herum und – brachte kein Wort heraus. Vor lauter Aufregung vergaß ich sogar, ihm durch einen Knicks meine Ehrerbietung zu erweisen. Auf die Idee, ihm die Hand zu reichen, kam ich gar nicht erst. Wie eine unvollendete Marmorstatue stand ich mitten im Raum und starrte ihn an.
Schon oft hatte ich den Magnifico gesehen: während der prächtigen Staatsempfänge auf der Piazza della Signoria, in der festlichen Prozession anlässlich des Neujahrsfestes, beim Gottesdienst im Dom und einmal maskiert während des Karnevals in den Straßen von Florenz – aber immer nur von weitem, umgeben von seinem Gefolge und seinen Leibwächtern.
Als ich ihm nun gegenüberstand, nur eine Armlänge von ihm entfernt, verstand ich plötzlich nicht mehr, warum im Laufe seiner Regentschaft aus der ehrerbietigen Anrede »Magnifico Lorenzo« Lorenzo il Magnifico – Lorenzo der Prächtige – geworden war. Wenn der Stoff seiner langen Robe auch schwerer, mit feinen Goldfäden durchwirkter Atlas war, so kleidete er sich doch in schlichtes Schwarz und trug keine der Juwelen, mit denen sich die Reichen und Mächtigen schmückten, um ihren Wohlstand zu zeigen – nicht einmal ein goldener Siegelring mit dem Wappen der Medici schmückte seine Finger. Wenn man Lorenzo de’ Medici ohne sein Gefolge auf der Straße begegnete – man würde ihn nicht als einen der reichsten und mächtigsten Männer Italiens erkennen.
Er war nicht schön, aber er verstand es, mit einem charmanten Lächeln und selbstbeherrschten Gesten die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Lorenzos Schönheit war keine körperliche – eine ernste Würde umgab ihn wie ein Glorienschein.
Wahrscheinlich war er es gewohnt, angestarrt zu werden. Jedenfalls ertrug er mit einem feinen Lächeln das kurze Schweigen, bis er wortlos auf den Stuhl gegenüber seinem Schreibtisch deutete und ich Platz nahm.
Auf einen Stock gestützt humpelte er zu dem Sessel hinter seinem Schreibtisch, auf dem er sich so vorsichtig niederließ, als würde jede Bewegung ihm unerträgliche Schmerzen bereiten. »Wir können uns noch eine Weile anschweigen, Madonna Caterina. Ich kann ein kultiviertes Schweigen ebenso genießen wie eine geistreiche Unterhaltung. Aber ich würde es vorziehen, wenn Ihr mir verratet, was Ihr von mir wollt«, gab er mit einem Lächeln zu. »Die Neugier quält mich. Bitte erlöst mich.«
»Vergebt mir, Euer Exzellenz! Ich wollte nicht unhöflich sein …«
»So unverschämt wie der Mailänder Botschafter vor wenigen Minuten könnt Ihr gar nicht sein, Madonna Caterina«, versicherte er mir. »Wir haben alles andere getan, als uns anzuschweigen.«
Der Magnifico bekleidete kein öffentliches Amt, obwohl er Florenz regierte. Die Außenpolitik oblag der Signoria, den Ratsherren von Florenz. Aber es war kein Geheimnis, dass er die Gesandten der Dogen von Venedig und Genua, der Herzöge von Mailand, Ferrara und Urbino, des Königs von Neapel und des Papstes im Palazzo Medici empfing, bevor sie um einen Termin beim Gonfaloniere, dem Bannerträger von Florenz, nachsuchten.
»Mein Sekretär sagte mir, dass Ihr seit dem frühen Morgen auf eine Audienz wartet. Auf die Frage des Schreibers habt Ihr Euren Namen genannt: Caterina. Euren Familiennamen wolltet Ihr ihm nicht nennen. ›Das ist die Antwort auf meine Frage an Lorenzo‹, habt Ihr ihm gesagt. Ich bin beeindruckt von Eurem selbstbewussten Auftreten. Stellt also Eure Frage an mich.«
»Die Frage lautet: Wer bin ich?«
Er bedachte mich mit einem erstaunt-amüsierten Blick, den er wohl der Sokrates-Büste neben dem Fenster abgeschaut hatte. »Eine interessante Frage, Madonna Caterina. Diese Frage haben sich schon Platon und Aristoteles gestellt.«
»Ich kenne die Antworten der beiden Philosophen, Euer Exzellenz. Ich fragte jedoch nicht nach dem Ich, sondern nach dem Wer?«
Lorenzo lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und betrachtete mich neugierig. »Welche Namen stehen denn zur Auswahl?«
Die Stunde der Wahrheit! Ich holte tief Luft. »Vespucci ist der eine Name und …«
»Dieser Name ist in diesem Haus lange nicht genannt worden«, unterbrach er mich unwillig. »Seid Ihr verwandt mit Piero und seinem Sohn Marco?« Das Lächeln war auf seinen Lippen erfroren.
»Piero Vespucci war mein Großvater«, erklärte ich. »Marco ist mein Stiefvater.«
»Piero Vespucci«, sagte er gedehnt, als müsste er sich nach Jahren erst wieder an den Klang des Namens gewöhnen. »Piero Vespucci war nach einer erfolglosen Verschwörung gegen Cosimo de’ Medici nach Neapel ausgewandert, wo er in den Diensten des Hauses Aragón Karriere gemacht hat. Aber getreu den Worten von Bernardo Cennini – ›Dem florentinischen Geist ist nichts unmöglich‹ – zog es ihn nach Florenz, um die Grenzen des Möglichen zu erforschen. Piero und sein Sohn Marco waren 1478 in die Verschwörung von Papst Sixtus und der Familie Pazzi gegen mich verwickelt: Sie halfen den Attentätern, die meinen Bruder Giuliano im Dom ermordet hatten, zu entkommen.«
»Ihr hattet Piero Vespucci nach zwei Jahren im Kerker Euren Großmut bewiesen und ihn begnadigt, Euer Magnifizenz«, erinnerte ich ihn. »Und Marco ist trotz lebenslänglicher Verbannung aus Venedig zurückgekehrt …«
Mit einer Geste wie ein Schwerthieb schnitt er mir das Wort ab. Offensichtlich hatte er keine Lust, mit mir über Schuld und Sühne der Familie Vespucci zu diskutieren. »Marco ist also Euer Stiefvater«, fasste er ungnädig zusammen. »Wer ist Eure Mutter, Signorina Vespucci?«
Ohne ein Wort zu sagen, deutete ich auf Sandro Botticellis Geburt der Aphrodite an der Wand gegenüber seinem Schreibtisch.
»Simonetta war …?«, fragte Lorenzo de’ Medici ungläubig.
»… meine Mutter«, ergänzte ich.
Er schüttelte den Kopf. »Das kann nicht sein! Simonetta starb im April 1476 an der Schwindsucht. Ich war in Pisa. Ich hatte ihr von dort aus meinen Arzt geschickt, als ich von ihrem Zusammenbruch erfuhr. Aber es war zu spät. Simonetta war tot, bevor der Medicus Florenz erreichte.« Sein Blick ruhte auf Botticellis Bild, als könnte er sich nach fünfzehn Jahren nicht mehr daran erinnern, wie seine geliebte Simonetta ausgesehen hatte.
Er hatte sie geliebt! Ich musste ihn nur ansehen, um seine Liebe zu spüren und den Schmerz, den er bei ihrem Tod empfand. Ich konnte ihm die Wahrheit nicht ersparen, so sehr sie ihm wehtun würde. »Ja, es ist wahr: Simonetta starb an der Schwindsucht. Aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Sie starb während meiner Geburt.«
Lorenzo de’ Medici starrte mich an. »Simonettas Tochter …«, flüsterte er fassungslos, die Hand an den Lippen. »Ich habe Simonetta geliebt. Als ich durch Piero Vespucci die Nachricht von ihrem Tod erhielt, habe ich die ganze Nacht geweint …«
»Vier Sonette habt Ihr in dieser Nacht an Simonetta geschrieben«, erinnerte ich ihn. »Ich bewahre Eure Verse wie Reliquien. Sie sind das Einzige, was mir von meiner Mutter geblieben ist: Eure Worte, Gedanken und Gefühle. Sie schenkte mir ihr Leben und hauchte ihre Seele aus, als ich zum ersten Mal meine Augen öffnete. Ich weiß fast nichts von meiner Mutter. Bis ich vorhin das Gemälde sah, wusste ich nicht einmal, wie sie aussah. Wie schön sie war!«
»Ihr seid Simonettas Tochter …«, wiederholte der Magnifico, als müsste er sich erst mit diesem unerwarteten – erschreckenden? – Gedanken vertraut machen. Sein Blick irrte von meinem Gesicht zur Geburt der Aphrodite hinter mir an der Wand. »Ihr habt dieselben Augen, dieselben Haare in der Farbe der untergehenden Sonne, dieselben sinnlichen Lippen. Ihr erinnert mich an Simonetta – und doch wieder nicht.«
»Ich bin nicht Simonetta«, sagte ich. »Ich bin ich. Und ich will von Euch wissen: Wer bin ich?«
»Vespucci ist der eine Name. Wie lautet der andere?«, fragte er leise, als fürchtete er die Antwort.
»De’ Medici, Euer Exzellenz.«
Lorenzo schwieg und betrachtete mich, als wären wir uns eben erst begegnet. »De’ Medici?«, flüsterte er.
»Euer Bruder Giuliano liebte Simonetta. Ganz Florenz verfolgte die Affäre der beiden, und selbst der betrogene Gemahl, mein Stiefvater Marco, schwieg dazu. Sein Hass auf Giuliano war der Anlass, dass er sich zwei Jahre später an der Pazzi-Verschwörung gegen Euch beteiligte. Simonettas unverhoffte Schwangerschaft wurde von Piero Vespucci nicht nur wegen ihrer Krankheit geheim gehalten, sondern auch wegen des befürchteten Skandals. Nicht einmal der Vater wurde über die Geburt in Kenntnis gesetzt.«
»Der Vater …?«, fragte Lorenzo.
Der Gedanke, dass Giuliano mit Simonetta ein Kind der Liebe gezeugt hatte, schien ihn zu verletzen. Beide, Lorenzo und Giuliano, waren in Simonetta verliebt gewesen. Wegen Giulianos Affäre mit ihr war zwischen den Brüdern ein eifersüchtiger Streit entbrannt, der – angefacht durch Gerüchte aus den Gassen von Florenz und Unwahrheiten aus dem Freundeskreis – zum erbitterten Bruderkrieg zu werden drohte. Lorenzo und Giuliano hatten sich erst an Simonettas Grab wieder die Hand gereicht.
»Ich glaube, dass Euer Bruder mein Vater war«, sagte ich.
Der Magnifico schwieg und starrte erst mich, dann Giulianos Bronzebüste an. Welche Gedanken mochten jetzt durch seinen Kopf gehen? Glaubte er mir? Und wenn er mir glaubte: Was würde er tun? Eine Anerkennung von Caterina Vespucci als illegitime Tochter von Giuliano de’ Medici und Simonetta Vespucci würde in Florenz einen Skandal verursachen. Fünfzehn Jahre alte Gerüchte über Giulianos Affäre mit Simonetta und Lorenzos Zuneigung zur Geliebten seines Bruders würden hervorgekramt und aus allen Windrichtungen diskutiert werden. Simonettas Tod. Giulianos Ermordung während der Pazzi-Verschwörung. Die Verurteilung von Piero und Marco Vespucci als Verräter. Eine Menge schmutziger Wäsche würde gewaschen werden …
Niemand in Florenz hätte über ein uneheliches Kind auch nur ein Wort verloren – aber bei der illegitimen Tochter eines Medici war das etwas anderes. Die Medici waren reich, mächtig und berühmt – berüchtigt auch dafür, dass sie nicht selten in anderen Betten als ihren eigenen schliefen. Cosimo hatte aus seiner Affäre mit einer dunkelhäutigen Sklavin einen Sohn, Piero beglückte mehrere Geliebte gleichzeitig, und auch Lorenzo hatte nicht nur Sonette vorgetragen, wenn er nachts in den Straßen von Florenz unterwegs war …
Die Medici kümmerten sich um ihre Kinder – ganz gleich, welchen Namen sie trugen. Wenn Lorenzo de’ Medici mich formell als die Tochter seines Bruders anerkannte und mich damit zu einer Medici machte, konnte das eine wahre »Sündflut« hervorrufen: Anklagen und Prozesse gegen ihn und seinen verstorbenen Bruder. Der Trick, mit dem er seinen Neffen Giulio legitimierte, indem er erklärte, Giuliano und dessen Geliebte Fioretta Gorini hätten sich 1478 heimlich trauen lassen, hatte schon damals ungläubiges Gelächter hervorgerufen. Wenn also mein Bruder Giulio legitim war, dann konnte ich es nicht sein.
Lorenzo de’ Medici schwieg noch immer. Er schien die Alternativen zu durchdenken, um zu einem Entschluss zu kommen. Wie konnte ich nur vergessen, dass auch er ein paar Zeilen unseres Dialoges zu sprechen hatte, dass auch er eine Entscheidung treffen musste! Und die war nicht leichter als meine. Was sollte ich tun, wenn er mir nicht glaubte? Was würde er tun? Mich aus dem Palazzo werfen lassen? Mich aus Florenz verbannen, weil ich den ungerechtfertigten Anspruch erhob, eine Medici zu sein?
Es war Wahnsinn gewesen, hierher zu kommen! Diese Erkenntnis traf mich wie ein Faustschlag – unerwartet und umso schmerzhafter. Ich war wie aus einem schönen Traum erwacht: noch etwas benommen, aber schon wieder klar denkend. Wie hatte ich nur für einen Augenblick annehmen können, dass Lorenzo mir glaubte! Verzweifelt hielt ich mich an den Armlehnen des Stuhls fest wie an den Planken eines sinkenden Schiffes. Mein Traum von der Freiheit versank in den Fluten des Schweigens zwischen Lorenzo und mir, und eigentlich war ich froh, dass er nichts sagte.
Er erhob sich von seinem Sessel, und einen Augenblick lang dachte ich, die Audienz sei beendet und er würde mich auffordern, aus seinem Palazzo und aus seinem Leben zu verschwinden. Doch er kam um den Schreibtisch herum und zog mich von meinem Stuhl, um mit mir zu Giulianos Bronzebüste hinüberzugehen.
Im Licht der flackernden Kerzen verglich er meine Gesichtszüge mit denen seines Bruders. Die Augen, die Nase, die Lippen. Mit der Hand strich er mir ein paar widerspenstige Haare aus der Stirn, um das Profil zu vergleichen. Schließlich ließ er die Hand sinken und zog mich an sich. Er umarmte mich und hielt mich fest, als wollte er um jeden Preis verhindern, dass ich so schnell aus seinem Leben verschwand, wie ich hineingeraten war:
Ich, Caterina de’ Medici.
»… und als mein Stiefvater Marco Vespucci nach der Pazzi-Verschwörung gegen Lorenzo und Giuliano aus Florenz verbannt worden war, wurde ich meinem Cousin Amerigo anvertraut«, setzte ich eine Stunde später meinen Bericht über meine Kindheit im Hause Vespucci fort. »Amerigo arbeitete damals schon im Kontor des Medici-Unternehmens, während seine beiden älteren Brüder die Universitäten von Florenz und Bologna besuchten und sich nicht um die Stieftochter ihres verbannten Cousins Marco kümmern konnten.« Oder wollten, fügte ich im Stillen an.
Die Familie Medici saß beim Abendessen im Bankettsaal. Die lange Tafel war an einem Ende gedeckt, das kostbare Tafelsilber und die Weingläser aus Empoli funkelten im Kerzenschein, aber das Essen, das die Diener auftrugen, war einfach: Brot, Wurst, Käse, Oliven und Rotwein.
An diesem Abend war keiner der üblichen Gäste anwesend – Lorenzo bewirtete in seinem Palazzo regelmäßig ein Dutzend oder mehr Personen, die ohne Rücksicht auf Rang und Stand und ohne jede höfische Förmlichkeit nebeneinander an seiner Tafel saßen: Botschafter, Professoren, Künstler und seine Freunde von der Platonischen Akademie. Von diesen Freunden war an diesem Abend nur Angelo Poliziano anwesend, der Erzieher von Lorenzos Söhnen. Er wohnte im Palazzo Medici. Die anderen – wie der Gesandte aus Mailand, der im Gästetrakt logierte – hatten sich wegen Lorenzos schlechtem Gesundheitszustand höflich entschuldigen lassen.
»Amerigos Vater war vor der Pazzi-Verschwörung der Notar der Medici. Ich kenne Amerigo gut«, warf Lorenzo ein – er hatte darauf bestanden, dass ich ihn so und nicht anders nannte. Er hasste die Anrede Magnifico Lorenzo und verbot seinen Kindern und Freunden, ihn anders als bei seinem Namen zu nennen. Was mich aber noch mehr erstaunte, war der vertraute Umgang innerhalb der Familie: Die Söhne sprachen den Herrn von Florenz mit dem vertrauten Du an, als wäre der Vater ihr bester Freund.
»Amerigo ist zwei Jahre jünger als ich«, fuhr Lorenzo fort, während er sich eine Scheibe Ziegenkäse auf das noch warme Haselnussbrot legte. »Wir hatten einige Jahre lang dieselben Lehrer, unter vielen anderen den berühmten Astronom und Kartenzeichner Paolo Toscanelli. Amerigo war erst vor wenigen Wochen bei mir, um mich um Geld für eine Expedition nach Indien zu bitten. Ich habe ihn weggeschickt.«
»Weil er nach Westen segeln will, um nach Indien und China zu gelangen?«, fragte ich. Wie oft hatte ich mit Amerigo über seinen Traum gesprochen, zur See zu fahren, um Toscanellis These zu beweisen, dass die Erde rund ist und der kürzeste Weg nach Indien nach Westen führt!
»Nein, nicht deshalb, denn ich kenne Toscanellis Weltkarte«, widersprach Lorenzo. »Sondern weil ich keinen Fiorino übrig habe, um seine Expedition auszustatten. Erst vor wenigen Wochen sind drei Schiffe meiner Flotte in einem Sturm vor Alexandria gesunken – mit der Ladung.«
»Da du, Caterina, im Hause Vespucci mit Seekarten, Astrolabien und nautischen Instrumenten aufgewachsen bist, hättest du doch sicher Lorenzos Schiffe aus dem Sturm heraussegeln können«, stellte Piero fest. Er hatte sich auf seinem Sessel zurückgelehnt, stemmte das Knie gegen die Tischkante und imitierte mit seinem Stuhl den Seegang an Bord eines Schiffes.
Wie sollte ich auf Pieros höhnische Bemerkung reagieren? Als Lorenzo mich vor einer Stunde seinen Söhnen Piero und Giuliano und seinem Neffen Giulio vorstellte, hatte mein Cousin mich nur mit einem verächtlichen Blick bedacht. Meine Anwesenheit im Palazzo missfiel ihm, und er gab sich nicht die geringste Mühe, seinen Widerwillen hinter einem Lächeln zu verbergen.
Während des Abendessens hatte ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden – doch das war für Piero nicht das Schlimmste gewesen. Eine meiner Verfehlungen war es, nicht dumm zu sein. Aber mein größter Fehler war zu wissen, dass ich nicht dumm war. Dass ich es jederzeit mit ihm, dem Kronprinzen von Florenz, aufnehmen konnte. Piero tat mir Leid, wenn er seine Vorherrschaft als Lorenzos ältester Sohn durch mich bedroht sah und wenn er es für unerlässlich hielt, mich mit Ironie und Sarkasmus auf den mir zustehenden Platz in der dritten Reihe hinter Lorenzo und sich selbst zu verweisen.
Pieros Gemahlin, die Römerin Alfonsina Orsini, schien sich mit ihrem Platz abgefunden zu haben. Alfonsina war eine Cousine von Pieros Mutter Clarice und von Virginio, dem Oberhaupt der Orsini. Sie hatte den Stolz und die Überheblichkeit eines alten römischen Adelsgeschlechts geerbt, nicht jedoch die notwendige Intelligenz, um eines Tages als Prima donna von Florenz an Pieros Seite zu stehen.
Mein Bruder Giulio, der am Tisch neben mir saß, spürte meine Anspannung. Er legte mir die Hand auf den Arm: Ich sollte mich von Pieros Sticheleien nicht herausfordern lassen. Noch vor einer Stunde hatte Giulio nicht gewusst, wie er auf meine Anwesenheit im Palazzo reagieren sollte. Er hatte mich umarmt und auf die Wange geküsst, als wären wir zusammen aufgewachsen, als hätten wir uns nicht gerade erst kennen gelernt. Seine Lippen hatten gelächelt – und doch war da ein Ausdruck in seinen Augen gewesen, den ich nicht gleich deuten konnte: ein vages Gefühl nur – war es Traurigkeit? Oder Mitleid?
Piero war Giulios Geste, die mich zur Zurückhaltung ermahnen sollte, nicht entgangen. »Und das erste Buch, das du gelesen hast, war vermutlich Plinius’ Historia Naturalis«, fuhr er fort, als sei ein solch bedeutendes Werk keine angemessene Lektüre für eine Frau, als würde er mir nicht zutrauen, auch nur die Einleitung in lateinischer Sprache zu verstehen.
Wenn Piero glaubte, dass ich meine Bildung besser auf Francesco Petrarcas Sonette beschränken sollte, weil die Naturwissenschaft meinen Verstand überstieg, hatte er sich in mir getäuscht! Ich musste ihm widersprechen, denn es ärgerte mich, dass er mit seiner Vermutung Recht hatte – ich hatte Plinius gelesen, als ich neun Jahre alt war. Amerigo hatte mir Latein mit der Weidenrute beigebracht.
»Nein, Piero: Mein erstes Buch war Marco Polos Reisebeschreibung von China und Indien«, korrigierte ich meinen Cousin mit einem charmanten Lächeln. Dass ich mit diesem Buch lesen gelernt hatte, verriet ich ihm nicht.
»Wozu liest eine junge Frau Marco Polo?«, plusterte sich Piero auf, um sein schützendes Gefieder neu zu ordnen. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, zupfte er wie gelangweilt an den Brokatärmeln seiner Jacke herum. »Du wirst doch nie in deinem Leben die Stadtmauern von Florenz verlassen. Außer Lorenzo verheiratet dich mit einem Orsini in Rom oder einem Sforza in Mailand, um ein neues Bündnis zu schließen.«
»Piero!«, ermahnte Lorenzo seinen Sohn scharf. »Caterina ist noch keine zwei Stunden deine Cousine, und schon beunruhigst du sie mit der Erwähnung ihrer Eheschließung.«
»Ich bin nicht beunruhigt …«, begann ich.
Doch Piero unterbrach mich, scheinbar unbeeindruckt vom Zorn seines Vaters: »Lorenzo, hast du nicht selbst gestern von der Bedeutung der Beziehungen zwischen Florenz und Mailand gesprochen? Hat der mailändische Botschafter heute Nachmittag nicht von Ludovico il Moros Wunsch gesprochen, die Familien Medici und Sforza enger zu verbinden, um den Frieden und die Freundschaft zwischen dem Herzogtum Mailand und der Republik Florenz zu garantieren? Hast du ihm gegenüber nicht dein Bedauern geäußert, dass du neben Lucrezia, Maddalena und Contessina keine weitere Tochter hast, die du mit einem Sforza verheiraten könntest?«
»Ich danke dir für die Belehrung, Piero, aber ich bin nicht senil. Noch nicht«, entgegnete Lorenzo in einem Tonfall, der mich frösteln ließ. »Du dagegen scheinst vergessen zu haben, dass ich keinen Unterschied zwischen legitimen und illegitimen Kindern mache. Tommaso Inghirami, der zusammen mit deinem Bruder Giovanni in Pisa studiert, Bernardo da Bibbiena und Michelangelo Buonarroti sind keine Medici. Trotzdem sind sie wie Mitglieder unserer Familie. Wie Angelo.« Lorenzo deutete auf seinen Freund Angelo Poliziano. Piero verzog die Lippen, aber sein Vater fuhr fort: »Und ich mache schon gar keinen Unterschied zwischen meinen eigenen Kindern und denen meines Bruders Giuliano. Das galt für Giulio ebenso, wie es für Caterina gilt! Habt ihr mich verstanden?«
»Ja, Lorenzo«, nickten Giulio und Giuliano.
»Dann war es ja ein glücklicher Zufall, dass Caterina in dem Augenblick im Palazzo auftauchte, als dir eine Tochter fehlte, die du einem Sforza ins Bett legen kannst …«, fauchte Piero.
Lorenzo beherrschte sich mit einem eisigen Lächeln, als Angelo Poliziano ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm legte. Piero spielte mit der Flamme der Kerze auf dem Tisch – und mit dem Feuer – und ignorierte Lorenzos Zorn.
»Keines meiner Kinder werde ich zwingen, meine Ratschläge zu befolgen. Eure Schwester Maddalena hat Franceschetto Cibò aus freiem Willen geheiratet. Euer Bruder Giovanni hat sich vor zwei Jahren selbst dafür entschieden, das Amt des Kardinals anzunehmen, als Papst Innozenz unserer Familie diese hohe Ehre anbot. Und auch du, Piero, hast dich bisher nicht dagegen gewehrt, mir eines Tages als Oberhaupt der Familie Medici nachzufolgen …«, sagte Lorenzo ernst. »Keiner von euch muss meine Entscheidungen gutheißen, aber jeder muss mit den Konsequenzen leben, wenn er es nicht tut.«
Lorenzos Worte versickerten im Schweigen bei Tisch, dann wandte er sich mir zu: »Caterina, du wolltest etwas sagen, als Piero dich so taktlos unterbrach.«
»Ich sagte: Ich habe keine Angst«, erwiderte ich, selbst überrascht über die Entschlossenheit in meiner Stimme. Meine Worte klangen so, als fürchtete ich mich vor gar nichts. Schon gar nicht vor Piero.
»Furcht solltest du auch nicht haben, wenn du eine Medici bist, Caterina«, warnte mich Lorenzo. »Ich weiß nicht mehr, wie viele Verschwörungen gegen unsere Familie geplant wurden, wie viele Attentate ich überlebt habe. Piero ist neunzehn Jahre alt, Giovanni ist sechzehn, Giulio wird bald vierzehn, und Giuliano ist zwölf. Ihr alle werdet irgendwann Opfer von Attentaten oder Giftanschlägen werden. Und wenn eure Feinde nicht versuchen, euch umzubringen, dann werden sie euren Namen in den Schmutz ziehen und euch Dinge nachsagen, die ihr nie tun würdet, wenn ihr bei Verstand seid.
Wir Medici leben gefährlich. Unsere Macht in Florenz, unser Einfluss in der Signoria, unser Ansehen in Mailand, Venedig, Rom und Neapel, unsere Macht unter den größten Banken Europas ruht auf einem geborstenen Marmorsockel.
Ich, Lorenzo de’ Medici, bin nur ein einfacher florentinischer Bürger. Ich bin nicht der Bannerträger der Republik. Ich bin nicht einmal Mitglied der Signoria. Ich habe keine offiziellen Aufgaben und Ämter in der Republik Florenz. Ich tue einfach nur das, was getan werden muss. Mit all meiner Kraft, die Gott mir gegeben hat. Viele Florentiner glauben, ebenso gut oder besser regieren zu können als ich. Einflussreiche Familien wie die Pazzi und – wie du weißt, Caterina – auch die Vespucci haben sich gegen uns Medici verschworen, um uns zu stürzen.« Lorenzo sah mich scharf an. »Ein Medici zu sein bedeutet zu lächeln, obwohl du weißt, dass dein Feind hinter seinem Rücken einen Dolch verbirgt. Ein Medici zu sein bedeutet, keine Angst haben zu dürfen.«
»Ich bin eine Medici«, sagte ich und es klang wie eine Kriegserklärung.
An Piero.
Und an die Furcht.
Nach dem Abendessen zog sich Lorenzo, auf seinen Vertrauten Angelo Poliziano gestützt, in sein Schlafzimmer zurück. Er hatte Angelo gebeten, ihm noch einige seiner Gedichte vorzulesen, um ihn von seinen furchtbaren Schmerzen abzulenken. Der Gichtanfall vom Vortag quälte ihn noch immer.
»Wir werden uns morgen unterhalten«, hatte Lorenzo gesagt, als er mir eine gute Nacht wünschte. »Es gibt viel zu besprechen.« Ich konnte mir vorstellen, worüber wir uns unterhalten würden: über mich. Und Piero.
Giulio brachte mich zu meinem Schlafzimmer. Lorenzo hatte Anweisung gegeben, das Zimmer meiner Cousine Maddalena für mich herzurichten. Maddalena war mit Papst Innozenz’ Sohn Frances-chetto Cibò verheiratet und lebte in Rom. Ihre Schwester Lucrezia war mit dem Florentiner Jacopo Salviati vermählt, und Lorenzos jüngste Tochter Contessina war vor vier Jahren ihrem Gemahl Piero Ridolfi in dessen Palazzo gefolgt. Nur Lorenzos Söhne Piero, Giovanni, der in Pisa studierte, Giuliano und sein Neffe Giulio lebten noch in dem großen Haus an der Via Larga.
Mit einem Kerzenleuchter in der Hand führte mich mein Bruder durch die dunklen Gänge des Palazzo. »Wie fühlst du dich nach deiner Unabhängigkeitserklärung?«, fragte Giulio.
»Gut!«, log ich. In Wirklichkeit fühlte ich mich miserabel.
Giulio sah mir in die Augen. »Weißt du, dass Piero dir heute Abend das größte Kompliment gemacht hat, zu dem er fähig ist?«
»Wie bitte?«, fragte ich verblüfft. »Ich dachte, er hätte mir mit dem Fehdehandschuh ins Gesicht geschlagen.«
»Das hat er auch getan – auf eine bemerkenswert ungalante Weise. Piero legt sich niemals mit einem Schwächeren an. Das ist unter seiner Würde, weil er weiß, dass er nicht wegen seiner intellektuellen Überlegenheit, sondern allein wegen der Tatsache, dass er Lorenzos Sohn ist, den Kampf gewinnen wird. Stattdessen liefert sich Piero erbitterte Wortgefechte mit seinem Vater und reizt Angelo Poliziano bis zum Funkenflug. Doch Angelo gibt die Hoffnung nicht auf, Piero doch noch Manieren beizubringen. Pieros Kriegserklärung an dich ist also so etwas wie eine Auszeichnung. Er hat dich akzeptiert – nicht als seine Cousine, aber als würdigen Gegner.«
Wir hatten mein Zimmer erreicht. Giulio öffnete und ließ mich eintreten. Der Raum war viel größer als mein Schlafzimmer in der Casa Vespucci. Vor einem fröhlich flackernden Kaminfeuer standen zwei gepolsterte Sessel.
Am Fenster, dessen Innenläden noch nicht für die Nacht geschlossen waren, entdeckte ich einen Schreibtisch mit verschließbaren Schubladen und zwei Kerzenleuchtern aus Silber. Neben einem silbernen Tintenfass, einem Bündel gespitzter Federn und einer Ledermappe mit geschnittenem Pergament lag ein Stapel Bücher auf dem Tisch.
Die Wände des Raumes waren mit indigoblauen Seidentapeten geschmückt, den Fliesenboden bedeckte ein orientalischer Teppich – welch ein Luxus! Über den aufgeschlagenen weißen Seidenlaken und den Kissen des Bettes wölbte sich der goldgewirkte Betthimmel wie ein Segel im Wind.
Mit erhobenem Kerzenleuchter blieb Giulio in der offenen Tür stehen. Das Feuer im Kamin tauchte sein Gesicht in einen purpurfarbenen Schein. Seine schwarzen Augen mit den langen Wimpern verbargen sich hinter schwermütig gesenkten Lidern. Seine Lippen waren zu einem gequälten Lächeln gepresst, als könnte er auf diese Weise sein schönes Gesicht weniger begehrenswert – weniger sinnlich? – erscheinen lassen. Trotz der unbeschwerten Herzlichkeit, mit der er mich als seine Schwester begrüßt hatte, wirkte er distanziert – unnahbar wie ein heiliger Eremit, der sich vor den Menschen in die wärmende, schützende Höhle seines Selbst zurückgezogen hatte. Wovor fürchtete er sich?
»Hat Lorenzo dir die Zehn Gebote erklärt?«, fragte Giulio.
Verblüfft fragte ich: »Was meinst du, Giulio? So etwas wie ›Lächele und schweige während der Staatsempfänge für ausländische Botschafter und vergiss nie: Du repräsentierst die Republik Florenz‹ oder ›Der schönste Schmuck einer Medici sind nicht Perlen und Diamanten, sondern Zitate von Platon‹?«
Giulio schloss mit einem Tritt die Tür hinter sich und lehnte sich herzlich lachend dagegen. Wie sich sein Gesicht veränderte, als er die unbeschwerte Lebenslust und das Lachen nicht mehr unterdrücken konnte! Seine sinnlichen Lippen waren geöffnet, seine schwarzen Augen glänzten. Wann hatte er zuletzt so ungezwungen gelacht?
»Lass das nicht Lorenzo hören!«, prustete er und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Er bittet Angelo Poliziano, dein Lehrer zu werden, damit du während der Empfänge eben gerade nicht den Mund zu halten brauchst. Und er wird ein Vermögen in Juwelen investieren, damit du sie mit Stolz trägst.« Er nahm meine Hand und führte mich zum Bett, wo wir uns nebeneinander auf die Brokatdecke setzten. »Mit den Zehn Geboten meinte ich nicht die höfische Etikette, die Angelo Poliziano und Giovanni Pico dich lehren können. Es gibt ein paar einfache Gesetze hier im Palazzo. Befolge sie, und du wirst überleben. Das erste Gebot lautet: Halte Sicherheitsabstand zu Seiner Überheblichkeit!«
»Ich werde mich bemühen, Giulio«, versprach ich seufzend und freute mich im Stillen über das Grinsen, das ich auf das Gesicht meines Bruders zauberte. »Ich werde mich nicht mit Piero anlegen, ihm nicht widersprechen. Ich werde in seiner Gegenwart meinen Stolz und meine Selbstachtung vergessen, werde mich um Demut und Unterwürfigkeit bemühen …«
»Versprich nichts, was du nicht halten kannst, Caterina«, winkte Giulio ab. »Wir Medici erkranken im Laufe unseres Lebens an zwei Leiden: an der Gicht, die unsere Körper erstarren lässt, und am Zynismus. Lorenzos Großvater Cosimo und sein Vater Piero starben beide an der Gicht, und auch Lorenzo ist mit zweiundvierzig Jahren schwer krank. Du, Caterina, scheinst von unserem Vater Giuliano die unbesiegbare Lebenslust und die Schlagfertigkeit geerbt zu haben.«
»Amerigo nennt mich respektlos, ungehorsam, eigensinnig …« Ich erinnerte mich an mein trotziges Nein, als Amerigo mir am Abend zuvor vorgeschlagen hatte, ins Kloster zu gehen.
Giulio schmunzelte. »Zweites Gebot: Bemühe dich um die Freundschaft Seiner Strebsamkeit!«
»Wer ist das: Seine Strebsamkeit?«, fragte ich verwirrt.
»Seine Eminenz, Kardinal Giovanni de’ Medici. Unser Cousin Gianni studiert in Pisa und wird nächstes Jahr den Doktorgrad in Kanonischem Recht mit einem summa cum laude erhalten. Dann wird ihm im März offiziell der Purpur verliehen. Er hat den Ehrgeiz, mit sechzehn Jahren nicht nur der einzige Kardinal in Rom zu sein, der eine Universität von innen gesehen, sondern auch den Doktorgrad in Kirchenrecht erworben hat. Aus Gianni wird noch einmal etwas …«
»Was?«, fragte ich.
»Wer mit dreizehn zum Kardinal ernannt wird und mit sechzehn seinen Doktorgrad erwirbt, hat jede Chance, Papst zu werden.«
»Was fordert das dritte Gebot?«, fragte ich.
»Lerne die Kunst des Krieges! Verrate niemandem deine Stärke oder deine wahren Absichten, nicht einmal denjenigen, die du für deine Freunde hältst. Greif an, wenn der Feind am wenigsten damit rechnet. Zieh dich zurück, wenn du nicht gewinnen kannst. Und falls du im Kampf siegst: Vernichte deinen Feind! Ich werde dir morgen das Schlachtfeld zeigen – der Palazzo Medici hat mehr verborgene Türen und Geheimtreppen, als du vermutest.« Giulio nahm meine Hand, als er mein betroffenes Gesicht sah. »Du verstößt gegen das vierte Gebot, Caterina.«
»Wie lautet es?«
»Lächle!«, sagte er ernst und hielt sich selbst nicht daran.
Die Kerze auf dem Tisch neben dem Bett war heruntergebrannt, und nur das Licht der Fackeln an der Palastfassade zur Gartenloggia erhellte den Raum. Giulio hatte erst lange nach Mitternacht seinen Vortrag über die Kunst zu überleben beendet und mich verlassen. Ich lag angekleidet zwischen den Seidenkissen auf dem Bett und starrte in das verglimmende Kaminfeuer.
Caterina de’ Medici: Das war ich. An den neuen Namen würde ich mich erst gewöhnen müssen. Er klang so stolz, so mächtig und reich, dass ich froh war, im Palazzo nur mit meinem Vornamen angesprochen zu werden.
Erst vor wenigen Stunden hatte Caterina Vespucci vor dem Palast auf Einlass gewartet, um eine Audienz beim Magnifico zu erbitten. Ich hatte es geschafft, mit Lorenzo zu sprechen und ihn zu überzeugen, dass ich die Tochter seines Bruders war. Wie sehr hatte ich mir all die Jahre gewünscht, eine Familie und ein Zuhause zu haben! Und als Amerigo mir eines Tages erklärte, wer meine Mutter und mein Vater waren, sehnte ich mich danach, ihnen so nah wie möglich zu sein. Meine Mutter Simonetta war bei meiner Geburt gestorben, mein Vater Giuliano zwei Jahre später ermordet worden. Wo konnte ich ihnen denn nah sein?
Der Palazzo Vespucci in der Nähe der Kirche Santa Trinità, in dem Simonetta mit ihrem Gemahl Marco gelebt hatte, war nach der Verbannung meines Stiefvaters verkauft worden. Die Vespucci ließen mich spüren, dass ich ein illegitimes Kind war: ein Kind der Liebe zwischen der schönen Simonetta und dem Bruder des mächtigsten Mannes von Florenz. Sie erinnerten mich daran, dass ich schuldig war am Tod meiner Mutter. Sie ließen mich wissen, dass sich die Vespucci mit den Pazzi gegen die Medici erhoben hatten, und wie Lorenzo sich an ihnen gerächt hatte.
Ich war am Ziel meiner Träume. Ich hätte glücklich sein können. Aber ich war es nicht. Denn in dem Augenblick, als ich meine Träume verwirklichte, stellten sie sich als Illusionen heraus.
Die Familie, nach der ich mich gesehnt hatte, gab es nicht. Lorenzo und seine Söhne inszenierten ein Theaterstück, und Florenz war die Bühne. Jeder der Medici kannte seine Rolle. Auf der Bühne der Politik und des Geldes spielten sie die glückliche Familie, reich und erfolgreich, unersetzlich für die Republik Florenz, für den Papst und für Italien – und hinter den Kulissen? Da vergaßen einige von ihnen ihren Text. Würde ich meine Rolle jemals lernen?
Im Hause Vespucci war ich eine Medici – hier im Palazzo Medici war ich für Piero eine Vespucci. Eines Tages sollte er seinem Vater nachfolgen. Bis dahin würde er mir das Leben zur Hölle machen – dann das Letzte Gericht: Piero würde mich aus dem Palazzo fortjagen …
Hellwach, wie aus einem tiefen Traum hochgeschreckt, setzte ich mich auf und strich mir mit beiden Händen über das Gesicht.
War es nicht besser, das Inferno zu verlassen, bevor meine Seele brannte? War das Fegefeuer von Amerigos anklagenden Blicken nicht der Hölle vorzuziehen? Er würde fragen, wo ich gewesen war. Ich würde ihm sagen, ich hätte einen Mann kennen gelernt, den ich nie mehr vergessen könnte. Denn niemals würde ich vergessen, wie Lorenzo mich umarmte, küsste und »meine Caterina« nannte.
Noch konnte ich der Hölle entfliehen! Es war ganz einfach: durch die Tür, die Treppe hinunter, durch den Innenhof zum Tor. Niemand würde mich aufhalten, wenn ich den Portier bat, das Portal für mich zu öffnen. Auf dem Weg durch die nächtlichen Straßen, am Dom vorbei zur Piazza della Signoria und weiter zur Kirche Santa Trinità, würde ich von Schatten zu Schatten huschen, um nicht einer Schar Nachtschwärmer in die Hände zu fallen.
Entschlossen schwang ich die Beine über den Rand des Bettes, wollte mich schon erheben, um zur Tür zu schleichen. Doch dann blieb ich sitzen. Ich wollte nicht aufgeben – nicht in dieser Nacht und in keiner der folgenden Nächte! Ich würde meinen Text und meine Rolle lernen! Nicht für mich – sondern für Lorenzo.
Im Morgengrauen weckte mich das Gurren der Tauben auf dem Sims neben dem Fenster, aber ich war zu müde, um ernsthaft ans Aufstehen zu denken. Ich hatte die halbe Nacht wach gelegen und nachgedacht. Und so drehte ich mich seufzend um und schlief wieder ein.
Das nächste Mal erwachte ich, als eine Dienerin leise mein Schlafzimmer betrat, um das Feuer im Kamin zu schüren. Ich sprang aus dem Bett, um ihr dabei zu helfen, und kniete mich neben sie, um die Asche aus dem Kamin zu entfernen.
»Lasst nur, das ist meine Aufgabe«, murmelte das Mädchen, das sich mir als Ginevra vorstellte. Sie nahm mir den Schürhaken aus der Hand und stocherte in den verkohlten Holzscheiten herum.
»Bitte entschuldige! Ich bin es gewohnt, jeden Morgen selbst Feuer zu machen und das Wasser zum Waschen aus dem Brunnen im Hof zu holen«, erklärte ich.
Amerigo hatte nur Violetta als Bedienstete angestellt, um für uns zu kochen. Die meisten anderen Arbeiten wie die Führung des Hauses hatte ich selbst erledigt. Nicht zuletzt deswegen hatte Amerigo mir vorgeschlagen, in den Konvent von Santa Croce zu gehen: Er wollte mir die schwere Arbeit ersparen und mir ein angemessenes Studium ermöglichen – er nannte es Studium, wenn eine junge Frau die Werke von Boccaccio und die Sonette von Petrarca las und die Kunst der anmutigen Konversation lernte. Und die Demut! Ich war nicht demütig, und ich war nicht dankbar, obwohl es mehr war, als ich erwarten durfte – wir Vespucci waren nicht reich. Nicht mehr. Amerigo wollte mir eine standesgemäße Verbindung ermöglichen – wenn ich schon kein Vermögen oder einen bekannten Namen mit in die Ehe brachte, so doch wenigstens Gelehrsamkeit. Wir Vespucci hatten kein Gold, aber Visionen – mehr als genug. Ich wollte wie Amerigo meinen Traum zu Ende träumen … eines Tages.
Ginevra lächelte verlegen: »Im Palazzo Medici müsst Ihr nicht arbeiten, Madonna Caterina. Gleich werde ich Euch das Waschwasser bringen, und dann werde ich Euch beim Anziehen helfen. Ihr habt doch nicht etwa in diesem Kleid geschlafen?«, fragte sie missbilligend.
Bevor ich antworten konnte, hatte sie sich erhoben und den Raum verlassen. Ich zog mein Kleid aus und legte es ordentlich aufs Bett. Es hatte über Nacht ein paar Knitterfalten bekommen, aber vielleicht konnte Ginevra mir ein heißes Eisen bringen, um die Falten zu glätten. Als sie zurückkehrte, wusch ich mich mit heißem, mit Rosenblüten parfümiertem Wasser. Inzwischen hatte Ginevra eine von Maddalenas Brokatroben aus einer Truhe geholt und auf dem Bett ausgebreitet.
»Der meergrüne Atlas wird gut zu Euren Haaren passen«, entschied das Mädchen und half mir in das kostbare Kleid.
»Ich bekomme keine Luft«, schnaufte ich, als Ginevra die Schleifen des Mieders zuzog. Die Robe war schwer – wie viele Ellen Seide, wie viel Brokat und Spitze sollte ich künftig tragen?
Ginevra zupfte an den Ärmeln herum, bis das seidene Unterkleid durch jeden Ärmelschlitz zu sehen war. Schließlich steckte sie mir meine langen Haare auf und befestigte sie mit einer perlenbestickten Ghirlanda. Dann führte sie mich, begeistert von ihrem Werk, vor den Spiegel.
Eine Fremde starrte mich aus dem Spiegel an. Sie war wie ich fünfzehn Jahre alt, aber sie war eine junge Frau, kein Mädchen mehr. Das Mieder betonte ihre schlanke Taille, und der Ausschnitt des Kleides überließ nur wenig der Fantasie des Betrachters. Die hochgesteckten Haare mit den in Kaskaden herabfallenden Locken umschmeichelten Hals und Schultern. Im Spiegel sah ich größer aus, als ich in Wirklichkeit war, würdevoller, eleganter. Und doch fühlte ich mich irgendwie verkleidet. Wie für eine Rolle …
Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, wie Ginevra mein blaues Kleid in den Kamin warf. Es fing sofort Feuer und brannte lichterloh. Eines war sicher: Jetzt konnte ich nicht mehr zurück!
Während Ginevra mir Maddalenas Schatulle mit dem Schmuck zeigte, den meine Cousine nach ihrer Hochzeit zurückgelassen hatte, und ich ein Halsband mit funkelnden Diamanten auswählte, erläuterte sie mir die täglichen Gepflogenheiten im Palazzo: »Die Familie nimmt das Frühstück nur selten gemeinsam ein. Seine Exzellenz steht oft schon vor dem Morgengrauen auf, während sein Sohn Piero sich erst gegen Mittag erhebt. Das erste gemeinsame Mahl der Familie ist das Abendessen, das nach Sonnenuntergang serviert wird. Oft sind ein Dutzend oder mehr Tischgäste eingeladen.«
»Wohnen zurzeit Gäste im Palazzo?«, fragte ich, während Ginevra mir das Diamantkollier umlegte.
»Der Gesandte des Regenten von Mailand residiert mit seinem Gefolge für einige Tage im Gästetrakt«, erwiderte Ginevra, während sie in der Schatulle nach dem passenden Saphirring suchte.
»Ich habe ihn noch nicht kennen gelernt«, sagte ich. »Er war gestern nicht beim Abendessen im Speisesaal …«
Ginevra wandte verlegen den Blick ab. »Der Conte zog es vor, in seinem Schlafzimmer zu speisen.«
Ich musste nicht weiter fragen, um zu ahnen, dass Ginevra ihm während des Essens und der süßen Stunden danach Gesellschaft geleistet hatte. Dass die Hausherren die Mädchen in ihre Betten befahlen, war üblich – aber dass die Gäste sich dasselbe Vorrecht herausnahmen, empfand ich als ungewöhnlich.
»In den nächsten Wochen werden noch weitere Gäste erwartet: eine Gesandtschaft des Dogen von Venedig, der Conte von Concordia und die Freunde des Magnifico von der Platonischen Akademie …«, zählte Ginevra an den Fingern ihrer Hand auf. »Es wird während der nächsten Wochen fast jeden Tag ein Bankett mit Musik und Tanz geben. Und an Weihnachten wird Kardinal Giovanni nach Hause kommen …«
Ich bat Ginevra, Amerigo eine handschriftliche Nachricht von mir zukommen zu lassen, damit er sich keine unnötigen Sorgen um mich machte. Dann ging ich hinunter zum Speisesaal, um zu frühstücken, in der Hoffnung, dass Piero sich noch nicht erhoben hatte. Lorenzo hatte gesagt, dass er mit mir sprechen wollte. Ich hielt es für das Beste, diese Unterredung hinter mich zu bringen, bevor Piero zum Frühstück erschien.
»Ist Seine Exzellenz schon aufgestanden?«, fragte ich einen Diener, der neben der Tür zum Speisesaal stand. Bereits beim Abendessen war mir aufgefallen, dass die Dienerschaft die unglaubliche Fähigkeit besaß, sich unsichtbar zu machen. Lorenzos Familie und seine Gäste speisten allein – ohne Heerscharen von Bediensteten, die bei Tisch aufwarteten. Aber sie waren da, wenn sie gebraucht wurden – ohne einen Wink oder ein Händeklatschen.
»Seine Exzellenz frühstückt.« Der Lakai öffnete mir die Tür des Speisesaals, und ich trat ein. Überrascht blieb ich stehen – ich hatte erwartet, mit Lorenzo allein zu sein.
Bei ihm am Tisch saß ein Mann in einer mit Edelsteinen bestickten Brokatjacke mit Hermelinbesatz. Die kostbare Kleidung des Fremden und sein Smaragdring schimmerten in den leuchtenden Farben eines Pfaus, und er schien sich wie einer dieser stolzierenden Vögel darin zu gefallen, sich größer zu machen, als er war: mit einer wippenden Feder am schwarzen Samtbarett und Haaren, die ihm bis auf die Schultern fielen.
»Ich bitte um Entschuldigung«, murmelte ich und wollte schon den Rückzug antreten, um Lorenzo nicht bei einem augenscheinlich offiziellen Termin zu stören.
»Buon giorno, Caterina«, begrüßte mich Lorenzo und winkte mich zum Tisch. »Setz dich zu uns!«
Während der Fremde sich höflich erhob, um mir beim Hinsetzen zu helfen, machte Lorenzo uns bekannt: »Caterina, ich möchte dir Giovanni Sforza vorstellen, den Neffen des Regenten Ludovico Sforza von Mailand. Der Conte von Pesaro ist für einige Tage als Gesandter seines Onkels in Florenz. Euer Gnaden, das ist meine Nichte Caterina, die Tochter meines verstorbenen Bruders.«
Lorenzo stellte mich in einem Tonfall vor, als müsste der Conte bereits von mir gehört haben. Glaubte er, den drohenden Skandal wegen meiner Aufnahme im Palazzo Medici ignorieren zu können, indem er so tat, als lebte ich schon seit Jahren hier? Doch dann kam mir ein anderer Gedanke, eine erschreckende Vorstellung: Hatte er vielleicht keine andere Wahl? Der Skandal in Florenz war so unvermeidlich wie ein Erdbeben und konnte ebenso vernichtend sein. Die Erschütterungen am Fundament seiner Macht würden bis Mailand zu spüren sein. Das Einzige, was ihm blieb, war, so zu tun, als ginge ihn das alles nichts an. Als seien seine Macht in Florenz, sein Status und sein Name unzerstörbar.
In diesem Augenblick wurde mir klar: Sie waren es nicht!
Giovanni Sforza beugte sich tief über meine Hand. Noch tiefer senkte er seinen Blick in den Ausschnitt meines Kleides. »Ich bin verzaubert von Euch«, murmelte er. »Der Morgenstern ist heute Früh vom Himmel herabgefallen.«
War es die höfische Etikette der Sforza in Mailand oder war er beeindruckt von Maddalenas kostbarem Diamantkollier? Dass er mich mit dem Morgenstern verglich, kam mir keinen Augenblick in den Sinn. Ich dankte ihm für sein Kompliment, und er nahm wieder Platz – aber nicht auf dem Sessel, auf dem er zuvor gesessen hatte, sondern auf dem Stuhl neben meinem, als könnte er es nicht ertragen, mehr als eine Elle entfernt von mir zu sitzen.
Während er und Lorenzo sich wieder in ihr Gespräch über ein Bündnis zwischen Florenz und Mailand vertieften, nahm ich mir ein wenig Fasanenpastete, Käse und Oliven und begann zu essen.
Der Conte von Pesaro erinnerte Lorenzo an die jahrzehntealte Freundschaft der Familien Sforza und Medici: »Mein Großvater, der große Condottiere Francesco Sforza, war ein Freund Eures Großvaters Cosimo, Exzellenz. Nur mithilfe der Goldfiorini des Hauses Medici war es ihm 1450 gelungen, die Visconti zu beerben und als Herzog den Thron von Mailand zu besteigen.
Cosimo hatte so viel Vertrauen in diese Freundschaft, dass er zwei Jahre später die Filiale der Banca Medici in Mailand gründete. Herzog Francescos Sohn, Galeazzo Maria Sforza, wurde oft hier im Palazzo Medici empfangen, bevor er 1476 im Dom von Mailand ermordet wurde. Und Ihr, Exzellenz, wart mehrmals ein geehrter Gast im Castello Sforzesco in Mailand. Ihr seid der Taufpate des jungen Herzogs Gian Galeazzo und der Freund des Regenten Ludovico il Moro. Was steht denn einem Bündnis zwischen Florenz und Mailand im Weg?«, fragte Giovanni Sforza mit zunehmender Ungeduld.
»Der Papst«, erwiderte Lorenzo und biss in ein Stück Pecorino, das er auf der Spitze seines Dolches balancierte.
»Papst Innozenz ist Euer Schwager, Exzellenz«, warf der Conte in einem Tonfall ein, als wäre Lorenzo diese Tatsache entfallen.
»Wie Ihr wisst, war ich bereits einmal exkommuniziert: Im Jahr 1478, nach dem Pazzi-Attentat, hat Papst Sixtus mich gebannt. Florenz litt damals monatelang unter dem Interdikt. Es gab keine Gottesdienste, keine Sakramente, keine Absolution. Ich werde die Stadt kein zweites Mal dem Interdikt aussetzen. Papst Innozenz wird den Kirchenbann gegen Florenz schleudern, sobald er auch nur den Verdacht hat, dass ich mit dem Regenten Ludovico ein Bündnis schließe. Der Sturz der Medici wäre nicht mehr aufzuhalten. Das, was Il Moro mit seinem Bündnis erreichen will – Frieden und Sicherheit –, wird also genau das bewirken, was wir beide nicht wollen: Unruhen in Florenz und Machtkämpfe der großen und reichen Familien. Damit sind die Florentiner kein verlässlicher Bündnispartner für Mailand.«
Ungestüm stellte Giovanni Sforza sein Weinglas auf den Tisch. Ein paar Tropfen des Chianti färbten die weiße Tischdecke aus Seidenbrokat blutrot. »Wenn Ihr nicht bereit seid, Ludovico die Hand zu reichen, wird er sich an den König von Frankreich oder Maximilian von Habsburg wenden«, knirschte er, offensichtlich unzufrieden mit Lorenzos Antwort. »Venedigs Expansionspolitik bedroht das Herzogtum Mailand. Es wird Krieg geben.«
Lorenzo blieb erstaunlich ruhig angesichts dieser Drohung. »Krieg? Macht Euch nicht lächerlich! Seit dem Frieden von Lodi 1454 zwischen Mailand und Venedig herrscht Krieg in Italien. Und er wird erst enden, wenn eine der beiden Mächte siegt.«
»Wünscht Ihr einen Sieg Venedigs?«, brauste Giovanni Sforza auf. Seine Faust hieb auf den Tisch und ließ die Weingläser erzittern.
»Nein, Conte: Die Handelsrepublik Venedig ist der größte Konkurrent von Florenz im Seidenhandel und bei den Gewürzimporten aus Indien und China. Aber Florenz hat außer Pisa keinen eigenen Seehafen. Florenz kann also ohne Venedig nicht existieren – ebenso wenig wie Venedig ohne die Zölle der florentinischen Händler. Ich wünsche keinen Sieg Venedigs …«
»Dann sind wir ja einer Meinung, Exzellenz«, lächelte Giovanni Sforza siegesgewiss und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück.
»… aber ich will auch keine Vorherrschaft Mailands«, fuhr Lorenzo unbeirrt fort, während die Gesichtszüge des Conte erfroren. »Das Gleichgewicht der Mächte in Italien darf nicht gestört werden: Der Herzog von Mailand und der Doge von Venedig, der Herzog von Ferrara und der Herzog von Urbino, der König von Neapel und der Papst belauern sich gegenseitig, damit keiner von ihnen stärker wird als alle anderen. Denn dann würde das Fundament Italiens zerbrechen.«
»Italien?«, fragte Giovanni Sforza spöttisch. »Wer ist Italien?«
»Wir alle sind Italien«, erklärte Lorenzo geduldig. »Die Hauptstadt von Italien ist nicht Mailand oder Florenz oder Rom. Italien ist eine Idee – eine Idee vom Frieden …«
»Ihr seid ein Träumer«, entgegnete der Conte von Pesaro verächtlich.