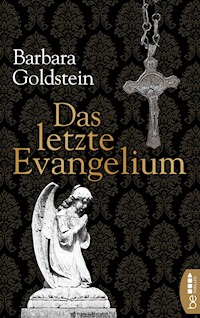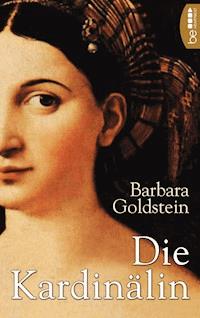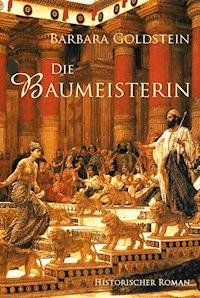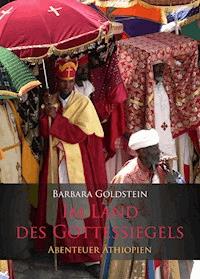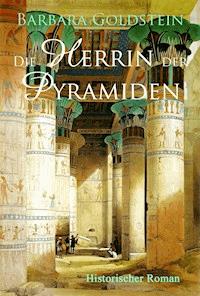4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alessandra d’Ascoli
- Sprache: Deutsch
Ein Papyrus mit brisantem Inhalt. Eine mörderische Verfolgungsjagd. Eine unsterbliche Liebe ...
Alexandria, 1439: Die junge florentinische Buchhändlerin Alessandra d'Ascoli sucht im Auftrag von Cosimo de' Medici nach verschollenen Handschriften und entdeckt einen antiken Papyrus. Seine brisante Botschaft: Petrus war nicht der erste Papst. Nach einem Mordanschlag flieht Alessandra zurück nach Florenz. Die Spuren des Attentäters führen weit hinauf in die Hierarchie der Kirche. Plötzlich ist nicht nur Alessandra in Gefahr, sondern auch die Liebe ihres Lebens - Niketas, ein geheimnisvoller Priester aus Byzanz ...
Auch in den folgenden weiteren historischen Romanen von Barbara Goldstein bei beTHRILLED löst Alessandra d'Ascoli spannende Rätsel:
Der Gottesschrein * Der Ring des Salomo * Das Testament des Satans * Das letzte Evangelium.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 861
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumHinweisKarte von FlorenzKapitel 1: AlessandraKapitel 2: NiketasKapitel 3: AlessandraKapitel 4: NiketasKapitel 5: AlessandraKapitel 6: NiketasKapitel 7: AlessandraKapitel 8: NiketasKapitel 9: AlessandraKapitel 10: NiketasKapitel 11: AlessandraKapitel 12: NiketasKapitel 13: AlessandraKapitel 14: NiketasKapitel 15: AlessandraKapitel 16: NiketasKapitel 17: AlessandraKapitel 18: NiketasKapitel 19: AlessandraKapitel 20: NiketasKapitel 21: AlessandraKapitel 22: NiketasKapitel 23: AlessandraKapitel 24: NiketasKapitel 25: AlessandraKapitel 26: NiketasKapitel 27: AlessandraKapitel 28: NiketasKapitel 29: AlessandraKapitel 30: NiketasEpilogDramatis PersonaeÜber dieses Buch
Ein Papyrus mit brisantem Inhalt. Eine mörderische Verfolgungsjagd. Eine unsterbliche Liebe …
Alexandria, 1439: Die junge florentinische Buchhändlerin Alessandra d‘Ascoli sucht im Auftrag von Cosimo de‘ Medici nach verschollenen Handschriften und entdeckt einen antiken Papyrus. Seine brisante Botschaft: Petrus war nicht der erste Papst. Nach einem Mordanschlag flieht Alessandra zurück nach Florenz. Die Spuren des Attentäters führen weit hinauf in die Hierarchie der Kirche. Plötzlich ist nicht nur Alessandra in Gefahr, sondern auch die Liebe ihres Lebens - Niketas, ein geheimnisvoller Priester aus Byzanz …
Über die Autorin
Barbara Goldstein, geb. 1966, arbeitete zunächst in der Verwaltung von Banken und nahm dann ein Studium der Philosophie und der Sozialen Verhaltenswissenschaften auf. Später machte sie sich als Autorin historischer Romane selbstständig und nahm ihre Leser mit in die Welt von Alessandra d‘Ascoli, einer florentinischen Buchhändlerin. Barbara Goldstein verstarb im März 2014 nach langer Krankheit.
Barbara Goldstein
Der vergessene Papst
beTHRILLED
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Copyright © 2009/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: akg-images/Erich Lessing
Umschlaggestaltung: Nadine Littig
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5297-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Ein Verzeichnis der handelnden Personen
findet sich am Ende des Buches.
Alessandra
Kapitel 1
Tayeb griff nach seinem Schwert, blieb plötzlich stehen und lauschte mit geneigtem Kopf. Trotz des kobaltblauen Schleiers, den er über Mund und Nase gezogen hatte, spürte ich seine Anspannung.
Ein Krieger, bereit zu töten.
Ich hielt den Atem an und horchte.
Nicht weit von uns entfernt rauschten die Wellen an den Strand von Al-Iskanderiya. Die trockenen Grasbüschel auf den Dünen raschelten im Nachtwind. Das Boot, in dem wir von der Stadt hierhergerudert waren, hatten wir nur drei, vier Schritte auf das flache Meeresufer gezogen, um im Falle eines Angriffs schnell entkommen zu können.
Stille.
Was hatte Tayeb gehört?
Mein Herz raste. Meine Hand verkrampfte sich um den Griff des Dolches, den ich unter dem arabischen Gewand trug. Trotz der kühlen Brise rann mir der Schweiß über das Gesicht.
»Werden wir verfolgt?«
Mit einer Geste gebot Tayeb mir zu schweigen und starrte weiter in die Finsternis. Seine Augen funkelten im Licht der Sterne.
Zugegeben, ich war jedes Mal aufgeregt, wenn ich mich auf Schatzsuche begab. Wenn ich mich durch den Staub einer Klosterbibliothek wühlte, um verlorene Schätze zu entdecken. Doch in dieser Nacht suchte ich nicht nach verschollenen antiken Handschriften, sondern nach dem größten Schatz der Menschheit, der seit Jahrhunderten verloren war: der berühmten Bibliothek von Alexandria.
Tayeb schob sein Schwert zurück und zog den Schleier der Tuareg bis unter das Kinn. »Ich wollte dich nicht erschrecken, Alessandra!«, flüsterte er. »Aber ich dachte, ich hätte etwas gehört.«
Ich legte ihm die Hand auf den Arm. »Lass uns weitergehen, Tayeb. Wir haben nur wenig Zeit.«
»Bism’ Allah!« Tayeb berührte die silberne Amulettkapsel mit den Koranversen an seinem Turban. Dann stapfte er durch den tiefen Sand am Strand entlang.
Bevor ich mich umwandte, um ihm durch das Ruinenfeld zu folgen, warf ich einen Blick zurück.
Es war schon spät, doch Al-Iskanderiya war noch hell erleuchtet. Die Staubwolke, die der Wind aus der nahen Wüste heranwehte, legte sich wie ein geheimnisvoller Schleier aus purpurnem Licht über die Stadt. Für die Muslime war dies eine Winternacht des Jahres 842. Die orthodoxen Christen begingen an diesem 24. Dezember 1438 die Geburt des Erlösers. Während der abendlichen Weihnachtsmesse waren Tayeb und ich durch die Gassen des Souks zum Hafen geeilt. Doch war es uns wirklich gelungen, unserem Verfolger zu entkommen?
Ich sah zum Hafenkai hinüber. Wie viele antike Gebäude war der Pharos nur noch eine Ruine. Vor über hundert Jahren war er nach einem Erdbeben eingestürzt. Und dort drüben hatte die von König Ptolemaios gegründete Bibliotheca Alexandrina gestanden. Die bedeutendste Akademie der Welt, in deren lichtdurchfluteten Lesesälen und schattigen Wandelgängen die berühmtesten Wissenschaftler geforscht und gelehrt hatten.
Ptolemaios, der Alexander dem Großen bis nach Indien folgte und sich nach dessen Tod zum Pharao von Ägypten machte, hatte einen Brief an die Herrscher des Erdkreises gerichtet, damit sie ihm alle Bücher der Welt für seine Bibliothek schickten. Ptolemaios hegte einen Traum, nicht weniger großartig als der seines die Welt erobernden Freundes: das gesamte Wissen von Himmel und Erde vereint an einem Ort. Jede Schriftrolle, die an Bord eines fremden Schiffes nach Alexandria kam, wurde kopiert – nur die Abschriften wurden den Besitzern zurückgegeben. Bald umfasste die Bibliothek Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Papyrusrollen.
Ein Rätsel hielt mich seit Jahren in Atem: Wohin war der kostbarste Schatz der Menschheit, die sechshunderttausend Bücher umfassende Bibliotheca Alexandrina, verschwunden?
»… und auch Plutarch …« Ich hatte das Werk des griechischen Historikers aus dem Bücherregal gezogen und aufgeschlagen vor Cosimo auf den Tisch gelegt. »… auch er berichtet, dass die Bibliothek 48 vor Christus zerstört worden sei, als Caesar während des Bürgerkrieges zwischen Kleopatra und ihrem Bruder die Schiffe im Hafen von Alexandria in Brand steckte.«
Cosimo, der mich stirnrunzelnd beobachtet hatte, nickte ernst. »Ich weiß, was Plutarch geschrie…«
»Doch weder Caesar noch Cicero oder Philon von Alexandria erwähnen die angebliche Vernichtung der größten Bibliothek der Welt.«
Mit verschränkten Armen hatte Cosimo sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt. Ahnte er, worauf dieser Disput in seinem Studierzimmer hinauslief?
Wie oft hatten wir solche Gespräche geführt, bevor ich nach Venedig abreiste, um in den Dachkammern des Dogenpalastes eine andere verschollene Bibliothek zu suchen, oder nach Montecassino oder Rom! Doch diesmal hatten meine Argumente den bitteren Beigeschmack einer Rechtfertigung meiner vermutlich monatelangen Abwesenheit aus Florenz. Ich konnte nicht bleiben! Ich durfte es nicht!
»Ich halte die Geschichte vom Brand der Bibliothek für eine infame politische Intrige«, hatte Cosimo erwidert.
Wie mein Vater Luca d’Ascoli, der ›Fürst der Buchhändler‹, wollte Cosimo de’ Medici Florenz zur geistigen Erbin von Alexandria als bedeutendster Stadt der Gelehrsamkeit machen. Luca handelte mit Büchern, die wir in Klöstern und Bibliotheken entdeckt und kopiert hatten und deren Abschriften er an Gelehrte in aller Welt verkaufte. Cosimo sammelte mit aller Leidenschaft Bücher und gab jedes Jahr ein Vermögen aus, um neue Manuskripte zu erhalten.
»Senecas Behauptung, durch den Brand wären vierzigtausend Schriftrollen vernichtet worden, bezieht sich nicht auf die königliche Bibliothek. Und die von den Kirchenvätern überlieferte Zerstörung im Jahr 391 durch fanatische Christen war nicht vollständig gewesen. Ein muslimischer Historiker berichtet, die arabischen Eroberer hätten im Jahr 640 die Bücher verbrannt, weil der Kalif befohlen hatte, alle Werke zu vernichten, die dem Koran widersprachen. Doch ich bezweifle, dass alle Bücher zerstört wurden.«
»Du glaubst also, dass ein Teil der Werke der Bibliothek von Alexandria noch existiert?«
»Wenn nicht die Originale, dann Abschriften. Wenn nicht in griechischer Sprache, dann als arabische Übersetzung.«
Und ich ahnte, wo sich die Bücher befanden.
Vor drei Jahren hatte mein Vater versucht, diesen geheimnisumwitterten Ort im Herzen der Wüste zu erreichen, und war gescheitert. Tayeb, der muslimische Gelehrte aus Agadez, hatte ihm das Leben gerettet und ihn zurück nach Florenz begleitet. Seit Lucas Rückkehr lebte er in unserem Haus an der Piazza del Duomo.
Eines Tages würde ich diese gefährliche Reise wagen, um die verlorenen Schätze zu suchen. Aber auch eine lange Reise bis ans Ende der Welt beginnt mit einem ersten Schritt. In Alexandria. In den Ruinen des antiken jüdischen Viertels, des Zentrums der rabbinischen Gelehrsamkeit.
»Du bist also entschlossen, nach Ägypten zu reisen?«, hatte Cosimo leise gefragt.
Ich hatte genickt.
»Wann?«
»Morgen früh«, hatte ich gestanden. »Ich werde Florenz im Morgengrauen verlassen und von Pisa nach Alexandria segeln.«
Er war enttäuscht gewesen, das hatte ich ihm angesehen.
»Carissima, ich hatte gehofft, wir würden an Weihnachten gemeinsam nach Ferrara reiten. Nur du und ich – dein Vater weigert sich ja, während des Konzils Ferrara zu besuchen. Du könntest in der Bibliothek der Universität ein wenig Staub aufwirbeln, während ich mit dem Papst und dem Kaiser über die Verlegung des Konzils nach Florenz verhan…«
»Nein, Cosimo.« Ich hatte mit meinen Gefühlen gerungen, mit Scham und Schuld und tiefer Traurigkeit. »Es ist besser, wenn wir uns einige Wochen lang nicht sehen. Ich muss in Ruhe nachdenken.«
»Weiß Luca, wo du letzte Nacht warst?«
Ich hatte den Kopf geschüttelt. »Nein, Cosimo. Aber du kennst den Inquisitor. Ich kann seine Fragen nicht beantworten. Und ich will sein entsetztes Gesicht nicht sehen, wenn er die Wahrheit erfährt. Ich will mich nicht vor Luca rechtfertigen, und ich will auch nicht, dass du es tust. Deshalb werde ich morgen früh abreisen.«
Mit Tränen in den Augen hatte ich »Leb wohl!« geflüstert. Dann war ich aus seinem Arbeitszimmer geflohen.
Ich folgte Tayeb in Richtung des Maryut-Sees, der zwischen den Dünen im Sternenlicht schimmerte.
Wie unscheinbar, wie bedeutungslos Al-Iskanderiya im Vergleich zum alten Alexandria war! Die von den Arabern errichteten Stadtmauern schützten nicht einmal die Hälfte der antiken Metropolis. Weite Ruinenfelder umgaben die Stadt. Was war von der Weltstadt des Altertums geblieben? Einstürzende Ruinen. Ein Raub der Wellen und des Windes.
Die aus dem Sand ragenden Säulen und Mauern erinnerten mich ein wenig an das Forum Romanum. Und doch, so dachte ich, als ich eine Düne hinunterglitt, war dieses Ruinenfeld anders als das Forum: Die umgefallenen Säulen und zerbrochenen Gewölbebögen lagen alle in einer Richtung. Sie waren nach Süden gekippt, als hätte eine gewaltige Flutwelle vom Meer sie erfasst und mit sich gerissen.
Stolpernd kämpfte ich mich den weggleitenden Abhang einer Sanddüne hinauf, die sich im Windschatten einer Ruine gebildet hatte. Das Gebäude, das bis zum Dach im Sand vergraben lag, schien sehr groß zu sein.
Eine Synagoge?
Tayeb erwartete mich an dem Mauerspalt, den wir gestern entdeckt hatten. Die Tasche mit dem Seil und den Kerzen lag neben ihm im Sand. Werkzeug wie Schaufeln und Brecheisen hatten wir nicht mitgeschleppt.
Das Deckengewölbe war vermutlich während eines Erdbebens gerissen: Einige Quadersteine waren herabgestürzt.
»Ich gehe zuerst!«
»Das dachte ich mir«, meinte Tayeb trocken. Er verknotete das Seil um meine Taille und spähte hinunter in die Tiefe. »Dort unten gibt es Skorpione.«
»Ich weiß.«
»Ich weiß, dass du’s weißt. Pass auf, wo du hintrittst.«
Er schlang das Seil um seine Schultern, um mich durch den Gewölberiss hinabzulassen.
Rückwärts kriechend tastete ich mit den Füßen nach einem festen Halt. Kühler Sand rieselte in meine Sandalen. Der Wüstenwind hatte Flugsand in den Mauerriss geweht. Im Inneren des Gebäudes hatte sich ein Abhang gebildet, auf dem ich nun in einer Lawine aus Staub hinabrutschte. Dann hatte ich den Boden erreicht und löste das Seil, das Tayeb hochzog.
Es war heiß und stickig. Und finster wie in Dantes Inferno. Ich schlug Feuer und entzündete eine Kerze.
Der Boden war ellenhoch mit Sand bedeckt. Wenige Schritte entfernt ragte ein Haufen geborstenen Holzes aus dem Sand – ein Lesepult oder eine Kanzel?
Die Ruine war so groß wie eine Kirche. Zwei Reihen schlanker Säulen trennten die Seitenschiffe ab und trugen eine Galerie, die zum Teil eingestürzt war. Das Gebäude war …
Mit der Kerze in der Hand stolperte ich an der zerstörten Kanzel vorbei zum Ende der Halle.
… war eine Synagoge!
Ich stapfte weiter.
Dort in der Wandnische hatte der Tora-Schrein gestanden. Er war vermutlich durch das Erdbeben zerstört worden, das die Synagoge so stark beschädigte, dass sie aufgegeben wurde.
Mein Blick fiel auf etwas Weißes zu meinen Füßen.
Eine Muschel!
Ich wusste, wie sie in die Synagoge gekommen war …
Der orthodoxe Patriarch hatte mich am vorigen Freitag empfangen. Philotheos wollte die Tochter des berühmten Fra Luca d’Ascoli kennenlernen, des ›Richters Gottes‹, der während des Konzils in Konstanz drei Päpste abgesetzt und die Kirche geeint hatte. Ich hatte Seiner Seligkeit von meiner Suche nach der Bibliotheca Alexandrina erzählt und ihn gebeten, mir Zutritt zu seiner Bibliothek zu gewähren, wo ich lateinische und griechische Geschichtswerke studieren wollte – wie das von Ammianus Marcellinus, dem bedeutendsten spätantiken Historiker. Sehr eindringlich hatte er die Katastrophe beschrieben, die Alexandria im Juli 365 vernichtet hatte:
Vor Sonnenaufgang hatten Blitze den Himmel erleuchtet, und ein furchtbares Erdbeben hatte die Stadt erschüttert. Hunderte Gebäude waren eingestürzt, und auch der Königspalast und die Bibliothek waren beschädigt worden. Das Meer hatte sich bis zum Horizont zurückgezogen und den Meeresboden freigelegt, so weit das Auge reichte. Hilflos zappelten die Fische im feuchten Schlamm. Im Hafen von Alexandria lagen die Schiffe auf dem Trockenen. Die Menschen, entsetzt und verängstigt über das starke Erdbeben und das unerklärliche Zurückweichen des Meeres, standen am ehemaligen Strand und starrten wie gebannt zum fernen Horizont. Eine Welle raste auf die Stadt zu. Je näher sie kam, desto gewaltiger wurde sie. Schiffe wurden mitgerissen und zerbrachen in der hochspritzenden Gischt. Mit furchtbarer Wucht ergoss sich die Flutwelle in die Stadt und riss alles mit, was das Erdbeben zuvor zerstört hatte. Boote wurden zwei Meilen weit in die Wüste getragen. Der Palast der Ptolemäer versank im Hafenbecken. Fünfzigtausend Menschen ertranken in den wirbelnden Fluten.
Ich bückte mich und hob die Muschel auf.
Das Erdbeben und die nachfolgende Flutkatastrophe hatten diese Synagoge so stark beschädigt, dass sie seither verlassen war. Würden wir in der Genisa, der Schriftenkammer, überhaupt noch etwas finden, das die Fluten nicht vernichtet hatten? Nur wenn die Papyrusrollen und Pergamentcodices, wie in der Antike üblich, in Tonkrügen versiegelt waren.
Ich kehrte zum Durchschlupf im Gewölbe zurück und bohrte meine Kerze in den Sand. »Tayeb!«
Ein Schatten hob sich dunkel und bedrohlich gegen den Sternenhimmel ab.
Als er nicht sofort antwortete, wurde ich unruhig: Waren wir doch verfolgt worden? Wer war der junge Mann, der uns seit unserer überstürzten Abreise aus Florenz auf den Fersen war? Wer hatte ihn geschickt?
Meine Hand zuckte zum Dolch. »Tayeb?«
»Wen erwartest du heute Nacht sonst noch?«, fragte er, während er sich zu mir herunterließ. Dann stand er neben mir und klopfte sich den Staub aus den Falten seines Gewandes.
»Wir müssen die Genisa suchen. Handschriften, die den Gottesnamen enthalten, werden nicht weggeworfen, sondern in einer Schriftenkammer begraben. Vielleicht finden wir dort Papyri aus der Bibliotheca Alexandrina.«
Mit den Kerzen schritten wir an der Synagogenwand entlang bis zum zerborstenen Tora-Schrein. Doch außer dem verschlossenen Eingangsportal und einer eingestürzten Steintreppe, die einst zur Galerie hinaufgeführt hatte, konnten wir nichts entdecken.
»Da ist eine Tür!« Tayeb wies auf den Haufen aus Flugsand, über den wir in die Synagoge hinabgestiegen waren.
Durch den tiefen Sand stapfte ich auf die andere Seite des Gebetssaals. Tayeb hatte Recht: Der Flugsand hatte eine Tür verschüttet. Nur der obere Teil war noch sichtbar.
Rätselhafte Dokumente in vergessenen Dachkammern und zugemauerten Kellergewölben, verschlossene Türen in Klosterbibliotheken, geheimnisvolle Schatztruhen, deren Schlüssel verloren waren, verborgene Gänge und Treppen im Vatikan – alles Verbotene zog mich magisch an! Je mehr Staub und Spinnweben ich beiseitefegen musste, um ein Mysterium zu erforschen oder um eine spektakuläre Entdeckung zu machen, desto größer der Nervenkitzel. Und der Spaß!
Ich bohrte meine Kerze in den Dünenhang und schaufelte den Sand mit beiden Händen von der Tür weg. Sobald ich ein paar Handvoll zur Seite geschoben hatte, rutschte neuer Sand nach. »So geht es nicht!«
»Ein Brett könnte den Sand seitlich der Tür aufhalten.« Tayeb erklomm die unter seinen Sandalen weggleitende Düne und stellte sich mit weit ausgebreiteten Armen neben die Tür. »So, siehst du? Wenn das Brett in diesem Winkel befestigt wird, fließt der Sand in diese Richtung.« Er wies zum gegenüberliegenden Seitenschiff. »Wir könnten einen der Torflügel aus den Angeln heben, zur Düne schleppen und im rechten Winkel neben der Tür verkeilen, sodass der Sand uns beim Freilegen der Tür nicht behindert.«
»So machen wir’s.«
Es gab nur ein Problem: Das Tor war vermutlich seit elf Jahrhunderten verschlossen – von außen! Und das Gebetshaus lag bis zum Deckengewölbe im Flugsand begraben.
Ich ging zum Portal, um es zu untersuchen. Die eisernen Scharniere waren morsch und rostig, die Holzbohlen vermodert und an einigen Stellen abgesplittert. Ich zerrieb einen Holzsplitter zwischen meinen Fingern und schnupperte daran. Er roch verrottet.
Ich zog meinen Dolch und bohrte ihn ins Holz. »Wenn wir die Scharniere freilegen, können wir die Nägel herausziehen. Sobald sie die Tür nicht mehr halten, wird sie uns durch den Druck des Sandes dahinter entgegenfallen.«
Die Frage, was angesichts der Verwüstung in der Synagoge mit den Handschriften in der Genisa geschehen war, schluckte Tayeb mit einem frechen Grinsen herunter. Offenbar glaubte er nicht ernsthaft daran, dass wir auch nur einen Fetzen Papyrus finden würden. Dennoch wollte auch er jetzt nicht aufgeben.
Und ich? Ich litt unter einem akuten Anfall des Schatzsucherfiebers. Die Symptome: Herzklopfen, Rastlosigkeit, Entschlossenheit, mich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen, und eine fast ekstatische Euphorie.
Ein unheilbares Leiden!, wie Cosimo bemerkt hatte.
Tayeb lehnte sich gegen das Portal, während ich die letzte Befestigung löste und das Scharnier, das die Tür gehalten hatte, zur Synagogenwand zurückschob. Es quietschte wie die beiden anderen. Das Salz des Meeres hatte das Eisen rosten lassen. Und wieder fragte ich mich, in welchem Zustand die Papyri waren – falls wir welche fanden. Würde die jahrhundertealte Tinte überhaupt noch lesbar sein? Oder erinnerten die modrigen Papyrusfasern nur noch an eine Handvoll Seetang, der mit dem letzten Sturm an den Strand gespült worden war?
Unter dem Druck des Sandes neigte sich der Torflügel. Tayeb stemmte beide Beine in den tiefen Sand, doch seine Ledersandalen begannen wegzugleiten. Er ächzte vor Anstrengung. Mit aller Kraft drückte ich gegen das Portal. Tayeb drehte sich um und lehnte sich mit ausgestreckten Armen dagegen.
»Jetzt!«
Wir sprangen zur Seite und ließen gleichzeitig los. Das Portal krachte in den Sand und wirbelte ihn hoch. Mit einem letzten Aufflackern erloschen die Kerzen. Es wurde finster.
Hustend zog ich meinen Schleier vor Mund und Nase, um mich vor dem aufgewirbelten Staub zu schützen. Neben mir hörte ich Tayeb keuchen.
Und da war noch ein Geräusch.
Ein leises Rauschen.
Ich hielt den Atem an: Skorpione?
Irgendetwas huschte über meine Sandalen. Panisch sprang ich einen Schritt zurück. Mit dem Saum meines Gewandes riss ich die Kerzen um. Heißes Wachs spritzte über meine Füße und verursachte brennende Schmerzen.
Oder waren es Skorpionstiche?
Mit zitternden Fingern tastete ich nach meinem Feuerzeug und schlug einen Funken. Dann entzündete ich das erste Licht und sah mich um.
Eine Sandlawine floss durch das geöffnete Portal in den Gebetssaal. Sie verursachte das leise Rauschen, das mich in Panik versetzt hatte. Erleichtert atmete ich auf – bis ich eine Sandviper in der Finsternis verschwinden sah.
»Wir müssen den Torflügel aus dem Sand ziehen, bevor er völlig verschüttet ist«, drängte Tayeb und wies auf den immer noch nachrutschenden Sand. »Pack mit an! Wir schleppen ihn zur Düne.«
Stolpernd zogen wir das schwere Portal um den Haufen aus Flugsand herum und wuchteten es mit letzter Kraft hinauf zur verschütteten Tür.
Nachdem wir das Tor aufgerichtet hatten, sanken wir erschöpft in den Sand. Tayeb reichte mir den Schlauch mit Wasser. Durstig trank ich. Ich betrachtete die Tür. Und wenn die Genisa eingestürzt war? Dann wären auch die Tonkrüge mit den Papyri zerstört.
»Na komm!« Tayeb half mir auf.
Er lehnte sich gegen den aufgerichteten Torflügel, der im nachrutschenden Sand immer wieder wegzugleiten drohte.
Nach wenigen Minuten hatte ich fast die Hälfte der Tür freigelegt. Ich versuchte sie mit der Schulter aufzuschieben, doch sie ließ sich nicht öffnen.
»Vielleicht ist sie verriegelt«, vermutete Tayeb. »Oder die Kammer dahinter ist eingestürzt, und Sand und Steine blockieren die Tür. Oder …«
»Vielleicht lehnt sich der Erzengel Djibril mit ausgebreiteten Flügeln gegen die Tür, um zu verhindern, dass wir die verschollene Bundeslade finden«, stieß ich hervor.
Die Vorstellung, dass der Erzengel Gabriel sich mit aller Kraft gegen die Tür stemmte, erheiterte Tayeb. Lachend lehnte er sich gegen den schwankenden Torflügel, der ihm beinahe entglitten und in den Sand gekracht wäre.
Ich ließ mich auf die Düne zurücksinken, hob beide Beine und trat mit aller Kraft zu.
Mit einem Knirschen ruckte die Tür eine Handbreit.
Ich richtete mich auf.
Die Tür war offen, wenn auch nur einen Spaltbreit!
Dann sah ich es: Der lockere Flugsand rieselte durch den Spalt und drohte die Tür erneut von der anderen Seite zu blockieren. Mit Gewalt trat ich gegen das Holz.
Die Tür öffnete sich ein wenig mehr.
Und noch mehr Sand rieselte in den Raum dahinter.
Wieder stieß ich zu. Und noch einmal. Bis der Spalt breit genug war, damit Tayeb und ich hindurchschlüpfen konnten.
Dann zwängten wir uns durch die schmale Türöffnung in den dahinter liegenden Gang. Das Ende des Korridors war in sich zusammengefallen. Sand und Quadersteine bedeckten den Boden.
Doch dann entdeckte ich die Tür in der linken Seitenwand. Sie hing schief in den Angeln. Mit einem kräftigen Stoß schob ich sie auf und leuchtete in die Finsternis. Stufen, die nach unten führten. Noch mehr Sand und Steine, die ein Wasserbecken füllten. Eine Wand war eingebrochen.
»Das war das Ritualbad«, murmelte ich enttäuscht.
Hatte die Genisa am Ende dieses eingestürzten Ganges gelegen? Mit beiden Händen wischte ich mir den Schweiß und den Staub aus dem Gesicht. »Morgen werden wir uns erneut auf die Suche machen. So schnell gebe ich nicht …«
»Komm und sieh dir das an!«
Ich kehrte in den Gang zurück. Tayeb lehnte an der gegenüberliegenden Wand, die …
Überrascht blinzelte ich im flackernden Kerzenschein und sah genauer hin.
… die ein Loch hatte!
»Ich bin gestolpert und mit der Schulter gegen diese Lehmziegelwand gestoßen. Dabei haben sich diese Steine verschoben und sind in den Raum dahinter gefallen, siehst du? Die Ziegel sind nur locker aufeinander geschichtet, um einen Durchgang zu verbergen.«
»Der Eingang zur Genisa!«
Vorsichtig entfernten wir einen Stein nach dem anderen.
Welchen Zweck hatte die Mauer aus Lehmziegeln? Hatte jemand nach dem Erdbeben und der Flut vom Juli 365 den Durchgang verschlossen, damit die verborgene Kammer nicht entdeckt wurde? Mit klopfendem Herzen kniete ich mich vor das Loch in der Wand, schob den Arm mit der Kerze bis zur Schulter hindurch und spähte in den Raum dahinter. Das Licht der Kerze blendete mich. Aber dort, an der gegenüberliegenden Wand, waren das nicht …
»Tonkrüge zur Aufbewahrung antiker Schriften!«, rief ich. »Die Genisa ist noch unberührt!«
Mühsam rang ich meine Ungeduld nieder, zog den Schleier vom Gesicht und schnupperte. Hoffentlich hatte sich kein Schimmel auf dem Papyrus gebildet!
Tayeb und ich brachen die Lehmziegel aus der Wand und warfen sie in den Gang. Dann krochen wir nacheinander in die Kammer.
Muscheln ragten aus dem Sand. Die Flutwelle war bis in die Genisa geströmt. Fußspuren führten von der Tür zu den Tonkrügen an der gegenüberliegenden Wand. Wie alt mochten die Sandalenabdrücke sein?
Ich blinzelte empor zur gewölbten Decke, deren Gewicht auf den Quadersteinen der eingestürzten Wand gegenüber dem Eingang ruhte. Unter dem Druck des Flugsandes waren einige der Gewölbesteine gerissen. Sie drohten herabzustürzen und das gesamte Gewölbe mit sich zu reißen. Wir durften nicht länger als nötig in der Genisa bleiben!
Die Steinquader der geborstenen Wand hatten mehrere Tonkrüge zertrümmert, deren Scherben auf dem Boden verteilt lagen. Zahlreiche Rinnsale aus feinem Sand hatten sich in die Kammer ergossen. Und dazwischen, im Staub verborgen …
»Papyrus!«, flüsterte Tayeb.
Ich kniete mich vor die zwei Ellen hohen Tonkrüge.
Tayeb entzündete mehrere Kerzen und hockte sich neben mich. »Die Gefäße ähneln der Amphore, die uns der jüdische Antiquitätenhändler im Souk angeboten hat. Du weißt schon: der Tonkrug, der angeblich aus der antiken Stadt Oxyrhynchos stammte.«
Ich zog einen der Tonkrüge zu mir heran. »Dieses Gefäß ist noch versiegelt!« Mit meinem Dolch hebelte ich den mit Wachs verschlossenen Deckel auf. Dann drehte ich die Amphore um und ließ den Inhalt in meinen Schoß gleiten. Ein in Leder gebundener und verschnürter Codex! Noch unversehrt! Außerdem rieselten die Reste eines Papyrus aus dem Tonkrug.
Ganz behutsam schlug ich das Buch auf, um die ersten Zeilen zu lesen. Der Text war in griechischer Schrift auf das Pergament gepinselt worden. Tayeb hob seine Kerze, damit ich lesen konnte.
»Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, des Sohnes Gottes.« Mein Blick flog über die nächsten Zeilen. »Das ist das griechische Markus-Evangelium.«
»Ein christliches Evangelium in einer jüdischen Synagoge?«
»Markus predigte in den Synagogen von Alexandria«, murmelte ich und starrte gedankenverloren auf den Pergamentcodex in meinen Händen, auf die Papyrusfasern aus dem Krug und auf die mit Lehmziegeln verschlossene Tür der Genisa. »Der Codex stammt nicht aus dem ersten Jahrhundert, sondern ist später, im dritten oder vierten Jahrhundert, abgeschrieben worden.«
Die Papyrusrollen, die oft etliche Ellen lang waren, waren am Ende des ersten Jahrhunderts durch die handlicheren Codices ersetzt worden. Die von den Christen verwendete Bibel bestand aus vielen Schriftrollen und war sehr umständlich zu benutzen. Ein Codex war praktischer zu lesen, problemloser zu transportieren und während einer Christenverfolgung leichter zu verstecken. Dieser Pergamentcodex war vermutlich im vierten Jahrhundert verfasst worden. Und er steckte in einem Tongefäß, das Reste einer viel älteren Papyrusrolle enthielt.
Erneut irrte mein Blick zu den Lehmziegeln am Eingang der Kammer. Warum versteckte ein Christ ein von der Kirche anerkanntes Evangelium in der Genisa einer verlassenen Synagoge? Wieso versiegelte er die Kammer mit Lehmziegeln? Warum musste alles so schnell gehen, dass nicht genug Zeit blieb, eine Mauer aus Steinquadern zu errichten, die das Versteck schützte?
Die Tonkrüge mussten noch etwas anderes enthalten! Werke, die die Kirchenväter nach der Festlegung des Bibelkanons als häretisch verdammten. Das Evangelium des Basilides, der geschrieben hatte, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben war? Das Thomas-Evangelium? Das Judas-Evangelium? Alle diese häretischen Texte waren im Lauf der Jahrhunderte verschollen.
»Alessandra?«
Und wenn sie nun in dieser Genisa versteckt worden waren, um sie vor der Vernichtung zu bewahren? Sollten die Schriften später, wenn die Gefahr der Verfolgung vorüber war, an einen anderen Ort gebracht werden?
»Alessandra! War da nicht ein Geräusch?« Tayeb wandte sich zum Eingang der Kammer um.
»Ich habe nichts gehört.«
»Du würdest im Augenblick nicht einmal mitbekommen, wenn die Synagoge hinter dir einstürzt«, frotzelte er und sprang auf, um mit seiner Kerze in den Gang zu leuchten. »Nichts zu sehen.« Er hockte sich wieder neben mich. »Vielleicht war’s eine Sandviper.«
Besorgt sah ich mich nach Schlangen und Skorpionen um. Dann blickte ich zu den gerissenen Gewölbesteinen empor: Wir sollten uns nicht allzu lang in der Kammer aufhalten und unser Leben riskieren.
»Der Codex stammt also aus dem vierten Jahrhundert?«
»Genau. Im ersten und zweiten Jahrhundert sind sehr viele Evangelien entstanden. Der Kirchenvater Irenaios, der um das Jahr 180 Bischof von Lyon war, war verbittert, weil viele Häretiker Bücher verfassten, die nicht mit dem wahren Glauben übereinstimmten. Im zweiten Jahrhundert lasen die christlichen Gemeinden unterschiedliche Evangelien. Das Johannes-Evangelium wurde nicht in allen Gemeinden als wahr anerkannt, und in Ägypten war das Thomas-Evangelium sehr beliebt.
Irenaios von Lyon hatte eine großartige Vision: Er wollte eine Kirche erschaffen, die nur einen Glauben hatte. Entschlossen ging er ans Werk: Er versuchte die Häresien in seinem monumentalen Buch zu widerlegen. Er rief die Gläubigen zur Vernichtung der ketzerischen Schriften auf und erklärte von den vielen Evangelien nur vier für wahr, weil sie angeblich von den Aposteln Matthäus, Markus, Lukas und Johannes verfasst worden seien.«
»Sieh mal einer an. Dann war es also der Bischof von Lyon und nicht ein römischer Papst oder ein byzantinischer Kaiser, der für alle Zeit festlegte, woran ein Christ glauben muss und woran nicht. Und was die unveränderliche und ewige Wahrheit ist.«
»Du hast es erfasst. Aber was mich wirklich wütend macht, ist die Tatsache, dass Irenaios die Gläubigen ermahnte, den Priestern zu gehorchen, da sie angeblich Nachfolger der Apostel sind und die Wahrheit kennen. Mit anderen Worten: unfehlbar sind!«
»Luca war auch …«
»Mein Vater hat sich das Denken niemals verbieten lassen – nicht als Inquisitor, nicht als Stellvertreter des Papstes in Rom! Nein, Tayeb, es waren die Priester, die immer Recht haben wollen, weil ihnen Gehorsam geschuldet wird, die mich, ein dreijähriges Kind, in den Kerker der Inquisition gesperrt haben.«
Schmerzhafte Erinnerungen überfielen mich.
Düsterer Fackelschein … Bewaffnete, die mich in eine finstere Zelle schleppten und brutal auf den Boden stießen … Dominikaner in schwarzweißen Habites, die mir wehgetan hatten … Die verzweifelten Schreie meiner Mutter unter der Folter … Das angsterfüllte Gesicht meines Vaters, des Inquisitors von Rom, der über uns richten sollte.
Ich fuhr mir über das Gesicht und erzählte weiter: »Athanasios, der Patriarch von Alexandria, war ein glühender Bewunderer von Irenaios. Zum Osterfest 367 belehrte er die Gläubigen über die Texte, die er als von Gott inspiriert ansah: die Evangelien und Briefe des Neuen Testaments, wie es noch heute existiert. Alle anderen Schriften, die die Menschen angeblich in die Irre führten, weil sie dem Glaubensbekenntnis widersprachen, sollten vernichtet werden. Auf dem Konzil von Nikaia im Jahr 325 war Jesus durch Abstimmung der Bischöfe – mit zwei Gegenstimmen! – und per Dekret des Kaisers Konstantin zum Gott erhoben worden. Unzählige Bücher müssen damals in Ägypten verbrannt worden sein: gnostische Evangelien und vielleicht auch Papyrusrollen aus der Bibliotheca Alexandrina.«
Tayeb deutete auf die versiegelten Amphoren. »Du glaubst, dass nicht alle Gläubigen dem Befehl zur Bücherverbrennung gehorchten.«
»Genau. Irgendjemand brachte diese Tonkrüge in die leer geräumte Genisa der verlassenen Synagoge, um sie hier zu verstecken. Niemand würde die ketzerischen Schriften hier suchen – es war ja lebensgefährlich.«
»Das ist es immer noch«, erinnerte mich Tayeb ernst.
»Das stimmt«, gab ich zu, meinte jedoch nicht die Gefahr des Einsturzes der Genisa. »Die Kirche verbrennt noch immer Schriften, die der offiziellen Lehre widersprechen. Dabei geht es nicht um den wahren Glauben. Es geht, um mit Irenaios’ Worten zu sprechen, um den Gehorsam der Gläubigen. Um es mit meinen Worten zu sagen: Es geht um Macht, die mit Gewalt gerechtfertigt wird.«
Mein Blick blieb an einem Papyrusfetzen hängen, der aus einem der zerstörten Tonkrüge ragte. Ein Stein aus der geborstenen Wand der Genisa hatte das Gefäß zerbrochen und den Papyrus zerfetzt. Ein paar Schnipsel lagen zwischen den Scherben, der Rest ruhte vermutlich unter dem Quader.
Ich hob ein Fragment auf.
Die Seitenränder waren ausgefranst. Ein tiefer Riss teilte es in zwei Teile, die nur noch von einzelnen Papyrusfasern zusammengehalten wurden. Das Material war sehr brüchig. Im Schein der Kerzen versuchte ich, die verblasste Schrift zu entziffern. Es war ein griechischer Text.
Das kann nicht sein!, dachte ich, als ich die ersten Worte las.
Beinahe hätte ich das Fragment fallen gelassen.
Jesus sprach: Werdet Vorübergehende
»Dieser Spruch findet sich nicht in den Evangelien!« Meine Stimme bebte vor Aufregung.
Vorsichtig wendete ich den Papyrusschnipsel, um die Rückseite zu betrachten. Auch sie war beschrieben:
»›Jesus sprach: Kein Prophet ist …‹ – dann folgt ein unleserliches Wort – ›… in seinem Dorf. Kein Arzt heilt …‹ – wieder ein paar verblasste Buchstaben.« Ich holte tief Luft und las erneut: »›Jesus sprach: Kein Prophet ist angenommen in seinem Dorf. Kein Arzt heilt die ihn kennen.‹«
Stürmisch umarmte ich Tayeb und warf ihn dabei fast um. »Weißt du, was das bedeutet?«
»Keine Ahnung«, gestand er verwundert.
Ich wies auf die Tonscherben und Papyrusfetzen vor uns im Sand. »Wir haben ein neues Evangelium gefunden!«
»Das freut mich!«, hörte ich eine Stimme mit römischem Akzent hinter mir.
Erschrocken ließ ich Tayeb los.
Im Eingang der Genisa stand der junge Mann mit den dunklen Augen, der uns seit unserer Abreise aus Florenz verfolgt hatte. Er war groß und schlank – ein durchtrainierter Kämpfer. Das Schwert, das er in der Hand hielt, funkelte im Licht der Kerzen.
»Und ich würde mich noch mehr freuen«, fügte er mit ausgestreckter Hand hinzu, »wenn Ihr es mir nun übergeben würdet.«
Niketas
Kapitel 2
»Sophia – Weisheit!«, rief der Diakon, als er das Evangelium über seinen Kopf hob, um es den Gläubigen zu zeigen. »Steht aufrecht!«
Ich erhob mich von meinem Sessel neben dem Patriarchen und half ihm auf.
»Evcharistó!«, flüsterte er, als er meine Hand ergriff und mit beiden Händen drückte. »Ich danke Euch, Niketas!«
Der Kaiser erhob sich von seinem Purpurthron.
Während der Chor die Hymne sang, legte der Diakon das Evangelium zurück auf den Altar. Als ich die goldbestickten Gewänder raffte und die Stufen zum Hochaltar emporstieg, um die Weihnachtsmesse zu zelebrieren, empfand ich nichts als stille Traurigkeit.
Nachdem der Diakon den Altar, den Patriarchen und mich beräuchert hatte, verkündete ich den Gläubigen das, was sie für das Wort Gottes hielten. Während ich die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium nach Lukas sang, ließ ich meinen Blick über die Hunderte orthodoxen Gläubigen schweifen, die in die Kirche San Francesco von Ferrara geströmt waren, um die Geburt ihres Erlösers zu feiern.
Mit geschlossenen Augen, als wäre er eingenickt, war der Patriarch auf seinem Sessel zusammengesunken. Joseph war alt und gebrechlich. Sein durch mönchische Enthaltsamkeit geformtes Gesicht hinter dem langen weißen Bart war bleich, und die schlichte schwarze Soutane und seine Haube mit dem schwarzen Schleier unterstrichen seine Totenblässe noch. Nur seine funkelnden blauen Augen verrieten, dass noch feurige Glut unter der Asche brannte – Temperament, Leidenschaft und ein eiserner Wille, sich Papst Eugenius nicht kampflos zu unterwerfen.
»Und der Engel sprach zu den Hirten: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Denn euch ist heute ein Retter geboren, er ist Christus, der Kyrios.«
Der Patriarch hatte die Augen geöffnet und beobachtete, wie ich nun feierlich von Jesus Christus als dem Erlöser sang. Er sah mir in die Augen, bis tief hinein in meine Seele, doch ich hielt seinem Blick stand, während ich weiter aus dem Gedächtnis zitierte: »Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Frieden …«
Als ich an diesem Nachmittag vor dem Altar der Kirche des Konvents liegend betete, hatte der Patriarch mich herausgerissen aus der Stille. Vor zehn Tagen hatte ich mich in das Dominikanerkloster von Ferrara zurückgezogen, um mich zu besinnen. Und um den furchtbaren Gewissenskonflikt zu lösen, der mir den Verstand zerfetzte.
Der Patriarch war zu mir ins Kloster gekommen, um mich zu bitten, an seiner Stelle den Gottesdienst in San Francesco zu halten. Er sei zu gebrechlich, um die Anstrengungen der sechsstündigen Messe zu ertragen.
Die Sorge hatte in seinen Augen geschimmert, als er mich mit gefalteten Händen von meinem Schreibtisch aus beobachtete, wie ich mich auf das Bett meiner Zelle sinken ließ und mir mit beiden Händen über das Gesicht fuhr.
Wie konnte er mich derart bedrängen! Er wusste doch, dass ich mit Gott um eine Entscheidung rang!
»Ihr werdet mich würdig vertreten, mein Sohn.«
Als ich nicht antwortete, hatte er milde gelächelt:
»Vielleicht werdet Ihr bald Patriarch sein, Niketas.«
»Es gibt würdigere Priester als mich, die anstelle Eurer Allheiligkeit die Weihnachtsmesse zelebrieren können!«, missachtete ich seinen Herzenswunsch, den ich ihm nicht erfüllen konnte – nicht gegen mein Gewissen. »Die Metropoliten von Ephesos und Nikaia sind die ranghöchsten …«
»Wenn der Erzbischof von Ephesos die Messe hält, ist das ein Affront gegen den Papst!«, mahnte er. »Niketas, Ihr wisst, wie sich Markos Eugenikos vor kurzem gegen den Primat des Papstes ausgesprochen hat … und wie der Papst während der letzten Konzilssitzung Blitz und Donner gegen unseren Freund Markos schleuderte. Ihr wart es doch, der durch eine beherzte Rede die erhitzten Gemüter auf griechischer wie auf lateinischer Seite besänftigte und so mutig verhinderte, dass zornige Bannflüche hin- und herflogen.
Sogar der Papst hat Euch aufmerksam zugehört, ohne Euch ins Wort zu fallen. Er schätzt Euch als einen Mann, der Verantwortung übernehmen kann und will, als einen besonnenen, aber nicht minder resoluten Hirten, der eine Herde aufgescheuchter Erzbischöfe, Metropoliten und Kardinäle beruhigen und ermahnen kann. Nein, Niketas, Seine Majestät der Kaiser wünscht, dass Ihr den Gottesdienst zelebriert.«
»Ich hatte den Basileus gebeten, mich bis Anfang Januar ins Kloster zurückziehen zu dürfen, um meinen Seelenfrieden wiederzufinden. Diesen Wunsch hat er mir gewährt!«
Patriarch Joseph, der Sohn des bulgarischen Zaren und einer byzantinischen Prinzessin, hatte das mönchische Leben geliebt. Der ehemalige Metropolit von Ephesos, seit nunmehr dreiundzwanzig Jahren Patriarch von Konstantinopolis, hatte sich als junger Mann in das Kloster auf dem Berg Athos zurückgezogen. Joseph, der mich seit meinem achten Lebensjahr kannte, konnte sehr gut nachempfinden, wonach ich mich sehnte.
»Und ich will auch, dass Ihr die Messe haltet!«, hatte er besänftigend auf mich eingeredet. »Niketas, habt Erbarmen mit einem alten, kranken Mann, und tut mir den Gefallen. Und vor allem: Tut ihn Euch selbst. Nein, bitte lasst mich ausreden, mein Sohn! Ich kenne Eure Zweifel – wie oft haben wir darüber gesprochen!
Besinnt Euch darauf, was Ihr seid, Niketas: ein Mensch, der irren kann. Aber vor allem seid Ihr ein geweihter Priester! Gott wird Euch an der Hand nehmen und Euch den rechten Weg zeigen. Haltet fest am Glauben! Neben Markos Eugenikos und Basilios Bessarion seid Ihr der brillanteste Kirchengelehrte von Byzanz. Ich kann Euch nichts lehren, was Ihr nicht selbst viel besser wisst. Als Euer Patriarch kann ich Euch nur ein liebevoller Vater sein, der Euch von ganzem Herzen rät: Achtet nicht auf die gotteslästerlichen Einflüsterungen Eures Freundes, Rabbi Natanael.« Er hatte schwermütig geseufzt. »Einen Juden zu Eurem Sekretär und Vertrauten zu machen! Wie konntet Ihr das tun!«
»Natanael ist wie ein Bruder für mich.«
»Niketas, ich flehe Euch an: Besinnt Euch!«
»Das habe ich getan, Allheiligkeit«, hatte ich gestanden. »Ich bin ein verirrtes Schaf, das die Herde weit hinter sich gelassen und sich allein durch das Dornengestrüpp gekämpft hat.«
»Kennt Ihr das Gleichnis vom verlorenen Schaf, Niketas? ›Wenn ein Hirte hundert Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er nicht die neunundneunzig im Pferch und geht das irrende suchen? Und wenn er es findet, freut er sich nicht mehr über dieses eine als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben?‹« Er hatte meine Hand ergriffen. »Lasst mich Euer Hirte sein, Niketas. Lasst mich Euch zur Herde zurückbringen.«
»Das verirrte Schaf hängt schwer verletzt im Dornengestrüpp fest. Je länger es um seine Freiheit ringt, desto tiefer bohren sich die spitzen Dornen in sein Fleisch.«
»Ich werde es befreien und seine Wunden liebevoll versorgen. Ich werde seinen Schmerz lindern und mich um dieses leidende Schaf kümmern, bis es wieder aus eigener Kraft auf der Weide herumspringen kann – so wie früher.«
Sollte ich es ihm sagen? Nach Liebe sehnte ich mich, nach Herzenswärme und Geborgenheit, nicht nach Mitleid oder nach Vergebung meiner geistigen Verirrung.
Doch dann hatte ich mich ihm schweren Herzens anvertraut: »Vielleicht stirbt das Schaf, während Ihr noch versucht, es aus den Dornen zu befreien.«
»O mein Gott!« Meine Hand hatte er nicht losgelassen. »So schlimm ist es?«
»Rabbi Natanael ist nicht nur mein Freund, sondern auch mein Arzt. Ich vertraue seiner Diagnose.«
»Ihr seid noch so jung, Niketas: erst fünfunddreißig. Was könntet Ihr noch alles erreichen! Sollte die Kirchenunion während dieses Konzils zustande kommen, könntet Ihr eines Tages sogar Papst werden, der erste griechische Papst seit Jahrhunderten. Dann könntet Ihr diese Niederlage von Ferrara, die Unterwerfung der orthodoxen Kirche und den demütigenden Kniefall des byzantinischen Kaisers vor dem römischen Papst, in einen triumphalen Sieg verwandeln! Niketas, mein lieber Junge! Von ganzem Herzen werde ich Gott anflehen, Euch noch nicht zu sich zu rufen!«
»Eure Gebete um mein Seelenheil werde ich benötigen, Allheiligkeit. Denn heute Morgen habe ich mich entschieden …«
Die dichten Weihrauchschwaden verursachten mir einen leichten Schwindel. Schwer lastete die mit Edelsteinen geschmückte Krone auf meinem Kopf, das steife Brokatgewand behinderte mich. Ich war erschöpft und sehnte mich nach der Ruhe meiner Klosterzelle.
Besorgt beobachtete mich der Kaiser, als ich nun, nachdem mir der Diakon das gewichtige Evangeliar abgenommen hatte, mit meiner Auslegung der Heiligen Schrift begann.
Obwohl ihm die eisige Winterkälte in Ferrara Schmerzen bereitete, hielt sich der Basileus sehr aufrecht auf dem Thron. Die Gicht plagte ihn derart, dass er kaum laufen konnte und in die Kirche getragen werden musste. Er trug die perlenbestickte und golddurchwirkte Purpurrobe, die ebenso steif und schwer war wie mein Ornat, die kaiserlichen Purpurstiefel und eine goldene Krone mit langen Schnüren von Perlen, Rubinen und Saphiren, die bis auf seine Schultern herabfielen.
Neben ihm saß sein Bruder Demetrios. Auch er ließ mich nicht aus den Augen – allerdings weniger aus brüderlicher Besorgnis, als vielmehr in der Hoffnung, ein erneuter Ohnmachtsanfall könnte mich in aller Öffentlichkeit stürzen lassen. Hatte Demetrios dem Diakon befohlen, derart viel Weihrauch zu verbrennen?
Der hoch gewachsene Mann neben ihm war mir nicht vorgestellt worden. Er hatte auf dem Sessel Platz genommen, der dem Protokoll nach Niccolò d’Este, dem Herrscher von Ferrara, zustand – doch der Marchese hatte es vorgezogen, an der lateinischen Weihnachtsmesse des Papstes in der Kathedrale teilzunehmen. Er trug eine lange, scharlachrote Robe aus Florentiner Tuch und eine Haube in derselben Farbe. Ein Siegelring war das einzige Abzeichen seiner Macht. Wer war er?
Nachdem ich meine Predigt beendet hatte, begann die Feier der Eucharistie. Der Chor intonierte den Hymnus der Cherubim, während der Diakon den Altar, die Weihnachtsikone, die Priester und mich beweihräucherte. Anschließend trugen der Diakon und ich den Teller mit dem Brot und den Kelch mit dem Wein zum Altar.
Nach dem Glaubensbekenntnis hob ich die Decke, mit der Teller und Kelch zugedeckt waren, und bewegte sie feierlich über den Gaben. Diese Handlung symbolisiert das Wehen des Heiligen Geistes. Gewiss würde Kardinal Cesarini, der offenbar auf Wunsch Seiner Heiligkeit an der Messe teilnahm, sofort nach dem Ende des Gottesdienstes zu Papst Eugenius eilen, um ihm zu berichten, dass ich dem orthodoxen Ritus gemäß das Filioque weggelassen hatte. Das Filioque war einer der Streitpunkte des Konzils – die Frage, ob der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausging, was die lateinische Kirche behauptete, die griechische jedoch leugnete.
»Lasst uns Dank sagen dem Herrn!« Ich sprach die Einsetzungsworte des Abendmahls und hob den Teller mit dem gesäuerten Brot: »Nehmt und esst! Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird zur Vergebung der Sünden.« Dann nahm ich den Kelch. »Trinkt alle daraus! Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.«
Ich betete die Anrufung des Heiligen Geistes, wie ich es schon tausend Mal getan hatte, und vollzog die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut von Jesus Christus. Aber es fiel mir unendlich schwer. Ich konnte nicht mehr an den Sinn der Eucharistie glauben. Ich bezweifelte die Göttlichkeit Jesu Christi. Ich glaubte nicht mehr, dass ich in apostolischer Nachfolge sein Stellvertreter auf Erden war.
Nach dem Vaterunser nahm ich das Brot und aß es, dann führte ich den Kelch zu den Lippen und trank vom Wein.
Nicht nur mein Gewissen quälte mich. Mir war schwindelig vom Weihrauchduft, und ich hatte starke Kopfschmerzen.
Dann geschah es.
Plötzlich war alles wieder so bestürzend klar, die Farben leuchteten so intensiv, und das Gold schimmerte so hell! Funken aus Licht tanzten vor meinen Augen und behinderten meine Sicht. Der Schmerz in meinem Kopf wich einer fast orgastischen Ekstase. Und da war wieder dieses himmlische Gefühl vollkommener Stille und seelischer Ruhe. Ein Empfinden von Freude und Glück, ja von göttlichem Segen. Ich fühlte mich so feinsinnig, so inspiriert und so lebendig!
Dann verwehten diese wundervollen, sinnlichen Gefühle, und zurück blieb wieder nur der Schmerz und die Traurigkeit. Und das Leiden an der Ohnmacht des langsamen Sterbens.
Ich zitterte am ganzen Körper und hatte Mühe, mich auf den Beinen zu halten. Mit beiden Händen musste ich mich am Altar festhalten. Um ein Haar hätte ich mit den Ärmeln meines Ornats den Kelch mit dem Wein zu Boden gerissen.
Ein bestürztes Raunen wehte durch die Kirche.
Einer der Priester stützte mich unauffällig.
»Es geht schon!«, dankte ich ihm und wies den Diakon an, das Brot in den Wein zu versenken.
»Glut des Glaubens, Fülle des Heiligen Geistes. Amen!«, rief der Diakon, während er das heiße Wasser in den Kelch goss. Und dann: »Nähert Euch in Gottesfurcht, Glauben und Liebe!« Anschließend folgte er mir mit dem Kelch und dem Silberlöffel, als ich die Altarstufen zum Thron hinabstieg, um dem Kaiser die Kommunion zu erteilen. Zwei Priester wichen nicht von meiner Seite.
Der Basileus erhob sich und erwartete mich mit über der Brust gekreuzten Händen und demütig gesenktem Haupt. Während Ioannis das in Wein getauchte Brot nahm, das ich ihm auf dem Silberlöffel darbot, hielt der Diakon ein weißes Seidentuch unter sein Kinn. Dann tupfte er damit die Lippen ab und bot ihm den Teller mit dem Antidoron dar, dem nicht konsekrierten Brot.
Der Basileus küsste andächtig den Kelch und nahm ein Stück des Brotes. Bevor er sich auf seinen Thron sinken ließ, umarmte er mich und küsste mich auf beide Wangen. »Komm nach der Messe zu mir. Wir müssen reden.«
Ich nickte stumm, warf dem Mann im scharlachfarbenen Gewand einen Blick zu und wollte mich dem Patriarchen zuwenden, als der Basileus mich am Arm festhielt.
»Du bist blass, Niketas. Ein neuer Anfall?«, sorgte er sich. »Mein Gott, ich fürchtete schon, du würdest am Altar zusammenbrechen. Soll ich Basilios Bessarion bitten, die Eucharistiefeier fortzusetzen?«
»Nein«, winkte ich ab. »Es wird schon gehen.«
Ich trat zum Patriarchen, um Seiner Allheiligkeit den Silberlöffel mit dem in Wein gelösten Brot darzubieten. Anschließend schritt ich die Reihen der Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Priester entlang, die im Gefolge des Kaisers und des Patriarchen nach Ferrara gekommen waren, um mit dem Papst über die Kirchenunion zu verhandeln. Nach dem Dankgebet und dem Segen kehrte ich zur Anbetung des Kreuzes an den Altar zurück.
Demetrios trat heran, um sich vor der Ikone des thronenden Pantokrators dreifach zu bekreuzigen, das Kreuz zu küssen und kniend meinen Segen zu empfangen. Dem jüngeren Bruder des Basileus folgte Kardinal Cesarini.
Vor anderthalb Jahren hatte er den Vorsitz des von Papst Eugenius als häretisch verdammten Konzils von Basel niedergelegt. Anschließend war er nach Florenz zurückgekehrt, um sich mit dem Papst auszusöhnen – wahrlich keine leichte Entscheidung für den Kardinal, denn unter seiner Federführung hatte sich das Konzil von Basel angemaßt, über dem Pontifex zu stehen. Nach der Beendigung des römischen Schismas vor zweiundzwanzig Jahren in Konstanz drohten nun die Basler Konziliaristen, die römische Kirche erneut auseinanderzureißen.
Giuliano Cesarini war ein heißblütiger Redner, mit dem ich mir während der Konzilssitzungen so manches Wortgefecht geliefert hatte, das jedoch niemals, wie bei anderen Kardinälen der florentinischen Kurie, zur Schlammschlacht entartete. Ein beherzter Mann, der für seinen Glauben stritt. Ein wahrhaftiger Mann, der Fehler wie seinen jahrelangen Vorsitz in Basel eingestehen und sich dafür beim Papst entschuldigen konnte. Ich schätzte ihn als großen Gelehrten und mochte ihn als Mensch.
Andächtig kniete der Kardinal in seiner purpurfarbenen Soutane nieder, berührte das Kreuz mit den Lippen und erhob sich. »Gewährt Ihr mir den Friedenskuss, Euer Seligkeit?«
Ich nickte. »Gewiss, Euer Eminenz!«
Er küsste mich auf beide Wangen. »Buon Natale!«
»Frohe Weihnachten!«
»Ich war überrascht, als Seine Heiligkeit mich wissen ließ, dass Ihr die orthodoxe Messe haltet«, gestand er. »Wolltet Ihr nicht bis Epiphanias in Klausur gehen?«
»Der Patriarch fühlte sich nicht wohl und bat mich, ihn zu vertreten. Morgen kehre ich ins Kloster zurück.«
»Wie schön für Euch – und wie bedauerlich für mich.« Er lächelte charmant. »Papst Eugenius bat mich, den römischen Primat mit Euch zu diskutieren. Er hätte gern gewusst, ob Ihr den Vorschlägen, die er dem Konzil in der nächsten Sitzung unterbreiten will, zustimmen würdet. Er will Eure Meinung hören, als orthodoxer Theologe und als einer der einflussreichsten Würdenträger der griechischen Kirche.«
Ich hob die Augenbrauen. »Warum fragt Seine Heiligkeit mich dann nicht selbst nach meiner Haltung zur römischen Vorherrschaft?«
»Nach der letzten Sitzung … nun ja, wie soll ich es sagen?«, wand er sich. »Nach Eurer leidenschaftlichen Rede ist er … ist er … Ach, was soll’s! Ich sag’s Euch, wie es ist: Er achtet Euch sehr. Und er schätzt Eure Ansichten und die Art und Weise, wie Ihr sie im Konzil vertretet. Aber nach Eurer Rede während der letzten Sitzung ist er verunsichert, wie Ihr reagieren würdet, wenn er Euch zum Abendessen unter vier Augen einlädt.«
»Bitte richtet Seiner Heiligkeit aus: Ich werde kommen. Unter einer Bedingung. Wenn ich ihm in einem vertraulichen Gespräch meine Meinung darlege, tue ich das nicht offiziell als Delegierter der orthodoxen Kirche, als Vertreter des Patriarchen oder als Berater des Kaisers. Über meine persönlichen Ansichten kann er jedoch bei einem Becher Wein ganz nach Belieben mit mir diskutieren.«
Kardinal Cesarini nickte zufrieden. »Das ist eine akzeptable Bedingung.«
»Wie schön! Dann freue ich mich auf seine Einladung nach Epiphanias.«
Ich bot ihm das Antidoron an, die nicht konsekrierten Reste des Abendmahlsbrotes, die auch von nichtorthodoxen Gläubigen empfangen werden durften. Doch er lehnte dankend ab und verabschiedete sich mit einem liebenswürdigen »Buona notte!«.
Den Mann im scharlachroten Gewand, der während der Messe neben dem Basileus gesessen hatte, quälten keine solchen Bedenken. Er nahm das Brot, das ich ihm reichte. »Möge das Schisma, das die griechische und die lateinische Kirche trennt, nach vier Jahrhunderten endlich beendet werden.« Als ich ihn verwirrt ansah, lächelte er. »Es tut mir leid, dass Seine Majestät der Kaiser noch keine Gelegenheit hatte, mich Eurer Seligkeit vorzustellen. Ich bin Cosimo de’ Medici.«
Kein selbstbewusstes ›Ich bin der Bankier des Papstes‹, kein stolzes ›Ich bin der Bannerträger von Florenz und regiere die mächtigste Republik Italiens‹. Nur ein schlichtes ›Ich bin Cosimo de’ Medici‹.
Er mochte um die fünfzig sein. Ein aufrechter Mann mit zurückhaltenden Gesten und einem festen Händedruck. Sein Gesicht hätte fast asketisch gewirkt, wären da nicht die feinen Lachfältchen in den Augenwinkeln gewesen. Vom ersten Augenblick an war er mir sehr sympathisch.
»Ich freue mich, Euch kennenzulernen, Exzellenz.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite!«, versicherte er mir. »Der Basileus hat mich gebeten, mich an Euch als Vertreter Seiner Allheiligkeit des Patriarchen zu wenden. Seine Majestät der Kaiser deutete an, dass Ihr Euch während der Feiertage in Klausur in einem Dominikanerkloster befindet. Würdet Ihr mir in den nächsten Tagen eine Audienz gewähren?«
»Sehr gern!« Ich bemühte mich, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen: Meine Rückkehr in den Konvent würde ich um einen Tag verschieben müssen. »Die vorweihnachtliche Fastenzeit ist beendet. Ich wäre glücklich, Euch morgen Abend zum Essen in meinem Haus begrüßen zu dürfen, Exzellenz – ich meine: falls Ihr keiner Einladung an den Tisch des Kaisers folgt. Der Metropolit von Nikaia, mit dem ich den Palazzo teile, wird vermutlich mit uns speisen.«
»Ich danke Euch für die Einladung, Euer Seligkeit, die ich mit dem größten Vergnügen annehme!« Dann beugte er das Knie, küsste meine Hand und erhob sich wieder. Mit einer eleganten Verbeugung trat er zurück.
Wieso hatte ihn der Basileus an mich verwiesen? Er wusste doch, dass ich in Klausur gegangen war, um in Ruhe nachzudenken. Warum wollte er nach der Messe mit mir reden? Hatte der Patriarch ihn vor dem Gottesdienst wissen lassen, wie ich mich entschieden hatte?
Während die Gläubigen die Kirche verließen, folgte ich dem Diakon zur Sakristei, um den priesterlichen Ornat abzulegen.
Als ich die Kammer betrat, lehnte Natanael mit verschränkten Armen an einer der Truhen.
Mein Bruder trug einen langen schwarzen Gelehrtentalar, auf dem der in Italien vorgeschriebene gelbe Judenkreis aufgestickt war. Ich hatte versucht, beim Bischof von Ferrara eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken, um Natanael diese Demütigung zu ersparen, aber der hatte mich kalt lächelnd auf die Beschlüsse des Laterankonzils von 1215 verwiesen, das die Juden zum von Gott verworfenen Volk erklärte. Seine Selbstgerechtigkeit und sein Hochmut hatten mich erzürnt. Natanael war tief verletzt, doch er hatte mich davon abgehalten, den Papst um einen Dispens zu bitten.
Schweigend beobachtete er, wie ich die schwere Krone vom Kopf hob und sie dem Diakon reichte. Dann fuhr ich mir mit beiden Händen durch das schulterlange schwarze Haar und schloss für einen Moment die Augen.
»Wie geht es dir?«, fragte er schließlich. Seit meinem Rückzug ins Kloster nach der letzten Konzilssitzung hatten wir uns nicht gesehen.
Mit einem Wink entließ ich den Diakon. »Ich werde den Ornat selbst ablegen. Kali nichta – gute Nacht!«
Er kniete nieder und küsste meine Hand. Bevor er die Sakristei verließ, warf er einen finsteren Blick auf den jüdischen Rabbi. In all den Wochen seit dem tragischen Tod meines Sekretärs Athenagoras hatte er sich nicht damit abfinden können, dass Natanael nun dessen Platz in meinem Gefolge einnahm. Leise schloss er die Tür hinter sich und ließ uns allein.
»Es geht mir gut«, murmelte ich und nahm die Kette mit dem Panagia-Medaillon ab. »Die zehn Tage im Kloster waren sehr erholsam.«
»Du bist so blass, Niketas. Und so schmal wie ein Asket«, sorgte sich Natanael. »Haben die Dominikaner dir nichts zu essen gegeben?«
»Ich habe das vorweihnachtliche Fasten gehalten«, erinnerte ich meinen Freund, der auch mein Arzt war.
»In deinem Zustand!«, ermahnte er mich ernst. »Niketas, du solltest alles vermeiden, was dich schwächt.«
»Die Ruhe im Kloster hat mir gutgetan, Natanael. Ich hatte keinen neuen Anfall.« Ich zog das Omophorion von der Schulter und betrachtete es. Das mit Kreuzen bestickte Brokatband war das Abzeichen meines Ranges. Würde ich es je wieder anlegen?
»Ich war heute Nachmittag im Konvent, um dir mitzuteilen, dass Cosimo de’ Medici nach Ferrara gekommen ist«, begann Natanael. »Doch der Prior hat mich freundlich, aber bestimmt abgewiesen: Du hättest ausdrücklich befohlen, niemanden zu dir zu lassen. Selbst einen Boten des Basileus habe er eine halbe Stunde zuvor wegschicken müssen.«
»Ich wollte nicht gestört werden. Das war doch gerade der Sinn meines Aufenthaltes im Dominikanerkloster.«
»Und wie konnte der Patriarch dich dann bewegen, die Messe zu halten?«
»Er kam zu mir in die Klosterzelle, um mit mir zu reden.«
Mein Bruder beobachtete mich, wie ich gedankenverloren das bestickte Brokatband anstarrte. Er spürte meine Traurigkeit und schwieg eine Weile. Schließlich fragte er: »Du hast eine Entscheidung getroffen, nicht wahr?«
Ich küsste das Omophorion und legte es sorgsam gefaltet auf die Truhe. Nie wieder würde ich es tragen.
Natanael umarmte mich. »Es tut mir leid«, flüsterte er. »Es tut mir so unendlich leid, Niketas. Das war doch niemals meine Absicht!«
»Das weiß ich.«
»Ich fühle mich schuldig«, murmelte er an meiner Schulter. »Ich habe dein vollkommenes Leben zerstört. Du warst so glücklich als Mönch, als Priester, als Me…«
»Natanael!«, unterbrach ich ihn sanft. »Gib nicht dir die Schuld! Es ist meine Entscheidung!«
Er nickte stumm.
»Vergib mir, Natanael. Ich weiß, wie enttäuscht du bist. Aber ich kann nicht gegen mein Gewissen handeln.«
»Ist schon gut«, beteuerte er. »Hast du es dem Patriarchen gesagt?«
»Ja, er weiß es.«
»Was hat er geantwortet?«
Ich atmete tief durch. »Wir kennen uns schon so viele Jahre. Er hat mich zum Priester geweiht. Er bedauerte meinen Entschluss. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich nicht nur meinen Gelübden gehorchen muss, sondern vor allem meinem Gewissen.«
»Ich bezweifle, dass der Kaiser das genauso sieht!«
Basilios hatte die Sakristei betreten und schloss nun leise die Tür hinter sich. Seit unserem Noviziat im Basilianerkloster war ich eng mit Basilios Bessarion befreundet. Er war sechsunddreißig, ein Jahr älter als Natanael und ich. Der Metropolit von Nikaia trug die schwarze Soutane und die Schleierhaube, auf seiner Brust funkelten das Kreuz und das Panagia-Medaillon.
»Selten habe ich eine so würdige Messe erlebt wie diese«, bekannte er, während er mich umarmte. »Du warst so inspiriert, Niketas! Wie leidenschaftlich du gepredigt hast. Alle hast du in deinen Bann gezogen. Deine Predigt war eine Glanzleistung – denn ich bezweifle, dass selbst ein brillanter Theologe wie Markos von Ephesos bemerkt hat, dass du nicht von der Geburt des Messias als Erlöser der Welt gesprochen hast, nicht vom Gott in Menschengestalt …«
»In der Krippe von Bethlehem lag kein Gott, sondern ein Menschenkind.«
Basilios schluckte. »Ich hatte so gehofft, du würdest im Kloster zur Besinnung kommen«, gestand er unglücklich. »Ich habe gebetet, Gott möge dir den Weg weisen.«
»Das hat Er getan. Ich werde meine Titel ablegen und von meinen Ämtern zurücktreten …«
»Niketas, bitte tu das nicht!«
»… und ich würde mich freuen, wenn du meine Entscheidung akzeptieren würdest, ohne sie infrage zu stellen. Als mein Beichtvater weißt du, dass ich sie mir nicht leicht gemacht habe.«
Basilios wandte sich verzweifelt ab und warf Natanael einen Hilfe suchenden Blick zu.
»Mein Gewissen gebietet mir, so zu entscheiden, denn ich glaube nicht, dass Jesus Christus zur Vergebung meiner Sünden den Sühneopfertod am Kreuz starb. Er war nicht der Sohn Gottes oder der von den Wolken des Himmels herabsteigende Engel aus der Vision des Propheten Daniel. Er war ein Gottessohn, wie du und ich und Natanael im jüdischen Sinn Gottessöhne sind: zutiefst gläubige Menschen. Nein, Basilios, lass mich bitte sagen, was ich zu sagen habe!«, bat ich meinen Freund, bevor er mir seine Argumente zur Gottessohnschaft Jesu Christi entgegenschleudern konnte. »Ich bin von ganzem Herzen Priester und mit ganzer Seele ein Diener Gottes. Aber ich kann die Eucharistie nicht mehr feiern.
Ich kann nicht mehr glauben, dass sich Brot und Wein in Leib und Blut des Christus verwandeln. Die Eucharistie kann ich nicht anders feiern denn als Gedächtnismahl für Rabbi Jeschua, den ich sehr schätze, ja sogar verehre, den ich jedoch wie Natanael nicht als Gott anbeten kann. Weil er ein Mensch war wie du und ich und Natanael: sterblich, schwach und fehlbar! Ein Umherirrender, der das Königreich Gottes herbeisehnte, das wir jedoch nur in uns selbst erschaffen können.«
Wie sehr Basilios unter meinen Zweifeln litt! Obwohl er nach dem letzten schweren Anfall, meiner verzweifelten Beichte und meinem Rückzug in die besinnliche Stille des Dominikanerklosters mit meiner Abdankung rechnen musste, hatte er die Hoffnung nie aufgegeben und für mein Seelenheil gebetet. Auch Natanael blinzelte und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
»Es ist ein schmerzhaftes Gefühl, wenn dein Glaube zerbricht«, bekannte ich. »Die Scherben zerreißen dir Herz und Seele. Du bist verzweifelt. Du stürzt, und niemand kann dich auffangen, nicht einmal deine besten Freunde, die sich doch nach Kräften bemühen. Du tastest dich durch die Finsternis, die dich plötzlich umgibt, suchst nach einem Halt, nach einem Rest von Glauben, an dem du dich wieder aufrichten kannst – als Priester und als Mensch. Aber es gibt keinen. Die Heilsgewissheit, die Erlösung durch Jesus Christus, der zur Vergebung deiner Unvollkommenheit am Kreuz starb, ist dir fortgerissen. Du bist ohnmächtig. Du zweifelst … und du verzweifelst. Und du bist ganz allein.«
Ich holte tief Luft, um die Traurigkeit niederzuringen.
»Das war die furchtbarste Erkenntnis der letzten zehn Tage: Am Ende werde ich allein sterben.« Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Basilios, du hast mich immer als einen Menschen bezeichnet, der sich der Welt entzieht, damit sie ihn nicht beherrscht. Du hattest Recht: Ich konnte die Einsamkeit und die Stille immer ertragen, habe sie sogar genossen, weil ich mich in der Meditation auf mich selbst besinnen konnte.
Und nun, da ich über meinen Tod nachgedacht habe, ist alles anders. Ohne die Geborgenheit und die Liebe unserer innigen Freundschaft kann ich nicht leben. Ich brauche euch beide, meinen Bruder Natanael und meinen Freund Basilios, damit ich bis zu meinem letzten Atemzug glücklich sein kann. Bitte verlasst mich nicht!« Ich holte tief Luft. »Und bitte akzeptiert meine Entscheidung. Unter diesen Umständen kann ich mein Amt nicht mehr ausüben. Ich weiß nicht einmal, ob ich noch Priester sein kann, ob ich überhaupt noch ein Teil der orthodoxen Kirche bin …«
»Um Gottes willen!«, stöhnte Natanael. Er gab sich die Schuld: Unsere Dispute hatten mich zu dieser Entscheidung getrieben.
»… denn falls ich nicht mehr zur Kirche gehöre, dann ist mir als Mönch die Rückkehr in mein Kloster verwehrt. Dann habe ich alles verloren: den Glauben, die Geborgenheit und die Hoffnung auf inneren Frieden.«
Basilios legte mir tröstend die Hand auf die Schulter. »Du arme, gepeinigte Seele! Wie gern würde ich deine Qualen lindern, Niketas! Aber nach all unseren endlosen Gesprächen, nach all deinen verzweifelten Beichten weiß ich nicht mehr weiter. Wie soll ich dir deine Zweifel nehmen? Ich kann dich nicht belehren: Dein Verstand, dein unstillbarer Wissensdurst, dein ständiges Zweifeln, deine Toleranz gegenüber dem jüdischen Glauben und deine … bitte verzeih, wenn ich das so sage! … deine jüdische Kindheit im Hause von Natanaels Vater haben dich in diese furchtbare Glaubenskrise gestürzt!
Orthodoxe Theologie, jüdischer Glaube, platonische Philosophie, gnostische Mystik – nichts ist dir fremd. Jedes Buch dieser Welt hast du gelesen. Aber genau da liegt dein Problem begraben: unter einem Berg von Büchern. Du weißt zu viel, um noch glauben zu können. Doch bedenke: Das Wissen ist der Feind des Glaubens. Und die Gelehrsamkeit ist das Fundament des Zweifels.« Er seufzte. »Und so wird der brillanteste Gelehrte von Byzanz zum größten Häretiker.«