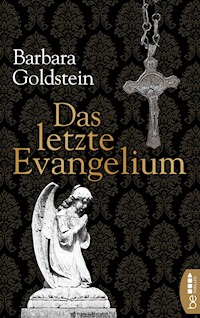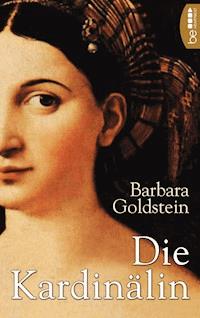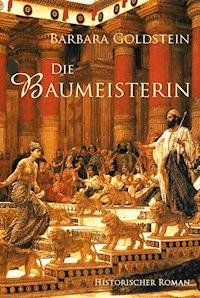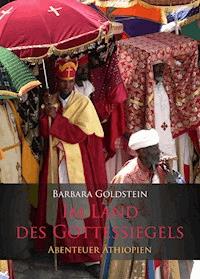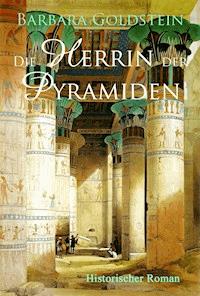7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Temur ist ein mächtiger Schamane und erfolgreicher Feldherr seines Vaters, des großen Dschingis Khan. Als sich Dschingis Khan 1206 zum Kaiser der Mongolen macht, verlässt Temur seine große Liebe, opfert seine Freiheit und wird Khan - um des Friedens willen.
Während sein Vater die Welt erobert, verzichtet Temur jedoch auf den Königstitel, um endlich frei zu sein und zu reisen: nach Peking, Samarkand, Bagdad und Delhi - doch am Ende siegt die Verantwortung über seine unstillbare Sehnsucht nach Freiheit.
Als Dschingis Khan stirbt, liegt das Schicksal des mongolischen Weltreiches in Temurs Händen, und er muss die schwerste Entscheidung seines Lebens treffen - für den Frieden oder für die Freiheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1194
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Über die AutorinTitelImpressumHinweisKartePrologKapitel 1: Der letzte FeindKapitel 2: Das Einzige, was der Mensch beherrscht,ist er selbstKapitel 3: »Ich bin wie das Wasser«Kapitel 4: Ein Gott im Himmel – Ein Herrscher auf ErdenKapitel 5: … und als Opfer die FreiheitKapitel 6: Einen abgeschossenen Pfeil hält niemand aufKapitel 7: »So sei mein Wort mein Schwert!«Kapitel 8: Jenseits des HorizontesKapitel 9: Der Sprung des TigersKapitel 10: »Du bist die Mitte meiner Welt«Kapitel 11: Das Spiel der KönigeKapitel 12: »Ich bin das Schwert Gottes!«Kapitel 13: Ash-Shah mat!Kapitel 14: Shivas TanzKapitel 15: »Ich werde frei sein!«EpilogDie handelnden PersonenStädteÜber die Autorin
Barbara Goldstein arbeitete nach dem Abitur zunächst in der Verwaltung bei japanischen und deutschen Banken, nahm dann ein Studium der Philosophie und Sozialen Verhaltenswissenschaften auf, war als Managerin in der Personalabteilung einer Bank tätig und verfasste zwei Sachbücher. Der Herrscher des Himmels ist ihr dritter Roman bei Bastei Lübbe. Wenn sie nicht für Recherchen auf Reisen ist, lebt und arbeitet sie in der Nähe von München.
Barbara goldstein
Der Herscherdes Himmels
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2007/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelbild: akg-images/Werner Forman
Umschlaggestaltung: © Atelier Versen, Bad Aibling
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0071-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Ein Verzeichnis der handelnden Personen
findet sich am Ende des Buches
Prolog
Es war ein langer Weg zurück, und er schien mir länger als mein halbes Leben. Die Reise dorthin, wo du aufgebrochen bist, um die Welt jenseits des Horizontes kennen zu lernen, ist die längste von allen. Und die einsamste, denn es ist ein Weg, den du allein gehen musst. Aber nun ist es nicht mehr weit.
Ich zügele mein Pferd.
Vor mir erstreckt sich die weite mongolische Steppe bis zu den Bergen in der Ferne, die im rotgoldenen Licht der Abenddämmerung und der kristallklaren Luft zartblau schimmern. Eine Landschaft, die mich versinken lässt in ihrer Unermesslichkeit. Während sich die Sonne über den Horizont neigt, nimmt das Steppengras jenen tiefvioletten Schimmer an, den ich sonst nirgendwo auf der Welt gesehen habe. Gott verschwendet das Licht und all seine Farben an die mongolische Steppe.
Jeder Berg, jeder Felsen, die Quellen, Seen und Flüsse atmen Lebendigkeit. Jeder Grashalm, jede Blume vibriert vor Lebenskraft. Jede Grille, jede Mücke singt ihr Lied mit einer Leidenschaft, als wäre es das letzte ihres Lebens.
Unter mir, am Fuß der Hügelkette, liegt das Lager inmitten eines Meeres von sanft wogendem Steppengras. Zwischen den weißen Jurten erleuchten die ersten Feuer die hereinbrechende Nacht. Von hier oben sehe ich mein eigenes Zelt in der Mitte des Lagers: die Palastjurte des Khans. Zwei Feuer brennen in den vergoldeten Kohlebecken vor dem offenen Eingang – als würde ich erwartet und mit aller Ehrerbietung empfangen werden, damit ich den mir zustehenden Platz auf dem leeren Thron des mongolischen Reiches einnehmen kann.
Unbeweglich sitze ich im Sattel, ein einsamer Reiter, die Hand in der Mähne des Pferdes, den Blick auf den Horizont gerichtet.
Ich muss nachdenken, bevor ich diese unvermeidliche Entscheidung treffe. Wie viele Jahre bin ich vor ihr davongelaufen? Erst jetzt, nachdem ich endlich in die Heimat zurückgekehrt bin, kann ich diesen Gedanken zu Ende denken. Ich muss in die Steppe kommen, mich auf die warme Erde legen, den unendlichen mongolischen Himmel über mir sehen, in den Farben ertrinken und diese große Stille in mich aufnehmen. Das Lied der Steppe hören, das die Grillen und Grashüpfer singen. Den betörenden Duft der Steppenkräuter riechen. Die Augen schließen. Vielleicht würde ich dann zu einem Ende kommen. Und Ruhe finden.
Müde steige ich vom Pferd und setze mich ins Gras, den Blick auf die heraufziehende Nacht gerichtet, nach Osten, wo ich ihn am heiligen Berg begraben habe: »Staub warst du, Staub wirst du sein, ewig und unvergänglich und doch nicht mehr du selbst. Die Flamme deines Lebens ist erloschen. Deine Spuren wird der Wind verwehen …«
Verzweifelt berge ich mein Gesicht in den Händen und weine lautlos in mich hinein.
Wie viele Jahre kann ein Leben haben? Ich bin erst einundvierzig Jahre alt und habe mehr erlebt als ein anderer in einem langen Leben: Ich war am Ende der Welt gewesen und dort, wo sie beginnt. Wie viele Leben hat ein Mensch? Hinter wie vielen Masken versteckt er sich? Ich war ein Khan gewesen, ein Schamane, ein Mönch und ein Eroberer, der weiß, dass er scheitern muss, immer wieder, mit jedem neuen Sieg – denn was ist die Eroberung anderes als die Überwindung der Resignation, der Verzweiflung, den Frieden nicht anders erringen zu können als durch Kriege und immer neue Kriege? Nie ist die Eroberung vollendet, immer ist sie ein Triumph, der schon am nächsten Tag zur vernichtenden Niederlage führen kann – und dann ist es, als hättest du nie gesiegt.
Und trotz aller Umwege, die ich in meinem Leben gegangen bin, nach Zhongdu und Linan, nach Samarkand und Bokhara, Bagdad und Delhi: Nach Venedig, dem Ziel meiner Träume, bin ich nie gekommen …
Es ist nicht wichtig, in welche Richtung du aufbrichst, denke ich. Es ist nicht wichtig, wie viele Umwege du machst, um zum Ziel zu kommen. Es ist nicht wichtig, wann du ankommst. Nur dass du irgendwann aufbrichst, um deinen Weg zu gehen.
Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich war. Und ich weiß, wer ich sein werde. Hier, in der mongolischen Steppe, bin ich vor einundvierzig Jahren geboren worden. Heute, da ich nach zweiundzwanzig Jahren meiner Reisen endlich hierher zurückgekehrt bin, ist mir, als würde ich noch einmal geboren werden.
Vor seiner Erleuchtung lebt der Mensch sein Leben, als wäre es sein letztes auf dieser Welt. Nach der Erleuchtung lebt er, als wäre es das allererste. Weise ist der, der weiß, dass er nichts weiß. Am Ende steht der Mensch da, wo er aufgebrochen ist. Aber er ist nicht mehr derselbe.
Ich ziehe die zerknitterte Landkarte des mongolischen Reiches hervor. Ein Pergamentfetzen fällt zu Boden, eine Seite, vor Jahren aus einem französischen Notizbuch herausgerissen. Ich halte sie fest, bevor der Wind sie fortträgt – wie meine Hoffnungen und Illusionen.
Dann entfalte ich die Landkarte und betrachte sie. Ein paar Linien auf dem Papier: Gebirge, Wüsten und das Meer – unveränderlich. Städte, die nun erobert sind – schwelende Ruinen. Staaten, die nach Jahrhunderten aufgehört haben zu existieren. An ihrer Stelle das mongolische Weltreich: eine Idee von Frieden und Freiheit, die von Bagdad im Westen bis Zhongdu im Osten reicht, von der mongolischen Steppe im Norden bis zum Yangtse im Süden. Ein Reich, erschaffen von einem Mann, der auf seiner Suche nach dem Frieden zum Schwert gegriffen hat: Dschingis Khan.
Auf der Rückseite der Landkarte lese ich die mit roter Tinte niedergeschriebenen letzten Befehle Dschingis Khans, des Herrschers der Welt. Ich kann meine eigene Handschrift kaum lesen. Nicht weil er zu atemlos diktiert hätte in der Stunde seines Sterbens, sondern weil ich geweint hatte, als ich seine letzten Worte niederschrieb. Um ihn. Und um mich selbst. Um mein Schicksal, das von ihm in seiner letzten Stunde besiegelt worden war: »Ein Gott im Himmel und ein Khakhan auf Erden. Siegel des Herrschers der Welt: Dschingis Khan«, lese ich die Inschrift seines Jadesiegels unter meiner eigenen Handschrift.
Soll ich mich seinem Befehl beugen? Soll ich tun, worum er mich mit seinem letzten Atemzug gebeten hat?
Dann zerreiße ich die Landkarte und den Willen des Herrschers der Welt in kleine Teile, die der Wind über die Steppe weht. Mein Blick folgt den Fetzen bis zum Horizont.
Meine Gedanken wehen ihnen hinterher. In eine andere Welt. In eine andere Zeit.
Nein, ich bin noch nicht zurückgekehrt aus dem Land jenseits des Horizontes. Ich bin getrennt von meiner eigenen Vergangenheit.
Ich muss ganz von vorn anfangen.
Mit geschlossenen Augen sinke ich ins Gras … breite meine Arme aus, als ob ich die ganze Welt umarmen wollte …
… und dann kommen all die verloren geglaubten, die vergessen gehofften und mit Gewalt verdrängten Erinnerungen zu mir zurück …
Kapitel 1
Der letzte Feind
Du entkommst mir nicht!«, rief ich ihr nach. Übermütig lachend galoppierte Kokatschin vor mir den Hügel hinab. Immer wieder sah sie sich um, ob ich ihr noch folgte.
Schwer atmend trieb ich mein Pferd an und stürmte hinter ihr her, hinunter zum Bach. Mein Hengst war schneller als ihrer, und so hatte ich sie bald eingeholt. Wir galoppierten nebeneinander her, so nah, dass unsere Stiefel aneinander rieben und die Steigbügel sich immer wieder verhakten. Ich beugte mich aus dem Sattel und griff nach den Zügeln ihres Hengstes, als sie das Pferd plötzlich in einem Wirbel aus Gras und Erde herumriss und in einer anderen Richtung davonstob. Ich wendete und folgte ihr.
Meine Gedanken rasten meinem galoppierenden Pferd voraus: die Vorfreude auf das, was wir tun würden, wenn …
Erneut änderte sie die Richtung, galoppierte über die blühende Steppe, setzte mit einem Sprung über den Bach, in dem sich der rotgoldene Abendhimmel spiegelte, und stürmte auf der anderen Seite einen Hügel hinauf. Mein Hengst war kräftiger als ihrer, und so hatte ich sie bald eingeholt. Ich drängte mein Pferd gegen sie, bis wir uns berührten, beugte mich vor, um ihr die Zügel zu entwinden, aber sie schlug nach mir.
Lachend wich ich ihren Schlägen aus, neigte mich zu ihr hinüber und legte meinen Arm um ihre Hüfte, um sie im Galopp auf mein Pferd zu reißen. Mit einem Ruck saß sie vor mir im Sattel. Ihr Hengst, nun ohne Reiterin, blieb hinter uns zurück.
Kokatschin hielt sich an mir fest, damit sie nicht abrutschte. Keuchend zügelte ich das Pferd.
Sie wandte mir ihr Gesicht zu, legte einen Arm um meine Schulter, als ob sie sich an mir festhalten wollte, schenkte mir ein verführerisches Lächeln und hauchte einen Kuss auf meine Lippen. Bevor ich sie festhalten konnte, glitt sie aus dem Sattel und floh erneut. Ich sprang ab und rannte ihr hinterher.
Von hinten warf ich mich auf sie, und sie fiel ins weiche Steppengras. Lachend tollten wir zwischen den Sommerblumen herum, und sie tat so, als wehrte sie sich gegen mich, indem sie mich mit Blüten bewarf.
Als ich mich erschöpft neben sie legte, um zu Atem zu kommen, drehte sie sich zu mir um, beugte sich über mich und strich mir eine Haarlocke aus der Stirn. Ich legte meine Arme um ihre Schultern und zog sie zu mir herunter. Tief atmete ich ihren betörenden Duft ein: Sie trug das chinesische Rosenparfum, das ich ihr geschenkt hatte.
Unser Kuss war stürmische Verliebtheit, gefühlvolle Zärtlichkeit, ein Aufflammen der hitzigen Leidenschaft der letzten Nacht – und er war ein Versprechen.
»Ich liebe dich, Temur!«, hauchte sie.
»Und ich …«, begann ich, doch sie küsste die Worte von meinen Lippen.
Ihr Kuss war sanft, aber fordernd. Ihre Zunge streichelte meine Lippen, und als ich sie öffnete, drang sie ein, provozierte, erregte, wollte entfliehen, ließ sich aufhalten, festhalten, spielte ihr lustvolles Spiel. Dann zog sie sich zurück und ließ mich bebend vor Erregung zurück.
Sie begann, die Verschlüsse an der rechten Schulter meiner Seidenrobe zu öffnen. Ich lag im Gras, beobachtete sie und genoss die Berührung ihrer Finger auf meiner Haut, als sie den Seidenstoff zurückschlug und zart über meine Brust strich. Ihre Nase und ihre Lippen huschten wie ein leiser Lufthauch über meine Haut, als sie mich küsste. Ihre Hände wanderten an der Innenseite meiner Schenkel hinauf, fanden, was sie suchten, glitten sanft darüber hinweg, streichelnd, liebkosend, aufreizend, kehrten zurück, dieses Mal zielsicher zupackend. Mit langsamen Bewegungen erregte sie mich weiter, bis ich mich kaum noch beherrschen und still liegen konnte. Durch die Falten meiner seidenen Hose fühlten sich die Berührungen wundervoll an.
Ungeduldig öffnete ich die Verschlüsse ihrer Seidenrobe, schob den Stoff zur Seite und liebkoste ihre Brüste. Meine Lippen umspielten die aufgerichteten Knospen, während sie sich wohlig unter mir räkelte und seufzte. Schließlich zog sie mich auf ihren bebenden Körper und öffnete sich mir.
Sanft glitt ich in sie hinein und begann mit langsamen, rhythmischen Bewegungen. Sie stöhnte lustvoll und schlang ihre Arme um meine Schenkel, um mich tiefer in sich hineinzuziehen.
»Ich liebe dich«, seufzte ich und barg mein Gesicht in ihrem offenen Haar. »Ich wünsche mir eine Tochter von dir. Eine süße kleine Tochter, die so wunderschön ist wie du, meine Geliebte!«
»Keinen Sohn, der so mächtig ist wie du?«, neckte sie mich. »So gut aussehend, so unwiderstehlich, so stark …« Sie lächelte verzückt: »… derart verliebt in die Liebe … und in mich.«
»Ich habe zwei Söhne«, erinnerte ich sie. »Willensstark und eigensinnig, wie ihr Vater – das behauptet zumindest ihre Mutter, wenn die beiden ihr Kriegsgeschrei anstimmen, weil etwas nicht nach ihrem Willen geschieht.« Ich küsste sie. »Nein, Geliebte, ich will eine Tochter von dir: still, zurückhaltend …«
Kokatschin lachte, als sei mein Ansinnen völlig undenkbar: nicht mit mir, ihrem leidenschaftlichen und temperamentvollen Geliebten, als Vater dieses Kindes!
Wir wanden uns ausgelassen im Gras, küssten uns, streichelten uns mit zärtlichen Worten, verführten uns mit einem verliebten Lächeln, erhitzten und entzündeten uns aneinander, rangen um jeden Funken der Lust, stiegen hinauf in den Himmel, höher und immer höher, errangen gemeinsam den Sieg über uns selbst. Ich gab mich ihr hin und verschenkte mich an sie. In einem Feuer der Leidenschaft ergaben wir uns unserem Schicksal: dem Abstieg in die Wirklichkeit, der Rückkehr zu uns selbst.
Als ich mich immer noch vor Lust bebend neben sie legte, schloss ich erschöpft die Augen und versuchte, die entschwindenden Gefühle festzuhalten, um mich erneut an sie zu verlieren. Aber trotz meiner geistigen Kräfte, über die ich als Schamane verfügte, trotz meiner Fähigkeiten der Selbstbeherrschung gelang es mir nicht. Sie lösten sich auf, vergingen in wohliger Entspannung.
Von ferne hörte ich das Donnern von Hufen auf dem Steppenboden. Seufzend setzte ich mich auf. Vom Lager her galoppierte ein Reiter heran. Er hatte die beiden grasenden Pferde schon von weitem gesehen und hielt auf uns zu.
Fluchend brachte ich meine Kleidung in Ordnung, erhob mich und erwartete seine Ankunft.
Dschebe zügelte sein Pferd und brachte es direkt vor mir in einem Wirbel aus Staub und Gras zum Stehen. Mein Freund grinste unverschämt, als er Kokatschin hinter mir erkannte, die sich ein paar Blüten aus den zerwühlten Haaren zog.
Kokatschin war eigentlich Dschebes Kriegsbeute aus dem Kampf gegen das Volk der Naimanen gewesen, doch als er erkannte, wie stürmisch wir uns ineinander verliebt hatten, hatte mein Freund sie mir überlassen. Nach unserer Rückkehr vom Feldzug wenige Wochen zuvor hatte er selbst unsere Hände zum ewigen Bund ineinander gelegt und uns dann zum Hochzeitsbett geleitet.
Mit vierundzwanzig Jahren war Dschebe, »der Pfeil«, der siegesverwöhnte Feldherr des Khans, das Idol aller jungen Männer und der umschwärmte Märchenprinz nicht nur der ledigen Frauen. Seine Lippen verzogen sich zu einem anzüglichen Grinsen: »Ich hoffe, ich konnte dich retten, bevor Kokatschin über dich herfällt, dir die Kleider vom Leib reißt …«
»Um mich zu retten, hättest du früher kommen müssen«, gab ich missgelaunt zurück. »Was ist geschehen? Kann ich nicht einmal für zwei Stunden verschwinden, ohne dass man mir den besten Feldherrn des Khans hinterherschickt, um mich zu suchen?«
»Die Delegation des Kaisers von Chin ist im Lager angekommen. Ein kaiserlicher Prinz wartet im Audienzzelt«, erklärte Dschebe, unbeeindruckt von meinem Unmut.
»Ist der Khan schon zurückgekehrt?«, fragte ich.
»Nein, er ist noch nicht wieder da. Ich habe ihm einen Pfeilboten entgegengeschickt, aber keine Antwort von ihm erhalten. Offenbar hat er Wichtigeres zu tun, als einen Neffen des Himmelssohnes zu empfangen. Da bin ich hergeritten, um dich zu suchen …«
Mit einem unwilligen »Du hättest mich ja nicht unbedingt finden müssen« ging ich zu meinem Pferd und schwang mich in den Sattel.
Ich hatte mich auf ein paar sinnliche Stunden mit Kokatschin gefreut, auf ein köstliches Abendessen in ihrer Jurte, auf eine Zeit der Besinnung und des Nachdenkens, ohne Verpflichtungen, ohne Verantwortung und Zeremoniell. Dieser kaiserliche Prinz hatte mir den Abend verdorben! Aber dass noch jemand anderer diese Nacht zu einer der schlimmsten meines Lebens machen würde, konnte ich nicht ahnen …
Die Strahlen der untergehenden Sonne hatten die Wolken in Brand gesteckt und tauchten die weißen Jurten des Lagers in feuriges Licht. Tausend Jurten und mehr Pferde, als der Himmel Sterne hatte. Jenseits des Lagers wand sich der Fluss wie ein goldschimmernder Drache durch die Unendlichkeit der Steppe.
Dschebe folgte mir, als ich den Hügel hinabgaloppierte und den breiten Weg zwischen den Jurten entlangtrabte, die in großen Kreisen um das Zelt des Khans in der Mitte aufgestellt waren. Ein paar Schritte abseits des Weges wurden Stuten gemolken, ein paar Kinder trieben die Fohlen zurück auf die Weiden außerhalb des Ordu, des Zeltlagers. Von irgendwoher duftete es köstlich nach Lammbraten und frischem Brot.
Als ich vor meinem Zelt aus dem Sattel sprang, eilte einer meiner Diener herbei, um das Pferd wegzuführen und abzusatteln. Dschebe warf ihm die Zügel zu und folgte mir.
Meine Jurte, die ich allein bewohnte, war größer als die Rundzelte mit den üblichen vier oder fünf faltbaren Scherengittern, die die Wände bildeten. An den Gittern hingen bestickte Wandteppiche und ein tibetischer Thangka, ein mit Brokatstoff eingefasstes Seidengemälde mit einer Darstellung des Lebensrades, das mein Bruder Schigi mir geschenkt hatte. Darüber wölbte sich ein leichtes Gestänge aus biegsamen Pappelstämmen, die zu einem flachen Dach zusammengefügt waren. Auf den Stangen lagen mehrere Schichten dicken weißen Filzes, der die Jurte im Sommer vor Hitze und Sandstürmen und im Winter vor Kälte und Schnee schützte. Ein aufwändig bestickter Filzteppich bedeckte den Boden. In der Mitte des Raumes flackerte das Feuer, dessen Rauch durch den Dachkranz entweichen konnte. Meine Bettdecken lagen zusammengerollt neben den bemalten Truhen mit meiner Schamanenausrüstung. Am Eingang hingen mein Bogen und mein lackierter Pfeilköcher.
Während ich ungeduldig die Schulterverschlüsse meiner Robe öffnete, brachte meine Gemahlin Nomolun ein weißes Brokatgewand mit Goldstickereien und half mir in die Ärmel. Sie band mir die himmelblaue Seidenschärpe und den Gürtel mit dem mit Silber beschlagenen Schwert um, während Dschebe sich seine Trinkschale mit Airag, gegorener Stutenmilch, einschenkte. Meinem Blick wich sie aus – sie ahnte, wo Dschebe mich gefunden hatte. Und mit wem. Trotz allem, was geschehen war, wurde Nomolun immer noch eifersüchtig, wenn ich mich mit jemand anderem vergnügte. Also liebt sie mich noch!, dachte ich befriedigt und strich sanft über ihren gerundeten Bauch, während sie an der silbernen Gürtelschnalle herumnestelte. Sie war im achten Monat schwanger.
Nomolun sah zu unserem Sohn Kaidu hinüber. Der Dreijährige forderte den Feldherrn des Khans mit seinem Holzschwert zum Zweikampf heraus. Dschebe ließ sich widerstandslos gefangen nehmen und tobte mit Kaidu herum.
Chinkim, mein zweiter Sohn, spielte still und selbstvergessen mit meinem Schamanenspiegel. Ich hoffte sehr, dass er nicht die Gabe besaß und eines Tages von Gott zum Schamanen berufen wurde, so wie ich, als ich in seinem Alter war.
Ich nahm Dschebe die Schale mit Airag aus der Hand und leerte sie durstig, während Nomolun mein Schwert richtete. Dann küsste ich sie auf den Mund, sah großzügig darüber hinweg, dass auch Dschebe sie zart liebkoste, und verließ mit ihm mein Zelt. Dass meine Gemahlin und mein bester Freund mehr als eine leidenschaftliche Nacht miteinander verbracht hatten und dass Nomolun von ihm schwanger war, wusste ich. Wenn zwei Menschen sich lieben, steht es einem Dritten nicht zu, sich zwischen sie zu stellen.
Das große Audienzzelt des Khans lag nur wenige Schritte entfernt. Vor der Jurte stapelten sich Holzkisten und Ballen von chinesischer Seide, offenbar Geschenke des Kaisers von Chin, die die chinesische Karawane durch die Wüste Gobi geschleppt hatte. Als ich näher trat, öffneten die Leibwächter des Khans die Deckel der Truhen. Ich lächelte zufrieden: Silberschmuck, schimmernde Perlen, purpurrote und safrangelbe Seide, glänzende Brokatstoffe, Rosenöl, Jasmintee, kobaltblau bemaltes Porzellan und Lackdosen. Der Kaiser war offensichtlich bereit, den Frieden an der Großen Mauer teuer zu bezahlen! Vermutlich hatte der Prinz auch wieder ein paar kaiserliche Ernennungsurkunden und klangvolle Titel und anderen Ehrenschmuck im Gepäck, um der Eitelkeit von uns wilden Barbaren zu schmeicheln.
Die Bewaffneten verneigten sich respektvoll, öffneten mir den Eingang zum Audienzzelt, und ich schritt durch die Reihen der chinesischen Delegation zum goldenen Thron am anderen Ende der Palastjurte. Die meisten Gefolgsleute des Khans hatten links und rechts vom Thronsessel auf niedrigen Kissen Platz genommen. Sie erhoben sich ehrerbietig, als ich das Zelt betrat. Keiner meiner Brüder war erschienen.
Hadji Hassan as-Siddik trug wie immer einen formvollendet geschlungenen Turban und ein elegantes langes Gewand. Mit beiden Händen überreichte er mir das Beglaubigungsschreiben des Prinzen, das ich sogleich entfaltete, um einen flüchtigen Blick auf das kaiserliche Siegel zu werfen. Ich tat, als könnte ich die chinesischen Schriftzeichen nicht lesen, und gab Hassan den Brief zurück. Mit einer würdevollen Verbeugung zog sich der Finanzminister des Khans drei Schritte zurück.
Der Schamane Kökschu inszenierte einen seiner dramatischen Auftritte mit der dröhnenden Schamanentrommel, als ich ihn ungeduldig zur Seite schob, um zum Thron zu gehen.
Auf diejenigen, die Kökschu nicht – wie ich – persönlich kannten, musste sein grenzenloses Selbstbewusstsein anmaßend und überheblich wirken. Aber diejenigen, die ihn kennen und hassen gelernt hatten, wussten, dass er arrogant und hochmütig war. Seine eisblauen Augen funkelten mich hinter der schwarzen Schamanenmaske böse an, und sein langer weißer Bart, der ihm bis zum Gürtel reichte, erzitterte vor Wut, als er mir auswich. Ich war sicher,dass er sich wieder einmal beim Khan über mein respektloses Verhalten gegenüber ihm, dem Obersten Schamanen des Reiches, beschweren würde. Aber nach unserer letzten erbitterten Auseinandersetzung vor einigen Tagen konnte ich die Selbstinszenie-rung meines Lehrmeisters in der Kunst der Magie nicht mehr ernst nehmen.
Auf den Stufen des Thrones blieb ich stehen und wandte mich um. Kökschu raffte beleidigt sein langes Schamanengewand und die Reste seines Stolzes um sich und rauschte davon.
Der Prinz, der die chinesische Delegation anführte, hatte sich von seinem Faltstuhl erhoben, um mir seine Ehrerbietung zu erweisen. Hassan trat vor, um ihm als Zeichen des Willkommens einen Khadag um die Schultern zu legen, einen himmelblauen Seidenschal, der dem Beschenkten Glück verhieß.
Der Neffe des Kaisers trug eine aufwändig mit Drache und Phoenix bestickte Brokatrobe aus pfirsichgelber Seide, die sehr provozierend an das kaiserliche Gelb erinnerte, die Farbe, die allein dem Himmelssohn vorbehalten war. Stolz, geradezu herablassend begegnete er meinem Blick. Dann aber entschloss er sich doch noch zu einem Kotau, einer tiefen Verneigung, und warf sich auf den Boden. Als er sich wieder aufrichtete, erklärte er: »Ich bin Prinz Yun Qi, der Neffe Seiner Majestät des Himmelssohnes Zhang Zong, der Ihnen durch mich seine Grüße übermitteln lässt.«
Der Prinz war zehn Jahre älter als ich, also etwa dreißig Jahre alt. Vielleicht fühlte er sich mir deshalb überlegen. Er war hoch gewachsen und schlank – fast so groß wie ich, aber offenbar nicht kampferprobt und daher auch nicht so kraftvoll athletisch wie ich. Seine Bewegungen waren anmutig und geschmeidig, als sei er geübt in der Kunst des Tai Chi – ein Schwert hatte er dabei sicherlich noch nie in der Hand gehalten. Ich fragte mich, mit welchen Waffen er kämpfte, wenn nicht mit der scharfen Klinge: mit Intrige und Verrat?
Ich spielte den ungebildeten mongolischen Barbaren, der nur die Sprache des Schwertes kennt und dessen einzige sinnvolle Beschäftigung das Plündern und Morden ist. Dabei tat ich so, als würde ich sein Chinesisch nicht verstehen.
Langsam stieg ich die Stufen empor und nahm auf den Leopardenfellen und Brokatkissen des Thrones Platz, während mein Freund Hassan die Worte des Prinzen in die mongolische Sprache übersetzte. Hassan, dessen Karawanen die Handelsrouten zwischen Samarkand im Westen und Zhongdu im Osten bereisten und der seit Jahren als Finanzminister des mongolischen Reiches im Lager des Khans lebte, hatte mich Chinesisch sprechen und schreiben gelehrt.
Ohne ein Wort zu sagen, nickte ich dem kaiserlichen Neffen zu, weiterzusprechen.
»Der Himmelssohn schickt mich zu Ihnen, um seiner Freude Ausdruck zu verleihen, dass in den Ländern nördlich der Großen Mauer seit Monaten Frieden herrscht«, formulierte der Prinz umständlich eine offizielle Begrüßung.
Ich wartete die mongolische Übersetzung seiner Worte ab, dann lächelte ich höflich und schwieg.
Frieden?, dachte ich: Wann war zuletzt Frieden? Wann hatten wir Mongolen nicht gekämpft – gegen die Tataren, die Merkiten, die Kereiten und bis vor wenigen Wochen gegen die Naimanen? Wann hatten wir nicht alles riskiert, um zu überleben?
Prinz Yun Qi war verunsichert. Durch meine abwartende Haltung zwang ich ihn, schneller zur Sache zu kommen, als er geplant hatte. Aber wie konnte er mit einem Mann, der ihn stumm vom Thron herab anlächelte, über das warme Sommerwetter und die mongolischen Weidegründe plaudern? Schon die Erwähnung des offensichtlich kräftigen Zustandes unserer Pferde war aus diplomatischer Sicht bereits sumpfiges Gelände, aus dem es kein Entkommen gab.
Dschebe, der einige Schritte neben dem Thron auf einem Kissen Platz genommen hatte, unterdrückte nur mühsam ein Grinsen.
Yun Qi rang sichtlich um Haltung. Dann nahm er einen neuen Anlauf, sich in eine diplomatisch unverfängliche Unterhaltung mit mir zu stürzen: »Der Himmelssohn schickt mich, um Ihnen seine Glückwünsche zum Sieg über den Khan der Naimanen zu überbringen … und seine Hoffnung auf einen fortdauernden Frieden zwischen den Mongolen und den Chin.«
Ich sah auf: Der Khan hatte das Audienzzelt betreten.
Als er die Situation überblickte, war er im Eingang stehen geblieben und hatte seinen Gefolgsleuten zu schweigen geboten. Der Khan war wohl gerade erst ins Lager gekommen, denn er trug eine schlichte Seidenrobe ohne aufwändige Stickereien. Er gab mir ein Zeichen, mit der Audienz für den Prinzen fortzufahren: Er wollte unbemerkt im Hintergrund bleiben, beobachten, ohne beobachtet zu werden.
Ich nickte dem chinesischen Prinzen gnädig zu. »Ich werde dem Khan die Grüße des Himmelssohnes übermitteln.«
Als Hassan meine Worte übersetzt hatte, war Yun Qi für einen Augenblick sprachlos. »Sie … sind nicht Dschingis Khan?«
»Nein, Prinz Yun Qi«, erwiderte ich auf Chinesisch. »Ich bin Temur, der älteste Sohn des Khans, im Krieg sein Feldherr und im Frieden während seiner Abwesenheit sein Stellvertreter.«
Wenn Yun Qi überrascht war über meine chinesischen Sprachkenntnisse, dann zeigte er es nicht. »Prinz Temur!« Er verneigte sich erneut vor mir. »Ich will ganz offen zu Ihnen sprechen, Exzellenz. Der erhabene Kaiser Zhang Zong beobachtet besorgt die mongolischen Angriffe auf die chinesischen Grenzdörfer nördlich der Großen Mauer …«
»Es tut mir aufrichtig Leid, wenn der Himmelssohn deshalb schlaflose Nächte hat«, konterte ich.
Mein Vater grinste amüsiert, als ihm einer seiner Gefolgsleute die Übersetzung meiner Worte zuflüsterte: Er sprach kein Chinesisch.
Bring zu Ende, was du begonnen hast, Temur!, signalisierte er mir. Dräng ihn in die Enge, bis er mit dem Rücken an der Wand steht! Zeig ihm seine Grenzen!
»Dschingis Khan ist ein Vasall des Himmlischen Kaisers!«, empörte sich der Prinz.
»Mein Vater hat Kaiser Zhang Zong niemals den Vasallenschwur geleistet. Es steht ihm also frei, Krieg zu führen und Frieden zu schließen, mit wem es ihm beliebt«, belehrte ich ihn.
»Er dringt auf chinesisches Gebiet vor, um Dörfer zu plündern!«
»Und ich ungebildeter Barbar dachte immer, dass das Reich Chin an der Großen Mauer beginnt«, erwiderte ich schlagfertig. »Und dass die Steppengebiete nördlich der Mauer mongolische Weiden sind, die zum Reich meines Vaters gehören. So lautet zumindest der Friedensvertrag, den der Kaiser von Chin vor sechzig Jahren mit meinem Urgroßvater Kabul Khan abgeschlossen hat.«
»Es gibt dort chinesische Dörfer!«, protestierte Yun Qi.
»Diese Tatsache ist mir nicht entgangen. Ich habe diese Dörfer oft genug …«
»… geplündert und niedergebrannt …«, unterbrach mich Yun Qi.
»Ich habe ihre Bewohner aufgefordert, das mongolische Reich zu verlassen oder sich dem Khan zu unterwerfen«, fuhr ich unbeirrt fort. »Wie Sie wissen, existieren diese Dörfer noch.«
Yun Qi quälte ein beunruhigtes »Noch?« hervor.
»Sagen Sie Ihrem Kaiser, er soll seine Regimenter von der Mauer abziehen und mit dem Säbelgerassel aufhören, das meinem Vater den Schlaf raubt. Dann werden die Dörfer noch lange existieren.«
»Sie drohen dem Kaiser von Chin?«, fragte der Prinz, erbost über meine Unverfrorenheit.
»Der Kaiser von Chin droht dem Khan! Oder wie soll mein Vater die Anwesenheit der Regimenter hinter der Mauer anders interpretieren denn als Vorbereitung für einen Angriff auf das mongolische Reich?«
Mein Vater stand noch immer im Zelteingang und beobachtete gespannt die Reaktion des Prinzen auf meine Provokation. Der Khan wusste: Wenn der Kaiser von Chin beschloss, uns mit seinem gewaltigen Heer noch während des Sommers anzugreifen – solange wir vom letzten Feldzug noch geschwächt waren – würden wir besiegt werden. Das Reich, das mein Vater errichtet hatte, seine Vision von Freiheit und Selbstbestimmung der Mongolen würden wie Staub im Wind der Geschichte verwehen.
Yun Qi schluckte eine Antwort herunter, die entweder eine Bestätigung meiner Vermutungen oder eine fadenscheinige Rechtfertigung kaiserlicher Entscheidungen gewesen wäre. Er hatte sich zu weit auf das Schlachtfeld vorgewagt und konnte nun weder vor noch zurück.
Ich ließ ihm Zeit, sich seiner unmöglichen Lage bewusst zu werden, dann erhob ich mich vom Thron, um die Audienz zu beenden. Der Prinz würde in dieser Nacht kein Auge zutun, da war ich ganz sicher. Gelassen stieg ich die Stufen hinunter, während er sich vor mir verneigte, dankbar darüber, dass ich nicht ernsthaft eine Antwort von ihm verlangte, die ihn den Kopf kosten würde.
»Prinz Yun Qi«, sprach ich ihn an. »Würden Sie mir die Ehre erweisen, morgen Abend mit meinem Vater und mir zu speisen? Sie sind von der langen Reise durch die Steppe sicher so erschöpft, dass Sie heute Nacht ausruhen wollen.«
Bevor er widersprechen konnte, wünschte ich ihm »Ming tian jian – Wir sehen uns morgen!« und verließ das Zelt mit Dschebe, der nur mühsam ein Lachen unterdrücken konnte.
Vor der Jurte erwartete mich mein Vater mit seinem Gefolge.
Im Schein der untergehenden Sonne schimmerten seine in mehrere Zöpfe geflochtenen und von silbernen Spangen gehaltenen Haare. Seine opalblauen Augen funkelten zufrieden, als ich zu ihm trat. Er umarmte mich und küsste mich zur Begrüßung auf beide Wangen, dann legte er mir seinen Arm um die Schultern, und wir gingen in Richtung seines Zeltes. Die anderen blieben hinter uns zurück.
»Obwohl ich nicht verstanden habe, welche Unhöflichkeiten du dem Prinzen an den Kopf geworfen hast, bin ich angemessen beeindruckt«, lächelte er. »Er war sehr blass, als du ihn stehen ließest.«
»Ich habe ihn an ein paar Tatsachen erinnert, über die er bis morgen Abend in Ruhe nachdenken kann. Und ich habe ihn zum Essen in deine Jurte eingeladen.«
Mein Vater nickte, offenbar einverstanden mit meiner Entscheidung. Ich folgte ihm.
»Der Prinz wird in den nächsten Tagen Eilboten zum Kaiser nach Zhongdu schicken«, fuhr ich fort, während wir nebeneinander gingen. »Ich werde den Befehl geben, sie nicht abzufangen. Yun Qi gibt sich stolz und herablassend und spielt die Rolle des kaiserlichen Prinzen, der dem ungebildeten mongolischen Barbaren überlegen ist. Aber ich muss nur ein wenig am Lack kratzen, um zu erkennen, dass er Angst hat. Deshalb denke ich, dass es klug wäre, seine Briefe ankommen zu lassen, gleichgültig, was er über die Verhandlungen mit dir schreibt. Wenn ich die Boten abfangen lasse, könnte das als kriegerische Handlung ausgelegt werden. Botschafter sind unantastbar …«
Wieder nickte er, ohne ein Wort zu sagen.
Ich musste ihn nur ansehen, um zu wissen, dass er über etwas nachdachte, dass er eine Entscheidung treffen musste, die ihn zutiefst aufwühlte.
»Willst du darüber sprechen?«, fragte ich ihn, als wir eine Weile schweigend gegangen waren.
Er blieb stehen und sah mich erschrocken an. Er, der mächtige Dschingis Khan, fürchtete sich – aber wovor? Er wandte sich ab, ging ein paar Schritte, hielt inne, um nachzudenken, warf einen Blick in den Nachthimmel hinauf. Dann kehrte er zu mir zurück: »Ja, ich will mit dir darüber reden. Es betrifft nicht nur mich, sondern uns beide, Temur. Komm mit! Ich will dir etwas zeigen.«
Er packte mich am Ärmel und zog mich mit sich fort zu einer Jurte, die ein paar Schritte entfernt stand. Zwanzig Bewaffnete bewachten das Zelt. Sie verneigten sich vor dem Khan, als wir näher kamen. Einer der Männer schlug den Türfilz zurück. Vier Bewaffnete betraten mit gezogenen Schwertern vor uns die Jurte.
In der Mitte des Zeltes brannte ein Feuer, und meine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit jenseits des Lichtscheins gewöhnen. Ein Mann lag am hölzernen Wandgitter der Jurte und starrte mich an. »Dschamuga!«, rief ich überrascht.
Der Fürst lag an Händen und Füßen gefesselt auf dem Filzteppich, unfähig, sich aus eigener Kraft in eine sitzende Position aufzurichten.
Dschamuga war wie mein Vater dreiundvierzig Jahre alt und von ebenso majestätischer Statur. Wie ich trug er seine schwarzen Haare zu langen Zöpfen geflochten, die hinter den Ohren aufgesteckt waren und durch silberne Spangen in schulterlangen Schlaufen zusammengehalten wurden.
Er neigte den Kopf zum Gruß, als er mich erkannte. »Temur! Wie schön, dich zu sehen!«, sagte er. »Und dieses Mal nicht mit einem Schlachtfeld zwischen uns.«
Ich starrte auf ihn hinab. Dschamuga, der Fürst, der sich zum Khan wählen ließ, um meinen Vater zu stürzen. Der Freund, mit dem mein Vater sich zerstritten hatte und gegen den er seit zwanzig Jahren Krieg führte. Der letzte Feind.
Trotz der Gefangennahme seines gefährlichsten Gegners schien mein Vater keinen Triumph zu empfinden, sondern Angst. Was fürchtete er?
Befriedigung – das war es, was ich tief in meinem Innersten fühlte. Der Mann, dem ich in den letzten Jahren so oft mit gezogenem Schwert gegenübergestanden hatte, der mir immer wieder alles genommen hatte, was ich besaß, lag nun gefesselt vor mir. Wie hätte ich denn nicht zufrieden sein sollen? Der letzte Feind war besiegt. Endlich gab es eine Chance auf Frieden!
»Fürst Dschamuga, es scheint dir entfallen zu sein, dass ich derjenige war, der die Schlacht gewann, und du derjenige, der nach der Niederlage vom Schlachtfeld floh, um sich in den sibirischen Wäldern zu verstecken. Was also verschafft uns die Ehre deiner Anwesenheit in unserem Lager?«
»Ich bin von meinen eigenen Männern verraten worden. Sie haben mich ausgeliefert, um ihr Leben zu retten«, stieß er verächtlich hervor.
»Sie werden für ihren Verrat an dir bestraft und morgen hingerichtet werden. Das verspreche ich dir.«
»Mich würdest du am liebsten auch töten, nicht wahr, Temur?«, schleuderte mir Dschamuga entgegen.
»Das ist das Recht des Siegers!«, erklärte ich kalt. Meine Hand lag auf dem Griff meines Schwertes. »Und es wäre das Ende eines Krieges, der mein Leben lang gedauert hat.«
»Temur!« Mein Vater trat zwischen uns und hob die Hand. »Ich will nicht, dass du ihn richtest.«
»Wie rührend – Vater und Sohn!« Dschamuga lachte höhnisch. »Wie sehr musst du ihn lieben, Temudschin: wie einen Sohn! Temur ist der einzige deiner Söhne, auf den du dich verlassen kannst, der Einzige, dem du wirklich vertraust! So wie ich immer der Feind war, auf den du dich verlassen konntest. Ohne Temur und ohne mich wärst du immer noch der unbekannte Stammesfürst namens Temudschin, wärst du niemals zu dem geworden, was du heute bist: der mächtige Dschingis Khan!«
Dschamugas hasserfüllte Worte hatten meinen Vater getroffen wie ein Schlag ins Gesicht. »Du hast Recht, Dschamuga. Im Krieg mit dir habe ich das Kämpfen gelernt und in der Niederlage gegen dich das Aufstehen nach dem Sturz, das unbeirrte Weiterkämpfen selbst gegen die größte Übermacht, das Überleben und das Siegen. Obwohl ich immer wieder alles verloren habe, was ich besaß, bin ich am Ende der Sieger. Denn wer nicht zu verlieren gelernt hat, kann nicht Sieger sein.«
»Du hältst dich wirklich für den Sieger in unserem Streit?«, fragte der Gefangene verächtlich, und ich wunderte mich über seine Unerschrockenheit. Er musste doch wissen, welches Schicksal ihm bevorstand!
»Der Krieg ist vorbei, Dschamuga. Du wirst morgen sterben«, entgegnete mein Vater kalt.
»Der Krieg ist nicht vorbei, Temudschin. Er wird niemals vorbei sein. Du hast die mongolische Steppe erobert, einen Stamm nach dem anderen besiegt und deiner Herrschaft als Khan unterworfen. Am Ende bleiben nur noch wir beide übrig, mein Freund. Ich bin der Letzte, den du besiegen kannst. Du weißt es genau, und deshalb hast du Angst vor der Entscheidung, mich hinzurichten. Du wirst allein weitergehen auf deinem Weg in die Einsamkeit des Mächtigen, der keinen Gegner mehr hat als sich selbst. Denn diesen Gegner kannst du auf dem Schlachtfeld nicht besiegen! Der Krieg ist noch lange nicht vorbei, Temudschin. Er geht weiter, bis über meinen Tod hinaus! Ich werde dir noch im Sterben das Kostbarste nehmen, was du besitzt: deinen Sohn.«
In diesem Augenblick verlor mein Vater seine Selbstbeherrschung, wandte sich abrupt um und verließ die Jurte. Er war nicht wütend über Dschamugas Drohung, nein: Er hatte Angst!
Ich warf dem Fürsten einen langen Blick zu, den er mit einem siegesgewissen Lächeln erwiderte, dann folgte ich meinem Vater.
»Ich werde der Sieger sein!«, brüllte Dschamuga mir hinterher.
In jener Nacht lag ich wach auf meinem Bett und starrte in die Finsternis. Kokatschin hatte sich im Schlaf an mich geschmiegt und die Arme um mich gelegt. Ihr Gesicht lag an meiner Schulter, ihr Atem streifte meine Wange. Sie duftete immer noch nach dem chinesischen Rosenparfum, wie vor Stunden, als wir uns in der Steppe geliebt hatten.
Sanft küsste ich sie, befreite mich aus ihrer Umarmung, ohne sie zu wecken, und setzte mich auf.
Seit dem Gespräch mit meinem Vater in seiner Jurte hatte ich keine Ruhe mehr gefunden. Dschamugas Worte »Ich werde der Sieger sein!« hatten mich getroffen – und ich wusste nicht, warum. Was waren sie denn anderes als der trotzige Aufschrei eines zum Tode Verurteilten … die zornige und sinnlose Rache am Sieger angesichts der eigenen Niederlage?
Aber auch das Verhalten meines Vaters hatte mich verwirrt. »Sag mir, Temur: Was soll ich mit ihm tun?«, hatte er mich gefragt.
»Ich dachte, diese Entscheidung wäre schon vor Jahren getroffen worden«, hatte ich geantwortet. »Wie viele Schlachten haben wir gegen Dschamuga geschlagen, wie viele Tote hat dieser endlose Kampf gekostet? Es wird keinen Frieden geben, solange er lebt.«
Mein Vater schien erleichtert, dass er das Todesurteil über Dschamuga nicht allein fällen musste, dass ich ihm die Entscheidung abnahm, dass ich hinter ihm stand. Als hätte er meine Loyalität jemals infrage gestellt!
Was machte meinem Vater solche Angst, was stand unausgesprochen zwischen uns? Was war so Furchtbares geschehen, dass Dschamuga noch im Tode die Macht besaß, mich von meinem Vater zu trennen?
Mit beiden Händen fuhr ich mir über das Gesicht. Dann erhob ich mich, kleidete mich an und verließ meine Jurte.
Im Lager war es still. Es war lange nach Mitternacht, und die meisten Feuer in den Zelten waren erloschen, sodass ich mich durch die Finsternis vorantasten musste.
Die Bewaffneten sprangen erschrocken auf, als ich in den Feuerschein vor Dschamugas Jurte trat. Sie verneigten sich respektvoll –und verstellten mir den Weg zum Eingang.
»Ich wünsche, zu Fürst Dschamuga gelassen zu werden«, erklärte ich ungeduldig und schob einen der Wächter zur Seite.
Der Offizier hielt mich auf. »Der Khan hat ausdrücklich verboten, dass Fürst Dschamuga mit dir spricht, Temur Noyan.«
Wenn mein Vater den Befehl erteilte, mich von Dschamuga fern zu halten, musste er das Schlimmste befürchten.
Unbeeindruckt ging ich einen Schritt weiter. Der Offizier zog sein Schwert, um mich aufzuhalten: »Ich habe den Befehl, dich in deine Jurte zurückzubringen. Notfalls mit Gewalt.«
Mit erhobenen Armen trat ich einen Schritt auf ihn zu. Ich trug keine Waffe, nicht einmal einen Dolch. Trotzdem wich er vor mir zurück.
»Ich nehme nicht an, dass die Befehle des Khans so zu interpretieren sind, dass du mich umbringen sollst, wenn ich darauf bestehe, mit Dschamuga zu sprechen«, sagte ich so leise, dass die Wachen, die uns in weitem Kreis umringten, mich nicht verstehen konnten. »Denn das musst du tun, um mich davon abzuhalten.«
»Ich kann den Befehl des Khans nicht verweigern! Darauf steht die Todesstrafe.«
»Ich weiß. Und welche Strafe erwartet dich, wenn du den Sohn des Khans, deinen vorgesetzten Noyan, tötest? Ich bin unbewaffnet.« Als ich sah, wie er bestürzt den Blick abwandte und einen Schritt zurückwich, ging ich weiter auf den Zelteingang zu und betrat die Jurte.
»Du bist zurückgekommen!«, sagte Dschamuga, als er mich im Feuerschein erkannte. »Hat Temudschin mit dir über mich gesprochen?« Als ich nickte, fragte er: »Aber er hat mit dir nicht über dich gesprochen, nicht wahr?«
Verwirrt schüttelte ich den Kopf. »Warum sollten wir über mich sprechen?«
»Weil du die Ursache unserer Feindschaft bist, Temur. Weil du der Grund für zwanzig Jahre Krieg bist.«
»Ich?«, fragte ich fassungslos.
Dschamuga nickte. »Setz dich, mein Sohn! Ich werde dir erzählen, was er dir all die Jahre nicht zu sagen wagte, weil er Angst hatte, dich zu verlieren – an mich. Aber in der Stunde meines Todes hast du das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Ich werde dir sagen, warum er nicht will, dass du mich richtest.«
Ich zögerte, doch dann ließ ich mich neben ihm am Feuer nieder und half ihm in eine sitzende Position, die ihm weniger Schmerzen bereitete.
»Er will nicht, dass du das Urteil an mir vollstreckst, weil er verhindern will, dass der Sohn den Vater tötet«, erklärte Dschamuga. »Er weiß, dass du ihm das nie verzeihen würdest und dass er dich dann für immer verloren hätte.«
»… den Vater?«, flüsterte ich verwirrt.
»Ich bin dein Vater, Temur«, sagte Dschamuga ernst.
Ich sprang auf. »Nein! Das ist nicht wahr!«, schrie ich. »Ich bin sein Sohn!«
»Aber erst, seit er dich mir weggenommen hat!«
Ich schwankte, musste mich festhalten. Ich war verwirrt, wütend. Und ängstlich, er könnte die Wahrheit sagen.
Seine Augen funkelten im Feuerschein. Bösartig? Mitleidig? Oder schon siegesgewiss? Vor wenigen Stunden hatte er gesagt, er würde der Sieger sein. War das die Rache an seinem Freund Temudschin, ihn und mich zu trennen?
Dschamuga wich meinem Blick nicht aus. »Es war vor fast zwanzig Jahren«, begann er zu erzählen, »als Temudschins Gemahlin Börte von den Merkiten entführt worden war. Er und ich waren damals enge Freunde. Wir standen uns so nah wie Dschebe und du. Wie ihr haben wir einander unser Leben anvertraut. Gemeinsam zogen wir nach Norden in die sibirischen Wälder, um Börte aus den Händen der Merkiten zu befreien.«
»Ich kenne die Geschichte: Meine Stiefmutter war schwanger, als sie zu meinem Vater zurückkehrte. Und als mein Bruder Dschutschi geboren wurde, war er nicht sicher, ob sein Sohn nicht der Sohn eines Merkiten war.«
Und seit Dschutschi wusste, wie sein Vater über ihn dachte – dass er ihn ungehorsam nannte, eigensinnig und unfähig, sich selbst und andere zu beherrschen –, flogen die Funken zwischen beiden, wenn sie sich zu nahe kamen.
Dschamuga nickte. »Diese Frage wird für immer zwischen Dschutschi und dem Mann, den er für seinen Vater hält, stehen. Dein Bruder Dschutschi und du, ihr habt viel gemeinsam. Ihr seid im selben Jahr geboren, mit nur wenigen Tagen Abstand, und ihr wisst beide nicht, wer euer Vater ist.«
Zornig rief ich: »Das ist …«
»… die Wahrheit, Temur. Deshalb bist du doch zurückgekommen: um die Wahrheit zu hören. So schmerzhaft sie auch sein mag.«
Betroffen schwieg ich und starrte ins Feuer.
»Ich habe deine Mutter geliebt, Temur«, sagte Dschamuga sanft, als hätte er Angst, seine Worte könnten mich verletzen, und ich könnte aufspringen und vor ihm fliehen, ohne ihm die Gelegenheit zu geben, sich mir vor seiner Hinrichtung noch zu offenbaren. »Vom ersten Augenblick an, als ich sie sah, habe ich sie geliebt. Als Temudschin sie mir wegnahm, war ich sehr wütend. Wir haben uns gestritten. Unsere Freundschaft zerbrach in diesem Kampf aus verletztem Stolz und enttäuschter Liebe. Wir führten Krieg gegeneinander – um die Vorherrschaft, um die Khanwürde, um das nackte Überleben. Als du geboren wurdest, hat er dich trotz seiner Zweifel als seinen ältesten Sohn anerkannt, um dich mir wegzunehmen.«
Nun wusste ich, warum mein Vater … der Khan verhindern wollte, dass ich in dieser Nacht mit Dschamuga sprach!
Ich barg mein Gesicht in den Händen und versuchte, klar zu denken. Der Khan fürchtete, dass ich erfuhr, wer mein Vater war. War er deshalb so erleichtert gewesen, als ich ihm die Entscheidung abnahm, Dschamuga hinzurichten? Er würde sich nie vor mir rechtfertigen müssen, meinen Vater gerichtet zu haben. Und außerdem wollte er verhindern, dass ich das Urteil selbst an ihm vollstreckte – dass ich meinen Vater tötete. Er würde mich verlieren … Oder hatte er mich bereits verloren?
Dschamuga merkte, was in mir vorging. Ich sah das Mitgefühl in seinen Augen funkeln. »Es wäre für uns beide leichter gewesen, wenn wir uns auf dem Schlachtfeld begegnet wären, wenn einer von uns in diesem endlosen Krieg gefallen wäre. Denn nun hast du – nicht er! – das Todesurteil über mich gesprochen und wirst mir beim Sterben zusehen.«
Ich nickte still.
»Es tut mir Leid um dich, mein Sohn. Du hast einen Vater verloren, den du liebst, einen anderen gefunden, den du hasst, und wirst ihn in wenigen Stunden wieder verlieren, weil du eine unvermeidliche Entscheidung getroffen hast. Du wirst dich selbst hassen, weil du dieses Todesurteil vor dir selbst nicht mehr rechtfertigen kannst.«
Wortlos erhob ich mich, um die Jurte zu verlassen. Ich ertrug es nicht, ihm weiter zuzuhören. Vier Monate zuvor hatten wir uns auf dem Schlachtfeld gegenübergestanden und unsere Heere gegeneinander gehetzt. Und jetzt …
Ich musste gehen, bevor ich eine unsinnige Entscheidung traf, die uns allen noch mehr Leid brachte, noch mehr Siege, die keine waren, noch mehr Tote, die vergeblich starben, noch mehr Krieg!
»Du kannst nicht weglaufen, Temur. Nicht vor der Wahrheit und schon gar nicht vor dir selbst!«, rief er mir nach.
Meine Welt brach zusammen. Durch die Ruinen meines Lebens stolperte ich zu dem Mann, den ich neunzehn Jahre lang für meinen Vater gehalten hatte.
Es war nicht das erste Mal, dass ich alles verlor, was ich besaß. Doch jedes Mal war mir ein Pferd geblieben, ein Schwert oder wenigstens ein Dolch, um mein Leben zu verteidigen. Aber dieses Mal wurde mir alles genommen, meine Existenz als Temur, Sohn des Dschingis Khan, meine Vergangenheit und der Sinn dessen, was ich in den letzten Jahren getan hatte. All die Jahre hatte ich gekämpft: gegen Dschamuga! Es war ein endloser Überlebenskampf gewesen. Wäre der Krieg anders verlaufen, wenn ich geahnt hätte, wer mein Vater war? Vielleicht wäre nicht Dschingis Khan der Sieger gewesen, wenn … ja, wenn …
Dschamuga war der Fürst, der die Stämme immer wieder gegen Dschingis Khan aufgehetzt hatte. Seine Waffen waren nicht Pfeil und Schwert, sondern Intrige und Verrat. Seine Grausamkeit war gefürchtet. Dieser Mann … mein Feind … sollte mein Vater sein? O Gott, tu mir das nicht an!
Die Hinrichtung von Fürst Dschamuga am nächsten Morgen hätte mich befriedigt, hätte mich glücklich gemacht, weil sie den lang ersehnten Frieden ermöglichte. Meine Söhne Kaidu und Chinkim würden nicht wie ich mit dem Schwert in der Hand aufwachsen. Die Vernichtung des Feindes hätte meinen Sieg in der letzten Schlacht gekrönt. Aber die Ermordung meines eigenen Vaters war nichts von alldem …
Die Wachen vor dem Zelt des Khans hielten mich nicht auf, als ich an ihnen vorbei in die Jurte stürmte.
Er lag wach auf seinem Bett und richtete sich auf, als ich eintrat. Das Feuer brannte noch: Er hatte wohl wie ich nicht schlafen können in dieser furchtbaren Nacht des Triumphes, der keiner war. »Du warst bei ihm«, sagte er leise, während er die Verschlüsse seiner Seidenrobe zuband. War er wütend? Nein, nicht wütend: Er war enttäuscht. Traurig.
»Ja, ich habe mit Dschamuga gesprochen«, erklärte ich und ging unbeherrscht ein paar Schritte auf und ab.
Er wandte das Gesicht ab, damit ich nicht sah, dass er weinte. Verstohlen wischte er sich die Tränen ab.
»Du fragst mich nicht, was er mir gesagt hat!«, warf ich ihm verbittert vor. In meinem Zorn ließ ich ihm nicht einmal Zeit, seine eigenen Gefühle zu ordnen.
»Ich muss dich nur ansehen, um zu wissen, was er dir erzählt hat«, sagte er sanft. »Und dass du ihm glaubst. Ich habe dich noch nie in diesem Zustand gesehen, Temur.«
»Seinen Vater verliert man nur einmal im Leben!«, fauchte ich und wandte mich ab.
Er erhob sich, trat hinter mich und legte mir die Hand auf die Schulter, sanft und tröstend. Er ließ mir Zeit, mich zu beruhigen, meine Selbstbeherrschung wiederzugewinnen. Dann drehte er mich zu sich um, damit ich ihn ansehen konnte. »Deinen Vater hast du heute Nacht verloren, Temur. Mich nicht.«
Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Er umarmte mich und hielt mich fest. »Ich habe in dieser Nacht einen Sohn verloren. Dich will ich nicht auch noch verlieren, Temur!«
Als ich nicht antwortete, sprach er beruhigend auf mich ein:
»Ich habe deine Mutter geliebt, wie du Kokatschin liebst. Ich war fasziniert von ihr, geradezu besessen. Und ich war glücklich, als sie mir ihre Liebe gestand. Dschamuga war eifersüchtig, behauptete, sie gehöre ihm, und nahm sie mir weg. Er hatte mir geholfen, Börte aus der Gewalt der Merkiten zu befreien, und dachte, ihm stünde als meinem Freund eine angemessene Belohnung zu. Er nahm deine Mutter in sein Bett. Ich habe sie mir wiedergeholt. Ich habe sie so geliebt, Temur! Und als sie mir ihre Schwangerschaft gestand, war ich glücklich: mein erstes Kind! Aber das Glück hatte einen bitteren Nachgeschmack: Warst du mein Kind?«
Ich entwand mich seiner Umarmung und riss mich los. »Du hast mich deine Zweifel mein Leben lang spüren lassen!«, schleuderte ich ihm verbittert entgegen. »Du hast mich immer anders behandelt als meine Brüder, nicht nur weil ich ein mächtiger Schamane und wie du von Gott berufen bin. Die Liebe, die du Tschagatai, Ogodei und Tolei und selbst deinem Adoptivsohn Schigi so großzügig geschenkt hast, musste ich mir erkämpfen! Du hast mich mehr gequält als jeden anderen, mehr noch als Dschutschi!«
»Ich verstehe deinen Zorn«, sagte er leise. »Ich konnte doch nie sicher sein, dass du mein Sohn bist. Was von Dschamuga in dir war, wollte ich aus dir herausprügeln. Temudschin, ›der Schmied‹, hat Temur, ›das Eisen‹, geformt und zu einer scharfen Waffe geschmiedet. Ich dachte: Wenn du an den Schlägen zerbrichst, dann warst du es nicht wert. Dann wollte ich dich wegwerfen wie ein zerbrochenes Schwert. Aber du wurdest unter meinen Schlägen immer härter: ein hervorragender Feldherr, ein fähiger Schamane, ein würdiger Fürst.«
Überrascht sah ich ihn an. »Ein Fürst?«
»Ich hatte vor, in den nächsten Tagen mit dir darüber zu sprechen, Temur. Ich will dich zum Fürsten ernennen.«
Ich wandte mich ab. Die Vorstellung, von ihm mit Dschamugas Fürstentitel belohnt zu werden, war mir unerträglich.
Er trat zu mir, legte mir die Hand auf den Arm, aber ich stieß ihn mit einer unbeherrschten Geste zurück.
»Ich habe dich zu dem gemacht, was du heute bist, Temur: ein eigensinniger und loyaler, ein unvernünftiger und intelligenter Mann, der jeden meiner Befehle auslegt, wie es ihm passt. Ein Mann, der tut, was er für richtig hält, und der nie sein Ziel aus den Augen verliert. Ein Mann, der niemals, nicht einmal in den gefährlichsten Situationen auf dem Schlachtfeld, an sich und seinen Fähigkeiten zweifelt.
Ich war immer wie ein Vater für dich da, wenn du mich gebraucht hast, wenn du mich um Rat gefragt hast, um ihn gleich darauf in den Wind zu schlagen, wenn du deine schamanischen Kräfte mit mir messen wolltest, um deine Grenzen zu erforschen –und meine. Wir haben oft gestritten, Temur. Wir sind zornig aufeinander losgegangen und haben uns im Lauf der Jahre schmerzhafte Verletzungen zugefügt. Aber ausgewichen bist du mir nie! Tu es auch jetzt nicht!«
Er vertrat mir den Weg, als ich aus der Jurte stürmen wollte. »Was soll ich tun, Temur? Sag mir, was du willst: Soll ich das Todesurteil aufheben? Soll ich Dschamuga vergeben, ihn begnadigen? Soll ich ihn leben lassen?«
»Nein!«, schluchzte ich und stolperte an ihm vorbei aus dem Zelt.
»Lass nicht zu, dass Dschamuga am Ende über uns beide triumphiert!«, rief er mir hinterher.
Dschebe fand mich auf dem Hügel oberhalb des Ordu. Ich saß allein in der Finsternis, um nachzudenken.
Mein Freund sprang aus dem Sattel, schickte sein Pferd fort und ließ sich wortlos neben mich ins Gras fallen.
»Wenn Dschingis Khan dich schickt, um mich zur Vernunft zu bringen, kannst du gleich wieder abziehen!«, fauchte ich ihn an.
»Hör auf, wie ein verwundeter Tiger um dich zu schlagen! Du verletzt nur dich selbst, Temur. Mir kannst du nicht wehtun, denn ich weiß, was du empfindest. Ich werde jeden deiner Angriffe mit Nachsicht und Verständnis abwehren!«, sagte er und legte mir die Hand auf den Arm. Ich schüttelte sie ab, doch er gab nicht auf: »Wie du weißt, habe ich in dem Krieg zwischen Dschingis Khan und Dschamuga meinen Vater verloren. Ich habe damals auf Dschamugas Seite gekämpft, und ich wollte mich am Khan rächen. Ich habe ihn in der Schlacht mit meinen Pfeilen so schwer verwundet, dass er fast gestorben wäre. Er hat mir in seinem unendlichen Großmut vergeben, Temur. Er hat mir vergeben! Er behandelt mich wie seinen eigenen Sohn, ersetzt mir durch seine Liebe den verlorenen Vater …«
»Er hat es dir gesagt?«, unterbrach ich ihn.
»Er hat Angst, dich zu verlieren. Er will kein weiteres Opfer dieses furchtbaren Krieges. Er glaubt, die nächsten Opfer wären du und er selbst.«
Ich wandte mich unbeherrscht ab.
»Außer mir weiß es niemand, Temur. Und dabei will er es belassen. Nie soll irgendjemand erfahren, was heute Nacht geschehen ist«, versuchte Dschebe mich zu besänftigen. »Lecke deine Wunden, Tiger, und dann kehre zu ihm zurück!«
»Dschebe, du bist mein Freund. Ich weiß nicht mehr, wie oft du mir in den letzten Jahren das Leben gerettet hast. Aber dieses Mal kannst du mir nicht helfen«, entgegnete ich. »Bitte lass mich allein! Ich muss nachdenken.«
Und eine Entscheidung treffen.
Dschebe umarmte mich liebevoll, küsste mich wie einen Bruder und warf mir einen beschwörenden Blick zu. Dann erhob er sich und ritt ohne ein weiteres Wort ins Lager.
Ich blieb allein zurück.
Rot wie Blut erhob sich die Sonne über den Horizont.
Es war still auf dem großen Platz vor der Palastjurte des Khans. Nur seine Feldzeichen und die weiße Fahne mit dem schwarzen Adler flatterten leise im Wind.
Ein Raunen ging durch die Menge der Zuschauer, als Dschamuga aus seinem Zelt geführt wurde. Die Krieger hatten auf ihren Pferden einen weiten Kreis gebildet. Jeder trug seine Rüstung, den Helm, jeder war mit seinem Schwert, mit Pfeilen und Bogen bewaffnet, als wollte er in die Schlacht ziehen – die letzte dieses Krieges. Die Frauen und Kinder standen abseits. Meine Gemahlin Nomolun hielt meine beiden Söhne Kaidu und Chinkim an der Hand. Neben ihr erkannte ich Kokatschin, die verstohlen zu mir herüberwinkte.
Die großen Trommeln dröhnten, ihr schneller Rhythmus drang in meinen Verstand, versetzte mich wie meine Schamanentrommel in Ekstase und erhitzte mein Blut. Ich musste mich konzentrieren, um nicht wie sonst bei solchen Zeremonien in schamanische Trance zu fallen.
Dann wandte ich mich wieder Dschamuga zu. Seine Hände waren gefesselt, seine Füße mit einem Strick zusammengebunden, und er stolperte vorwärts, als zwei Bewaffnete ihn vor den Thron des Khans schleppten, der vor dem Eingang der Palastjurte aufgestellt worden war. Sie stießen ihn auf die Knie und zwangen ihn mit gezogenen Schwertern zum Kotau vor dem Herrscher.
Unbeweglich stand ich nicht einmal eine Armlänge neben dem Khan und starrte auf Dschamuga hinab. Als er sich aufrichtete, erwiderte er furchtlos und, wie mir schien, mitleidig meinen Blick. Trotz der Fesseln und der knienden Stellung bewahrte er die Haltung und die Würde eines Khans der Mongolen.
Dschingis Khan beobachtete mich von der Seite. Er war erleichtert gewesen, als ich im Morgengrauen in sein Zelt zurückgekehrt war. Und er hatte keine Einwände gehabt, als ich forderte, die Art von Dschamugas Hinrichtung selbst bestimmen zu dürfen. Er hatte nicht einmal gefragt, was ich vorhatte.
Ich sah ihm fragend in die Augen, und er wandte den Blick ab.
Der Khan hatte einen meiner Brüder ausersehen, Dschamuga hinzurichten. Der trat nun mit gezogenem Schwert hinter den Gefesselten und wartete auf das Zeichen von mir, ihn zu richten.
Das laute Dröhnen der Trommeln verstummte. Die atemlose Stille nach dem Lärm betäubte den Verstand.
Kökschu erschien – aus gegebenem Anlass bemerkenswert zurückhaltend, geradezu unauffällig – im Schamanengewand, um für den zum Tode Verurteilten zu beten und Gottes Wohlwollen für seine Jenseitsreise zu erflehen. Seine langen weißen Haare wehten im Wind. Kökschu war erst neununddreißig, aber sein Haar und sein langer Bart waren seit der Nacht seiner dreizehnten und letzten Schamanenweihe weiß wie Schnee – seit jener Nacht, die er selbst als die seiner Erleuchtung bezeichnete.
Als Kökschu das Gebet beendet und mit gesenktem Blick seinen Platz neben dem Khan eingenommen hatte, schleppten meine Diener eine weiße Filzdecke heran und entrollten sie hinter Dschamuga im Gras. Ich gab meinem Bruder ein Zeichen, das Schwert wegzustecken, und er gehorchte.
»Du willst sein Blut nicht vergießen und ihn wie einen Fürsten sterben lassen!«, sagte der Khan überrascht. »Das ist …«
»… der Hinrichtung eines Khans der Mongolen angemessen. Es ist dir angemessen, mein Khan!«, erwiderte ich, und er schwieg.
Kökschu wollte etwas sagen, besann sich aber, als ich ihm in die Augen sah. Offenbar wollte er sich nicht ausgerechnet an diesem Tag mit mir anlegen: Er ahnte wohl, dass es dieses Mal nicht bei Blitz und Donner und einem Wirbelsturm eisiger Gefühle zwischen uns geblieben wäre.
Zwei Bewaffnete schleppten Dschamuga zur weißen Filzdecke, auf der der Tradition entsprechend ein Khan ernannt und durch seine Gefolgsleute symbolisch in den Himmel gehoben wurde. Sie zerschnitten seine Fesseln und entfernten sich.
Der Fürst nahm mit einer Würde auf der Decke Platz, als sei er der Herrscher eines Reiches, das nur noch die Größe einer Filzdecke hatte. Dann betete Dschamuga, indem er seinen Gürtel löste und über die Schultern legte und die Hände der aufgehenden Sonne entgegenstreckte. Ich gab meinem Bruder, der bereits seinen unruhig tänzelnden Hengst bestiegen hatte, ein Zeichen zu warten, bis der Fürst sein letztes Gebet beendet hatte.
Als Dschamuga sich wieder aufrichtete, fragte Dschingis Khan: »Willst du noch etwas sagen?«
»Nein, Temudschin: Es ist alles gesagt und getan«, erklärte der Fürst. Dann erhob er sich, band seinen Gürtel wieder um und legte sich auf die Filzdecke, den Blick in den Himmel gerichtet.
Vier Bewaffnete eilten herbei, nahmen die Enden der Decke und legten sie über den zum Tode Verurteilten.
Die Trommler begannen einen schnellen Rhythmus zu schlagen und steigerten ihn zum dröhnenden Wirbel, zum infernalischen Donnern, das gewaltsam jedes Gefühl diesseits der ekstatischen Erregung mit sich riss, das die Seele des Sterbenden in den Himmel hinauftragen würde. Mein Herz begann zu rasen.
Mein Bruder trieb seinen vor dem Lärm scheuenden Hengst an und galoppierte über die eingerollte Decke. Die Hufe verfingen sich im weichen Filz, und beinahe wäre er gestürzt. Doch im letzten Augenblick fing sich das Pferd, und er wendete, um erneut über die Decke zu galoppieren. Die Hufe zerschmetterten Dschamugas Körper.
Neun Mal ritt mein Bruder über die weiße Khandecke, bis er sicher war, dass der Fürst nicht mehr lebte, dass der letzte Feind des Khans besiegt war.
Stille. Schweigen. Atemlose Erregung.
Als die Bewaffneten den weißen Filz entrollten und Dschamugas sterbliche Überreste hervorzogen, kniete ich mich neben ihn, um ihm nach einem kurzen Gebet die Augen zu schließen.
Kein euphorisches Gefühl des Triumphes, des Sieges über den Feind, kein schmerzhaftes Gefühl der Trauer um meinen Vater, nicht einmal ein Funken Mitgefühl mit dem Gerichteten. Nichts, ich fühlte nichts. Nichts, außer der eisigen Leere in mir.
Der Khan war vom Thron herabgestiegen und trat neben mich.
»Er ist tot«, sagte ich leise. »Bist du nun zufrieden?«
»Nein, Temur«, entgegnete er verbittert. »Denn die Stunde meines Triumphes ist die Stunde meiner größten Niederlage. Einen abgeschossenen Pfeil kann ich nicht aufhalten.«
Er weiß es!, dachte ich. Er ist Schamane wie ich: Er weiß, was ich tun werde. Was ich tun muss. Und er weiß, dass er es nicht verhindern kann. Nicht verhindern darf.
Der Khan kniete sich neben mich und legte Dschamugas Arme wie im Gebet übereinander. Dann half er mir, den Toten wieder in die weiße Filzdecke einzuwickeln, stand auf und trat einen Schritt zurück, um ein Gebet für seinen toten Feind zu sprechen.
Ich nahm Dschamugas sterbliche Überreste in die Arme und erhob mich. Langsam schritt ich durch die Reihen der Zuschauer, die vor mir zurückwichen und eine Gasse bildeten. Einer meiner Diener führte zwei gesattelte Pferde mit gefüllten Provianttaschen heran. Ich legte den Leichnam über den Sattel meines Ersatzpferdes und band ihn fest.
Dschebe ahnte, was ich vorhatte, und wollte mich davon abhalten, mein Pferd zu besteigen. Ich umarmte und küsste ihn: »Bitte kümmere dich um Kokatschin und Nomolun. Ersetze ihnen den Gemahl. Und sei meinen Söhnen ein Vater, Dschebe.«
»Das werde ich«, seufzte er an meiner Schulter. Er wusste, dass er mich nicht aufhalten konnte.