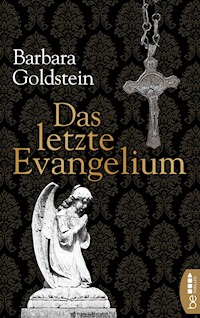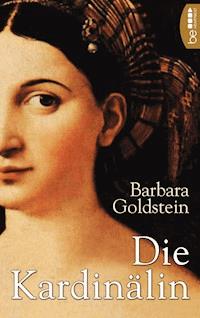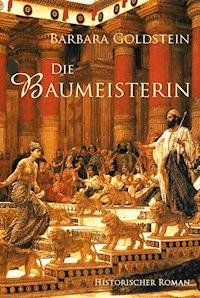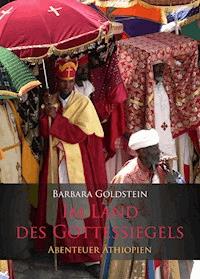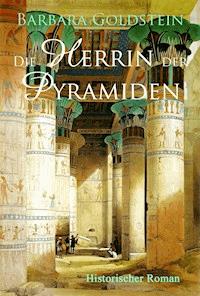4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein farbenprächtiger Renaissance-Roman: Liebe und Spannung im Venedig des 16. Jahrhunderts
Venedig 1515: Als die berühmte Humanistin Celestina ermordet werden soll, rettet sie der Rabbi Elija, der vor der spanischen Inquisition geflohen ist. Trotz aller Gefahren verlieben sie sich. Bei der gemeinsamen Übersetzung der Evangelien machen sie eine unglaubliche Entdeckung: Die Evangelisten erzählen nicht die Wahrheit über Jesus Christus. Dieser war ein gesalbter König Israels, wurde als Rebell gegen die römische Herrschaft gekreuzigt und überlebte.
Doch als Elija von der Inquisition festgenommen wird, muss Celestina sich entscheiden: für die Wahrheit - oder für das Leben des Mannes, den sie liebt ...
Weitere historische Romane von Barbara Goldstein bei beHEARTBEAT:
Die Kardinälin * Der Fürst der Maler.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 926
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungDIE HANDELNDEN PERSONENCELESTINA - Kapitel 1ELIJA - Kapitel 2CELESTINA - Kapitel 3ELIJA - Kapitel 4CELESTINA - Kapitel 5ELIJA - Kapitel 6CELESTINA - Kapitel 7ELIJA - Kapitel 8CELESTINA - Kapitel 9ELIJA - Kapitel 10CELESTINA - Kapitel 11ELIJA - Kapitel 12CELESTINA - Kapitel 13ELIJA - Kapitel 14CELESTINA - Kapitel 15ELIJA - Kapitel 16CELESTINA - Kapitel 17ELIJA - Kapitel 18ANMERKUNGENÜber dieses Buch
Ein farbenprächtiger Renaissance-Roman: Liebe und Spannung im Venedig des 16. Jahrhunderts
Venedig 1515: Als die berühmte Humanistin Celestina ermordet werden soll, rettet sie der Rabbi Elija, der vor der spanischen Inquisition geflohen ist. Trotz aller Gefahren verlieben sie sich. Bei der gemeinsamen Übersetzung der Evangelien machen sie eine unglaubliche Entdeckung: Die Evangelisten erzählen nicht die Wahrheit über Jesus Christus. Dieser war ein gesalbter König Israels, wurde als Rebell gegen die römische Herrschaft gekreuzigt und überlebte. Doch als Elija von der Inquisition festgenommen wird, muss Celestina sich entscheiden: für die Wahrheit - oder für das Leben des Mannes, den sie liebt …
Über die Autorin
Barbara Goldstein, geb. 1966, arbeitete zunächst in der Verwaltung von Banken und nahm dann ein Studium der Philosophie und der Sozialen Verhaltenswissenschaften auf. Später machte sie sich als Autorin historischer Romane selbstständig und nahm ihre Leser mit in die Welt von Alessandra d‘Ascoli, einer florentinischen Buchhändlerin. Barbara Goldstein verstarb im März 2014 nach langer Krankheit.
Barbara Goldstein
Die Evangelistin
beHEARTBEAT
Vollständige E-Book-Ausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2013/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © akg-images/Rabatti – Domingie
Umschlaggestaltung: Manuela Städele
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5290-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Meinen Eltern
in Dankbarkeit
für ihre Großzügigkeit,
ihr Vertrauen und ihre Liebe.
DIEHANDELNDENPERSONEN
Celestina Tron Venezianische Humanistin
Tristan Venier Celestinas Geliebter, Mitglied im Consiglio dei Dieci (Rat der Zehn)
Menandros Celestinas Freund, griechisch-orthodoxer Priester
Leonardo Loredan Doge von Venedig
Antonio Tron Celestinas Cousin, Prokurator von San Marco
Zaccaria Dolfin Antonio Trons Freund, Mitglied im Consiglio dei Savi (Rat der Weisen)
Antonio Grimani Prokurator von San Marco und Mitglied im Consiglio dei Savi (Rat der Weisen)
Domenico Grimani Antonio Grimanis Sohn, Kardinal
Antonio Contarini Patriarch von Venedig
Giovanni de’ Medici (Gianni) Papst Leo X.
Baldassare Castiglione Humanist in Rom
Giovanni Montefiore Humanist in Florenz
Elija Ibn Daud Sefardischer Rabbi aus Granada
David Elijas Bruder, Medicus
Judith Davids Gemahlin
Esther Davids und Judiths Tochter
Aron Elijas Bruder, Bankier und Kaufmann
Marietta (Mirjam Halevi) Arons Verlobte
Angelo (Joel Halevi) Mariettas Bruder, Sekretär und Vertrauter von Papst Leo X.
Jakob Silberstern Elijas Freund, aschkenasischer Rabbi aus Köln und Worms
Yehiel Silberstern Jakobs Sohn
Asher Meshullam Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in Venedig
Chaim Meshullam Ashers Bruder, Bankier
CELESTINA
KAPITEL 1
»Celestina, ich will dich nachher sehen«, hatte mir der Doge vor einer Stunde zugeflüstert. »Wir müssen reden!«
Er wirkte so besorgt, ja beinahe ängstlich. Was war bloß geschehen?
Gedankenverloren lehnte ich an der Säule von San Marco auf dem Molo und wartete unruhig auf sein Erscheinen und den Beginn der feierlichen Zeremonien.
Dann endlich wehte der Ruf über die Piazzetta: »Der Doge!«
Die dicht gedrängte Menge hielt den Atem an und reckte die Köpfe, als Leonardo Loredan den Palazzo Ducale durch die prächtige Porta della Carta verließ. Mit seinem Gefolge, den Prokuratoren von San Marco, den Mitgliedern des Zehnerrates in ihren schwarzen Seidenroben und etlichen rotgewandeten Senatoren, schritt er durch das wogende Menschenmeer zum Molo.
Still war es auf der überfüllten Piazzetta. Nur das Schreien der Möwen, das Flattern der auffliegenden Tauben von der Basilica di San Marco und das Knattern des großen purpurfarbenen Banners mit dem goldgestickten Löwen auf dem Bucintoro durchbrach das Schweigen.
Der Wind vom Meer brachte keine Kühlung an diesem schwülheißen Himmelfahrtstag des Jahres 1515. Die Wellen schwappten über die mit Algen bewachsenen Stufen des Molo, und die schwankenden Gondeln schlugen gegeneinander.
Ein Sturm zog herauf.
Dröhnend kündigten die großen Glocken von San Marco den Beginn der feierlichen Prozession an.
Der Doge winkte den Zuschauern unter den Arkaden und auf der Loggia des Palazzo Ducale zu, während er zur goldenen Staatsgaleere hinüberschritt, wo ihn der Patriarch mit seinem Gefolge erwartete.
Tristan hielt sich direkt hinter dem Dogen. Seine schwarze Seidenrobe, die ihn als Mitglied des Consiglio dei Dieci auswies, flatterte in der leichten Brise dieses glühend heißen Maitages.
Als er mich neben der Säule des geflügelten San-Marco-Löwen am Molo entdeckte, winkte er mir verstohlen zu.
Ich wandte den Blick ab, als hätte ich ihn nicht bemerkt, und beobachtete den Flug der Möwen, die sich vom Dach des Palazzo Ducale in die Tiefe stürzten, um über den Hafen auf die Lagune hinauszufliegen.
In diesem Augenblick drängte sich jemand von hinten gegen mich und warf mich dabei fast um. Seine Hand lag vertraulich auf meiner nackten Schulter. Schon wollte ich mich zu ihm umwenden, als er seinen Arm um meine Taille schlang und neben mich trat.
»Venedig hat hunderttausend Einwohner, und alle drängen sich heute auf der Piazza San Marco, der Piazzetta, dem Molo und der Riva degli Schiavoni. Oder sie rudern in ihren geschmückten Gondeln auf der Lagune«, lächelte er verschmitzt. »Und doch ist es nicht schwer, dich zu finden, Celestina.«
»Baldassare!«, freute ich mich. »Wie schön, dich zu sehen! Was machst du in Venedig?«
Baldassare Castiglione, obwohl wesentlich älter als ich – er war siebenunddreißig, ich war fünfundzwanzig –, war ein sehr attraktiver Mann, hoch gewachsen, schlank und athletisch. Seine eisblauen Augen bezauberten mich jedes Mal, wenn er mich ansah wie gerade jetzt. Sein gepflegter Bart und seine aufrechte Haltung verliehen ihm ein sehr würdiges Aussehen. Als Baldassare vor einigen Jahren nach London gereist war, hatte ihn der englische König voller Hochachtung ›einen wahren Sir‹ genannt, und so musste Raffaello ihn in Rom porträtiert haben.
»Ich war auf dem Weg von Rom nach Mantua. Glaubst du, ich lasse mir ein grandioses Spektakel wie Venedigs Vermählung mit dem Meer entgehen?« Baldassares Geste umfasste die ganze lichtfunkelnde Lagune. »Oder ein Wiedersehen mit dir?«, lachte er fröhlich und hauchte mir einen Kuss auf die Wange. »Dies ist ein Gruß von Raffaello.«
Nun küsste er mich auf die andere Wange:
»Diesen Kuss sendet dir Seine Heiligkeit. Papst Leo lässt fragen, wann du endlich nach Rom kommst. Die Tore des Vatikans stehen dir weit offen! Ich fürchte, der Heilige Vater wird dich exkommunizieren, wenn du nicht bald deine Reisetruhen packst.«
Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, wie Tristan neugierig zu uns herübersah.
Baldassare hatte meinen Blick bemerkt. »Ist er dein Geliebter?«
Ich nickte.
»Ihr seid ein schönes Paar«, urteilte mein Freund nach einem forschenden Blick auf Tristan, den er bisher nur aus meinen Briefen kannte. »Trotz eurer Jugend habt ihr es weit gebracht auf der steilen Treppe des Ruhms. Tristan ist einer der mächtigsten Männer der Regierung von Venedig. Und du bist eine berühmte Gelehrte. Ihr liebt euch mit aller Leidenschaft. Das macht mir meine Aufgabe nicht gerade leicht!« Er senkte seine Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern. »Ich soll dich überreden, endlich nach Rom zu kommen. Ich handele in allerhöchstem Auftrag.«
Vergnügt lächelte ich über den Machtkampf zwischen dem Papst und mir. Mein letzter Brief an Giovanni de’ Medici mit den Manuskriptabschriften meines Buches hatte ihn offenbar beeindruckt. Und jetzt schickte Seine Heiligkeit den tapferen Helden Baldassare an die Front.
»Was soll ich in Rom?«, fragte ich.
»Celestina, ich bitte dich! Die berühmtesten Künstler, Gelehrten und Humanisten sind in Rom – Raffaello, Michelangelo und Leonardo. Und ich schreibe mein Libro del Cortegiano, das der Papst als ein Glaubensbekenntnis der Selbstbestimmung bezeichnet.«
»Ich kann und will nicht für Papst Leo arbeiten. Denn das wäre Verrat an meinem Vater, der im Kampf gegen seinen Vorgänger fiel, Papst Julius den Eroberer. Giacomo Tron starb mit dem Schlachtruf Libertà! auf den Lippen.«
»Du schlägst die Bitte Seiner Heiligkeit aus, obwohl du eine Medici bist.«
»Die Familie meiner Mutter, die Iatros, sind der Athener Zweig der Florentiner Medici. Sie leben schon seit der Zeit vor Cosimo de’ Medici in Athen. Der Papst und ich sind also nur sehr entfernt verwandt.«
»Er schätzt dich als große Gelehrte. Dein Manuskript hat ihn begeistert: ›Wann ist der Mensch zutiefst menschlich? Wenn er leidet und doch liebt. Wenn er hasst und trotzdem vergibt‹, hast du geschrieben. ›Das ist das Credo der Humanitas, der Menschlichkeit und der Moral!‹, rief Seine Heiligkeit. ›Das ist prägnanter als die Bergpredigt!‹ Er nennt dich seine Evangelistin.«
»Sag ihm: Es geht noch prägnanter. ›Lebe und liebe! Und verschenke niemals deine Freiheit!‹ Nein, Baldassare, ich werde meine Unabhängigkeit nicht aufgeben. Nicht für Rom, nicht für die Kirche, nicht für den Papst.«
Der Doge und sein Gefolge hatten uns erreicht.
Leonardo Loredans Blick war ernst – wie vor einer Stunde, als er mir verkündet hatte, dass er nach der Zeremonie mit mir reden wollte.
Erneut fragte ich mich: Was war geschehen? Weshalb war er so besorgt um mich?
Als der Doge Baldassare an meiner Seite erkannte, blieb er stehen, um ihn zu begrüßen: »Ich wusste nicht, dass Ihr in der Serenissima weilt, Exzellenz!«
Baldassare verneigte sich tief. »Erst seit einer Stunde, Euer Hoheit!«
»Dann vergebe ich Euch, dass Ihr mich nicht sofort nach Eurer Ankunft aufgesucht habt. Celestina hat mir einige Seiten Eures Libro del Cortegiano zu lesen gegeben. Es freut mich, dass Ihr das Buch nicht in Rom, sondern in Venedig veröffentlichen wollt. Es wäre mir eine Ehre, wenn Ihr die Vermählung mit dem Meer vom Bucintoro aus beobachten würdet.«
Baldassare verneigte sich. »Mit dem größten Vergnügen!«
Leonardo Loredan legte seine Hand auf Tristans Arm. »Darf ich Euch Tristan Venier vorstellen, Exzellenz? Signor Venier ist Mitglied im Rat der Zehn.«
Während der Doge Baldassare erklärte, dass der Consiglio dei Dieci als Geheimdienst mit richterlicher Gewalt das Recht hatte, gegen jeden zu ermitteln, der die Sicherheit der Republik von San Marco zu gefährden drohte, streichelte Tristans Blick mein aufgestecktes Haar, meine nackten Schultern, versank im Ausschnitt meines Kleides und umschmeichelte meine Taille.
»Sehen wir uns heute Nacht?«, flüsterte er, während er meine Hand küsste und dabei mit dem blauen Topasring spielte, den er mir geschenkt hatte. Als ich lächelte, hauchte er: »Ich habe dafür gesorgt, dass du während des Banketts heute Abend neben mir sitzt. Dann werden wir tanzen, bis der Tag erwacht. Und dann …« Er seufzte verzückt, wie er es manchmal tat, wenn ich ihn an sehr intimen Stellen streichelte.
»Ich freue mich auf dich«, flüsterte ich zurück und verbarg meine Vorfreude auf eine stürmische Nacht mit Tristan hinter einem formvollendeten Lächeln.
Seit meiner Rückkehr aus dem Exil in Athen zwei Jahre zuvor war es uns gelungen, unsere Liebe geheim zu halten. Die Enthüllung einer skandalösen Affäre hätte das Ende von Tristans glänzender Karriere als jüngstes und einflussreichstes Mitglied des Consiglio dei Dieci bedeutet.
Doch auch für mich, die ich mir meinen Weg in die Freiheit und Selbstbestimmung hart erkämpfen musste, wäre dies ein vernichtender Schlag gewesen. Dass ich als Frau gebildet war und fließend Lateinisch, Griechisch, Französisch und Arabisch sprach, war für die Humanisten nur schwer erträglich gewesen – bis ich nach Athen ins Exil gehen musste.
Leonardo Loredan riss mich aus meinen Erinnerungen. »Tristan, Signor Castiglione ist der Botschafter des Herzogs von Urbino in Rom und einer der berühmtesten Schriftsteller Italiens. Celestina und er haben sich vor Jahren am Hof des Herzogs von Urbino kennen gelernt«, erklärte der Doge unnötigerweise – mein Geliebter kannte das Manuskript des Cortegiano, das ich auf Baldassares Wunsch korrigierte.
Antonio war neugierig näher getreten. Doch bevor mein Cousin meine Hand ergreifen konnte, um sie zu küssen, trat ich einen Schritt zurück. Antonio funkelte mich zornig an. Wir hassten uns mit brennender Leidenschaft. Was er mir angetan hatte, würde ich ihm niemals vergeben!
Leonardo Loredan bemerkte den Funkenflug zwischen meinem Cousin und mir. Er legte Antonio die Hand auf die Schulter und stellte Baldassare seinen mächtigsten Gegner vor.
»Signor Castiglione, es ist mir eine Freude, Euch mit Antonio Tron, dem Prokurator von San Marco, bekannt zu machen. Die Prokuratoren sind nach dem Dogen die höchsten Würdenträger der Republik.«
Während Baldassare sich verneigte, bot mir der Doge seine Hand, damit er mich an Bord des Bucintoro führen konnte. An Leonardo Loredans Arm schritt ich die Planke hinauf an Bord der Staatsgaleere.
Vergoldete Skulpturen, die die Herrschaft des Dogen über das Meer verherrlichen sollten, zierten die Längsseiten der prunkvollen Galeere oberhalb der langen Reihe der rot lackierten Ruder. Dazwischen leuchteten Meerjungfrauen, Seepferdchen und springende Delfine im von den Wellen funkelnd reflektierten Sonnenlicht. Der Bug des Schiffes war mit einer goldschimmernden Figur geschmückt, die dem Schaum der Wellen zu entsteigen schien. Das Deck war bis zum hohen Heck mit dem Thron des Dogen von einem purpurroten Baldachin beschattet. Welch eine beeindruckende Zurschaustellung venezianischer Macht, die durch die Anwesenheit von vier Admirälen und hundert Kapitänen noch unterstrichen wurde. Hundertsechzig Arbeiter aus dem Arsenale, der Flottenwerft von Venedig, ruderten am Himmelfahrtstag die Staatsgaleere.
Der Patriarch Antonio Contarini, der den Dogen an Deck erwartete, half mir an Bord. »Celestina, Ihr seht heute wieder entzückend aus! Wie ein Engel, der von den Wolken des Himmels herabsteigt.«
»Ich danke Eurer Eminenz«, lächelte ich. »Ich hoffe, dass Ihr mich nicht für den aufziehenden Sturm verantwortlich macht!« Ich wies auf die Gewitterwolken über dem Lido.
Nach seiner Ernennung zum Patriarchen von Venedig hatte Antonio Contarini die Serenissima als zutiefst unmoralische und unchristliche Stadt bezeichnet. In einem Anfall von Glaubenseifer hatte er verfügt, dass die Venezianer drei Tage lang fasten sollten, um von Gott die Vergebung ihrer Sünden zu erreichen. Wehe dem, der nicht zur Beichte erschien! Contarinis Ruf zur Umkehr hatte einen ähnlichen Erfolg wie Savonarolas apokalyptische Predigten in Florenz. Die Wirkung hielt jedoch nicht wie in Florenz fünf Jahre, sondern kaum mehr als fünf Wochen an. Sollte eines Tages die von Christus verkündete Gottesherrschaft doch noch über die Welt hereinbrechen, würde sie Venedig als letzte Stadt erreichen – laut Contarinis zornigen Worten erst lange nach Sodom und Gomorrha.
Der Patriarch verzog keine Miene. »Nicht für dieses Unwetter mache ich Euch verantwortlich! Aber sagt mir: Wann habt Ihr zuletzt einen Sturm gemieden?«
Er spielte auf meine Auseinandersetzung mit dem Humanisten Giovanni Montefiore in Florenz an.
»Ich wehre mich, wenn ich angegriffen werde.«
»Und Eure Worte reißen schmerzhafte Wunden. Giovanni Montefiore hat sich bei Giulio de’ Medici, dem Erzbischof von Florenz, bitter über Euch beklagt. Der Skandal um das ägyptische Evangelium hat in Rom hohe Wellen geschlagen. Kardinal de’ Medici hat mir geschrieben. Ich wäre glücklich, wenn Ihr Euch in Zukunft gegenüber einem angesehenen Humanisten wie Giovanni Montefiore um etwas mehr Zurückhaltung bemühen würdet …«
»… wie es einer Frau zukommt. Das wolltet Ihr doch sagen, nicht wahr, Euer Eminenz? Sanft, gehorsam und still. Ohne eigene Meinung. Eben das ist der Grund, warum ich Humanistin geworden bin: Weil ich für meine Rechte als Frau und für meine Würde als Mensch kämpfe! Mein Vater war Mitglied im Consiglio dei Savi. Ich bin fünfundzwanzig, und wenn ich sein Sohn gewesen wäre, hätte ich nun einen Sitz im Maggior Consiglio inne. Da ich jedoch als seine Tochter auf eine Stimme im Senat verzichten muss, werde ich es mir nicht nehmen lassen, meine Meinung außerhalb des Ratssaals frei zu äußern.«
Eingedenk meiner engen Beziehung zum Papst schluckte der Patriarch seine Antwort herunter.
»Ein Humanist ist nur glücklich, wenn er seine Feder schwingen kann«, fuhr ich unbeirrt fort. »Dieser ruhmsüchtige Florentiner Tintenkleckser müsste sich geschmeichelt fühlen, dass ich seine Beleidigungen überhaupt einer Antwort würdige und mich auf dieses Duell der spitzen Federn einlasse – das im Übrigen nicht er gewinnen wird!«
Vor einigen Wochen hatte Giovanni Montefiore der verstreuten Nation der Humanisten verkündet, er habe in einem ägyptischen Kloster eine uralte griechische Papyrushandschrift gefunden, die er für ein noch unbekanntes Evangelium hielt. Ich war zu ihm nach Florenz gereist, um mir den Papyrus anzusehen, denn auch ich besaß eine antike Handschrift aus dem Katharinenkloster im Sinai. Ich hatte es gewagt, ihm ins Gesicht zu sagen, dass ich sein Evangelium für eine Fälschung hielt. Wohlgemerkt: Ich hatte nie erklärt, dass ich ihn für einen Fälscher hielt, sondern lediglich die Echtheit des Papyrus bestritten. Denn weder die Tinte noch die griechische Sprache, in der das Dokument verfasst war, entstammten der Antike. Zudem endete der Text mitten im Satz, als sei der Schreiber bei seiner Arbeit unterbrochen worden. Ich weigerte mich also, diesen Papyrus als Evangelium zu bezeichnen.
Seither verspritzte Giovanni Montefiore Unmengen von Tinte, um mich zu beleidigen, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen und mein Urteil über den Papyrus lächerlich zu machen: Ich war ja nur eine Frau! Doch inzwischen war der umstrittene Papyrus auch von anderen Gelehrten als Fälschung entlarvt worden. Viele Humanisten in ganz Europa hatten die Korrespondenz mit ihm eingestellt. Sic transit gloria!
Kardinal Domenico Grimani, der zur Feier der Himmelfahrt Christi aus Rom angereist war, schien sich im Gegensatz zum Patriarchen über mein Duell der Federn mit Montefiore zu amüsieren. Hatte der Papst ihm mein Manuskript gezeigt, das er, wie Baldassare mir erzählt hatte, das ›Credo der Humanitas‹ nannte?
Während ich Domenico mit einem Ringkuss begrüßte, strömten die Senatoren und Prokuratoren an Bord. Der Doge nahm auf seinem Thronsessel am Heck der Galeere Platz.
Kommandos wurden gebrüllt, Seile losgemacht, Ruder ins Wasser getaucht.
Baldassare und ich lehnten nebeneinander an der Bugreling, als das Schiff ablegte. Tristan war in ein offenbar sehr ernsthaftes Gespräch mit Leonardo Loredan vertieft. Als er bemerkte, dass ich zu ihm hinübersah, lächelte er. Da wandte ich mich wieder um und sah mit Baldassare hinaus auf die türkisfarbene Lagune.
Durch den Bacino di San Marco, den Hafen von Venedig, wurde die Galeere des Dogen zum Lido hinübergerudert. In feierlicher Prozession begleiteten Hunderte prächtig geschmückter Boote und bunt bemalter Gondeln den Bucintoro an der Riva degli Schiavoni entlang zur Vermählung mit dem Meer.
»Welch ein Anblick!« Baldassare bestaunte die großen Kriegsgaleeren und Handelsschiffe, die im Hafen zwischen San Giorgio Maggiore, der Giudecca und dem Canal Grande ankerten. »Venedig ist die Königin der Meere.«
»Die Serenissima ist eine tragische Schönheit«, erwiderte ich. »Der Krieg gegen den Papst, den Kaiser und den König von Frankreich, das Interdikt, die fallenden Gewürzpreise, die Flüchtlinge von der Terraferma, der Hunger und die Pest – all das hat Venedig in den letzten Jahren überstanden. Doch die Königin der Meere versinkt jedes Jahr tiefer in die Lagune. Sie stirbt, wie sie gelebt hat: großartig und stolz.«
»Venedig versinkt im Meer, und Rom erhebt sich aus seinen Ruinen«, versuchte er erneut, mich in die Ewige Stadt zu locken.
Während wir die Ostspitze der Insel umrundeten, betrachteten wir San Pietro di Castello, die Bischofskirche des Patriarchen. Wenig später erreichte das Dogenschiff den Lido und das offene Meer, das silbern im Sonnenlicht glitzerte.
Von Osten fegten die düsteren Sturmwolken heran. Über dem Horizont zuckten die ersten Blitze. Der ferne Donner übertönte die Glocken von San Marco, deren Klang über die Lagune wehte.
Die Boote und die geschmückten Gondeln waren der Galeere des Dogen gefolgt – manche von ihnen so nah, dass ihre Ruder die Ruderer des Bucintoro behinderten.
Leonardo Loredan erhob sich nun von seinem Thron und kam zum Bug der Staatsgaleere, wo ich mit Baldassare auf ihn wartete. Den Ring, das Symbol der Herrschaft, hatte der Patriarch aus der Schatulle in der Rückenlehne des Throns genommen und feierlich gesegnet. Nun reichte er ihn mir auf einem Samtkissen. Ich löste die Bänder, die den kostbaren Goldring festhielten, und gab ihn dem Dogen.
Gedankenvoll musterte er mich. Ahnte er, weshalb Baldassare nach Venedig gekommen war?
Schließlich wandte er sich ab, um den Ring ins Meer zu werfen.
»Desponsamus te, mare nostrum«, rief er laut, damit man ihn auch auf den anderen Booten und Gondeln hörte. »Wir vermählen Uns mit dir, o Meer, als Zeichen der wahren und ewigen Beherrschung.«
Die Zuschauer jubelten. Viele umarmten sich stürmisch, und so manche Gondel schwankte gefährlich auf den Wellen.
Dann sprangen die venezianischen Fischer ins Wasser, um nach dem Ring zu tauchen und ihn dem Dogen als Zeichen seiner Herrschaft über das Meer zurückzugeben. Immer mehr Männer stürzten sich lachend und prustend in die Wogen. Sie tauchten wieder auf, hielten sich keuchend an den Rudern des Bucintoro fest und verschwanden wieder.
Dann hatte einer der Männer den Ring gefunden. Er hielt ihn triumphierend in der ausgestreckten Hand, schwamm zum Bucintoro und kletterte an Deck, um ihn dem Dogen zu bringen.
Nach der feierlichen Zeremonie wurde das Dogenschiff zur Kirche San Nicolò auf dem Lido gerudert, wo Leonardo Loredan mit seinem Gefolge an Land ging, um dort die Messe zu besuchen.
Während die Prokuratoren und Senatoren dem Staatsoberhaupt folgten und vor dem herannahenden Gewittersturm in die Kirche flohen, kam Tristan mir so nah, dass sich unsere Hände einen Herzschlag lang berührten.
Was hatte der Doge ihm gesagt?, fragte ich mich beunruhigt. Und worüber wollte er mit mir sprechen?
Die Blitze zuckten über Venedig, und der Donner dröhnte, als Zaccaria Dolfins Boot drei Stunden später, nach der Messe in San Nicolò, am Molo anlegte.
Der Senator, der nur wenige Ruderschläge von meinem Palazzo entfernt am Canal Grande wohnte, hatte sich erboten, mich auf seinem Boot mitzunehmen. Er nahm an, dass ich auf dem schnellsten Weg nach Hause zurückkehren wollte. Doch während der Fahrt hatte ich ihn gebeten, mich an der Piazzetta abzusetzen.
Baldassare hatte sich nach dem Gottesdienst im strömenden Regen von mir verabschiedet. Nun ließ er sich zur Terraferma hinüberrudern, um die Reise nach Mantua fortzusetzen.
Am Landungssteg des Molo zog ich mir die hohen Zoccoli aus und huschte über die regennassen Stufen an Land. Der Bucintoro hatte bereits wieder abgelegt und war auf dem Weg zurück ins Arsenale.
Ich raffte meinen Rock und rannte durch den niederrauschenden Regen über die Piazzetta zur Porta della Carta. Wegen des Gewitters war es so dunkel, dass ich hinter der Basilika und dem Campanile kaum den Uhrturm am Eingang zur Merceria, der Straße der Händler zwischen San Marco und dem Rialto, erkennen konnte.
Viele Verkaufsstände, die jedes Jahr an Himmelfahrt auf der Piazza San Marco aufgebaut wurden, hatte der Wind umgeweht. Bunte Sonnensegel flatterten haltlos im Sturm, und die Regenfluten hatten die angebotenen Zuckerwaren mit sich gerissen.
Ein kleiner Crucifixus wurde von den umgestürzten Reliquienständen in Richtung Molo geschwemmt. Er schwankte auf den Wellenwirbeln zwischen den Pflastersteinen, wurde herumgeworfen und weiter fortgerissen. Ich hob ihn auf, bevor er in die Lagune gespült wurde.
Dann durchquerte ich den von Fackeln erhellten Torgang des Palazzo Ducale.
Während ich die Treppe zur Loggia hinauflief, warf ich einen Blick hinauf zu meinem ›Königreich der Himmel‹, jener staubigen Dachkammer, in der ich so viele Nächte meiner Kindheit verbracht hatte.
In der Loggia hielt ich einen Augenblick inne. Ich war tropfnass. Meine aufgesteckten Haare hatten sich gelöst und fielen mir über die Schultern. So konnte ich unmöglich vor dem Dogen erscheinen!
Nachdem ich meine Haare geordnet und zu einem Knoten gebunden hatte, schlüpfte ich wieder in die hohen Zoccoli und eilte an der Bocca di Leone vorbei zur Treppe zu den oberen Stockwerken.
Im Palast wurde das abendliche Bankett vorbereitet. Von der Küche wehte ein betörender Duft nach frischem Brot zu mir herüber. In der Sala del Maggior Consiglio, wo das Festessen stattfinden sollte, übte ein Musiker auf der Geige ein fröhliches Lied. Wie ich mich auf diesen Abend freute! Tristan und ich würden die ganze Nacht tanzen. Dann würde er mich zur Ca’ Tron bringen und leidenschaftlich lieben.
Versonnen lächelnd stieg ich die Treppe zur Dogenwohnung empor und betrat die Sala degli Scarlatti, das Vorzimmer für die Berater und Sekretäre des Dogen.
»Er erwartet Euch«, erklärte mir sein Sekretär und öffnete mir die Tür zur Sala delle Mappe, deren Wände Landkarten der venezianischen Hoheitsgebiete auf der Terraferma und im östlichen Meer zierten.
Der Saal war leer.
Aus einem der hinteren Räume der Dogenwohnung vernahm ich das Prasseln eines Feuers, und so schritt ich weiter.
Ich fand ihn in einem Sessel vor dem flackernden Kaminfeuer. Leonardo trug nicht mehr die goldgelbe Brokatrobe des Dogen, sondern einen weiten dunkelblauen Mantel mit Hermelinbesatz. Er wirkte erschöpft. Sein Gesicht war eingefallen – hatte er wieder Schmerzen? Achtundsiebzig Lebensjahre hatten tiefe Spuren in sein Gesicht gegraben.
»Du wolltest mit mir reden, Leonardo.«
»Setz dich, mein Kind!«
Ich nahm auf dem Sessel gegenüber Platz, um mich vom Feuer trocknen zu lassen.
Er starrte in die Flammen und schien nach den richtigen Worten zu suchen.
»Du hast vorhin sehr ernsthaft mit Tristan gesprochen«, sagte ich in das Schweigen hinein.
»In der Ratssitzung gestern Nacht ist Tristan zu einem der drei Vorsitzenden des Zehnerrats gewählt worden«, offenbarte er mir schließlich.
Tristan hatte sein ehrgeiziges Ziel erreicht!, freute ich mich für ihn. Er war der einflussreichste Mann Venedigs, mächtiger als der Doge, der ihn all die Jahre gefördert hatte.
In Venedig herrschte ein republikanisches Misstrauen gegenüber der Macht einzelner Adliger. Positionen im Zehnerrat und im Rat der Weisen wurden nur für ein Jahr vergeben – lediglich der Doge und die Prokuratoren wurden auf Lebenszeit ernannt. Die zehn Consiglieri dei Dieci wurden jedes Jahr vom Senat neu gewählt. Außerdem gehörten dem Rat der Doge und seine Berater sowie ein Verfassungsrichter an.
Jeden Monat wählten die Ratsmitglieder drei Vorsitzende aus ihrem Kreis, die unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit Staatsverbrechen wie Hochverrat und Verschwörung gegen die Republik untersuchten oder außenpolitische Missionen leiteten.
Die unbeschränkte Macht, die geheimnisumwitterten nächtlichen Sitzungen, die Geheimpolizei, die Denunziationen in den Bocche di Leone und vor allem die Angst hatten zur Folge, dass die anderen Senatoren die Consiglieri dei Dieci äußerst misstrauisch überwachten.
»Ein Mitglied des Rats der Zehn muss über jeden Zweifel erhaben sein«, erklärte der Doge. »Vor einigen Tagen wurde ein anonymer Brief in die Bocca di Leone in der Loggia des Dogenpalastes geworfen. Tristan wird beschuldigt, eine Affäre zu haben.«
»O mein Gott!«, entfuhr es mir.
»Ja, das habe ich auch gesagt, als der Brief gestern Nacht im Rat der Zehn verlesen wurde. Eure Liebe kann Tristans Sturz bedeuten, das Ende einer glänzenden Karriere. Aber das ist noch nicht alles: Tristan soll die Signori di Notte bestochen haben. Dieser Vorwurf ist noch viel gefährlicher! Ein Consigliere nimmt Einfluss auf die Signori di Notte, deren Aufgabe es ist, nachts für die Sicherheit in den Straßen Venedigs zu sorgen! Und für das sittlich einwandfreie Verhalten der Venezianer.«
Ich schwieg.
Tristan und ich hatten doch von Anfang an gewusst, welche gefährlichen Folgen unsere Liebe haben konnte.
»Die Dieci haben beschlossen, die Anschuldigung gegen einen der Ihren zu ignorieren. Der Brief war anonym. Dem Denunzianten ging es also nicht um die fünfzig Zecchini Belohnung. Er verzichtet auf ein kleines Vermögen! Eine Anklage vor dem Rat der Zehn war demnach nicht beabsichtigt.
Offenbar sollte der Brief eine Warnung für Tristan sein. Und für dich. Eines ist gewiss: Niemand aus dem Zehnerrat hat ihn verfasst, denn Tristan ist in derselben Nacht zum Vorsitzenden gewählt worden. Alle haben ihm ihr Vertrauen ausgesprochen.
Ich habe den Brief heute Morgen in Tristans Beisein verbrannt, während wir miteinander sprachen. Denn ich vermute, dass dies nicht der letzte Brief sein wird.«
»Hast du Tristan verboten, mich wiederzusehen?«
»Nein, Celestina, ganz im Gegenteil«, entgegnete Leonardo. »Ich habe ihn aufgefordert, dich endlich zu heiraten!«
»Aber wir sind uns einig … ich meine: Wir haben einander versprochen, dass wir nicht heiraten wollen. Wozu denn auch? Wir sind glücklich.«
»Ihr verstoßt gegen Anstand und Moral!«
»Wir lieben uns!«
Mit einer energischen Geste fegte er mein Argument beiseite. »Tristan wird morgen sein Amt als Vorsitzender des Consiglio dei Dieci antreten. Sollte er nächstes Jahr nicht in den Rat der Zehn wiedergewählt werden, stehen ihm alle anderen Ämter der Republik offen. Er kann Prokurator werden. Und in einigen Jahren Doge. Das kann er aber nur, wenn er verheiratet ist! Ein Doge braucht eine Dogaressa! Und einen sittlich vollkommenen Lebenswandel.«
Ich sagte nichts.
»Tristan ist siebenundzwanzig. Ich bin achtundsiebzig. Vielleicht bleiben mir trotz meiner Krankheit noch ein paar Jahre. Ich will, dass Tristan mir eines Tages nachfolgt.«
»Der Doge wird in geheimer Abstimmung gewählt. Jeder adelige Venezianer kann Staatsoberhaupt werden«, erinnerte ich ihn. »Du kannst deinen Nachfolger nicht bestimmen.«
»Nein, aber viele Kandidaten für dieses Amt gibt es nicht. Der Prokurator Antonio Grimani ist inzwischen einundachtzig Jahre alt. Glaubst du, dass der Maggior Consiglio ihn in dieser verzweifelt schwierigen Zeit von Krieg, Not und wirtschaftlichem Niedergang zum Dogen wählen wird? Glaubst du, der ehemalige Admiral der Flotte kann als Steuermann das festgefahrene Staatsschiff in ruhigere Gewässer lenken? Nun ja, wenn ich es mir überlege, ist der alte Grimani vielleicht doch noch eine bessere Wahl als sein und mein Lieblingsfeind Antonio Tron.
Ich jedenfalls werde alles tun, um zu verhindern, dass dein Cousin Antonio Doge wird. Der Prokurator behauptete vor wenigen Tagen im Maggior Consiglio wieder einmal, ich sei unfähig: ›Nichts in dieser Stadt wird in Ordnung kommen, solange Leonardo Loredan regiert!‹ Dieser widerwärtige Intrigant!
Ich denke, es ist auch in deinem Sinne, wenn Antonio nicht Doge wird. Er wird dich wieder ins Exil schicken – wie vor fünf Jahren nach dem Tod deiner Eltern. Das nächste Mal kann ich dir nicht helfen, Celestina. Oder er lässt die Staatsinquisition dein Haus durchsuchen und dich im Gefängnis verschwinden. Die verbotenen Bücher in deiner Bibliothek werden die römische Inquisition nach Venedig bringen. Und du weißt, wie das Urteil lauten wird!«
Er sah mich scharf an, dann drang er weiter in mich:
»Ich glaube, dass Tristan ein besserer Doge sein wird als Grimani und Tron. Er ist jung, selbstbewusst, hat hohe Ideale und eine großartige Vision von Venedig. Tristan ist der Mann, der Papst Leo, König François und Kaiser Maximilian Widerstand leisten kann. Das Kämpfen hat er bei deinem Vater gelernt. Die Venier gehören zum alten venezianischen Adel. Auf diesen Fundamenten wurde Venedig erbaut!
Tristan ist ein Nachkomme des großen Dogen Antonio Venier. Unter seiner Herrschaft war Venedig der mächtigste Staat Europas. Antonio Venier ist eine Ikone, sein Name steht für die Unbesiegbarkeit der venezianischen Seemacht. Aber eine Ikone muss glänzen, Celestina, sie darf nicht in den Schmutz gezogen werden. Der künftige Doge Tristan Venier muss unangreifbar sein. Und das bedeutet, dass ihr beide heira…«
»Ich will nicht heiraten!«
»Celestina, sei vernünftig!«, beschwor er mich. »Du bist die ideale Dogaressa. Du bist gebildet, besonnen, charmant und sprichst mehrere Sprachen. Du bist die Frau, die Tristan an seiner Seite braucht.«
Unbeherrscht sprang ich auf und lief zum Fenster, um in den Innenhof des Palazzo Ducale hinabzusehen. Die niederrauschende Sintflut überschwemmte den Cortile. Ich lehnte meine Stirn gegen die Glasscheiben, schloss die Augen und dachte nach.
Selbst eine Frau aus einer reichen und adeligen Familie war in Venedig nicht finanziell unabhängig. Der Besitz, den sie mit in die Ehe brachte, gehörte fortan ihrem Gemahl. Sie durfte nicht allein reisen und nicht einmal allein das Haus verlassen, um am Sonntag zur Messe zu gehen. Eine Frau war in Venedig nur die juwelengeschmückte Zierde am Arm ihres Mannes, die mit sittsam gesenktem Blick zu schweigen hatte.
Mein Vater hatte mir sein Vermögen hinterlassen: einen großartigen Palazzo am Canal Grande, ein ebenso schönes Haus unterhalb der Akropolis von Athen und eine kostbare Büchersammlung, die die respektvolle Bezeichnung Bibliothek verdiente. Ich war unabhängig. Und frei.
Im Dogenpalast wäre ich eingesperrt gewesen wie ein Vogel in einem goldenen Käfig. Tristan und ich besaßen prächtige Palazzi. Mein Arbeitszimmer war so groß wie der Empfangssaal der Dogenwohnung. Meine umfangreiche Bibliothek hätte ich in diesen Räumen niemals unterbringen können. Dort gab es keinen Arbeitsraum, keine Dachterrasse, keinen Garten, keine Loggia, wo ich lesen, schreiben, denken, atmen, leben konnte.
Eine Heirat mit dem künftigen Dogen hätte für mich den Verlust meiner unter großen Opfern erkämpften Freiheit bedeutet. Bisher war mein Geliebter für mich die Garantie meiner Selbstentfaltung jenseits aller strengen gesellschaftlichen Konventionen gewesen. Das Vertrauen, das Lieben, das Sehnen, das Umeinanderkämpfen war ein Spiel, das unser Leben interessant machte, uns zu immer neuen Ideen und Überraschungen anregte und niemals langweilig wurde. Wie sehr liebten Tristan und ich unsere Freiheit!
Ich betrachtete den Ring an meiner Hand, einen lagunenblauen Topas, den verschlungene Ornamente aus Gold festhielten.
»Ich werde dich lieben und ehren, bis der Tod uns trennt. Und jeden Tag meines Lebens will ich um dich kämpfen«, hatte er in jener Nacht gesagt, als wir mit feierlichem Schwur die Ringe tauschten.
Liebe ist wie das Licht einer Kerze: Man kann es nicht festhalten – weder durch einen Ring noch durch ein Wort. Man muss das Licht entzünden, die Flamme hüten und vor dem Sturm bewahren. Denn wenn das Licht erlischt, ist es zu spät. Tristan und ich waren uns einig, dass wir einander nicht besitzen und uns nicht durch ein Eheversprechen aneinander binden, sondern jeden Tag aufs Neue suchen und finden und wieder verlieren wollten, um uns wieder auf die Suche zu machen. Und sollte eines Tages die hell lodernde Flamme der Liebe verloschen sein, würden wir einander die Ringe zurückgeben.
»Weiß Tristan von unserem Gespräch?«, fragte ich, ohne mich zu Leonardo umzuwenden.
»Nein, er hat keine Ahnung. Er hat mich um Rat gefragt, wie er sich dir gegenüber verhalten soll. Ich hielt es für das Beste, mit dir zu sprechen, bevor er es heute Nacht tut. Tristan hat Angst vor deinem Nein. Er fürchtet, dass es für immer zwischen euch stehen wird. Und dass er dich verlieren wird, wenn er dich um deine Hand bittet. Er liebt dich so sehr!«
Ich wandte mich zu ihm um. »Aber offensichtlich liebt er mich nicht genug, um auf das Amt des Dogen zu verzichten.«
»Du tust ihm Unrecht!«, versuchte Leonardo mich zu beschwichtigen.
»Und er erwartet von mir, dass ich meine eigene Karriere als Humanistin aufgebe, um ihm die seine zu ermöglichen. Leonardo, ich habe heute Nachmittag eine Einladung des Papstes nach Rom ausgeschlagen.«
Er war bestürzt. »Celestina …«
»Als Dogaressa kann ich nicht mehr als Humanistin arbeiten und mit Gelehrten in aller Welt korrespondieren. Es ist mir nicht erlaubt, Bücher zu verfassen oder nach Istanbul oder Alexandria zu reisen. Ich darf keine Entscheidungen mehr treffen, keine eigene Meinung haben und meinem Gemahl, dem Dogen von Venedig, nicht widersprechen. Ich bin dann nicht mehr frei!«
Traurig sah er mich an, denn er wusste, wie weh er mir tat. »Manchmal muss man Opfer bringen …«
»Das sagst gerade du mir, Leonardo?«, unterbrach ich ihn. »Du, der Mann, der die Türken zurückgeschlagen und mit zwei Päpsten Krieg geführt hat, die Venedig ihre Souveränität und Freiheit nehmen wollten? Der Mann, der vor sechs Jahren in der Schlacht von Agnadello seinen besten Freund verlor – meinen Vater! Du, von allen Menschen ausgerechnet du, willst mir einreden, dass ich meine Freiheit aufgeben soll? Nein, Leonardo, ich habe zu kämpfen gelernt, bei meinem Vater und bei dir. Das Aufgeben habt ihr beide mich nicht gelehrt!«
Leonardo schwieg betroffen.
»Und Opfer habe ich gebracht!«, fuhr ich unbeirrt fort. »In den letzten Jahren ist mir alles genommen worden, was mir jemals etwas bedeutet hat. Mein Vater fiel im Krieg gegen den König von Frankreich, den Papst und den Kaiser. Er starb für die Freiheit Venedigs. Für meine Freiheit, Leonardo!
Meine Mutter starb nur wenige Monate später an der Pest, die die Kriegsflüchtlinge aus dem eroberten Padua nach Venedig trugen. Dann verlor ich meinen gesamten Besitz an meinen Cousin Antonio und musste ins Exil nach Athen gehen. Aber ich habe gekämpft. Ich bin wieder in Venedig!«
»Celestina, mein liebes Kind …«
»Mein Vater hat mich gelehrt, dass man seinen Glauben nicht am Abend mit der Kleidung ablegt, um sich am nächsten Morgen für einen neuen zu entscheiden, der bequemer ist. Für seinen Glauben ist er in den Tod gegangen. Und auch ich glaube an die Freiheit des Menschen.«
»Um Gottes willen! Celestina, ich bitte dich …«
»Dir verdanke ich meinen Ruhm als Humanistin – gegen die Bestimmungen des Senats hast du mir den Schlüssel zum ›Königreich der Himmel‹ gegeben! Mein Streben nach Erkenntnis, nach Wahrheit, nach Freiheit begann in einer staubigen Dachkammer im Westflügel des Dogenpalastes!«
»Ich will, dass du Tristan heiratest. Und ich will, dass du noch heute Nacht, bevor es zu spät ist, die Bücher verbrennst, die euch beide auf den Scheiterhaufen der Inquisition bringen können! Dich, weil du sie besitzt, ihn, weil er davon wusste.«
Ich war zornig gewesen über seine Forderung. Verzweifelt. Traurig. Und doch wusste ich: Er hatte Recht. Was ich tat, war lebensgefährlich.
Im Innersten aufgewühlt verließ ich den Palazzo Ducale und trat hinaus auf die Piazzetta.
Verbrenne die Bücher! Verbrenne alles, was du bist, alles, was du sein willst, alles, woran du glaubst! Und dann wirf auch deine Freiheit auf diesen lodernden Opferaltar!
Oder steig selbst auf den Scheiterhaufen!
Was sollte ich tun? Die Bücher verbrennen und Tristan heiraten? Oder der Einladung des Papstes folgen und mit den Büchern nach Rom gehen? Einsam, aber frei.
Der Regen hatte aufgehört, doch niemand hatte die umgestürzten Verkaufsstände auf der Piazza San Marco wieder aufgerichtet. Die regennasse Piazza war ein riesiger Spiegel, der das unter den letzten Sonnenstrahlen goldglühende Venedig reflektierte – ein zauberhafter Anblick, den ich schon oft von den Arkaden der Prokuratien aus bewundert hatte.
Die beiden bronzenen Figuren auf dem Uhrturm neben der Basilika schlugen die große Glocke zur vollen Stunde – ein unheimliches Dröhnen angesichts der apokalyptischen Verwüstung. Am Himmelfahrtstag erschienen zu jeder vollen Stunde in einer der beiden Türen des Uhrturms die Heiligen Drei Könige, die sich vor der Madonna verneigten und dann durch die andere Pforte wieder verschwanden. So gern ich als Kind dieser bezaubernden Prozession der Figuren zugesehen hatte – an diesem Tag hatte ich keinen Blick dafür. Ich fror in meinem nassen Kleid und zitterte vor Verzweiflung und Zorn.
An der gegenüberliegenden Seite, zwischen den Arkaden der Prokuratien und dem Krankenhaus von San Orseolo, verließ ich die Piazza San Marco. Hinter den Kirchen San Teodoro und San Gemignano, die die Westseite der Piazza begrenzen, bog ich in die Calle dell’Ascension ein und wandte mich nach rechts zur Kirche San Moisè. Dann folgte ich den Gassen, die immer wieder die Richtung ändern, über Brücken und Kanäle und kleine Plätze bis zum Campo San Stefano. Von dort waren es nur wenige Schritte zu meinem Palazzo am Canal Grande.
Um diese Jahreszeit war der Campo ein blühender Garten. Doch der Sturm hatte viele Äste von den Bäumen gerissen, und der niederprasselnde Regen hatte die Blüten zerdrückt.
Eine Schar Tauben flog auf, während ich den weiten Platz überquerte. Ich sah ihnen nach, wie sie sich in den wolkenschweren Himmel hinaufschwangen und hinter der roten Backsteinfassade der Kirche San Stefano verschwanden.
Sie waren frei. Ich war es nicht.
Menandros öffnete mir das Portal. Er hatte mich erwartet, weil er von Zaccaria Dolfins Diener wusste, dass ich nach der Zeremonie am Molo ausgestiegen war und offenbar noch mit dem Dogen gesprochen hatte.
Er erschrak, als er mich sah: »Um Himmels willen, Celestina, wie siehst du aus?«, flüsterte er im vertrauten Griechisch. »Was ist geschehen?«
»Nichts, Menandros. Noch nicht«, sagte ich leise. An ihm vorbei drängte ich ins Haus.
»Tristan war vor einer Stunde hier und hat nach dir gefragt. Er schien nicht zu wissen, dass du beim Dogen warst.« Menandros verriegelte die Tür und folgte mir zur Treppe.
»Pack die Reisetruhen! Im ersten Morgengrauen werden wir nach Rom reiten. Wir müssen die Bücher so schnell wie möglich vor der Inquisition in Sicherheit bringen. Ich werde mich unter den Schutz des Papstes stellen. Gianni wird nicht zulassen, dass Tristan bedroht wird, nur weil er von den Büchern wusste.«
»Du zitterst am ganzen Körper. Alexia wird dir in deinem Schlafzimmer ein heißes Bad richten und dann deine Truhen packen: Hosen für den langen Ritt und die schönsten Kleider für den Empfang im Vatikan. Rom wird dir zu Füßen liegen! Ich kümmere mich um ein Boot, das unsere Pferde, die Reisetruhen und die Bücherkisten zur Terraferma bringt. Vielleicht kann Zaccaria Dolfin uns aushelfen: Er besitzt ein großes Boot. Dann helfe ich dir beim Packen der Bücher.«
Als er ging, um die Abreise vorzubereiten, stieg ich die breite Marmortreppe empor in den ersten Stock, wo sich der prächtige Empfangssaal mit Blick auf den Canalazzo befand, und von dort aus hinauf zum Arbeitszimmer im zweiten Stock.
Noch nie war mir dieser großartige und für mich viel zu große Palazzo so verlassen erschienen wie an diesem Abend: Seit dem Tod meiner Eltern standen die meisten Räume leer. Noch nie hatte ich mich so einsam gefühlt – nicht einmal in jener Nacht, als ich überstürzt nach Athen fliehen musste, um mein Leben zu retten.
Ich betrat mein Arbeitszimmer mit der Bibliothek. Es war fast dunkel in dem großen Raum, dessen fünf große Fenster mit den filigranen Spitzbögen tagsüber das Funkeln der Wellen des Canalazzo einfingen. Die Sonne war inzwischen untergegangen, und von Osten her zog die Nacht herauf.
Ich riss mir die nassen Kleider vom Leib. Nackt setzte ich mich in den mit purpurrotem Leder bezogenen Stuhl vor meinen Schreibtisch und schlang die Arme um die angezogenen Knie. Eine Weile saß ich so, still und in mich gekehrt, und starrte die Bücher in den Regalen an, die Manuskriptseiten auf meinem mit Folianten, Tintenfass, Federspitzer, Siegelwachs, Sandstreuer und einem Bündel Gänsefedern bedeckten Schreibtisch.
Ich zog das Buch zu mir heran, mit dem ich zuletzt gearbeitet hatte: Giovanni Pico della Mirandolas Conclusiones. Seine berühmten neunhundert Thesen, die er 1486 in Rom mit den Kardinälen disputieren wollte und für die er vom Inquisitionstribunal exkommuniziert worden war. Giovanni Pico war der Scheiterhaufen erspart geblieben – seinen Büchern nicht. Dies war eines der wenigen Exemplare der Conclusiones, die noch existierten.
Traurig blätterte ich durch das Buch und las hier und da eine seiner Thesen: ›Intellectus agens nihil aliud est quam Deus – Der aktive Verstand, das Denkvermögen, die Einsicht, ist nichts anderes als Gott‹, und ein paar Seiten zuvor: ›Tota libertas est in ratione essentialiter – Alle Freiheit existiert nur im Verstand.‹
Kein Wunder, dass die Kirche dieses wundervolle Buch verboten hatte! Konnte ich … durfte ich Leonardos eindringlicher Bitte entsprechen, dieses Werk verbrennen und seine Asche in den Wind verstreuen? Und was war mit all den anderen Büchern in diesem Raum, den christlichen und muslimischen, arabischen, griechischen und lateinischen Schriften, verfasst von Kardinälen und Patriarchen, Kirchenvätern und Gelehrten, Ketzern auf dem Thron des Papstes und Heiligen auf dem Scheiterhaufen?
Wenn ich Giovanni Picos Conclusiones verbrennen würde, obwohl er selbst nie gerichtet worden war, was war dann mit Fra Girolamo Savonarolas Meditationen? Der Mönch, den viele Florentiner für einen Heiligen und Märtyrer und alle anderen für eine Geißel Gottes hielten, war auf dem Scheiterhaufen gestorben. Nachdem ich seine tiefsten Gedanken, die er im Gefängnis niederschrieb, gelesen hatte, war ich überzeugt, dass er weder das eine noch das andere war. Er war ein Mensch, schwach und fehlbar, der die Wahrheit suchte und auf diesem steinigen Weg stolperte, stürzte, scheiterte. Denn die Wahrheit gab es nicht. Nicht einmal zwei Menschen, die in allem übereinstimmten wie Tristan und ich, konnten sich darüber einigen, was Wahrheit ist.
Tristan liebte mich zu sehr, um zu verlangen, dass ich meine verbotenen Bücher verbrannte. Er ließ mich gewähren, obwohl ihn meine Arbeit als Humanistin in einen furchtbaren Gewissenskonflikt stürzte. Er glaubte an die eine, allein seligmachende Wahrheit.
Tristan hatte nicht, wie ich, einen katholischen Vater und eine griechisch-orthodoxe Mutter. Er hatte nicht jahrelang im orthodoxen und von Muslimen beherrschten Athen gelebt. Er hatte keine Forschungsreisen nach Istanbul und Alexandria unternommen, um alte Schriften in Bibliotheken zu suchen. Er hatte sich nicht durch die Gluthitze der Wüste Sinai zum Katharinenkloster gequält, hatte nicht nachts am Lagerfeuer in der Wüste mit den Beduinen sehr leidenschaftlich über die Suren des Korans diskutiert. Er hatte seine Kindheit nicht im ›Königreich der Himmel‹ verbracht, um von den wunderbaren Früchten der Erkenntnis zu kosten, die ich genossen hatte.
Für Tristan gab es nur eine Wahrheit. Nie hatte er gezweifelt und sich die Fragen gestellt, auf die es keine Antwort gibt. Wer einmal, wie ich, angefangen hatte zu denken, zu zweifeln, zu fragen und sich, da es niemand anderer tat, auch die Antworten zu geben, konnte damit nicht mehr aufhören, denn er stellte am Ende alles in Frage: sich selbst, den Menschen und sein Handeln, die Welt, wie sie ist, und am Ende Gott. Ehrlich gesagt: Ich beneidete Tristan um seinen Seelenfrieden. Er musste nicht jeden Tag aufs Neue um seinen Glauben kämpfen.
Ich würde nach Rom gehen, die Bücher in Sicherheit bringen und in Ruhe überlegen, was ich künftig tun wollte. Venedig für immer zu verlassen, um wieder ins Exil zu gehen – ein furchtbarer Gedanke!
Mit Tränen in den Augen erhob ich mich von meinem Stuhl, entzündete die Kerzen im silbernen Leuchter und begann, die kostbaren Bücher, die ich nach Rom mitnehmen wollte, auf einem Tisch in der Mitte des Raumes aufzustapeln.
Ich zog Marsilio Ficinos Theologia Platonica aus dem Regal. Diesen Folianten brauchte ich, um mein Manuskript fertig stellen zu können. Da ich nicht wusste, ob Gianni das Exemplar, das sich vor Jahren in der Bibliothek des Palazzo Medici in Florenz befunden hatte, nach seiner Wahl zum Papst nach Rom mitgenommen hatte, musste ich es einpacken. Marsilio Ficino war Giannis Lehrer gewesen – wie Giovanni Pico della Mirandola.
»Dein Bad ist eingelassen, Celestina.«
Menandros stand in der Tür und beobachtete mich. Dass ich nackt war, war weder ihm noch mir peinlich. Es war nicht das erste Mal, dass er mich so sah – oder ich ihn. In den eisig kalten Wüstennächten auf dem Weg zum Katharinenkloster waren wir uns sehr nah gekommen. Menandros war mehr als nur mein Sekretär. Er war ein vertrauter Freund.
»Alexia erwartet dich in deinem Schlafzimmer. Sie hat deine Reisetruhen gepackt.«
»Ich bin noch lange nicht fertig.«
Ich zog ein weiteres Buch aus dem Regal, doch Menandros nahm mir den Folianten aus der Hand und umarmte mich tröstend. »Während ich die Bücher einpacke, die du in Rom benötigst, solltest du dich von Alexia verwöhnen lassen. Wir haben eine anstrengende Reise vor uns.«
Ich lehnte mich gegen ihn und ließ mich von ihm umarmen. Dann hauchte ich ihm ein »Evcharistó« auf die Wange und ging in mein Schlafzimmer, das sich direkt neben meiner Bibliothek befand.
Alexia, meine griechische Dienerin, die mich von Athen nach Venedig begleitet hatte, kümmerte sich rührend um mich. Sie half mir in die Wanne und goss Rosenöl ins Badewasser.
Mit geschlossenen Augen räkelte ich mich im heißen Wasser und dachte an Tristan.
Ich konnte nicht abreisen, ohne ihn noch einmal gesehen zu haben. Ich betrachtete den Topasring an meinem Finger – den Ring, der uns zu einem Paar machte, in Glück und Unglück … aber auch in Lebensgefahr?
Die Glocke von San Stefano schlug Mitternacht, als ich mich in den Sattel schwang. Menandros reichte mir die Zügel meines Pferdes, dann stieg auch er auf. Im Licht der Fackeln schimmerte der Griff seines Degens.
Nachts waren die Straßen von Venedig selbst für Reiter mit schnellen Pferden gefährlich. In jeder dunklen Gasse konnten Angreifer lauern. Obwohl die Signori di Notte nachts für Ruhe und Sicherheit sorgten, gab es seit dem Krieg so viele Flüchtlinge vom Festland, dass die Straßen unsicher geworden waren und viele dunkle Canali abseits des hell erleuchteten Canalazzo nachts mit Ketten gesperrt wurden.
Menandros und ich trabten über den Campo San Stefano. Das vorgeschriebene Schellenhalsband zur rechtzeitigen Warnung der Fußgänger – in den letzten Jahren hatte es in den engen Gassen viele schwere und sogar tödliche Unfälle gegeben – war den Pferden abgenommen worden. Wir mussten uns an drei Signori di Notte vorbeischleichen, die für die Stadtsechstel San Marco, San Polo und Santa Croce verantwortlich waren.
Hinter der Augustinerkirche San Stefano überquerten wir den Campo San Angelo. Dann tauchten wir in die Finsternis der engen Gassen ein, die zum Campo San Luca führten. Dort wandten wir uns nach links in die Calle del Carbon und erreichten den Canalazzo. Leise schwappten die Wellen gegen die mit Algen bewachsenen Fondamenti und Bootsstege mit den festgemachten Gondeln.
Wir hatten den Ponte di Rialto erreicht. Wie ich erwartet hatte, waren die hölzernen Zugbrücken in der Mitte des Ponte hochgezogen, und die Rialtobrücke, die einzige Verbindung zwischen dem Sestiere di San Marco, wo ich wohnte, und dem Stadtteil Santa Croce, wo sich die Ca’ Venier befand, war unpassierbar. Es gab nur diesen einen Übergang über den Canalazzo. Und wie jede Nacht wurde er von zwei Bewaffneten bewacht. Denn wenn der hölzerne Ponte di Rialto brannte, würde, wie vor einigen Jahren, auch der Fondaco dei Tedeschi, das Warenlager der Deutschen, in Flammen aufgehen. Das wäre eine Katastrophe gewesen, denn nur der Handel mit den deutschen Kaufleuten verhinderte seit der Entdeckung der Seewege nach Indien und dem Verfall der Gewürzpreise den Untergang des leckgeschlagenen Schiffes Venedig.
Als ich mich mit Menandros näherte, erhoben sich die beiden Bewaffneten von den Stufen der Brücke. Sie kannten mich. Und sie wussten, wie einflussreich Tristan Venier war. Deshalb ließen sie den hölzernen Mittelteil des Ponte di Rialto herab, damit wir auf die andere Seite gelangen konnten.
Auf dem Rialtomarkt bogen wir nach links zum Campo di San Polo ab, der durch die Fackeln an den Fassaden der Häuser beleuchtet wurde: Sie wurden erst nach ein Uhr gelöscht.
Hinter dem blühenden Garten des Campo ritten wir weiter in Richtung des Stadtteils Santa Croce. Durch ein finsteres Labyrinth enger, verwinkelter Gassen erreichten wir schließlich Tristans Palast am Canalazzo, wo wir vor dem Tor aus den Sätteln sprangen.
Ich sah an der schmucklosen Backsteinfassade der Rückseite des Palastes empor. Die Schlichtheit täuschte: Tristans Haus war eines der prächtigsten in Venedig und konnte sich stolz mit der filigranen, in Gold und Blau gehaltenen Ca’ d’Oro auf der anderen Seite des Canal Grande messen.
Alle Fenster zum Garten waren dunkel.
Ich schlug gegen das schwere Tor.
Alles blieb still. Offenbar wurde ich nicht erwartet.
Ich trat mit meinen Reitstiefeln gegen das Portal, während Menandros unsere Pferde in den Stall neben dem Garten führte.
Endlich erschien Tristans Kammerdiener Giacometto. Mit einem brennenden Kerzenleuchter in der Hand schob er das Tor auf und leuchtete mir ins Gesicht.
»Madonna Celestina!«, rief er erstaunt aus. »Verzeiht mir, ich wusste nicht, dass Ihr heute Nacht kommen wolltet. Der Signore ist sehr früh vom Bankett im Palazzo Ducale zurückgekehrt. Er war sehr enttäuscht, weil er Euch dort nicht getroffen hat.«
»Schläft er schon?«
»Er hat noch auf Euch gewartet, hat in seinem Arbeitszimmer an geheimen Akten gearbeitet und ist schließlich zu Bett gegangen. Gewiss schläft er schon.«
»Dann geh auch du zu Bett, Giacometto! Es ist schon spät. Ich finde den Weg auch ohne Kerzenleuchter. Und lass das Portal offen. Ich werde vor dem Morgengrauen wieder gehen.«
Er nickte. »Buona notte. Und viel Vergnügen!«
»Grazie, Giacometto. Gute Nacht!«
Er wartete mit dem Kerzenleuchter unten an der Treppe, bis ich den ersten Stock erreicht hatte. Dann kehrte er in sein Zimmer zurück. Im Dunkeln schlich ich weiter bis zu Tristans Schlafzimmer im zweiten Stock.
Leise öffnete ich die Tür und trat in den vom Mondlicht erleuchteten Raum. Tristan schlief fest. Unter dem dünnen seidenen Laken war er nackt.
Einen Augenblick lang stand ich vor dem Bett und betrachtete ihn traurig. Seinen schlanken, muskulösen und doch so anmutigen Körper, das schöne Gesicht mit dem bezaubernden Lächeln, umrahmt vom Glorienschein seiner schulterlangen, dunklen Haare.
Ich zog die Stiefel aus, die Hosen, das weite Seidenhemd. Dann legte ich mich neben ihn auf das Bett und küsste ihn wach.
Verschlafen öffnete er die Augen.
Er schlang seine Arme um mich und küsste mich. »Da bist du ja! Den ganzen Abend habe ich auf dich gewartet. Wo warst du? Warum bist du nicht zum Bankett gekommen?«
Ich wandte mein Gesicht ab, damit er im Mondlicht meine Tränen nicht sah. »Ich musste nachdenken.«
»Baldassare und du – ihr habt euch auf dem Bucintoro sehr ernsthaft unterhalten.«
So wie du und Leonardo!, dachte ich im Stillen.
»Baldassare sagte mir, mein Buch habe den Papst sehr beeindruckt. Gianni wünscht, dass ich zu ihm komme.«
»Du hast dich entschieden, nach Rom zu reisen.«
»Ja.«
Er atmete tief durch. »Wann?«
»Morgen.«
Enttäuscht ließ er sich in die Kissen zurücksinken und fuhr sich mit der Hand über die Augen. Er wusste, dass er kein Recht hatte, mich von dieser Entscheidung abzubringen. Denn damit hätte er unser Versprechen gebrochen, das wir uns in Florenz gegeben hatten, dem anderen niemals seine Freiheit zu nehmen. Nur so, einander vertrauend, hatte unsere Liebe zwei Jahre lang alle Stürme überstanden.
»Wann kommst du zurück?«
Gemeinsam versanken wir in einem Meer von Gefühlen, ließen uns treiben, genossen die Wärme des anderen, die Geborgenheit, die Liebe, die Zärtlichkeit und die Leidenschaft, ergaben uns einander, waren nicht mehr getrennt, nicht mehr allein.
Lange nach Mitternacht war Tristan in meinen Armen eingeschlafen. Im Mondlicht betrachtete ich sein Gesicht neben mir auf dem Kissen und strich ihm über das Haar.
Ich entsann mich all der schönen Dinge, die wir gemeinsam getan hatten. Die Bootsfahrt durch die nebelige Lagune. Unser Liebesspiel in der schwankenden Gondel. Das mitternächtliche Bad in der Lagune. Die Spaziergänge Arm in Arm in Chioggia und die Abendessen in Murano oder Torcello. Die wilden Ausritte auf der Terraferma. Unsere Reise nach Florenz, wo ich mir Giovanni Montefiores ägyptisches Evangelium ansehen wollte, die Liebesnächte im Palazzo Medici, wo wir als Gäste von Kardinal Giulio de’ Medici wohnten, und jene Nacht, als wir in der Capella Medici die Ringe tauschten. Tristan und ich hatten sehr viel Spaß gehabt. So viel Liebe, so viel Freude.
Vielleicht war es das Beste, wenn ich ohne Abschied ging. Keine Worte, die unsere tiefen Gefühle ohnehin nicht ausdrücken konnten. Keine Versprechen, die wir, wenn wir uns selbst treu bleiben wollten, ohnehin nicht halten konnten. Kein Schmerz und keine Tränen.
Um ihn nicht zu wecken, entwand ich mich vorsichtig seiner Umarmung und erhob mich. Dann kleidete ich mich leise an, ging in Tristans Arbeitszimmer, schloss die Tür hinter mir und setzte mich an seinen Schreibtisch. Ich schob die geheimen Dokumente des Consiglio dei Dieci zur Seite, an denen Tristan gearbeitet hatte, während er auf mich wartete, und zog einen Briefbogen heran.
Die Feder flog über das Papier. Meine Tränen tropften auf die Schrift und lösten die Tinte auf.
›Nimm den Ring zurück, Tristan! Ich entbinde dich von allen Versprechen, die du mir gegeben hast. Du bist frei. Ich liebe dich. Celestina.‹
Dann rollte ich den Brief zusammen, zog meinen Ring vom Finger, schob das Papier hindurch, schlich in sein Schlafzimmer und legte den Ring neben ihn auf das Kopfkissen. Wenn er ihn fand, würde ich schon auf dem Weg nach Rom sein.
Menandros erwartete mich mit den Pferden am Portal des Palastes. Schweigend ritten wir zurück zum Ponte di Rialto und überquerten den Canalazzo.
Jahrhundertelang war Venedig eine Stadt aus Holz gewesen, deren Paläste auf Pfählen in der Lagune standen – leicht wie Schiffe auf den Wogen des Meeres. Obwohl nach ein Uhr nachts kein Feuer brennen durfte, waren immer wieder große Teile der eng bebauten Stadtsechstel ein Raub der Flammen geworden, zuletzt nach der verheerenden Explosion im Arsenale. Damals, im Jahre 1509, zwei Monate vor der Schlacht von Agnadello, in der mein Vater gefallen war, brannten die Galeeren im Arsenale und beinahe der ganze östliche Stadtteil Castello, und das Feuer drohte auf den Dogenpalast und die Basilica di San Marco überzugreifen.
Der herrliche Palazzo meines Cousins war in jener Nacht durch die Detonation zerstört worden. Antonio, der aus einer abendlichen Sitzung des Consiglio dei Savi herbeigeeilt war, musste ohnmächtig zusehen, wie seine prächtige Ca’ Tron bis zu den Pfahlfundamenten niederbrannte.
Es war eine furchtbare Katastrophe für Venedig gewesen, und der Verdacht, dass im Auftrag von Papst Julius ein Anschlag auf die Flottenwerft verübt worden war, konnte auch durch die Untersuchung des Zehnerrats nie ganz ausgeräumt werden. Viele venezianische Paläste waren inzwischen aus Stein, doch das Feuerverbot galt weiterhin. Und daher war es in Venedig nach ein Uhr nachts so finster wie in Dantes Inferno.
Von der Riva del Carbon bogen wir in die Calle Loredan zum Campo San Luca ab. Kurz darauf passierten wir die Brücke über den Rio und bogen in die enge Straßenschlucht ein, die nach einigen hundert Schritten zum Campo San Angelo führte.
Plötzlich zügelte Menandros sein Pferd.
»Was ist?«, wisperte ich.
»Vielleicht sollten wir einen anderen Weg nehmen«, flüsterte er beunruhigt.
Von vorn näherten sich Schritte.
Ein einzelner Mann, der noch spät unterwegs war. Er kam uns vom Campo San Angelo entgegen. Dann fiel das Licht des Mondes auf ihn: Er trug ein langes dunkles Gewand und über der rechten Schulter ein gefaltetes, weißes Tuch.
Meine Finger zogen die Zügel straff. Bedeutete er Gefahr?
»Es wäre ein Umweg, durch die Merceria und über die Piazza San Marco zu reiten. Lass uns weiterreiten, Menandros! Es ist ja nicht mehr weit!«
Menandros ließ den sich nähernden Mann nicht aus den Augen. »Lass uns dort vorn links abbiegen – in die Gasse zur Kirche San Moisè. Das ist kein großer Umweg!«
Ich trieb mein Pferd an, die rechte Hand am Dolch. Menandros lenkte seinen Hengst so dicht neben meinen, dass sich unsere Knie berührten.
Wir hatten die Calle zur Kirche San Moisè beinahe erreicht, als aus der Gasse drei Bewaffnete sprangen.
»Das sind sie!«, rief einer der Angreifer und zog seinen Degen. »Ergreift sie!«
Ich wollte mein Pferd wenden, um zurück zum Campo San Luca zu fliehen, aber von hinten näherten sich zwei weitere Bewaffnete.
Ein Hinterhalt … ein Attentat, denn die Angreifer wussten, wen sie vor sich hatten!
Ein Assassino stürzte vor und ergriff die Zügel meines scheuenden Pferdes.
Als der Mann mein rechtes Bein packte, um mich vom Pferd zu zerren, zog ich meinen Dolch und stach zu. Ich sah, wie er sich an den Hals fasste und vor Schmerz stöhnte. Dann fiel er auf die Knie.
Menandros hieb mit seinem Degen auf zwei Angreifer ein, die ihn von mir wegdrängen wollten.
Ein Schrei!
Ein weiterer Mann näherte sich mir von hinten.
Ich sah mich um: In der Gasse war es mir unmöglich, mein scheuendes Pferd zu wenden und mich ihm entgegenzustellen.
Mein Hengst schlug nach hinten aus, traf den Angreifer an der Schulter und warf ihn um. Der Assassino brüllte vor Schmerz und Zorn, sprang auf und schlug mit seinem Degen auf die Fesseln meines Pferdes ein, die er mit einem Hieb durchtrennte.
Mit einem grauenvollen Wiehern brach der Hengst zusammen und riss mich mit sich. Hart schlug ich mit dem Kopf auf den gestampften Lehmboden der Gasse. Mein rechtes Bein war unter dem sich in Qualen windenden und ausschlagenden Pferd begraben. Als es sich aufrichten wollte, stöhnte ich vor Schmerz, biss die Zähne zusammen und versuchte mich zu befreien. Vergeblich!
War mein Bein gebrochen?
Ich sah empor zu den dunklen Fenstern. Hörte denn niemand in den Häusern der Gasse das qualvolle Wiehern meines Pferdes, die klirrenden Klingen und die Schmerzensschreie? Warum kam uns niemand zu Hilfe?
Der Mann warf sich auf mich, doch es gelang mir, ihn abzuwehren und mit meiner Klinge zu verwunden.
Menandros kämpfte nur noch mit einem Assassino. Der andere lag in seinem Blut mitten in der Gasse.
Wo war der fünfte?
Dann sah ich ihn, nur wenige Schritte entfernt: Der Mann im langen schwarzen Talar, der uns in der engen Gasse entgegengekommen war, rang mit ihm und drängte ihn gegen die Häuserwand.
Ein Dolch blitzte im Mondlicht. Dann sank der Assassino röchelnd in sich zusammen, rutschte an der Hauswand herunter und blieb neben dem weißen Tuch liegen, das dem Fremden von der Schulter geglitten war.
Es war ein Tallit, ein jüdischer Gebetsschal.
Ich fuhr herum. Der Mann, den ich verwundet hatte, stürzte sich erneut auf mich.
In diesem Augenblick dachte ich: Das ist eine Hinrichtung! Nach seinem toskanischen Akzent war der Anführer ein Florentiner. Und ich ahnte, wer ihn geschickt hatte, um mich zu töten!
Der Assassino kniete schwer atmend neben mir, eine Hand auf dem Lehmboden der Gasse abgestützt. Wo hatte ich ihn getroffen? War er schwer verletzt?
Seine Augen schimmerten im Sternenlicht, die Lippen waren leicht geöffnet.
Sein keuchender Atem streifte mein Gesicht.
Er legte mir den Dolch an die Kehle und dann …
ELIJA
KAPITEL 2
»… und Shemtov ben Isaak Ibn Shaprut war ebenfalls dieser Ansicht!«, verbiss Jakob sich in seine Meinung. »Elija, lies doch selbst nach in seinem Buch!«
Jakob schob mir den aufgeschlagenen Folianten über den Schreibtisch: Ibn Shapruts ןחַוֹבּ ןבֶאֶ – Der Prüfstein aus dem Jahr 5140, oder wie die Gojim sagten, Anno Domini 1380.