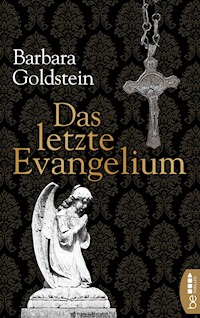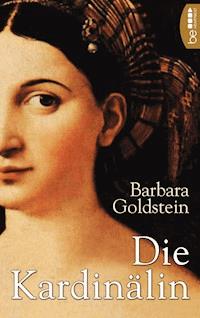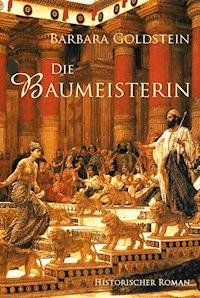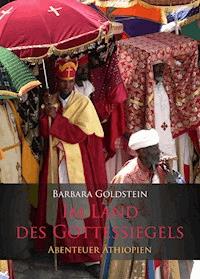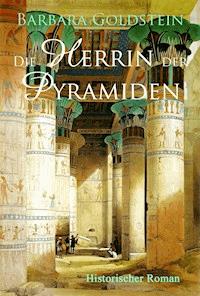4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Raffael: Ein Genie der Malerei - und der Liebe.
Raffaello Santi, ein junger, ehrgeiziger Maler, kommt 1504 nach Florenz, um sich mit den größten Maestros der italienischen Renaissance des Cinquecento, Leonardo da Vinci und Michelangelo, zu messen. Er lernt Felicia della Rovere kennen, die Tochter von Papst Julius II., und folgt ihr nach Rom, obwohl sie mit einem Orsini verheiratet ist. Dort wird er als Maler, Dichter, Archäologe und Architekt des neuen Petersdomes umschwärmt und zum Vertrauten von Päpsten, Fürsten und Bankiers. Doch bald steht Raffaello im Mittelpunkt der blutigen Auseinandersetzung zwischen den Medici und den della Rovere um die Macht im Vatikan. Seine unsterbliche Liebe zu Felicia della Rovere treibt ihn an den Rand des Abgrunds ...
Dieser historische Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Der Maler der Liebe" erschienen. Weitere historische Romane von Barbara Goldstein bei beHEARTBEAT:
Die Evangelistin * Die Kardinälin.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 986
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumFlorenzKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9RomKapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18PersonenregisterÜber dieses Buch
Raffael: Ein Genie der Malerei - und der Liebe
Raffaello Santi, ein junger, ehrgeiziger Maler, kommt 1504 nach Florenz, um sich mit den größten Maestros der italienischen Renaissance des Cinquecento, Leonardo da Vinci und Michelangelo, zu messen. Er lernt Felicia della Rovere kennen, die Tochter von Papst Julius II., und folgt ihr nach Rom, obwohl sie mit einem Orsini verheiratet ist. Dort wird er als Maler, Dichter, Archäologe und Architekt des neuen Petersdomes umschwärmt und zum Vertrauten von Päpsten, Fürsten und Bankiers. Doch bald steht Raffaello im Mittelpunkt der blutigen Auseinandersetzung zwischen den Medici und den della Rovere um die Macht im Vatikan. Seine unsterbliche Liebe zu Felicia della Rovere treibt ihn an den Rand des Abgrunds …
Dieser historische Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel »Der Maler der Liebe« erschienen.
Über die Autorin
Barbara Goldstein, geb. 1966, arbeitete zunächst in der Verwaltung von Banken und nahm dann ein Studium der Philosophie und der Sozialen Verhaltenswissenschaften auf. Später machte sie sich als Autorin historischer Romane selbstständig und nahm ihre Leser mit in die Welt von Alessandra d‘Ascoli, einer florentinischen Buchhändlerin. Barbara Goldstein verstarb im März 2014 nach langer Krankheit.
Barbara Goldstein
Der Fürst der Maler
beHEARTBEAT
Vollständige E-Book-Ausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2013/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelbild: © www.aiwaz.net
Einbandgestaltung: Manuela Städele
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5289-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
FLORENZ
Über die Hälfte
unserer Handlungen
entscheidet das Glück.
Die andere Hälfte
unterliegt unserem freien Willen.
Niccolò Machiavelli
Kapitel 1
Am Anfang war das Wort
Hinter der nächsten Hügelkette musste das Tal des Arno liegen. Von dort war es nicht mehr weit bis Florenz.
Der Weg von Arezzo war mir endlos erschienen, denn obwohl ich einen feurigen Hengst aus dem Stall des Herzogs ritt, kam ich nicht schnell voran. Seit ich das Stadttor meiner Heimatstadt Urbino durchquert hatte, zerrte ich einen Esel hinter mir her. Er trug das Gepäck, das ich mitgenommen hatte. Die Jacke aus schwarzem Samt mit der Perlenstickerei am Kragen, die der Neffe des Herzogs mir zum Abschied geschenkt hatte, damit ich in Florenz nicht wie ein abgerissener Bettler herumlief – das waren wirklich Francescos Worte: als ob ich es nötig hätte, in Florenz um einen Auftrag zu betteln! –, meine selbst gemachten Pinsel, die zu feinem Pulver gemahlenen Farben, die Staffelei.
Das Empfehlungsschreiben von Elisabetta Gonzaga da Montefeltro, der Herzogin von Urbino, an Piero Soderini, den Bannerträger von Florenz, trug ich in meiner Jackentasche. Sie hatte lange gezögert, mir dieses Schreiben auszustellen. Vier Mal hatte ich sie daran erinnern müssen! Doch als ich ihr Porträt dann fertig gestellt hatte, musste sie einsehen, dass sie mich nicht in Urbino halten konnte. »Der Engel muss seine Flügel ausbreiten«, hatte sie lächelnd zum Abschied gesagt, als sie mir den Brief an Piero Soderini überreichte. Der Hengst aus dem herzoglichen Stall war die Bezahlung für das Bild gewesen. Nach der Plünderung des Palazzo Ducale durch den Papstsohn Cesare Borgia zwei Jahre zuvor, im Juni 1502, und dem Lösegeld, das die Herzogin fünf Jahre zuvor zahlen musste, um ihren Gemahl Guidobaldo da Montefeltro aus dem Kerker der Familie Orsini zu befreien, war der Herzog von Urbino arm wie eine Kirchenmaus.
Von der Hügelkuppe aus hatte ich einen herrlichen Blick über das Val d’Arno. Der Fluss schimmerte im Licht der untergehenden Septembersonne wie feingehämmertes Blattgold. Ich blieb stehen und genoss den Anblick. Ein leichter Nebel schwebte über der toskanischen Landschaft, ein Sfumato wie von Leonardo gemalt. Pinien und Zypressen säumten die Flussufer, ihre Wipfel waren von den Strahlen der Abendsonne vergoldet. Farbtupfen von Goldocker auf schattigem Malachitgrün, mit dem feinen Pinsel aufgetragen. Die Wolken am Horizont hatten Feuer gefangen und würden bald in den Schatten der Nacht versinken.
Ich sprang aus dem Sattel, zog Papier und Zeichenkohle aus den Packtaschen meines Esels, hockte mich auf einen Stein am Wegesrand und begann das Tal unter mir zu skizzieren. Der Stift flog über das Papier und holte die Idee einer Landschaft aus den Tiefen an die Oberfläche des weißen Blattes. Die weich geschwungene Linie des Horizontes wie die Silhouette einer Frau. Die toskanischen Hügel wie ihre schwellenden Brüste. Die Wolken wie ihr offenes Haar ... Während ich die Olivenbäume auf einem Hügel mit schnellen Schraffuren nur andeutete und dem Steilhang über dem Arno eine felsige Oberfläche aus schattigen Konturen verlieh, drang lautes Fluchen aus dem Tal bis zu mir herauf.
Ich sah auf.
Einige hundert Schritte entfernt war ein Wagen in einem Schlagloch stecken geblieben. Die Pferde zerrten unruhig am Geschirr, und ein Pferdeknecht griff in die Zügel, um sie zu beruhigen. Einer der Männer beugte sich über das Rad: Die Achse schien gebrochen zu sein.
Eine Hand voll Bewaffneter, die den Wagen begleitet hatten, sprangen von den Pferden. Ich erkannte ihre Kleidung unter den funkelnden Brustharnischen: Sie waren Schweizer Gardisten, die Leibwächter des Papstes! Wer, fragte ich mich, saß in diesem Wagen?
Ich erhob mich, steckte den Kohlestift ein, schob die zusammengerollte Skizze in die Packtasche meines Esels und stieg wieder in den Sattel.
Noch vor Sonnenuntergang wollte ich die nächste Herberge erreichen. Es war leichtsinnig, ohne bewaffneten Begleitschutz von Urbino nach Florenz zu reiten. Beutegierige Wegelagerer überfielen nicht nur in Umbrien und den Marken, sondern auch in der Toskana reisende Kaufleute und kirchliche Würdenträger. Seit die toskanischen Republiken und Cesare Borgia deutsche Landsknechte und französische Ritter für ihre Feldzüge angeworben hatten, verkauften die Söldner ihre Dienste an den, der das meiste bot. Seit dem Tod Papst Alexanders und dem Sturz seines Sohnes Cesare als Herzog der Romagna schürten die Condottieri die Fehden zwischen den Republiken, um neue Aufträge für Kriegszüge zu erhalten, und nahmen reisende Kaufleute gefangen, um Lösegelder zu erpressen. Wer ihnen in die Hände fiel, konnte sein letztes Gebet anstimmen und Gott auf Knien danken, wenn er bis zum Amen noch lebte.
Bis auf zweihundert Schritte hatte ich mich der kleinen Reisegruppe genähert, als eine Horde bewaffneter Reiter aus dem Schatten der Bäume hervorbrach. Einer der Männer trug den verzierten Brustharnisch der Schweizer, ein anderer einen spanischen Helm. Desertierte Söldner aus dem Heer Cesare Borgias! Das mit vertrocknetem Gras getarnte Schlagloch in der Straße war eine Falle gewesen!
Im Schatten eines Baumes zügelte ich meinen Hengst.
Hatten die Söldner mich gesehen?
Einer der Männer riss die Tür des Wagens auf und zerrte ein junges Mädchen heraus, das vor Angst schreiend ins Gras stolperte.
Die Schweizer Gardisten stürzten sich auf die Angreifer und versuchten, sie zurückzudrängen. Sie waren machtlos.
Ein Assassino schlug mit seinem Degen auf einen Schweizer ein, der die Schläge mit seiner Waffe abwehrte. Verzweifelt wich er Schritt um Schritt zurück, bis er über einen Stein am Wegrand stolperte. Er war tot, noch bevor er auf das Pflaster der Straße fiel. Einer der Pferdeknechte ließ seinen Degen fallen und flüchtete durch das hohe Gras, nur um Augenblicke später von einem Pfeil aus einer Armbrust durchbohrt zu werden. Leblos brach er zusammen.
Ich ließ die Zügel meines Esels fallen, dann sprang ich aus dem Sattel und rannte los. Aber nicht in den Schatten der Bäume, was jeder vernunftbegabte Mensch getan hätte, um sein Leben zu retten. Ich lief auf das blutige Handgemenge zu.
Die Schweizer Gardisten hatten keine Chance gegen die Übermacht der Assassini! Wer nicht im Kampf fiel oder während der Flucht erschossen wurde, ergab sich. In der Hoffnung zu überleben, legten die Schweizer ihre Waffen nieder. Nur um wenige Augenblicke später hingerichtet zu werden!
Eine zweite Frau wurde aus dem Wagen gezerrt und auf den Boden geworfen. Dann flog das Gepäck aus der offenen Tür, um von den Wegelagerern nach Beute durchwühlt zu werden. Kleider aus Atlas und Brokat wurden mit dem Dolch zerfetzt, seidene Schuhe auf den Boden geworfen, Goldstücke und Schmuck wurden eingesteckt.
Die Männer waren zu sehr mit ihrer Beute beschäftigt, und so war ich bisher unbemerkt geblieben. Ich sprang in das dichte Unterholz neben dem Weg und schlich mich durch die schwarzblauen Schatten der untergehenden Sonne entgegen an den Wagen heran.
Das junge Mädchen lag am Boden. Der Rock ihres Kleides war zerrissen und hochgeschoben, das Mieder zerfetzt und die Brüste halb entblößt. Einer der Männer kniete zwischen ihren Beinen. Sie versuchte, nach ihm zu treten, aber er hielt sie fluchend fest. Mit Gewalt spreizte er ihre Schenkel.
Wie tot lag sie da, als er in sie eindrang. Sie hatte die Augen geschlossen.
Die ältere der beiden Frauen riss sich los und stürzte sich auf ihn, aber das schien seine Lust nur noch anzufachen. Er stieß sie brutal von sich. »Du kommst gleich dran, mein Täubchen! Patiens-toi!«, keuchte er, ohne in seinen Bewegungen innezuhalten.
Die Männer lachten höhnisch, als die Frau zu Boden fiel.
Im Schutz des Gehölzes hatte ich mich bis auf wenige Schritte genähert. Nicht einmal zwei Armlängen von mir entfernt lag sie neben der Leiche eines Schweizer Gardisten im Gras und musste hilflos zusehen, wie ihre Dienerin vergewaltigt wurde.
Nachdem er seine Lust an dem Mädchen befriedigt hatte, erhob sich der Franzose und stolperte auf die junge Frau zu, die vor ihm zurückwich. »Du konntest es nicht erwarten, nicht wahr?«, lockte er mit heiserer Stimme und streckte die Hand nach ihr aus.
»Que le diable t’emporte!«, fauchte sie ihn auf Französisch an. »Geh zum Teufel!«
Er antwortete nicht, denn seine Aufmerksamkeit war kurz abgelenkt, als sich einer der Söldner unter dem Gejohle seiner Freunde auf das andere Mädchen warf, um seine Lust zu stillen.
Eine zweite Chance würde ich nicht bekommen! Ich stürzte nach vorne, durchbrach das Gebüsch, packte die junge Frau am Arm und riss sie mit mir fort. Der Franzose starrte uns verblüfft hinterher. Gemeinsam rannten die junge Frau und ich die Straße hinunter zu meinem Hengst. Ich sprang in den Sattel und riss sie vor mich auf das Pferd. Dann galoppierten wir in die aschgraue Dämmerung hinein.
Zwei der Räuber nahmen auf ihren Schlachtrössern die Verfolgung auf, die anderen blieben bei ihrer Beute. Ich lenkte meinen Hengst weg von der Straße, um in den dichten Büschen am Flussufer zu verschwinden.
»Haltet Euch an mir fest! Wenn Ihr stürzt, werden sie Euch töten!«, rief ich.
»Dich doch auch!«, antwortete sie atemlos.
Wir durchbrachen das dichte Gebüsch und sahen in einiger Entfernung vor uns den Arno. Ich riss das Pferd herum und galoppierte nach Norden.
Die Sonne war untergegangen, und es wurde Nacht. Die Finsternis konnte unsere Rettung sein! Wenn wir uns so lange im Sattel halten könnten, bis es dunkel würde!
Einen Arm um die Taille der Madonna geschlungen, beugte ich mich so tief wie möglich über den Sattel und gab meinem Pferd die Fersen.
Tausendmal hatte ich mit Francesco dieses Spiel gespielt: Wir waren wilde Sarazenen und raubten unsere Geliebten – Strohgarben, die wir auf den Feldern vor Urbino vor uns in den Sattel rissen. Aber das hier war kein Spiel! Es war blutiger Ernst!
Das Getrommel der Hufe und das Schnauben der Pferde kam immer näher! Die Schlachtrösser unserer Verfolger waren langsamer als mein Hengst, aber ausdauernder. Und sie hatten keine zweite Person zu tragen.
Mehr als einmal zischte ein Pfeil aus einer Armbrust an meinem Kopf vorbei.
Wir erreichten das Ufer des Arno. Zehn Ellen unter uns rauschte die reißende Strömung. Wiehernd scheute mein Hengst vor dem hohen Steilufer und dem brodelnden Inferno in der Tiefe. Es gab kein Entkommen! Vor uns der Fluss und die Chance des Überlebens – hinter uns der sichere Tod!
Ich zerrte an den Zügeln, um zu wenden, und konnte schon die mordlüsternen Gesichter unserer Verfolger erkennen, die uns beinahe erreicht hatten. Mit einem genüsslichen Grinsen zogen sie ihre Degen und kamen auf uns zu.
Erneut riss ich den Hengst herum und galoppierte auf das Steilufer zu. Ich drängte das scheuende, panisch wiehernde Pferd bis an den Rand des Felsens und drückte ihm die Absätze meiner Stiefel in die zitternden Flanken. Die junge Frau klammerte sich an mir fest. Sie hielt den Atem an.
Ich ließ die Zügel los und gab dem zurückweichenden Pferd die Fersen. Es bäumte sich auf, und beinahe wären wir aus dem Sattel zu Boden gestürzt. Doch dann sprang es, und wir fielen etliche Ellen tief. Mit einem gewaltigen Sprung landeten wir in den Fluten des Arno.
Prustend tauchten wir aus der silbrigen Gischt auf. Der Fluss war tief, und die schnelle Strömung riss uns mit sich fort, bis wir schließlich das andere Ufer erreichten. Erschöpft zogen wir uns an Land, stiegen in den Sattel und galoppierten den Arno entlang.
Unsere Verfolger blieben hinter uns zurück. Ihre Pfeile konnten uns nicht erreichen. Und sie wagten den Sprung in den Arno nicht!
Gegen Mitternacht war die junge Frau trotz der nassen Kleidung vor Erschöpfung im Sattel eingeschlafen. Ihr Kopf ruhte an meiner Schulter, ihre Arme hatten meine Hüften umschlungen. Ich genoss den Duft ihres Haares und die Bewegung ihres Körpers an meinem. Vorsichtig legte ich meinen Arm um ihre Taille und zog sie an mich.
Sie erwachte und sah mich einen Augenblick lang verwirrt an. Dann erinnerte sie sich. »Ich bin dir sehr dankbar ...«, begann sie. »Du hast mir das Leben gerettet. Meine Leibwache, die Pferdeknechte, meine Dienerin ...« Den Satz ließ sie unvollendet.
Als ich nicht antwortete, wandte sie mir ihr Gesicht zu. Das Gesicht eines Engels. Nein, viel schöner. Irdischer. Sinnlicher. Das Gesicht der Göttin Psyche, in deren Gestalt die Natur selbst sich erschöpfte, an deren Schönheit sogar Aphrodite verzweifelte. ›Jede Sprache war zu arm an Worten, sie zu loben‹, schrieb Lucius Apuleius in seinem Märchen von Amor und Psyche.
Ihre goldenen Locken waren mit einer Ghirlanda und einem perlenbestickten Haarnetz nur mit Mühe gebändigt worden. Einige Strähnen hatten sich während des scharfen Rittes befreit und fielen über die Ohren und die im Mondlicht schimmernden Wangen. Der mit Hermelin verbrämte Ausschnitt ihres Kleides aus meerblauem Atlas war tief und durch den zarten Schleier kaum verhüllt, und mein Blick streichelte ihre wohlgeformten Brüste.
Als sie sich umdrehte, musste sie meine Erregung bemerkt haben, denn sofort änderte sie ihre Haltung vor mir im Sattel. »Mein Name ist Felice della Rovere, aber mein Vater nennt mich ›die Contessina‹.«
»Ich bin Raffaello Santi aus Urbino.« Ich stutzte. »Della Rovere? Seid Ihr verwandt mit Francesco della Rovere, dem Neffen des Herzogs von Urbino?«
»Du kennst Francesco?«, fragte sie erstaunt.
»Er ist mein bester Freund.«
»Francesco ist mein Cousin«, erklärte sie.
Die Familie della Rovere in Urbino kannte ich gut genug, um zu wissen, dass Francesco als Sohn von Giovanni della Rovere und Giovanna Feltria, der Schwester des Herzogs Guidobaldo, nur einen Onkel hatte: Giuliano della Rovere.
Schweigend ritten wir eine Weile am Arno entlang. »Wohin soll ich Euch bringen?«, fragte ich sie schließlich.
»In das Franziskanerkloster von Santa Croce in Florenz. Dort war ich während der letzten drei Jahre. Der Konvent von Santa Croce ist berühmt für seine theologischen Studien. Mein Vater legt Wert auf eine gute Erziehung ...«
»Er ist ein Förderer des Ordens der Franziskaner«, warf ich ein.
Sie fuhr herum. »Du weißt, wer mein Vater ist?«
»Euer Vater ist Giuliano della Rovere. Seine Heiligkeit, Julius II.«, sagte ich, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, einen Papst zum Vater zu haben. War es für sie vermutlich auch! So wie es für mich eines Tages selbstverständlich sein würde, einen Papst zum vertrauten Freund und Beichtvater zu haben. Und einen anderen zum erbitterten Feind.
»Du kennst die della Rovere gut, Raffaello! All ihre Sünden!«
»Nicht alle, Madonna Felice. Aber viele. Euer Cousin Francesco ist mein Freund – wenn wir uns nicht gerade streiten. Ich gehöre fast schon zur Familie des Herzogs von Urbino.«
»Francesco hat mir von dir geschrieben«, offenbarte sie mir. »Du bist der Sohn des Hofmalers von Onkel Guido und Günstling von Tante Elisabetta. Du siehst, ich kenne auch die Sünden deines Vaters, Raffaello!«
Ich wusste, was sie meinte. Seit Jahren ging in Urbino das Gerücht, dass mein Vater Giovanni eine Affäre mit der Herzogin Elisabetta hatte, während er sie malte.
»Und auch du sollst nicht wie ein Heiliger leben ...«, lächelte sie.
»Nicht anders als Euer ›Unheiliger Vater‹!«, konterte ich.
»Hast du schon viele Frauen geliebt?«, fragte sie und lehnte sich gegen mich.
Ich dachte an Alessandra. An Violetta. An Clarissa. Und an Francescos Schwester Fioretta, die nicht nur meine Fähigkeiten als Maler schätzen gelernt hatte. »Nein, nicht viele: eine.«
»Nur eine?«, fragte sie. Sie schien enttäuscht.
Was, zum Teufel, hatte Francesco über mich geschrieben?
»In wen bist du verliebt?«, wollte sie wissen.
»In Euch, Felice!«, gestand ich.
Sie starrte mich überrascht an. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Es kam wohl nicht oft vor, dass ihre marmorne Selbstbeherrschung Sprünge bekam! Und meine Anwesenheit hinter ihr auf dem Pferd schien sie zu verunsichern ... zu erregen?
Sie hielt sich an mir fest, um nicht vom Pferd zu fallen.
Ich küsste sie auf die leicht geöffneten Lippen. Sie schloss die Augen und antwortete mir mit ihrem Körper. Ich zügelte das Pferd, ließ den Lederriemen fallen und schlang meine Arme um Felice.
»Du weißt genau, was du willst, nicht wahr, Amor?«, neckte sie mich atemlos zwischen zwei Küssen.
»Ganz genau!«, versprach ich ihr.
Sie ließ mich los und glitt aus dem Sattel. Für einen Augenblick dachte ich, ich wäre zu weit gegangen und sie würde nach Florenz laufen wollen. Doch dann drehte sie sich um und sah zu mir herauf. Als ich zögerte, streckte sie mir ihre Hand entgegen.
Ich sprang vom Pferd. Sie ergriff meine Hand und zog mich mit sich fort. Ich sank neben ihr ins warme Gras.
Mit der Hand fuhr ich ihr sanft über die Stirn, die Nase entlang, über die Lippen, das Kinn, den Hals hinab. Sie lächelte wie ein Engel, als meine Hand ihre Brüste streifte. Ich zögerte nicht lange und öffnete ihr geschnürtes Mieder. Als sich ihre Brüste aus der festen Atlasseide befreiten, atmete sie tief ein. Ich streichelte ihre Schultern und hauchte einen Kuss auf ihre Rosenknospen.
Sie ließ mich nicht aus den Augen. »Du bist schön, Raffaello«, flüsterte sie in mein Ohr. »So muss Gott den ersten Menschen erschaffen haben.« Ihre warme Hand fuhr unter den Stoff meines Hemdes und streichelte meinen Bauch. »Stolz, hoch gewachsen, schlank ...« Ihre Hand glitt an meinem Körper hinab zwischen meine Beine, und mit einem übermütigen Lächeln fügte sie hinzu: »... und sehr stark.«
Ich genoss die Bewegung ihrer Finger. »Und du bist vom Himmel herabgestiegen. Um die Menschen zu verführen«, flüsterte ich atemlos.
Sie lachte, schlang ihre Arme um meine Schultern und zog mich auf ihren heißen Körper. Dann öffnete sie meine Jacke und zog mir das Seidenhemd über den Kopf. »Ich bin kein Engel!«, warnte sie mich, als ihre Finger meine Schultern, meine Arme, meine Brust streichelten und eine Spur aus feuriger Glut hinterließen.
»Dafür danke ich Gott!«, flüsterte ich und küsste sie fordernd auf die geöffneten Lippen. Ihr Kuss schmeckte nach Sinnlichkeit, nach Leidenschaft. Und er versprach Sinnhaftigkeit. Und Leiden.
Ungeduldig nestelte sie am Verschluss meiner Hose. Lachend führte ich ihre Hand, als sie am Stoff zu zerren begann.
Sie drängte sich an mich, verschränkte ihre Beine hinter meinem Rücken und zog mich ungestüm zu sich heran. Ich glitt in sie hinein.
Felice della Rovere nahm mit einer Selbstverständlichkeit Besitz von meinem Körper, die mich in Ekstase versetzte. Meine Gedanken und meinen Verstand schenkte ich ihr aus freiem Willen.
Sie hatte die Augen geschlossen und öffnete mir ihre Seele.
Wir stiegen hinab in das himmlische Gefühl des Einsseins, des Verschmelzens mit dem anderen.
»Ich liebe dich!«, hauchte ich in ihr Ohr.
Ihr Lächeln im Mondschein verriet mir, dass sie dasselbe empfand.
Ich begann mich auf ihr zu bewegen, als sei sie so zerbrechlich wie Glas aus Murano. Ich brannte lichterloh, als sie meine Schenkel umfasste und den Rhythmus beschleunigte. Keuchend bewegten wir uns aufeinander, wanden uns im Gras. Sie nahm mein Gesicht in beide Hände und tauchte ihren Blick in meinen.
Ich weiß nicht, was mich mehr erregte: die Reibung unserer schweißnassen Körper oder das Verschmelzen unserer Seelen. Die Wogen unserer Lust trugen uns immer höher, rissen uns hinauf in die himmlischen Sphären.
O Gott! Wie sehr ich Felice liebte!
Gemeinsam erreichten wir den Himmel, und für einen Augenblick schien die Zeit stehen zu bleiben. Und mit ihr die Erde, der Mond und der Rest des Universums. Es gab nur noch uns beide.
Dann lagen wir eng ineinander verschlungen im Gras und hielten uns aneinander fest. Mein Kopf ruhte an ihrer Schulter, meinen Arm hatte ich um ihre Hüfte geschlungen. Sie atmete ruhig, so ruhig, dass ich dachte, sie würde schlafen.
So, genau so wollte ich sie malen!
Ich erhob mich und zog mich an. Dabei ließ ich sie nicht aus den Augen. Doch dann fiel mir ein, dass meine Farben, Pinsel und das Skizzenpapier noch in den Satteltaschen des Esels steckten, den ich zurücklassen musste.
Felice war das, was ich gesucht hatte! In Urbino, in Perugia, in Siena. Bei Clarissa und Violetta und Alessandra. Nicht nur ein faszinierendes Gesicht, das ich malen konnte, nicht nur ein begehrenswerter Körper, an dem ich meine Lust befriedigen konnte, sondern eine Frau, in deren Armen ich von meiner Ruhelosigkeit erlöst werden konnte.
Ich griff in die feste Innentasche meiner Jacke, die ich mir bei einem Schneider in Perugia hatte einnähen lassen, um Rötel und zerbrechliche Kohlestifte bei mir tragen zu können, wohin ich auch ging. Maestro Perugino hatte sich darüber lustig gemacht, dass ich ohne Silberstift nicht einmal ins Bett ging. Das Lachen wäre ihm im Hals stecken geblieben, wenn er geahnt hätte, dass ich nicht nur mit Kohlestift und Rötel, sondern auch mit seiner Tochter Violetta zwischen die Laken gekrochen war. Ich fand den Kohlestift, mit dem ich vor Stunden das Val d’Arno skizziert hatte. Papier – wo sollte ich Papier herbekommen? Die Zeichnung hatte ich in der Packtasche des Esels verstaut: sie war verloren.
Aus der anderen Tasche zog ich das zerknitterte Empfehlungsschreiben der Herzogin von Urbino an den Bannerträger von Florenz. Auf der Rückseite des Briefes begann ich Felice zu skizzieren. Ihre geschlossenen Augen, ihre kecke Nase, die sinnlichen Lippen. Das Gesicht eines Engels. Ihre stolze, selbstbewusste Haltung. Die leichte Bewegung ihrer Schultern, ihrer Brüste, ihres flachen Bauches, wenn sie im Schlaf atmete.
Den rostig roten Farbton des Rötels verwischte ich mit dem Finger zu weichen Schattierungen, die auf dem getönten Pergament sehr plastisch wirkten. Die Umrisse ihres Körpers schienen aus der Tiefe aufzusteigen und Gestalt anzunehmen.
In diesem Augenblick erwachte sie. Sie sah mich auf dem Stein sitzen und sie zeichnen und richtete sich auf.
»Bleib wie du bist!«, befahl ich, während ich ihr Gesicht schattierte.
»Ich hatte nicht vor, mich zu ändern«, versprach sie mir.
»Ich meinte: Beweg dich nicht.«
»Vorhin wolltest du, dass ich mich bewege!«, antwortete sie frech.
Mit dem Silberstift bannte ich das Mondlicht auf ihr Haar.
»Erzähl mir von dir!«, verlangte sie, als sie sich im Gras räkelte.
»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, murmelte ich, während ich mit dem Silberstift ihre Augen funkeln ließ.
»Dann erzähl mir alles. Die ganze Heiligenlegende!«
»Ich bin kein Heiliger ...«
»Das hat Francesco in seinen Briefen auch nie behauptet!«
»... obwohl ich an einem Karfreitag geboren wurde. Das war 1483. Meine Mutter starb an der Pest, als ich acht Jahre alt war.«
Sie schwieg. Ihre Mundwinkel entspannten sich. Mit dem Rötelstift zog ich die geschwungenen Umrisse ihres Mundes nach.
»Als ich neun war, half ich meinem Vater Giovanni Santi in seiner Bottega – seiner Werkstatt. Ich zerrieb Farben, grundierte Bildtafeln, fertigte Pinsel. Bei ihm habe ich malen gelernt in der flämischen Manier des Jan van Eyck. Bei ihm habe ich gelernt, das Sichtbare zu spiegeln.«
»Das klingt wie Platon ...«, lachte sie.
»Es stehen mehrere von Marsilio Ficino übersetzte Bücher von Platon in der Bibliothek des Palazzo Ducale. Francesco hat sie mir geliehen.
Als ich zehn Jahre alt war, begleitete ich meinen Vater nach Cagli und Fano, wo er Aufträge für Altartafeln und Fresken angenommen hatte. Die Bottega florierte. Einem Auftrag folgten zwei oder drei andere. Wir gingen nach Pesaro und Senigallia, um dort zu malen, und kehrten erst Monate später nach Urbino zurück.«
»Du sagtest, du gehörst zur Familie des Herzogs ...«
»Anlässlich der Geburt ihres Sohnes Francesco malte mein Vater für die Schwester des Herzogs, Giovanna Feltria della Rovere, eine Verkündigung für die Kirche Santa Maria Maddalena in Senigallia.
Ihre Schwägerin, die Herzogin Elisabetta, lernte meinen Vater kennen und ernannte ihn zum Hofmaler. Gerüchten zufolge schätzte sie nicht nur seine Kunst, sondern auch sein Können. Elisabetta schickte Giovanni nach Mantua, wo er ihre Schwägerin, Isabella d’Este, und deren Gemahl, den Marchese Francesco Gonzaga, porträtieren sollte.
Als mein Vater nach Urbino zurückkehrte, war er krank: in Mantua war die Malaria ausgebrochen. Mein Vater starb, als ich elf Jahre alt war. Onkel Bartolomeo, ein Dominikanerpater, nahm mich auf. Er wollte, dass auch ich Priester werde. Am Weihnachtsabend verließ ich sein Haus. Ich lief weg.«
»Warum?«, fragte sie atemlos.
Ich sah nicht auf, als ich ihre Brüste mit dem Kohlestift schattierte und das Licht auf ihrer Haut mit einem Hauch von Silber andeutete. Ihre Hand mit dem Rubinring lag wie schwerelos auf ihrem Bauch. Schließlich antwortete ich: »Onkel Bartolomeo hatte all meine Zeichnungen, die Kohlestifte, die Farben, einfach alles, verbrannt. Er war fanatischer als Fra Girolamo Savonarola, ein alter Freund, mit dem er zusammen Theologie studiert hatte. Mein Fegefeuer der Eitelkeiten fand Jahre vor Savonarolas in Florenz statt. Onkel Bartolomeo verbot mir zu malen.«
Felice sah mich neugierig an. »Du hast dich nicht daran gehalten.«
»Maestro Perugino sagte einmal: ›Wenn ein Vulkan ausbricht, ist die Lava nicht aufzuhalten. Wenn Raffaello malt ...‹ Das Ende ließ er offen.«
»Das war kein Kompliment«, schlussfolgerte sie.
»Nein.« Ich erinnerte mich meiner Auseinandersetzung mit Pietro Perugino und fuhr fort: »Als mein Vater starb, war Pier Antonio Viti der Gonfaloniere – der Bannerträger – von Urbino. Er war ein Freund meines Vaters gewesen. Dessen Bruder Timoteo Viti, ein bekannter Maler, Goldschmied und Musiker, hielt sich damals in Urbino auf, nachdem er aus Bologna zurückgekehrt war. Ich half Timoteo heimlich in seiner Malerwerkstatt, die nur ein paar Schritte vom Haus meines Vaters entfernt lag. Ich fegte die Bottega, holte seine Farben vom Apotheker und kochte für ihn. Ich war sein Modell. Onkel Bartolomeo hat davon nie etwas erfahren.
Timoteo brachte mir viel bei: die Bezähmung meiner Ungeduld, das Vertrauen auf meine Intuition, die Beharrlichkeit. Er lehrte mich zu erkennen, was ich wirklich wollte: malen!
Erst die Möglichkeit, unseren Traum zu verwirklichen, macht unser Leben lebenswert. Der Traum hält uns am Leben, wenn er auch nicht satt macht. Am Weihnachtsabend 1494 lief ich weg. Ich ging nach Perugia.«
»Das klingt so einfach. Du warst erst elf Jahre alt ...«
»Es war ganz einfach«, widersprach ich. »Mach zuerst den ersten Schritt, dann den zweiten. Folge dem Weg, den du vor dir siehst, und lasse dich nicht beirren.«
Ich sah auf, und unsere Blicke trafen sich. Ihr schien diese Lebenseinstellung nicht fremd zu sein.
»Am Weihnachtsabend stritten Onkel Bartolomeo und Onkel Simone miteinander. Onkel Bartolomeo wollte, dass ich in Pisa kanonisches Recht studiere, um Kardinal in Rom zu werden. Onkel Simone, ein Offizier in den Diensten von Herzog Guido, bestand darauf, dass ich die Laufbahn eines Condottiere einschlug. Ich sollte die Franzosen aus dem Land jagen und die Borgia-Sippe gleich hinterher. In diesem Augenblick begriff ich, dass es keinem von beiden um mich ging, sondern um die Einkünfte, die ich der Familie als Kardinal in Rom einbringen könnte, oder den Ruhm als Condottiere auf den Schlachtfeldern Italiens.
Damals wusste ich nicht, wer ich war und wer ich eines Tages sein wollte – obwohl ich Platon und Aristoteles gelesen hatte. Aber ich wusste, was ich tun wollte! Erkenne dich selbst! Nicht durch Denken, durch Nachdenken vorgeformter Gedanken, sondern durch Handeln. Aber die Entscheidungen waren längst getroffen. Andere Menschen hatten sie mir abgenommen. Werde, der du bist! Diese Worte wiederholte ich immer wieder, während meine Onkel über meine Karriere stritten. Werde, der du bist, nimm deine Bestimmung an, und gehe deinen Weg! Wenn es sein muss, allein!
Ich stand auf, verließ Gänsebraten und Familie, ließ meine Vergangenheit hinter mir und ging nach Perugia. Ich suchte Pietro di Cristoforo Vannucci auf, genannt Pietro Perugino, einen guten Freund meines Vaters. Er hatte von Giovanni Santis Tod gehört und nahm mich in seine Werkstatt in Perugia auf, obwohl ich ihm nur fünf statt der üblichen fünfzig Dukaten Lehrgeld zahlen konnte. Perugino kaufte mir neue Kleidung und Schuhe und gab mir ein Bett in seinem Haus. Er war wie ein Vater für mich.«
»Wie lange warst du bei ihm?«, fragte sie.
»Sechs Jahre.«
»Und ...?«
»Wir haben uns gestritten.«
»Und jetzt willst du nach Florenz? Was suchst du dort?«
»Die Vollkommenheit«, lächelte ich. »Aber ich werde sie dort nicht finden. Denn ich habe sie bereits gefunden.«
Sie starrte mich an. Und begriff. »Die Vollkommenheit ist vergänglich.«
»Die Liebe nicht!«, widersprach ich. Meine Liebe nicht!
»Die verträumte Verliebtheit nicht. Aber die erotische Leidenschaft schmilzt wie Schnee in der Frühlingssonne.« Sie zögerte. Meinem Blick wich sie aus. »Ich war auf dem Weg nach Rom zu meinem Vater. In Rom herrschen auch ein Jahr nach seiner Thronbesteigung als Papst Unruhen. Die Familien der Colonna und der Orsini wollen in Rom die Macht ergreifen und drohen, den Präfekten von Rom zu stürzen. Mein Vater, Papst Julius, will ein Bündnis mit den Orsini schließen, einer der mächtigsten Familien Roms. Ich werde Gian Giordano Orsini heiraten.«
»Florenz!«
Das erste Wort seit Stunden! Das erste Wort, seit sie mir offenbart hatte, dass sie in wenigen Tagen heiraten würde!
Schweigend hatte ich meine Skizze und die Stifte eingesteckt, schweigend hatte sie sich angekleidet, schweigend waren wir im ersten Morgenlicht nach Norden aufgebrochen.
Kein Blick, kein Wort. Nur unsere Körper, die sich aneinander lehnten, sich rieben, sich streichelten. Und Funken schlugen. Funken der Liebe und Funken der Hoffnung.
Auf der alten Römerstraße Via Cassia, die Rom, Siena und Florenz verbindet, ritten wir auf die Stadt zu. Unter uns lag Florenz, die Schöne, die Elegante, die Gebildete. Die Stadt der Maler und Bildhauer, die Stadt der Humanisten – sie lag da im Tal des Arno wie eine schöne Frau, die auf ihren Liebhaber wartet. Ich sah von weitem die Stadtmauer, die Wehrtürme der Palazzi, den Campanile und Filippo Brunelleschis alles beherrschende Domkuppel.
Vor der Porta Romana wurden wir aufgehalten. Ein Zöllner inspizierte die Ladung jedes Karrens und den Inhalt der Körbe und Säcke. Felice und ich wurden misstrauisch angestarrt, weil wir kein Gepäck bei uns hatten, aber wir wurden durchgelassen.
Hinter dem Tor kämpften wir uns an den Tischen der Geldwechsler vorbei, die venezianische Zechinen und römische Dukaten in florentinische Goldmünzen wechselten. Doch weder Felice noch ich trugen Geld bei uns. Der Strom der Besucher riss uns mit sich. Wir folgten einem Ochsenkarren mit Gemüse in nordöstlicher Richtung durch die Gassen. Obwohl die Straßen von Florenz breiter waren als die von Urbino oder Perugia, blockierten zwei Lastkarren mit florentinischer Seide die Via Romana direkt vor dem Palazzo Pitti. Die Fahrer sprangen ab und beschimpften sich gegenseitig in ihrer toskanischen Mundart.
Am Palazzo Pitti vorbei ritten wir zum Ponte Vecchio. Auf der Brücke herrschte ein unglaubliches Gedränge. Die Auslagen der Fleischerläden bogen sich unter Fasanen, Kapaunen und Wildschweinen. Der Boden war schlüpfrig vom Blut und Fett der gemetzelten Tiere, und es stank erbärmlich. Zwischen den Läden sah ich frisch geschlachtetes Geflügel und Rinderhälften. Die Abfälle wurden einfach in den Arno geworfen.
Wir ritten durch enge, gepflasterte Gassen im Schatten von fünfzig Ellen hohen Geschlechtertürmen. Die Häuser links und rechts des Weges wie auch die steinernen Wehrtürme waren durch hölzerne Brücken verbunden. Die Auseinandersetzungen der Familienclans wurden nicht in den Straßen von Florenz, sondern über den Dächern der Palazzi zwischen den mehr als hundertfünfzig Türmen der Stadt ausgetragen.
Dann verließen wir die Schatten und ritten über die weite Piazza della Signoria.
Die Signoria von Florenz war größer als der Palazzo dei Priori von Perugia und prächtiger als der Palazzo Pubblico von Siena. Ich zügelte das Pferd und sah hinauf zum schlanken Wehrturm, Symbol der weltlichen Macht der Republik Florenz und stolze zwanzig Ellen höher als der Campanile, Sinnbild der kirchlichen Macht.
Am Palazzo Gondi und der Kirche San Firenze vorbei gelangten wir durch das Labyrinth der Gassen zur Piazza Santa Croce. Wir überquerten den weiten Sandplatz, auf dem eine Hand voll Männer Calcio spielte, als gelte es, eine Schlacht zu schlagen. Sie rannten lachend einem Lederball hinterher, um ihn durch einen gezielten Tritt auf die andere Seite des markierten Spielfeldes in ein offenes Zelt zu schießen.
Dann hatten wir den Konvent von Santa Croce erreicht. Ich sprang vom Pferd und half Felice aus dem Sattel. Sie machte ein Gesicht, als würde ich sie zu ihrer Hinrichtung führen. Ich band das Pferd an einem Eisenring an der unfertigen Fassade der Kirche fest und folgte ihr.
Felice ergriff meine Hand und zog mich durch das hohe Portal in die Basilika.
Ich hatte keinen Blick für die steinernen Arkaden. Die Splitter farbigen Lichts, die durch die Glasfenster auf den Boden fielen, bemerkte ich nicht. Die hundert Kerzen, die die Apsis erleuchteten, übersah ich. Ich sah nur sie.
Vor dem Altar sank Felice auf die Knie und zog mich zu sich herunter. Sie begann leise zu beten. »Ave Maria, gratia plena, ora pro nobis!« Dann fuhr sie auf Italienisch fort: »Bete für uns, Maria! Bete für unsere Liebe! Und dass wir uns eines Tages wiedersehen!«
Wie konnten wir ahnen, dass ihre Bitte in Erfüllung gehen sollte? Wir würden uns wiedersehen. Aber anders, als jeder von uns es sich ausmalen konnte ...
Wir erhoben uns, und ich nahm sie in die Arme, um sie zu küssen. Ihr Körper drängte sich gegen meinen, ihre Hände umfassten meinen Nacken und zogen mein Gesicht zu ihrem herunter. Tränen liefen über ihre Wangen, als wir uns mit einer Leidenschaft küssten, die dem Ort unangemessen war, nicht aber unseren Gefühlen.
»Ich liebe dich!«, flüsterte ich in ihr Ohr. Ich wollte sie nie wieder loslassen. Sie durfte nicht einfach wieder aus meinem Leben verschwinden!
»Ich liebe dich auch, Raffaello!«, antwortete sie und strich mir mit der Hand über das Gesicht.
»Bitte geh nicht!«, bat ich sie verzweifelt.
Sie schüttelte den Kopf, sagte kein Wort. Es war unmöglich. Sie musste dem Willen ihres Vaters gehorchen und Gian Giordano Orsini heiraten. »Ich werde dich nicht vergessen, Raffaello!«, flüsterte sie und besiegelte dieses Versprechen mit einem Kuss.
Sie wollte gehen, doch ich hielt sie zurück. Ich streifte meinen Ring vom Finger und gab ihn ihr. »Er ist jetzt deiner!«, versprach ich ihr. »So wie ich!«
Sie zog ihren Rubinring von der Hand und steckte ihn an den kleinen Finger meiner rechten Hand. »Und ich gehöre dir!«
Dann erhob sie sich und floh vor ihren eigenen Gefühlen.
Ich blieb zurück.
Ich hatte sie verloren.
Ich hatte mich selbst verloren.
War die Liebe nur eine Idee, eine Illusion? Ein Traum, der für mich nie in Erfüllung gehen sollte?
Wie viele Frauen hatte ich vor Felice verführt? Alessandra, Violetta, Clarissa, Fioretta! Wie vielen würde ich mich nach ihr hingeben? Ich liebte sie. Ich liebte sie alle. Jede von ihnen. Sie wurden schöner, wenn ich sie liebte. Sie erblühten wie vom Tau benetzte Rosen im ersten Sonnenlicht. Ihre Augen strahlten, ihre Haut leuchtete, und ihre Haare glänzten. So wollte ich sie malen: als Idee von der Schönheit, der Vollkommenheit!
Aber was waren diese Affären mehr als ein kurzes Aufflackern von Leidenschaft, ein Funkenflug der Ekstase? Das Festhalten am anderen, um nicht mehr allein zu sein? Geborgenheit, Vertrautheit, Zärtlichkeit. Verliebtheit.
In nur einer Nacht hatte ich Felice gefunden und wieder verloren. Mit ihr war Sinn in mein Leben gekommen. Wie eine gewaltige Woge hatte er alles weggespült, was mein Leben ausgemacht hatte. Was zurückblieb, war die Sehnsucht, das unstillbare, brennende Verlangen nach einem Wiedersehen. Ich war verzweifelt. Mir blieben weder Glaube, Hoffnung noch Liebe, keines dieser drei. Nur die Erinnerung an sie.
›Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand‹, hatte Paulus gesagt. War er jemals verliebt gewesen?
Liebe ist nur ein Wort!, dachte ich enttäuscht. Und doch: Dieses Wort stand am Anfang von allem ...
Kapitel 2
Aus dem Stein befreit
Allein irrte ich durch die Straßen. Was sollte ich nun anfangen? Meine Gedanken waren bei ihr. Ich war in Florenz, dem Ziel meiner Träume, angekommen, und doch schien mir alles so sinnlos.
Die Sonne hing in einem farblosen Himmel. Der ockerfarbene Stein der Palazzi ertrank in schwarzen Schatten, die an den Hauswänden emporkrochen. Die labyrinthischen Straßen schienen nirgendwohin zu führen.
Was sollte ich nun anfangen? Ohne Gepäck? Ohne meine Pinsel und Farben? Ohne einen Fiorino in der Tasche? Das einzig Wertvolle, das ich besaß, waren meine Hände. Meine Zukunft in Florenz schien beendet, bevor sie begonnen hatte.
Wohin sollte ich mich wenden? Zur Zeit von Lorenzo il Magnifico wäre ein junger, ehrgeiziger Künstler in die Via Larga zum Palazzo Medici geschickt worden, wo er ein Bett und eine warme Mahlzeit bekommen hätte. Und vielleicht einen Auftrag für ein Porträt, eine Skulptur, eine Goldschmiedearbeit. Aber die Medici waren vor zehn Jahren aus Florenz vertrieben worden. Der großartige Palazzo stand seit der Plünderung durch die florentinische Bevölkerung leer. Das Tor war verschlossen.
Langsam schlenderte ich die Via Larga hinab, an der sich die Palazzi aufreihten wie von einem Architekten mit dem Ellenmaß ausgerichtet. Florenz war eine riesige Baustelle: Aus jeder Straße erklang das unermüdliche Hämmern der Steinmetze und Handwerker. Auf jeder Piazzetta eröffneten sich neue Perspektiven aus Licht und Schatten.
Nur nicht für mich.
Am Dom vorbei ging ich in Richtung Piazza della Signoria. In der Via dei Speziali, der Straße der Apotheker und Farbenhändler, betrachtete ich die Auslagen: gemahlene umbrische und toskanische Farben.
Ich blieb stehen und atmete mit geschlossenen Augen die Düfte von Himmel und Erde ein. Den schweren, erdigen Geruch von roter Terra di Siena, das Aroma von Pflanzengrün, das an den Geschmack grüner Oliven aus den Gärten von Perugia erinnerte, und von Indigo, der Farbe des Himmels über Urbino. Ich griff mit beiden Händen in einen Leinensack mit gemahlenem Himmelsblau und ließ die Farbpigmente wie Sand durch meine Finger rinnen. Das war ein Gefühl wie Seide auf meiner Haut! Wie gerne wollte ich malen – und doch hatte ich kein Geld, auch nur eine dieser leuchtenden Farben, aus denen meine Träume bestanden, zu kaufen!
Die verführerischen Düfte der Garküchen vom nahen Mercato Vecchio trieben mich weiter. Auf dem Markt drängten sich die Stände der Obsthändler und Gemüsebauern. Ein Händler hatte seinen Karren mit Käfigen voller Tauben beladen. Jeder der Vögel saß in seinem eigenen Käfig. Jeder von ihnen wollte seine Flügel ausbreiten – so wie ich ...
Der Duft von frisch gebackenem Brot raubte mir fast den Verstand: Ich war hungrig und floh die Via Calimala hinab zur Piazza della Signoria.
Wie viele junge Künstler hatte der Marzocco, Donatellos steinerner Löwe, schon gesehen, die hoffnungsvoll die Treppe zum Portal der Signoria hinaufstiegen und desillusioniert wieder herunterkamen? Ich trat durch das Portal in den Innenhof des Palazzo.
Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich nicht aufgeregt war. Es war Monate her, dass ich Herzog Guido um einen Auftrag gebeten hatte. Da ich durch meinen Vater, den Hofmaler, und meine Freundschaft zu Francesco zur Familie gehörte, erhielt ich regelmäßig Bestellungen für Bilder. Vor dem Porträt der Herzogin Elisabetta hatte ich ein Bild des Heiligen Georg mit dem Drachen gemalt, eine Allegorie des Sieges über Cesare Borgia, der Urbino 1502 erobert und Herzog Guido ins monatelange Exil vertrieben hatte. Der ›Drache‹ war nun der Gefangene des Papstes.
Ich stieg die breite Treppe zum Piano Nobile, dem ersten Stockwerk, hinauf und blieb auf dem Treppenabsatz stehen. Durch das halb geschlossene Portal des Großen Ratssaals wehte mir der dumpfe Geruch von frischem Gipsverputz entgegen. Offenbar wurde der Saal für eine Freskierung vorbereitet. Ich öffnete vorsichtig einen Türflügel, konnte aber nichts erkennen, da die Holzgerüste mit Stoffbahnen verhängt waren, um die empfindlichen Putzschichten vor einem kalten Luftzug und die riesigen Entwurfskartons vor neugierigen Blicken zu schützen.
Ein paar Stufen weiter gelangte ich in das Arbeitszimmer eines Magisters, der mein Erscheinen mit einem unwilligen Blick quittierte.
»Buon di«, begrüßte ich ihn höflich. »Ich wünsche eine Audienz bei Piero Soderini.«
»Ach ja?«, fragte der Beamte in einem Tonfall, als würde ihm diese Bitte jeden Tag hundert Mal vorgetragen werden. »In welcher Angelegenheit?« Sein Blick blieb missbilligend an meiner Kleidung hängen, die seit dem unfreiwilligen Sprung in den Arno gelitten hatte. Für was hielt er mich – für einen mittellosen Vagabunden? Für einen Bettler?
»In meiner eigenen«, trotzte ich selbstbewusst seinem Desinteresse.
»Und wer bist du?«, fragte der Beamte gelangweilt.
»Maestro Raffaello di Giovanni Santi aus Urbino. Ich will den Gonfaloniere um einen Auftrag bitten!«, sagte ich geradeheraus.
Der Beamte lachte amüsiert. »Die Staatskassen der Republik Florenz sind leer, Maestro Raffaello. Seit Seine Gnaden Maestro Leonardo da Vinci den Auftrag gegeben hat, den Großen Saal zu freskieren, ist die Republik bankrott. Leonardos Schlacht von Anghiari kostet Florenz weit mehr als das wirkliche Gefecht bei Anghiari gegen Francesco Sforza von Mailand. Dabei hat er noch nicht einmal zu malen begonnen ...«
»Maestro Leonardo arbeitet im Ratssaal?« Es waren seine Gerüste und Entwurfskartons gewesen, die ich im Großen Saal gesehen hatte! Die Nachricht, dass Leonardo nach Florenz zurückgekehrt war, hatte ich in Urbino vernommen. Der berühmte Maestro war einer der Gründe, weshalb ich nach Florenz gekommen war.
»Wenn er mal arbeitet! Meist entwirft Maestro Leonardo Belagerungsmaschinen, die niemand braucht. Oder er klettert auf den Campanile, um seine Flugmaschinen fliegen zu lassen.«
»Ich habe ein Empfehlungsschreiben der Herzogin von Urbino ...«, begann ich.
»Und Leonardo da Vinci hatte ein Empfehlungsschreiben von Cesare Borgia. Das ist Borgias Art, mit Florenz Krieg zu führen. Keine Waffen, keine Belagerung. Er ruiniert Florenz, indem er uns seinen teuersten Künstler schickt.«
Ich setzte die Maske eines höflichen Lächelns auf. »Wann kann ich den Gonfaloniere sprechen?«
»Morgen vielleicht. Komm morgen Nachmittag wieder!«
Morgen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht ...
Ich war enttäuscht. Wie anders hatte ich mir meinen triumphalen Einzug nach Florenz vorgestellt! In Urbino war ich der Hofmaler des Herzogs Guidobaldo da Montefeltro. Hier in Florenz war ich ein unbekannter Maler. Ich kannte niemanden, niemand kannte mich. Und ich war arbeitslos.
Aber nicht hoffnungslos.
Ich verließ die Signoria und ging zum Haus der Gilden.
Florenz war eine Stadt des Geldes. Die Kaufleute waren ebenso in ihrer Gilde, der Arte di Calimala, organisiert wie die Wollhändler in der Arte della Lana. Und wie Richter und Notare, Färber, Seidenhändler, Geldwechsler, Ärzte und Apotheker, und die Handwerker wie Schuhmacher, Schreiner, Schmiede und Steinmetze. Jeder Mann musste einer Gilde angehören. Die Fraternità San Luca, ein Zweig der Gilde der Ärzte, Apotheker und Gewürzhändler, war keine Zunft, sondern eine Bruderschaft. Diese Vereinigung der Maler wachte über die Qualität der Farben und die Einhaltung von Verträgen zwischen Auftraggeber und Künstler. Jeder Maler, der in Florenz eine Werkstatt eröffnen oder Aufträge annehmen wollte, musste sich für die Gebühr von einem Fiorino bei der Bruderschaft einschreiben.
Im Register las ich einige bekannte Namen: Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Filippino Lippi, der vor einem halben Jahr verstorbene Sohn des Fra Filippo Lippi, Andrea del Sarto, mein Freund Bernardino Pinturicchio – wie ich ein Schüler von Pietro Perugino, mit dem ich vor zwei Jahren die Dombibliothek von Siena freskiert hatte. Bastiano da Sangallo, mein Mitschüler aus Peruginos Werkstatt, hatte sich vor einem Jahr eingetragen. Der Name Michelangelo Buonarroti war mit energischer Feder durchgestrichen worden. Ein handschriftlicher Vermerk am Rand des Buches wies darauf hin, dass Michelangelo in die Gilde der Steinmetze und Bildhauer übergewechselt war.
Woher sollte ich den Fiorino nehmen, um meinen Namen unter den aller anderen Künstler zu setzen? Um Florenz mitzuteilen, dass ich nun gekommen war!
In dieser Nacht schlief ich auf der harten Marmorbank des Palazzo Medici. Zuerst lag ich wach und dachte an mein Bett in meinem Haus in Urbino. Ein weiches, breites Bett! Und nach dem Aufwachen – ein ausgiebiges Frühstück! Dann ein Besuch im Palazzo Ducale, ein Ausritt mit Francesco, eine gemeinsame Fechtstunde im Cortile ...
Es war ein verlockender Gedanke, im Morgengrauen nach Urbino zurückzureiten! Doch: Ich konnte nicht zurückkehren – ich wollte es nicht! Ich hatte mein weiches Nest verlassen, um fliegen zu lernen. Und ich würde erst nach Urbino zurückkehren, wenn ich sämtliche Pirouetten des Fluges im Aufwind des Ehrgeizes beherrschte! Nicht früher!
Der Nachtwächter, der mich erst von der Marmorbank fortschicken wollte, blieb schließlich die halbe Nacht neben mir sitzen. Im Schein der Fackeln des Palazzo Medici skizzierte ich ihn. Er freute sich sehr, als ich ihm die Kohlezeichnung schenkte, die er sich von seinem Lohn mit Sicherheit nicht leisten konnte. Er wachte über mich.
Der Gedanke an Felice, die auf ihrem Lager in einer Klosterzelle von Santa Croce lag, hielt mich von meinem Abendgebet ab. Ob sie wie ich schlaflos die Laken zerwühlte? Sie würde in der Morgendämmerung nach Rom aufbrechen, um Gian Giordano Orsini zu heiraten. Tränen flossen aus meinen Augen auf die zusammengerollte Jacke unter meinem Kopf, Tränen der Enttäuschung, der Wut. Tränen der Ohnmacht.
Als ich mich beim ersten verschlafenen Vogelgezwitscher von der Marmorbank erhob, war der Nachtwächter verschwunden. Einen Kanten Brot und ein Stück harten Pecorino hatte er zurückgelassen. Meinen Hunger konnten sie nicht stillen.
Im ersten Morgenlicht ging ich hinunter zum Lungarno. Ich hockte mich auf die hohe Mauer, um den Fischern zuzusehen, die ihre Netze aus dem Arno zogen. Wie gerne hätte ich sie gezeichnet! Aber ich hatte kein Papier.
Nach der Siesta ging ich zum Palazzo della Signoria und fragte nach dem Gonfaloniere, aber ich wurde abgewiesen. Er habe heute keine Zeit für mich. Ich sollte am nächsten Tag wiederkommen.
Morgen! Vielleicht!
Ziellos irrte ich durch die Straßen von Florenz.
Die prächtigen Fassaden der Palazzi und Kirchen: Was waren sie mehr als goldene Käfige? Ich war frei! Ich atmete die verführerischen Düfte von gebratenem Kapaun und gerösteten Mandeln ein, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Was waren sie mehr als ein sinnloser und damit verzichtbarer Genuss? Das wirkliche Glück entstand nicht aus sinnlicher Schwelgerei! Ich lauschte den Klängen von Lauten und Violas, ohne sie zu hören. Sie waren nicht die Posaunen von Jericho, die die Mauern der Stadt zum Einsturz brachten! Trotzig ignorierte ich alles um mich herum. Doch was nützte mir die Illusion meiner Freiheit, mein Hunger, meine Verzweiflung?
Mein Bett auf der Marmorbank des Palazzo Medici war nicht hart genug, um mich diesen Gedanken zu Ende denken zu lassen.
Aus der Trattoria gegenüber dem Palazzo Medici duftete es nach Bistecca alla Fiorentina vom Holzkohlenfeuer, nach Pollo alla Diavola und anderen Köstlichkeiten. Der Wirt hatte zur Siesta die Tische und Bänke nach draußen auf die Via Larga gestellt. Fast alle Sitze waren von Kaufleuten und Bankherren besetzt, die bei einem Becher Chianti ihre Geschäfte besprachen.
Auf den Treppenstufen neben der Trattoria begann ich, einige der Passanten zu skizzieren. Das Papier hatte ich dem Schreiber eines Notars abgeschwatzt. Ich zeichnete eine Bäuerin, die mit einem Gemüsekorb voller Gurken und Erbsen die Via Larga herunterkam, einen Studiosus in schwarzem Samt, einen Kaufmann in flämischer Tracht.
Ein Gast der Trattoria hatte mich beobachtet. Er kam mit einem Becher Wein zu mir herüber und setzte sich neben mich auf die Treppenstufen. Dass seine schwarze, elegante Samtkleidung durch den Staub beschmutzt werden könnte, schien ihn nicht zu kümmern. Selbst als er neben mir auf den Stufen saß, ein Bein angewinkelt, das andere ausgestreckt, die Hand mit dem Becher auf dem Knie balancierend, sich mit dem Ellbogen auf den Stufen abstützend, war er ein Nobile, von der perlenbestickten Samtkappe und den schulterlangen schwarzen Haaren bis zu den Lederstiefeln. Sechs goldene Ringe mit Saphiren und Rubinen zierten seine Finger.
Eine Weile sah er schweigend zu, wie ich einen jungen Mann skizzierte, der auf einem Esel die Via Larga entlangritt.
»Nicht schlecht!«, kommentierte er und trank einen Schluck Wein. »Diese Haltung! Ist das der Messias?«
»Wenn du willst ...« Mit ein paar schnellen Strichen änderte ich die Kleidung des Mannes. »Für sechs Soldi überlasse ich es dir«, bot ich ihm an und begann die nächste Zeichnung. Ein Bettler auf der Marmorbank neben der Loggetta des Palazzo Medici. Ich zeichnete ihn als Petrus.
Der Mann lachte, und seine blauen Opalaugen funkelten. »Sechs Soldi? Ist die Zeichnung so viel wert?«
»Keine Ahnung, wie viel sie wert ist.« Ich ließ mich von seinem spöttischen Tonfall nicht provozieren. »Wie viel ist sie dir wert?«
»Warum dann gerade sechs Soldi?«, fragte er neugierig.
»Das Bistecca alla Fiorentina in der Trattoria nebenan kostet drei Soldi, ein Becher verdünnter Wein einen Soldo. Ich bin hungrig. Und durstig.«
»Bistecca und Wein kosten zusammen vier Soldi. Was machst du mit den anderen beiden?«
»Ich werde Zeichenpapier kaufen. Für weitere Skizzen.«
»Die du dann verkaufen wirst?«
»Ich habe kein Geld«, gestand ich.
Der Mann deutete auf die Zeichnung des Messias auf dem Esel. »Sechs Soldi ist ein inakzeptabler Preis.«
Ich zögerte. »Wie viel bietest du?«
Er lachte amüsiert, griff in die Geldbörse, die er am Gürtel trug, und zählte mir zehn Fiorini d’Oro auf die Hand. »Damit du bis heute Abend nicht verhungerst.«
»Heute Abend?«, fragte ich verunsichert. Auf was hatte ich mich eingelassen? Wofür bezahlte er mich, wenn nicht für die Zeichnung?
»Via San Gallo 15. Bei Sonnenuntergang.« Er erhob sich und stieg die Stufen hinab zur Via Larga.
Mit den zehn Fiorini in der Hand saß ich auf der Treppe und sah ihm nach. Ich hatte ihn nicht einmal nach seinem Namen gefragt! Und die Zeichnung lag noch immer neben mir!
Im Haus der Gilden setzte ich schwungvoll meinen Namen unter die von Michelangelo Buonarroti und Leonardo da Vinci.
Ich glaubte fest daran, dass ich alles erreichen konnte, wenn ich es nur wollte! Gehe deinen Weg, und werde, der du bist! Ich zahlte den einen Fiorino, der mich von einem Bettler zu einem wirklichen Menschen machte, und fragte mich zur Apotheke am Canto delle Rondine durch.
Der Laden hatte vor Jahren dem Humanisten Matteo Palmieri gehört und belieferte Leonardo und Perugino mit Farben. Ich kaufte Bleiweiß, Goldstaub, Karminrot aus getrockneten und gemahlenen Läusen, die tiefrote Farbe namens Drachenblut aus dem Harz von Kokospalmen, Zinnober, geriebenen schwarzen Asphalt aus Persien, dunkle Umbra-Erde und die hellere Terra di Siena, Grünspan vom Kupfer, Malachit, Indigo, das leuchtende Blau des gemahlenen Lapislazuli aus Oltramare und Elfenbeinschwarz aus verkohlten Tierknochen. Dazu erwarb ich Gips für die Grundierung, Öllasur und Bernstein für den Firnis, Marderhaar und Schweineborsten für die Pinsel.
Für die Farben zahlte ich acht Fiorini und zwei Soldi. Der Hunger war nicht mehr so schlimm. Der Traum hält uns am Leben, wenn er auch nicht satt macht.
Vor mir lag die Via San Gallo im Licht der untergehenden Sonne. Die Umgestaltung der Stadt hatte auch vor dieser Straße nicht Halt gemacht. Wie bei der Errichtung der Palazzi Medici, Strozzi und Pitti waren auch hier Dutzende von kleinen Häusern abgerissen worden, um einem Palazzo mit seinen Loggien, Ställen und Gärten Platz zu machen.
An der Stelle, wo der Zählung nach das Haus Via San Gallo 15 stehen sollte, ragte der großartige Palazzo eines florentinischen Bankhauses in den glühenden Abendhimmel. Über dem Portal las ich das bemalte Wappenschild: Banca Taddei.
Nicht nur die Familien der Medici, der Pitti, der Strozzi und der Tornabuoni unterhielten bedeutende Bankhäuser in ganz Europa. Vom nebeligen London bis ins osmanische Constantinopolis und vom kalten Nowgorod bis zum ehemals maurischen Granada tätigten die Florentiner Bankherren die Kreditgeschäf-te der zivilisierten Welt und hatten als Nobili die Macht in Florenz.
Unschlüssig stand ich vor dem Tor zwischen den über das Steinpflaster rumpelnden Eselskarren und den vom Mercato Vecchio kommenden Marktfrauen, als mir ein Bediensteter durch den Bogengang zum Gittertor entgegeneilte. »Ihr werdet erwartet, Maestro!«, rief er, als ich mich gerade umwenden wollte.
»Und wer erwartet mich?« Ich war irritiert über die förmliche Anrede.
»Was für eine Frage! Il Principe erwartet Euch!«
Der Diener öffnete mir das schmiedeeiserne Tor. Wir durchquerten das von den letzten Sonnenstrahlen durchflutete Atrium mit winzigen Lorbeerbäumen in Terrakottagefäßen und stiegen eine breite Treppe hinauf zum Piano Nobile. Der Palazzo war mit seinem Innenhof und dem dahinter liegenden Garten nicht kleiner als der Palazzo Medici auf der anderen Straßenseite.
Wer war der Principe? Worauf hatte ich mich eingelassen?
Der Diener führte mich durch Loggien und Gänge und öffnete mir die Tür zu einem Studierzimmer, das von unzähligen Kerzen hell erleuchtet war.
In der Mitte des Raumes stand der wunderbarste Schreibtisch, den ich je gesehen hatte, ein Meisterwerk der florentinischen Handwerkskunst. Zu meinen Füßen lag ein kostbarer orientalischer Teppich. In der Luft hing ein schwerer Duft nach Lotus und Goldstaub und kostbaren Büchern.
Er erwartete mich.
Er saß auf einem gepolsterten Stuhl am Schreibtisch und las. Als ich eintrat, erhob er sich und legte das Buch auf den Tisch: Giovanni Pico della Mirandolas Über die Würde des Menschen. Dann reichte er mir ein Glas unverdünnten Wein.
Ich überreichte ihm wortlos die Skizze des Messias, die er auf den Stufen liegen gelassen hatte.
Er lächelte und hielt das Papier in die Flamme einer brennenden Kerze. »Ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich habe mich dir noch nicht vorgestellt. Ich bin Taddeo Taddei.«
Ich starrte ihn an und wusste nicht, was ich sagen sollte. »Ich bin Raffaello Santi aus ...«
»Ich weiß«, gestand er geheimnisvoll lächelnd und trank einen Schluck Wein, während das Papier in seiner Hand brannte.
»Woher kennt Ihr mich, Signor Taddei? Ich hatte Euch heute Nachmittag meinen Namen nicht genannt.« Ich konnte meinen Blick nicht von der Zeichnung wenden, die ihm die Hand verbrennen würde, wenn er sie nicht losließ.
Taddeo Taddei lächelte nachsichtig, als hätte ich eine unglaublich dumme Frage gestellt. »Ich habe gesehen, wie du zeichnest. Du hältst den Silberstift wie Pietro Perugino, du schraffierst Licht und Schatten wie Perugino, dein Messias sah aus wie von Perugino skizziert. Mit einem Unterschied: Du zeichnest mehr wie Perugino als er selbst.«
Im Schein der Kerzen erkannte ich drei Bilder von Maestro Pietro an der Wand. Und zwei von Sandro Botticelli. War Taddeo Taddei Kunstliebhaber?
»Wenn ich etwas tue, dann mit Leidenschaft. Oder ich lasse es bleiben«, formulierte ich selbstbewusst.
»Perugino zu imitieren findest du ... leidenschaftlich?«
»Sechs Jahre habe ich bei ihm gelernt. Er ist einer der führenden Maler unserer Zeit.«
Haltung und Perspektive hatte mich mein Vater gelehrt. Doch bei Pietro Perugino hatte ich das Malen mit Farben gelernt. Ich war vom ersten Tag an sein Lieblingsschüler gewesen. Das hieß in anderen, unfarbigeren Worten: Ich lief zum Apotheker, um Farben zu kaufen, rieb ihm stundenlang, bis mir die Arme schmerzten, die feinsten Farbpulver, mischte ihm seine Farben mit Nussöl und kochte bis spät in die Nacht Leim für die Leinwandgrundierungen. Als Gegenleistung ließ Pietro mich ihm schon im ersten Lehrjahr beim Malen helfen: Ich malte ein Stück Himmel in einem seiner Madonnenbilder. Pietro war zufrieden. Ich war glücklich. Von diesem Tag an arbeiteten mein Maestro und ich oft an demselben Bild. Er lehrte mich, seinen Stil vollkommen zu beherrschen, bis meine Madonnen sich nicht mehr von seinen unterschieden – nicht einmal im Preis, den er von seinen Auftraggebern verlangte, als er meine Bilder mit seinem Namen signiert hatte ...
»Pietro Perugino hat aus mir gemacht, was ich heute bin ...«, fügte ich an. Aber glaubte ich mir das eigentlich selbst?
»Und was, Maestro Raffaello, bist du heute?«, unterbrach mich der Principe. »Vor wenigen Stunden habe ich dich in der Via Larga getroffen. Du hattest kein Papier für Skizzen und kein Geld. Ich kann mich auch nicht erinnern, Pinsel und Farben gesehen zu haben.«
»Ich habe eine Begabung!«, trotzte ich ihm, wütend über seine Erbarmungslosigkeit.
»Nein, Raffaello, du hast keine Begabung zum Malen! Du hast einen Dämon in dir. Er treibt dich voran, bis an deine Grenzen. Und darüber hinaus. Du bist nach Florenz gekommen, um den Parnassos zu besteigen und dich mit den Göttern der Malerei zu messen, mit Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci und Michelangelo Buonarroti. Wie du dich mit Pietro Perugino gemessen hast.
Ich habe deine Vermählung der Jungfrau gesehen, die du letztes Jahr in Città di Castello gemalt hast. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie Peruginos Vermählung im Dom von Perugia. Nur ... vollkommener! Und nun bist du nach Florenz gekommen, um die größten Meister Italiens zu treffen. Willst du dieses Jahr wie Leonardo malen? Und nächstes Jahr wie Michelangelo?«
Trotzig ballte ich meine Hände zu Fäusten. Glaubte er, mich für zehn Fiorini verhöhnen und demütigen zu dürfen? »Ich will lernen!«, presste ich hervor.
»Dann lerne, Raffaello! Lerne zu malen wie Raffaello! Werde, der du bist!« Taddeo Taddei nahm meine Hand, öffnete sanft die Faust und strich mir beinahe zärtlich über die Finger. »Wer bist du?«
»Ich bin ein Mensch ...«, begann ich bescheiden.
Taddeo Taddei lachte. »Und was für einer!«
»Vor vier Jahren ging ich von Perugia nach Città di Castello. Ich habe Pietro Perugino im letzten Jahr meiner Lehre verlassen.«
»Warum verlässt ein Schüler seinen Lehrer?« Taddeo Taddeis Blick bohrte sich in meinen. Meine Hand ließ er nicht los.
»Weil er nichts mehr lernen kann.«
»Dann hättest du schon Jahre früher gehen müssen! Du bist gegangen, weil er dich eingeengt hat, weil er dich gefesselt hat. Weil du deine Flügel nicht ausbreiten konntest, Raffaello. Weil du fliegen lernen willst, um sie alle zu übertreffen. Ich habe ...«
»Das Fliegen überlasse ich Leonardo!«, unterbrach ich ihn und entzog ihm meine Hand.
»Ich habe deine Krönung des Heiligen Niccolò da Tolentino in Città di Castello gesehen«, fuhr der Principe unbeirrt fort. »Der Bildaufbau könnte von deinem Vater Giovanni stammen, die Figuren sehen aus wie von Pietro Perugino entworfen. Wenn nicht dein Name darunter stünde, würde niemand glauben, dass es von dir ist, sondern von Perugino. Die Figuren sind zu grazil, zu elegant, zu süß, zu ... schön, um wahr zu sein. Sie leben nicht. Sie haben keine Seele.«
»Keine Seele?«, begehrte ich auf.
»Deine Jungfrau in der Marienkrönung für die Cappella Oddi in der Kirche San Francesco in Perugia ist weder eine Castissima Diva noch eine Mutter. Dein Christus in der Kirche San Domenico in Città di Castello leidet nicht, wenn er am Kreuz hängt. Er lächelt, als ob er Maria Magdalena verführen will. Oder seinen Lieblingsjünger Giovanni. Dein betender Gottessohn im Garten Gethsemane dankt Gott für den gebratenen Fasan, den er gerade gegessen hat. Aber er ringt nicht mit Gott um sein Leben. Lies!«, befahl er mir und reichte mir eine Bibel, die auf seinem Schreibtisch gelegen hatte. »Lies! Und dann male den Weg, die Wahrheit und das Leben! Geh deinen Weg, finde deine Wahrheit, und lebe dein Leben!«
Ich starrte ihn an. »Ihr habt alle meine Werke gesehen, nicht wahr? In Perugia, in Città di Castello und in Siena.«
Statt einer Antwort öffnete Taddei die Tür zum benachbarten Speisesaal mit einer für zwei Personen gedeckten Tafel. »Lass uns essen! Dabei können wir uns unterhalten.«
Als die Dienerschaft unsere Stühle zurechtgerückt und uns Fingertücher über den Schoß gebreitet hatte, wurde das Mahl aufgetragen. Wir aßen gebratenen Kapaun in Pfeffersauce, Fasanenpastete, mit Goldstaub gewürzte Wachteleier, dazu Weißbrot. Taddeo Taddei zeigte mir, wie ich mit der silbernen Gabel mit den drei Zinken die Wachteleier aufspießen konnte. Gabeln gab es nicht einmal im Palazzo Ducale in Urbino!
Das Abendessen, das Signor Taddei für mich veranstaltete, übertraf alles, was ich erwartet hatte.
Ich aß wie ein Verhungernder, trank wie ein Verdurstender. Und genoss auf dem weichen Lederstuhl die behagliche Wärme des Kaminfeuers. Welch ein Unterschied zu den harten Brotkanten des Nachtwächters, den wurmstichigen Äpfeln, die mir eine mitleidige Bäuerin auf dem Mercato Vecchio geschenkt hatte, und dem Wasser aus dem Brunnen von San Marco! Und zur harten Marmorbank des Palazzo Medici, auf der ich die letzte Nacht verbracht hatte!
Als ich vom Marzipankonfekt nahm, ergriff er meine Hand und hielt sie fest. »Deine Hände gefallen mir, Raffaello«, gestand er, ganz in die Betrachtung meiner Finger vertieft. Leicht wie einen kleinen Vogel hielt er meine Hand. »Sie sind weich ... zärtlich.« Spielerisch bewegte er Felices Rubinring an meiner Hand. Als er meinen Blick sah, lachte er amüsiert und naschte das Konfekt aus meiner Hand. Dabei berührten seine Lippen leicht meine Finger.
Ich war ... erregt!