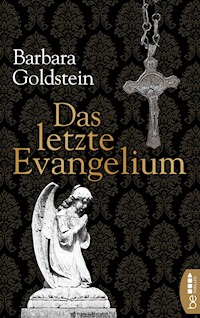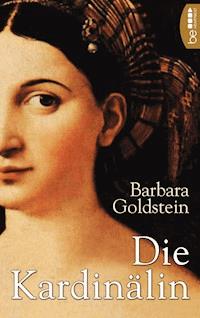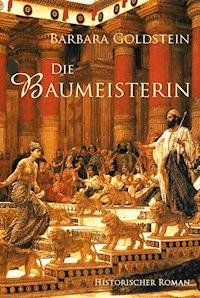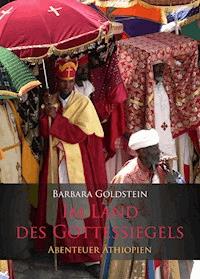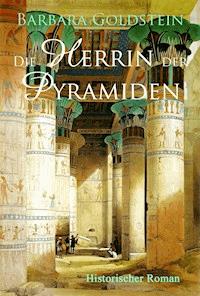4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alessandra d’Ascoli
- Sprache: Deutsch
Ein rasanter historischer Roman um das Vermächtnis des letzten Templers
Im Auftrag des Papstes sucht die florentinische Buchhändlerin Alessandra d'Ascoli in Jerusalem einen Papyrus, der aus dem Vatikan geraubt wurde. Sie weiß nicht, dass der Dieb sie verfolgt und ihr nach dem Leben trachtet. Den päpstlichen Archivar, der das wertvolle Dokument in den Gewölben des Vatikans beschützen sollte, hat der Tempelritter bereits getötet. Im Labyrinth unter dem Tempelberg greift er nun auch sie an. Ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt.
Alessandra bleiben nur wenige Stunden, um zu finden, wonach seit Jahrhunderten vergeblich gesucht wird: die verschollene Bundeslade - den Schlüssel zu unermesslicher Macht. Wird der geheimnisvolle Papyrus, eine codierte Schatzkarte der Templer, sie zum Gottesschrein führen?
Auch in den folgenden weiteren historischen Romanen von Barbara Goldstein bei beTHRILLED löst Alessandra d'Ascoli spannende Rätsel:
Der vergessene Papst * Der Ring des Salomo * Das Testament des Satans * Das letzte Evangelium.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 728
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumHinweisZitatKarte von JerusalemPrologIntermezzoAlessandra - Kapitel 1Yared - Kapitel 2Alessandra - Kapitel 3Yared - Kapitel 4Alessandra - Kapitel 5Yared - Kapitel 6Alessandra - Kapitel 7Yared - Kapitel 8Alessandra - Kapitel 9Yared - Kapitel 10Alessandra - Kapitel 11Yared - Kapitel 12Alessandra - Kapitel 13Yared - Kapitel 14Alessandra - Kapitel 15Yared - Kapitel 16Alessandra - Kapitel 17Yared - Kapitel 18Alessandra - Kapitel 19Yared - Kapitel 20Alessandra - Kapitel 21Yared - Kapitel 22Alessandra - Kapitel 23Yared - Kapitel 24Alessandra - Kapitel 25Yared - Kapitel 26Alessandra - Kapitel 27Yared - Kapitel 28Alessandra - Kapitel 29Yared - Kapitel 30Alessandra - Kapitel 31Yared - Kapitel 32Alessandra - Kapitel 33Yared - Kapitel 34Alessandra - Kapitel 35Yared - Kapitel 36Alessandra - Kapitel 37Yared - Kapitel 38Alessandra - Kapitel 39Yared - Kapitel 40Alessandra - Kapitel 41Yared - Kapitel 42IntermezzoAlessandra - Kapitel 43Yared - Kapitel 44Alessandra - Kapitel 45Yared - Kapitel 46Alessandra - Kapitel 47Yared - Kapitel 48Alessandra - Kapitel 49Yared - Kapitel 50IntermezzoYared - Kapitel 51Alessandra - Kapitel 52Yared - Kapitel 53Alessandra - Kapitel 54Yared - Kapitel 55Alessandra - Kapitel 56Yared - Kapitel 57Alessandra - Kapitel 58Yared - Kapitel 59Alessandra - Kapitel 60IntermezzoAlessandra - Kapitel 61Yared - Kapitel 62Alessandra - Kapitel 63Yared - Kapitel 64Alessandra - Kapitel 65Yared - Kapitel 66Alessandra - Kapitel 67Yared - Kapitel 68Alessandra - Kapitel 69Yared - Kapitel 70Alessandra - Kapitel 71Yared - Kapitel 72Alessandra - Kapitel 73Yared - Kapitel 74Alessandra - Kapitel 75Yared - Kapitel 76Alessandra - Kapitel 77Yared - Kapitel 78Alessandra - Kapitel 79Yared - Kapitel 80Alessandra - Kapitel 81Yared - Kapitel 82Alessandra - Kapitel 83Yared - Kapitel 84Alessandra - Kapitel 85Dramatis PersonaeÜbersetzung der StädtenamenÜber dieses Buch
Ein rasanter historischer Roman um das Vermächtnis des letzten Templers
Im Auftrag des Papstes sucht die florentinische Buchhändlerin Alessandra d‘Ascoli in Jerusalem einen Papyrus, der aus dem Vatikan geraubt wurde. Sie weiß nicht, dass der Dieb sie verfolgt und ihr nach dem Leben trachtet. Den päpstlichen Archivar, der das wertvolle Dokument in den Gewölben des Vatikans beschützen sollte, hat der Tempelritter bereits getötet. Im Labyrinth unter dem Tempelberg greift er nun auch sie an. Ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt. Alessandra bleiben nur wenige Stunden, um zu finden, wonach seit Jahrhunderten vergeblich gesucht wird: die verschollene Bundeslade - den Schlüssel zu unermesslicher Macht. Wird der geheimnisvolle Papyrus, eine codierte Schatzkarte der Templer, sie zum Gottesschrein führen?
Über die Autorin
Barbara Goldstein, geb. 1966, arbeitete zunächst in der Verwaltung von Banken und nahm dann ein Studium der Philosophie und der Sozialen Verhaltenswissenschaften auf. Später machte sie sich als Autorin historischer Romane selbstständig und nahm ihre Leser mit in die Welt von Alessandra d‘Ascoli, einer florentinischen Buchhändlerin. Barbara Goldstein verstarb im März 2014 nach langer Krankheit.
Barbara Goldstein
Der Gottesschrein
beTHRILLED
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Copyright © 2013/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Textredaktion: Dr. Lutz Steinhoff
Titelillustration: © akg-images/© akg-images/Rabatti – Domingie
Umschlaggestaltung: Atelier Versen, Bad Aibling
Karte im Innenteil: Dr. Helmut Pesch
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5298-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Ein Verzeichnis der handelnden Personen sowie eine Übersetzung der Städtenamen finden sich am Ende des Buches.
Dem Weg der Bundeslade werde ich folgen,
bis ich den Staub des Ortes schmecke,
an dem sie versteckt ist –
Staub, der süßer ist als Honig.
Yehuda Halev
Prolog
Geheimarchiv des Vatikans in Rom
Sonntag, 21. Februar 1445
Eine Stunde vor Sonnenaufgang
Der alte Mönch schaudert. In den Gewölben des Vatikans ist es kalt wie in einer Gruft. Er steigt eine Treppe hinunter und geht einen langen, düsteren Gang entlang in Richtung der Krypta der Basilica di San Pietro.
Als er mit rasselndem Schlüsselbund die Tür zum Geheimarchiv aufschließen will, stutzt er.
Sie ist nur angelehnt.
Nein, erschrocken oder ängstlich ist er nicht, aber eine gewisse Unruhe kann er nicht leugnen. Er ist sicher, dass er die Tür abgeschlossen hat, als er lange nach Mitternacht die Kammern des Archivs verließ.
Leonardo hält den Atem an und lauscht in die nächtliche Stille der alten Gewölbe. Doch alles ist ruhig.
Er stößt die Tür auf. Die rostigen Scharniere knarzen leise.
»Alessandra?«
Der alte Mönch betritt den Raum. Er ist verlassen.
In den Regalen reihen sich die zu Folianten gebundenen Akten. Neben dem Arbeitstisch steht die Truhe mit der privaten Korrespondenz von Papst Johannes. Leonardo will sie heute ordnen. Der Papst war des Raubes, des Mordes, der Vergewaltigung und des Inzests angeklagt und durch Luca d’Ascoli, den ›Richter Gottes‹, als Pontifex maximus abgesetzt worden. Die unerfreulichsten Briefe wird Leonardo auf Befehl von Papst Eugenius verbrennen und eines der dunkelsten Kapitel der Kirchengeschichte neu schreiben.
Auf dem Arbeitstisch liegen die Werke von Flavius Josephus, die Alessandra letzte Nacht studiert hat, um sich auf ihre Expedition nach Jerusalem vorzubereiten. Die Beschreibung des jüdischen Tempels ist mit einem Streifen Pergament markiert. Alessandras Notizen über die seit der Zerstörung des Tempels verschollene Tempelbibliothek, die sie in den Ruinen zu finden hofft, liegen zwischen apokryphen Schriften verstreut. Alles scheint unverändert.
Erst jetzt bemerkt Leonardo den Lichtschimmer unter der Tür gegenüber. Er zuckt erschrocken zusammen.
»Alessandra?«
Stöbert sie wieder in den antiken Handschriften, in der Hoffnung, dort Hinweise auf die verlorene Tempelbibliothek zu finden? Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass sie sich schon vor der Laudes in ihre Arbeit vergräbt, wenn sie nicht schlafen kann.
Keine Antwort.
Leonardos Herz pocht laut in seinen Ohren. Unruhig tastet er nach dem Holzkreuz auf seiner Brust und umklammert es mit zitternden Fingern.
Um Himmels willen! Ist in der Kammer des Archivs ein Feuer ausgebrochen? Alle Akten des Archivum Secretum werden in diesen Gewölben aufbewahrt. Dekrete, Breven, Bullen. Prozessakten der Inquisition. Häretische Schriften. Apokryphe Evangelien. Das Unionsdekret, das das jahrhundertealte Schisma aufgehoben und die Kirche Jesu Christi wieder vereint hat.
Doch es riecht nicht nach Rauch. Kein tosendes Inferno.
Ist jemand ins Geheimarchiv der Päpste eingedrungen?
Ohne sein hölzernes Brustkreuz loszulassen, huscht Leonardo lautlos zur Tür. Sein Habit streift Alessandras aufgeschlagenes Notizbuch. Es wird vom Tisch gerissen. Mit einem erschreckend lauten Krachen landet es auf dem Boden.
Wieder zuckt Leonardo zusammen. Vor Aufregung wagt er kaum zu atmen. Aber dann fasst er sich ein Herz. Er vermag seine Hand kaum ruhig zu halten, als er die Klinke nach unten drückt und die Tür aufschiebt.
Vorsichtig späht er in den Raum. Er ist dunkel und verlassen. Tiefe Schatten hängen wie Spinnweben zwischen den Regalen. Einige der Truhen, die seit Papst Eugenius’ Rückkehr aus dem Exil in Florenz noch nicht ausgepackt worden sind, stehen offen. Augenscheinlich sind sie durchwühlt worden. Pergamente und Folianten liegen verstreut auf dem Steinboden.
Leonardo tritt in den Raum, hebt eines der Dokumente auf und entziffert die lateinische Handschrift.
Die Akten der Inquisitionsprozesse gegen die Templer!
Und Luca d’Ascolis Urteil als Inquisitor!
Durch die geöffnete Tür zur nächsten Kammer dringt Licht, wie von brennenden Kerzen.
Ein leises Knistern!
Leonardos Herz setzt einen Schlag aus. Das Pergament entgleitet seiner Hand und flattert zu Boden.
Jemand ist noch dort.
Das Licht flackert, als ob es von einem Luftzug bewegt wird. Aber kein Schatten regt sich.
Starr vor Entsetzen wartet Leonardo einige Atemzüge lang, doch nichts geschieht. Mit zitternden Knien schleicht er schließlich zwei, drei, vier Schritte auf die geöffnete Tür zu. Ein Geräusch – hinter ihm! Zu Tode erschrocken taumelt er herum.
Aus den tiefen Schatten taucht ein hochgewachsener Mann auf. Die Narbe eines Schwerthiebs zerspaltet sein Gesicht von der Stirn bis zu den verkniffenen Lippen. Doch nicht das Gesicht des Mannes fasziniert Leonardo, sondern der weiße Habit, den er trägt.
»Was wollt Ihr?«, flüstert Leonardo mit tonloser Stimme – er ahnt es bereits.
Der Mann mit der Statur eines Kriegers sagt es ihm.
Leonardo ringt sich zu einer Lüge durch: »Ich weiß nicht, wovon Ihr …«
»Wo ist die Lade?«, herrscht ihn der Mönch im weißen Habit an. »Sie befand sich im Besitz der Templer. Jacques de Molay hat sie 1307 nach Paris gebracht. Zusammen mit dem Templerschatz. Seit den Inquisitionsprozessen ist sie verschwunden. Sie muss die Dokumente enthalten. Wo ist sie?«
»Ich weiß es nicht.« Leonardo weicht einen Schritt zurück.
Er muss Alessandras Leben schützen! Jeden Augenblick kann sie die Tür öffnen und hereinkommen. Sie weiß, wo ihr Vater, der Inquisitor, die Lade der Templer gefunden hat. Und den aramäischen Papyrus.
Der Ritter Christi richtet einen Dolch auf Leonardos Brust. »Wo ist die Lade?«
Leonardo schweigt verbissen. Doch in seiner Todesangst bleibt sein Hilfe suchender Blick unwillkürlich einen Lidschlag zu lang an einer Truhe hängen, die halb verborgen hinter einer Reihe großer Folianten im Bücherregal ruht.
Der Gotteskrieger, der den alten Mönch nicht aus den Augen gelassen hat, wendet sich um und sieht die Bücherkiste.
»Muito obrigado!«, murmelt er und sticht zu.
Mit weit aufgerissenen Augen stolpert Leonardo rückwärts und ringt verzweifelt röchelnd nach Atem. Ein Gurgeln entringt sich seiner Kehle. Blut tritt auf seine Lippen, rinnt ihm über das Kinn und tropft auf seinen Habit. Dann stürzt er zu Boden und bleibt mit ausgestreckten Gliedern auf dem Rücken liegen.
Der Todesengel zieht die Klinge aus Leonardos Brust und wischt das Blut ab. Sodann bekreuzigt er sich, wispert »Domine Jesu Christe, libera me ab iniquitatibus meis« und küsst andächtig seine Finger.
Er kniet sich neben den Sterbenden, der ihn entsetzt und erschrocken zugleich anstarrt, ergreift die rechte Hand des Fraters und malt mit dem Finger das heilige Symbol in dessen Handfläche. Dann nimmt er die linke Hand und wiederholt die Geste. Sanft legt er seine Hand auf die Stirn des Todgeweihten, als ob er ihm neben dem Sterbesakrament auch Trost spenden wolle. Mit dem Daumen malt er drei Kreuze auf die Stirn. »Benedicat tibi Dominus et custodiat te. Ostendat Dominus faciem suam tibi et misereatur tui. Convertat Dominus vultum suum ad te et det tibi pacem«, murmelt er in beruhigendem Ton und wischt dem Sterbenden eine Träne aus dem Augenwinkel. »Vergib mir, Bruder in Christo.«
Er erhebt sich und eilt zum Bücherregal mit der Truhe, in der er endlich die uralte Lade aus Akazienholz findet. Seine Miene zeigt keine Regung, als er eine große und schwere Papyrusrolle mit verblasster aramäischer Schrift aus der Lade nimmt, die er augenscheinlich nicht lesen kann. Wortlos richtet er sich auf und verlässt den Raum.
Leonardo hört, wie der Assassino an Alessandras Arbeitstisch unvermittelt stehen bleibt, um einen Blick auf die aufgeschlagenen Bücher zu werfen, die sie zur Vorbereitung ihrer Schatzsuche in Jerusalem gelesen hat. Dann folgt ein Rascheln und Kratzen, als würde er ihre Aufzeichnungen und die Folianten von Flavius Josephus zusammenraffen und mitnehmen. Alessandras Notizbuch, das aufgeschlagen unter dem Tisch liegt, übersieht er in der Dunkelheit. Dann fällt die Tür hinter ihm ins Schloss.
Unter großen Anstrengungen hebt Leonardo den Kopf und starrt auf die Wunde in seiner Brust.
So viel Blut … Sein Habit ist nass von seinem Blut. Er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Ermattet lässt er sich zurücksinken und schließt die Augen. Er friert und zittert. Keuchend ringt er nach Atem, und er beginnt zu husten. Er wird an seinem Blut ersticken.
Nur mit Mühe hebt er die rechte Hand und taucht den Finger in die Wunde. Er muss Alessandra warnen. Der Assassino hat Luca d’Ascolis Buch gelesen, das Urteil des ›Richters Gottes‹ über die Tempelritter. Lucas Tochter ist in Lebensgefahr!
Mit seinem Blut malt Leonardo ein Symbol auf den Steinboden. Das blutrote Kreuz, das er auf dem weißen Mantel gesehen hat. Das ›Kreuz der Unschuld‹.
Es bleibt unvollendet.
Intermezzo
Maryam Tseyon
Fasika, 2. Miyazya 6945
Nach Sonnenaufgang
»Komm nicht näher! Zieh die Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, die du betreten willst, ist heiliger Boden!«, gebietet der Abuna. Mit seinem Gefolge ist er soeben am Portal erschienen. Neben ihm steht ein Diakon, der eine Schale mit geweihtem Wasser darbietet.
Der König der Könige, angetan mit der prächtigen Staatsrobe seines Vaters David und einem Schleier, der sein Gesicht verbirgt, hält auf den Stufen zum Portal inne. Zwei Diener knien nieder, um die Riemen seiner Sandalen zu lösen.
»Wer bist du?«, fragt Abuna Gabriel barsch, dem uralten heiligen Ritual folgend.
Der Gesalbte des Herrn antwortet nicht sofort. Langsam wendet er sich um. Sein Blick sucht den nur wenige Schritte entfernten steinernen Thron Davids und Salomos und die monolithischen Stelen, die in den blauen Himmel aufragen.
Zwischen den hohen Stelen leuchten die mit Ikonen bestickten Schirme der Priester, die eben noch die Psalmen gesungen haben. Ihre Trommeln und Sistren sind verstummt.
Die in weiße Gewänder gehüllten Gläubigen, die sich seit dem frühen Morgen zwischen den Eukalyptusbäumen drängen, recken die Köpfe. Sie wollen einen Blick auf den Erwählten Gottes erhaschen, der an diesem zweiten Tag des Monats Miyazya im Weltjahr 6945 das Heiligtum betritt. Es ist Fasika, das Fest der Feste. Der Tag, an dem Gott den Bund mit seinem auserwählten Volk erneuern wird.
Atemlose Stille herrscht auf dem weiten, von der Sonne durchglühten Platz, als der Abuna seine Frage in schroffem Tonfall wiederholt: »Wer bist du?«
Der König der Könige wendet sich zu ihm um. »Ich bin der Sohn Davids, der Sohn Salomos, der Sohn Meneliks«, antwortet er mit weit tragender Stimme.
Ein ekstatisches Trillern, ein schrilles Triumphgeschrei von tausend schlagenden Zungen, weht über den Platz.
Der Abuna verneigt sich tief. »Wahrhaftig, dann seid Ihr der Gesalbte des Herrn! Gelobt sei der allmächtige Gott.«
Die Antwort »In Ewigkeit. Amen« verhallt im lauten Trillern der Gläubigen.
Der Geweihte Gottes wäscht nun seine Hände in der dargebotenen Silberschale und trocknet sie an einem Tuch, das der Diakon ihm reicht, ohne ihn dabei zu berühren.
Der Abuna weist zum Portal der Basilika. »Tretet ein in den Tempel Gottes, Euer Majestät.«
Der König der Könige rafft seine Gewänder, steigt die Stufen hinauf, tritt über die Schwelle aus rötlichem Stein, die von den Küssen der Gläubigen glänzend glatt geschliffen ist, und schreitet von der staubigen Hitze des Platzes in die wohltuende Kühle des Heiligtums. Er durchmisst die lichtdurchflutete Vorhalle, deren Wände mit Fresken ausgemalt sind, und betritt die fünfschiffige Basilika durch das mittlere Portal.
Er blinzelt. Dann gewöhnen sich seine Augen an die geheimnisvolle Dunkelheit. In dieser Basilika ist er elf Jahre zuvor gesalbt worden. Wie an jenem Tag während des feierlichen Rituals seiner Krönung ist die Basilika erfüllt vom betörenden Wohlgeruch des Weihrauchs und Hunderter nach Akazienhonig duftender Kerzen. Aus goldenen Gefäßen kringeln sich Weihrauchschwaden hinauf zur Decke – bewegte Ornamente aus Licht und Schatten.
Kostbare Teppiche bedecken den Steinboden. Die Wände der Seitenschiffe sind mit farbenprächtigen Ikonen auf Pergamentrollen aus feinstem Ziegenleder geschmückt, die einen herben Duft verbreiten. Die hohen Säulen des Hauptschiffs, das vor mehr als einem Jahrtausend errichtet worden ist, sind mit Engeln bemalt, die ihre Flügel ausbreiten.
Die bunten Brokatgewänder der Priester und die Kronen der Diakone funkeln im Licht der Butterlampen. Zwischen den Säulen der Seitenschiffe drängen sich Mönche in safrangelben Umhängen und weißen Turbanen. Sie tragen lange Gebetsstäbe im Arm. Mit einem weißen Tuch verhüllen sie ihr Gesicht, als der Sohn Davids an ihnen vorüberschreitet.
Abuna Gabriel geleitet den Gesalbten zur Ikonenwand, deren purpurner Vorhang zur Seite geschoben ist. Der nächste Saal, dessen Decke von Säulen getragen wird, ist der Vorraum des Maqdas, des Allerheiligsten. Unter dem Portal erwartet sie Abuna Mikael. Der Patriarch verneigt sich vor dem Sohn Davids, ergreift dessen Arm und hilft ihm, vor den Stufen niederzuknien.
Der Erwählte des Herrn beugt sich vor und berührt, andächtig ein Gebet murmelnd, die Schwelle mit seiner Stirn und seinen Lippen. Dann reicht er Abuna Mikael und Abuna Gabriel seine Hände, lässt sich aufhelfen und küsst die ehrwürdigen Ikonen auf den Wänden neben dem Portal.
Zwei Priester treten aus der Finsternis des Allerheiligsten. Der erste trägt ein mit Brokatstoff verhülltes Tabot, auf dem sich das Wasser, das Brot und der Kelch mit dem Wein befinden. Der zweite hält das Matsahaf Kiddus aus Pergament und Leder an seine Brust gepresst. Sodann küsst er die Bibel und schlägt den uralten Folianten auf:
»In jener Zeit sprach der Herr zu Moses«, liest Abuna Mikael in der heiligen Sprache aus dem Buch vor, das ihm der Diakon aufgeschlagen darbietet. »Und Gott befahl Moses: ›Haue dir zwei steinerne Tafeln, und steige zu mir auf den Berg! Und mach dir eine Lade aus Holz! Und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten waren, die du zerbrochen hast. Und du sollst sie in die Lade legen.‹ Und Moses machte eine Lade aus Akazienholz und hieb zwei steinerne Tafeln wie die ersten. Und er stieg auf den Berg, die zwei Tabotat in seiner Hand. Und der Herr schrieb auf die Tafeln, ebenso wie die erste Schrift, die zehn Worte, die er auf dem Berg mitten aus dem Feuer gesprochen hatte. Und der Herr gab sie Moses. Und Moses wandte sich ab und stieg vom Berg herab. Und er legte die Tabotat in die Lade, die er gemacht hatte. Und dort blieben sie, wie der Herr es ihm geboten hatte.«
Nachdem der Abuna das Pergament andächtig mit den Lippen berührt hat, schließt der Priester das Matsahaf Kiddus und tritt zurück. Der König der Könige schlägt das Zeichen des Bundes über Stirn und Brust. Schließlich tritt er über die Schwelle in das von Butterlampen erleuchtete Sanktuarium.
Abuna Gabriel und Abuna Mikael bleiben in der Basilika zurück. Nicht einmal den Abunas, den Patriarchen des Reiches, ist es gestattet, das Manbar unverhüllt zu sehen. Die ehrwürdige Lade aus Akazienholz, die die allerheiligsten Tabotat bewahrt, ist von mehreren Schichten purpurnen und goldenen Brokatstoffs bedeckt.
Der Gesalbte kniet vor der Lade nieder und verneigt sich tief. Während der Wächter der Lade ein Weihrauchgefäß schwenkt und die Kapelle mit dem geweihten Duft beräuchert, hebt er den schweren Stoff an und gewährt dem Nachfolger Salomos einen Blick auf den Gottesschrein, der vor den Augen von Sterblichen verborgen bleiben muss – das Manbar, das das Symbol des Gottesbundes birgt.
»Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem!«, flüstert Abuna Mikael ergriffen. »Siehe, dein König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Nil bis an die Enden der Erde.«
Als der Sohn Davids die Hand nach der Lade ausstreckt, um sie zu berühren, hält Abuna Gabriel bestürzt den Atem an: Um Gottes willen! Der Allmächtige bestraft all die, die es wagen, seine Lade zu entweihen. Der Zorn Gottes ist fürchterlich. Für wen hält er sich – für den Messias?
Doch der König der Könige lässt sich nicht beirren. Zart streichen seine Finger über das uralte zersplitternde Holz. Andächtig betastet er die goldenen Verzierungen. Dann hebt er den Schleier, der sein Gesicht verhüllt, beugt sich vor und küsst den Schrein Gottes.
Abuna Gabriel atmet auf: Der Herr beschützt seinen Auserwählten aus der Blutlinie Davids! Der Herr ist ihm gnädig und vergibt ihm seinen Stolz und seine Anmaßung, die tief in seinem Glauben wurzeln, dem Bewusstsein, nach seiner jahrzehntelangen Gefangenschaft nun der Auserwählte des Herrn zu sein. Der König der Könige von Israel. Der Kaiser des neuen Zion. Der Hüter der Lade.
Der Gesalbte hebt den Kopf und lauscht.
Das Hufgetrappel galoppierender Pferde dringt in die Stille des Sanktuariums. Waffen und Rüstungen klirren. Befehle werden gebrüllt. Dann vernimmt er entsetzte Schreie. Vor der Basilika bricht ein Tumult aus.
Wenige Augenblicke später stürmt ein Bewaffneter in die Basilika und drängt sich durch die Reihen der aufgeregt tuschelnden Priester und Mönche. Vor der Schwelle zum Allerheiligsten fällt er auf die Knie und drückt die schweißüberströmte Stirn auf den Boden. »Vergebt mir, Euer Majestät!«, keucht er, noch ganz außer Atem vom scharfen Ritt. Den Blick hält er gesenkt, um dem Gesalbten des Herrn nicht ins unverschleierte Antlitz zu sehen. »Die Ungläubigen greifen an! Das auserwählte Volk ist in Gefahr! Und …«, mit zitternden Fingern deutet er ins Allerheiligste, »… und die heilige Lade.«
Der Kaiser springt auf, drängt sich an Abuna Mikael und Abuna Gabriel vorbei, die bestürzt vor ihm zurückweichen, und stürmt mit wehendem Ornat nach draußen.
Zornig verlangt er nach seinem Schwert.
Alessandra
Kapitel 1
Auf dem Tempelberg in Jerusalem
16. Dhu’l Hijja 848, 19. Nisan 5205
Karfreitag, 26. März 1445
Mitternacht
Außer Atem husche ich die Stufen hinauf zum Tempelberg. Mit der Hand am Griff meines Dolchs durchquere ich lautlos das Tor des Propheten, tauche in die Schatten und blinzele in die Finsternis.
Wenige Schritte entfernt, am südlichen Ende des Haram ash-Sharif, schimmert die silberne Haube der Al-Aqsa wie die aufgehende Mondsichel. Im Norden ragt zwischen hohen Zypressen die goldene Kuppel des Felsendoms in den Sternenhimmel – der Halbmond an ihrer Spitze weist nach Mekka. Außer dem Zittern der Blätter im kalten Sturmwind und dem aufgeregten Zirpen der Zikaden ist nichts zu hören. Still und verlassen liegt der Tempelberg – so scheint es. Ich spähe hinüber zur weißen Marmorfassade des Felsendoms, kann den Assassino aber nirgendwo entdecken.
Ist uns jener geheimnisvolle Mönch vom Funduk an der Via Dolorosa bis zum Tempelberg gefolgt? In der Nähe der Grabeskirche hatte mich ein Geräusch erschreckt – Metall auf Stein. Als ich mit dem Dolch in der Hand herumwirbelte, sah ich einen Mönchsritter in weißem Habit in einen finsteren Durchgang huschen. Als Tayeb und ich die Gasse erreichten, war er verschwunden.
Auf dem Berg Zion schlägt verhalten, fast scheu, die Glocke des Franziskanerklosters und ruft die Fratres zum Gebet.
Es ist Mitternacht.
Fröstelnd zerre ich mein Gewand um mich, verharre reglos im Schatten und beobachte den Tempelberg.
Die Nacht ist kühl. Und windig. Der Horizont hinter dem Schattenriss der Al-Aqsa scheint in Flammen zu stehen. Jenseits des Ölbergs zuckt ein Feuerwerk von Blitzen durch den sturmdurchtosten Himmel und erleuchtet die Wolken von innen mit infernalischem Lodern.
»Alessandra?«, wispert Tayeb.
Während ich zu ihm zurückkehre, streiche ich mir die langen Haare aus der Stirn. Nach dem Willen des Kalifen müsste ich blaue Kleider tragen und ein fünf Pfund schweres Holzkreuz um den Hals. Doch um kein Aufsehen zu erregen, bin ich wie eine Muslima gekleidet.
Mein Freund ist in ein weites Gewand von leuchtendem Indigo gehüllt. Die Falten seines schwarzen Turbans, den er nach der Art der Tuareg gebunden hat, verschleiern sein Gesicht und lassen nur die dunklen Augen frei. Auf seiner Brust schimmert das silberne Tenerelt-Kreuz aus Agadez, das in Rom für ein christliches Symbol gehalten wird. Mit zusammengekniffenen Augen späht er die Treppe auf der Schuttrampe aus antiken Ruinen hinab zum Platz vor der Klagemauer. Seine Hand liegt auf dem Griff seines Schwertes.
»Siehst du ihn?«, flüstere ich.
Tayeb schüttelt den Kopf, ohne die Stufen, die auf den Tempelberg führen, aus den Augen zu lassen.
Mein Blick schweift über Jerusalem, die ›Stadt des Friedens‹, um die so viele ›heilige‹ Kriege geführt worden sind. Jeruschalajim, die Schöne. Al-Quds, die Heilige. Die Stadt Davids und Salomos, in der Jesus gekreuzigt wurde und Mohammed in den Himmel ritt. Steingewordenes Symbol des Glaubens – und des religiösen Fanatismus. Kein Fußbreit dieser Stadt, der nicht im Namen Gottes, Jahwes oder Allahs mit Blut bespritzt ist, keine Handbreit, die nicht auf eine Prophezeiung oder eine Szene aus der hebräischen Bibel, dem Koran oder den Evangelien verweist. Kein Atemzug, der nicht von einem Gebet oder einer Lobpreisung begleitet wird.
Jenseits der südlichen Stadtmauer erkenne ich den Schatten des Berges Zion mit dem Grab König Davids. Im Christenviertel schimmert matt die Kuppel der Grabeskirche. Und auf der Höhe jenseits des engen Gassenlabyrinths des jüdischen Viertels ragt trutzig die Zitadelle in den Sternenhimmel, einst prunkvoller Palast von König Herodes, dann römische Garnison, byzantinisches Kloster und Kreuzfahrerburg, nun Sitz des Vizekönigs von Damaskus, während er in Jerusalem ist – Al-Quds gehört zum Herrschaftsgebiet des mächtigen Emirs von Dimashq.
Die Zitadelle ist von Fackeln erleuchtet. Die feurige Musik und das trunkene Gelächter eines Gelages wehen zu mir herüber – der Wein scheint in Strömen zu fließen. Gibt der Vizekönig, der sich auf Pilgerfahrt in Jerusalem befindet, einen Empfang für Prinz Uthman, den Sohn des Mameluckensultans, der vor wenigen Tagen von seiner Hadj nach Mekka eingetroffen ist? Yared al-Gharnati, als Vertrauter des Sultans die schattenhafte Eminenz des Reiches, soll dem hoffnungsvollen Getuschel im jüdischen Viertel zufolge den Prinzen nach Jerusalem begleitet haben.
Trotz meiner Anspannung genieße ich das erregende Gefühl, in Jerusalem zu sein. ›Ein unheilbares Leiden‹, so hatte Papst Eugenius mit einem nachsichtigen Lächeln das aufgeregte Herzklopfen, die zitternden Finger und die Euphorie genannt, die mich jedes Mal packen, wenn ich mich durch den Staub ehrwürdiger Bibliotheken wühle, um jahrhundertealte Pergamentcodices und antike Papyrusrollen zu entdecken.
Je mehr Staub ich aufwirbeln muss, um ein Geheimnis zu erforschen oder um eine spektakuläre Entdeckung zu machen, desto größer der Nervenkitzel. Und der Spaß! Rätselhafte Schriftrollen wie jener Papyrus, den der Erbe der Tempelritter aus der Lade genommen hat, vergessene Dachkammern und zugemauerte Kellergewölbe voller Spinnweben und Staub, verschlossene Türen in Klosterbibliotheken, geheime Gänge und verborgene Treppen in den Gewölben des Vatikans – jedes Mysterium zieht mich magisch an!
Ein Kreuz, mit Blut gemalt …
Als ich seufze, wendet Tayeb sich zu mir um. »Was ist?«
»Ich musste an Leonardo denken. Wie gern hätte er uns begleitet, um die verschollene Tempelbibliothek zu suchen.«
In der Finsternis tastet Tayeb nach meiner Hand. Er sagt nichts, aber ich weiß auch so, dass er wie ich Trauer und Zorn empfindet. Bevor Seine Heiligkeit vor seiner Rückkehr aus dem florentinischen Exil Leonardo als Leiter des Geheimarchivs nach Rom berief, ist er mein Sekretär gewesen.
Ich habe ihn an jenem Morgen gefunden und voller Entsetzen das Symbol erkannt, das er mit seinem Blut auf den Boden gemalt hatte. Papst Eugenius, der sofort zu mir in die Gewölbe des Vatikans eilte, als er von der Bluttat erfuhr, hielt das Zeichen zuerst für ein Tau, das Kreuz der Franziskaner, ein Symbol der Erlösung. Leonardo hat dem Orden des heiligen Francesco von Assisi angehört.
Doch das blutige Symbol war kein Tau.
Es war ein Templerkreuz.
»Leonardo wollte mich warnen. Der Assassino ist noch in Rom. Er beobachtet mich, um herauszufinden, was ich über ihn weiß. Und über den aramäischen Papyrus.«
»Habt Ihr ihn gelesen?«, fragte der Papst, der trotz seiner zweiundsechzig Lebensjahre und seiner schweren Krankheit noch immer eine Ehrfurcht gebietende Gestalt war. Das Zittern seiner Hände verbarg er geschickt, indem er sie fest um sein Brustkreuz faltete und nur noch wenigen Auserwählten die Hand mit dem Fischerring zum Kuss darbot. Eine Schreibfeder konnte er schon nicht mehr halten.
Der jahrelange Streit mit dem häretischen Konzil von Basel hatte tiefe Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Wegen der Unterzeichnung des Unionsdekrets von Florenz, das 1439 das jahrhundertealte Schisma beendete und die katholische und die orthodoxe Kirche vereinigte, war er vor sechs Jahren vom Konzil von Basel abgesetzt, exkommuniziert und durch einen Gegenpapst ersetzt worden. Gegen den erbitterten Widerstand der orthodoxen Patriarchen, die die Kirchenunion verdammten, herrschte er jedoch unbeirrt weiter als erster Pontifex einer vereinigten griechisch-römischen Kirche.
»Nein, Heiliger Vater, ich habe die Schriftrolle nicht gelesen. Bei meinen Nachforschungen nach der verschollenen Tempelbibliothek habe ich mich mit den Werken von Flavius Josephus beschäftigt, um den Tempel zu rekonstruieren.«
Ich zeigte ihm eine der Skizzen mit dem Grundriss des herodianischen Tempels in meinem Notizbuch, das der Assassino übersehen hat, weil es unter dem Tisch lag. Er hielt das Büchlein in das Licht der Kerzen und betrachtete mit einem kurzsichtigen Blinzeln meine Zeichnung.
Acht große Tore öffneten sich zum Tempelbezirk, dessen Boden mit einem Mosaikpflaster verziert und der von zweischiffigen Säulenhallen umgeben war. Mit dem Finger auf der Skizze spazierte er in seiner Fantasie durch den vor mehr als einem Jahrtausend zerstörten ersten Vorhof, erklomm die fünfzehn Stufen zum Nikanor-Tor, dessen gewaltige Torflügel mit Gold und Silber verziert waren, und betrat den zweiten Vorhof mit dem Brandopferaltar. Zwölf Stufen führten hinauf zum goldglänzenden Tempel mit dem Allerheiligsten, das völlig leer war. Nur ein Stein lag an der Stelle, wo in Salomos Tempel die Bundeslade verehrt worden war.
Schließlich gab er mir das Notizbuch zurück. »Aber Ihr wisst, was in dieser mysteriösen Schriftrolle steht?«
Ich bekannte, dass mir mein Vater in ebendiesen Gewölben des Vatikans aus dem aramäischen Papyrus vorgelesen hatte, als ich sieben oder acht Jahre alt war. Und dass ich mich trotz der Länge des Papyrus von fast zwanzig Ellen nur an einen einzigen Vers erinnern könne, der mich damals fasziniert und zugleich erschreckt hatte. Wie gern wollte ich die Schriftrolle lesen! Denn ich glaube, dass mich jener Furcht erregende Engel, von dem ich als Kind so gebannt war, zum verschollenen Tempelschatz führen kann …
Papst Eugenius faltete die zitternden Hände um sein Brustkreuz. »Was habt Ihr denn nun herausgefunden?«
Monsignor Fantìn, der Kater Seiner Heiligkeit, strich mit erhobenem Schwanz um meine Beine. Die Dominikaner, die dem Papst aufwarteten, hatten dem kupferrot getigerten Kater aus den Gassen Venedigs im Scherz den Titel eines Monsignore verliehen. Als ich ihm über das seidige Fell streichelte, schmiegte er sich maunzend an mich. Dann sprang Seine Eminenz der Kater auf meinen Schoß, drehte sich zweimal um sich selbst, um die gemütlichste Position zu finden, und rollte sich zusammen.
»In den letzten fünf Tagen habe ich den Tatort untersucht. Mit Unterstützung der Inquisitoren habe ich, soweit möglich, den Raub und den Mord rekonstruiert. Und ich habe die Dokumente gelesen, die der Assassino durchwühlt hat, um herauszufinden, wonach er gesucht hat.«
»Haben Euch meine Inquisitoren Schwierigkeiten bereitet?«
»Das war doch zu erwarten.«
»Und weiter?«
»Einer der Dominikaner wollte sich nicht damit abfinden, dass ich, nicht er, die Morduntersuchung leite. Er hielt mir eine Strafpredigt über Anstand und Moral.«
Der Papst schüttelte missbilligend den Kopf.
»Eine Frau, die alleinverantwortlich das Unternehmen in Florenz führt, das sie gemeinsam mit ihrem Vater aufgebaut hat, die großartige Bibliothek und das Scriptorium mit achtzig Kopisten, Kalligrafen und Buchmalern – mehr als in einem bedeutenden Kloster? Die mit ihrem muslimischen Freund Forschungsreisen in den Orient unternimmt, um seltene Handschriften zu entdecken, die sie übersetzt und an Gelehrte in aller Welt verkauft? Die einen Mönch und Priester verführt hat, seinem orthodoxen Glauben abzuschwören? Gott bewahre die Christenheit vor dieser Frau, dieser … wie nannte er mich in seinem ›heiligen Zorn‹? … dieser Priesterhure! Nach einer erbitterten Auseinandersetzung über die ihrem Herrn, dem Mann, unterworfene Frau, über Demut und Gehorsam und die Tugend des geduldigen Schweigens …«
Er schlug mit der Faust auf die Armlehne. »Ich werde dafür sorgen, dass sich der Frater bei Euch entschuldigt.«
»Warum? Er hat doch recht. Ich war die Geliebte eines Mönchs und Priesters, eines Erzbischofs und Metropoliten, eines der höchsten Würdenträger der orthodoxen Kirche. Drei Jahre lang habe ich mit Niketas zusammengelebt, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Denn weder die katholische noch die orthodoxe Kirche hätte uns ihren Segen gegeben. Niketas und ich sind doch das beste Beispiel für den sittlichen Verfall von Florenz und der gesamten Christenheit«, stieß ich hervor. »Wusstet Ihr nicht, dass die Dominikaner allmächtig, allwissend und unfehlbar sind, allen voran die Fratres der Inquisition? Ich muss es wissen, denn mein Vater war Dominikaner.«
Zugegeben, nach allem, was mir die dominikanischen Inquisitoren auf Befehl von Kardinal Giordano Orsini angetan hatten, war ich verbittert. Sie hatten mich, ein dreijähriges Kind, als ›Lucifers Tochter‹ in den Kerker von Santa Maria sopra Minerva gesperrt und meine Mutter Adriana Colonna, die ›Satanshure‹, in der Zelle neben meiner grausam gefoltert. Fra Luca d’Ascoli, der ›Richter Gottes‹, mein eigener Vater, sollte als Inquisitor von Rom über uns richten. Welch eine perfide machtpolitische Intrige von Kardinal Orsini, seinem entschlossensten Gegner in der florentinischen Kurie, der meinen Vater als engsten Vertrauten von Papst Martin und mächtigen Stellvertreter Seiner Heiligkeit stürzen wollte!
»Wo ist dieser anmaßende Frater jetzt?«
»Ich habe ihn nach Santa Maria sopra Minerva zurückgeschickt. Sein Getuschel hinter meinem Rücken über meinen Freund Tayeb und die scheinbar unabsichtlich hingeworfenen Bemerkungen über die Gelehrsamkeit als Ursache für Glaubenszweifel, Häresie und meine Vertrautheit mit einem ›Ungläubigen‹ empfand ich als äußerst hinderlich für die Aufklärung des Mordes.«
»Das kann ich mir vorstellen. Ich werde den Dominikaner für sein Verhalten zur Rechenschaft ziehen. Und der andere?«
»Er besann sich rechtzeitig, wer ich bin.«
»Die Tochter des Inquisitors von Rom. Die Vertraute des Papstes. Und – ein noch höherer Rang! – die beste Freundin des päpstlichen Katers.« Der Papst blickte versonnen lächelnd auf Monsignor Fantìn. »Mia cara, wisst Ihr, dass Ihr um diesen alles überragenden Status beneidet werdet? Erst vorgestern zerfetzte Monsignor Fantìn während einer Audienz die Purpursoutane von Kardinal Borgia …«
Beim wohligen Räkeln auf meinem Schoß hatte der kapriziöse Kater die raschelnde Papiertüte in der Tasche meines Kleides entdeckt. Ich trug immer etwas Florentiner Marzipankonfekt bei mir, die Sorte mit den gezuckerten Mandeln, die nach Orangenlikör duftete und die Niketas so geliebt hatte. Ich bot die zerknitterte Tüte dem Papst dar, der jedoch lächelnd abwinkte, weil er das österliche Fasten hielt. Dann stibitzte ich ein Stück Konfekt und gab es dem auf meinem Schoß umhertapsenden und ungeduldig nach der Papiertüte haschenden Monsignor Fantìn, der sich zufrieden maunzend wieder zusammenrollte.
Ganz in mein schmerzliches Andenken an Niketas versunken, streichelte ich sein weiches Fell, bis der Kater wohlig schnurrte.
Stumm beobachtete mich Eugenius. Schließlich beugte er sich vor und legte tröstend seine Hand auf die meine. Er kannte meine Liebe zu Niketas und wusste, wie einsam ich war.
Ich entrang mir ein mattes Lächeln, ergriff seine zitternde Hand und drückte sie. »Danke.«
»Schon gut«, winkte er ab. »Was habt Ihr und Euer Freund denn nun herausgefunden?«
»Einige der Truhen, die seit Eurer Rückkehr aus dem Exil in Florenz noch nicht ausgepackt worden sind, standen in jener Nacht offen. Die Pergamente und Folianten, die Ihr auf meinem Arbeitstisch ausgebreitet seht, lagen verstreut auf dem Boden. Leonardo hat seinen Mörder überrascht, als der Lucas Anmerkungen zu den Templerprozessen las. Und sein Urteil.«
Der Papst nickte langsam.
»Heiliger Vater, was wisst Ihr über die Templer?«
Er hob beide Hände. »Abgesehen von der düsteren Legende, die sich um den Fluch des letzten Großmeisters auf dem brennenden Scheiterhaufen rankt? Nicht viel.«
»Dann werde ich Euch berichten, damit Ihr versteht, was in jener Mordnacht geschehen ist.«
»Ich bitte darum.«
»Also gut. Jerusalem wurde, wie Ihr sicherlich wisst, 1099 während des ersten Kreuzzugs erobert«, begann ich zu erzählen. »Die Al-Aqsa war damals als ›Templum Salomonis‹ bekannt – daher der Ordensname der Templer: Arme Ritterschaft Christi vom Tempel Salomos. Seit der Gründung des Ordens zwei Jahrzehnte später durch Hugues de Payns, den ersten Großmeister, wohnten die Mönchsritter im alten Königspalast neben der Al-Aqsa-Moschee, die sie als Kirche weihten. 1165 lebten schon vierhundert Ritter mit ihrem umfangreichen Gefolge in ihrem Kloster auf dem Tempelberg.
Heiliger Vater, wusstet Ihr, dass das Templerkreuz aus dem achteckigen Grundriss des Felsendoms gebildet wurde? Luca hat es mir vor Jahren gezeigt, als wir gemeinsam hier im Vatikan alte Handschriften kopierten.«
Monsignor Fantìn sprang von meinem Schoß auf den Seiner Heiligkeit, als ich mich erhob und über meinen Schreibtisch beugte. Unter einem Stapel Bücher zog ich ein unbeschriebenes Pergament hervor und skizzierte mit kratzender Feder den Grundriss. »Seht Ihr? Wenn Ihr die gegenüberliegenden Ecken des Felsendoms, der damals ›Templum Domini‹ genannt wurde, durch Linien verbindet, erhaltet Ihr das Schema eines Kreuzes mit Serifen. Eines Templerkreuzes.«
Papst Eugenius runzelte die Stirn, als ich das Pergament derart ungestüm auf den Schreibtisch warf, dass durch den Luftzug die Feder aus dem Tintenfass kippte. Ahnte er, worauf dieser Disput letztlich hinauslief? O ja! Er kannte mich, seit ich ein kleines Kind war, und wusste, dass ich erneut vor meinen Gefühlen fliehen würde. Wie vor drei Jahren, als ich nach Konstantinopolis aufbrach, um mich nach all den Jahren mit dem byzantinischen Kaiser zu versöhnen. Obwohl mir Ioannis, der mit mir um seinen Bruder trauerte, am Ende vergeben hat, dass ich ihm Niketas wegnahm, konnten seine tröstenden Worte meinen Schmerz nicht lindern und mir meine Seelenruhe nicht wiedergeben. Denn die Flucht vor den eigenen Gefühlen, vor Traurigkeit und Einsamkeit, ist, wie ich aus leidvoller Erfahrung weiß, ein sinnloses Unterfangen – in Byzanz wie in Jerusalem …
Ich besann mich.
»Die Templer waren einst die mächtigste Organisation der Welt. Der Reichtum des Ordens, der nur dem Papst Gehorsam schuldete, war legendär. Die ›armen Brüder Christi‹ waren nicht so arm, wie sie in ihren Mönchsgelübden gelobt hatten, sie besaßen riesige Ländereien in England, Schottland, Frankreich, Portugal, Kastilien, Aragón, Italien und im Deutschen Reich. Zudem Hunderte von Komtureien und Burgen in ganz Europa und im Heiligen Land. Und eine Flotte – ein Herrscher, der einen Kreuzzug ins Heilige Land plante, musste erst den Großmeister der Templer fragen, ob er ihm Schiffe zur Verfügung stellte. Die Ordensritter waren die Bankiers von Königen und Päpsten – kaum ein Herrscher, der nicht bei den Templern verschuldet war und ihnen seine Kronjuwelen verpfänden musste. Wie ein souveränes Staatsoberhaupt empfing der Großmeister, ehrsüchtig und stolz umgeben von seinem ritterlichen Gefolge, die Könige von England und Frankreich in den Tempeln in London und Paris und betrieb eine eigene Außenpolitik – nicht nur im Orient. Der Templerorden war ein Staat im Staat, der sich von Schottland bis Sizilien und von Portugal bis ins Heilige Land erstreckte – nicht mitgerechnet die Geheimagenten des Ordens in den muslimischen Ländern. Nachdem Sultan Salah ad-Din 1187 Jerusalem erobert und den Tempelberg erneut dem Islam geweiht hatte, verlegten die Templer ihr Hauptquartier nach Akko. Erst 1291 wurden sie nach Limassol auf Zypern vertrieben, als die Mamelucken, die von Kairo aus noch immer das Heilige Land beherrschen, die letzte Bastion der Kreuzfahrer stürmten.«
»Das war der Anfang vom Ende, das König Philippe von Frankreich im Jahr 1307 besiegelte, als er die Templer wegen Häresie anklagte und durch seinen Vertrauten, den Inquisitor von Frankreich, verurteilen und auf dem Scheiterhaufen hinrichten ließ«, ergänzte der Papst. »Daraufhin wurde der Templerorden entmachtet und zerschlagen.«
Monsignor Fantìn, der mit seinem goldenen, mit Rubinen besetzten Brustkreuz gespielt und dabei seine scharfen Krallen in den wollenen Habit geschlagen hatte, verbannte er ungeduldig von seinem Schoß.
»Die reichste und mächtigste Organisation der Welt, die außer dem Großmeister nur dem Papst Gehorsam schuldete, gibt es nicht mehr. Doch gingen die tapferen Gotteskrieger und mit ihnen der Mythos der vollkommenen Ritter Christi auf lebenslangem Kreuzzug an jenem Freitag, dem 13. Oktober 1307, wirklich unter?«
»Ein Templerkreuz, mit Blut gemalt …«, flüsterte der Papst.
Ich nickte. »Wem also vermachten die Templer ihr geheimes Wissen, das sie bei der Inquisition in den Verdacht der Häresie gebracht hatte?«
Er starrte mich an. »Alessandra, Ihr wisst, wer …?«
Ich hob die Hand und bat ihn um Geduld. »Wie Ihr wisst, hat mein Vater als Dominikaner in Paris Kirchenrecht studiert. Er war fasziniert von den Templern, die muslimisches Wissen ins christliche Abendland brachten. Einige Großmeister leisteten sich muslimische Sekretäre und jüdische Leibärzte, korrespondierten mit den Führern islamischer Sekten wie den Assassinen und gewährten ›Ungläubigen‹ die Aufnahme in den Orden.«
»Kein Wunder, dass die ›Verteidiger des Glaubens‹ ins Kreuzfeuer der Inquisition gerieten«, brummte der Papst und schüttelte unwillig den Kopf.
»Als mein Vater nach dem Konzil von Konstanz als Inquisitor von Papst Martin nach Rom zurückkehrte, hat er begeistert die Akten der Templerprozesse im Geheimarchiv des Vatikans studiert und in einem Buch ausführlich kommentiert.«
»Ja, ich weiß. Als Kardinal habe ich seine Anmerkungen gelesen.« Eugenius nahm den in Leder gebundenen Folianten von meinem Tisch und blätterte durch die steifen Pergamentseiten, die dabei leise knackten. »Der ›Richter Gottes‹, der in Konstanz ein Schisma beendet und drei Päpste abgesetzt hatte, verdammte die französischen Inquisitoren als ›Folterknechte, die ihre Hände mit dem Blut Unschuldiger besudelt und eine nicht zu vergebende Schuld auf die Kirche geladen hätten‹.« Der Papst legte das Buch zurück auf den Tisch. »Euer Vater verurteilte das Machtstreben König Philippes, der sich des legendären Templerschatzes bemächtigen wollte, auf das Schärfste. Die Ritter Christi lobte er als aufrechte Verteidiger des Glaubens und sprach sie frei vom Verdacht der Häresie.«
»Ganz recht. In den letzten Tagen habe ich Lucas Anmerkungen erneut gelesen, um zu verstehen, warum sich der Assassino mit dem Templerkreuz auf dem Habit dafür interessierte«, erklärte ich. »Die Anschuldigungen, die gegen die Tempelritter erhoben wurden, sind wirklich erschreckend. Sie verraten mehr über die geistige Haltung der Inquisitoren als über die ihrer Opfer. Mit raffinierten Fragen haben die Inquisitoren die erwünschten Antworten erzwungen. Wer nicht gestand, wurde gefoltert. Und wer gefoltert wurde, bekannte sich in seiner Todesangst für schuldig. Schuldig, die Sakramente missachtet, das Kreuz angespuckt und Christus verleugnet zu haben. Schuldig, während der Einweihungsriten unsittliche, homosexuelle Akte vollzogen zu haben. Schuldig, ein Häretiker zu sein, der ein Götzenbild an-betet.«
»Den mysteriösen Baphomet.«
»Genau. Das Urteil über die Ritter Christi stand von Anfang an fest. Der Inquisitionsprozess und die reumütigen Geständnisse der Templer unter der Folter dienten nur der Rechtfertigung eines unrechtmäßigen Vorgehens gegen den Orden, über dessen Schicksal der französische König bereits vor der Anklage bei der Inquisition entschieden hatte. Der Prozess war eine infame politische Intrige. König Philippe hatte dem Papst gedroht, ihn als Häretiker absetzen und exkommunizieren zu lassen, falls er den Templerorden schützte.«
»Die Gotteskrieger waren also die Opfer eines erbitterten Machtkampfes zwischen dem König und dem Papst um die Vorherrschaft in der Kirche. Und um den geheimnisvollen Schatz der Templer.«
»Scheint so«, gab ich zu. »Allerdings frage ich mich, wie jener 13. Oktober 1307 angeblich so unerwartet zum Schicksalstag der Templer werden konnte. Der letzte Großmeister Jacques de Molay kannte doch die Pläne des französischen Königs, den Templerorden mit dem Johanniterorden zu vereinigen, um anschließend sich selbst zum Großmeister des schlagkräftigsten und reichsten Kreuzritterordens aller Zeiten zu machen – mit einem gewaltigen Heer, einer mächtigen Flotte und der größten Bank des Abendlandes, die seine Geldsorgen beseitigen würde. Die Geheimagenten des Großmeisters verkehrten an Philippes Hof – wie konnte ihnen eine derartig aufwendige Aktion wie die Erstürmung aller Templerkomtureien Frankreichs am 13. Oktober 1307 entgangen sein? Das ist unbegreiflich.«
»In der Tat!«
»Es gibt nur eine schlüssige Antwort: Jacques de Molay wusste von dieser Razzia. Denn im Tempel von Paris wurde – abgesehen von einem silbernen Reliquienschrein mit einem gold- und perlenverzierten Schädel, dem geheimnisumwitterten Baphomet – nur diese Lade aus Akazienholz, ein langer aramäischer Papyrus und ein Bericht über das Reich des legendären Priesterkönigs Johannes gefunden. Aber kein Templerschatz.«
Der Papst musterte mich aufmerksam. »Mia cara, Ihr habt doch nicht etwa herausgefunden, wohin der Schatz verschwunden ist?«, scherzte er, und als ich nicht antwortete, verging ihm das Schmunzeln. »Oder doch?«
Ich lächelte geheimnisvoll und schwieg.
»Alessandra!«, ermahnte er mich mit erhobenem Finger.
»Einen Augenblick Geduld, Euer Heiligkeit!«
Seufzend lehnte er sich zurück und verschränkte die Arme. »Also schön. Und weiter?«
»Der Assassino hat das Urteil meines Vaters über die Templer gelesen. Doch weder Lucas Anmerkungen noch die Inquisitionsprotokolle haben ihm die Frage beantwortet, die sein Großmeister als so wichtig für das Schicksal des Christentums erachtete, dass dieser seinen Ordensritter nicht nur, wie ich vermute, nach Valencia, Avignon und Paris entsandte …« Ich machte eine dramatische Pause, um dem Papst Gelegenheit zu geben, das ganze Ausmaß der Geschehnisse zu erfassen. »… sondern ihm schließlich sogar befahl, ins Geheimarchiv des Vatikans einzubrechen.«
»Der Großmeister?«, fragte er verwirrt. »Alessandra, Ihr wisst, wer den Assassino geschickt hat?«
»Ja, Euer Heiligkeit.«
Ausführlich berichtete ich ihm von meinen Nachforschungen über die Erben der Templer und ihre Suche nach dem mysteriösen Priesterkönig Johannes. Um 1165 hatte jener Priesterkönig eine Botschaft an den byzantinischen Kaiser und den Papst gesandt, worin er gelobte, die christlichen Stätten im Heiligen Land mit seiner Furcht erregenden Streitmacht zu schützen und die Muslime zu vernichten. Mit seinem Brief entfachte er eine Hoffnung, die die Jahrhunderte überdauert hat – obwohl der Priesterkönig seinen heiligen Schwur nie gehalten hat. Der Siegeszug der Muslime, die damals das Heilige Land eroberten, war unaufhaltsam. »Nachdem ich den Brief des Priesterkönigs gelesen habe, glaube ich, dass sein Reich nicht in Asien liegt, wo es jahrhundertelang gesucht wurde, sondern in Afrika, südlich von Ägypten.«
Der Papst zog die Landkarte auf dem Tisch zu sich heran und legte die Hand mit dem Fischerring auf Jerusalem, das nun zum Mameluckenreich gehört. Das Heilige Land war in schimmerndem Blattgold ausgeführt. Das Herrschaftsgebiet des ägyptischen Sultans, dessen Grenzen mit roter Tinte auf der Karte eingezeichnet waren, erstreckt sich vom syrischen Aleppo über Antiochia, Damaskus und Jerusalem bis in die libysche Wüste westlich von Alexandria, in die nubischen Länder südlich von Assuan und umfasst auch die tributpflichtigen Vasallenstaaten der Emire von Medina und Mekka. Ein gewaltiges Reich, größer als jeder christliche Staat in Europa, mächtig und unbesiegbar.
»Ich glaube, dass das Reich des Priesterkönigs an den Quellen des Nils liegt«, offenbarte ich. »Ist es also möglich, an der afrikanischen Westküste entlangzusegeln, die Südspitze des Kontinents zu umrunden, um im Osten, in Äthiopien, die ›Terra do Preste João‹ zu erreichen? Der Großmeister der Erben des Templerordens, der sich selbst als Kreuzritter im Kampf gegen den Islam sieht, glaubt offenbar fest daran. Jenseits der muslimischen Reiche sucht er einen starken Verbündeten in seinem Kampf gegen den Islam, in seinem Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems von der Herrschaft der Mamelucken – den Priesterkönig Johannes, den König der Könige, den mächtigsten und reichsten Herrscher der Welt. Mit seiner Streitmacht könnte dem Großmeister und seinen Mönchsrittern gelingen, woran alle Kreuzzüge bisher gescheitert sind – die völlige Vernichtung des Islam.«
Wie gebannt folgte mir der Papst durch das Gespinst aus faszinierenden Mysterien, das ich in den letzten Tagen entwirrt hatte – die Tempelritter und ihr verschollener Schatz. Die Erben der Templer. Der sagenhafte Priesterkönig Johannes. Der Santo Cáliz, der Heilige Gral in der Kathedrale von Valencia. Und der geheimnisvolle Stein ›Lapis ex coelis‹, den die Templer in Wolfram von Eschenbachs Parzival in der Gralsburg Munsalvaesche bewachen.
»Der Gralsdichter Wolfram von Eschenbach wusste meines Erachtens von einer Verbindung der Templer zum Priesterkönig und hat sie in seinem Parzival verschlüsselt niedergeschrieben«, fasste ich zusammen.
»Ein faszinierender Gedanke, in der Tat! Und Ihr glaubt nun, der Großmeister habe einen seiner Ordensritter nach Rom geschickt, um herauszufinden, ob es tatsächlich eine Verbindung zwischen den Templern und dem Priesterkönig Johannes gab?«
»Ja, davon bin ich überzeugt. Vergesst nicht: Wir reden vom Infante von Portugal. Dem größten Kreuzritter des ›Ordem de Nosso Senhor Jesu Cristo‹. Vermutlich sollte der Assassino im Geheimarchiv unter anderem geografische Berichte sammeln, die es den Kapitänen des Ordens ermöglichen würden, die ›Terra do Preste João‹ auf dem Seeweg um die Südspitze Afrikas zu erreichen.«
Der Papst seufzte erleichtert. »Ihr seid die Tochter Eures Vaters, des Inquisitors von Rom! Ich bin froh, dass ich Euch mit den Untersuchungen des Mordes betraut habe. Denn ich bezweifle, dass meine Inquisitoren einen derart komplizierten Fall hätten aufklären können.«
»Er ist noch nicht aufgeklärt«, mahnte ich ernst. »Ein Rätsel bleibt nach wie vor ungelöst: Was steht in dem aramäischen Papyrus? Die antike Schriftrolle hat in der Lade aus Akazienholz gelegen, die aus dem Pariser Tempel stammt. Der Assassino hat den Papyrus mitgenommen. Aber wieso?«
Eugenius runzelte die Stirn. »Was habt Ihr vor?«
Ich erläuterte ihm meinen Plan.
»Um Himmels willen, Alessandra, das ist viel zu …«
»Tayeb wird mich begleiten. Er freut sich darauf, an den heiligen Stätten des Islam in Jerusalem zu beten. Er wird mich beschützen, wie er es in Alexandria getan hat, als wir unseren spektakulären Fund machten.«
»Alessandra, mein Kind!«, beschwor er mich. »Ihr stürzt Euch wieder einmal in ein lebensgefährliches Abenteuer, um den Schmerz und die Trauer um Eure verlorene Liebe zu vergessen. Um Euch nach all den Monaten endlich wieder lebendig zu fühlen. Aber das ist Irrsinn! Als Euer Freund und als Euer Papst verbiete ich Euch, nach Jerusalem zu …«
»Wollt Ihr mich exkommunizieren, wenn ich Euch nicht gehorche? Soll ich Euren Sekretär rufen, damit er Euch die silberne Glocke, die Kerze und die Heilige Schrift bringt?« Ich senkte die Stimme. »Heiliger Vater, ich werde nach Jerusalem reisen! Und wenn Ihr nicht nur mein Papst, sondern auch mein Freund seid, werdet Ihr mich nicht aufhalten!«
»Erwartet Ihr allen Ernstes, dass ich Ja und Amen sage und Euch meinen Segen gebe, wenn Ihr Euch in Lebensgefahr begebt?«, erregte er sich – er hatte Angst um mich. »Alessandra, kommt zur Besinnung! Leonardo wollte Euch warnen, als er das Templerkreuz mit seinem Blut gemalt hat!«
»Leonardo war mein Freund, dessen Tod ich nicht ungesühnt lassen kann. Ich werde seinen Mörder finden.« Und mit einem satanischen Lächeln fügte ich hinzu: »Oder er mich. Und dann gnade ihm Gott!«
»In den letzten beiden Nächten ist uns der Assassino zum Tempelberg gefolgt«, reißt Tayeb mich aus meinen Erinnerungen. »In der Nacht davor hat er im Funduk unser Gepäck durchwühlt. Glaubst du, er hat den Brief des Papstes an den Patriarchen von Jerusalem gefunden? Oder das päpstliche Breve?«
Ist er hier?, frage ich mich beunruhigt und beobachte die von den Sturmböen bewegten Schatten des Haram ash-Sharif. Der weiße Schimmer dort drüben zwischen den Eukalyptusbäumen – ist das die von den unablässigen Blitzen erleuchtete Fassade des alten Königspalastes neben der Al-Aqsa, des Hauptquartiers der Tempelritter? Oder ein im Wind flatternder weißer Habit mit rotem Templerkreuz?
»Du solltest morgen um eine Audienz beim Patriarchen nachsuchen und ihm den Brief des Papstes geben«, rät Tayeb ernst. Ich spüre seine Anspannung. »Eugenius bittet ihn, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um dein Leben zu schützen. Joachim ist ein entschiedener Gegner der Kirchenunion von Florenz. Er hat Niketas exkommuniziert und verdammt, weil er als Metropolit von Athen das Unionsdekret unterzeichnet und damit seinen orthodoxen Glauben verraten hat. Ich habe den Brief gelesen, in dem der Patriarch Niketas’ Tod als gerechte Strafe Gottes bezeichnet, und ich weiß, wie verletzt du warst. Der Kaiser von Byzanz hat ihn zur Mäßigung ermahnt – und das trotz eures erbitterten Wortgefechts in Florenz, als Ioannis dich aufforderte, Niketas der Kirche zurückzugeben. Und doch: Wenn Papst Eugenius es wünscht, wird er dir ein paar Bewaffnete zur Verfügung stellen.«
Ich weise auf die hell erleuchtete Zitadelle auf der anderen Seite der Stadt. »Wie, glaubst du, wird der Vizekönig von Damaskus reagieren, wenn er erfährt, dass ich während der Osterfeiertage mit einer Schar christlicher Bewaffneter den Tempelberg stürme? Die Entweihung der Al-Aqsa wird er Yared al-Gharnati melden, dem Vertrauten des Sultans, der vor ein paar Tagen mit seinem Gefolge nach Jerusalem gekommen ist. Und dann sei Allah uns gnädig! Gewiss wird er sich an unsere Namen erinnern. Nachdem wir vor sechs Jahren das Evangelium fanden, wandte sich der Patriarch von Alexandria mit einem Brief des Papstes an Yared, um uns das Todesurteil zu ersparen.« Ich atme tief durch. »Nein, Tayeb, vor dem Patriarchen von Jerusalem werde ich gewiss nicht zu Kreuze kriechen!«
Tayeb seufzt. »Wie du willst.«
»Y’allah – lass uns gehen. Wir haben nicht viel Zeit.«
Im Morgengrauen wird der Muezzin der Al-Aqsa die Muslime zum Gebet rufen, während sich die Juden, die in diesen Tagen Pessach feiern, an der Klagemauer versammeln, um das Schma Israel zu beten. Die Christen werden an diesem Tag ein schweres Holzkreuz durch die Via Dolorosa tragen. Denn dieser 26. März 1445 ist ein Karfreitag.
»Bism’Allah.« Tayeb schultert die Tasche mit unserer Ausrüstung und wirft einen letzten Blick hinab zur Klagemauer.
Mit der Hand am Griff des Schwertes folgt er mir zur Al-Aqsa. Vor dem Hauptportal der Moschee führt eine schmale Treppe hinunter in die gewaltigen Gewölbe. In der letzten Nacht haben Tayeb und ich das Labyrinth unterhalb der Al-Aqsa erforscht. Einige der Gänge hatten die Tempelritter vermutlich auf der Suche nach dem Schatz Salomos gegraben.
Wenig später haben wir den Einstieg zu den Ställen Salomos an der Südostecke der Tempelplattform erreicht.
Beunruhigt beobachte ich das Gewitter, das jenseits des Ölbergs über dem Toten Meer tobt. Unablässig zucken Blitze durch den Himmel. Im Osten, wo der Himmel im Wetterleuchten silbrig schimmert, regnet es schon in Strömen. Und wenn der Sturm, der ungestüm an meinem Gewand zerrt, das Gewitter nach Jerusalem treibt? Wenn der niederprasselnde Regen den Tempelplatz überschwemmt und durch die Kanäle in die unterirdischen Zisternen rauscht, während Tayeb und ich durch das Labyrinth der Gänge kriechen?
Nach einem letzten besorgten Blick nach Osten folge ich meinem Freund über eine gewundene Treppe hinunter in die Kammer, die ›Wiege Jesu‹ genannt wird. An der Tür streife ich die Sandalen von den Füßen und trete ein.
Die kleine Moschee wird von einer Handvoll Öllampen erleuchtet. In der Mitte des Gebetsraums befindet sich die marmorne Wiege, in die der Legende zufolge Maryam den kleinen Issa legte. Issa ibn Maryam, der von Allah Geliebte, ist nach muslimischem Glauben der letzte Prophet vor Mohammed, dem ›Siegel der Propheten‹.
Tayeb kniet sich auf den Boden und holt die Pechfackeln und die Seile aus der Tasche. Wortlos reicht er mir mein Notizbuch.
Ich halte die Pergamentseiten ins Licht und blättere durch meine Anmerkungen zum Mord an Leonardo und meine Vermutungen zu jenem geheimnisvollen Assassino, die ich noch in Rom verfasst habe. Dann betrachte ich die Seiten mit den Skizzen des Labyrinths unterhalb der Al-Aqsa. »Was hältst du davon, wenn wir das Buch hierlassen?«
»Er wird es finden und mitnehmen«, gibt Tayeb zu bedenken.
»Na hoffentlich! Dann wissen wir immer, wo er ist. Drei Schritte hinter uns.« Verschmitzt lächelnd zeige ich ihm meine Notizen, die ich seit unserer Ankunft in Jerusalem in Tifinagh niedergeschrieben habe. Tifinagh ist die Schrift der Tuareg, die Tayeb mich vor einigen Jahren lehrte, als wir uns gemeinsam auf die geplante Reise nach Timbuktu vorbereiteten.
›Salz kommt aus dem Norden, Gold aus dem Süden, aber das Wort Gottes und die Schätze der Weisheit sind nur in Timbuktu zu finden‹, lautet ein Sprichwort der Tuareg.
Ich bin überzeugt, dass es einen Teil der Handschriften der Bibliothek von Alexandria noch gibt. Als Abschriften in arabischer Übersetzung. In den Bibliotheken von Timbuktu. Mein Vater hatte versucht, jenen geheimnisumwitterten Ort im Herzen der Sahara zu erreichen, um dort Bücher zu kopieren und nach Florenz zurückzubringen, und war gescheitert. Tayeb, der Gelehrte aus Agadez, der an der Universität von Timbuktu den Koran studiert hatte, hatte Luca das Leben gerettet und vor acht Jahren zurück nach Italien begleitet.
Eines Tages will ich die gefährliche Reise nach Timbuktu wagen, die Papyri und Pergamente der antiken Bibliotheca Alexandrina kopieren und die Abschriften durch mein florierendes Scriptorium in Florenz an Gelehrte in Venedig, Rom und Byzanz verkaufen. Und natürlich an Papst Eugenius für seine geplante vatikanische Bibliothek.
»Der Assassino wird die Schrift aus Punkten, Linien, Kreuzen und Kreisen für einen Geheimcode halten. Und das Templerkreuz, das ich mit roter Tinte neben die Skizze des Felsendoms gezeichnet habe, wird ihn verwirren.«
Ich werfe meine Notizen zurück in die leere Tasche. Tayeb verbirgt sie in einer Nische. Dann entzünden wir die Fackeln, legen uns die Seile um und verlassen die Moschee.
Breite Stufen, deren Ende der Schein der Fackeln nicht erreicht, führen hinunter in die Ställe Salomos. Die Tempelritter hatten dieses ausgedehnte Gewölbe unterhalb der Al-Aqsa als Pferdestall genutzt. Ich weise auf das Tempelportal in der Südwand, das Sultan Salah ad-Din zumauern ließ. »Durch dieses Tor sind in der Antike die Gläubigen in den Tempel geströmt.«
»In den Vorhof, wo Jesus die Tische der Geldwechsler und Taubenverkäufer umstieß?« Tayeb mustert die mächtigen Pfeiler der zwölfschiffigen Halle.
Ich nicke. »Herodes hat das Tempelplateau über den Felsen Morija hinaus bis zur zehn Ellen dicken Südmauer erweitert und es mit diesen gewaltigen Tonnengewölben um zwanzig Ellen angehoben. Nach der Zerstörung des Tempels durch die Römer und der Vertreibung der Juden aus Jerusalem hat Hadrian einen Jupiter-Tempel über den Ruinen errichten lassen. Ein Symbol römischer Staatsmacht. Die Al-Aqsa wurde später auf den Fundamenten des römischen Tempels errichtet. Und der Felsendom steht auf den Ruinen des jüdischen Tempels. Wenn wir die Gänge im Tempelberg erforschen, werden wir vielleicht das Allerheiligste finden.«
Tayeb lacht vergnügt, obwohl er nicht ernsthaft daran glaubt, dass wir im Labyrinth irgendetwas finden werden – weder die verschollene Tempelbibliothek mit Tonkrügen voller antiker Schriftrollen noch einen Hinweis darauf, was die Tempelritter hier unten gesucht und gefunden haben: Gold, Papyri oder die seit zwei Jahrtausenden verlorene Bundeslade? Der Heilige Gral kann es nicht gewesen sein, denn die Tempelritter bewachten ihn ja nicht nur in der dichterischen Fantasie des Wolfram von Eschenbach, sondern, wie ich in Rom herausgefunden habe, tatsächlich in der Gralsburg San Juan de la Peña in Aragón.
Hatte der aramäische Papyrus die Gotteskrieger veranlasst, in diesem Labyrinth zu graben? Ist die antike Handschrift eine Schatzkarte? Oder ist sie …
Tayeb bleibt plötzlich stehen, zieht den Schleier vom Gesicht und lauscht mit geneigtem Kopf.
»Der Assassino?«, wispere ich atemlos.
Yared
Kapitel 2
Auf dem Davidsturm der Zitadelle
16. Dhu’l Hijja 848, 19. Nisan 5205
Karfreitag, 26. März 1445
Eine halbe Stunde nach Mitternacht
»Führe uns in die Freiheit, Yared, Prinz von Ägypten«, hat Benyamin gesagt. »Und schenke uns den lang ersehnten Frieden!«
Gemächlich steige ich die Stufen zur Plattform des Davidsturms empor, wo mich der kühle Nachtwind umfängt, und lausche auf das trunkene Gelächter der Mamelucken, die ich im Empfangssaal des Emirs zurückgelassen habe.
Fröstelnd ziehe ich meine Djellabiya enger um mich, schlendere durch den kleinen Garten auf dem Festungsturm und betrachte die erleuchtete Zitadelle zu meinen Füßen – die zinnenbewehrten Wehrmauern, die mit Schwalbennestern bekränzten Türme und die kleine Moschee. Schon vor Stunden, nachdem in einem feurigen Inferno aus purpurnem und violettem Licht die Sonne untergegangen ist, hat der Muaddin die Gläubigen zum Nachtgebet gerufen.
Zwischen den duftenden Myrtenbüschen hindurch gehe ich auf die andere Seite des Davidsturms.
Ich will allein sein. Ich muss nachdenken, bevor ich diese unvermeidliche Entscheidung treffe. Erst jetzt, da ich nach all den Jahren endlich in Jeruschalajim angekommen bin, kann ich diesen Gedanken, der mich seit Monaten nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, zu Ende denken. Noch vor wenigen Wochen, in Mekka und Medina, war es mir unmöglich.
Dies ist die Nacht der Entscheidung.
In der Ferne schlägt verhalten die Glocke der Grabeskirche.
Eine halbe Stunde nach Mitternacht.
Gegen die Brüstung gelehnt, blicke ich über die Dächer des armenischen und des jüdischen Viertels hinweg zum Tempelberg.
Unablässig zucken Blitze über den Himmel und lassen die Klagemauer in gleißendem Licht erstrahlen. Darüber glänzt die goldene Kuppel des Felsendoms. Sturmzerfetzte Wolken, die von innen heraus in Purpur, Gelb und Violett aufleuchten, fegen über den schwarzkristallenen Himmel.
Der Gewittersturm, der sich jenseits des Ölbergs entlädt, tobt auch in meinem gequälten Gewissen.
»Der Trunk der Freiheit!«, murmelte Benyamin in seinen Becher, nachdem wir den Kiddusch über den Wein gesprochen hatten. Das war vor fünf Tagen. Am Sederabend.
Nach meiner Hadj nach Mekka – so nannte Uthman meine Pilgerreise, die letztlich eine aufwendig inszenierte Bekehrung zum Islam war – waren Benyamin und ich an diesem 14. Nisan in Jeruschalajim angekommen. Dem rituellen Sedermahl gaben wir den Anschein eines fröhlichen Gelages mit engen Freunden, die glücklich waren, endlich ans Ziel ihrer Träume gelangt zu sein.
Benyamin stellte seinen Becher auf das weiße Damasttuch, das zwischen uns ausgebreitet lag, und ließ sich seufzend in die Kissen seines Ruhelagers sinken. Der Empfang durch den Vizekönig am Davidsgrab und der Einzug nach Jeruschalajim hatten ihn ebenso ermüdet wie mich.
»Pessach in Jeruschalajim!«, murmelte er mit leuchtenden Augen, strich sich über den Bart und lauschte auf den Klang seiner Worte. Mein Freund sprach Arabisch mit dem kastilischen Akzent von Isbiliya, das die Christen seit der Reconquista Sevilla nennen. »Wenn du mir vor sechs Wochen in Mekka prophezeit hättest, dass wir zum Pessachfest in Jeruschalajim sein würden – ich hätte dir nicht geglaubt.« Er räkelte sich auf den seidenen Kissen. »Stell dir vor, Yared, an diesem Pessach werden wir zum ersten Mal in unserem Leben nicht sagen: ›Leschana haba be’Jeruschalajim – Nächstes Jahr in Jeruschalajim!‹ Denn wir sind endlich angekommen! Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ein Traum, den ich nicht mehr zu träumen wagte, seit wir beide aus Gharnata geflohen sind. Und deine messianische Vision wird hoffentlich ebenso Wirklichkeit werden!«