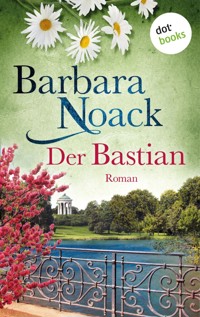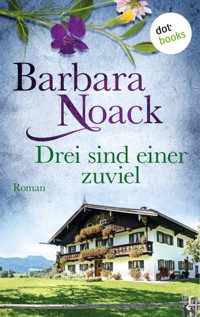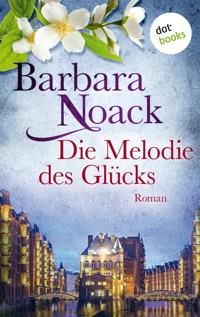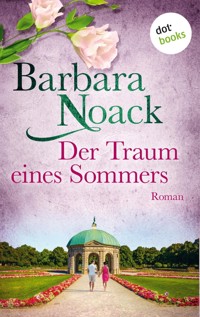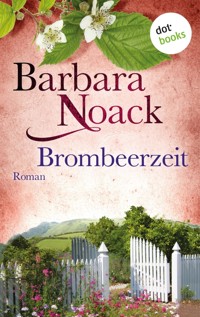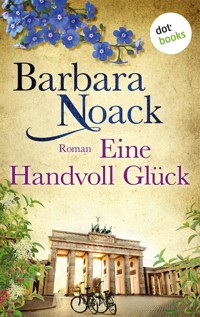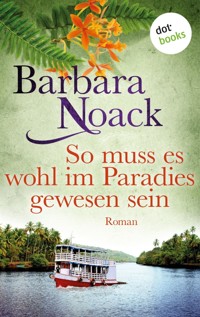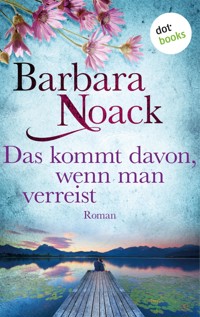Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines schönen Bedauerns: Der gefühlvolle Roman »Das Leuchten heller Sommernächte« von Bestseller-Autorin Barbara Noack jetzt als eBook bei dotbooks. Eine gemeinsam durchtanzte Nacht – und dieser gewisse Herr Ypsilon geht der Journalistin Maijie nicht mehr aus dem Kopf. Doch so schnell wie sie sich kennengelernt haben, so schnell müssen sie auch wieder Abschied voneinander nehmen. Herr Ypsilon wohnt nicht nur in einer anderen Stadt, auch alle anderen Umstände sprechen gegen ihre Liebe. Über viele Jahre hinweg kreuzen sich ihre Wege und jedes Mal flammen die Gefühle erneut auf – doch ihr Wiedersehen ist nie von langer Dauer … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Roman »Das Leuchten heller Sommernächte« – ehemals unter dem Titel »Ein gewisser Herr Ypsilon« erfolgreich – von Bestseller-Autorin Barbara Noack. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine gemeinsam durchtanzte Nacht … Maijie begegnet einem Mann, der sie auf Anhieb umhaut. Sie erfährt nicht seinen Namen, doch für sie ist er der gewisse Herr Ypsilon. So schnell wie sie sich kennengelernt haben, so schnell müssen sie auch wieder Abschied voneinander nehmen, denn Herr Ypsilon wohnt in einer anderen Stadt und die Umstände sprechen gegen ihre Liebe. Über viele Jahre hinweg kreuzen sich ihre Wege und jedes Mal flammen die Gefühle erneut auf – doch das Wiedersehen ist nie von langer Dauer …
Über die Autorin:
Barbara Noack, geboren 1924, hat mit ihren fröhlichen und humorvollen Bestsellern deutsche Unterhaltungsgeschichte geschrieben. In einer Zeit, in der die Männer meist die Alleinverdiener waren, beschritt sie bereits ihren eigenen Weg als berufstätige und alleinerziehende Mutter. Diese Erfahrungen wie auch die Erlebnisse mit ihrem Sohn und dessen Freunden inspirierten sie zu vieler ihrer Geschichten.
Ihr erster Roman Die Zürcher Verlobung wurde zweimal verfilmt und besitzt noch heute Kultstatus. Auch die TV-Serien Der Bastian und Drei sind einer zu viel, deren Drehbücher die Autorin verfasste, brachen in Deutschland alle Rekorde und verhalfen Horst Janson und Jutta Speidel zu großer Popularität.
Von Barbara Noack erschienen bei dotbooks bereits die Romane Die Zürcher Verlobung, Der Bastian, Danziger Liebesgeschichte, Drei sind einer zuviel, Brombeerzeit,Der Zwillingsbruder, Eine Handvoll Glück und Ein Stück vom Leben.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2016
Copyright © der Originalausgabe 1961 by Langen Müller
in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/kwest
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-657-7
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Ein gewisser Herr Ypsilon an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Barbara Noack
Ein gewisser Herr Ypsilon
Roman
dotbooks.
Teil 1Dein Terminkalender – und meine Phantasie
Prolog
Ich werde ihn »Herr Ypsilon« nennen.
»Ypsilon« ist ein gutes Pseudonym für jemand, der nicht beim rechten Namen genannt zu werden braucht. Zudem hat das Ypsilon seinem in ähnlichen Fällen benutzten Zwillingsbruder, dem X, gegenüber den Vorteil, daß es durch seine Dreisilbigkeit aus der wesenlosen Klasse der Buchstaben in den Stand eines Beinamens erhoben wird. Hinter »Herr X« kann sich schließlich ein jeder verstecken. »Herr Ypsilon« hingegen hat schon beinah ein Gesicht.
Das Gesicht des Herrn Ypsilon war viel zu freundlich geraten. Der arme Mensch sah immer so aus, als ob er es gut meinte. Und so etwas kann leicht zu Mißverständnissen führen.
Er mochte zudem so nüchtern gucken, wie er wollte, die tiefe Lage seiner Augen und lange Wimpern stempelten ihn auf den ersten Blick zu einem Träumer, und das ärgerte ihn ungemein. Denn er träumte wirklich gern.
Zudem gehörte der Herr Ypsilon zu jenem glücklichen Typ, der in allen Lebensaltern ab sechzehn Jahren wie ein Liebhaber ausschaut und niemals wie ein Beamter, Familienvater, Lebemann oder Großpapa. Selbst ein Zweitagebart verlieh ihm noch den rauhen Reiz eines Filmpartisanen.
Es war kein weibliches Kunststück, ihn zu lieben. Aber es fällt um so schwerer, ihn der Wahrheit entsprechend als wenig energisch, kultiviert und beinah schön zu schildern, ohne dabei wohlanständige Langeweile zu verbreiten.
Ich wünschte, ich könnte ihn mit waghalsigen Attributen ausrüsten, mit einer gern gelesenen Lasterhaftigkeit, saugrobem Benimm der Geliebten gegenüber – leidenschaftliche Hände, die Spitzenhemden zerreißen, sind in Romanen sehr beliebt (nur in Romanen). Ein draufgängerisches Biest ist überhaupt so viel dankbarer zu beschreiben als ein sympathischer, ruhiger Mann von fünfunddreißig Jahren.
So alt war Herr Ypsilon, als ich ihn kennenlernte. In den folgenden Jahren brachte er es auch ohne dichterische Zuschüsse meinerseits zu einiger Berühmtheit in seinem Beruf, so daß die Gazetten zuweilen über ihn berichteten, jedoch nie in den Klatschspalten.
Wir begegneten uns zum erstenmal vor – nun, zehn Jahre ist es bestimmt her. Ausgerechnet auf dem grell lärmenden, staubbrodelnden »Zinnober«, dem Berliner Akademiefest, fand diese Begegnung statt.
Kapitel 1
Anfangs hatte es meinen Freunden viel Spaß gemacht, den Bärenführer zu spielen. Ich war der Bär, der zum erstenmal und darum noch recht hilflos treppauf und treppab hinter ihnen her durch den hektischen Gähnkrampf der letzten Faschingsnacht tapste.
Später, so gegen Mitternacht, machte sie meine Anhänglichkeit merklich nervös. Sie stellten mir immer häufiger und immer dringlicher alleinstehende männliche Bekannte vor. Ich war jedoch nicht gewillt, mit einem dieser vom nächtelangen Feiern bis zur Hohläugigkeit strapazierten jungen Männer in verschwitzten Hemden – kariert war gerade große Mode, und der mehlige Schimmer darüber stammte von gepuderten Mädchenschultern – eine fastnächtliche Notgemeinschaft zu gründen; wozu auch. Ich war sehr gern das dritte Rad an einem Wagen, der sich verzweifelt bemühte, in die ungestörte Zweisamkeit zu rollen.
Meine Freunde Suse und Felix begannen ernsthaft und mit Recht zu fürchten, sie würden mich bis zum Morgen nicht mehr los. Darum zerschnitten sie im günstigen Moment das Band, an dem ich – arglos störend – hinter ihnen herschlenderte.
Ich war plötzlich allein und hilflos wie ein Hund, der im Gedränge seinen Herrn verloren hat. Ein bärtiger Maler nutzte meine offensichtliche Verlassenheit auf seine Weise, das heißt, er kniff mich in die Kehrseite, in der absolut irrigen Annahme, ich hätte Verständnis für solchen Spaß.
Ich rettete mich zu einem tomatenroten Wollhemd, das ich selbst gebügelt hatte: Es gehörte meinem Bruder Peter, und ich tippte erleichtert an seine leuchtende Schulter.
Peter nahm sein Gesicht nur widerwillig aus einer frisch gewaschenen, knisternden Mädchenmähne.
»Ach, Maijie…«, sagte er, »du?« Und es wurde mir kränkend klar, daß er meine Freude über unser Zusammentreffen an diesem Orte keineswegs teilte. »Was willst du, Maijie?« fragte er nicht unfreundlich, aber auch nicht sehr geduldig.
Maijie ist nicht mein Taufname, der lautet bürgerlicher. Maijie ist ein Wortgebilde, das meine ungelenke Babyzunge für mich erfand und das mir seitdem anhängt. Andere heißen ihr Leben lang Brüdi, Püppi, Pützchen, Bubi und so fort.
»Ich bin verloren worden«, sagte ich. »Von Suse und Felix…« Peters Mädchen mit den knisternden Haaren sah mich böse an.
»Na, dann such sie«, schlug er vor und drehte mir den Rücken zu.
»Es nützt mir leider nicht viel, sie wiederzufinden. Sie wollen mich nicht.«
Peter rollte sich eine Haarsträhne des Mädchens um den Zeigefinger. Für ihn war unser zufälliges Treffen auf dem Fasching erledigt.
Ich lahmte enttäuscht von dannen, ich lahmte, weil ich ein arg lädiertes Knie hatte. Aber ich war erst ein paar Schritte weit, da rief er mich zurück.
»Maijie!«
»Ja?« hoffte ich – trotz der bösen, leidenschaftlich verglasten Blicke seines Mädchens.
»Sie glaubt mir nicht, daß du meine Schwester bist. Sag ihr, daß du’s wirklich bist.«
Ich nahm das Haar zurück. »Gucken Sie meine Ohren an und seine!«
»Bist du nun beruhigt?« fragte Peter sein Mädchen. Es nickte ohne Überzeugung.
»Manchmal sehen Schwestern eben nicht wie Schwestern aus.«
Und damit war ich endgültig entlassen. Um eine Erfahrung bitterer, stieg ich die Treppe hinab: Es nutzt einem im Fasching gar nichts, auf ein noch so verwandtschaftliches Verhältnis zu pochen. Jeder muß allein sehen, wie er sich amüsiert. Und wo er bleibt.
Als mich ein ältlicher Torero mit der Bemerkung: »Was hat das Puppchen bloß für niedliche Beißerchen!« in seinen Schnapsdunst zu hüllen versuchte, wußte ich, wo ich bleiben würde: auf keinen Fall länger hier. Mir fehlte damals noch jegliche Gelassenheit im Umgang mit öffentlichen Ärgernissen.
Ich war ein totaler Mißerfolg in dieser lärmenden Fastnacht, ich wollte nach Hause und mich schämen ob meiner hochgeschlossenen Prüderie.
Die Garderobenstudentin nahm wortlos meine Marke, wühlte eine Weile im großen Massenhängen nach meinem Mantel und stellte ein paar Gummistiefel auf den langen, hölzernen Tisch, der uns voneinander trennte. Ihr lustloses Gähnen verwandelte sich dabei plötzlich und unverhofft in ein weibliches Lächeln, das kaum der Anblick meiner Galoschen ausgelöst haben konnte.
Ich blickte mich um auf der flüchtigen Suche nach einem Grund für weibliches Entzücken und entdeckte einen Mann hinter mir, der sich gerade den Schal vom Nacken zog und diesen in den Mantelärmel stopfte. Das war Herr Ypsilon.
Sein ungewöhnlich gutes Aussehen war wohl weniger entscheidend für die spontane Zuneigung des Garderobenmädchens als seine Ausstrahlung. Inmitten der Alkohol verdampfenden, heftig strapazierten Körper in schweißfeuchten Trikots wirkte er, als habe er sich gerade vom dichten, kurzen Hals bis zu den Füßen die Zähne geputzt. Mit Pfefferminzgeschmack.
Er war im Straßenanzug, und er war nicht allein hierhergekommen. Es gehörten einige Herren unterschiedlichen Alters zu ihm, die ihre Mäntel nur wenige Schritte von uns entfernt in die Garderobe reichten. Zu ihnen blickte er hilfesuchend hinüber, als er seinen Mangel an Kleingeld feststellte. »Ich habe nur fünfzig Mark.«
»Zahlen Sie, wenn Sie gehen«, sagte die Garderobiere, denn er sah nicht nur keimfrei und absolut vertrauenerweckend aus. Er war ganz einfach der Mann, bei dem eine Frau eine Ausnahme macht.
Ich weiß auch nicht, woran das lag. Nichts in seinem Auftreten verlangte danach, im Gegenteil. Hinter seinem höflichen Lächeln hockte der dringende Wunsch: »Wenn möglich, laßt mich zufrieden.« Ein Wunsch, den man auf dem Fasching an der Garderobe abgeben sollte. Ich hatte das auch versäumt.
»Warten Sie, vielleicht kann ich wechseln«, rief ich schnell und beinahe besorgt, er könne fortgehen. »Wo habe ich denn…?« Im Mantel war das Portemonnaie nicht, in meiner Rocktasche auch nicht. »Gleich habe ich’s. Moment.«
»Vielen Dank«, wehrte er meine Bemühungen ab, »aber meine Kollegen…«
»In der Galosche!« erinnerte ich mich noch rechtzeitig. In der linken Galosche steckte das Portemonnaie. Es war prallgefüllt mit Fünfzigern, Groschen, Sechsern und Pfennigen, kurz – mit allem, was ich nach ausführlichem Suchen aus Sommertaschen, Mänteln und Knopf schachteln zusammengesammelt hatte. Man will schließlich nicht unvermögend auf ein Fest gehen.
Durch die Vielzahl an Münzen nahm der Geldwechsel einige Zeit in Anspruch. Herrn Ypsilons Kollegen hatten inzwischen ihre Garderobenmarken erhalten. Einer tippte ihn kurz an die Schulter: »Wir gehen schon vor« und zwinkerte dabei anerkennend: kaum hier und schon ein Mädchen. Alle Achtung!
»So warten Sie doch!« rief er ihnen nach, aber die hörten nicht mehr. Vier seriöse Rücken schoben sich unternehmungsgeladen in die dampfende, bunte Kulisse.
»Sieben Mark fünfzig, sechzig, fünfundsechzig«, zählte ich in Herrn Ypsilons Hand, die vor Münzen beinahe überquoll.
»Jetzt sind sie glücklich fort«, ärgerte er sich.
»Sieben Mark achtzig, einundachtzig, dreiundachtzig, vierund…«
»Sagen Sie bitte, wollen Sie mir die restlichen zweiundvierzig Mark in Pfennigen auszahlen?« entsetzte er sich.
»Nein.« Ich gab ihm seinen knisternden Schein zurück und zeigte etwas kleinlaut mein Portemonnaie vor, in dem sich nur noch Schuppen vom letzten Silvesterkarpfen befanden. »Nicht einmal das kann ich mehr. Entschuldigen Sie.«
»Oh, es macht nichts.« Aber ich spürte deutlich, daß es ihm wohl etwas ausmachte. Er war ärgerlich, und er war keineswegs gewillt, unseren mißglückten Geldwechsel zum Anlaß zu nehmen, mich kennenzulernen. Schade. Da kam ein Mann daher, dessen bloßer Anblick meine hochgeschlossene Prüderie bis zum Herzen aufknöpfte, und ausgerechnet dieser Mann legte gar keinen Wert auf mein Gefühlsdekolleté.
Was für eine gelungene Nacht!
»Ich habe Ihnen ja gleich angeboten, nachher zu zahlen«, sagte das Garderobenmädchen und reichte ihm die Marke.
Herr Ypsilon nickte verabschiedend in mein bekümmertes Gesicht und ging seinen Kollegen nach. Dabei band er seinen schottischen Schlips zu einer schüchternen Schleife. Das war seine Konzession an den Fasching und lockerte etwas die zivilen Hemmungen.
Ich nahm einen Gummischuh vom Tisch und stellte ihn auf den Boden. Mein angeschlagenes Knie unter dem dicken Verband, den ich mit ein paar aufgestickten Pailletten dem närrischen Treiben weit mehr angepaßt hatte als meine Stimmung, schmerzte heftig beim Bücken. Und die Galosche erinnerte mich plötzlich an leere, frostkalte Straßen, an das Warten auf einem zugigen Bahnsteig.
Fünfzehn kostbare Mark hatte die Eintrittskarte zu diesem Vergnügen gekostet. Davon hatte ich höchstens sieben Mark fünfzig abgeärgert. Warum sollte ich der Festleitung einen halben Eintrittspreis schenken? Zudem ist es feige, vor Unannehmlichkeiten zu kneifen. Wenn ich jetzt nach Hause ginge, würde niemals ein ordentlicher Massenmensch aus mir werden.
Ich zog die Galosche wieder aus und stellte sie auf den Tisch zu ihrem linken Pendant mit dem kraftlosen umgekippten Gummischaft.
»Vielleicht bleibe ich doch noch ein bißchen hier«, sagte ich zu dem Garderobenmädchen.
Nach zehn Minuten angestrengten, vergeblichen Suchens in Sälen, Nischen und dämmrigen Bars wandte sich Herr Ypsilon einmal um – und sah mich.
Er lächelte verwundert. »Sie?«
»Es ist purer Zufall«, sagte ich errötend.
Herr Ypsilon hatte wohl schon die trostlose Einsamkeit eines Alleinstehenden auf einem Faschingsfest zu spüren bekommen, denn er wandte sich nicht sofort ab, sondern sah mich unschlüssig an.
Was er vor sich sah, war zwar nicht überwältigend, aber immerhin schön bunt. Ein rotgepunktetes Kopftuch, leicht verrutscht. Eine hemdartige Bluse ohne Ärmel. Ein türkisfarbener Fransenrock. Ein glitzernd bestickter Knieverband. Verlegene Finger um ein nicht mehr ganz sauberes Taschentuch, in das der Lippenstift und zwanzig Pfennig für alle Fälle eingeknotet waren. Aus der blütenförmigen Halskette tropften Glasblätter und Knospen von gerissenen Fädchen.
Eine ein bißchen verhuschte, leicht erhitzte, ungemein verlegene Dreiundzwanzigjährige stand vor ihm und wäre in diesem Augenblick so gerne eine aufregende, faszinierende Person gewesen, eins von diesen schrägäugigen, gazellenhaften Tierchen mit knisternder Mähne…
»Gute Nacht«, sagte ich und wandte mich zum Gehen, um meiner Beteuerung, ihn nur durch Zufall verfolgt zu haben, glaubwürdigen Nachdruck zu verleihen.
»Hören Sie –«, hielt mich seine unschlüssige Stimme auf.
»Ja?«
»Was haben Sie mit Ihrem Knie gemacht?«
»Ich bin vom Rad gestürzt. Aber es ist schon über eine Woche her, und – es stört überhaupt nicht beim Tanzen.«
»Na, wenn es nicht stört –«, er lachte plötzlich amüsiert, »– dann kommen Sie.«
Man stieß uns ins Kreuz und trat gegen unsere Schienbeine auf dem Schlachtfeld vor der lautstarken Dixielandband. Wir rangen stolpernd und lachend nach Atem. Und ich war glücklich in seinen unbeteiligten Armen.
Einmal schrie er mir etwas zu. Ich verstand »Tagung in Berlin… Abendessen… eingeladen, Berliner Fasching kennenzulernen…«
»Ich mache das hier auch zum erstenmal mit!« schrie ich zurück.
»Wie?«
»Ich auch – zum erstenmal – hier!«
»In Berlin?«
»Nein – hier. Zinnober!«
»Ah ja.« Danach verzichteten wir auf gebrüllte Konversation.
Beim nachfolgenden Septembersong ging es etwas friedlicher zu. Die Pärchen schleuderten sich nicht länger um die eigene Achse, sondern preßten die verschwitzten Gesichter glitschfest aneinander und guckten tiefsinnig in eine nicht vorhandene Ferne, denn der Septembersong ist ein melancholisches Lied.
Herr Ypsilon, mit dem ich mich im dampfenden Gewühl langsam drehte, suchte über meine Schulter hinweg zwischen Bürstenhaarschnitten, Pferdeschwänzen, verwegenen Ponies und ölblanken Mähnen nach den Häuptern seiner Kollegen, jedoch vergebens. »Sie sind leider nicht hier. Ich verstehe nicht, wie sie so plötzlich vom Erdboden verschwinden konnten!«
»Hier trifft man nur immer diejenigen Leute wieder, die man nicht sehen will.«
»Ja, ich glaube auch –«, und dann wurde ihm klar, was er da gedankenlos bestätigt hatte, und ereiferte sich beinahe, als er beteuerte: »Bitte, ich habe Sie bestimmt nicht damit gemeint.«
Dem Septembersong folgte ein rascher Oldtimer, bei dem einem des öfteren anderer Leute Füße unterliefen. Und als auch dieser Nahkampf vorüber war, hinkten wir – leicht gerupft – aus der Arena.
Herrn Ypsilons Hosenbeine waren bis zu den Knien unter einer mehlartigen Staubschicht ergraut, an seinem Jackett fehlte ein Knopf. »Wahrlich, ein heftiges Fest«, sagte er, das vereinsamte Knopffädchen zwirbelnd, während seine Blicke über die von der Kampfstätte trödelnden Tänzer hinweg noch immer nach den verlorenen Kollegen ausschweiften.
»Also dann – vielen Dank.« Er gab mir die Hand. »Ihrem Knie hat es nicht geschadet? Nein?«
»Also dann –«, sagte auch ich. »Hoffentlich finden Sie Ihre Leute bald.«
»Ja, hoffentlich. – Gute Nacht.«
»Gute Nacht. Und viel Spaß noch.«
»Danke, gleichfalls.«
Wir zerschnitten voll nüchterner Geschäftigkeit die allgemeine Schlenderei, Herr Ypsilon nach rechts und ich nach links, ohne uns noch einmal nacheinander umzusehen.
Und die Enttäuschung drückte schmerzhaft auf das wunde Knie!
Ich lahmte aus den lärmbrodelnden Regionen des Faschings zu den kühleren Garderobenräumen hinab, auf denen spürbare Müdigkeit lastete, und ließ mir zum zweitenmal in dieser Nacht Mantel und Galoschen herausgeben.
Wenn ich mich beeilte, würde ich noch die letzte U-Bahn am Bahnhof Zoo erreichen. In dem ausgekühlten Abteil saß gewiß ein Betrunkener auf der Bank schräg gegenüber, das kannte ich schon. Dann war noch ein Pärchen da, eine eingedöste, auf ihrem ratternden Sitz kraftlos hin und her schwankende Toilettenfrau, die Feierabend hatte, und jener undefinierbare Mann, dem man alles Zutrauen konnte.
Zuerst stiegen die ungefährlichen Personen aus. Das war immer so. Übrig blieben der undefinierbare Mann und ich – zwei bange, endlose Stationen lang. Meistens war er harmlos, aber einmal war er’s vielleicht nicht…
Und zu allem war strenger Februar.
Mein Leben gefiel mir zur Zeit nicht besonders gut. Dafür konnte ich leider nur mich selbst verantwortlich machen, denn zumindest sprichwörtlich ist jeder seines Glückes Schmied. Ich schmiedete sehr unvollkommen, ich war überhaupt nicht sehr talentiert und aus diesem Grunde wohl zur Zeitung gegangen, womit ich keineswegs behaupten will, daß die Gazetten der Sammelplatz für Existenzen sind, die zu einem anderen Beruf nicht taugen. Es gab sehr clevere, wendige, begabte Leute unter meinen Kollegen, die es zu etwas brachten. Ich hingegen würde immer zweite Garnitur bleiben, und diese Erkenntnis nagte tiefe Löcher in mein Selbstbewußtsein.
Das Blatt, dessen Feuilletonredaktion mich beschäftigte, erfreute sich keines feinen Rufes, dafür aber einer um so höheren Auflage. Es war über die Boudoirgespräche eines Prinzenliebchens ebensogut orientiert wie über die letzten Gedanken der Flugpassagiere kurz vor dem Absturz, bei dem es keine Überlebenden gab. Wir wußten und schrieben einfach alles für den unausgeschlafenen Leser auf seinem morgendlichen Weg zum Büro.
Was mein Privatleben anbelangt: ein Bruder und ein Hund, die bekocht werden mußten. Ein paar Freunde. Aber eine Liebe, die den Alltag auf eine reizende Lämmerwolke gehoben hätte, besaß ich leider nicht. Zuweilen kam es zu einem Flirt, bei dem mich meine Phantasie anregend unterstützte. Eben – meine Phantasie. Davon besaß ich viel zuviel. Ein Mann, der mich einmal sehr gern mochte, bezeichnete sie als seinen ärgsten Rivalen, gegen den er in seiner irdischen Begrenzung nicht anglänzen konnte – und resignierte. Meine Phantasie hatte sich nicht etwa an den wundervollen Aschenbrödel-Einzelschicksalen und Starkarrieren infiziert, die in unserem vielgelesenen Kulturerzeugnis breitgewalzt wurden; sie trug ein Empirekleid, entzückte sich an verschnörkelten Geistigkeiten und galoppierte im Damensitz über weiche, sonnige Herbstwiesen, ohne jemals vom Pferd zu plumpsen. Und der Mann, der dazugehörte, ja, der sah eigentlich genauso aus wie der Herr Ypsilon. Wir hatten hoffnungsvolle, leicht erziehbare Kinder und litten keine Not… in meiner Phantasie.
Sie hatte sich diese sanfte Traumwelt im Kriege zum Schutz gegen die furchtbare Wirklichkeit aufgebaut und konnte auch später nicht mehr von ihr lassen.
Wenn ich ohne anzuhalten bis zum Bahnhof Zoo rannte, würde ich den letzten Zug bestimmt noch erreichen.
An der Ausgangstür sah ich mich noch einmal um. Hinter mir stand Herr Ypsilon.
»Es ist purer Zufall«, lächelte er.
Er schaute wirklich aus wie Orpheus ohne trauriges Schicksal, groß, hell und beinah schön – trotz seiner fürwitzigen Jungennase. Aber meine paßt auch nicht zu meinem Charakter.
»Ich wollte gerade gehen.«
»Und Ihre Kollegen?«
»Eben deshalb«, sagte er. »Ich habe sie gefunden. Als ich sie sah, wurde mir plötzlich klar, wie wenig ich sie vermißt habe. Sie lärmten in einer Bar und benahmen sich genauso, wie sich Männer benehmen, wenn sie unbeobachtet auf Geschäftsreise sind.«
Wir sahen uns an und lächelten und wußten nicht recht. Und dann sagte ich: »Jetzt ist er weg.«
»Wer?«
»Mein letzter Zug.«
Herr Ypsilon überlegte einen Augenblick. »Dann bleibe ich auch. Schließlich ist es meine Schuld, daß Sie ihn verpaßt haben« – und stützte mich, als ich die Galoschen abschüttelte und zum drittenmal in dieser Nacht zur Aufbewahrung gab.
Jetzt lächelte das Garderobenmädchen nicht mehr. »Sagen Sie mal, wollen Sie mich eigentlich…?«
»O nein«, beteuerte Herr Ypsilon. »Wir sind nur ein wenig unentschlossen heute nacht.«
Er legte eine Hand auf meinen Ellbogen und schob mich in den Trubel zurück, der sich von Saal zu Saal steigerte.
Auf einem Barhocker entdeckte ich Suse und Felix, einen über dem anderen. Auch an meinem heftig beschäftigten Bruder stiegen wir auf einer rechts und links mit Liebespärchen gespickten Treppe vorbei. Ich trat versehentlich einem Romeo auf die Hand. Er schimpfte noch, als wir einen neuen Saal erreicht hatten und rauh in eine volkstümlich schunkelnde Kette eingehenkelt wurden. Herrn Ypsilons amüsiert-hilfloser Miene merkte ich an, daß er des Schunkelns unkundig war.
Man sang vom Kaiser Wilhelm, den wir wiederhaben wollen, aber den mit Bart, aber den mit Bart.
Dem monarchistischen Gebrüll folgte ein Berliner Gassenhauer.
»Wir versaufen unser’ Oma ihr klein Häuschen und die erste und die zweite Hypothek.«
Ypsilon guckte fasziniert auf meinen mitgrölenden Mund. »Daß Sie so schöne Stücke auswendig können!«
»Ich kann alles, was nicht unbedingt zur feineren Bildung gehört. Das Unnütze lernt sich soviel leichter, finden Sie nicht?« Darin gab er mir recht.
Wir lösten uns aus der Schunkelkette und schlenderten weiter, an zärtlich verhäkelten Pärchen vorbei.
»Es findet hier erstaunlich viel Liebe statt«, stellte Herr Ypsilon fest.
»Schließlich ist der Fasching die beste Gelegenheit, schnell und gründlich Bekanntschaften zu schließen. – Oh, danke.« Ich war über ein paar ins Halbdunkel gestreckte Beine gestolpert, aber er fing meinen Fall noch rechtzeitig ab.
»Man sammelt hier Adressen und Telefonnummern, damit man nicht plötzlich allein dasteht, wenn der Frühling ausbricht, verstehen Sie?«
»Ah, ja, das leuchtet mir ein«, sagte er amüsiert und stellte gleich darauf eine sehr berechtigte Frage: »Haben Sie Durst?«
»Gern«, sagte ich, »aber wenn Sie glauben, daß ich auch hierhergekommen bin, um jemanden kennenzulernen …«
»Ein absurder Gedanke!« widersprach er glatt.
»Ich bin nur hier, um endlich einmal mitreden zu können, wenn vom berühmten »Zinnober« gesprochen wird.« Und erst nach dieser Erklärung, zu der ich mich moralisch verpflichtet fühlte, durfte er mir auf den Barhocker helfen.
Über uns zitterten stanniolblanke Ungeheuer an langen Drähten, die an die Prähistorie und den Surrealismus gleichermaßen erinnerten. Die Wände waren schwarz, mit tanzenden Skeletten bemalt. Auch unsere zartesten Gefühle sind heute abgebrüht genug, um sich von derart anheimelnden Kulissen nicht verschüchtern zu lassen.
Herr Ypsilon trank mir zu. »Probieren Sie. So einen schönen, warmen Sekt bekommt man nicht alle Tage«, lobte er, den hellen Kopf in den rechten Winkel seines Armes gestützt. Ich sah ihn an – und meine Phantasie zwängte sich verstohlen in ihr Empirekleid aus weißem Musselin, das so gar nicht zu dem burschikosen Kordhosenton paßte, den ich mir bei der Zeitung angewöhnt hatte.
»Sie – Sie sind nur vorübergehend in Berlin?«
»Ja«, sagte er kurz.
Ich schüttete warmen Sekt in mich hinein und wagte mich noch einmal vor.
»Beruflich?« fragte ich.
»Ja.« Genauso freundlich-abweisend, während er die makabren Kulissen betrachtete.
Da gab ich es auf.
Der Student hinter der Bar schenkte Sekt nach und winkte einer Litfaßsäule zu, einer mit unendlich viel Mühe beklebten Säule, aus der oben ein schwitzender, trauriger Jungenkopf und unten seine großen Füße in Turnschuhen hervorguckten. Wir drehten sie im Kreise und lasen ihre Plakate. »Raubmord! Fünftausend Mark Belohnung. Der Täter ist einsfünfundsiebzig groß, rothaarig. Besondere Kennzeichen: abstehende Ohren, Alter neunzehn Jahre.«
»Der Steckbrief paßt genau auf mich«, erklärte uns die Säule. »Das war Absicht.«
»Sehr ulkig.«
»Aber im nächsten Jahr denke ich mir was anderes aus. Das hier ist zu unpraktisch. Die Mädchen wollen mich bloß lesen, sonst nichts. – Oh, danke.« Die Säule nahm das Glas Sekt, das Herr Ypsilon ihr zuschob, und schüttete es in ihren mageren Hals, wobei der Adamsapfel auf und nieder tanzte. Dann wandte sie sich an den Barmixer. »Hast du Reni gesehen? Ich habe sie überall gesucht.«
Herr Ypsilon machte plötzlich so ein wehmütig-vergnügtes Erinnerungsgesicht. »1938 war ich zum letztenmal auf einem Fasching. In München.«
»Sie sind Münchner?« hakte ich ein und erkannte sofort meinen Fehler, denn er kehrte zu seiner abweisend-freundlichen Haltung zurück: »Nein.«
Der Mann hatte das Ausfragen zweifellos nicht gern. »Was macht Ihr Knie?« lenkte er ab. »Sein Verband mit all den Pailletten und Herzchen ist zweifelsohne sehr lieb. – Wie ist das überhaupt passiert?«
»Ich bin in eine alte Dame hineingeradelt, aber sie hatte schuld. – Gucken Sie mal!«
Ein ganzes Rudel Frohsinn wälzte sich lärmend in die düstere Bar. Es handelte sich dabei um Herrn Ypsilons Kollegen, ihre zufälligen Faschingsbräute und deren Anhang, der sich von den zugereisten Herren kostenloses Durstlöschen versprach.
Herr Ypsilon starrte sekundenlang zu ihnen hinüber. Dann riß er mich so heftig vom Barhocker, daß ich beinah lang hingeschlagen wäre. Im Schutze der Litfaßsäule, die er vor sich hertrieb, erreichten wir unerkannt den Ausgang und tauchten im tanzenden Hexenkessel des nächsten Saales unter.
»Das ist noch mal gutgegangen«, lachte er erleichtert und zog mich fester in seine Arme. Über meine Schulter hinweg schaute er auf die Uhr an seinem Handgelenk. »Vier Uhr früh. Ich glaube, es wird langsam Zeit.«
»Zeit wozu?« Ich kam vor Schreck aus dem Takt und hatte sogleich den trübseligen Geruch meiner Galoschen in der Nase.
»Fastnacht zu feiern«, sagte er. »Sonst ist sie endgültig vorbei.«
Und somit begannen wir in den frühen Stunden des Aschermittwochs, den Fasching nachzuholen.
Wir feierten ihn so, wie ihn routinierte Massenfeierer gar nicht mehr erleben können, weil echte Fröhlichkeit ein Geschenk ist und kein Zustand.
Wenn ich heute daran zurückdenke, so sehe ich sein zärtliches Jungengesicht über mir in einem Wirbel von Farben, Lärm und Rauch. Unsere Füße berührten keinen staubbedeckten Boden, sie tanzten auf einer mit Luftballons gepflasterten Ebene, vielleicht waren es auch Wolken. Oder ein Regenbogen.
»… und dabei tanze ich gar nicht gern.«
»Ich auch nicht. Wollen wir aufhören?«
»Um Himmels willen, nein!«
Wir feierten mit Haut und Haaren bis über beide Ohren den Fasching aus – und unser Vergnügen war sehr sichtbar. Gegen Morgen steuerten wir eine leere Fensternische in einem halblauten, düsteren Raum an.
Der Weg dorthin führte über einen Clochard – oder Penner, wie man diese nicht ganz reinlichen Superindividualisten hier zu nennen pflegt. Er lag zusammengerollt im Staub, den zerknitterten Lokalteil einer Abendzeitung über den Hüften, und schlief neben einer dreiviertelgeleerten Schnapsflasche. Aus seinen senkellosen, zerfetzten Stiefeln starrten magere, bläulichweiße Schienbeine blank hervor. Das schmutzige Oberhemd war durchlöchert.
»Das ist schon beinah kein Kostüm mehr, sondern eine soziale Anklage«, meinte Herr Ypsilon, als wir vorsichtig über den Schlafenden hinwegstiegen. »Was mag ihn wohl bewogen haben, die närrischen Nächte so ungewöhnlich närrisch zu verbringen?«
»Wahrscheinlich hat er seinen Sartre falsch verstanden«, überlegte ich. »Auf jeden Fall widert ihn unsere läppische Fröhlichkeit an. So ein Auswuchs bürgerlicher Einfalt!«
»Armes Luder. Mitten im harten Staub! Maijie, es ist gewiß nicht einfach, auf so trostlose Art originell sein zu müssen.«
»Nein, Herr Ypsilon.«
»Was halten Sie von der Fensternische da drüben? Ihr Knie braucht endlich Ruhe.«
Durch die Fensterritzen zog die Februarkälte in eisigen Fäden. Wir hockten einander gegenüber und schauten ausführlich aneinander vorbei.
»Haben Sie Schmerzen?« fragte Herr Ypsilon.
»Nein. Ich spüre nichts. Komisch ist das mit so einem Knie. Es tut bloß weh, wenn man unglücklich ist.«
Herr Ypsilon spielte mit den Fransen seines Rockes.
»Nebenan scheint jemand Knieweh zu haben – hören Sie?«
In der Nische neben uns zupften müde Finger über die Saiten einer Gitarre. Sie zupften unendlich, geradezu spanische Mittagsmelancholie in den Raum.
»Vielleicht ist ihm seine Freundin durchgebrannt. Armes Nebenan«, sagte ich mit dem flüchtigen Mitleid der Besitzenden.
»Wir scheinen aus Versehen in den Abstellraum für die Enttäuschten geraten zu sein. Der Clochard, der Mann mit der Gitarre, das alte Mädchen da drüben…«
Ich lehnte den Rücken gegen die kühle Nischenwand und wickelte den Lippenstift aus dem Taschentuch. Dabei rollten meine beiden Groschen-für-alle- Fälle zu Boden.
Herr Ypsilon bückte sich nach ihnen. »Da hat sie ja auch noch Wechselgeld versteckt«, lachte er. »Wie kamen Sie eigentlich dazu, mit Groschen und Pfennigen meinen Fünzigmarkschein zerkleinern zu wollen?«
»Ja, wie kam ich… weiß auch nicht. Aber ich finde, es war eine gute Idee.«
»Eine wundervolle Idee.«
Ich zog meine Lippen ohne Spiegel nach und sah ihn dabei an. Die Zärtlichkeit für ihn machte meine Arme so schwer, daß ich ihr Gewicht am liebsten um seinen Hals gelegt hätte.
So hockten wir schweigend da und schauten uns an. Und atmeten wider den Atem. Und schauten uns an. In meinem Schoß lag die Hand mit dem auf geschraubten Lippenstift. Es ging ganz still vor sich, ohne Leidenschaft, ohne jede Regung. Wir schauten uns nur an.
»Dabei wollten wir bloß Fasching feiern«, sagte er endlich, nahm mir den Lippenstift aus der Hand, schraubte ihn zu und verknotete ihn zusammen mit den Groschen in meinem Taschentuch. Das kleine Bündel legte er in meinen Schoß.
Wir schauten uns an. Und hatten in diesem Augenblick bereits das beschwingte Stadium der Verliebtheit übersprungen und mit dem Liebhaben begonnen.
»Ich muß heute wieder fort«, sagte er. »Ich darf gar nicht daran denken.«
»Wann?«
»Irgendwann am späten Nachmittag geht die Maschine.«
»Kannst du’s nicht verschieben?«
Er nahm meine Hand auf. »Komm mit.«
»Ja«, sagte ich, ohne zu wissen, wohin.
»Aber es hat ja keinen Sinn.«
»Nein. Ja…«Ich war so durcheinander.
Er legte seinen Mund in die Innenfläche meiner Hand – ich spürte seinen warmen Atem, seine Lippen … ich schloß die Augen…