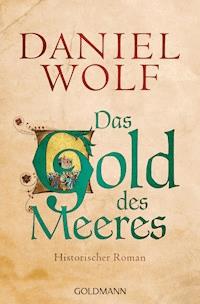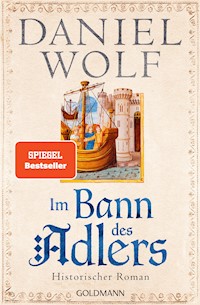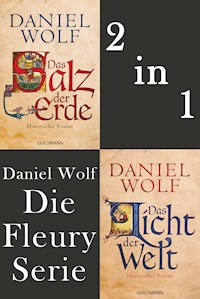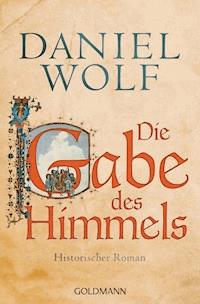9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Fleury-Serie
- Sprache: Deutsch
In seiner Heimat tobt ein brutaler Krieg. Er kämpft für Frieden und Wohlstand. Doch er hat einen mächtigen Feind, der alles daransetzt, ihn zu vernichten.
Varennes-Saint-Jacques im Jahre des Herrn 1218: Eine Stadt, drei Menschen, drei Schicksale. Der Buchmaler Rémy Fleury träumt von einer Schule, in der jedermann lesen und schreiben lernen kann. Sein Vater Michel, Bürgermeister von Varennes, will seine Heimat zu Frieden und Wohlstand führen, während in Lothringen Krieg herrscht. Die junge Patrizierin Philippine ist in ihrer Vergangenheit gefangen und trifft eine folgenschwere Entscheidung. Sie alle eint der Wunsch nach einer besseren Zukunft, doch ihre Feinde lassen nichts unversucht, sie aufzuhalten. Besonders der ehrgeizige Ratsherr Anseau Lefèvre hat geschworen, die Familie Fleury zu vernichten. Niemand ahnt, dass Lefèvre selbst ein grausiges Geheimnis hegt ...
Die Fortsetzung des grandiosen Mittelalter-Epos „Das Salz der Erde“; lesen Sie auch die E-Only-Zusatzgeschichte „Der Vasall des Königs“!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1509
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Varennes-Saint-Jacques im Jahre des Herrn 1218: Eine Stadt, drei Menschen, drei Schicksale. Der Buchmaler Rémy Fleury träumt von einer Schule, in der jedermann lesen und schreiben lernen kann. Sein Vater Michel, Bürgermeister von Varennes, will seine Heimat zu Frieden und Wohlstand führen, während in Lothringen Krieg herrscht. Die junge Patrizierin Philippine ist in ihrer Vergangenheit gefangen und trifft eine folgenschwere Entscheidung. Sie alle eint der Wunsch nach einer besseren Zukunft, doch ihre Feinde lassen nichts unversucht, sie aufzuhalten. Besonders der ehrgeizige Ratsherr Anseau Lefèvre hat geschworen, die Familie Fleury zu vernichten. Niemand ahnt, dass Lefèvre selbst ein grausiges Geheimnis hegt …
Daniel Wolf, geboren 1977, arbeitete u. a. als Musiklehrer, in einer Chemiefabrik und im Öffentlichen Dienst, bevor er freier Schriftsteller wurde. Schon als Kind begeisterte er sich für alte Ruinen, Sagen und Ritterrüstungen; seine Leidenschaft für Geschichte und das Mittelalter führte ihn schließlich zum historischen Roman. Er lebt mit seiner Frau und zwei Katzen in einer der ältesten Städte Deutschlands.
Mehr von Daniel Wolf:Das Salz der Erde. Historischer Roman( Auch als E-Book erhältlich)
Daniel Wolf
___________________________________
Das Licht der Welt
Historischer Roman
1. Auflage
Originalausgabe Januar 2015
Copyright © 2014 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Gestaltung des Umschlags: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: Leemage / getty images; DEA / A. DAGLI ORTI / getty images; FinePic®, München
Redaktion: Eva Wagner
BH · Herstellung: Str.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-13165-4
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Sandra
»Tempori aptari decet – Man muss sich der Zeit anpassen.«
(Lucius Annaeus Seneca, 1. Jahrhundert)
Dramatis Personae
VARENNES-SAINT-JACQUES
Michel Fleury, Bürgermeister
Isabelle Fleury, seine Gemahlin, eine Kauffrau
Rémy Fleury, ihr Sohn, ein Meister der Buchmalerei
Louis, ein Knecht Michels
Yves, ein Knecht Michels
Gaston, Rémys Geselle
Anton, Rémys Lehrling
Dreux, Rémys Gehilfe
Ratsherren:
Henri Duval, der städtische Richter
Odard Le Roux, ein Kaufmann
Eustache Deforest, der Vorsteher der Kaufmannsgilde sowie Münzmeister
Soudic Poilevain, ein Kaufmann
Jean Caboche, der Obermeister der Schmiede sowie Schultheiß
Guichard Bonet, der Obermeister der Weber und Tuchfärber
Bertrand Tolbert, der Obermeister der Stadtbauern sowie Marktaufseher
Anseau Lefèvre, ein Wucherer
Kaufleute der Gilde:
Fromony Baffour
Thibaut d’Alsace
René Albert
Philippe de Neufchâteau
Adrien Sancere
Victor Fébus
Girard Voclain
Andere Bewohner Varennes’:
Jean-Pierre Cordonnier, der Obermeister der Schuster, Gürtler und Seiler
Gaillard Le Masson, der Obermeister der Steinmetze und Maurer
Adèle, Jean Caboches Frau
Alain, Jeans und Adèles Sohn
Azalaïs, Jean Caboches Stieftochter
Chrétien, Anseau Lefèvres fattore
Daniel Levi, ein jüdischer Fernhändler
Olivier Fébus, Victor Fébus’ jüngster Sohn
Julien, ein Schmied
Hugo, ein Schuster
Guillaume, ein Stadtknecht
Richwin, ein Stadtknecht
Eugénie, eine Schankwirtin
Hervé, ein jugendlicher Beutelschneider
Maman Marguérite, eine Frauenwirtin
ADEL UND KLERUS
Renouart de Bézenne, ein lothringischer Ritter
Felicitas, sein Weib
Nicolas, ihr Sohn und Erstgeborener, ein Tempelritter
Catherine, ihre jüngste Tochter
Abbé Wigéric, der Vorsteher der Abtei Longchamp
Bruder Adhemar, ein Mönch der Abtei Longchamp
Pater Arnaut, ein Priester
SPEYER
Hans Riederer, ein Kaufmann, Michel Fleurys fattore
Sieghart Weiß, Riederers Gehilfe
Ludolf Retschelin, ein Patrizier und Ratsherr
METZ
Robert Michelet, ein Kaufmann, Michel Fleurys fattore
Évrard Bellegrée, der Schöffenmeister der Republik Metz
Roger Bellegrée, sein Sohn
Jehan d’Esch, ein Ratsherr der Treize jurés
Robert Gournais, ein Ratsherr der Treize jurés
Géraud Malebouche, ein Ratsherr der Treize jurés
Baptîste Renquillon, ein Ratsherr der Treize jurés
Pierre Chauverson, ein Ratsherr der Treize jurés
Messere Ottavio Gentina, ein lombardischer Geldverleiher
Thankmar, ein deutscher Söldner
Pierre Ringois, ein Kaufmann
HISTORISCHE PERSONEN
Friedrich II. (1194–1250), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches; genannt Stupor mundi, das Staunen der Welt
Konrad von Scharfenberg (um 1165–1224), Bischof von Metz und Speyer sowie Kanzler des Kaisers
Thiébaut (um 1191–1220), Herzog von Oberlothringen
Gertrude de Dabo (?–1225), sein Weib
Mathieu (um 1193–1251), Thiébauts Bruder, Herzog von Oberlothringen ab 1220
Henri II. (1190–1232), Graf von Bar
Blanche de Navarre (1177–1229), Gräfin von Champagne
Érard de Brienne (um 1170–1246), der Herr von Ramerupt und Venizy
Walther von der Vogelweide (um 1170–1230), ein Lyriker und Minnesänger
Eudes de Sorcy (?–1228), Bischof von Toul ab 1219
Rogier de Marcey (?–1251), Bischof von Toul ab 1231
Theoderich von Wied (um 1170–1242), Erzbischof von Trier
Jean d’Apremont (?–1238), Bischof von Metz ab 1224
Simon von Leiningen, der spätere Gemahl Gertrudes de Dabo
Albertus Magnus (um 1200–1280), ein Universalgelehrter
Leonardo Fibonacci (um 1170–1240), ein Mathematiker
SONSTIGE
Philippine, eine Dame mit rätselhafter Vergangenheit
Guiberge, ihre Magd
Pater Bouchard, der Kaplan von Warcq
Arnold Liebenzeller, ein Kaufmann aus Straßburg
Villard de Gerbamont, ein gelehrter Ritter
Tristan de Rouen, ein Doctor der Theologie an der Universität von Paris
William von Southampton, ein Magister an der Universität von Paris
Saint Jacques, der Schutzheilige von Varennes
Robyn Hode, eine englische Sagengestalt, heute bekannt unter dem Namen Robin Hood
Im Anhang befindet sich ein Glossar der im Roman verwendeten historischen Begriffe.
PROLOGOktober 1214
VARENNES-SAINT-JACQUES
Der Abt schaute das Ende der Welt, und die Farbenpracht entzückte ihn.
Das Pergament erstrahlte in Purpur und Blau, in Grünspan und Zinnober. Engel gossen die Schalen des Zornes aus, ihre Schwingen aus Blattgold glitzerten im Kerzenschein, während die Rache des Allmächtigen über die Welt kam. Schön und schrecklich zugleich waren sie, die sieben Plagen der Endzeit; es war ein Gemälde der Furcht und der Herrlichkeit, das unter den Pinselstrichen des Mönchs Form annahm. Hier wurden die Meere zu Blut, da versengte die Sonne die sündige Menschheit, der Euphrat vertrocknete in ihren grausamen Strahlen zu Staub.
»Wunderbar«, flüsterte der Abt, »ganz wunderbar«, und der Mönch am Schreibpult lächelte demütig.
Es geschah nicht oft, dass der Abt mit der Arbeit seiner Brüder zufrieden war. Normalerweise erblickte er überall Nachlässigkeit, wenn er das Skriptorium besuchte, und stets musste er die Mönche antreiben, da sich andernfalls Pfusch und Müßiggang breitmachten.
Heute jedoch kam ihm nichts als Lob über die Lippen. Schreiber, Rubrikatoren, Buchmaler – sie alle hatten sich selbst übertroffen. Der Text der Offenbarung des Johannes war frei von Fehlern und garstigen Tintenklecksen. In Reih und Glied marschierten die heiligen Worte über die Seiten, jeder Buchstabe gestochen scharf. Die Initialen waren kleine Kunstwerke, eines schöner als das andere, ebenso die Miniaturen an den Seitenrändern.
Und das Gemälde. Ach, das Gemälde.
Dieses Buch würde den Ruhm der Abtei Longchamp mehren, das wusste der Abt. Wichtiger noch: Es würde dem Kloster eine stattliche Summe einbringen. Am besten sollte er sogleich mit dem Meister der Kaufmannsgilde sprechen und den neuen Prachtcodex anpreisen. Auf diese Weise würde er gewiss rasch einen vermögenden Käufer finden.
Der Abt ermahnte seine Brüder, nicht in ihrer Sorgfalt nachzulassen, ehe er das Skriptorium verließ und zu seinen Gemächern schritt, wo er sich einen mit Otterfell gefütterten Mantel überwarf. Just in diesem Moment kam ein Novize herein.
»Abbé Wigéric, Euer Gnaden!«, sagte der Bursche atemlos.
»Ich habe keine Zeit, Junge. Komm später wieder.«
»Aber Ihr müsst mich anhören«, beharrte der Novize frech. »Es ist wichtig!«
Obwohl der Abt versucht war, den Burschen scharf zurechtzuweisen, rief er sich ins Gedächtnis, dass dieser Novize nicht dafür bekannt war, seine Oberen mit Nichtigkeiten zu behelligen. Was er zu sagen hatte, mochte tatsächlich wichtig sein. »Na schön. Sprich. Was gibt es?«
»Ich war eben in der Stadt, um bei unseren Brüdern von Saint-Julien neue Kerzen zu holen, als ich von der neuen Werkstatt erfuhr. Sie hat heute aufgemacht, Abbé. Im Viertel der Schuster, Seiler und Gürtler. Die ganze Stadt spricht darüber!«
»Was für eine Werkstatt?«, fragte der Abt gereizt. »Wovon redest du, Junge?«
»Eine Schreibwerkstatt! Ein Skriptorium wie unseres!«
»Du musst dich irren. Die anderen Klöster haben keine Skriptorien. Unseres ist das einzige in ganz Varennes.«
»Nein, nicht die Klöster«, sagte der Novize. »Sie gehört einem gewöhnlichen Bürger. Einem Laien.«
»Eine weltliche Schreibwerkstatt? So etwas gibt es nicht – jedenfalls nicht hier. Man hat dir Lügen aufgetischt.«
»Es ist die Wahrheit, Euer Gnaden. Ganz bestimmt. Der Sohn des Bürgermeisters steckt dahinter. Die Leute sagen, er will der erste weltliche Schreiber und Buchmaler Varennes’ werden.«
Der Abt horchte auf. »Rémy Fleury? Der ist doch in Schlettstàdt.«
»Er ist vor einigen Tagen zurückgekommen und hat ein Haus in der Stadt gemietet.«
Das Antlitz des Abtes verfinsterte sich. Wenn es wirklich der Wahrheit entsprach, was der Junge erzählte, wäre das eine Katastrophe. Er musste der Sache schnellstens auf den Grund gehen. »Wo finde ich diese Werkstatt?«
»In der Gasse zwischen dem Greifenturm und dem Wagenturm. Ihr könnt sie nicht verfehlen.«
Abbé Wigéric schickte den Novizen weg und verließ seine Gemächer. Sein Besuch beim Gildemeister musste warten – diese Angelegenheit war dringlicher. Draußen zog er seinen Mantel enger um die Schultern. Es war ein goldener Herbsttag, sonnig und klar, und die Blätter der uralten Rotbuche im Klosterhof leuchteten rot, gelb und orange, beinahe wie ein ersterbendes Herdfeuer. Aber die Luft war kalt an diesem Morgen. Sein Atem dampfte, als er an den Klostergärten vorbeischritt, das Tor durchquerte und die mit wildem Wein überwucherten Mauern der Abtei hinter sich ließ.
Ein Schreiber, der nicht dem Klerus entstammte und der seine Arbeit nicht im Skriptorium einer Ordensgemeinschaft verrichtete, war eine Torheit, ein Frevel! Das hatte der Abt schon damals gedacht, als der junge Fleury nach Schlettstàdt gegangen war, um die Schreibkunst und das Handwerk der Buchmalerei zu erlernen. Es war allein Sache der Klöster, Schriften zu kopieren und das Wissen zu vervielfältigen. Laien waren für dieses heilige Werk denkbar ungeeignet. Ginge es nach Wigéric, sollte es den einfachen Christen nicht einmal gestattet sein, Lesen und Latein zu lernen. Man brauchte diese Fähigkeiten nicht, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Wenn sie das Wort Gottes hören wollten, sollten sie sich gefälligst an einen Priester wenden, der ihnen aus der Heiligen Schrift vorlas. Überdies enthielten viele Bücher komplexes Wissen – Wissen, das ein nicht im Glauben gefestigter Geist missverstehen, das sein Seelenheil gefährden könnte. Die Heilige Kirche tat gut daran, das einfache Volk davon fernzuhalten. Schlimm genug, dass viele Kaufleute lesen und schreiben konnten. Man hatte ja gesehen, wohin das führte: zu Aufstand, Rebellion und Unfrieden allerorten.
Und nun besaß dieser Rémy Fleury auch noch die Frechheit, eine weltliche Schreibwerkstatt zu eröffnen – hier, in Varennes-Saint-Jacques, vor Wigérics Nase. Was für eine Provokation! Wollte er die Abtei Longchamp in den Ruin treiben? Ja, so musste es sein. Die Familie Fleury war seit jeher eine Feindin der Kirche. Zweifellos war der junge Fleury genauso aufsässig und impertinent wie sein Vater, der Bürgermeister, möge der Allmächtige ihn dereinst für seine Sünden strafen.
In seinem Zorn war Wigéric immer schneller ausgeschritten. Nun ging sein Atem schwer, und er spürte Schweißtropfen über die Wangen rinnen. Er war nicht mehr der Jüngste, und seine beträchtliche Leibesfülle tat ihr Übriges. Der Abt spähte die Gasse hinab. Er befand sich mitten im Viertel der Schuster, Gürtler und Seiler und erblickte über den Dächern den Greifen- und den Wagenturm.
Da drüben – das musste es sein!
Die Augen zu Schlitzen verengt, näherte er sich dem Haus. Kisten stapelten sich neben dem Eingang. Die meisten waren leer, zwei enthielten Kleider und etwas Essgeschirr. Energisch klopfte Wigéric an. Als er keine Antwort erhielt, öffnete er kurzerhand die Tür und trat ein.
Das Haus, ein Steingebäude, verfügte über zwei Stockwerke. Früher hatte es einem Schuster gehört, der im Erdgeschoss gearbeitet und im Obergeschoss gewohnt hatte. Es war niemand da. Leise, als befände er sich tief in Feindesland, schlich Wigéric durch die geräumige Werkstatt, die noch so gut wie leer war. Im hinteren Teil standen weitere Kisten, ein Tisch mit zwei Stühlen und ein Schreibpult.
Irgendwo rumpelte es. Der Abt spitzte die Ohren. Die Geräusche kamen aus dem Keller. Er trat zum Pult, betrachtete das Möbelstück mit zusammengekniffenen Lippen und stellte sich vor, wie Fleury hier kauerte und seinem schändlichen Treiben nachging. Wie er Codices kopierte, der Abtei Longchamp wichtige Aufträge wegschnappte und gedankenlos Wissen verbreitete, das die Klöster bisher sorgsam unter Verschluss gehalten hatten. Hatte dieser Mann auch nur einmal darüber nachgedacht, welchen Schaden er anrichten würde?
Auf dem Tisch lagen eine Armbrust – wozu brauchte ein Buchmaler eine Armbrust? – und ein Buch, in Leder gebunden. Wigéric schlug es auf. Es war De brevitate vitae von Seneca, ein uraltes philosophisches Machwerk, entstanden in den dunklen Jahren nach Christi Ermordung. Das gottlose Elaborat eines Heiden. Die Falte zwischen Wigérics Augenbrauen vertiefte sich. Seit einigen Jahren gruben gewisse Gelehrte immer mehr heidnische Schriften aus grauer Vorzeit aus und studierten ihren Inhalt. Wenngleich diese Praxis von verschiedenen Kirchenlehrern unterstützt wurde, hielt Wigéric nichts davon. Seneca, Cicero und all die anderen Römer waren Unwissende gewesen, denen niemals die göttliche Wahrheit und das himmlische Heil zuteilgeworden waren. Welchen Sinn hatte es, sich mit ihren Gedanken zu befassen? Dies war sündhaft, ja gefährlich. Der wahre Christ benötigte lediglich die Bibel, allenfalls noch einen Psalter oder ein Stundenbuch. Alle übrigen Bücher waren überflüssig.
Wigéric blätterte in den Seiten. Widerwillig musste er zugeben, dass dieser Codex ein ausgesprochen schönes Exemplar war. Die Schrift war gleichmäßig und gut lesbar, die Miniaturen und Initialen konnten sich durchaus mit jenen messen, die seine Brüder für die neue Kopie der Offenbarung angefertigt hatten. Hier war ein Meister seines Fachs am Werk gewesen. Hieß dieser Meister Rémy Fleury? Falls ja, war er noch gefährlicher, als Wigéric angenommen hatte.
Der Abt vernahm Schritte und hob den Kopf.
Rémy Fleury stand da und blickte ihn an. Sein schlichter Kittel war staubig, auch in seinem Haar hatte sich Schmutz verfangen. Es war kurz und dunkelblond; blond war auch der Stoppelbart, der Kinn und Wangen bedeckte. Als Wigéric ihn das letzte Mal gesehen hatte, war er ein Jüngling gewesen. Inzwischen war er zum Manne gereift – zu einem gut aussehenden noch dazu, wie Wigéric missmutig feststellte.
»Was kann ich für Euch tun?«, fragte Fleury.
Der Abt deutete auf die Brevitate vitae. »Habt Ihr dieses Buch angefertigt?«
»Es ist mein Meisterstück. Es ist nicht dafür gedacht, dass man darin blättert.« Frech griff Fleury über den Tisch, zog das Buch zu sich und schlug es zu. »Wenn Ihr es lesen wollt, kann ich Euch eine andere Abschrift besorgen.«
»Ich lese keine Schriften von Heiden«, sagte der Abt und machte kein Hehl aus seinem Abscheu. »Habt Ihr keine Angst, dass Ihr Euch versündigt, wenn Ihr derart gottlose Gedanken in Euch aufnehmt?«
»Warum sollte ich? Die Moralvorstellungen der Heiden enthalten viel Wahres, das wir Christen übernehmen sollen, um es bei der Verkündung des Evangeliums zu gebrauchen. Augustinus lehrt uns das, nicht wahr?«
Einen Kirchenvater zu zitieren, noch dazu den Verfasser einer Mönchsregel, war der Gipfel der Unverfrorenheit. Als wüsste Wigéric das nicht! Stechend blickte er den Buchmaler an. »In der Stadt erzählt man sich, Ihr wollt eine Schreibwerkstatt eröffnen. Ich konnte das nicht glauben und bin hier, um mich zu vergewissern, dass das nichts als Gerede ist. Es ist doch Gerede?«
»Nein, genau das ist meine Absicht.« Fleury ließ ihn stehen, ging nach draußen und trug die Kiste mit dem Essgeschirr herein.
»Eine Werkstatt, in der Ihr Bücher und Codices anfertigen werdet«, hakte der Abt nach.
»Und Verträge, Schuldscheine, Briefe. Was eben anfällt.« Fleury stellte die Kiste ab und ging hinaus, um auch die andere zu holen.
Diese Unhöflichkeit! Der Kerl war schon immer maulfaul und eigenbrötlerisch gewesen, bereits als junger Bursche. Ganz anders als sein Vater, der sich gerne reden hörte und sich immerzu wichtig nahm, aber auf seine Weise genauso unerträglich. »Redet mit mir, Mann!«, blaffte der Abt, als Fleury die Kiste zur anderen stellte.
»Verzeiht, aber ich habe zu tun.«
»Wisst Ihr nicht, wer ich bin?«, fragte Wigéric empört.
»Der Abt des Klosters Longchamp. Euer Besuch ehrt mich.« Fleury nickte ihm knapp zu, ehe er mit dem Essgeschirr in der Küche verschwand, die sich an die Werkstatt anschloss.
Wigéric ging ihm nach. »Aber es gibt bereits eine Schreibwerkstatt in Varennes. Das Skriptorium der Abtei.«
»Das weiß ich.« Fleury begann, das Geschirr aus der Kiste zu räumen.
»Wenn Ihr auch eine eröffnet, gibt es zwei. Dafür ist Varennes zu klein.«
»Varennes ist groß genug. Wenn wir guten Willens sind, wird keiner den anderen stören.«
»Aber wie wollt Ihr ein Gewerbe ausüben, wenn Ihr keiner Bruderschaft angehört? Das ist verboten.«
»Ich gehöre einer Bruderschaft an«, meinte Fleury und untersuchte eine Schüssel, die einen Sprung hatte.
»Ach ja?«, höhnte der Abt. »Welche denn? Gibt es neuerdings eine Bruderschaft der Schreiber, Buchmaler und Rubrikatoren, deren einziges Mitglied Ihr seid?«
»Die Schuster, Gürtler und Seiler waren so freundlich, mich aufzunehmen.« Fleury stellte die Schüssel zurück in die Kiste.
Wigéric wurde immer wütender. Dieser Kerl hatte auf alles eine Antwort. »Was ist mit dem Bischof? Hat er Euch überhaupt erlaubt, als Laie eine Schreibwerkstatt zu eröffnen?«
»Ich brauche keine Erlaubnis des Bischofs. Ich habe die Genehmigung des Rates, das genügt.«
Natürlich. Fleurys Vater war der Bürgermeister; Rémy bekam vom Rat jede Erlaubnis, die er brauchte. Es war genauso, wie Wigéric sich gedacht hatte: Vater und Sohn machten gemeinsame Sache, zum Schaden der Klöster. Diese Familie würde erst ruhen, wenn die Kirche in Varennes zugrunde gerichtet war. »Selten ist mir ein Mann begegnet, der so starrsinnig ist!«, sagte Wigéric heftig. »Ich frage mich, was Euch die Abtei Longchamp getan hat, dass Ihr uns derart böswillig schaden wollt.«
»Ich möchte niemandem schaden. Nichts liegt mir ferner.« Fleury legte ihm den Arm um die Schultern und schob ihn mit sanfter Gewalt aus der Küche und durch die Werkstatt. »Ich habe wirklich viel zu tun, Abbé. Lasst uns weiterreden, wenn ich mehr Zeit habe. Gehabt Euch wohl.«
Bevor der Abt begriff, wie ihm geschah, stand er auf der Gasse, und die Tür fiel hinter ihm zu. Fleury hatte ihn hinausgeworfen, auf die Straße gesetzt wie einen lästigen Bettler. Ihn, den Vorsteher der Abtei Longchamp! Wigéric konnte kaum noch atmen vor Zorn. Aber das würde Fleury bereuen. Wigéric würde sich über ihn beschweren, beim Rat, beim Bischof, beim Erzbischof, wenn es sein musste. Er würde eine Allianz der Klöster schmieden und diesen unverschämten Kerl zu Fall bringen.
Der Abt wandte sich ab und stolzierte die Gasse hinauf.
Spätestens zu Weihnachten, so schwor er sich, würde diese unselige Werkstatt aufhören zu existieren.
ERSTES BUCHStupor mundi
Mai bis Dezember 1218
Mai 1218
AMANCE IM HERZOGTUM OBERLOTHRINGEN
In der Glut der Abenddämmerung erschien Alain Caboche die Burg wie eine Bestie, die niemals schlief. Immerzu regte sich etwas in ihrem steinernen Leib, am Tag wie in der Nacht. Feindselige Augen, die das Heerlager am Fuß des Hügels beobachteten. Münder, die Befehle brüllten. Hände, die einander Steine reichten und die Wunden in der Schildmauer heilten. Und wehrhaft war das Monstrum. Von seinen Türmen und Zinnen regnete es Pfeile, Felsbrocken und siedendes Öl, sobald sich Feinde den Toren näherten.
Die Burg war hungrig. Sie verschlang Menschen.
Über neunzig Leben habe die Festung über dem Dörfchen Amance bereits gefordert, hieß es im Lager. Allein vom Aufgebot der freien Stadt Varennes-Saint-Jacques, dem auch Alain angehörte, waren bereits acht Männer gefallen; noch einmal so viele lagen verletzt auf den Pritschen der Wundärzte. Dabei hatte die Belagerung gerade erst angefangen.
Wen es wohl als Nächsten erwischt?, dachte Alain dumpf, während er an den Latrinengräben am Rande des Heerlagers sein Wasser abschlug. Hugo. Ja. Ganz sicher Hugo. Der junge Schustergeselle war eine ängstliche Natur, die mir nichts, dir nichts in Panik geriet und im Kampfgetümmel wild mit seinem Kriegskolben um sich schlug, ohne jedes Gefühl für Angriff und Verteidigung. Es glich einem Wunder, dass er den Feldzug bisher unbeschadet überstanden hatte.
Oder Du lässt den armen Hugo laufen und holst Dir stattdessen Lefèvre. Anseau Lefèvre war einer der Ratsherren von Varennes und führte das Aufgebot an. Alain hasste ihn, wie er noch nie einen Mann gehasst hatte. Lefèvre für Hugo – ist das ein Handel, Herr? Komm. Zeig uns, dass Du gerecht sein kannst. Wenigstens einmal.
Um sein eigenes Leben machte sich Alain keine großen Sorgen. Er war hochgewachsen und muskulös wie sein Vater, dazu zäh und schnell. Außerdem verfügte er über eine erstklassige Kettenrüstung und verstand etwas vom Kämpfen. Obwohl nur Schmied und gerade einmal achtzehn Jahre alt, wusste er sich zu verteidigen. Das hatte er in den letzten Wochen mehr als einmal bewiesen. Nein, wenn ihn nicht gerade hinterrücks ein Armbrustbolzen traf, würde er bis zum Sieg des Königs seinen Mann stehen und danach gesund und munter nach Hause marschieren.
Alain schüttelte sein Glied aus, zog die Bruche hoch und griff nach seinem Gürtel, der mitsamt dem Dolch und der Streitaxt über dem Zaun hing. Auf der anderen Seite des Latrinengrabens, unter dem Vordach einer Hütte, saß ein bärtiger Höriger, der ihn anstarrte und ausspuckte. Alain senkte den Blick und schlang seinen Gürtel um die Hüfte. Die Bauern von Amance taten ihm leid. Als wäre es nicht schlimm genug, dass der König ihnen ihre Schweine und den Ertrag ihrer Felder weggenommen hatte, pissten und schissen ihnen jeden Tag tausendfünfhundert Männer auf die Allmende. Dabei konnten diese armen Teufel wahrlich am allerwenigsten etwas für diesen Krieg.
Es war windstill und warm, sodass der infernalische Gestank der Latrinen Alain bis weit in das Heerlager hinein verfolgte, wo er sich mit dem Rauch der Herdfeuer und dem Schweißgeruch der Männer vermengte. Die meisten Krieger, die vor den Zelten herumlungerten, kamen wie Alain aus Lothringen, doch manche waren auch aus dem Land der Deutschen, dem Elsass und Burgund, einige gar aus Frankreich. Von überall her hatte der junge König seine Vasallen und Verbündeten versammelt, um den aufsässigen Herzog von Oberlothringen zu zerschmettern. Warum – das wusste niemand so recht. Alain hätte bereitwillig einen ganzen Sou darauf gewettet, dass es im Heerlager keine zehn Männer gab, die in allen Einzelheiten erklären konnten, wie es zu der Fehde zwischen König Friedrich und Herzog Thiébaut gekommen war. Auch nicht Alain selbst, obwohl er sich für einen klugen Kopf hielt. Thiébaut hatte sich in Zwistigkeiten in der Grafschaft Champagne eingemischt und sich damit den Zorn des Königs zugezogen, der ihm Verrat an der Krone vorwarf. Während der kurzen, aber heftigen Fehde waren Rosheim zerstört und Nancy geplündert worden, Thiébaut war nach Süden geflohen und hatte sich in Amance verschanzt – und hier saß er nun fest, verlassen von fast all seinen Getreuen, eingeschlossen von einer zehnfachen Übermacht.
Alain erreichte den östlichen Rand des Heerlagers am Fuße des Burghangs. Hier lagerte das Aufgebot von Varennes, denn Lefèvre bestand darauf, dass seine Untergebenen jederzeit in die vorderste Linie stürmen konnten, wenn zum Angriff geblasen wurde. Erdwälle und Palisaden schützten die Zelte vor den feindlichen Wurfmaschinen und Armbrustschützen. Seit dem frühen Abend schwiegen die Waffen. Die Männer ruhten sich aus, pflegten ihre Blessuren oder schlürften Suppe.
Alain hielt nach Lefèvre Ausschau. Als er ihn nirgends entdeckte, setzte er sich zu Julien, Hugo und einigen anderen ans Feuer.
»Ist Satan zur Hölle gefahren?«
»Schön wär’s«, meinte Julien, ein Schmied wie Alain, bärtig, sehnig, die Hände und Arme von Funken verbrannt. »Eben ist er weggestiefelt. Weiß der Teufel, was er treibt. Suppe?«
Alain nickte, und Julien reichte ihm einen Napf mit dampfendem Kohleintopf.
»Hab gehört, dass wir morgen früh wieder angreifen«, sagte einer der Männer.
»Hab ich auch gehört«, murmelte Alain und pustete auf seinen Löffel. Die Suppe war so heiß, dass er sich an dem irdenen Napf fast die Finger verbrannte.
»Wieso hungern wir sie nicht einfach aus?«, fragte Hugo, der Brot schneiden wollte, aber mehr damit beschäftigt war, nervös am Griff seines Messers herumzufingern. »Ich meine, warum kämpfen, wenn wir einfach abwarten könnten? In spätestens einem Monat haben sie da drin nichts mehr zu beißen. Dann kommen sie aus ihren Löchern gekrochen, und wir hätten gewonnen, ohne dass einer von uns den Kopf hinhalten müsste.«
»Du weißt nicht, wie viele Vorräte sie haben«, sagte Alain. »Amance ist eine wichtige Burg. Wichtige Burgen sind immer auf Belagerungen vorbereitet.«
»Außerdem hat der König keine Geduld«, ergänzte Julien. »Er will diese Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen – und dann ab nach Rom, damit er sich endlich die Kaiserkrone aufsetzen kann.«
Hugo presste die Lippen zusammen und verteilte das Brot. Er hatte sich für den Feldzug gemeldet, weil er dieses Schankmädchen vom Salztor mit seinem Mut beeindrucken wollte. Und allmählich dämmerte ihm, dass das nicht die beste Idee seines Lebens gewesen war.
Das Aufgebot Varennes’ bestand nur aus Freiwilligen – so wollte es der Stadtrat. Es gab lediglich die Vorschrift, dass jede Bruderschaft und jeder Pfarrsprengel der Stadt eine gewisse Zahl von Männern bereitstellen musste, wenn der König militärischen Beistand einforderte. Alain, dessen Vater im Rat saß, war einer der wenigen Höhergestellten, die dem Ruf zu den Waffen gefolgt waren. Die anderen waren zumeist einfache Gesellen, Arbeiter und Tagelöhner ohne Bürgerrecht. Sie hatten sich gemeldet, um für einige Wochen ihrem eintönigen Dasein zu entfliehen und um ihren kargen Lohn mit Kriegsbeute aufzubessern. Keiner hatte damit gerechnet, dass der Feldzug so blutig werden würde.
Alain spülte den leeren Napf an einem Wasserfass aus, setzte sich einen Steinwurf von den Männern entfernt auf die zertrampelte Wiese und lehnte sich gegen das Rad eines Ochsenwagens. Die Strapazen der vergangenen Wochen saßen ihm tief in den Gliedern, und ihm war nicht nach Reden zumute. Er wollte in Ruhe seinen Gedanken nachhängen. Vielleicht würde er sogar hier draußen schlafen, denn er hatte die stickige Luft in den Zelten gründlich satt.
Die Sonne war längst hinter der Burg versunken, und die Zinnen der Festung krallten sich wie Reißzähne in den flammenden Himmel. Die schwarzen Mauern und Türme erschienen Alain bedrohlicher denn je. Menschen waren keine auf den Wehrgängen zu sehen, doch er wusste, sie waren da. Warteten. Beobachteten.
Er dachte an Jeanne, während er reglos auf der Erde saß, an ihre Augen, ihr Haar. Sie hatten sich zum ersten Mal geliebt in der Nacht vor seinem Aufbruch, er hatte ihr die Welt und den Himmel versprochen und würde sie zur Frau nehmen, sobald er heimkehrte. Gewiss, er war noch nicht mündig, aber das würde ihn nicht aufhalten. Sein Vater war ein kluger Mann, und er liebte Alain über alles. Er würde ihnen nicht im Wege stehen. Er würde alles tun, um seinen Sohn glücklich zu machen.
Ich werde dich stolz machen, Vater. Du hast mein Wort.
Alain musste eingeschlafen sein, denn als er die Augen öffnete, war es früher Morgen. Grauer Dunst lag über dem Hang und der Zeltstadt. Sein Waffenrock fühlte sich klamm an. Ein dumpfer Aufschlag hatte ihn geweckt. Jetzt hörte er fernes Geschrei und sah, wie ein Schleuderstein gegen die äußere Burgmauer schmetterte. Er sprang auf und griff unwillkürlich nach seiner Streitaxt.
»Alain!« Julien lief über die Wiese. »Es geht los!«
Alain folgte seinem Waffenbruder zu den Zelten, wo aufgeregte Betriebsamkeit herrschte. Die Männer Varennes’ schlüpften in ihre Gambesons, stülpten Helme über und griffen nach Äxten, Schilden, Kriegssensen. Der Graf von Bar ritt auf seinem Schlachtross vorbei und rief seine Getreuen zu sich. Ritter schnauzten ihre Schildknappen an. Waffenknechte schulterten Sturmleitern und stellten sich hinter der Palisade auf.
Weitere Felsbrocken schlugen gegen die Burgmauern. Inzwischen schossen nicht mehr nur die kleineren Katapulte, sondern auch die Blide, das gewaltige Hebelgeschütz, das man auf einer Anhöhe errichtet hatte. Die haushohe Belagerungsmaschine übte eine unheilvolle Faszination auf Alain aus. Wenn im Innern der Holzkonstruktion das Gegengewicht nach unten sackte, der Wurfarm in die Höhe schnellte und die lederne Schlinge einen mühlradgroßen Brocken durch die Luft schleuderte, erschien sie ihm wie eine Apparatur aus der Hölle, die ein teuflischer Verstand ersonnen haben musste.
Alain schlüpfte in eines der Zelte, wo Julien ihm half, seine Rüstung anzuziehen. Als sie ins Freie traten, erblickten sie den Mann, den sie Satan nannten.
Anseau Lefèvre war gekleidet und gerüstet wie ein Ritter von adligem Geblüt. Er trug ein schimmerndes Panzerhemd über dem wattierten Untergewand, dazu Beinlinge und Handschuhe aus Kettengliedern und einen grünen Rock, dessen gefranster Saum ihm bis zu den Knien fiel. Der Topfhelm umhüllte seinen ganzen Kopf, und man konnte sein Gesicht nur sehen, weil er das Visier hochgeklappt hatte. Aristokratisch, blass und schmal war es, hager fast, mit vorspringenden Wangenknochen und dunklen, tief in den Höhlen liegenden Augen. Anziehend und zugleich auf eine schwer zu fassende Weise unangenehm. Als er leichten Schrittes zu den Männern trat, umspielte ein höhnischer Zug seine Lippen.
Er macht sich nicht einmal mehr die Mühe, seine Verachtung für uns zu verbergen, dachte Alain.
»Nehmt den Rammbock und macht euch bereit«, befahl Lefèvre.
Der Rammbock, ein gut zwanzig Ellen langer geglätteter Baumstamm mit einem Widderkopf aus Eisen, lag neben den Zelten im Gras. Die sechs stärksten Männer des Aufgebots, darunter Alain und Julien, schulterten ihn. Just in diesem Moment kam der Befehl zum Abmarsch. Der Graf von Bar führte den Angriff und ritt voraus, zahlreiche Ritter und zwei Hundertschaften einfacher Krieger folgten ihm. Während sie den staubigen Weg entlangmarschierten, der sich den Burgberg hinaufschlängelte, streifte Alain Hugo immer wieder mit Blicken. Er hatte dem Schustergesellen gestern versprochen, von nun an auf ihn aufzupassen.
Der eigentlichen Festung war ein kleines Vorwerk vorgelagert, bestehend aus zinnenbewehrten Schildmauern mit überdachten Wehrgängen und zwei Türmen, die das Burgtor flankierten. Die Katapulte hatten die Anlage beschädigt; gleichwohl war es dem königlichen Heer noch nicht gelungen, das Vorwerk zu erstürmen. Bei früheren Angriffen hatte man lediglich den Burggraben mit Geröll zugeschüttet, damit man an die Mauern herankam.
Obwohl der Katapultbeschuss ihnen schwer zusetzte, drängten sich Herzog Thiébauts Getreue auf den Wehrgängen. Da der Bereich vor dem Torhaus großräumig gerodet worden war, hatten sie freies Schussfeld. Folglich empfing die Angreifer ein Hagel aus Bolzen und Pfeilen, kaum dass sie den Schutz der Bäume verlassen hatten und über die Wiese rannten. Rasch suchten die Männer Deckung hinter den Sturmwänden, tragbaren Barrieren aus Holz und Weidengeflecht, die man in den vergangenen Tagen unter beträchtlichen Verlusten aufgestellt hatte. Sie standen zu beiden Seiten des Weges, ganze Reihen davon, die einander überlappten.
Alain und seine Gefährten ließen den Rammbock fallen und schöpften Atem, während die Geschosse über die Sturmwände hinwegzischten oder mit dumpfem Aufschlag darin stecken blieben. Hastig blickte Alain sich um. Alle da. Niemand verletzt. Ein Ritter des Grafen von Bar schräg vor ihnen hatte nicht so viel Glück: Ein Pfeil bohrte sich in den Sehschlitz seines Helmvisiers. Bevor Alain den Kopf einzog, sah er noch, dass der Mann aus dem Sattel kippte, während sich sein Ross wiehernd aufbäumte.
»Wollt ihr hier Wurzeln schlagen?«, schnarrte Lefèvre. »Auf die Füße mit euch, faules Pack!«
»Der Sturmbock ist höllisch schwer, Herr«, begehrte Julien auf. »Wir brauchen eine kurze Verschnaufpause.«
»Pause? Wir sind hier nicht bei der Sonntagsmesse. Verschnaufen könnt ihr später. Weiter jetzt. Oder muss ich euch Beine machen?«
Alain biss die Zähne zusammen. Es war wie immer: Lefèvre wollte, dass das Aufgebot von Varennes in der vordersten Linie kämpfte, denn er lechzte danach, dem König zu gefallen. Den Preis dafür zahlten die Männer, denen Lefèvre ein unmenschliches Maß an Mut und Opferbereitschaft abverlangte.
Doch keiner von ihnen wollte sich den legendären Zorn des Hauptmannes zuziehen. Also hoben Alain und die anderen Schmiede den Rammbock auf und arbeiteten sich von Sturmwand zu Sturmwand nach vorne, gefolgt vom Rest des Aufgebots.
Derweil begannen die Armbrustschützen des Grafen von Bar, die Verteidiger der Burg zu beschießen, ohne dabei viel auszurichten: Die meisten ihrer Bolzen prallten wirkungslos von den Zinnen ab.
Schließlich erreichten sie die vorderste Reihe der Sturmwände, legten den Rammbock ins Gras und duckten sich. Alain bemerkte, dass sie allein waren. Auf dieser Seite des Weges hatte sich keine andere Gruppe so weit nach vorne gewagt. Nur ein einzelner Bogenschütze stand in ihrer Nähe, zog einen Pfeil aus seinem Köcher, schoss ihn ab und ging sofort wieder in Deckung.
Vorsichtig spähte Alain an der Korbwand vorbei. Bis zum Burggraben waren es noch fünfzehn, zwanzig Klafter und keine Deckung weit und breit. Das Tor unverletzt zu erreichen, erschien ihm ausgesprochen schwierig, wenn nicht unmöglich.
Ein Schleuderstein sauste heran und riss über dem Torhaus einen Teil des Wehrganges weg. Holz barst krachend, Männer schrien. Damit endete der Katapultbeschuss. Jemand stieß ins Horn, auf der anderen Seite des Weges erschienen Waffenknechte zwischen den Sturmwänden, Leitern geschultert. Brüllend rannten sie in Richtung Vorwerk.
Sie kamen nicht weit. Kaum hatten sie die Deckung verlassen, wurden sie so heftig beschossen, dass sie sich zurückziehen mussten. Beim vordersten Trupp wurden zwei Männer von Pfeilen und Bolzen durchbohrt, die übrigen ließen die Leiter fallen und nahmen die Beine in die Hand. Bei den anderen Trupps wurden mehrere Krieger verwundet. Einer hatte einen Bolzen in der Schulter und einen zweiten im Oberschenkel stecken und erreichte die Sturmwände nur kriechend.
»Worauf wartet ihr?«, bellte Lefèvre. »Auf zum Tor, na los!«
»Nein«, sagte Alain. »Das könnt Ihr nicht von uns verlangen. Das ist verrückt.«
Der Ratsherr lächelte dünn. »Angst, Caboche? Ts-ts-ts. Dein Herr Vater würde das gar nicht gutheißen. Du bist doch sein ganzer Stolz.«
»Natürlich habe ich Angst. Ich wäre ein Narr, wenn ich keine hätte. Habt Ihr nicht gesehen, was gerade geschehen ist? Wenn wir die Deckung verlassen, werden wir abgeschlachtet.«
Die Männer murmelten zustimmend.
»Nicht, wenn ihr schnell seid«, sagte Lefèvre. »Du bist doch schnell, Caboche?«
»Nicht mit dem Rammbock auf den Schultern. Außerdem ist es nicht damit getan, da hinüberzulaufen. Wenn diese Sache einen Sinn haben soll, müssen wir das Tor aufbrechen. Schaut es Euch an. Es ist so fest, wie ein verdammtes Burgtor nur sein kann. Es wird dem Rammbock lange standhalten.« Alain wusste, dass es ihm nicht zustand, so mit ihrem Hauptmann zu sprechen, doch er konnte seinen Zorn nicht mehr bändigen. Von Anfang an hatte Lefèvre in seiner Gier nach Ruhm bereitwillig das Leben der Männer aufs Spiel gesetzt, hatte sie ins größte Gemetzel geworfen und geopfert wie Spielsteine in einer Partie Wurfzabel. Alain hatte es satt. »Wir sind tot, bevor wir das Holz auch nur angekratzt haben!«
»Während ihr das Tor aufbrecht, greifen wir anderen die Wehrgänge mit Sturmleitern an«, entgegnete Lefèvre. »Damit verschaffen wir euch die Zeit, die ihr braucht.«
»Wir sind nur vierundzwanzig Mann, Herrgott noch mal! Wir haben keine Chance gegen die ganze Burgbesatzung.« Alain schaute dem Hauptmann in die Augen. »Macht, was Ihr wollt, aber ohne uns. Wir haben schon genug für Euch geblutet.«
»Ja!«, riefen einige Männer.
»Genug ist genug!«
Gut zehn Krieger bauten sich hinter Alain auf, manche die Hand an der Waffe. Lefèvre blickte sie stechend an.
»Verweigert ihr mir den Befehl?«
Niemand antwortete.
»Muss ich euch daran erinnern, dass ihr mir Treue bis zum Tod geschworen habt?«, fragte der Ratsherr scharf.
Alain holte tief Luft. Was sie hier taten, war überaus gefährlich. Wenn sie den Eid brachen, den sie Lefèvre und ihrer Heimatstadt gegenüber abgeleistet hatten, bevor sie in den Kampf gezogen waren, drohten ihnen Schmach und harte Strafen. »Hier geht es nicht um Treue«, sagte er. »Sondern allein um Eure Ruhmessucht.«
Lefèvre trat so nah an ihn heran, dass sich beinahe ihre Gesichter berührten. Sein Atem roch nach Wein und Minze. »Du hast ein großes Maul, Caboche. Ich wette, es wäre nicht so groß, wenn dein Vater nicht im Rat säße.«
»Lasst meinen Vater aus dem Spiel«, sagte Alain.
»Heb den Rammbock auf, und ich vergesse vielleicht diesen Vorfall.«
»Nein.«
»Du verschwendest deine Zeit, Alain«, sagte Julien. »Wir alle wissen, was zu tun ist. Bringen wir’s hinter uns.«
Der Schmied zückte seine Streitaxt. Was dann geschah, ging so schnell, dass Alain nicht eingreifen konnte. Lefèvre stieß ihn zur Seite und zog seine Klinge. Julien stürzte sich auf den Ratsherrn, doch er kam nicht einmal zum ersten Schlag, denn sein Gegner war ein verteufelt guter Schwertkämpfer. Er entwaffnete Julien, rammte ihm die Faust samt Schwertknauf ins Gesicht und trat ihm vor die Brust, sodass er auf den Rücken fiel. Als er sich aufrichten wollte, hielt Lefèvre ihm die Klinge an den Hals.
»Noch jemand Lust auf ein Tänzchen?« Der Ratsherr blickte herausfordernd in die Runde.
Einige der Männer schienen tatsächlich in Erwägung zu ziehen, ihn anzugreifen. Doch die Mehrheit rührte sich nicht vom Fleck.
»Ihr«, wandte sich Lefèvre an ein Grüppchen Tagelöhner, »nehmt jetzt sofort den Rammbock, oder ich schicke euren Freund Julien zu seinem Schöpfer. Ihr anderen holt die Sturmleitern da drüben. Habt ihr mich verstanden?«
Die Tagelöhner im Aufgebot, allesamt einfache Männer ohne Bürgerrecht, fürchteten Lefèvre am meisten, und sie beeilten sich, den Befehl auszuführen. Damit bröckelte auch der Widerstand der anderen. Mit einem Fluch auf den Lippen setzte sich ein älterer Schuster in Bewegung. »Helft mir, verdammt noch mal!«, blaffte er die Männer an. »Oder soll ich die Leiter allein schleppen?«
Die Angesprochenen folgten ihm. Erst fünf, dann zehn, dann der Rest des Aufgebots, bis nur noch Julien, Hugo und Alain bei Lefèvre waren.
»Sieht so aus, als wäre deine kleine Rebellion schon zu Ende.« In Lefèvres Augen blitzte es. »Willst du deinen Freunden nicht helfen? Sie werden dich brauchen.«
»Komm, Alain«, drängte Hugo.
Der Ratsherr schob sein Schwert in die Scheide, spuckte aus und befahl den Männern, die vier Leitern zu einer Lücke zwischen den Sturmwänden zu bringen. Alain half Julien auf. Seinem Freund lief Blut aus der Nase, er wischte es achtlos weg.
»Wieso habt ihr mir nicht geholfen, verdammt noch mal?«
»Das war dumm! Was hast du denn gedacht? Dass du ihm den Schädel einschlägst und damit durchkommst?«
»Verdient hätte er es«, knurrte Julien.
Alain reichte ihm die Streitaxt und verfluchte ihn im Stillen. Hätten sie alle wie ein Mann zusammengestanden, wäre es ihnen vielleicht gelungen, Lefèvre von seinem wahnwitzigen Vorhaben abzubringen. Mit seiner Unbesonnenheit aber hatte Julien es dem Ratsherrn ermöglicht, ihren Widerstand im Keim zu ersticken. Jetzt gab es nichts mehr, was Alain noch tun konnte. Fortlaufen? Wohl kaum. Diese Schande würde seinen Vater umbringen. Und Jeanne würde ganz gewiss keinen Feigling und Eidbrecher heiraten. Er konnte nur hoffen, dass es nicht so schlimm kam, wie er befürchtete.
Derweil feuerte Lefèvre die Männer mit großspurigen Reden an: »Denkt an den Ruhm, der uns bevorsteht! Wenn wir das Torhaus erstürmen, wird der König jeden von uns reich belohnen. Gewiss schlägt er die mutigsten von euch sogar zum Ritter.«
Der Glanz in seinen Augen war mehr als Ehrgeiz, erkannte Alain. Es war nackter Wahnsinn.
»Lasst uns das machen.« Alain scheuchte die Tagelöhner weg und übernahm gemeinsam mit Julien und den anderen Schmieden den Sturmbock.
»Los!«, brüllte Lefèvre.
Die Schmiede liefen voraus, die anderen folgten ihnen mit den Sturmleitern. Sofort wurden sie beschossen. Einer der Schmiede wurde in den Hals getroffen, Blut quoll aus seinem Mund, während er zusammenbrach. Das zusätzliche Gewicht des Sturmbocks lastete schmerzhaft auf Alains Schulter. Zu allem Überfluss prallte Julien gegen den Sterbenden und verlor das Gleichgewicht. Er ließ die Ramme los, sodass Alain den Baumstamm auch nicht mehr halten konnte. Die Männer sprangen auseinander, und der Sturmbock krachte zwischen ihnen auf die Erde. Julien brüllte vor Schmerz. Er war zu langsam gewesen, und die höllisch schwere Waffe war auf seinem Fuß gelandet.
Um sie herum schwirrten Pfeile und Bolzen durch die Luft.
Alain nahm all seine Kraft zusammen und hob den Sturmbock weit genug an, dass Julien den Fuß darunter hervorziehen konnte. Der ältere Schmied stöhnte vor Schmerz. Hastig nahm Alain seinen Schild vom Rücken und hielt ihn schützend vor sich. »Schaffst du es bis zu den Sturmwänden?«
»Ich versuch’s.« Julien hinkte los.
Alain blickte sich um. Der Angriff war binnen weniger Herzschläge zusammengebrochen. Die Männer hatten die Leitern fallen gelassen, einige lagen im Gras und schützten sich mit ihren Schilden, andere waren verwundet oder tot, die übrigen rannten zurück zu den Sturmwänden. Dort entdeckte Alain Lefèvre.
Er ist nicht mitgekommen! Dieser Sauhund ist nicht mitgekommen!
»Zurück mit euch!«, brüllte der Hauptmann. »Greift an, ihr Feiglinge!« Dabei schwenkte er sein Schwert und versuchte die Männer daran zu hindern, hinter den Sturmwänden Deckung zu suchen.
In diesem Moment fasste Alain den Entschluss, ihn zu töten. Zum Teufel mit den Folgen! Sollten sie ihm zu Hause den Prozess machen, sollten sie ihn ächten oder hängen, es war ihm gleichgültig, solange er nur Lefèvre zur Hölle schicken konnte.
Als er gerade loslaufen wollte, entdeckte er Hugo. Der Schustergeselle kniete keine zehn Schritte entfernt neben dem Mäuerchen, das den Weg begrenzte. Er hatte seinen Helm verloren, Blut sickerte aus einer Platzwunde an seiner Schläfe. Bei dem Versuch, sich mit seinem Schild zu schützen, hatte er sich im Ledergurt verheddert.
»Hugo!«, brüllte Alain. »Komm her!«
Der Schuster hob kurz den Kopf und glotzte ihn mit glasigen Augen an, bevor er wieder versuchte, den Gurt abzustreifen.
Alain hob den Schild vor Gesicht und Brust und rannte zu ihm. »Komm mit. Wir müssen hier weg.«
»Ich kann nicht … ich muss …«, stammelte Hugo.
Alain zog seinen Dolch, durchtrennte Hugos Schildgurt und zerrte seinen benommenen Gefährten auf die Füße. »Siehst du, wohin unsere Leute laufen? Lauf ihnen einfach nach. Hast du verstanden?«
Hugo nickte.
Etwas prallte gegen Alains Helm. Er keuchte auf und taumelte zur Seite. Ehe er den Schild heben konnte, verspürte er einen schmerzhaften Stoß, als hätte man ihn gegen die Brust getreten.
»Alain!«, schrie Hugo.
Alain kippte nach hinten um, blinzelte, versuchte Luft zu holen. Sein Atem ging rasselnd, gurgelnd, er schmeckte Blut. Er hob die Hand und betastete den gefiederten Schaft, der aus seinem Brustkasten ragte.
»Alain! Alain …«
Der Verwesungsgestank lag wie ein Nebelstreif über dem Pfad. Sie hatten ihn gerochen, lange bevor sie die Leichen sahen. Michel Fleury zügelte seinen nussbraunen Zelter und betrachtete die Farne, die am Wegesrand zwischen den Birken wuchsen. Eine Hand, bleich und wächsern, ragte unter dem Gestrüpp hervor und lag wie eine tote Spinne auf dem moosigen Waldboden. Michel presste die Hand auf Nase und Mund.
Als seine beiden Knechte zu ihm aufschlossen, stieg er aus dem Sattel.
»Was habt Ihr vor?«, erkundigte sich Yves.
»Nachsehen, ob das jemand ist, den wir kennen.«
»Lasst gut sein, Herr. Ich mach das schon.«
Der hünenhafte Knecht schwang sich aus dem Sattel, strich sich das grausträhnige Haar hinter ein Ohr und schob mit angehaltenem Atem die Farnwedel zur Seite. Yves und der schweigsame, treue Louis dienten Michel seit vielen Jahren. Sie waren mit ihm alt geworden, und er hätte ihnen jederzeit sein Leben anvertraut.
»Es sind drei«, meldete Yves mit nasaler Stimme. »Keine von uns. Männer des Herzogs.«
Michel bekreuzigte sich. Der Gestank machte sein Pferd nervös, es schnaubte und zuckte mit den Ohren. »Ruhig, Tristan, alter Junge«, raunte er dem Tier zu und tätschelte ihm den Hals. »Bald hast du es überstanden. Bald, hörst du?« Wenn er auf Reisen war, sprach er immerzu mit seinem Pferd – eine Gewohnheit, die Freunde und Bedienstete gerne belächelten. Doch Tristan war für ihn mehr als ein Reittier. Er war sein Gefährte.
Michel stieg wieder auf und unterdrückte ein Stöhnen. Sie saßen seit den frühen Morgenstunden im Sattel, und ihn schmerzte der Rücken, die Beine, die Arme, einfach alles. Er war nun dreiundfünfzig Jahre alt, und an Tagen wie diesem spürte er jedes einzelne davon. »Komm«, forderte er Yves auf. »Reiten wir.«
»Sollten wir nicht unsere Christenpflicht tun und sie begraben?«, fragte der Knecht.
»Es ist schon spät. Wir sollten wirklich weiter. Wenn wir unterwegs Bauern treffen, bitten wir sie, sich um die Toten zu kümmern.«
Sie ritten los. Yves hielt prüfend den Finger in die Luft. »Ihr habt recht, Herr. Wir sollten zusehen, dass wir bald Amance erreichen. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt’s noch vor dem Abend Regen.«
Michel lachte leise in sich hinein. Schon den ganzen Tag war es warm und trocken, und am Himmel zeigte sich keine einzige Wolke. Es würde ganz gewiss nicht regnen, weder heute noch morgen. Wenn Yves das Wetter vorhersagte, irrte er sich in neun von zehn Fällen – aber gab er deshalb auf? Wer das erwartete, kannte Yves schlecht.
Als sie kurz darauf das Birkenwäldchen verließen, begegnete ihnen ein Trupp Holzfäller. Michel gab jedem der Männer einen frisch geschlagenen Denier aus der Münze von Varennes und bat sie, die Gefallenen zu bestatten. Er vermutete, dass die drei Waffenknechte erschlagen worden waren, als Herzog Thiébaut vor der Streitmacht des Königs nach Amance geflohen war. Da sie als Verräter und Eidbrecher galten, hatte niemand es für nötig gehalten, ihnen ein christliches Begräbnis zu gewähren.
Michel verabscheute Krieg, und diese Fehde verabscheute er ganz besonders. Sie war ein weiteres Beispiel für die Torheit der Mächtigen, die jeden noch so unbedeutenden Konflikt am liebsten mit dem Schwert austrugen. Warum verhandeln, wenn man stattdessen seine Hörigen und Vasallen in den Tod schicken konnte? Dabei wäre eine friedliche Lösung denkbar einfach gewesen, wenn alle Beteiligten nur ein wenig mehr Vernunft, Besonnenheit und guten Willen gezeigt hätten.
Angefangen hatte alles mit Erbfolgestreitigkeiten in Frankreich, wo sich die Gräfin Blanche de Navarre und Érard de Brienne um die Grafschaft Champagne stritten. Blanche hatte weit bessere Chancen, ihre Ansprüche durchzusetzen, denn zu ihren Unterstützern zählten der Papst und der König von Frankreich sowie eine ganze Reihe mächtiger Herren, darunter der Herzog von Burgund und die Bischöfe von Reims und Langres.
Da Érard de Brienne nicht einmal ansatzweise derart zahlreiche und illustre Bundesgenossen hatte, wäre die Auseinandersetzung gewiss frühzeitig zu Ende gewesen – wenn nicht Herzog Thiébaut von Oberlothringen in seiner unendlichen Weisheit beschlossen hätte, für Érard Partei zu ergreifen. Warum er das getan hatte, darüber rätselte man im Heiligen Römischen Reich seit Monaten. Vielleicht, weil zur Gegenseite auch der Graf von Bar gehörte und Thiébaut die Gelegenheit nutzen wollte, seinem alten Widersacher auf dem Schlachtfeld zu begegnen. Was Thiébaut dabei nicht bedacht hatte: Sein eigener Lehnsherr und König, Friedrich II., hatte gerade sein Bündnis mit der französischen Krone erneuert. Folglich wertete Friedrich Thiébauts Verhalten als Verrat, bezichtigte den Herzog der Felonie und überzog Lothringen mit Krieg – wegen einer Sache, die das Herzogtum im Grunde nicht das Geringste anging.
Michels Heimatstadt Varennes-Saint-Jacques war glücklicherweise von den Kämpfen verschont geblieben. Der Rat der Zwölf, der die Geschicke der Stadt lenkte, konnte jedoch nicht verhindern, dass sie in die Fehde hineingezogen wurden. Denn Varennes war dem König zur Heerfolge verpflichtet. Also hatte der Rat eine Kampftruppe aufgestellt, bestehend aus vierzig Freiwilligen, die an Friedrichs Seite gegen Thiébaut zog. In den vergangenen Wochen hatte Michel Nacht für Nacht gebetet, dass die Männer gesund und wohlbehalten heimkehren würden. Inzwischen wusste er, dass Gott seine Gebete nicht erhört hatte.
Am frühen Abend erblickten sie die Burg, die über der kleinen Siedlung Amance aufragte. Es war eine imposante Anlage, deutlich größer und wehrhafter als die Festungen der gemeinen lothringischen Ritter. Weithin sichtbar flatterten auf ihren Türmen die Farben des Hauses Châtenois, der rote Schrägbalken mit den drei silbernen Adlern. Die Burg befand sich also noch in der Hand des Herzogs.
Michel und seine Knechte trieben ihre Pferde an und kanterten zu der Zeltstadt, die sich neben dem Bauerndorf erstreckte.
»Wo lagert das Aufgebot von Varennes-Saint-Jacques?«, fragte Michel einen Kriegsknecht, der sich neben dem Gehege für die Schlachtrösser auf seine Lanze stützte.
»Tut mir leid, Herr, ich versteh kein Lothringisch«, erwiderte der Mann auf Deutsch mit schwäbischem Zungenschlag. Offenbar ein Krieger aus dem Gefolge des Königs, der wie sein Vater und sein Großvater dem Haus der Staufer entstammte. Glücklicherweise beherrschte Michel die Sprache der Deutschen beinahe ebenso gut wie seine Muttersprache. Er wiederholte die Frage.
»Die Gasse zwischen den Zelten entlang, bis es nicht mehr weitergeht, und dann rechts«, antwortete der Wachposten. »Gleich neben dem Aufgang zum Burgtor. Ihr könnt’s nicht verfehlen.«
»Hab Dank, Freund. Gott segne dich.« Sie stiegen ab und führten die Pferde an den Zügeln, während sie an den Zelten vorbeischritten. Der König hatte wahrlich ein beeindruckendes Heer zusammengezogen, und Michel vernahm eine Vielzahl von Sprachen und Dialekten. Unter Friedrichs Banner kämpften nicht nur Deutsche und Franzosen, sondern auch Sizilianer und Apulier. Wobei das bei näherer Betrachtung nicht verwunderlich war, hatte der König doch den größten Teil seines jungen Lebens im Süden Italiens verbracht. Er war erst vor wenigen Jahren über die Alpen gekommen, um sein königliches Erbe anzutreten. »Der apulische Knabe« wurde er mal spöttisch, mal liebevoll genannt.
Das Lager der Krieger aus Varennes bestand aus sechs Zelten, vor denen zwei Pferde grasten. Es schien niemand da zu sein, abgesehen von einem Schustergesellen namens Hugo, der neben einem Karren hockte. Er trug einen Verband um den Schädel und bot ein Bild des Elends. Als er Michel erblickte, sprang er auf.
»Herr Bürgermeister! Was macht Ihr denn hier?«
»Wo sind die anderen?«, fragte Michel.
»Die eine Hälfte ist bei den Verwundeten. Die andere besorgt etwas zu essen.«
»Und euer Hauptmann?«
Hugo zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, wo er steckt. Er ist seit heute früh verschwunden.«
Wenn du abgehauen bist, Lefèvre, sorge ich dafür, dass man dich jagt und am erstbesten Baum aufknüpft.
Michel übergab Louis sein Pferd und trat zu Hugo an den Karren, auf dem sieben in grobes Leinen eingeschlagene Körper lagen. Seine Kehle wurde eng.
»Ich soll sie begraben«, murmelte Hugo kaum hörbar. »Aber ich bring’s einfach nicht über mich. Sie hier zu verscharren – das ist doch nicht richtig. Sie gehören auf die Kirchhöfe ihrer Pfarreien.«
»Wer ist es?«
»Zwei Tagelöhner. Weiß nicht, wie sie heißen. Hab sie nie nach dem Namen gefragt. Jean-Pierre von den Metzgern. Arnaut von den Webern. Bruno und Robert von den Schmieden.« Hugos Stimme wurde immer leiser. »Und Alain Caboche.«
Jeans Sohn. Allmächtiger! Michel schloss für einen Moment die Augen. »Wann ist das passiert?«
»Heute früh. Sat…, der Hauptmann wollte, dass wir das Burgtor angreifen. Es hat nicht geklappt«, fügte Hugo hinzu.
»Zeig ihn mir«, verlangte Michel.
Mit zusammengekniffenen Lippen schlug der Schustergeselle das Tuch zurück. Michel rang mit den Tränen – Tränen der Trauer und des Zorns. Er war gerade einmal achtzehn Jahre alt. Er wollte heiraten. Wenigstens war er nicht verstümmelt worden. Offenbar hatte ein Armbrustbolzen sein Panzerhemd durchschlagen. Michel war kein Medicus, doch die Wunde in Alains Brust sah aus, als wäre der Junge direkt ins Herz getroffen worden. Gewiss hatte er nicht lange gelitten.
»Wollt Ihr die anderen auch sehen?«
Michel überhörte die Frage. »Erzähl mir, wie es geschehen ist.«
Hugo bedeckte Alain wieder mit dem Leichentuch. »Es gab einen Angriff auf das Vorwerk der Burg. Der Graf von Bar wollte die Mauern mit Leitern erstürmen, aber seine Männer mussten sich zurückziehen. Die Verteidiger waren einfach zu stark. Trotzdem hat uns der Hauptmann befohlen, mit dem Rammbock und Leitern zum Tor zu laufen, damit uns der König reich belohnt, wenn wir das Vorwerk einnehmen.«
»Hat er das so gesagt?«
Hugo nickte geistesabwesend. »Alain hat ihn gewarnt, dass das zu gefährlich ist. Es gab Streit deswegen, und beinahe hätte er Julien umgebracht. Der Hauptmann, meine ich, nicht Alain. Jedenfalls hat er uns gezwungen, ganz allein anzugreifen, ohne die anderen Krieger. Weit sind wir nicht gekommen. Kaum waren wir raus aus der Deckung, wurden wir beschossen.«
Mit jedem Satz, den er vernahm, wurde Michel zorniger. Er hatte gewusst, dass Lefèvre achtlos mit den Männern umsprang – ein Bote des Rates hatte es ihm vor zwei Tagen berichtet, woraufhin er sofort aufgebrochen war, um dem Treiben des Hauptmanns ein Ende zu machen. Doch was Hugo gerade erzählte, übertraf seine schlimmsten Erwartungen.
»Es ist alles meine Schuld«, sagte Hugo. »Hätte ich mich nicht so ungeschickt angestellt, wäre Alain noch am Leben.«
»Hör auf damit. Die Schuld an Alains Tod trägt allein der Hauptmann. Du gehst jetzt los und holst die Männer. Wenn du sie gefunden hast, sucht ihr Lefèvre und bringt ihn her.«
ENDE DER LESEPROBE