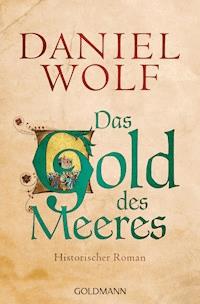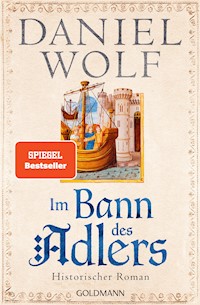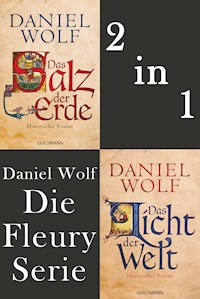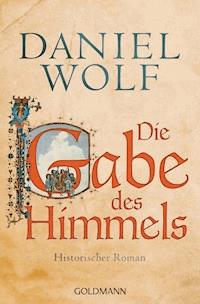9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Fleury-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein grandioses Mittelalter-Epos ... um Liebe, Freiheit und das weiße Gold!
Herzogtum Oberlothringen, 1187. Nach dem Tod seines Vaters übernimmt der junge Salzhändler Michel de Fleury das Geschäft der Familie. Doch seine Heimatstadt Varennes leidet unter einem korrupten Bischof und einem grausamen Ritter, der die Handelswege kontrolliert – es regieren Armut und Willkür. Als Michel beschließt, Varennes nach dem Vorbild Mailands in die Freiheit zu führen, steht ihm ein schwerer Kampf bevor. Seine Feinde lassen nichts unversucht, ihn zu vernichten. Nicht einmal vor Mord schrecken sie zurück. Und schließlich gerät sogar seine Liebe zur schönen Isabelle in Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1505
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Daniel Wolf
––––––––––––––––––––––––––––––––
Das Salz der Erde
Historischer Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Juli 2013
Copyright © 2012 by Wilhelm GoldmannVerlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Gestaltung des Umschlags und der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: Initiale: Bridgeman Art Library, Psalm 68, initial S, Jonah praying to Christ on his exit from the whale & Jonah thrown to the whale, illstration from the ›De Braile Psalter‹ / Primary creator: Brailes, William de (fl.c. 1230)/Ort: © Courtesy of the Warden and Scholars of New College, Oxford;Pergament: © FinePic®, München
Umschlaginnenseiten: © FinePic®, München
Redaktion: Eva Wagner
BH · Herstellung: Str.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-10596-9V005
www.goldmann-verlag.de
»Der Kaufmann dringt in die Geheimnisse der Erde ein, bereist nie gesehene Küsten, durchmustert raue Wüsten und pflegt mit barbarischen Stämmen in unbekannten Sprachen freundschaftlichen Handelsverkehr. Sein Eifer einigt Völker, dämpft Kriege und festigt den Frieden.«
(Hugo von St. Viktor, 12. Jahrhundert)
Herzogtum Oberlothringen
Dramatis Personae
VARENNES-SAINT-JACQUES
Michel de Fleury, ein Kaufmann der Gilde
Jean de Fleury, Michels jüngerer Bruder
Vivienne, ihre Schwester
Rémy, ihr Vater
Gaspard Caron, ein Kaufmann der Gilde
Isabelle Caron, Gaspards Schwester
Marie, ihre Mutter
Lutisse, Gaspards Gemahlin
Ministerialen und Mitglieder der Gilde:
Jaufré Géroux, Vorsteher
Guibert de Brette
Robert Laval
Jacques Nemours
Aimery Nemours
Kaufleute der Gilde:
Charles Duval
Marc Travère
Raymond Fabre
Fromony Baffour
Pierre Melville
Abaëlard Carbonel
Thibaut d’Alsace
Ernaut Baudouin
Stephan Pérouse
Raoul Vanchelle
sowie Catherine Partenay
Tancrède Martel, der städtische Schultheiß
Frédégonde, Magistra des Beginenhofs
Jean Caboche, Schmiedemeister und Oberhaupt seiner Bruderschaft
Archambaud Leblanc, Stadtbauer und Oberhaupt seiner Bruderschaft
Isoré Le Roux, ein Kleinkrämer
Adel und Klerus
Ulman, der Bischof von Varennes-Saint-Jacques
Aristide de Guillory, ein lothringischer Ritter
Renard de Guillory, sein Vater
Berengar, sein Sarjant
Nicolas de Bézenne, ein lothringischer Ritter, Aristides Feind
Renouart de Bézenne, Nicolas’ erstgeborener Sohn
Pater Jodocus, ein Priester
Speyer und Vogtei Altrip
Eberold, ein Speyerer Kaufmann, Gaspards und Isabelles Onkel
Galienne, seine Gemahlin
Thomasîn, ein Freisasse
Winand und Boso, seine Knechte
Historische Personen
Friedrich I., genannt »Barbarossa«, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
Heinrich VI., Barbarossas Sohn, späterer Kaiser
Folmar von Karden, Erzbischof von Trier
Johann I., Archidiakon der Erzdiözese Trier, Kanzler Kaiser Friedrichs
Simon II. Châtenois, Herzog von Lothringen
Ferry I. de Bitche, Simons Bruder, ein lothringischer Adliger
Ferry II. de Bitche, sein Sohn
Philipp von Schwaben, König des Heiligen Römischen Reiches ab 1198
Otto von Braunschweig, Gegenkönig und Philipps Rivale
Mathieu de Lorraine, Bischof von Toul
Walram von Limburg, ein deutscher Adliger
Sonstige
Salvestro Agosti, ein reicher Kaufmann aus Mailand
Conon, ein Wollweber aus Metz
Saint Jacques, der Schutzheilige von Varennes
Grimald, Archidiakon Johanns Leibdiener
Namus, Bischof Ulmans Leibdiener
Eine Anmerkung zu den Namen: Im Hochmittelalter war der Namenszusatz »de« bzw. »von« noch kein Adelsprädikat (das wurde er in Deutschland und Frankreich erst in der frühen Neuzeit), er verwies meist nur auf den Ort, aus dem eine Person stammte. In den Städten hatten viele Bürger bereits im 12. Jahrhundert »richtige« Familiennamen.
Im Anhang befindet sich ein Glossar der im Roman verwendeten historischen Begriffe.
Prolog
Dezember 1173
HERZOGTUM OBERLOTHRINGEN
Zwei Wochen vor Weihnachten beging Michel zum ersten Mal in seinem jungen Leben ein Verbrechen.
Gefrorener Schnee bedeckte die Felder, umhüllte Sträucher und Baumkronen und lastete schwer auf den Hüttendächern. Es war der härteste Winter seit vielen Jahren. Der einäugige Odo behauptete gar, es sei der kälteste aller Zeiten. »Und ich weiß auch, wer uns das eingebrockt hat«, hatte er erst gestern verkündet. »Barbarossa! Ja, unser Herr Kaiser ist schuld. Hätte er den Papst nicht herausgefordert, wäre das nicht passiert. Das haben wir jetzt von seiner Streitsucht. Gott straft uns mit Eis und Schnee und bitterer Kälte, und er wird erst aufhören, wenn Barbarossa endlich mit der Kirche Frieden schließt.«
Odo musste es wissen: Er saß von morgens bis abends in der Schenke unten bei der Kreuzung und lauschte den Nachrichten der fahrenden Händler und Scholaren aus Metz und Varennes-Saint-Jacques, während er seine alten Knochen am Kaminfeuer wärmte.
Gleich nach dem Morgenbrot stahlen sich Michel und sein Bruder Jean von zu Hause fort und stapften den Hügel hinauf, vorbei an der Dorfkirche und dem kleinen Friedhof, auf dem ihre Mutter begraben lag. Am Waldrand verließen sie den Trampelpfad und schlichen durch das Unterholz, damit Pierre sie nicht schon von Weitem kommen sah. Pierre war der Köhler von Fleury, ein hagerer Kerl, der in einer einsamen Kate zwischen den turmhohen Fichten hauste und sich nur selten im Dorf blicken ließ. Michel wusste aus zuverlässiger Quelle, dass er in seinem Schuppen zahlreiche Krüge mit köstlichen, in Honig eingelegten Pflaumen und Birnen aufbewahrte. Er bekam Bauchschmerzen, wenn er nur daran dachte, denn er hatte seit Wochen nur Hirsegrütze und trockenes Brot gegessen. Doch Pierre, der alte Geizhals, würde ihnen niemals etwas abgeben – darauf konnten sie warten, bis sie schwarz wurden. Wenn sie etwas von den Früchten haben wollten, mussten sie in den Schuppen einbrechen und sich welche holen.
Die Sache war nicht ganz ungefährlich. Der Köhler hasste Kinder. Als sie sich das letzte Mal bei seiner Hütte herumgetrieben hatten, hatte er sie mit Kastanien beworfen und schimpfend zum Teufel gejagt. Wenn er sie in seinem Schuppen erwischte, würde er sie gewiss grün und blau schlagen, wie Robert, den Sohn des Schmieds, der im Sommer Pierres Katze in eine Jauchegrube geworfen hatte.
Einen Steinwurf von der Köhlerkate entfernt bemerkte Michel, dass sein Bruder nicht mehr hinter ihm war. Er wandte sich um und entdeckte ihn zwischen den Büschen am Fuß der Böschung, wo er in seinem Beutel herumwühlte.
»Jean!«, rief er leise.
»Ich komm ja schon.« Hastig kämpfte sich sein Bruder durch den Schnee die Böschung hinauf. Er war erst sechs Jahre alt, zwei Jahre jünger als Michel, aber nicht viel kleiner und schwächer. Zu Michels großem Verdruss schlug Jean nach ihrem stämmigen und hochgewachsenen Vater, während er selbst unverkennbar nach ihrer Mutter kam, die schlank und zierlich gewesen war.
»Was hast du da?«, fragte er, als er sah, dass Jean etwas in der Hand hielt.
»Eine Maulwurfspfote. Odo hat sie mir gegeben. Es ist ein Amlu… ein Alu…«
»Ein Amulett?«
»Ich soll es immer bei mir tragen, wenn ich in den Wald gehe«, erklärte Jean. »Damit die Faune mir nichts tun.«
»Vater sagt, es gibt keine Faune.«
»Natürlich gibt es sie. Man kann sie nur nicht sehen. Sie verstecken sich vor den Menschen.«
»Leise!«, zischte Michel. »Willst du, dass Pierre uns hört?«
Sie schlichen durch das Gebüsch. Michel wünschte, Jean hätte nicht von Faunen angefangen, denn nun fühlte er sich aus dem Unterholz von unsichtbaren Augen beobachtet.
Als Pierres Kate in Sicht kam, duckten sie sich.
Die kleine Hütte hatte, wie die meisten Gebäude in Fleury, Wände aus aufgeschichteten Feldsteinen und ein Dach aus Stroh. Aus dem Kamin kräuselte sich eine dünne Rauchfahne, ebenso aus dem Schacht des Kohlenmeilers, der wie ein altertümlicher Grabhügel aus der Wiese vor dem Gemüsegarten wuchs. Neben dem Meiler stand der windschiefe Schuppen, in dem Pierre die Honigfrüchte aufbewahrte.
Kein Geräusch störte die Stille des Waldes.
»Pierre ist nicht da«, flüsterte Michel.
»Vielleicht ist er drinnen.«
»Glaub ich nicht. Morgens geht er immer Holz sammeln. Er kommt frühestens heute Mittag zurück.«
Michel pirschte sich an die Hütte heran, gefolgt von Jean, der seine Maulwurfspfote fest umklammert hielt. Sie versteckten sich hinter einem Stapel Feuerholz und beobachteten die Kate aus der Nähe. Im Schnee vor der Tür waren frische Spuren zu sehen, die in den Wald führten.
»Siehst du? Er ist fortgegangen.«
»Da!«, keuchte Jean, als ein Schatten hinter dem Schuppen hervorhuschte.
»Das ist nur die Katze«, sagte Michel.
Das Tier blickte argwöhnisch zum Feuerholzstapel, bevor es durch einen Spalt im Mauerwerk schlüpfte.
Jeans Stimme zitterte leicht. »Lass uns zum Dorf zurückgehen.«
»Wir gehen erst, wenn wir die Früchte haben«, sagte Michel entschlossen, obwohl er sich in Wahrheit genauso sehr fürchtete wie sein Bruder. Pierre mit seiner verbrannten Wange und seinem stinkenden Kittel aus Fell- und Lederstücken jagte ihm eine Heidenangst ein, und ihm fiel wieder ein, dass Odo einmal gesagt hatte, Pierres Großvater stamme von Waldschraten ab. Er hatte diese Geschichte immer für Unsinn gehalten, aber jetzt war er sich plötzlich nicht mehr so sicher. Pierre hatte tatsächlich einiges von einem Waldschrat an sich, den krummen Rücken etwa oder die prankenhaften Hände … und sagte man diesen Geschöpfen nicht nach, sie fräßen Kinder?
Michel unterdrückte ein Schaudern. Allein der Gedanke an die honigsüßen Pflaumen und Birnen hielt ihn davon ab aufzugeben und zu fliehen.
»Du wartest hier«, sagte er zu Jean und rannte über die Wiese. Als er die Schuppentür erreichte, wurde ihm schlagartig klar, dass ihr Plan eine entscheidende Schwäche aufwies: ihre Spuren. Wegen des Schnees würde Pierre sofort wissen, dass jemand während seiner Abwesenheit in den Schuppen eingedrungen war, und natürlich würde er die Kinder Fleurys verdächtigen. Aber daran ließ sich nun nichts mehr ändern. Vielleicht hatten sie Glück, und es fing wieder an zu schneien, bevor der Köhler zurückkam.
Vorsichtig zog Michel den primitiven hölzernen Riegel zurück und öffnete die Tür.
Der Schuppen enthielt zwei Fässer, eine große Kiste und mehrere Säcke mit Getreide und Erbsen. Michel fasste sich ein Herz und schlüpfte hinein.
Es dauerte nicht lange, bis er die eingelegten Früchte fand: Pierre verwahrte sie in einer zweiten Kiste, die hinter den Fässern stand. Michel öffnete eines der irdenen Gefäße. Beim Anblick der Honigpflaumen lief ihm das Wasser im Mund zusammen, und er konnte nicht widerstehen, eine Frucht herauszufischen und sie sich in den Mund zu stecken.
Voller Wonne schloss er die Augen. Es musste Monate her sein, dass er das letzte Mal etwas derart Köstliches gegessen hatte. Einen Moment lang erwog er, so viele Krüge mitzunehmen, wie er tragen konnte. Doch dann regte sich sein Gewissen. Er wollte Pierre nicht ernstlich schaden. Ein Krug genügte.
Er presste den Deckel auf das Gefäß, schloss die Schuppentür und huschte zu Jean zurück.
»Zeig her!«, sagte sein Bruder aufgeregt und griff nach dem Krug.
»Wir essen sie, wenn wir im Dorf sind.«
»Du hast schon eine gegessen – ich hab’s gesehen. Lass mich auch!« Jean versuchte, ihm den Krug wegzunehmen, und sie begannen zu rangeln. »Immer willst du mir alles verbieten!«
»Wenn es dir nicht passt, hol dir einen eigenen Krug. Aber du traust dich ja nicht …«
Sie erstarrten, als Geräusche ertönten.
Stimmen. Knackende Zweige.
Knirschende Schritte.
»Kopf runter!«, stieß Michel hervor.
Sie duckten sich hinter dem Holzstapel und beobachteten den Waldrand. Zwischen den Bäumen erschien Pierre und stolperte den Pfad entlang. Der Köhler sah schrecklich aus: das verbrannte Gesicht zerschlagen, das linke Auge geschwollen, der Kittel blutverschmiert. Außerdem hatte ihm irgendjemand mit einem Lederriemen die Hände gefesselt.
Ihm folgten zwei Männer, die ihm hin und wieder einen groben Stoß versetzten. Anhand ihrer Eisenhelme und Waffenröcke erkannte Michel sie als Kriegsknechte Guiscard de Thessys.
Er biss sich auf die Unterlippe. Es fiel ihm nicht schwer zu erraten, was geschehen war: Man hatte Pierre beim Wildern erwischt. Im Dorf fürchtete man schon lange, dass es eines Tages so kommen würde. Es war ein offenes Geheimnis unter den Bewohnern Fleurys, dass Pierre gelegentlich mit seiner Schleuder durch das Unterholz streifte, um heimlich einen Hasen, ein Rebhuhn oder gar einen Frischling zu erlegen. Dabei war es den Leibeigenen bei Strafe verboten, in den Wäldern der Allmende zu jagen. Allein der Herzog und seine Vasallen hatten das Recht dazu.
Zu guter Letzt tauchte ein Reiter auf. Michels Magen zog sich zusammen. Guiscard de Thessy saß mit gekrümmtem Rücken auf seinem Schlachtross, in einen Wollumhang gehüllt, der ihn vor der beißenden Kälte schützte. Der grobe Stoff fiel über das Schwert, das er am Gürtel trug, und wegen der Kapuze sah man von seinem Antlitz lediglich den wuchernden, von grauen Strähnen durchsetzten Bart. Er war ein Ritter des Herzogs und der Herr von Fleury – und auf der ganzen Welt gab es nichts und niemanden, vor dem Michel mehr Angst hatte.
Er betrachtete den Krug in seiner Hand. Nicht auszudenken, was Guiscard tun würde, wenn er sie mit den gestohlenen Früchten erwischte. Hastig vergrub er das Gefäß im Schnee. Jean bekam davon nichts mit. Mit aufgerissenen Augen beobachtete er die beiden Kriegsknechte und Guiscard, die sich mit ihrem Gefangenen der Hütte näherten.
»Wir müssen sofort hier weg«, flüsterte Michel ihm zu.
Bevor die Männer sie sehen konnten, huschten sie über die Wiese und am Kohlenmeiler vorbei und schlüpften durchs Gebüsch, bis sie zu dem Weg kamen, der am Waldrand entlangführte. Dort begannen sie zu rennen, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her. Nur einmal warf Michel einen Blick über die Schulter. Guiscard und seine Kriegsknechte schienen sie nicht zu verfolgen.
Schließlich erreichten sie die Kirche und kurz darauf Fleury, ihr Heimatdorf, das in einer Senke zwischen den Hügeln lag. Etwa die Hälfte der rund dreißig Bauernhäuser umstanden einen weitläufigen Platz, auf dem die Dörfler ihrer Arbeit nachgingen. Julien, der Schmied, zertrümmerte mit einer Stange das Eis im Ziehbrunnen. Am Backofen des Dorfes buken mehrere Frauen Brot und tauschten dabei den neuesten Klatsch aus.
Michel und Jean hasteten zu ihrer Hütte, vor der ihr Vater, ein blonder, breitschultriger Mann, gerade Holz hackte. Sein Atem dampfte in der eiskalten Luft. Neben ihm spielte ihre zweijährige Schwester Vivienne im Schnee.
»Wo habt ihr euch denn wieder herumgetrieben?«, fragte er. »Ich habe euch doch gesagt, dass ihr den Schweinestall sauber machen sollt.«
»Pierre«, keuchte Michel. »Haben ihn gefesselt … Guiscard … beim Wildern erwischt …«
Sein Vater ließ die Axt sinken und runzelte die Stirn. »Guiscard hat Pierre beim Wildern erwischt?«
Michel nickte.
»Wieso weißt du davon? Hast du es gesehen?«
Als Michel zu einer gestammelten Antwort ansetzte, sagte sein Vater: »Jetzt komm erst einmal zu Atem. Dann erzählst du mir der Reihe nach, was passiert ist.«
Bevor Michel anfangen konnte, erschienen Guiscard, seine Männer und der unglückliche Pierre auf dem Pfad, der neben der Kirche den Hügel hinabführte. Mit der Axt in der Hand trat Michels Vater auf den Platz, um besser sehen zu können. Auch die anderen Dorfbewohner unterbrachen ihre Arbeit und reckten die Hälse.
Die beiden Kriegsknechte zerrten Pierre auf den Dorfplatz, und neben dem Brunnen versetzte ihm einer der Männer einen Tritt in die Kniekehlen. Wegen seiner Handfesseln konnte der Köhler den Sturz nicht abfangen und fiel mit dem Gesicht voran in den Schnee. Er wimmerte leise, machte jedoch keinen Versuch aufzustehen.
Niemand eilte ihm zu Hilfe. Mit der Ankunft der Männer hatten die Dorfbewohner eilends den Platz verlassen. Nun standen sie furchtsam vor ihren Hütten und beobachteten schweigend das Geschehen.
Guiscard zügelte sein Pferd und warf zwei tote Kaninchen in den Schnee. Die Stimme, die daraufhin aus der Kapuze drang, war rau und dunkel, beinahe wie das Knurren eines Raubtiers.
»Dieser Lump hat es gewagt, in der Allmende zu wildern und diese Hasen zu erlegen. Damit hat er uns alle bestohlen – euch, mich und Seine Gnaden Herzog Matthäus. Offenbar glaubt er, das Gesetz gelte nicht für ihn. Seht her, was mit jenen geschieht, die den Wildbann brechen.«
Der Ritter gab seinen Kriegsknechten einen Wink, woraufhin die beiden Männer Pierre an den Armen packten und auf die Füße zerrten.
»Habt Erbarmen, Herr, ich bitte Euch«, flehte der Köhler, während aus seiner gebrochenen Nase Blut sickerte.
»Geht ins Haus«, befahl Michels Vater.
Ohne zu zögern ergriff Michel die Hand seiner Schwester, die aussah, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Jean machte keine Anstalten, ihm zu folgen. Mit fasziniertem Entsetzen betrachtete er die Kriegsknechte, die Pierre über den Platz führten.
»Jetzt komm!«, zischte Michel.
Widerwillig schlüpfte sein Bruder nach ihm in die Hütte. »Glaubst du, sie werden Pierre hängen?«, fragte er, nachdem Michel die Tür geschlossen hatte. »Glaubst du’s?«
Michel hoffte inständig, dass Pierre eine mildere Strafe bekam. Zwar konnte er den Köhler nicht ausstehen, aber deswegen wünschte er ihm noch lange nicht den Tod. Ohne Jean eine Antwort zu geben, durchquerte er den vorderen Teil der Hütte, in dem sich der Koben mit dem Schwein der Familie befand, und setzte Vivienne auf eines der beiden Schlaflager neben der Feuerstelle. Es bestand aus Fellen und groben Wolldecken auf einem schlichten Holzgestell und war breit genug, dass die drei Geschwister darin schlafen konnten.
»Nicht weinen«, sagte er, als das Mädchen zu schluchzen begann. »Du musst keine Angst haben.« Er gab ihr ihre Puppe. »Schau mal, hier ist Joie. Spiel ein bisschen mit ihr, ja?«
Vivienne weinte ständig, meist ohne ersichtlichen Grund, und manchmal hatte Michel nicht übel Lust, sie dafür zu ohrfeigen. Er tat es jedoch nie. Er hätte es niemals zugegeben, aber er liebte seine jüngeren Geschwister, und es machte ihm nichts aus, auf sie aufzupassen. Seit dem plötzlichen Tod ihrer Mutter vor knapp zwei Jahren war das seine Pflicht, und er nahm sie sehr ernst.
Glücklicherweise beruhigte sich Vivienne und war kurz darauf in ihr Spiel vertieft. Michel ging zu Jean zurück, das Schwein ignorierend, das ihm in der Hoffnung auf Futter seine Schnauze entgegenstreckte.
»Sie binden ihn an!«, stieß Jean hervor, der den Dorfplatz durch eines der Luftlöcher in der Hauswand beobachtete. Wie die meisten Hütten Fleurys besaß auch ihre keine richtigen Fenster.
Michel pulte das Stroh aus einem anderen Mauerspalt und spähte nach draußen. Die Kriegsknechte hatten Pierre zur Dorfschenke gebracht, wo sie seine Fesseln durchschnitten und seine Hände an einem Balken des vorspringenden Daches festbanden.
Guiscard stieg aus dem Sattel, in der Hand eine Birkenrute. Er schlug die Kapuze zurück, wodurch sein kahler und vernarbter Schädel zum Vorschein kam. Als er zur Schenke schritt, knirschte der Schnee unter seinen Stiefeln.
»Herr, wartet – bitte«, sagte Michels Vater.
Guiscard wandte sich um und starrte ihn an. Michel hatte diesen Blick schon oft gesehen. Du hast kein Recht, mich anzusprechen, schien er zu sagen. Du bist Abschaum, weniger wert als der Dreck an meinen Sohlen. Ich sollte dich für diese Unverschämtheit töten. Guiscard schaute alle Leibeigenen auf diese Weise an.
Michels Vater ließ sich jedoch nicht einschüchtern. »Es ist ein harter Winter, Herr«, sagte er. »Pierre hat gewildert, damit er nicht hungern muss. Habt Gnade mit ihm, und wir werden dafür sorgen, dass er es nicht wieder tut.«
Michel kaute auf seiner Lippe. Guiscards Faust ballte sich um die Birkenrute, als erwäge er, anstelle des Köhlers Michels Vater zu züchtigen.
»Es spielt keine Rolle, warum er es getan hat«, erwiderte der Ritter harsch. »Gesetz ist Gesetz, und es gibt keine Ausnahmen. Wann lernt ihr Hörigen das endlich?«
Mit schweren Schritten ging er zur Schenke. Einer der Kriegsknechte zückte einen Dolch, zerschnitt Pierres Kittel und entblößte den bleichen Rücken des Köhlers.
Guiscard holte aus. Pierre schrie vor Schmerz, als die Birkenrute auf seine Haut klatschte. Wieder und wieder schlug der Ritter zu, sodass Pierres Rücken bald von blutigen Striemen überzogen war. Obwohl Michel den Anblick kaum noch ertrug, war er nicht imstande, sich abzuwenden. Mit angehaltenem Atem saß er da und spähte durch das Mauerloch, wie gebannt von dem schrecklichen Geschehen vor der Schenke.
Erst als Vivienne zu weinen anfing, konnte er sich losreißen. Er setzte sich zu ihr aufs Schlaflager und redete beruhigend auf sie ein. Es half nichts – sie weinte nur umso heftiger. Michel wusste sich nicht anders zu helfen, als ihr die Ohren zuzuhalten, damit sie Pierres Schreie nicht mehr hören musste.
Irgendwann verstummte der Köhler.
»Was ist passiert?«, fragte Michel seinen Bruder, der immer noch durch das Luftloch lugte.
»Der Herr hat aufgehört«, antwortete Jean.
»Und Pierre – ist er … ist er tot?«
»Ich weiß nicht …«
Viviennes Angst hatte sich etwas gelegt, und sie weinte nicht mehr. Michel gab ihr ihre Puppe, eilte zum Mauerspalt und blickte zur Schenke. Pierre hing reglos an seinen Fesseln, sein Rücken eine einzige Wunde. Ob er tot war oder nur ohnmächtig, konnte Michel nicht erkennen. Einer der Kriegsknechte grinste die Dorfbewohner verächtlich an.
Guiscard warf die Birkenrute in den Schnee und stieg in den Sattel. »Schneidet ihn los«, befahl er.
Michels Vater und zwei weitere Dorfbewohner, Jacques und Renier, liefen zu Pierre und lösten seine Fesseln. Der Köhler stöhnte, als die drei Männer ihn bäuchlings auf den Boden legten. Michels Vater murmelte etwas, und Renier eilte über den Platz.
»Der Nächste, den ich beim Wildern erwische, kommt nicht so glimpflich davon«, sagte Guiscard. »Er wird hängen, so wahr mir Gott helfe. Also lasst euch das verdammt noch mal eine Lehre sein.«
Der Ritter gab seinem Pferd die Sporen und ritt von dannen. Seine Kriegsknechte folgten ihm im Laufschritt.
Endlich erwachten die Dörfler aus ihrer Erstarrung. Sie strömten zur Schenke und redeten aufgebracht durcheinander. Die eine Hälfte beschimpfte Pierre für seine Dummheit, die andere machte ihrer Wut über die überzogene Strafe Luft. Der alte Odo schüttelte gar die Faust in Richtung der Hügel, wo Guiscards Landgut stand, und rief ein paar äußerst derbe Flüche.
»Halt den Mund, Dummkopf!«, brachte Julien ihn zum Schweigen. »Oder willst du auch halbtot geprügelt werden?«
Kurz darauf kam Renier zurück. Bei ihm war Eloise, die Hebamme, die wie immer ihren weiten, tausendmal geflickten Kittel trug. Michel war froh, dass man sie geholt hatte. Von allen Bewohnern der Hügel verstand sie am meisten von Heilkunst. Als Michel im vergangenen Winter krank gewesen war, hatte die Hebamme ihm einen Kräutertrunk gebraut, der scheußlich geschmeckt, ihn aber binnen zwei Tagen von seinem Fieber kuriert hatte. Bei ihr war Pierre in guten Händen.
»Aus dem Weg«, sagte sie mit befehlsgewohnter Stimme, woraufhin die Dorfbewohner ihr Platz machten.
Michels Vater und Jacques hatten Pierres Rücken derweil mit Stoffstreifen verbunden. Eloise sah sich die Arbeit an und nickte knapp. »Bringt ihn in meine Hütte.«
Jemand holte eine Trage aus Weidenzweigen; Jacques und Renier legten den Verletzten darauf und trugen ihn weg. Pierre war bei Bewusstsein, doch Michel sah den fiebrigen Glanz in seinen Augen. Er brauchte dringend Hilfe.
Nachdem Eloise gegangen war, zerstreuten sich die Dörfler allmählich, verschwanden in ihren Hütten oder setzten bedrückt ihre Arbeit fort. Michels Vater redete noch eine Weile mit seinem Freund Julien, ehe er mit grimmiger Miene zur Hütte schritt.
Michel und Jean verstopften hastig die Luftlöcher und taten so, als hätten sie nichts gesehen und gehört.
»Macht endlich den Schweinekoben sauber«, befahl ihr Vater, als er hereinkam.
Das war das Letzte, was er an diesem Morgen zu ihnen sagte. Er verlor kein Wort über Pierres Bestrafung und saß bis mittags mürrisch und brütend am Herdfeuer.
Seit Michels Mutter gestorben war, verfiel sein Vater, eigentlich ein fröhlicher und offener Mann, oft in stundenlanges Grübeln, und Michel hatte sich inzwischen daran gewöhnt. Doch so düster wie heute war seine Stimmung schon lange nicht mehr gewesen, und Michel wagte nicht, ihn anzusprechen, obwohl er gerne gefragt hätte, ob Pierre wieder gesund werden würde.
Nach dem Mittagsmahl, das sie schweigend einnahmen, verließ sein Vater die Hütte und kam eine halbe Stunde später mit Julien zurück.
»Geht nach draußen spielen«, forderte er Michel und Jean auf. »Julien und ich haben etwas zu bereden. Nehmt Vivienne mit.«
Michel bemerkte, dass der Schmied einen Lederbeutel über der Schulter trug, in dem ein länglicher Gegenstand steckte. Während die beiden Männer nach hinten gingen, verließen Jean, Vivienne und er die Hütte und begannen lustlos, einen Schneemann zu bauen. Julien blieb jedoch nicht lange. Kurz darauf öffnete er die Tür und scheuchte das Schwein ins Freie.
»Wieso nimmt Julien unser Schwein mit?«, fragte Michel seinen Vater, als der Schmied das Tier zu seinem Haus trieb.
»Ich habe es ihm verkauft.«
»Warum?«
»Wir brauchen es nicht mehr«, antwortete sein Vater.
Verwirrt blickte Michel dem Schmied nach. Sie hatten das Schwein seit dem Frühjahr gemästet und wollten es nächste Woche schlachten, damit sie Fleisch für den restlichen Winter hatten – und nun gab sein Vater es einfach weg?
Der breitschultrige Mann ging neben Michel in die Hocke. »Hör zu«, sagte er. »Ich möchte, dass ihr heute früh schlafen geht. Bevor es dunkel wird, liegt ihr im Bett, verstanden?«
Michel nickte. Das Verhalten seines Vaters erschien ihm immer merkwürdiger.
Im Verlauf des Nachmittags leerte sich der Dorfplatz. Die meisten Bewohner Fleurys waren Bauern wie Michels Vater, für die es während der Wintermonate außerhalb der eigenen vier Wände nicht viel zu tun gab, weshalb sie sich früh in ihre Hütten zurückzogen, um bis zum Einbruch der Dunkelheit zu nähen, Schafswolle auszubürsten oder Werkzeug zu reparieren. Lediglich die Kinder blieben draußen. Dank Jean, der eine Schneeballschlacht anzettelte, vergaß Michel bald die Sache mit dem Schwein und sogar den schrecklichen Vorfall vom Vormittag und tollte zwei Stunden lang mit den anderen im Schnee herum. Sogar Vivienne hatte Spaß an dem wilden Gefecht. Ungeschickt tapste sie zwischen den Älteren herum und kicherte vergnügt, wenn einer von einem Schneeball getroffen wurde. Allerdings verging ihr das Lachen, als Robert sie versehentlich anrempelte und sie mit dem Gesicht voran in den Schnee fiel. Diesmal ließ Michel sie brüllen, bis sie heiser war.
Als es zu dämmern begann, rief ihr Vater nach ihnen. Wortkarg forderte er sie auf, am Feuer Platz zu nehmen. Nachdem sie etwas Gerstengrütze gegessen und einen Becher warme Ziegenmilch getrunken hatten, bestand er darauf, dass sie ihre Gebete sprachen, sich auszogen und schlafen legten. Jean murrte, denn er hasste es, früh ins Bett gehen zu müssen. Ihr Vater duldete jedoch keine Widerrede, und eingeschüchtert von seinem ungewohnt scharfen Ton kroch Jean unter die Decken.
Michel konnte nicht sofort einschlafen. Im Licht des ersterbenden Herdfeuers beobachtete er seinen Vater, der in Gedanken versunken am Tisch saß und seinen Bierkrug leerte. Irgendwann griff er in sein Wams, holte einen Beutel hervor und öffnete ihn. Michel war nicht wenig überrascht, als er sah, dass er Silbermünzen enthielt, schimmernde Deniers. Geld war recht selten in Fleury. Die Dorfbewohner hatten kaum Verwendung dafür und benutzten es eigentlich nur, wenn sie mit auswärtigen Händlern Geschäfte machten; untereinander tauschten sie die Dinge, die sie brauchten. Wieso besaß sein Vater auf einmal einen ganzen Beutel davon?
Julien hat es ihm für das Schwein gegeben, kam es ihm in den Sinn, als sein Vater die Münzen auf dem Tisch stapelte und zählte. Aber warum hat er nichts Nützlicheres dafür verlangt, eine neue Säge oder wenigstens eine Schachtel voller Nägel? Was sollen wir mit so viel Geld?
Während er noch darüber rätselte, was das bedeuten mochte, wurden ihm die Lider schwer. Kurz darauf schlief er ein und träumte von zwei Kaninchen, die tot im Schnee lagen, von Guiscards kalten Augen, von Pierre, dessen Blut zu Boden troff.
»Wach auf, Michel.« Eine Hand rüttelte ihn an der Schulter.
Verschlafen setzte er sich auf. Es war stockfinstere Nacht. Neben dem Schlaflager stand sein Vater, ein schwarzer Umriss vor der orangefarbenen Glut des Herdes.
»Weck Jean und Vivienne, und zieht euch an«, flüsterte er. »Wir müssen fort.«
»Fort? Wieso?
»Tut, was ich sage. Aber seid leise.«
Michel gehorchte und weckte seine Geschwister. Vivienne kam sofort zu sich; Jean hingegen blickte ihn benommen und verwirrt an. Sein hellbraunes Haar stand in alle Richtungen ab.
»Vater will, dass wir uns anziehen«, raunte Michel ihm zu und stieg aus dem Bett. Flackernder Flammenschein erfüllte die Hütte, als sein Vater einen Kienspan an der Glut entzündete und in eine Tonschale auf dem Tisch legte. Er schien schon eine Weile wach zu sein, denn er war vollständig angezogen – oder er hatte gar nicht erst geschlafen. Rasch packte er ihre Habseligkeiten und sämtliche Vorräte in den Huckelkorb, den er normalerweise zum Reisigsammeln verwendete.
Michel holte seinen Leibrock, die wollenen Beinlinge, die Bruche und den Überwurf aus der Kiste am Fußende des Schlaflagers und schlüpfte hinein. Während er seine Filzschuhe anzog, setzte sich endlich auch Jean in Bewegung.
»Was ist los?«, murmelte er.
Ihr Vater gab keine Antwort. »Hilf deiner Schwester«, wies er Michel an.
Michel zog Vivienne an, die sich ausnahmsweise einmal nicht dagegen sträubte. Unterdessen griff sein Vater nach oben in die Dachbalken und holte einen Lederbeutel hervor. Es war derselbe Beutel, den Julien mittags bei sich gehabt hatte. Als sein Vater ihn in den Tragekorb steckte, verrutschte das Leder, und der Griff eines Schwertes kam zum Vorschein. Michel wusste, dass es den Leibeigenen verboten war, Waffen zu tragen. Der Herr würde seinen Vater hart bestrafen, wenn er ihn mit dem Schwert erwischte, ihn vielleicht gar halbtot prügeln wie Pierre. Was ging hier vor?
Sein Vater verschloss hastig den Beutel. »Seid ihr fertig?«
Michel schaute zu Jean, der gerade in seine Schuhe schlüpfte, und nickte.
»Gut. Zieht eure Umhänge an. Draußen ist es bitterkalt.«
»Wohin gehen wir?«
»Wir verlassen Fleury.«
»Für immer?«
»Ja.« Sein Vater schulterte den Tragekorb. »Wir laufen zum Waldrand. Ihr müsst so leise sein, dass niemand uns hören kann. Schafft ihr das?«
Michel und sein Bruder nickten. Ihr Vater blies den Kienspan aus und öffnete die Tür; eisige Nachtluft strömte in die Hütte. Michel ergriff Viviennes Hand, und lautlos huschte die Familie über den Dorfplatz. Michel hatte sich gefragt, ob ein Unglück Fleury heimgesucht hatte und sie deshalb fliehen mussten, ein Feuer vielleicht oder ein Überfall durch Räuber, doch im Dorf herrschte vollkommene Stille. Alles schien in bester Ordnung zu sein.
Hatte sein Vater ein Verbrechen begangen? Flohen sie vor Guiscards Kriegsknechten, die ihn bestrafen wollten? Tausend Fragen tobten durch Michels Kopf, aber er hielt sein Versprechen und gab keinen Laut von sich.
Als sie zur Kirche kamen, trat ihr Vater an die Friedhofsmauer und starrte in die Dunkelheit, blickte zu den beiden Ulmen, unter denen ihre Mutter begraben lag. Immer wenn es die Arbeit zuließ, kamen sie hier herauf, versammelten sich um die schlichte Ruhestätte und beteten für ihre Seele. Erst vor zwei Tagen hatten sie das Grab besucht – zum letzten Mal, wie Michel nun klar wurde.
Er erinnerte sich so gut an seine Mutter, als wäre sie gestern noch bei ihnen gewesen. Er sah sie vor sich, wie sie das Herdfeuer schürte oder Vivienne stillte, wie sie Jean und ihm Geschichten erzählte oder mit ihnen über die Wiese tollte. Sie war eine schöne Frau gewesen, dunkelblond und zerbrechlich und immerzu fröhlich, selbst dann noch, als das tückische Fieber bereits angefangen hatte, ihren Leib auszuzehren. Sie fehlte ihm sehr, und dass sie gezwungen waren, sie hier zurückzulassen, machte ihn traurig. Wenigstens würde sie auf dem Gottesacker nicht allein sein. Ihre Eltern ruhten hier, ihr älterer Bruder und viele andere Menschen, die sie gemocht hatte.
Irgendwann murmelte sein Vater etwas, so leise, dass Michel es fast nicht verstehen konnte. »Vergib mir, Ameline. Ich hoffe, du verstehst, warum ich das tun muss.«
Er wandte sich ab, und für einen Moment sah Michel den Schmerz in seinem Gesicht. »Lasst uns gehen«, sagte er.
Er nahm Vivienne auf den Arm, und sie eilten über die Weide der Allmende und von dort aus zum Wald, der schwarz wie ein undurchdringlicher Grenzwall vor ihnen aufragte. Am Waldrand entlang stapften sie in Richtung Osten, wo, wie Michel wusste, die Grenze von Guiscards Land verlief.
Es fing an zu schneien, dicke Flocken, die still auf das weiße Land herabsanken. Obwohl die Wanderung durch den tiefen Schnee äußerst beschwerlich war, gönnte ihr Vater ihnen keine Rast, selbst dann nicht, als Jean langsamer und langsamer wurde und sich beklagte, seine Füße täten weh. »Weiter, Jean«, trieb er ihn an. »Du musst durchhalten.«
Nur einmal blieb er kurz stehen, um Vivienne, die ihm schwer geworden war, in ein Tragetuch zu stecken, damit er die Arme frei hatte und einen Wanderstock benutzen konnte. Sie war erstaunlich tapfer. Michel hatte erwartet, dass sie ununterbrochen weinen würde, doch sie blieb die ganze Zeit mucksmäuschenstill, so, als hätte sie genau verstanden, was ihr Vater ihnen gesagt hatte. Irgendwann fielen ihr die Augen zu, und sie schlief ein.
Schließlich kamen sie zu dem Bach, der die Grenze von Guiscards Ländereien bildete. Er floss durch einen Graben in den verschneiten Wiesen und verschwand beinahe unter Sträuchern und Brombeerhecken, in denen Eiszapfen glitzerten. Es war nicht schwer, ihn zu überqueren, denn er war zugefroren, und das dicke Eis trug ihr Gewicht. Während Michel hinüberging und die Böschung emporkletterte, wurde ihm plötzlich bewusst, dass er noch nie so weit von zu Hause fort gewesen war.
Auf der anderen Seite ließ sich Jean auf einen umgestürzten Baumstamm fallen. »Ich kann nicht mehr«, verkündete er müde und trotzig.
»Uns scheint niemand zu folgen«, sagte ihr Vater, während er nach Westen blickte. Fleury war schon lange nicht mehr zu sehen – das Mondlicht fiel auf unbewohnte Hügel. »Ich denke, eine kurze Rast können wir uns erlauben. Hilf mir mit dem Korb, Michel.«
Michel nahm ihm den Korb ab, damit er sich setzen konnte, ohne Vivienne zu wecken. Der Behälter war nicht schwer, denn ihr Vater hatte nur die notwendigsten Sachen mitgenommen: Nahrung, warme Decken, einige Werkzeuge, natürlich den Beutel mit den Silbermünzen und das Schwert.
Während sie sich mit Brot und Ziegenmilch stärkten, fragte Jean missmutig: »Müssen wir noch lange laufen?«
»Wir sind noch einige Stunden unterwegs«, antwortete ihr Vater. »Aber wenn wir erst das Moseltal erreicht haben, wird der Weg leichter.«
»Wohin gehen wir?«, fragte Michel.
»Nach Varennes-Saint-Jacques.«
Er hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Varennes war eine Stadt an der Mosel, einen Tagesmarsch vom Lehen ihres Herrn entfernt. Michel war freilich noch nicht dort gewesen, hatte aber schon viel davon gehört. Zweimal im Monat kam ein fahrender Kaufmann aus Varennes nach Fleury und verkaufte den Bauern Salz, Fisch und Wetzsteine. Sein Name war Herr Caron, und er erzählte stets erstaunliche Geschichten von seiner Heimatstadt, wenn er abends in der Dorfschenke saß.
»Verstehst du, warum wir fortgehen müssen?«, fragte sein Vater.
»Wegen des Herrn«, vermutete Michel.
»Solange Guiscard über Fleury herrscht, sind wir dort unseres Lebens nicht sicher. Diesmal hat es Pierre erwischt, aber wer weiß, wen es nächste Woche trifft. Vielleicht mich, vielleicht sogar dich oder Jean. Ein kleiner Fehler genügt, und man wird hart und gnadenlos bestraft – ihr habt es ja heute Morgen gesehen. Deshalb können wir nicht in Fleury bleiben. Ich würde es nicht ertragen, wenn Guiscard euch etwas antäte.«
Vivienne regte sich und blickte verwirrt um sich. Ihr Vater strich ihr über das Haar. »Schlaf weiter«, murmelte er, und ihr Kopf sank wieder gegen seine Brust.
»In Varennes beginnen wir ein neues Leben«, fuhr er fort. »Ich suche mir Arbeit in einer Werkstatt oder auf den Äckern vor der Stadt – Herr Caron sagt, dass die reichen Handwerker und Stadtbauern immer Leute brauchen. Falls ich nicht auf Anhieb etwas finde, ist das nicht schlimm. Ich habe von Julien dreißig Deniers für das Schwein bekommen. Damit kommen wir eine Woche über die Runden, wenn es sein muss.«
Mit jedem Wort, das sein Vater sagte, wuchs Michels Aufregung. Er hatte sich immer gewünscht, Varennes einmal zu sehen. »Wo werden wir wohnen?«
»Bei meinem Lohnherrn, bis ich genug Geld für eine eigene Hütte gespart habe. Das wird nicht lange dauern – die Quartiere in der Unterstadt sollen nicht teuer sein. Und wer weiß, vielleicht bringen wir es eines Tages sogar zu einem richtigen Haus mit Fenstern und mehreren Räumen.«
»So eins wie der Hof des Herrn?«, fragte Jean.
»Schon möglich. Es hängt ganz davon ab, wie tüchtig euer Vater ist, schätze ich.« Ihr Vater lächelte, als Michel und sein Bruder einander voller Vorfreude anschauten. »Das Beste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Es gibt ein altes Gesetz. Es besagt, dass jeder, der sich in Varennes niederlässt, nach einem Jahr und einem Tag ein freier Mann ist. Wenn Guiscard uns bis dahin nicht auf sein Land zurückgeholt hat, kann er uns nichts mehr anhaben. Wir wären keine Leibeigenen mehr.«
»Wir müssten ihm nicht mehr gehorchen?«, fragte Michel.
»Wir wären freie Menschen und nur dem Bischof von Varennes und dem Kaiser zu Treue verpflichtet. Nun esst auf. Es wird Zeit, dass wir weiterkommen.«
Es schneite heftiger, als sie losgingen. Obwohl das Schneetreiben ihr Fortkommen nicht gerade erleichterte, war ihr Vater dankbar dafür, denn es löschte ihre Spuren aus. Michels Angst und Erschöpfung waren wie weggeblasen. Er konnte es kaum erwarten, endlich nach Varennes zu kommen und die Wunder zu sehen, von denen Herr Caron immerzu sprach, die bunten Märkte, die prächtigen Steinhäuser, die zahllosen Kirchtürme. Jean erging es genauso. Er hatte aufgehört, sich über den weiten Weg und seine schmerzenden Füße zu beklagen, und kämpfte sich entschlossen durch den Schnee.
In der Morgendämmerung erreichten sie einen Fluss, ein graues Band, das sich durch das weiße Tal schlängelte – die Mosel. Sie war vollständig zugefroren. Am Ufer steckte ein kleines Boot im Eis fest.
»Es ist nicht mehr weit«, sagte ihr Vater, während sie der Straße neben dem Fluss folgten. »Noch höchstens eine Wegstunde …« Er verstummte, und seine Augen weiteten sich. »Ins Gebüsch mit euch, schnell!«
Bevor Michel ihm und Jean nachrannte, sah er noch, dass auf einer Anhöhe im Osten vier Schatten erschienen waren.
Reiter.
Keuchend schlüpfte er durch das Buschwerk am Straßenrand. Vereiste Zweige rissen an seinem Wollumhang und peitschten ihm ins Gesicht, als er seinem Vater und seinem Bruder folgte. Gut zwanzig Ellen von der Straße entfernt duckten sie sich und beobachteten das Flussufer durch das Geäst eines Brombeerstrauchs.
Die Männer kamen näher. Schweigend ritten sie die Straße entlang. Obwohl sie weite Umhänge trugen und ihre Gesichter in den Mantelkapuzen verbargen, gab es keinen Zweifel daran, dass es sich um Guiscard de Thessy und drei seiner Soldaten handelte.
Michel wagte nicht zu sprechen, nicht zu atmen. Sie sind unseretwegen hier. Sie wollen uns einfangen, nach Fleury zurückbringen und bestrafen. Aber wie nur hatte der Herr von ihrer nächtlichen Flucht erfahren? Sie waren doch so vorsichtig gewesen. Hatte man sie verraten? Bitte lass sie nicht unsere Spuren sehen!
Kurz darauf erreichten die Reiter die Stelle, wo die kleine Familie die Straße verlassen hatte. Obwohl der Schnee hier nicht sehr hoch lag und obendrein festgefroren war, konnte man ihre Spuren leicht erkennen. Es musste nur einer der Männer im richtigen Moment zur Seite schauen …
Der Ritter und seine Kriegsknechte ritten an der Stelle vorbei, ohne die Abdrücke im Schnee zu bemerken. Gott hatte Michels Gebet erhört – dank des Schneetreibens hatten die Männer die Spuren einfach übersehen.
Unglücklicherweise wählte Vivienne genau diesen Moment, um aufzuwachen und nach ihrer Puppe zu fragen.
»Wo ist Joie?«
»Sei still!«, zischte Michel leise, und sein Vater machte »Schhhh«, während er das Mädchen an seine Brust drückte – doch es war bereits zu spät. Guiscard zügelte sein Schlachtross und starrte zum Gebüsch.
»Habt ihr das gehört? Das war ein Kind, oder?«
Nun hielten auch die Soldaten ihre Pferde an. Einer ließ seinen Blick über den Schnee neben der Straße schweifen. »Hier sind Spuren, Herr. Sie führen da hinüber. Sehen frisch aus.«
»Sucht alles ab«, befahl Guiscard. »Ich verwette meinen Schwertarm, dass sich der Kerl und seine Bälger hier irgendwo verstecken.«
Die Männer stiegen ab, schlugen ihre Mäntel zurück und zogen die Schwerter.
Ihr Vater packte Jean und Michel am Arm. »Wir laufen zum Wald«, stieß er hervor. »Aber bleibt um Himmels willen zusammen.«
Sie hasteten los. Obwohl sie versuchten, leise zu sein, verursachte die Hatz durch das dichte Gestrüpp beträchtlichen Lärm, denn ständig zertraten sie Äste oder blieben an dornigen Zweigen hängen. Sie hatten sich noch keine fünf Schritte bewegt, als die Männer sie hörten.
»Da drüben sind sie!«
»Schnappt euch das Pack!«, brüllte Guiscard.
Der Atem brannte Michel in der Kehle, während er seinem Vater nachrannte, über umgestürzte Baumstämme sprang und Böschungen hinabschlitterte. Immer wieder blickte er sich nach Jean um, der sich verzweifelt bemühte, nicht zurückzufallen. »Lauf schneller!«, rief er ihm zu.
»Versuch ich ja«, gab sein Bruder zurück.
Guiscard und seine Männer waren nicht weit hinter ihnen. Michel konnte sie nicht sehen, doch er hörte, wie sie durch das Gestrüpp brachen.
Das Strauchwerk ging in ein Wäldchen über, das sich bis zu den Hügeln im Osten des Moseltales erstreckte. »Da rüber!«, rief ihr Vater und führte sie tiefer in den Forst hinein, wo die ausladenden Kronen der Tannen und Fichten ein dichtes Dach bildeten, sodass kaum Schnee unter den Baumstämmen lag und sie auf dem gefrorenen Boden keine Spuren hinterließen.
»Michel!«, keuchte Jean.
Michel sah, dass sein Bruder gestürzt war. Rasch half er ihm beim Aufstehen.
»Mein Knie!«, wimmerte Jean. Er hatte sich den linken Beinling aufgerissen und blutete.
»Wir müssen trotzdem weiter. Nimm meine Hand.«
Die Männer kamen immer näher und hatten den Rand des Wäldchens fast erreicht. Jean weinte, riss sich jedoch zusammen und ergriff Michels Hand.
Einen schrecklichen Augenblick lang dachte Michel, sie hätten ihren Vater verloren. Er reckte den Kopf und blickte sich nach allen Seiten um. Nach ihm zu rufen wagte er nicht, aus Angst, die Soldaten auf sich aufmerksam zu machen.
Da! Zwischen den Bäumen blitzte sein erdfarbener Umhang auf.
Ihr Vater wartete schwer atmend vor einem mehr als mannshohen Haufen aus abgestorbenem Holz auf sie. »Kriecht da hinein«, sagte er, als Michel und Jean zu ihm rannten. »Beeilt euch!«
Das Holz war vermutlich von den Herbststürmen aus den Baumkronen geschüttelt worden und türmte sich zwischen einer vom Blitz gespaltenen Fichte und einem Felsen auf. Ihr Vater deutete auf eine Lücke zwischen den Ästen, durch die Michel erst Jean kriechen ließ, bevor er selbst hineinkletterte. Im Innern des Haufens befand sich ein kleiner, kaum zwei Ellen hoher Hohlraum. Michel und Jean rückten eng zusammen, als ihr Vater Vivienne durch die Lücke schob. Anschließend stellte er hastig den Tragekorb ab, zwängte sich durch die Öffnung und zog den Korb hinein. Trotz der Kälte rann ihm der Schweiß über das Gesicht. Er musste zu Tode erschöpft sein, nachdem er die ganze Nacht Vivienne und ihre Sachen getragen hatte. Vermutlich hatte ihn die Hatz durch das Gestrüpp die letzten Reste seiner Kraft gekostet.
Rufe hallten durch den Wald. Offenbar hatten Guiscard und seine Männer ihre Spur verloren und teilten sich gerade auf, um den Forst einzeln nach ihnen abzusuchen.
Auch Michel war völlig entkräftet. Er lehnte sich gegen den Felsen, der die Rückwand des Hohlraumes bildete, und rang um Atem. Vivienne klammerte sich an ihn und zitterte am ganzen Leib.
Es war so eng, dass man sich kaum bewegen konnte. Michels Vater spähte durch die Lücke und beobachtete den Wald. Jean zog die Nase hoch und untersuchte sein Knie. Es hatte aufgehört zu bluten. Wie es schien, hatte er sich nur die Haut abgeschürft. Schließlich griff er in den Kragen seines Überwurfs, holte einen dünnen Faden hervor, an dem die Maulwurfspfote hing, und betrachtete sein Amulett.
Michel hätte nicht zu sagen vermocht, wie viel Zeit verging. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht mehr.
»Da kommt einer«, flüsterte sein Vater.
Michel presste Vivienne an sich, sodass ihr Kopf in seiner Halsbeuge lag. »Du musst jetzt ganz leise sein, hörst du?«, raunte er ihr zu.
Ein Zweig knackte in der Stille des Waldes. Vorsichtig, damit er ja kein Geräusch machte, öffnete ihr Vater den Lederbeutel, der aus dem Tragekorb schaute. Michels Mund wurde trocken, als er sah, wie sein Vater das Schwert hervorzog. Was hatte er vor? Wollte er es dem Kriegsknecht in die Brust stoßen, wenn sich der Mann zu der Öffnung hinunterbeugte?
Vivienne spürte sein pochendes Herz und schlang die Arme noch fester um ihn.
Kurz darauf konnte Michel den Kriegsknecht sehen. Es war einer der Männer, die Guiscard geholfen hatten, Pierre zu bestrafen. Er trug ein Kettenhemd unter dem Umhang und einen spitzen Helm mit eisernem Fortsatz, der die Nase vor Hieben schützte. Mit gezücktem Schwert schlich er durch den Wald, blickte mal hierhin, mal dorthin, suchte den Boden nach Spuren ab. Aus dem Mund drangen ihm Wölkchen dampfenden Atems.
Er war keine zwanzig Ellen von ihrem Versteck entfernt. Noch fünf, höchstens sechs Schritte, und er würde die Lücke zwischen den Ästen entdecken.
Michels Vater biss die Zähne zusammen und umklammerte den Griff des Schwertes so fest, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten.
Der Soldat wandte dem Holzhaufen den Rücken zu. Offenbar hatte er aus einer anderen Richtung ein Geräusch gehört. Geh! Bitte geh!, betete Michel.
Diesmal erhörte Gott sein Stoßgebet nicht. Der Kriegsknecht kam abermals näher, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt. Hatte er etwas gesehen?
Ein Ruf schallte durch den Forst.
»Gilles! Hörst du mich?«
Der Mann hob den Kopf. »Ich bin hier drüben!«
»Komm zurück zu den Pferden. Wir brechen die Suche ab.«
»Wieso? Sie können nicht weit sein.«
Ein zweiter Soldat erschien zwischen den Bäumen, und die beiden Männer unterhielten sich. Michel musste die Ohren spitzen, um sie zu verstehen.
»Der Wald ist zu groß – wir finden sie nie. Der Herr will weiterreiten. Er glaubt, dass sie früher oder später in Varennes aufkreuzen, und will sie dort abfangen.«
»Soll mir recht sein. Hab diese Kälte langsam satt. Ich brauche dringend einen Becher Wein.«
Die Kriegsknechte stapften davon.
Kaum waren sie verschwunden, ließen Michel, Jean und ihr Vater gleichzeitig den angehaltenen Atem entweichen.
»Heilige Jungfrau Maria, war das knapp!« Ihr Vater lehnte den Kopf gegen den Felsen und schloss die Augen. »O Herr, ich danke dir.«
Sie alle waren so erschöpft, dass sie im Versteck blieben, bis sie sich etwas von den Strapazen der vergangenen Stunden erholt hatten. Ihr Vater verteilte das restliche Brot und die Ziegenmilch und gab jedem eine Decke. Durch die Enge in dem Hohlraum spürten sie die Kälte kaum.
Nachdem Michel gegessen hatte, wurde er müde und konnte kaum noch die Augen aufhalten.
Er musste eingeschlafen sein, denn irgendwann gab ihm sein Vater einen leichten Klaps auf die Wange.
»Aufwachen, du Schlafmütze. Es wird Zeit, dass wir weitergehen.«
Kurz darauf stapften sie durch den Wald. Obwohl seit der Morgendämmerung mindestens zwei Stunden vergangen sein mussten, war es kaum heller in dem Forst. Durch den Schnee in den Baumkronen gelangte nur wenig Tageslicht zum Waldboden.
»Gehen wir immer noch nach Varennes?«, fragte Michel.
»Natürlich«, antwortete sein Vater.
»Aber dort ist der Herr!«, sagte Jean.
»Uns bleibt nichts anderes übrig. Bei dieser Kälte überstehen wir in der Wildnis keine drei Tage. Guiscard wird uns schon nicht finden. Varennes ist groß. Er kann nicht die ganze Stadt nach uns absuchen.«
Sein Vater entschied, für den Rest des Weges die Straße zu meiden und über die Felder zu wandern. Es war ein dunkler, trüber Tag, und es schneite ununterbrochen. Ihnen begegnete keine Menschenseele, nicht einmal dann, als sie auf einige Bauernhäuser stießen. Rauch quoll aus den Kaminen, und während sie an den Hütten vorbeigingen, vernahm Michel fröhliche Stimmen. Bei diesem ungemütlichen Wetter zogen die Menschen es vor, den ganzen Tag drinnen zu bleiben, sich am Herdfeuer zu wärmen und einander mit Liedern und Geschichten zu unterhalten.
Er dachte an Fleury und stellte sich vor, dass auch dort die Leute gerade in der Dorfschenke zusammensaßen, Holz ins Feuer warfen und frische Ziegenmilch tranken, Julien, Renier, Eloise, Jacques, der alte Odo und all die anderen. Vermutlich redeten sie seit dem Morgen über nichts anderes als ihre Flucht. In diesem Moment wurde ihm klar, dass ihre Freiheit einen Preis hatte: Wenn sie es schafften, Guiscard zu entwischen, würden sie die vertrauten Gesichter nie wiedersehen.
Seine Wehmut währte jedoch nicht lange, denn wenig später tauchte Varennes-Saint-Jacques aus dem Schneetreiben auf. Etwas Derartiges hatte Michel noch nie gesehen. Die Stadt, die da am Ufer der Mosel lag, war mindestens zehnmal so groß wie Fleury. Kirchen und Häuser, viele aus Stein und mit zwei oder drei Stockwerken, standen dicht an dicht; ihre spitzen Dächer und Kamine ragten so hoch empor, als strebten sie dem Himmel entgegen.
»Guiscard wird schon hier sein«, sagte sein Vater. »Vermutlich wartet er bei den Toren auf uns. Wir müssen einen anderen Weg hinein finden.«
Schon von Weitem hatte Michel gesehen, dass die Stadtmauern alt, brüchig und heruntergekommen waren. Einer der Türme war teilweise eingestürzt, und über dem Trümmerhaufen klaffte eine Spalte im Wall, durch die ein Ochsenwagen gepasst hätte. Sie verbargen sich hinter einem windschiefen Schuppen, der zu einem verlassenen Bauernhaus gehörte. Als ihr Vater sicher war, dass niemand sie beobachtete, kletterten sie über den Schutt und schlüpften durch die Mauerbresche.
Michel schlug das Herz bis zum Hals. Sie hatten es geschafft – sie waren in Varennes!
Die Gasse, in der sie sich befanden, verlief an der Innenseite der Wehrmauer. Die Hütten, die sie säumten, sahen nicht viel anders aus als die Bauernkaten Fleurys: klein, fensterlos, mit Wänden aus Holz oder Bruchsteinen und Dächern aus Stroh. Schweine, Gänse und Hühner suchten in den engen Höfen und Gemüsegärten nach Futter.
»Haltet die Augen offen«, sagte ihr Vater. »Denkt daran, wir sind erst in Sicherheit, wenn Guiscard die Stadt verlassen hat. Suchen wir uns einen Gasthof, wo wir uns aufwärmen können.«
Sie gelangten in eine breite Straße, in der es vor Menschen nur so wimmelte. Schmiede, Zimmerleute und Schuster gingen in den Werkstätten ihrer Arbeit nach, hämmerten, sägten, schnitten Leder zurecht und brüllten ihre Gesellen an. Ein Mann schob einen Karren mit Feuerholz und fluchte gotteslästerlich, als er in einem Schlagloch stecken blieb. Vor einer Garküche tranken zwei rotgesichtige Mönche dampfenden Würzwein und unterhielten sich angeregt über die Sonntagspredigt des Bischofs. Den Schnee hatte man weggeräumt; er bildete schmutzig braune Haufen in Ecken und Winkeln.
Der Gestank raubte Michel schier den Atem. Es roch nach Rauch, Exkrementen, fauligem Gemüse. Zwei Häuser weiter öffnete eine Frau ein Fenster und goss den Inhalt ihres Nachttopfs auf die Straße. Ein Herr in feinen Kleidern wurde beinahe getroffen und schüttelte wütend seine Faust.
Michel hatte erwartet, dass die Bewohner Varennes’ alle wie Herr Caron aussehen würden, der immerzu ein edles Gewand in leuchtenden Farben, Stiefel aus Wildleder und elegante Hüte trug. Dies war jedoch nicht der Fall – die meisten Bürger kleideten sich wie die Bauern Fleurys und hatten schlichte Kittel, Beinlinge und Ledermützen an. Michel, sein Vater und seine Geschwister fielen daher nicht auf, als sie sich unter die Leute mischten.
Bei den beiden trinkfreudigen Mönchen erkundigte sich ihr Vater nach einem Gasthof.
»Die meisten Herbergen und Schenken sind bei den Stadttoren«, antwortete einer der Brüder. »Am besten geht ihr zum Salztor, dort gibt es die günstigsten Quartiere.«
Ihr Vater runzelte die Stirn. »Und anderswo, zum Beispiel am Marktplatz?«
»Neben der Münze steht auch eine. Nicht ganz billig, aber gut. Einfach die Straße hinunter und dann rechts – ihr könnt es nicht verfehlen. Der Herr sei mit euch!« Der Mönch prostete ihnen zum Abschied zu.
Der Marktplatz war nur einen Steinwurf entfernt. Er erstreckte sich vor der größten Kirche, die Michel je gesehen hatte, dem Dom von Varennes. Mehrstöckige Stein- und Fachwerkhäuser umgaben ihn. Der Platz selbst war übersät von zahlreichen Buden, Zelten und Verkaufsständen, die ein steinernes Marktkreuz überragte. Bauern und Händler boten dort trotz Eis und Schnee ihre Waren feil, und die kalte Luft war erfüllt von ihrem Geschrei. Auf den Tischen lagen Werkzeuge, geschliffene Messer und Tongeschirr aus, daneben Käseräder, geräucherte Fische, Kleider in allen Farben und Formen. Kapaune und pralle Würste hingen an eisernen Haken, aus Fässern sprudelte Wein und Bier. Kunden, wie die Verkäufer in dicke Umhänge gehüllt, schlenderten an den Ständen vorbei, begutachteten die Auslagen und feilschten um Preise. In aufeinandergestapelten Holzkäfigen gackerten Hühner und schnatterten Gänse; für die größeren Tiere gab es Gehege, in denen sich Schweine, Schafe und Rinder drängten. Tausend Düfte und Eindrücke stürzten auf Michel ein – er wusste nicht, wohin er zuerst schauen sollte. Herr Caron hatte wahrlich nicht übertrieben: Varennes war in der Tat ein Ort voller Wunder.
An mehreren Ständen wurde Salz angeboten. In bauchigen Fässern wartete es auf Käufer. Michel erinnerte sich, dass Herr Caron einmal erzählt hatte, die kostbare Substanz sei das wichtigste Handelsgut der Stadt. Es stamme aus einer Saline in den Hügeln, wo das Weiße Gold in einem langwierigen Prozess aus Quellwasser gewonnen werde. Michel hoffte, dass er diese geheimnisvolle Saline einmal zu sehen bekäme. Denn er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie man aus Wasser Salz machte.
Unterdessen hatte es aufgehört zu schneien, und zwischen den tief hängenden Wolken zeigte sich eine bleiche Sonne. Die städtische Münze, ein wuchtiges Steingebäude an der Südostseite des Platzes, war nicht schwer zu finden. Aus den vergitterten Fenstern drang das Hämmern und Klopfen der Münzschmiede, die im Auftrag des Bischofs aus geschmolzenem Silber neue Sous und Deniers schlugen. Die Herberge daneben wirkte recht komfortabel. Gerade kamen drei Männer in kostbaren, pelzbesetzten Mänteln aus dem Gebäude und unterhielten sich in einer fremden Sprache, während sie zum Marktplatz schlenderten.
»Ich hoffe, wir können es uns leisten, hier einzukehren«, sagte sein Vater zweifelnd.
Als sie zur Eingangstür schlurften, keuchte Jean plötzlich: »Vater! Da!«
Michel fuhr herum. Auf einer der Straßen, die zum Domplatz führten, war Guiscard de Thessy aufgetaucht. Er ritt in Richtung Markt und forderte die Leute mit harschen Befehlen auf, ihm Platz zu machen. Aus den Nüstern seines Schlachtrosses quoll dampfender Atem, der sich mit dem Rauch der Garküchen vermischte.
Michel wollte zur Herberge laufen, doch sein Vater hielt ihn fest. »Nicht! Er sieht uns, bevor wir drinnen sind. Zurück zum Markt, schnell!«
Verstohlen huschten sie um die Hausecke und verbargen sich hinter der Bude eines Weinhändlers. Geduckt spähte Michel an einem Stapel aus leeren Fässern vorbei. Vor der Münze hatte der Ritter sein Pferd gezügelt und ließ seinen Blick über das bunte Labyrinth des Marktes schweifen.
»Dieser Kerl gibt einfach nicht auf«, murmelte sein Vater. »Wir müssen uns irgendwo verstecken.« Er deutete auf eine Gasse zwischen zwei Kaufmannshäusern. »Wenn ich ›jetzt‹ sage, lauft ihr da rüber.«
Guiscard rief einen jungen Burschen zu sich, der gerade des Weges kam, ein Zimmermannsgeselle. Er fragt nach uns, dachte Michel, als die beiden Männer miteinander redeten.
Der Geselle schüttelte den Kopf und ging weiter. Mit finsterer Miene ritt Guiscard eine der Gassen zwischen den Zelten und Viehgehegen entlang.
»Ihr da«, sprach er einen Marktaufseher an, der sich an einer rauchenden Kohlenpfanne aufwärmte. »Mir ist ein Leibeigener weggelaufen, ein Bauer namens Rémy mit seinen drei Bälgern. Blond, groß, breite Schultern. Ist vermutlich gegen Mittag hier aufgetaucht und sucht jetzt eine Bleibe. Habt Ihr ihn gesehen?«
»Kann mich nicht erinnern«, erwiderte der Marktaufseher und betrachtete mit gerunzelter Stirn das Schwert des Ritters. »Ihr seid auf dem Markt, Herr. Hier ist das Tragen von Waffen verboten. Ich muss Euch bitten, entweder den Domplatz zu verlassen oder mir Euer Schwert auszuhändigen.«
»Scher dich zum Teufel«, knurrte Guiscard, doch ehe er weiterreiten konnte, verstellte ihm der Aufseher den Weg.
»Ihr verletzt den Marktfrieden«, sagte der Mann. »Ich kann Euch dafür festnehmen. Euer Schwert. Ich sage es nicht noch einmal.«
Michel war so verblüfft, dass er für einen Moment seine Angst vergaß. Er hatte noch nie erlebt, dass jemand es wagte, derart unverschämt mit dem Herrn zu reden.
Guiscard wurde wütend und begann lautstark mit dem Aufseher zu streiten. Händler und Kunden reckten die Hälse und amüsierten sich über die Auseinandersetzung.
»Jetzt!«, flüsterte Michels Vater.
Sie rannten über den Platz. Die Gasse war eng, dunkel und schmutzig. Morsche Kisten stapelten sich vor der linken Hauswand, halb von rußgrauem Schnee bedeckt. Eine Gestalt, die einen Korb trug, kam ihnen aus den Schatten entgegen. Als sie gerade an ihr vorbeischlüpfen wollten, fragte sie unvermittelt: »Bist du nicht Rémy, der Bauer aus Fleury?«
»Herr Caron!«, platzte es aus Jean heraus.
Im Zwielicht der Gasse hatte Michel den Kaufmann gar nicht erkannt. Der Mann mit dem markanten Gesicht und dem schwarzen Kinnbart warf den kaputten Korb zu den Kisten und lächelte. »Natürlich, du bist es. Und deine Kinder hast du auch mitgebracht. Jean, Michel und … Vivienne, richtig? Was verschlägt euch nach Varennes?«
»Entschuldigt, wir müssen gehen«, sagte ihr Vater kurz angebunden. Gehetzt schaute er zu Guiscard, der immer noch den Marktaufseher anbrüllte. Herr Caron bemerkte seinen Blick und entdeckte den Ritter.
»Seid ihr in Schwierigkeiten?« Sein Lächeln verschwand.
Ohne ein weiteres Wort schob ihr Vater sie weiter. Während sie zum anderen Ende der Gasse eilten, sah Michel, dass Herr Caron abermals zu Guiscard schaute. »Wartet«, rief er ihnen nach. »Vielleicht kann ich euch helfen.«
Ihr Vater wandte sich zu ihm um, den linken Arm um Vivienne gelegt. Misstrauen und Wachsamkeit sprachen aus seiner Miene.
Der Kaufmann senkte seine Stimme. »Seid ihr aus Fleury geflohen?«
»Was geht es Euch an?«, erwiderte ihr Vater schroff.
»Angenommen, es wäre so – dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr ein Versteck braucht, wo ihr unterkommen könnt, bis Guiscard die Suche nach euch aufgegeben hat.«
»Schon möglich.«
»Ich könnte euch mein Haus anbieten.«
»Warum solltet Ihr das tun?«
»Weil Leibeigenschaft in meinen Augen ein Verbrechen ist. Weil ich es als meine Christenpflicht betrachte, jedem zu helfen, der nach Freiheit strebt. Und weil ich de Thessy nicht ausstehen kann«, fügte Herr Caron mit einem feinen Lächeln hinzu.
Michels Vater schwieg. Unterdessen hatte sich Guiscard endlich dem Aufseher gebeugt und ihm fluchend sein Schwert ausgehändigt. Nun suchte er weiter den Markt ab. Er ritt einmal quer über den Domplatz und verschwand schließlich aus Michels Blickfeld.
»Du kannst mir vertrauen, Rémy«, sagte Herr Caron. »Ich will euch doch nur helfen – du hast mein Wort.«
»Bitte, Vater«, bettelte Jean. »Lass uns zu Herrn Caron gehen. Michel will es auch. Nicht wahr, Michel?«
Michel nickte. Genau wie sein Bruder war er todmüde und sehnte sich nach einer warmen Kammer, wo sie sich ausruhen konnten. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Herr Caron etwas im Schilde führte.
Ihr Vater jedoch zögerte noch immer. »Wir würden Euch nur zur Last fallen.«
»Unsinn. Ich bin ein sehr wohlhabender Mann, wenn du mir diese unbescheidene Feststellung gestattest. Ich kann es mir durchaus leisten, vier Gäste einen Tag und eine Nacht in meinem Haus aufzunehmen.«
Just in diesem Moment tauchte Guiscard wieder auf. Der Ritter hatte offenbar den Markt umrundet und stieg am Stand eines Weinhändlers aus dem Sattel. Barsch orderte er einen Krug. Er stand keine zehn Ellen vom Eingang der Gasse entfernt, in der sie standen, und hatte ihnen den Rücken zugewandt.
»Rasch, da entlang, bevor er euch sieht!«, flüsterte Herr Caron und huschte tiefer in die Gasse hinein.
Guiscards neuerliches Auftauchen hatte ihrem Vater die Entscheidung abgenommen, ob es klug war, Herrn Caron zu trauen. Ohne zu zögern, ergriff er mit der Rechten Michels und mit der Linken Jeans Hand und lief dem Kaufmann nach. Sie gelangten in eine breitere und hellere Gasse hinter den Kaufmannshäusern und eilten über den festgetrampelten Schnee an einer Hofmauer aus verwitterten Ziegelsteinen entlang, bis sie zu einer schmalen Pforte kamen. Herr Caron öffnete sie und ließ sie hindurchschlüpfen, bevor er ihnen folgte und die Tür schloss.
»Ich würde sagen, das war recht knapp«, meinte Herr Caron, und seine Lippen formten wieder jenes feine, elegante Lächeln. »Andererseits sollte ich froh sein, dass de Thessy aufgetaucht ist, sonst hättest du dir nie von mir helfen lassen.«
»Ich weiß nicht, wie ich Euch je danken soll«, erwiderte Michels Vater steif.
»Gehen wir ins Haus. Ihr seid gewiss hungrig. Ich sorge dafür, dass ihr etwas zu essen bekommt.«
Sie durchquerten den Hof, der neben dem Stallgebäude eine Remise mit zwei Wagen, einen Backofen, einen kleinen Gemüsegarten und eine Sickergrube enthielt, auf der ein hölzerner Deckel lag. Hühner pickten im Schneematsch nach Körnern und liefen gackernd auseinander, als sie zur Hintertür des Hauses schritten.
Trotz seiner Erschöpfung kam Michel aus dem Staunen nicht heraus. Ein Gebäude dieser Größe hatte er noch nie betreten. Es war wahrhaft riesig – allein ins Erdgeschoss hätte ihre Hütte mit Leichtigkeit hineingepasst. Der Eingangsbereich bestand aus einem einzigen fensterlosen Raum mit Gewölbedecke und einem zweiflügeligen Portal, das hinaus auf den Domplatz führte. An den Wänden standen Körbe und Fässer, und ein seltsamer Geruch lag in der Luft, nach Leder, Fett, Kräutern und anderen Dingen, die Michel nicht benennen konnte. In einer Ecke saß eine junge sandfarbene Katze und putzte sich. Gerade wuchteten zwei Bedienstete eine große Kiste die Kellertreppe herauf, stellten sie ab und wischten sich den Schweiß von den Gesichtern.
»Sind das die Kerzen?«, fragte Herr Caron.
»Ja, Herr. Waren hinter den leeren Salzfässern versteckt, weswegen wir sie nicht gleich gefunden haben.«
»Ausgezeichnet. Bringt sie zur Abtei Longchamp. Aber beeilt euch, die Mönche warten schon. Und lasst euch nicht wieder über den Tisch ziehen. Ich habe mit dem Abt einen Sou pro Kerze vereinbart, und keinen Denier weniger. Wenn ihr zurück seid, schafft den Müll aus der Gasse weg. Ich bekomme Ärger mit dem Dreckmeister, wenn er noch eine Nacht länger herumliegt.«
Anschließend führte Herr Caron sie eine Treppe hinauf. »Olive, wir haben Gäste!«, rief er in die Küche. »Bring uns Brot, Fleisch und Käse. Außerdem zwei Krüge Wein und drei Becher heiße Milch für die Kinder.«