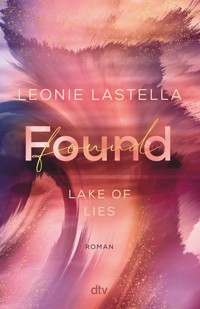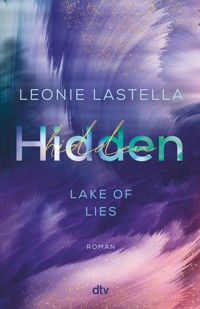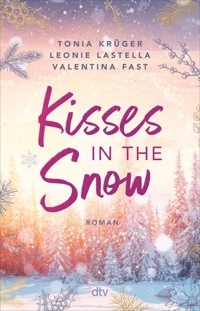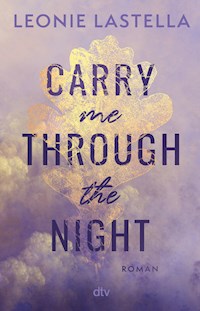9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, so unvergesslich wie die erste Liebe Genau die richtige Mischung aus Tiefgang und Romantik Noch nie hat Harper einen Menschen so geliebt wie Ashton. Doch in ihrem Leben ist keine Zeit für Abenteuer, Spontaneität und Kompromisse. Dabei sollte nichts wichtiger sein als die erste Liebe – oder? Als sie Ashton zum ersten Mal in die Augen sieht, stellt er Harpers Welt völlig auf den Kopf. Doch egal wie stark ihr Herz auch klopfen mag, sie kann sich nicht auf einen Flirt mit Ashton einlassen. Denn jeden Abend schlüpft sie aus ihrem sorglosen Studentenleben in die Rolle der fürsorglichen Schwester, die sich um ihren autistischen Bruder kümmert. Harper hat keine Zeit für Abenteuer, für Spontaneität, für Kompromisse. Und doch erobert Ashton nach und nach ihr Herz. Zum ersten Mal ist ihr etwas wichtiger als ihre Familie – und plötzlich steht Harper vor der wohl schwersten Entscheidung ihres Lebens … »›Das Licht von tausend Sternen‹ berührt – und besitzt selbst die Strahlkraft eines Sterns.« buchmedia magazin Folgende weitere Romance-Titel sind von Leonie Lastella bei dtv erschienen: »Wenn Liebe eine Farbe hätte« »So leise wie ein Sommerregen« »Carry me through the night« »Seaside Hideaway – Unsafe« »Seaside Hideaway – Unseen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Ein einziger Blick in Ashtons Augen und Harpers Welt steht Kopf. Doch egal wie stark ihr Herz auch klopfen mag, sie kann sich nicht auf Ashton einlassen. Denn jeden Abend schlüpft Harper aus ihrem sorglosen Studentenleben in die Rolle der fürsorglichen Schwester, die sich um ihren autistischen Bruder kümmert. Und doch verliebt sie sich nach und nach in Ashton. Zum ersten Mal ist ihr etwas wichtiger als ihre Familie – und plötzlich steht Harper vor der wohl schwersten Entscheidung ihres Lebens ...
Für meine Kinder.
Seid irgendwann für jemanden das Licht von tausend Sternen.Und dann gebt diesen Menschen niemals wieder her.
KAPITEL 1
Harper
Das Treiben auf dem Campus wird durch die dicken Wände der Mansfield Library ausgesperrt. Es ist so still zwischen den massiven Nussbaumregalen und Tausenden von Buchrücken, dass man den Staub tanzen hören könnte. Außer mir befinden sich nur noch die Bibliothekarin im Raum und ein Typ, der auf einem Wälzer über Grundlagen sozialer Mediengestaltung eingeschlafen ist. Ich glaube, er hat nur einen ruhigen Platz außerhalb seines Wohnheims gesucht, wo er während der rund um die Uhr andauernden Erstsemesterpartys mal wieder ein Auge zukriegt.
Ich binde meine Haare zu einem wirren Knoten auf dem Kopf zusammen und vertiefe mich wieder in meine Lektüre. Das Semester hat zwar schon letzte Woche begonnen, aber Kennenlernspiele, Orientierungskurse und Vorstellungsrunden zählen meiner Meinung nach nicht. Ab Montag steigen wir in den Stoff ein. Das bedeutet für den Großteil der Studenten, dass sie am letzten Wochenende vor dem Ende der Semesterferien noch mal ordentlich die Sau rauslassen. Ich nicht.
Ich bin gern vorbereitet und habe am liebsten meine Ruhe. Vor allem vor Typen wie dem, der gerade lachend und johlend mit zwei Freunden die Bibliothek betritt und sich kein Stück darum schert, dass überall Schilder hängen, man solle leise sein. Sogar der ranzige Tiefschläfer neben mir wacht auf, packt knurrend seine Sachen zusammen, schleudert sie in seinen Rucksack und verlässt den Raum.
»Ash, jetzt sei mal leise, sonst schmeißt uns Miss Dunham raus, bevor ich meine Bücher habe.«
Eine sehr gute Idee, die das Mädchen der kleinen Gruppe da hat. Mich bei dem Lärm auf meine Bücher zu konzentrieren, ist tatsächlich eine Herausforderung und wird noch schwerer, weil ich den Typen anstarre, den die kleine Blonde Ash genannt hat. Er ist einfach jemand, an dem der Blick hängen bleibt – ob man will oder nicht. Sein Gesicht ist markant, ohne kantig zu sein. Die Augen haben die Farbe eines perfekten Montana-Sommertags. Das tiefe Azurblau steht in geradezu groteskem Kontrast zu seinem dunklen, halblangen Haar und dem Dreitagebart, der ihm den perfekten Touch Verwegenheit verleiht. Er ist groß. Größer als sein Kumpel, der sich neben das Mädchen an den Tresen lehnt und die Zeit für ein Powernap nutzt. Ein enges graues Shirt, das keinen Zweifel an dem durchtrainierten Körper darunter lässt, umspannt Ashs Brust und wird durch eine zerrissene Jeans komplettiert. Ein Tattoo schlängelt sich unter dem Shirtärmel heraus bis zum Unterarm, wo es fast gegen drei tätowierte Ringe stößt, die sein Handgelenk umgeben. Ein toter Baum, dessen tiefschwarze Äste seine Muskeln umschlingen und einen Schriftzug einrahmen, den ich auf die Entfernung nicht entziffern kann. Ich zwinge mich, ihn nicht noch länger anzustarren.
»Langweilig«, beschwert er sich knapp.
Ich verdrehe die Augen und konzentriere mich wieder auf den Text vor mir, aber bereits wenige Sekunden später stört mich ein impulsiver, harter Takt, den Ash mit seinen Fingern auf das Holz des Regals direkt neben dem Empfangstresen trommelt.
Miss Dunham schürzt ihre Lippen und schüttelt den Kopf. In all den Jahren ihrer Arbeit in den stillen Räumen der riesigen Bibliothek der Universität von Missoula hat sie sich offensichtlich eine Autorität angewöhnt, die keine Worte braucht. Sie scheint es nicht gewöhnt zu sein, dass ihr strenger Blick ohne Effekt bleibt.
Das blonde Mädchen hilft ihr, indem sie dem trommelnden Mister Perfect einen unsanften Stoß gibt und ihn auffordert: »Such dir eine Beschäftigung, Ash, sonst trete ich dir in den Arsch!«
Er nickt, sieht sich um, und ehe ich weggucken kann, fixiert er mich. Zu spät, um so zu tun, als hätte ich die ganze Zeit in meinem Buch gelesen. Vor den Augen seiner Freundin – zumindest denke ich, dass das Mädchen mit ihm zusammen ist – wirft er mir einen herausfordernden Blick zu. Und er scheint deswegen nicht die Spur eines schlechten Gewissens zu haben. Er dreht ihr einfach den Rücken zu und schlendert zu mir herüber. Ich werde rot und vergrabe mein Gesicht schnell in den Aufzeichnungen für das erste Semester meines Sozialpädagogikstudiums.
»Hi.« Seine Stimme ist dunkel und warm. Seinem Verhalten nach zu urteilen, hätte ich Spott darin vermutet, Oberflächlichkeit oder einen Hauch Überheblichkeit, aber er klingt irritierend ernst, und seine Stimme ist fest, als er abermals »Hi« sagt und mir seine Hand entgegenstreckt. »Ich bin Ashton«, stellt er sich vor.
Ich ignoriere seine Hand und blättere eine Seite weiter. Als wäre ich zum Lesen gekommen, seitdem er die Bibliothek betreten hat. Als würde es mich nicht ablenken, dass er mir eine Spur zu nahe kommt. »Harper«, sage ich knapp, ohne von meinen Aufzeichnungen aufzuschauen. Ich werde mit Sicherheit nicht die Ablenkung sein, von der seine Freundin gesprochen hat – und ich denke auch nicht, dass sie das im Sinn hatte. Aber der Spruch, den ich ihm an den Kopf knallen will, bleibt mir im Hals stecken, als ich ihn ansehe. Wie ein windschiefer Baum lehnt er sich gegen den Tisch, auf dem meine Sachen verstreut liegen. Eindringlich sieht er mich dabei an und bohrt seinen Blick tief unter meine Oberfläche.
»Harper«, wiederholt er meinen Namen, und aus seinem Mund klingt mein Name irgendwie wild und aufregend. Als würde er sich, schon während er ihn ausspricht, jede Menge Dinge vorstellen, die uns beide bis in die Grundfeste erschüttern könnte. Seine Freundin wird das nicht lustig finden, wenn sie mitbekommt, was er hier gerade tut. Vielleicht führen sie aber auch eine offene Beziehung und es kratzt sie nicht. Womit wir wieder beim Thema wären: Mich sollte Ashton noch weniger interessieren.
»Ein schöner Name«, sagt er, und ich schließe meine Augen, um mich auf meinen eigentlichen Plan zurückzubesinnen.
Ich sollte den Kerl wegschicken, um wenigstens noch das Kapitel zu Ende zu bearbeiten, an dessen Anfang die neongelbe Markierung klebt. Ich kappe den Anflug eines Kribbelns, den sein intensiver Blick in mir auslöst. Das ist seine Masche, da bin ich sicher, und ich bin kein Mädchen, das auf solche Spielchen hereinfällt.
»Ist das dein Ernst?«, kommentiere ich seine einfallslose Anmache.
»Es ist ein schöner Name«, entgegnet er unbeeindruckt. »Ungewöhnlich.«
»Solltest du nicht zu deiner Freundin gehen oder auf irgendeine Party?«, versuche ich ihn zu verscheuchen. »Die Bibliothek scheint nicht gerade dein gewohnter Lebensraum zu sein.« Dabei richte ich meinen Blick demonstrativ auf das Schild mit der Aufschrift »Ruhe«, das direkt neben mir an einem der Regale hängt.
Er klopft dagegen und verzieht den Mund zu einer kindlichen Grimasse, die ihn mir ärgerlicherweise verdammt sympathisch macht. Er streicht sich die Haare aus der Stirn und setzt sich schwungvoll mit dem Hintern auf die Tischplatte, sodass er den Großteil meiner Aufzeichnung bedeckt. Ein Weiterarbeiten ist unmöglich. Ich ziehe die Augenbrauen nach oben und hoffe, dass er endlich geht.
»Das da hinten sind Will und Becca«, sagt er jedoch, als hätte er meine Abfuhr gar nicht wahrgenommen, und zeigt mit einem breiten Grinsen zuerst auf den anderen Jungen und dann auf das Mädchen, das noch immer auf die vorbestellten Bücher wartet, die Miss Dunham aus dem Lagerraum holt.
Vermutlich ist das sein Haifischgrinsen, bevor er zuschnappt und die Flirtbeute erlegt. Ich werde mit Sicherheit nicht sein Appetithäppchen.
»Becca ist nicht meine Freundin«, fährt er fort. »Sie steht auf Will, aber er starrt lieber Löcher in die Luft, als sie endlich um ein Date zu bitten.« Er lacht leise. »Will ist manchmal echt ein Idiot.«
»Hör zu, ich bin hier, weil ich lernen muss, also …«, sage ich und deute auf meine Aufzeichnungen, die er unter sich begraben hat.
»Das Semester hat noch nicht mal angefangen. Und Erstis wie du haben sowieso noch Schonfrist.«
»Ich bin vielleicht im ersten Semester, aber ich bin kein typischer Ersti«, wiederhole ich seine Bezeichnung für die Sorte Neustudenten, die derzeit die Partys rund um den Campus überschwemmen und nicht wie ich ausschließlich am Studieren interessiert sind. »Und zweitens hat das Semester bereits begonnen. Schon vor einer Woche.« Ich versuche mir noch immer nicht anmerken zu lassen, dass mich seine Nähe nervös macht. Er riecht verdammt gut. Nach Sonne, feuchter Erde und frischer Luft – ein bisschen so wie mein Lieblingsort weit oben in den Rocky Mountains. Unsere Hütte auf der Spitze des Cooper Passes, die laut Mom nur noch von Spinnweben zusammengehalten wird. Früher sind wir oft gemeinsam hochgefahren. Ich habe es geliebt. Mom hingegen meidet diesen Ort. Weil sie sich vor den Erinnerungen an Dad fürchtet. Sie haben noch immer die Kraft, sie von einer Sekunde auf die andere wie ein Tornado von den Füßen zu reißen.
»Also sagst du Ja?« Ashtons Frage zerreißt die Bilder von Bergen im Morgennebel, glasklaren Seen und einem unendlich weiten Himmel, die sich vor meinem inneren Auge abgespielt haben.
Er sieht mich an und ein Funken Sorge bricht durch das Lächeln auf seinem Gesicht: »Ist alles klar bei dir? Du warst wie weggetreten.«
»Hab mich tot gestellt, weil ich dachte, du würdest dann vielleicht verschwinden«, erwidere ich mit einem Augenverdrehen, während gleichzeitig ein illoyales Lächeln über meine Lippen bricht.
»Sobald du Ja gesagt hast.« Seine Augen blitzen mich an, und ich suche verzweifelt nach dem Teil des Gesprächs, den ich verpasst habe. Ich laufe rot an und ärgere mich wahnsinnig, weil Ashton das am Ende noch als Kompliment verstehen wird.
Ich verschränke die Arme, weil ich seinem Grinsen keinen Millimeter meiner Abwehr überlassen werde. »Wozu soll ich Ja sagen?«, frage ich fest.
»Zu einem Date mit mir. Ich versuche zu beweisen, dass Will der größere Idiot von uns beiden ist, weil er es nicht schafft, Becca zu fragen, während ich dich darum bitte, mit mir auszugehen.«
Niemals. Doch mein Herz ist nicht so kompromisslos wie mein Hirn und poltert hinter dem Nein her, das ich hervorquetsche.
»Warum nicht?«, fragt Ashton und scheint dem Rätsel wirklich auf die Spur kommen zu wollen, wieso ich ausgerechnet ihn verschmähe.
Seufzend zupfe ich an den Zetteln und schaffe es, sie unter seinem Schenkel hervorzuziehen. Ich raffe die Aufzeichnungen zusammen, klappe die zwei Bücher zu und stopfe alles in meine Tasche. »Weil ich generell nicht Ja zu Dates sage, zu denen ich nur eingeladen werde, um zu beweisen, wer der größere Idiot ist«, erkläre ich. Als würde ich je zu irgendeinem Date Ja sagen. Ich werfe mir den Rucksack über die Schulter und gehe Richtung Ausgang. Ashton folgt mir. Natürlich, jetzt, wo ich es aufgegeben habe, arbeiten zu wollen, ist er plötzlich in der Lage, seinen Körper vom Tisch zu hieven.
»Jetzt warte doch mal«, insistiert er und heftet sich mir an die Fersen.
Als wir den Ausgang erreichen, versperrt er mir nicht, wie ich kurz befürchte, den Weg, sondern hält mir die Tür auf. Ich würde zu gern nur einen oberflächlichen Weiberhelden in ihm sehen, aber er macht es mir nicht gerade leicht.
Mit langen Schritten verlasse ich das Gebäude. Ashton folgt mir, und ich gebe dem winzigen Teil in meinem Inneren, der sich diebisch darüber freut, einen Tritt in den Hintern.
Tief durchatmen! Ich ignoriere die ersten Regentropfen, die sich aus dem grauen Himmel lösen und auf meiner Haut zerplatzen, und laufe unbeirrt weiter. Es dämmert bereits, und ich sollte zusehen, dass ich nach Hause komme.
»Ich will eine Verabredung mit dir«, bittet Ashton mich noch mal. Mein Mund ist trocken, als ich aus den Augenwinkeln die Regentropfen beobachte, die unter dem Halsausschnitt seines Shirts verschwinden, während er weiter neben mir herläuft. Ich kann die Mädchen verstehen, die nachgeben und ihm blindlings ins Gebrochene-Herzen-Nirwana folgen.
»Ich kann nicht«, sage ich dennoch leise, und ein Funken Bedauern schleicht sich in meine Stimme, als ich seinen intensiven Blick bemerke. Ich kann mir das einfach nicht leisten. Nicht mal, wenn ich zugeben würde, dass die Neurotransmitter meines Körpers wegen ihm ein Vierter-Juli-Feuerwerk veranstalten.
Ashton streicht sich in einer fast verzweifelten Geste die mittlerweile klatschnassen Haare aus der Stirn und zuckt mit den Schultern. »Kannst du mir sagen, warum?«
Wieso tut er so, als würde es ihm wirklich etwas bedeuten? Ich bin sicher nicht die Erste, die er versucht auf die Tour rumzubekommen. Wahrscheinlich bin ich nicht mal die Erste am heutigen Tag. Oder seit dem Mittagessen. Also wieso bewegt dieser ernste Gesichtsausdruck und der vermutlich über Jahre perfektionierte Bad-Boy-mit-tiefem-Schmerz-Blick etwas in mir? Ich schließe die Augen und versuche nicht auf seine Masche reinzufallen.
»Ich habe keine Zeit«, erkläre ich kurzerhand und laufe noch schneller.
Ashton hat seine Sweatshirtjacke, die er um die Hüften gebunden hatte, gelöst und breitet sie über unseren Köpfen aus, obwohl ich ihn nicht darum gebeten habe, meinen Retter zu spielen. Trotzdem schlüpft ein Lächeln über meine Lippen, und ein leichtes Prickeln stiehlt sich durch meinen Körper, als mich sein Arm beim Laufen berührt. Schweigend legen wir die restliche Strecke bis zur Bushaltestelle zurück. Ich habe Glück, dass, gerade als wir das schwach erleuchtete Bushaltestellenhäuschen erreichen, die Linie 6 am Straßenrand hält. Das erleichtert mir meine Flucht. Allerdings habe ich die Rechnung ohne Ashton gemacht. Er greift nach meiner Hand und hält mich zurück, bevor ich einsteigen kann. »Du hast keine Zeit. Die Ausrede ist gut. Für heute. Aber was ist mit morgen? Übermorgen?«
Ich starre auf seine Finger, die meine Hand umschließen, und mein Herz beginnt zu flattern. Dummes Herz.
Ganz langsam dreht er meine Handfläche nach unten und zückt einen Stift, mit dem er eilig Zahlen auf meine Haut kritzelt. Mir ist klar, dass es seine Nummer ist. Nicht klar ist mir, warum jeder Wirbel aus Tinte Minibeben in meinem Bauch auslöst.
»Morgen kann ich auch nicht«, bringe ich krächzend hervor. Ich muss klarer werden, sonst wird er es nicht verstehen, aber warum, zum Henker, kostet es mich so viel Überwindung, die folgenden Worte auszusprechen? »Hör zu, du scheinst ein echt netter Kerl zu sein, aber ich bin nicht auf der Suche nach einer Beziehung.« Ich erröte. »Oder nach was auch immer du suchst.« Das hört sich laut ausgesprochen noch verfänglicher an als in Gedanken. »Ich will mich auf das Studium konzentrieren.« Ich hole tief Luft. »Und ich bin nicht besonders abenteuerlustig«, schließe ich leise. Denn eins ist klar, Ashton sucht genau das – ein Abenteuer.
»Ein bisschen Abenteuer gehört zum Studium dazu«, widerspricht er. »Den Anfang könntest du machen, indem du morgen zur Kappa-Sigma-Party kommst und mich dort triffst. Die fetteste Party zum Semesterbeginn.« Er grinst mich an, und dieses schiefe Grinsen zeigt mir, dass er nicht nachgeben wird.
»Ich überlege es mir«, murmle ich und blicke auf meine Hand, die er noch immer festhält und die ich bereits an ihn verloren habe. »Ich muss einsteigen. Sonst fährt der Bus ohne mich.«
Ashton lässt mich widerstrebend los. »Überleg nicht nur. Komm! Wir treffen uns um acht am Wohnheim, oder du rufst mich an und ich hole dich ab«, sagt er, aber die Türen des Busses schließen bereits und ersparen mir eine Antwort. Wir fahren an und ich arbeite mich schwankend durch den Gang bis zur hintersten Sitzbank. Ich versuche mir einzureden, dass ich das tue, weil ich dort keinen Sitznachbarn habe, und nicht, weil ich so noch einen letzten Blick auf Ashton erhaschen kann. Die durchweichte Sweatshirtjacke hat er sich locker auf die Schulter gelegt und steht unbewegt im Regen, während sich nasser Asphalt und die einsetzende Dämmerung zwischen uns schieben.
KAPITEL 2
Ashton
»Was war vorhin eigentlich mit dir los?«, fragt Becca und wirft mir ein trockenes Shirt zu. Sie legt die Wäsche zusammen, die auf einem Ständer in unserer Wohnküche hängt. Ich tue so, als wüsste ich nicht, dass sie auf meinen erbärmlichen Versuch anspielt, Harper zu einem Date zu überreden. Ich zucke mit den Schultern und wechsle meine Klamotten. Ich habe keine saubere Jeans mehr und weiche auf eine Jogginghose aus. Ich muss dringend in den Waschsalon – und dann überzeuge ich Becca endlich, dass wir uns eine eigene Maschine anschaffen. Ich habe keine Lust noch länger auf das fest in koreanischer Hand liegende Waschcenter neben unserer Wohnung angewiesen zu sein. Zu den Stoßzeiten steht man sich dort die Beine in den Bauch.
»Kommt sie morgen zur Party?«, bohrt Becca weiter.
»Wer?«, frage ich gespielt unbeteiligt und öffne ein Pale Ale, das ich aus dem Kühlschrank ziehe.
»Du weißt genau, wen ich meine.« Sie durchquert den Raum und schlägt mir ein Tanktop um die Ohren. »Das Mädchen aus der Bibliothek.«
»Ich hatte kein Glück, denke ich.«
»Und das bist du nicht gewohnt, du Armer. Ich sehe förmlich, wie du leidest.« Sie lacht und ich muss ebenfalls grinsen. Ich bin es wirklich nicht gewohnt, abgewiesen zu werden, aber die Abfuhr von Harper hat mich nicht nur deswegen getroffen.
»Leck mich«, brumme ich Becca zu und schmeiße ihr meine nassen Sachen rüber. Sie fängt sie und hängt sie zum Trocknen auf.
»Du bist heute mit Kochen dran«, erinnert sie mich, und ihr Blick ist unerbittlich. Sie wird sich nicht mit einer Bestellung vom Pizzaservice zufriedengeben wie die letzten Male. Ich kann kochen, habe aber selten Lust dazu. Meistens, weil ich Besseres vorhabe. Heute, weil Harper meine emotionale Festigkeit durch den Mixer gedreht hat. Was natürlich die Frage aufwirft, wieso es ein wildfremdes Mädchen schafft, mich mit ihrem Namen und einem einfachen Nein zu destabilisieren.
Ich dürfte dem Ganzen gar nicht so viel Bedeutung beimessen. Harper sollte nur eine Ablenkung sein. Weil die Bibliothek für meinen Geschmack zu still ist und Stille ein guter Nährboden für lästige Gedanken, auf die ich nicht besonders viel Wert lege. Nur deswegen habe ich sie angesprochen. Aber ihre wild zusammengebundenen blonden Haare, ihre natürliche Ausstrahlung und die Ernsthaftigkeit, die sich in der Falte zwischen ihren Augenbrauen manifestiert, machten mir ziemlich schnell klar, dass Harper anders ist als die Mädchen, die ich sonst regelmäßig date. Das gefiel mir, brachte mich aus dem Gleichgewicht. Ihre Abwehr reizte mich. Und ihr Name gab mir den Rest.
Ich habe es unter Lässigkeit versteckt, aber es war, als hätte sie mit ihrem Namen eine Tür aufgestoßen. Eine Tür, die ich aus guten Gründen fest verschlossen halte. Immer. Ich musste mich setzen. Dass ich mich auf ihre Unterlagen gepflanzt habe, war weniger Anmache als Notwendigkeit.
Ich gehe in mein Zimmer und schließe die Tür hinter mir. Der Raum ist grün gestrichen. Darin steht nur mein Bett, eine schmale Kommode mit meinen Klamotten drin und in der Ecke der wuchtige Schreibtisch, der trotz seiner enormen Grundfläche überquillt. Nur die Ecke, auf der der Computer und das Schnittpult stehen, ist aufgeräumt. Ich lasse mich auf das Bett fallen und meine Gedanken wandern zu Emma. Genau wie vorhin, als Harper mir ihren Namen nannte. Ich atme tief durch und schließe die Augen. Die Tatsache, dass ich ausgerechnet ein Mädchen anmache, das denselben Namen trägt wie die Lieblingsautorin meiner kleinen Schwester, hätte ihr mit Sicherheit ein Lachen entlockt. Emma hat Harper Lee geliebt. Diese Affenliebe ging so weit, dass sie irgendwann darauf bestand, wir sollten sie Scout, wie die Hauptfigur aus Wer die Nachtigall stört, nennen. Geistesabwesend streiche ich über das Tattoo auf meinem Arm.
Emma war verrückt. Stur. Einzigartig. Im Positiven wie im Negativen. Es ist, als hinge ihr Lachen zwischen den kahlen Ästen des Tattoos auf meinem Arm. Sie hat immer gelacht. Selbst dann noch, als der Krebs meine Schwester und unsere Familie längst kaputt gekriegt hatte.
Es gibt sicher nicht nur ein Mädchen an der Uni, das Harper heißt. Der Name ist selten, aber nicht so selten, dass ich Parallelen ziehen sollte, wo es keine gibt, nur um Emma auch vier Jahre nach ihrem Tod nahe zu sein.
Es klopft. Becca hat wie immer einen siebten Sinn für meinen Gemütszustand. Sie ist da sehr verlässlich, genauso wie ich immer für sie da bin. Wobei ich zugeben muss, dass ich wahrscheinlich fünf Leben bräuchte, um gleichzuziehen.
Ich kenne Becca seit meiner frühesten Kindheit. Irgendwann hat Emma sie angeschleppt. Sie war mit ihren Eltern aus Florida nach New York gezogen. Ich weiß, dass Mom einigermaßen entsetzt war, dass Emma ausgerechnet sie als beste Freundin auserkoren hatte.
Becca ist eine Spur zu durchgeknallt, ein bisschen zu dunkel gekleidet. Sie ist immer etwas zu laut und hat ständig verrückte Einfälle. Mom hatte sich eher ein braves, ruhiges Mädchen als beste Freundin ihrer Tochter gewünscht. Jemand, der ihre Krankheit als Grund nahm, sie in Luftpolsterfolie zu wickeln und sie nicht zu jeder Menge waghalsigem Unfug anzustiften. Aber weder Becca noch Emma ließen sich davon beirren. Genauso wenig wie vom Krebs, der durch Emmas Körper wütete und ihre Freundschaft prägte.
Becca war bis zum Schluss für Emma da. Und sie ist für mich da. Immer. Sie ist meine Familie.
Sie hüpft zu mir aufs Bett und trommelt mit den flachen Händen auf meinen Bauch. »Alter, jetzt komm schon. Wir haben keine Zeit, Trübsal zu blasen, nur weil ein Mädchen deine winzige Männlichkeit verletzt hat. Ich habe eben eine Nachricht von Will bekommen, dass heute Abend noch eine Party auf dem Platz beim Autio steigt. Vorglühen für die Party bei den Kappa Sigmas morgen.«
Die Grizzly-Statue, die im Zentrum des Campus steht und von irgendeinem Typen namens Autio modelliert wurde, ist das Wahrzeichen unserer Uni.
»Winzig, ja?« Ich ziehe eine Augenbraue nach oben und ringe mir ein Lächeln ab.
»Siehst du, geht doch«, kommentiert sie meinen Versuch guter Laune. »Also los.«
Becca springt vom Bett und ist schon halb bei der Tür, als ich den Kopf schüttle. Ich habe keine Lust. Was echt besorgniserregend ist. Ich habe immer Lust aufs Feiern. Noch dazu, wenn es eine unerlaubte Party ist, und da der Autio-Grizzly heilig ist, hat sicher niemand das Ganze autorisiert. Es gibt wenig, was mich mehr packt als gute Musik, ausgelassene Stimmung mit ein wenig Nervenkitzel und Alkohol.
»Also, was ist?«
»Ich glaube, heute nicht«, winke ich trotzdem ab. »Ich muss noch arbeiten«, sage ich und deute auf meinen zugemüllten Schreibtisch, auf dessen Kante sich Bücher und Zettel stapeln. »Ich habe noch ein oder zwei Ideen für den Film, die ich ausprobieren will.«
»Das Semester hat gerade erst angefangen, du Streber. Jetzt komm schon.«
Dasselbe habe ich zu Harper gesagt. Wenn ich hierbleibe, werde ich den ganzen Abend darüber nachdenken, warum sie nicht zugesagt hat, morgen zu kommen. Die Gedanken an sie werden mich zu Emma treiben, zu meiner Familie und dem ganzen Scheiß, den ich vergessen will.
Becca hat recht, ich sollte nicht hierbleiben und meinem Hirn erlauben, mich selbst zu zerfleischen. »Also schön. Auf zum Autio.« Ich zucke mit den Schultern, packe sie und kitzle sie durch. Auch wenn man sie für tough halten könnte, ist Becca im Herzen ein Kind, das noch immer mit meiner Schwester unter einem der großen Kastanienbäume im Central Park liegt und Eiscreme isst. Sie gackert und windet sich aus meinen Armen.
»Lass das, du Idiot.«
»Ich bin nicht der Idiot, sondern Will.«
Ihr Gesicht verdüstert sich, und obwohl sie mir ein Kissen vor die Brust haut, nickt sie.
»Warum bittest du ihn nicht einfach um ein Date, Becca?«
»Weil ich dazu zu altmodisch bin.«
Ich schüttle den Kopf, weil es fast nicht mit anzusehen ist, wie sehr die beiden umeinander herumeiern. »Du und altmodisch.« Ich zeige ihr einen Vogel. »Das ist ein Witz, und das weißt du. Wenn du nicht den ersten Schritt machst, werdet ihr erst zusammenkommen, wenn Will schon Viagra braucht, um noch einen hochzubekommen.«
Wieder trifft mich das Kissen. »Wann kochst du?«, wechselt Becca das Thema. »Ich verhungere. Wenn wir rechtzeitig am Autio sein wollen, solltest du langsam mal anfangen.«
Becca verhungert immer. Ich frage mich, wie sie es schafft, bei den Unmengen an Essen, die sie tagtäglich in sich reinschaufelt, so zierlich zu sein.
»Sobald wir endlich eine Waschmaschine bestellen«, kontere ich. »Ich habe dir letzte Woche schon einen Link per WhatsApp geschickt. Das günstigste Modell kostet gerade mal 150 Dollar. Das liegt im Budget. Ich bin es leid, meine Waschmaschine mit Gary von nebenan zu teilen.« Gary ist fünfzig, wohnt mit seiner pflegebedürftigen Mutter zusammen, hält nicht viel von Hygiene und ist immer dann im Waschsalon, wenn ich auch dort bin. Manchmal denke ich, er nutzt den steril gekachelten Raum als zweites Wohnzimmer. Oder er stalkt mich. Ich weiß nicht, was besorgniserregender wäre.
Becca scrollt durch ihre Nachrichten und ruft den Link eines Online-Händlers auf, den ich ihr geschickt hatte. Sie scrollt hoch und runter, tippt auf ihrem Smartphone herum und nickt dann.
»Done. Könntest du dann jetzt bitte kochen?«
Bei jedem anderen hätte ich das für einen Scherz gehalten, aber Becca ist so. Erst ziert sie sich wochenlang und dann kauft sie die Waschmaschine zwischen zwei Schlägen mit einem Daunenkissen. Weil sie Hunger hat und mich nur so zum Kochen bekommt.
Ich seufze. »Ich überweise dir morgen meinen Anteil.« Und bevor sie abwinken kann, frage ich: »Grünes Curry, die Dame?«
Sie nickt begeistert und spurtet vor mir her in die Küche, wo sie die Arbeitsfläche erklimmt. Becca sitzt immer neben dem Herd, während ich koche. Meistens ist sie mir im Weg und helfen tut sie selten – und trotzdem mag ich es.
KAPITEL 3
Harper
Der Bus braucht eine gute halbe Stunde bis Frenchtown, ein Vorort von Missoula, der sich zwischen zwei Gebirgsrücken quetscht. Ohne den Golfplatz, der den gesamten Ort aufwertet, wäre das Städtchen einfach nur trostlos.
Es ist bereits dunkel, als ich unser Haus erreiche, ein flacher Bungalow, der nicht durch seine Lage, wohl aber durch die vielen liebevollen Details besticht, mit denen Mom das Haus zu unserem Zuhause gemacht hat. Von hier aus ist es nicht weit bis zum Community Medical Center, wo Mom als Krankenschwester arbeitet, und die Miete ist trotz der Nähe zum Golfplatz und zum Zentrum bezahlbar. Das liegt mit Sicherheit daran, dass die winzige Siedlung nördlich von der Interstate 90 und südlich von der Durchgangsstraße gestreift wird.
Ich beeile mich und springe über die Stufen der Veranda zu der Fliegentür, durch die Lärm aus dem Inneren des Hauses sickert. Ben heult, und ich höre Moms Stimme an, dass sie gestresst ist, auch wenn sie versucht, es zu verbergen. Wenn ich ihre Ungeduld schon hören kann, spürt Ben sie wie mit einem Vorschlaghammer. Ich hätte vor über einer halben Stunde hier sein sollen. Jede Abweichung von der Regel bedeutet für Ben ein undurchdringliches Chaos. Schuldbewusst sehe ich auf die Uhr. Ich bin genau vierunddreißig Minuten zu spät, und das nur, weil ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, Mom zu versetzen und zu dieser dämlichen Party zu gehen. Dabei weiß ich, dass Mom zur Arbeit muss und sich auf mich verlässt. Ich kann nicht glauben, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, sie und Ben hängen zu lassen. Nur weil es mir gefallen hat, wie meine Zellen reagiert haben, als Ashton gestern seine azurblauen Augen auf mich gerichtet hat. Er hat sicher längst passenden Ersatz gefunden. Es versetzt mir einen Stich. Dabei sollte es das nicht. Denn er ist wohl kaum der Typ, der mehr als Spaß im Sinn hat. Es gibt eindeutig wichtigere Dinge im Leben. Ich kann für eine Party mit einem heißen Typen nicht einfach meinen Alltag über den Haufen werfen.
»Bist du das, Harps?« Ich höre, wie Mom in der Wohnküche ihre Sachen zusammenrafft. Dann eilt sie zu mir in den Flur, wo ich gerade meine Schuhe von den Füßen streife. Sie gibt mir einen liebevollen Kuss auf die Stirn. Dass sie sich, in all dem von mir verschuldeten Chaos, die Zeit dafür nimmt, macht mein schlechtes Gewissen noch größer. Sie fragt nicht einmal, warum ich zu spät bin. Das ist kein Desinteresse, sie vertraut einfach darauf, dass ich niemals ohne guten Grund den Zeitplan durcheinanderbringen würde.
Wenn sie wüsste.
»Er ist in der Küche. Heute war kein guter Tag. Vielleicht guckt ihr die Sterne an, damit er sich beruhigt. Er sollte längst im Bett sein.«
»Ich mach das schon«, murmle ich und will eigentlich nur, dass Mom geht – damit mein schlechtes Gewissen aufhören kann, von innen gegen meine Schädeldecke zu hämmern. Sobald sie aus dem Haus ist, werde ich versuchen, die Sache mit Vanilleeis und einem Kapitel Peter Hase geradezubiegen. Ben ist eigentlich zu alt für die Geschichte, aber er klammert sich daran fest wie an so viele andere Dinge, die seinem Leben Halt geben.
»Ich muss wirklich dringend los, sonst macht mich die Oberschwester einen Kopf kürzer. Bis morgen früh, meine Kleine.« Mit einem letzten Kuss schlüpft Mom durch die Tür hinaus in die Dunkelheit. Sie geht die halbe Meile zum Krankenhaus wie jeden Abend zu Fuß. Um diese Zeit fährt kein Bus mehr und Mom steht sowieso nicht auf das Gedränge in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vielleicht weil sie es durch Bens Autismus gewohnt ist, Abstand zu suchen. Sie mag die Stille der Nacht, die Anonymität des einsamen Feldwegs, der sich an der Interstate entlangschlängelt und schließlich einige Fuß westlich des Haupteingangs des Frenchtown Community Medical Centers in die Demer Street mündet. Das sind ihre zehn Minuten Ruhe, bevor sie das strapazierende Leben mit einem stark autistischen Sohn gegen den stressigen Klinikalltag eintauscht. Diese habe ich ihr heute geklaut. Sie wird sich abhetzen müssen und trotzdem nicht rechtzeitig zum Schichtbeginn im Krankenhaus sein.
Ich hänge meine Jacke an die Garderobe und betrete die helle Wohnküche. Blumen in selbst gemachten Töpfen säumen die Fenster und heben sich gegen das Hellblau der Wände ab. Bens Lieblingsfarbe, in der wir alle Räume gestrichen haben. So etwas Einfaches wie die Wandfarbe kann Bens Welt aus den Angeln heben. Oder ihm helfen, sich zu beruhigen. Das ganze Haus ist nach seinen Bedürfnissen gestaltet. In diesen vier Wänden ist er relativ stabil. Heute nicht. Und ich weiß, dass auch mein Zuspätkommen dafür verantwortlich ist.
Mein kleiner Bruder sitzt auf dem Küchenfußboden und wiegt sich gleichmäßig hin und her. Mit der Hand schlägt er sich im Takt der Worte, die seinen Mund verlassen, gegen die Schläfe.
»Kassiopeia, Kepheus, Kiel des Schiffs, Kleine Wasserschlange, Kleiner Wagen.« Er zählt die Sternenbilder in alphabetischer Reihenfolge auf. Dad hat ihn dazu gebracht, die Sterne zu lieben, und Ben hat eine geradezu manische Obsession für die Astronomie entwickelt. Jedes Sternenbild wird von einem Klatschen begleitet, wenn Bens Hand auf seine dunkelbraunen Locken fällt. Sie fallen ihm tief ins Gesicht. Er lässt sich seine Haare selten schneiden. An einem guten Tag schafft Mom es manchmal, das wirre Chaos etwas zu kürzen, aber einen vernünftigen Haarschnitt hatte Ben noch nie.
»Ben?« Er wird mich nicht ansehen, aber meine Stimme führt meistens dazu, dass er zumindest aufhört, sich selbst zu schlagen. Ich habe das dringende Bedürfnis, ihn zu umarmen. Aber das ist eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, seitdem sich Bens Autismus mit zwei Jahren manifestiert hat: Meine Bedürfnisse oder die von Mom sind nicht dieselben wie Bens. Also hocke ich mich neben ihn und sehe ihm eine Weile zu. Auch wenn Bens Art oft abweisend ist und einem das Gefühl geben kann, er würde Nähe hassen, ist es nicht so. Ich weiß, dass es ihm hilft, wenn ich da bin und ihm die Zeit gebe, sich zu beruhigen. Mein Magen knurrt, aber ich bleibe etwa eine halbe Armlänge von Ben entfernt auf dem Boden hocken und ignoriere das Ziehen in meinen Eingeweiden. Genau wie den dämlichen Gedanken, dass ich gerade lieber auf einer Studentenparty wäre und dass ausgerechnet ein Typ wie Ashton der Grund dafür ist.
»Kreuz des Südens, Leier, Löwe …«
Er ist bei L angekommen, und ich hoffe, dass wir weniger als einen Durchlauf brauchen, bis er sich wieder gefangen hat. Sonst werde ich vermutlich mitten in unserer Küche verhungern.
»Ben?«, versuche ich noch mal zu ihm durchzudringen und habe dieses Mal Erfolg. Er sieht auf und unterbricht seine manische Handbewegung. Sein Blick gleitet an mir vorbei ins Leere, aber ich weiß, dass er in diesem Moment seine Aufmerksamkeit auf mich richtet.
»Wollen wir uns ein Eis machen und dann in dein Zimmer gehen?« Eis liebt Ben mindestens so sehr wie die Farbe Blau und nur ein kleines bisschen weniger als Sterne.
»Nördliche Krone, Oktant, Orion.« Er runzelt die Stirn und plötzlich klart sich sein Gesichtsausdruck auf. »Eis und dann Sternenkuscheln.« Er steht auf, als wäre nichts gewesen, und läuft zum Eisfach. »Und Peter Hase.«
Natürlich. Manchmal könnte ich Mom erwürgen, dass sie Ben dieses Buch mitgebracht hat. Seufzend rapple ich mich auf und folge meinem Bruder. Ich hole eine Familienpackung Vanilleeis aus dem Gefrierfach, stelle Schokosoße und bunte Streusel dazu und baue alles nach dem immer gleichen Muster auf der Arbeitsfläche auf. Sollte ich den Platz der Soße mit dem der Streusel vertauschen, könnte das zu einem Zusammenbruch führen, der den von eben in epischem Ausmaß in den Schatten stellt.
Als Ben noch kleiner und ich wesentlich jünger war, habe ich solche Anfälle bewusst provoziert. Am Anfang kam ich nur schwer damit klar, dass Ben so viel von Moms und Dads Aufmerksamkeit einforderte. Ich wollte ihn ehrlich hassen – und konnte es doch nicht. Niemand könnte Ben hassen.
Ich liebe meinen kleinen Bruder. Das ist eine einfache, unumstößliche Wahrheit, die mich nach einem langen Tag Eiscreme anstatt einer richtigen Mahlzeit essen lässt.
Ich sehe Ben zu, wie er zwei Schüsseln mit der Präzision eines Neutronenmikroskops auf exakt dieselbe Weise füllt. Das dauert manchmal so lange, dass am Ende nur Eissuppe bleibt. Heute ist er schnell fertig und präsentiert mir das Ergebnis mit einem Lächeln, das nicht für mich bestimmt ist, sondern einfach seine Zufriedenheit widerspiegelt.
Er läuft in seiner leicht linkischen Art in sein blaues Zimmer am Ende des Flurs und vergräbt sich dort mit der Schüssel Eis in einem Berg aus Kissen, Decken und Laken. Ich habe mich schon oft gefragt, wieso sein Autismus bei dem Chaos aus Stoffen haltmacht und er diese nicht akribisch nach Farben oder Mustern sortiert. Eine Antwort darauf gibt es nicht. Genauso wenig wie darauf, warum ausgerechnet Ben an Autismus leidet. Oder warum seine autistische Spektrumsstörung so stark ausfällt, dass er nicht in der Lage ist, der Welt außerhalb dieses Hauses zu begegnen. Mom hat viel ausprobiert. Schulen, Entwicklungszentren, sogar eine Behindertenwerkstatt, aber die waren entweder mit Bens heftigen Anfällen völlig überfordert oder die Hilfe war schlichtweg zu teuer. Oft traf beides zu.
Ich lege mich zu Ben und genieße mein Eis, das ein wenig zu kalt in der Leere meines Magens herumdümpelt. Ich warte, bis er aufgegessen hat, und lösche dann das Licht. Der Raum ist dunkel, bis auf die fluoreszierende Farbe, die warm und weich vom dunkleren Blauton der Decke abstrahlt. Dieses Kunstwerk war Moms und mein Geschenk zu Bens fünftem Geburtstag. Das war kurz nach Dads Tod, als Ben nicht mehr in den Garten wollte, um die echten Sterne anzusehen. Bens Arzt meinte, das läge daran, dass die Erinnerungen an Dad Emotionen hervorriefen, mit denen Ben nicht umgehen könne. Nach Dad auch noch seine geliebten Sternenbilder zu verlieren, setzte Ben jedoch dermaßen zu, dass er wochenlang von einem Anfall in den nächsten stolperte. Er weinte, verletzte sich, schrie. Mom war am Ende, ich kurz davor, meinen Verstand zu verlieren. Dann habe ich in einer Dekorationssendung gesehen, wie die Moderatorin die Wand eines Kinderzimmers mit fluoreszierender Farbe bemalte. Ein Prinzessinnenschloss, das gleichzeitig Nachtlicht war.
Mom und ich haben die Farbe im Internet bestellt und das komplette Sonnensystem an die Decke von Bens Zimmer gemalt. Wir wären fast verzweifelt. Mom ist von der Leiter gefallen und ich habe mich ernstlich mit dem Abklebeband angelegt, aber wir hatten auch Spaß. An diesem Abend kam Ben das erste Mal seit Wochen wieder zur Ruhe. Wie jetzt lag er unter dem Sternenhimmel und fuhr zufrieden mit einer Hand in der Luft die Sterne und Planeten an der Decke nach. Dazu murmelt er in alphabetischer Reihenfolge die Namen sämtlicher Sternbilder.
Erst als Ben alle Sternbilder aufgezählt hat, ziehe ich Peter Hase hervor und beginne zu lesen. Ben schließt die Augen und malt mit seiner Hand unbestimmte, aber immer gleiche Muster auf seine Brust. Ich lege eine der Decken in einer knappen Bewegung über seinen Körper. Ben kommentiert das mit einer doppelten Drehung seiner Hand, beruhigt sich aber sofort wieder.
Zehn Minuten später ist er eingeschlafen. Ich stelle das Buch zurück an seinen Platz, direkt neben die ordentlich aufgereihten Autos. Es hat einige Zeit und diverse Wutanfälle gedauert, bis ich verstanden habe, dass er sie nach Farben und deren Anfangsbuchstaben im Alphabet ordnet.
Ich sehe ihm eine Weile beim Schlafen zu und streiche ihm die Locken aus der Stirn. Eine Geste der Zuneigung, die ich mir nur erlaube, weil Ben schläft. Nur dann kann ich ihn berühren und seinen warmen, kleinen Körper an meinem spüren. Für einen Moment ist es, als wäre Ben nicht besonders.
Ich genieße die Ruhe, seinen regelmäßigen Atem, das Glimmen der Sterne über uns, bevor ich mich aufrapple und die Schüsseln in die Spüle in der Küche räume. Ich lasse Wasser hineinlaufen und überlege einen Moment, sie einfach stehen zu lassen. Wenn Ben morgen früh wach wird, wird ihn das schmutzige Geschirr aufregen, also gebe ich mir einen Ruck und spüle es ab, obwohl ich bereits todmüde bin.
Mein Blick fällt auf Ashtons nur noch diffus zu erkennende Nummer auf meinem Handrücken. Ich eliminiere das bescheuerte Kribbeln, das von der Tinte aus über meine Haut kriecht, indem ich die Zahlen mit der rauen Seite des Schwamms bearbeite, bis nur noch gerötete Haut übrig ist. Dann trockne ich die Schüsseln notdürftig ab und stelle sie zurück in den Küchenschrank. Ich mache mich bettfertig und schleppe mich anschließend in mein Zimmer. Auch dieser Raum ist in einem zarten Blau gestrichen, obwohl ich eine andere Farbe bevorzugt hätte. Ich lasse mich auf das Bett plumpsen und ärgere mich darüber, dass ich mich jetzt, wo meine Gedanken nicht mehr um Ben kreisen, frage, ob Ashton wohl aufgefallen ist, dass ich nicht zu der Party gekommen bin.
Ich schnappe mir meinen Zeichenblock und beginne die harten Kanten seines Kinns zu skizzieren, die weiche Linie seiner Lippen, die verwuschelten kinnlangen Haare. Während der Schulzeit habe ich sehr viel gezeichnet, hatte sogar die Idee, Kunst zu studieren, aber die Aussicht, später im künstlerischen Bereich einen Job zu bekommen, der krisensicher ist, ist eher gering. Und ich brauche Stabilität. Für Mom. Und vor allem für Ben.
Ich zeichne nur noch selten. Und jedes Mal, wenn ich es tue, werfe ich die Bilder am Ende in den Müll. Als ich mit dem Porträt fertig bin, starre ich einen Augenblick auf die Zeichnung, die Ashton ziemlich gut, wenn auch nicht perfekt trifft. Dann zerknülle ich auch dieses Papier. Ich ziele auf den Mülleimer, verfehle ihn aber um mehrere Zentimeter, sodass das Papierknäuel unter die Heizung kullert und im Schatten des Schreibtisches liegen bleibt. Ich schlage den Arm über meine Augen und versuche, Ashton aus meinem Kopf zu verscheuchen. Aber er hat es sich mit seinem Killerblick und seinem beängstigend perfekten Lachen mitten im Emotionszentrum meines Hirns bequem gemacht.
KAPITEL 4
Ashton
Die Bässe dröhnen durch den verrauchten Raum des Kappa-Sigma-Wohnheims und bewegen die Massen. Ich lehne an der Wand schräg gegenüber dem Eingang und mache mir nichts vor. Anstatt mit Becca und Will einen draufzumachen, stehe ich hier, weil ich auf Harper warte.
Ich bin kein besonders geduldiger Mensch. In der Regel gebe ich schnell auf, wenn eine Frau nicht interessiert ist. Und dass Harper noch immer nicht aufgetaucht ist, obwohl es bereits weit nach ein Uhr nachts ist, kann man nicht anders interpretieren. Auch wenn mein Hirn sich bemüht, eine andere Erklärung zu finden. Sie hat mich versetzt. Zum zwanzigsten Mal in der letzten halben Stunde checke ich mein Handy, aber sie hat auch keine Nachricht geschickt. Will stößt mich von hinten an, während mir Becca einen Pappbecher mit eindeutig alkoholischem Inhalt direkt vor die Nase hält. Ich greife zu und kippe ihn in einem Zug hinunter. Irgendein scharfes Zeug. Vermutlich hat jemand selbst gebrannten Schnaps mitgebracht.
»Prost, ich hoffe, der war gut«, brüllt Becca über die Musik hinweg.
Sie sieht mich vorwurfsvoll an und deutet auf ihren eigenen und Wills Becher. Sie wollten wohl mit mir anstoßen.
»Hast echt miese Laune«, stellt sie immer noch brüllend fest. Ich konzentriere mich auf meine Freunde. Das ist besser, als mich meiner unterirdischen Laune hinzugeben. Ich sollte einen Scheiß darauf geben, dass Harper mich versetzt hat. Im Grunde kenne ich sie nicht. Und da sie nicht will, dass wir das ändern, sollte ich sie abhaken.
Ich beuge mich zu Becca hinunter. »Komm, ich mach’s wieder gut.« Becca, Will und Alkohol sind die perfekte Ablenkung.
Ich kämpfe mich bis in die Küche durch, fülle meinen Pappbecher mit der klaren, scharf riechenden Flüssigkeit von vorhin auf. Auf der Flasche klebt kein Etikett, was meine Annahme von selbst gebranntem Stoff stützt. Dann stoße ich mit Becca und Will an. Will tanzt dabei zu der ohrenbetäubenden Musik. Genau genommen tanzt er nicht allein, sondern mit Becca. Die beiden haben schon gut einen sitzen, sonst würden sie einander nicht so nahe kommen. Sieht vielversprechend aus. Vielleicht schaffen ihre alkoholenthemmten Körper, was die beiden nüchtern nicht hinbekommen. Ich sollte versuchen aufzuholen, was den Alkoholpegel betrifft. Vielleicht hat der Abend dann noch eine Chance, kein komplettes Harper-Desaster zu werden.
KAPITEL 5
Harper
Ich wache auf und schlurfe noch immer schlaftrunken in die Küche. Mom ist schon im Bett und erholt sich von der Nachtschicht im Krankenhaus. Bevor sie sich hingelegt hat, hat sie noch Kaffee gekocht und den Tisch gedeckt. Ihr habe ich es auch zu verdanken, dass Ben bereits auf seinem Stuhl sitzt und seine Froot Loops nach Farben sortiert, anstatt mich wie sonst penetrant zu wecken. Bevor ich mich zu ihm an den Tisch setze, fülle ich einen Becher mit der rettenden Portion Koffein. Ich stütze den Kopf in die Hände und frage mich, warum der so viel wiegt. Ich habe schlecht geschlafen, und das lag vor allem daran, dass Ashton wie ein Geist durch meine Träume gepoltert ist.
»Bist du traurig?«, fragt Ben, ohne von seiner Aufgabe aufzusehen. Die blauen Froot Loops sind bereits vollständig sortiert, und das Wort Blau befindet sich praktischerweise im Alphabet ganz vorn, weswegen Ben die Loops als Erste knabbert. Immer vier Stück zusammen mit einem Schluck Milch aus dem Glas, das Mom neben seiner Schüssel positioniert hat. Währenddessen widmet er sich dem Sortieren der übrigen Farbvarianten der Frühstücksflocken.
Mom hat Ben Emotionen erklärt, aber da er sie nicht selbst nachempfinden kann, ist seine Trefferquote miserabel. Es überrascht mich, dass er ausgerechnet jetzt nahe dran ist, und ich schäme mich etwas, dass ich so tue, als würde er wie immer danebenliegen.
»Wie sieht ein trauriges Gesicht aus, Ben?«, frage ich ihn und sehe ihn erwartungsvoll an. Er versucht ein trauriges Gesicht zu machen, scheitert aber. Unbeholfen kratzt er sich am Kopf und blättert dann in seinen laminierten Karten, die er am Gürtel seiner Hose befestigt hat. Er zeigt auf die Karte, die ein Foto von Mom mit heruntergezogenen Mundwinkeln und Tränen auf den Wangen zeigt.
»Sehe ich so aus?«
Er reagiert nicht direkt durch ein Kopfschütteln, sondern verharrt einen Moment, bevor er suchend durch die Karten blättert. Er kann sich nicht entscheiden, welche Karte meinen Zustand wiedergibt.
Manchmal ist es erstaunlich, wie exakt Ben die Gefühlslage seines Gegenübers erkennt, gerade weil er sie nicht deuten kann. In mir kämpfen die unterschiedlichsten Emotionen miteinander. Ich bin irritiert, weil Ashton noch immer in meinem Kopf herumspukt. Wütend, weil ich wirklich gern zu der Party gegangen wäre. Und bedrückt, weil ich so etwas überhaupt denke, anstatt einfach zu akzeptieren, dass Bens Bedürfnisse wichtiger sind als meine.
Mom tut alles dafür, dass ich studieren kann, obwohl ihr das viel abverlangt. Ich sollte dankbar sein für diese Chance und mich nicht beklagen, weil mein Leben anders ist als das anderer Mädchen in meinem Alter.
Weder Ben noch Mom haben sich dieses Leben ausgesucht. Keiner von uns. Aber so ist es nun mal. Einen autistischen Bruder zu haben, verlangt manchmal Opfer, aber trotz allem bin ich froh, dass Mom, Ben und ich unser Leben gemeinsam stemmen. Wir haben uns. Sind glücklich. Zumindest die meiste Zeit. Und doch ist ein versteckter, egoistischer Teil meines Herzen traurig darüber, dass ich nie erfahren werde, ob Ashton es wert gewesen wäre, hinter seine Fassade zu blicken.
»Ich bin müde«, schwindele ich, um Ben zu helfen. Ich blättere die Karten um, bis ein Foto von ihm erscheint, auf dem er kleine, gerötete Augen hat, während er wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf einem der Küchenstühle hängt.
Ben lacht. Das Foto bringt ihn immer zum Lachen, und ich stelle seine Pose nach, einfach um noch mal sein Lachen zu hören. Dann klappe ich die Karten um, bis das Foto von Mom, Dad, mir und Ben als Baby direkt nach der Geburt oben auf dem Stapel liegt. Wir strahlen alle drei, als wären Ostern, unsere Geburtstage und Weihnachten auf einen Tag gefallen.
»Du bist müde und glücklich?«, fragt Ben und sortiert unermüdlich weiter seine Froot Loops.
Es ist ein guter Morgen, deswegen lege ich meine Hand auf seine. Nur kurz. So lange, wie ich denke, dass er die Nähe aushalten kann. »Nicht ich, wir. Wir sind glücklich.«
»Weil wir einander haben«, rattert Ben die Worte herunter, die Mom ihm seit Jahren immer wieder sagt. Ich weiß nicht, ob er fühlt, was die Worte ausdrücken, aber ich mag es, dass er sie ausspricht.
»Genau, weil wir einander haben, Tiger.«
»Tiger haben scharfe Zähne und wohnen in Asien. Das ist weit weg. Ich bin kein Tiger.«
Ich lache und fülle mir ebenfalls Froot Loops in eine Schüssel, die auf meinen Platz steht. »Du hast recht, Ben. Du bist kein Tiger.«
»Ich bin nämlich ein Kind.« Er blättert durch seine Karten und nickt. »Ein Junge.«
»Ich weiß, mein Schatz.«
»Piraten haben Schätze«, wirft Ben ein, und seine Stimme bleibt monoton, ohne erkennbare Satzmelodie oder Betonung, die seine Aussage als Scherz erkennbar machen würde. »Schätze sind meistens aus Gold. Ich bin kein Schatz«, sagt er.
Manchmal glaube ich, er muss denken, wir wären alle nicht ganz bei Trost, weil wir ständig falsche Dinge sagen. Ben versteht Zweideutigkeiten nicht, was oft ungewollt komisch ist.
»Hättest du Lust, einmal ein Pirat zu sein?«
»Ich habe kein Schiff und der Clark Fork River ist zu flach für ein richtiges Piratenschiff. Außerdem muss man groß sein, um ein Pirat zu sein. Kinder dürfen keine Schwerter tragen.« Ben unterstreicht seine Worte mit einer steten halben Drehung des Handgelenks.
»Das stimmt«, gebe ich zu. »Allerdings weiß ich nicht, ob der Clark Fork River wirklich zu flach ist. Wir könnten nachsehen gehen.«
Ben scheint mit sich zu ringen. Er ist gern draußen in der Natur, und die Aussicht, vielleicht doch ein Piratenschiff zu sichten, ist verlockend, aber er weiß auch, dass die Welt oft zu groß für ihn ist.
»Ich räume auf und du gehst dich anziehen, in Ordnung?«
Er zögert noch immer, flitzt dann aber doch los, in Richtung seines Zimmers.
»Und Ben, schön leise sein. Mom schläft.« Er nickt mehrmals heftig und schleicht dann übertrieben langsam die restlichen Meter zu seiner Zimmertür. Ich muss grinsen, weil es zeigt, wie sehr er Mom und mich trotz seiner Unfähigkeit, dies auszudrücken, liebt.
Ich esse mein Frühstück, wasche dann unsere Schüsseln aus und schneide ein paar Äpfel auf. Ben isst sie nur, wenn jedes Viertel des Apfels wie ein Schiffchen ausgehöhlt wird. Zwölf davon packe ich in seine dunkelblaue Frühstücksbox und verstaue sie in seinem Rucksack, stelle noch eine Flasche Mineralwasser ohne Kohlensäure dazu. Das unkontrollierte Prickeln von Kohlensäure bringt ihn aus dem Konzept. Ich ziehe den Reißverschluss des Rucksacks zu und achte darauf, dass die Verschlüsse exakt mittig oben zusammenstoßen.
Ben taucht auf und ich seufze theatralisch. Er trägt seinen Pyjama, dazu blaue Gummistiefel und eine leuchtend blaue Sweatshirtjacke mit dunkelblauem Teddyfell. Wenigstens kein Color-blocking. Als alltagstauglich würde ich sein Outfit aber auch nicht bezeichnen.
»Du bist wütend?«, fragt Ben, und die Drehung seines Handgelenks wird hektischer.
»Nein, Tiger. Ich bin nicht wütend.«
»Ich bin kein Tiger«, stellt er noch mal fest, und ich bin mir sicher, dass er mich entweder für nicht besonders helle oder extrem vergesslich hält. Die meisten Leute denken, es bräuchte viel Geduld, um mit einem stark autistischen Kind zusammenzuleben. Das stimmt schon, aber ich glaube, es ist für Ben wesentlich anstrengender, mit der Ironie und Zweideutigkeit klarzukommen, die sich in fast jeden unserer Sätze mogeln.
Ich überlege, ob ich darauf bestehen soll, dass Ben sich etwas Richtiges anzieht, und beschließe dann, dass richtig ein dehnbarer Begriff ist.
»Ich weiß, kein Tiger. Habe ich abgespeichert. Lass uns los. Dann kann Mom schlafen.« Ich halte ihm die Tür auf, und Ben springt die Verandastufen herab, wie er es immer tut. Die ersten zwei Stufen auf dem linken Bein, die letzten beiden auf dem rechten. Dann läuft er zum Gartentor und wartet dort auf mich. Mechanisch schiebt er seine Hand in meine und wir überqueren gemeinsam die viel befahrene Durchgangsstraße. Sobald wir die andere Seite erreichen, löst er sich eilig wieder von mir.
Es hat lange gedauert, bis ich es nicht mehr persönlich genommen habe, dass Ben meine Berührungen als unangenehm empfindet. Er sieht sie als notwendiges Übel, wenn er zum Beispiel eine Straße überqueren muss, aber es stresst ihn. Ich laufe mit ihm hinunter zum Fluss und wir wandern eine ganze Weile am Ufer entlang. Wenn man Ben hier draußen beobachtet, könnte man fast denken, ihm fehle nichts. Wie jedes andere Kind tollt er durch das Unterholz, schlägt mit einem Ast das Gestrüpp beiseite und quietscht, als ein Frosch direkt vor seiner Nase in das Wasser springt. Am Rande des King Ranch Golf Course setzen wir uns auf einen umgestürzten Baum und Ben isst seine Äpfel. Er bietet mir sogar zwei Stücke an, die ich genüsslich kaue. Weil sie herrlich süß sind. Und weil es sich nach einem Sieg anfühlt, dass Ben sie mir gegeben hat. Denn das bedeutet, dass er sich mit meinen Bedürfnissen beschäftigt hat.
Ich weiß, dass es nicht im eigentlichen Sinne ein Sieg ist. Autismus ist nichts, was man besiegen kann. Bens Zustand wird nie besser werden. Er wird sein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein, aber ich habe gelernt, einen guten Tag zu erkennen und ihn zu genießen.
Ich rutsche vom Baumstamm und lege mich in das dichte Gras. Ben spielt am Fluss. Ich höre ihn Informationen über alles Mögliche herunterbeten, was er im Schlamm am Ufer findet. Meistens sind es Passagen aus seinen Kinderwissenschaftsbüchern, einiges hat er aus dem Fernsehen.
Es riecht nach feuchter Erde, frischem Gras und klarer Luft. Genauso hat Ashton gerochen. Wie ein perfekter Sommermorgen in Montana. Ich lege meinen Kopf in den Nacken und sehe nichts als azurblauen Himmel, der mich unwillkürlich an Ashtons Augen erinnert. Ben hat recht. Blau ist wirklich eine Knallerfarbe.
KAPITEL 6
Ashton
Sie ist nicht gekommen. Nach einigen Shots war es mir irgendwann gleichgültig. Das Problem ist, dass ich wieder nüchtern bin, was bedeutet, ich habe einen epischen Kater und es ist mir nicht länger egal.
Becca sitzt mir gegenüber und betrachtet mich wie ein missglücktes Experiment. Ich habe die Arme auf den Tresen der Küche gestützt und mein Kopf liegt wie ein Bleigewicht darauf. Wenn ich nicht aufpasse, knallt er noch runter und hinterlässt einen Krater in der Arbeitsplatte.
»Alles klar bei dir?«, fragt sie und kaut dabei auf ihrem Frühstück rum. Ich glaube, sie hat sich extra für Crunchy Nuts entschieden, um meine Selbstbeherrschung zu testen.
»Hmm«, grunze ich undeutlich und sehe, wie Becca vom Stuhl rutscht und ein Glas mit Wasser füllt. Sie stellt es vor mich und lässt eine Kopfschmerztablette hineinplumpsen.
»Frühstück für Champions«, sagt sie fröhlich und kaut dann ohrenbetäubend laut weiter. Becca trinkt so viel wie ich, wiegt die Hälfte und hat trotzdem nie Probleme am Morgen danach. Das ist nicht fair. Ich kippe die aufgelöste Tablette hinunter. Für einige Sekunden fühlt es sich so an, als müsste ich den gestrigen Abend in die Toilettenschüssel kotzen. Würde zu meiner Laune passen. Aber dann beruhigt sich mein Magen wieder, und ich lege meinen Kopf auf dem Unterarm ab, damit die Tablette in Ruhe wirken kann. Mom hat immer behauptet, dass der Körper Ruhe braucht, damit sich die Wirkstoffe entfalten können. Ich glaube zwar längst nicht mehr daran, einfach, weil so ziemlich alles aus Moms Mund gelogen war, aber trotzdem ist es eine der guten Erinnerungen: Mom, die sich zu mir auf das Sofa gelegt und mir so lange über die Stirn gestrichen hat, bis meine Kopfschmerzen von der Tablette in Watte gehüllt waren und ich einschlafen konnte. Dass die Kopfschmerzen die einzige Möglichkeit waren, Moms Aufmerksamkeit zu erlangen, zeigt, wie kaputt meine Familie war. Ich schüttle die Gedanken ab und blinzle zu Becca hinüber. »Warum bist du nur so ekelhaft gut drauf?«
»Um das Gegengewicht zu dir Trauerkloß zu bilden.« Sie lacht und schlägt mit dem Geschirrtuch nach mir. Ich mache mir nicht die Mühe, ihr auszuweichen.
»Tu wenigstens so, als wärst du lebendig. Will kommt gleich, und du weißt, dass er eine Zombiephobie hat.«
»Will ist ein Weichei.«
Becca gibt mir einen Kuss auf die Schläfe und schiebt mich dann resolut in die Senkrechte.
»Du hättest ihn auf keinen Fall dazu überreden sollen, The Walking Dead zu gucken. Du weißt, wie er ist. Seitdem springt er mir ständig im Dunkeln auf den Arm.«
»Ich werde es mir merken«, brumme ich. »Mit Will nur Disney-Filme angucken.« Ich notiere es auf ein unsichtbares Merkblatt und vergrabe dann meinen Kopf wieder zwischen den Armen.
»Was hast du heute noch vor?«
Will und Becca wollen heute an den See fahren und chillen. Sie haben mich gefragt, ob ich mitwill, aber ich habe das Gefühl, als würde es zwischen den beiden endlich in die heiße Phase gehen. Dem will ich auf keinen Fall im Weg stehen.
»Schlafen?« Ich deute auf meinen Kopf und zucke mit den Schultern. »Keine Ahnung. Brady wollte später noch vorbeikommen und ’ne Runde zocken. Und heute Abend muss ich arbeiten.«
»Wir können dich später zur Arbeit fahren und Brady kann dich genauso gut dort treffen. Du solltest wirklich mitkommen.«
»Und euch beim Sex zusehen?« Ich schüttle mich und weiche dieses Mal Beccas Schlag aus. »Dagegen ist The Walking Dead ein Sonntagsspaziergang. Nein, danke. Außerdem habe ich noch jede Menge zu tun.« Zum Beispiel mich zum hundertsten Mal fragen, warum, zum Henker, Harper nicht aufgetaucht ist.
»Dir setzt die Abfuhr dieses Mädchens immer noch zu.«
Manchmal hasse ich dieses unsichtbare Band zwischen Becca und mir, das mich zu einem offenen Buch für sie macht.
»Es setzt mir nicht zu«, behaupte ich.
»Aha«, sagt Becca, und die Art, wie sie jeden Buchstaben einzeln betont, zeigt, dass sie mir nicht glaubt.
»Ich habe zu tun, und jetzt verschwinde endlich.« Ich gebe Becca einen Kuss auf die Wange, ignoriere ihre hochgezogene Augenbraue und stecke ihr, schon im Rückzug begriffen, ein Kondom in die Gesäßtasche. »Und sag Will, er soll nicht die armen Wildtiere traumatisieren.« Dann verschwinde ich schleunigst in mein Zimmer, bevor Becca mir eine runterhauen kann.
KAPITEL 7
Harper
Ich liebe Sonntage. Sie sind ruhig, blau. Und ich mag es, dass wir alle zusammen sind, ohne Termine, Stress oder Druck. Mom hat frische Waffeln mit Sahne und Kirschen gemacht. Sie und ich liegen auf der Veranda in der alten Patchwork-Hängematte. Es ist windstill, sodass sich die träge Spätsommerhitze zwischen den Holzbohlen staut. Ben hat Reste von allem, was er heute gegessen hat, auf Gesicht und Schlafanzug verteilt und spielt im Garten. Er schaukelt. Früher mochte er die Bewegung nicht, heute kann er nicht genug davon bekommen. Mir wäre nach zwei Stunden Dauerschaukeln so schlecht, dass ich mir meine Waffeln noch mal durch den Kopf gehen lassen würde. Aber Ben lächelt und schaukelt. Und lächelt und schaukelt.