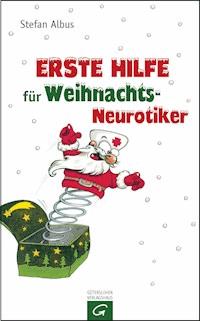8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Das Anti-Weihnachtsbuch – damit das Fest der Feste doch noch schön wird
- Ein alternatives satirisches Weihnachtsbuch
- Für alle, die Weihnachten »unbeschadet« überstehen wollen
- Das ultimative Geschenk für alle Weihnachtshasser
Man merkt, dass Weihnachten naht, wenn rechtschaffene Bürger sich für adventliche Illuminations-Orgien verschulden, aus dem Radio klebriger X-Mas-Pop anstelle frommer Lieder tropft, Geschenkewahn, Kalorienterror und White-Christmas-Paranoia vorherrschen. Ist dagegen ein Kraut gewachsen?
Wir empfehlen die satirischen Glossen von Stefan Albus, in denen er skurrile Phänomene der Advents- und Weihnachtszeit pointiert aufs Korn nimmt. Kopfschüttelnd fragt er sich, warum in Nikolausstiefeln immer noch Nüsse stecken, die spätestens seit Erfindung der Schokolade kein Kind mehr freiwillig isst. Oder wie viele Reklameprospekte man braucht, um eine Bibel aufzuwiegen. Und warum das Schönste aller Feste ausgerechnet in der fiesesten Jahreszeit liegt. Albus recherchiert, beobachtet und wertet – extrem subjektiv, aber nicht verletzend. Sein Ziel: Menschen, die die Adventszeit unbeschadet überstehen und das Fest der Feste vielleicht doch noch genießen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Ähnliche
Stefan Albus, geboren 1966, Dr. techn., Chemiker, arbeitet seit 1996 als Wissenschafts-und Fachjournalist, Ghostwriter, Redenschreiber und Buchautor.
Er erhielt mehrere Stipendien; seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Förderpreis zum Literaturpreis Ruhrgebiet. Albus lebt in Herne.
www.xmassaker.de
Valeria Barth, geb. 1981, studierte Kunst und Grafik Design sowie Illustration. Als freiberufliche Designerin und Illustratorin arbeitet sie für verschiedene Verlage. Ihre besondere Vorliebe gilt dem Entwickeln von Charakteren und dem Comic.
Inhaltsverzeichnis
TÜRCHEN AUF!
Über das, was sich der Autor beim Schreiben dieses Buchs gedacht hat. Wie man uns geklaut hat. Und wie wir es uns zurückholen.
He, wie durchgeknallt muss man eigentlich sein, um im Frühsommer bei 30 Grad im Schatten ein Buch über Weihnachten zu schreiben? Mit Glühwein auf dem sonnenwarmen Schreibtisch? Nun – sicher nicht verrückter als Wham!-Sänger George Michael: Der Mann hat sich allen Ernstes im Sommer 1984 vor ein Mikrofon gestellt, um einen Song einzusingen, der eigentlich Last Easter heißen sollte. Das Werk war mal eben auf Last Christmas umgetextet worden, damit seine Plattenfirma noch schnell was auf den Weihnachtsmarkt werfen konnte. Ich stelle mir vor, wie George, in Bermuda-Shorts und Hawaiihemd gewandet, einen Caipirinha mit viieeel Eis in der Hand, seinem Toningenieur einen Vogel zeigt, als der ihm die bekannten Rentierschellen in die Kopfhörer mischt.
Aber dieses Buch muss sein! Denn in Deutschland läuft etwas schief. Schockierte Supermarkt-Kunden müssen in Flipflops und T-Shirt mit ansehen, wie die Angestellten das Regal mit der Sonnenmilch zur Seite schieben, um Platz für das Gestell mit den Spekulatius-Packungen zu schaffen. Einander ansonsten sehr zugetane Paare horten über Monate hinweg ganze Übersee-Container voller Präsente, damit der andere am Ende eins mehr auspacken muss als man selbst. Dem Vernehmen nach beginnen schon die ersten Chemiker, Doktorarbeiten über die Zutaten exotischer Fondue-Soßen zu schreiben, die Festtagstafeln längst zu Außenstellen heidnischer Heiler-Apotheken machen: Früher fand man diese Kräuter und Pülverchen nur auf den Rezeptblöcken hutzliger Frauen, die daraus Zaubertränke brauten … Vernünftige, biedere Menschen versiegeln ihren Briefkasten mit Bauschaum und fürchten sich, in ihren Mail-Account zu gucken, der vor naiven Weihnachts-Animationen überquillt – bis zum Festplatten-Burnout. Und über allem thront Lord Mammon: Selbst in den seriösen Nachrichten bekommen wir mit der größten Selbstverständlichkeit erklärt, dass wir noch mehr, noch mehr, noch mehr kaufen müssen, damit der Mann vom Einzelhandels-Verband endlich wieder was zu lachen hat.
He – und Weihnachten? Halloo? Schon mal gehört?
Es wird Zeit, Fragen zu stellen! Aber nicht nur zum spirituellen Nährwert der adventlichen »Sonderpreis-Sause« und ihrer Begleiterscheinungen. Sondern auch zu anderen Traditionen, die sich verselbstständigt haben und längst gegen uns wenden wie angeschossene Zombis in 80er-Jahre B-Movies.
Warum stellen wir uns die Wohnung zum Beispiel mit Bäumen zu, die wie verrückt nadeln und durch eine einzige schiefe Kerze jeden Augenblick in Flammen aufgehen können? Und warum hängen wir da auch noch glänzende Kugeln dran? Wieso geben wir jedes Jahr Millionen für Lichterketten und leuchtende Schneemänner aus? Überhaupt: Warum liegt das schönste aller Feste ausgerechnet in der fiesesten Jahreszeit? Wie konnte aus dem asketischen Nikolaus der dicke Weihnachtsmann werden? Was treibt manche Leute dazu an, am Heiligen Abend Tiere in den Ofen zu schieben, die sie bis dahin nicht mal aus dem Bio-Buch ihrer Kinder kannten, während andere längst resigniert zum Kartoffelsalat-Eimer aus der Kühltheke greifen? Sind Gans und Karpfen wirklich so out wie Cross-Border-Leasing-Deals? Warum leben viele Menschen in heller Panik vor dem 18. Dezember? Und wieso hat das gute alte Aschenputtel im Fernsehen eigentlich drei Wunschnüsse, von denen die Gebrüder Grimm nichts wussten? Apropos: Wer ist überhaupt der Weihnachts-Vierteiler?
Diese und ähnliche Fragen wollen wir auf den folgenden Seiten beleuchten. Bleiben Sie dran! Dann sind Sie am Ende schlauer – und lassen sich von deprimierenden Einzelhandels-Statistiken, Geschenketerror und X-Mas-Kitschsongs aus allen Lautsprechern der Welt nicht mehr den Blick verstellen auf das, was Weihnachten nämlich eigentlich ist: ein fröhliches Fest des Lebens.
Viel Spaß! Der Advent wird noch hart genug.
Stefan Albus, im Juni 2011
ZU FRÜH! ZU FRÜH!
Über politisch korrekte Teigwaren und erste Hilfe im spätsommerlichen Spekulatius-Tsunami.
»Ohne Pfeife?«, frage ich, »Wozu soll das …?« Am anderen Ende der Leitung hörte ich Moni schwer atmen. Ich klemmte den Hörer zwischen Schulter und Wange und nutzte die Sekunden, in denen sie nach Luft rang, mir die nassen Schuhe auszuziehen. Ich hatte Schneematsch geschippt und war die Treppe hochgestürzt, um rechtzeitig am Telefon zu sein; froh, dass im Display diesmal keine 0800er-Nummer stand, unter der einem eine elektronische Vocoder-Stimme ganz persönlich zu einem Lotterie-Hauptgewinn gratuliert, hatte ich abgehoben.
Mit Moni hatte ich allerdings nicht gerechnet – Claudia und ich waren für den Abend mit ihr und ein paar anderen verabredet – es musste also etwas sehr Dringendes sein. Ich betrachtete die Pfütze, die der schmelzende Schnee auf meinem Parkett hinterließ. »Die machen jetzt Weckmänner ohne Pfeife … damit die Kids nicht auf dumme Gedanken kommen!«, stammelte Moni nach einer Weile. »Stell’ dir das mal vor.« Ich versuchte es und dachte unwillkürlich an meine Weckmann-Pfeifen-Sammlung, die ich – wie wahrscheinlich alle Jungs in meiner Alterskohorte – irgendwann Ende der sechziger Jahre angelegt und spätestens Anfang der Siebziger ganz schnell wieder vergessen hatte. Trotzdem hatte ich seitdem nie eine Zigarette angefasst – hatte mir allerdings vorgenommen, das Pfeiferauchen mit etwa 70 noch anzufangen, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass ich längst tot wäre, bevor der damit assoziierte Lungen- oder Zungenkrebs zuschlagen könnte. Hmmm … ob dafür die Weckmänner meiner Jugend …
Dann wurde mir klar, worum es eigentlich ging: Diese komischen Pfeifen waren zwei-Pfennig-Gimmicks, die überhaupt noch niemals jemand in perfektem, quasi platonisch reinem Zustand gesehen hatte, sondern immer nur wie von einem schielenden, betrunkenen und dazu boshaften und kinderhassenden Einarmigen erdacht und zusammengeschustert, insgesamt eher missratener Golfschläger als Raucherutensil, mit verwaschenen Oberflächendetails und einem Geschmack irgendwo zwischen Tuffstein und Bordsteinkante. »Hör mal«, sagte ich, »ich hab’ mir an einem dieser Teile fast mal einen Schneidezahn ausgebissen. Außerdem knirschen die furchtbar, wenn man den Teig da abknabbert, und …« »Darum geht es nicht!«, sagte Moni in einem Ton wie eine Kreissäge, die einen Nagel erwischt. »Worum dann?«, fragte ich. »Kultur! Die Pfeife ist ein Kulturgut«, sagte die Freundin meiner Freundin, diesmal im Timbre eines Franzosen, dem jemand ein Kaugummi auf die Trikolore gedrückt hat. »Sag mal, geht das nicht ’ne Nummer kleiner?«, meinte ich. Aber zugegeben: Irgendwie hatte sie recht. Ein Weckmann ohne Pfeife, das war wie Helmut Schmidt ohne Zigarette oder Miss Liberty ohne Fackel. Außerdem kann es für eine bekennende Genuss-Raucherin mit zwei Packungen Durchsatz täglich durchaus ein kleiner Schock sein, zu Sankt Martin beim Bäcker zu stehen und einer Auslage von Hefemännchen angesichtig zu werden, die ihres prägenden, persönlichkeitsstif-tenden Utensils beraubt sind: ihrer Tonpfeife. Moni las mir einen Artikel aus der Saarbrücker Zeitung vor, dessen Autor investigativ tätig geworden war, um den Sachverhalt aufzuklären: Tatsächlich »fordern immer mehr Eltern und Kindergärten von den Bäckereien Weckmänner ohne Pfeife«, hatte er geschrieben. Und die Bäcker: Wurden prompt weich wie nasse Brötchen. Dabei, Hand auf ’s Herz: Hat wirklich jemalsjemand versucht, Stutenkerl-Pfeifen zum Rauchen irgendwelchen Krauts zu verwenden? Obwohl: Die Symbolik ist schon nachvollziehbar. Tatsächlich kann man sich durchaus fragen, warum ein harmloses Gebäckstück mit traurigen Rosinenaugen ausgerechnet ein Instrument zum Konsumieren suchtgefährdender Drogen mit auf den Weg bekommt. Hätte es nicht ein Spazierstock auch getan? Ein Pilgerstab? Eine Sense? Meinetwegen ein Schwert – das man anschließend als Schaschlik-Spieß hätte verwenden können?
Nun: Tatsächlich ist die Idee mit dem Spazierstock nicht ganz so abwegig. Angeblich soll es sich bei der Pfeife nämlich ursprünglich gar nicht um eine solche, sondern vielmehr um einen Bischofsstab gehandelt haben, der dann irgendwann zur Raucherflöte umgewidmet wurde – womöglich gar von atheistischen Bäckern ganz bewusst und total extra.
Aber vielleicht fanden Leute in weniger aufgeregten Zeiten Pfeife rauchende Männer auch einfach gemütlicher als strenge Gottesmänner. Außerdem: Zum einen scheint bisher nicht bekannt geworden zu sein, dass sich sozial deviante Weckmänner neuerdings vor Bäckereien zusammenrotten, um im Halbdunkel heimlich eine schiefe Pfeife herumgehen zu lassen; mich persönlich hat auch noch kein herumgammelnder Teigmann je gefragt: »Ey, Digga, haste mal ’ne Kippe?« – insofern scheint das gesellschaftliche Gleichgewicht durch politisch auf Korrektheit getrimmte Backwaren noch nicht in unmittelbarer Gefahr zu sein.
Eine ganz reale Herausforderung für Demokratie und Bürgersinn droht dagegen von einer ganz anderen Seite: Man stelle sich nur einmal Mitte September vor einen beliebigen Supermarkt und schaue in die desillusionierten Gesichter der Leute, die da geschockt herauswanken, um zu ahnen, dass etwas schiefläuft in unserem Lande: Wenn die ersten Spekulatius in die Regale geräumt werden, haben Psychotherapeuten Urlaubssperre, im Internet bilden sich Selbsthilfegruppen, die Telefonseelsorge ist gefragt wie die Telekom-Hotline.
Nachdem ich einmal eine Verkäuferin gefragt hatte, warum sie die Packungen nicht gleich zu Ostern verkauft und die ganzen Dominosteine dazu und meinetwegen auch Lebkuchenherzen und Glühwein, den meinetwegen mit Eiswürfeln drin – und nur ein resigniertes »Ach wissense …« geerntet hatte, begann auch ich nervös zu werden und zu recherchieren. Ob es womöglich eine durchgeknallte Sekte gibt, die glaubt, dass der Heiland zurückkehrt, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen – zumindest was den Verkauf typischer Süßigkeiten betrifft?
Nach einer Weile wurde mir jedoch klar: Die Spekulatius-Welle brandet aus einem sehr viel irdischeren Grund jedes Jahr früher in die Läden. Tatsächlich rührt man den Mürbeteig für die Advents-Süßwaren nämlich oft schon im Sommer zusammen. Anschließend muss das Zeug in ausgebackener Form natürlich erst einmal auf Lager. Da aber herumliegende Ware totes Kapital und dies renditegei… äh: -bewussten Kostenrechnern immer schwerer zu erklären ist, versuchen die Leute mit dem spitzen Bleistift im Kopf, das Weihnachtsgebäck so früh wie möglich in die Läden zu bringen – wahrscheinlich um Platz zu schaffen für Zuckerguss-Ostereier, die dann irgendwann ihrerseits neben dem Silvester-Partyset im Laden liegen werden. Egal: Gehobene Augenbrauen bei Kunden, die im schönsten Altweibersommer in T-Shirt, Bermudas und Sandalen durch die Supermarkt-Auslage schlendern und jedes Jahr einen gefühlten Monat früher mit den kargen Freuden der bevorstehenden kalten Jahreszeit konfrontiert werden, tauchen nun mal in keiner Bilanz auf. Andererseits: Warum auch nicht! Glühweinflaschen kann man an manchen Tankstellen-Shops ja auch ganzjährig zur Kasse tragen – sie wandern außerhalb der heiligen Jahreszeit lediglich ein paar Regalfächer nach unten. Auch Printen – im Großteil der Republik fest mit der Jahreszeit um Christi Geburt assoziiert – stecken einem Aachener Bäcker mit größter Selbstverständlichkeit das ganze Jahr über in die Tüte, gerne sogar; auch in »Heino-City« Bad Münstereifel kann der vor nix fiese X-Mas-Fan sich von Ostern bis Ostern+1 jeden beliebigen Tag mit diesem Backwerk eindecken. Ausgerechnet dem Spekulaas haftet trotz aller Bemühungen des Einzelhandels jedoch noch immer hartnäckig das Image eines Saisonhandelsguts an, das man im Sommer in etwa so vermisst wie zugefrorene Türschlösser.
Menschen, die sich zur Revolution aufgerufen fühlen, sobald die ersten Spekulatius-Tüten neben dem Wühltisch mit dem Strandspielzeug auftauchen, mag vielleicht ein Blick auf den sprachlichen Ursprung des Worts Spekulatius weiterhelfen. Tatsächlich werden hier mehrere Theorien diskutiert – und zumindest eine davon ist hochinteressant! So gibt es Sprachforscher, die den Spekulatius aus dem lateinischen speculum abgeleitet sehen wollen, was so viel wie Abbild oder Spiegelbild bedeutet; das macht einigen Sinn, schließlich erhält man beim Entnehmen des Teiglings aus der Holz-Form ein gegenbildliches Abbild des dort hineingefrästen Gegenstands.
Wahren Trost bietet jedoch eine ganz andere Deutung: Sie hat mit dem heiligen Bischof von Myra, genannt Νικóλαος (Nikolaos), zu tun, der uns später noch ausführlicher beschäftigen wird. Auf lateinisch heißt Bischof in seiner Funktion als Hüter bzw. Aufseher der Kirche speculator (auch wenn das griechische επισκοπος, episkopos, manchem vielleicht geläufiger ist). Insofern kann man des Deutschen liebstes Weihnachtsgebäck durchaus als Bischof nehmen: Spekulatius sind also nichts anderes als gebackene Erinnerungen an den Bischof Nikolaus von Myra.
Nebenbei: Wer sich ekelt, in einen heiligen Mann zu beißen: Keine Sorge – Schokonikoläuse essen wir ja auch! Obwohl: Zugegebenermaßen gehört auch der Autor dieser Zeilen zu denen, die erst zubeißen, nachdem das schön verpackte Stück Schokolade durch einen Sturz aus zwei Metern Höhe oder einen »Unfall«, etwa einer Kollision mit der Schreibtischplatte, jegliche menschlichen Züge verloren hat. Spekulatius naschen fällt da schon leichter!
Aber wir schweifen ab! Halten wir fest: Mit dem Rückgriff auf den heiligen Nikolaus ist der Grund für die Verankerung des Kekses in der Weihnachts- bzw. Adventszeit geklärt. Und jetzt? Weiter denken! Denn der Speculator wiederum lässt sich zwanglos auf das römische Wort speculari zurückführen, das man als gucken bzw. schauen übersetzen kann – auch Spekuliereisen (Brille), spieken (Abgucken) wie auch der Spickzettel und spekulieren haben ihre etymologische Wurzel hier, auch wenn nach 2008 nicht mehr jedem auf Anhieb klar sein dürfte, was die Börsen-Spekulation mit Voraussicht zu tun hat. Egal: Ergänzt man schauen um eben jene Vorsilbe »voraus«, hat man durchaus gute sprachwissenschaftlich-kirchenhistorische Gründe in Händen, Nikolaos-Kekse noch früher in die Läden zu lassen – quasi als Vorfreude in Tüten! Auch so kann man seinen Frieden mit dem Kapitalismus machen! In Holland und Belgien scheinen die Menschen diese Einsicht tatsächlich bereits gewonnen zu haben: Dort genießt man Spekulatius ganz selbstverständlich auch zwischen Weihnachten und dem ersten Advent, also gleich das ganze Jahr über.
Und Hand auf ’s Herz: Sie sind ja auch lecker. Es soll Leute geben, die sich um Heiligabend herum mit einer Jahresration versorgen – zumindest was Lebkuchen angeht, sind dem Autor derlei Praktiken aus dem Bekanntenkreis definitiv bekannt. Machen wir also Hände mit Füßen: Wer noch vor September welche haben möchte, aber sich schämt, danach zu fragen, weil das sorgsam erarbeitete Sozialprestige dadurch umgehend auf das eines Anlageberaters abstürzen würde, vermenge einfach zwei Teile Mehl, je einen Teil Zucker und Butter mit drei bis vier Eiern, gibt Backpulver oder Hirschhornsalz dazu (Rentierhornsalz soll auch gehen) und reichert diese Matrix nach Gusto mit Kardamom, Zimt und Gewürznelken an; dann auf ’s Backblech damit und eine Viertelstunde in den Ofen (180 °C) – fertig!
Am stilechtesten gelingen die Kult-Kekse natürlich, wenn man den Teig vor dem Ausbacken in Formen aus traditionellem Birnen- oder Ahornholz bzw. – für fortschrittliche Geister! – Silikon drückt, die man sich den Rest des Jahres als Warnung vor dem Feste auch an die Wand hängen kann. In der Auswahl der Motive, die einen später aus dem Keksteller anlächeln, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, sofern sie fromm genug ist: Engel, Schneemänner, Windmühlen, Sterne, Tannenbäume – alles da. Sogar Osterhasen wurden bereits gesichtet – letztere wahrscheinlich vom Deutschen Supermarkt-Verband in endlosen Sitzungen ersonnen, um das Weihnachtsgebäck demnächst schon vier Wochen vor Karfreitag in die Läden bringen zu können. Wenn es so weitergeht, dürfen wir uns bald sicher auch auf Gartenzwerge, Sonnenblumen und Beachball spielende Bikinidamen als Motiv freuen – wir sind gespannt!
Egal. Ich war mir sicher, neulich noch Weckmänner mit Pfeife gesehen zu haben. Möglicherweise hatte sich der Bann ja doch noch nicht bis hin zu jedem Bäcker herumgesprochen. Ich beschloss, Moni an diesem Abend ein paar mitzubringen. Vorher setzte ich mich allerdings kurz an den Computer: Bis zu Ebay schien sich die Pfeifenrevolution auch noch nicht herumgesprochen zu haben. Vielleicht sollte ich welche horten?
ALLES FÜR NÜSSE
Über Aschenbrödel und des Seewolfs rohe Kartoffel – und was zwei Schotten im Fahrstuhl damit zu tun haben.
»Ich weiß gar nicht, was ihr dagegen habt«, sagte Moni, »sieht doch ganz geschmeidig aus.« Sie führte ihren Glühwein-Becher an den Mund, schnupperte jedoch nur kurz daran und stellte ihn schnell wieder hin, so, als hätte sie unsere Zukunft drin gesehen. »Warum muss der eigentlich immer so heiß sein, dass man Ostereier drin kochen könnte?«, fragte sie. »Die destillieren den Alkohol draus ab und verkaufen den extra«, meinte Andi.
Claudia boxte ihm in die Seite und angelte sich einen Spekulatius vom Teller vor uns. Ich kenne niemanden außer meiner Freundin, der jemals von diesen Keksen genascht hätte, die man auf Weihnachtsmarkt-Stehtischen manchmal findet
– wie sie es schafft, den Heiligen Abend trotzdem immer wieder zu erleben, ist mir ein Rätsel, denn mit den Jahren lagert sich auf diesen und ähnlichen öffentlichen Gebäckstücken so ziemlich das komplette Arsenal an Krankheitskeimen ab, das die westliche Welt zu bieten hat. Dies und Claudias Vorliebe für scharfe Gerichte und Lebkuchenherzen hatte in mir mehr als einmal den Verdacht aufkeimen lassen, dass sie in Wirklichkeit ein gut getarnter Probensammler von der Wega war, der das terrane Arsenal an biologischen Waffen auskundschaften sollte. Wir standen an einem von mindestens 81 Glühweinständen auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt, direkt unter einem 20.000-Watt-Heizpilz mit eigener Erdgas-Pipeline bis Moskau. Vor dem Schneeregen draußen schützte uns eine fingerdicke Kunststoff-Plane, die alles, was sich dahinter bewegte, so verschwimmen ließ, als wäre in unserem Glühwein doch noch Alkohol – und nicht zu knapp. Aus einem kleinen Lautsprecher über uns kam Rockin‘ Around the Christmas Tree, gefolgt von Last Christmas. Noch vor zehn Minuten hatten wir auf der anderen Seite der Folie gestanden und mit Schutzhelmen auf dem Kopf aus vollem Hals das Steigerlied gesungen – ein Flashmob, den Rob sich ausgedacht und via Facebook angeleiert hatte. Rob war ein junger Typ, der sich in meinen Keller eingenistet hatte, um darin ein Tonstudio einzurichten. Und ab und zu in meiner Küche auftauchte, um Bier oder anderes Zeug zu mopsen. Irgendwie hatte er uns neugierig gemacht. Und nicht nur uns: Es waren fast 50 Leute gekommen. Von den Passanten hatte keiner eingestimmt, aber einige hatten immerhin ihre Handykameras gezückt. »Geschmeidig?«, meinte Andi. »Hast du die Frisuren vergessen?« »Lieber tot als Prinz in einem tschechischen Märchenfilm«, fügte Rob hinzu und nahm einen tiefen Schluck aus seinem Pilsglas. Moni zog sich Handschuhe an und versuchte es noch einmal mit ihrem Glühwein. Der Schneeregen draußen wurde dichter. Ich hatte den Eindruck, dass die unscharfen Gestalten auf der anderen Seite der Folie schneller vorbei hetzten. Einige hatten Nikolausmützen mit blinkenden Leuchtdioden auf. »Also Weihnachten ohne Drei Nüsse für Aschenbrödel, das geht gar nicht«, sagte Moni, nachdem sie ihre Tasse erneut abgestellt und von sich geschoben hatte. Claudia schnüffelte daran. Ich fand, dass sie ziemlich süß aussah mit diesem dicken Schal um den Hals, die Maschen so riesig, als hätte ihre Großmutter das Ding mit den Zeigefingern gestrickt.
Aber Moni hatte recht! Ich kannte nicht wenige Leute, für die Weihnachten auf der Stelle zu einer Art Vietnam zu werden drohte, wenn sie in den Tagen um Weihnachten auch nur eine halbe Sekunde dieses Zelluloid-Märchens aus dem Jahr 1973 verpassen würden. Okay – allzu groß ist die Gefahr nicht: Allein 2010 wurde die Story um die zauberhafte Libuše Šafránková als schöne Stieftochter der bösesten Mutter der Welt zwischen dem 12. und dem 26. Dezember im deutschsprachigen Fernsehen nicht weniger als zwölf Mal ausgestrahlt. Auf mehr Hits kommt nur noch Dinner for One, das in aller Regel allerdings erst eine Woche nach Weihnachten zu bewundern ist. Tipp: Wenn das Gespräch auf Ihrer nächsten Cocktailparty abzusterben droht, fragen Sie nach den Namen des Schimmels und der Eule aus dem Film (Nikolaus! Rosalie!) – und der Fortgang einer fröhlichen Party ist gesichert. Mehr Hallo kann man sich eigentlich nur noch mit geröchelten Darth-Vader-Zitaten und den sprechenden Tieren aus Urmel sichern (na, wie hieß das Walross?).
Gut: Über Drei Nüsse wäre sicher eine ganze Menge zu berichten – zum Beispiel, dass die Heldin von ihren Fans mittlerweile in die Nähe einer Pippi Langstrumpf gerückt wird und das Heim des Strumpfhosen-Prinzen (übrigens gespielt von einem herrlich adelig blickenden Pavel Trávníček, dem im Anschluss leider nicht mehr allzu viel gelang) das Schloss Moritzburg war, 15 Kilometer vor Dresden gelegen. Inzwischen zeigt man sich dort dem Erbe des zum Kultfilm gereiften B-Movies gewachsen und organisiert jährliche Ausstellungen, um den Strom der Nuss-Pilger in halbwegs geordnete Bahnen zu lenken – und betrachtet den Streifen pragmatisch gar als »Teil der Schlossgeschichte«. Erwähnenswert ist vielleicht auch, dass die für deutsche Zuschauer seltsamen Abweichungen, die sich der Film vom Aschenputtel-Original leistet, keinem durchgeknallten Drehbuchautorenteam zu schulden ist, sondern einer Erzählung der Schriftstellerin Božena Němcová zu verdanken, die das Grimmsche Epos übernahm und um die geniale Idee der drei Wunschnüsse erweitert hat. Neben den Drei Nüssen hat uns die Dame nicht nur eine Menge weiterer, zum Teil ähnlich aufgebohrter Märchen hinterlassen, sondern auch sonst eine Menge geleistet: Zum Beispiel hat sie mit ihrem Roman Babička der tschechischen Sprache zum Durchbruch verholfen (wer jetzt an den gleichnamigen Song von Karel Gott denkt: knapp daneben, denn Babička heißt schlicht Großmutter), wurde aber nur 42 Jahre alt und starb trotz der vielen, vielen Auflagen ihres besten Buchs 1862 verarmt in Prag. Insofern ist es vielleicht etwas zynisch, dass sie ausgerechnet auf der tschechischen 500-Kronen-Banknote abgebildet ist, aber so ist nun mal der Gang der Zeit. Apropos jung verstorben: Auch Carola Braunbock, jene charismatische Dame, die in den Drei Nüssen die böse Schwiegermutter verkörpert hat, verschied schon 1978 mit gerade einmal 54 Jahren. Sie hat den zweifelhaften Ruhm, den Menschen ausgerechnet als böse, dicke Tante in seltsamen Kleidern in Erinnerung zu bleiben, sicher nicht verdient.
Ach, bleiben wir doch noch einen Moment bei den Aschenbrödel-Toten: Seit 2009 kann man das Thema der Filmmusik unter dem Titel Küss mich, halt mich, lieb mich, dargeboten von der, nun ja, Sängerin Ella Endlich endlich auch mit deutschem Text ergattern bzw. sich zeitgemäß herunterladen (Küss mich, halt mich, lieb mich, Text-Auszug: »Auch Wunder könn’ geschehn«); angeblich war dies die erste und einzige deutsche Fassung, die vor den Ohren des Komponisten Karel Svoboda Gnade gefunden haben soll, der sich allerdings bereits 2007 erschossen hat. Svoboda war eine Art Ennio Morricone der deutschen TV-Co-Produktionen: Auf sein Konto ging die Musik zu rund 900 Filmen und Serien, darunter Wickie und die starken Männer und Die Biene Maja. Drei Nüsse für Aschenbrödel war eines seiner ersten Film-Projekte. Fest steht: Das flirrige Pianoriff zu Beginn des Stücks dürfte mindestens noch für die nächsten fünf Jahrzehnte wie eine Art Instant-Weihnachten wirken, das einen garantiert auch beim Eiersuchen am Ostersonntag unmittelbar in den vierten Advent beamen kann.
Aschenbrödel also ... Okay, wenn man bedenkt, dass das Jahr 1973 auch Filme wie Das große Fressen, Die Höllenfahrt der Poseidon, Mein Name ist Nobody und Der Schakal hervorgebracht hatte, darf man sich schon einmal leise fragen, wieso es ausgerechnet ein derart schräges Märchen schaffen konnte, sich den Zeitstrahl entlang in die weihnachtliche Gegenwart zu hangeln.
Was hingegen nicht verwundert, ist der Drang vieler Deutscher, sich Weihnachten zu einem TV-Ereignis vor dem Fernseher zu versammeln
– und für einen kleinen Augenblick gewissermaßen von einem Haufen Eigenbrötler zur Nation zu werden. Fragt man Leute in einem Alter, das Božena Němcová leider nicht mehr erreichen konnte, nach Media-Events, die ihre Jugend geprägt haben, kommen nach den bereits erwähnten Wicki- (ganz bestimmt und echt wirklich mit »ck« geschrieben!) und Biene-Maja-Episoden, den Vätern der Klamotte, Timm Thaler (übrigens am ersten Weihnachtstag 1979 zum ersten Mal ausgestrahlt!) sowie Robbie, Tobbie und das Fliwatüüt garantiert ganz schnell Titel wie David Balfour, Der Seewolf und Zwei Jahre Ferien.
Wetten: Es gibt Menschen, die dieses Buch jetzt erst einmal zur Seite legen, einen Tee kochen, sich eine alte Strickjacke holen und dann erst weiterlesen. Keine Frage: Diese sogenannten Weihnachts-Vierteiler gehören zur bundesrepublikanischen Nachkriegs-Kulturgeschichte wie Der Kommissar, Heino und die Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Dabei ist mit Vierteiler wohlgemerkt kein Vollstrecker einer barbarischen Foltermethode gemeint; dieser Gattungsbegriff gibt lediglich treffend die Tatsache wieder, dass es sich bei diesen Werken um aufwendige Verfilmungen diverser Vorlagen aus dem Dunstkreis der großen Weltliteratur handelte, deren Episoden über vier Wochen hinweg sonntagabends ausgestrahlt wurden – mit dem abschließenden Höhepunkt optimalerweise an einem der Weihnachtsfeiertage. Der Seewolf zum Beispiel – ein Film, der mehrere Jack-London-Romane arg freischwebend miteinander verquirlt und trotzdem gut ankam –, am 5., 12., 19. und 26. Dezember 1971. Zwei Jahre Ferien nach Motiven aus Werken von Jules Verne schlug seinen Spannungsbogen sogar fast bis Silvester. Okay: Die Abenteuer des David Balfour – nach locker verschraubten Vorlagen des Schatzinsel- und Dr. Jeckyll und Mr. Hyde-Autors Robert Louis Stevenson gestaltet, finishte zwar schon am 17. Dezember 1978, war aber trotzdem schön. Letztlich trugen die Cliffhanger-Epen sogar zur Ost-West-Völkerverständigung bei: Der Seewolf war sogar in der DDR zu sehen – dort allerdings in acht Folgen zerhackt und nachsynchronisiert. Ein Sakrileg war diese Achtelung übrigens nicht unbedingt: Das ZDF brachte den Mehrteiler später sogar auf 16 Häppchen verteilt – mit Erfolg. Richtig übel kam lediglich der Kinofilm an, zu dem man das Material dann letztlich auch noch zusammengestoppelt hatte.
Egal: Der soziale Kitt, der sich aus diesen Weihnachtsmehrteilern gewinnen ließ, klebt heute noch. Die Filmmusik zu David Balfour zum Beispiel darf auf keinem Folk-Sampler fehlen und war ganz sicher einer der Grundsteine des Erfolgs der Kelly Family, die dieses Stück damals noch in Fußgängerzonen zum Besten gab.
Eines jedoch ist sicher: Für die Einschaltquoten dieser Ur-Straßenfeger würden heutige TV-Produzenten ihren Ferrari gegen einen alten Smart eintauschen: Keine Kantine, kein Klassenraum, keine Schlange, in der oder dem man sich nicht die Stirn heiß redete über diese und jene dramatische Wendung im Lederstrumpf oder über die Frage, ob David Balfour seinen Alan Breck wiederfindet, wie geil die schottischen Highlands im Nebel aussehen und ob David und die Rebellentochter Catriona sich am Ende vielleicht doch noch kriegen. Oder ob Humphrey van Weyden sich aus den Fängen des brutalen Robbenfänger-Kapitäns Wolf Larsen befreien kann oder wie das mit dem geblendeten Michael Strogoff denn jetzt noch was werden soll und überhaupt! Das schönste: Jeder konnte mitreden, und wer – auf Grund welcher Schicksalsschläge auch immer – eine Folge verpasst hatte, ließ sie sich so schnell wie möglich vom besten Freund erzählen, um mitreden zu können. Gut: Videorecorder gab es zwar schon, aber die waren groß und schwer und für das Geld, das man für eine einzige Cassette hinlegen musste, konnte eine vierköpfige Familie essen gehen – ganz abgesehen davon, dass ein Band nicht mal für eine Folge reichte und selbst die gelungenste Aufzeichnung aussah, als wäre sie zwei Jahre auf irgendeinem Acker vergraben gewesen.
Auch Fragen wie die, ob die Kartoffel, die Raimund Harmstorf in einer der Seewolf-Folgen zerdrückt, tatsächlich roh war oder nicht zumindest ein wenig angedünstet, konnten die Nation spalten wie heute nur noch Prozesse à la Kachelmann – die während der Arbeitszeit darüber geführten Diskussionen dürften das bundesdeutsche Sozialprodukt stärker geschwächt haben als fünf katholische Feiertage. Noch heute outen sich Leute, deren Kinderseele von dieser Szene nachhaltig traumatisiert wurde. Für Harmstorf, immerhin Zehnkampfmeister und einer der ersten wirklich virilen Waschbrettbäuche der deutschen Fernsehgeschichte, war der Film übrigens
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage
Copyright © 2011 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
eISBN 978-3-641-06569-0
www.gtvh.de
www.randomhouse.de
Leseprobe