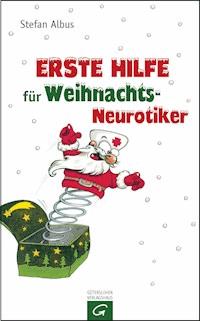11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Santiago war gestern!
- Der erste Erfahrungsbericht eines Menschen, der in Deutschland gepilgert ist
- Witzig geschrieben, und doch mit der nötigen Tiefe
- Mit aktuellem Kartenmaterial über das deutsche Pilger-Wege-Netz und nützlichen Adressen
Rucksack auf, Haustür zu – und los! Um auf dem Jakobsweg zu pilgern, muss man nicht durch Pyrenäen, Meseta, Pamplona & Co.: Auch Deutschland ist durchzogen von einem ausgedehnten Wegenetz im Zeichen der Muschel. Der Journalist Stefan Albus macht die Probe aufs Exempel und die älteste deutsche Stadt Trier zu seinem Santiago: Mit dem Pilgerstab in der Hand durchquert er Dortmund, Köln und die menschenleere Eifel, begegnet Heino, einem ausgestiegenen Manager, üblen Nervensägen und stillen Heiligen, jeder Menge Pilgerkollegen – und am Ende sogar sich selbst. Fazit nach über 400 Kilometern zu Fuß: Schlange stehen vor spanischen Pilgerherbergen muss nicht sein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Warmwerden
Pilgern auf dem Jakobsweg: Dieses Thema hat sich in den vergangenen Jahren zu einem ausgesprochenen Kracher entwickelt. Bücher dazu füllen ganze Regale, selbst das Fernsehen interessiert sich dafür, Santiago-Heimkehrer werden auf Partys bewundert wie Marathonläufer mit einer Bestzeit unter drei Stunden, Vortragsveranstaltungen über staubige Wege in der nordspanischen Meseta sind so voll wie Autogrammstunden der Fußball-Nationalmannschaft. Wie kommt das?
Nun: Wenn Sie dieses Buch – vielleicht im Buchladen, vielleicht bei einem Freund oder einer Freundin in der Küche oder auf Ihrem eigenen Sofa – durchgeblättert haben und inzwischen an dieser Stelle angekommen sind, spricht vieles dafür, dass Sie die Antwort längst wissen. Vielleicht haben Sie ja sogar wie ich vor meinem Aufbruch das Gefühl, dass es so nicht mehr weitergeht in Ihrem Leben.
Damit sind wir beide in guter Gesellschaft. Denn den Wunsch nach einer sinnstiftenden Auszeit teilen immer mehr Menschen – meiner Erfahrung nach gerade besonders kreative, aufgeschlossene Leute. Wachsende Zeitverdichtung bei denen, die Arbeit haben, Zukunftsängste und steigender Rechtfertigungsdruck bei denen, die – möglicherweise bewusst! – »zwischen zwei Projekten« stehen, bei allen das Gefühl, immer weniger Momente für sich selbst zu haben und die eigentlichen Bedürfnisse über den täglichen Stress aus den Augen zu verlieren: All das erzeugt bei vielen Menschen den Wunsch nach Stille. Den Wunsch, einmal innezuhalten und herauszufinden, was einem eigentlich wirklich wichtig ist. Den Wunsch, zur Ruhe zu kommen. Dann fangen viele an, sich für den Jakobsweg zu interessieren. Ein Vertreter einer großen deutschen Jakobusbruderschaft sprach mir gegenüber einmal von einer »Graswurzelbewegung«, von einer echten Gegenbewegung zur zerstörerischen Berufswelt, der sich derzeit immer mehr Leute anschließen.
Wer auf dem Jakobsweg pilgert, zeigt sich und anderen, dass er auf dem Weg nach innen ist.
Aber Moment: Wandern, um zur Ruhe zu kommen: Ist das nicht paradox? Nein – im Gegenteil: Einmal davon abgesehen, dass die Erfahrung eines allzu abrupten Wechsels zwischen jahrelangem Terminstress und der Bewegungslosigkeit in der absoluten Stille etwa eines Zen-Sesshins vergleichbar sein dürfte mit dem Gefühl, als rotglühendes Glas in Eiswasser geworfen zu werden, hat meditatives Gehen durchaus seinen Sinn, wenn man innere Stille finden und nachdenken möchte. Nicht nur Aristoteles hat im Gehen gegrübelt – auch Nietzsche meinte: »Nur die ergangenen Gedanken haben Wert.« Wer wandert, erreicht nicht nur irgendwann ein Ziel, sondern erfährt, wenn er es richtig anfängt, auch eine Menge über sich selbst. Und lernt nebenbei, mit der Welt wieder in Gleichtakt zu kommen: weil Gehen nun mal unsere natürliche Fortbewegungsart ist. Und unsere Sinnesorgane darauf getrimmt sind, Eindrücke in genau dem Tempo zu verarbeiten, in dem wir sie beim Wandern – und nicht beim Rad- oder gar Autofahren! – aufnehmen. Und das Leben aus dem Rucksack – also die Erfahrung, mit dem auszukommen, was man auf dem Rücken tragen kann – vermag ebenfalls ungemein zu erden.
Der Jakobsweg ist ausdrücklich für kontemplatives Wandern gemacht. Warum? Ganz einfach: Natürlich gibt es objektiv betrachtet nicht allzuviel, was diesen alten Pilgerpfad von anderen Wanderrouten unterscheidet – außer eben der Tatsache, dass die Leute, die sich darauf begeben, dies in aller Regel ganz bewusst tun, um etwas über sich herauszufinden. Das Geheimnis des Jakobswegs sind die Menschen, die diesem Weg folgen. Und ja: auch die, die (noch) an seinem Rand stehen – denn auch sie wissen inzwischen zumeist, warum man als Pilger unterwegs ist, auch wenn sie den Weg nie selbst gegangen sind. Mit vielen von ihnen ergeben sich äußerst fruchtbare Gespräche. Wer auf dem Jakobsweg pilgert, zeigt sich und anderen, dass er auf dem Weg nach innen ist. Pilgern heißt, loszugehen, um letztlich bei sich selbst anzukommen.
Die Renaissance des Pilgerns hat allerdings dazu geführt, dass die Zahl derjenigen, die sich den »klassischen« Jakobsweg zwischen Saint-Jean-Pied-de-Port und Santiago de Compostela unter die Stiefel nehmen, wächst wie der deutsche Schuldenberg: 2009 waren in Nordspanien fast drei Mal so viele Jakobspilger unterwegs wie im Jahr 2000! Immer wieder hört man deshalb, dass Menschen auf die Erfahrung des Wegs verzichten, weil sie keine Lust haben, mit roten Augen in die Morgensonne zu blinzeln, nur um später am Tag noch irgendwo ein Bett zu ergattern. Andere schrecken vor der weiten Anreise nach Spanien und der fremden Sprache zurück; wieder andere würden sich trotz allem gerne auf den Weg machen – aber vielleicht nicht unbedingt über die volle Distanz von immerhin etwa 800 Kilometern.
Für diese Leute gibt es eine gute Nachricht: Man kann auch in Deutschland pilgern. Auf dem Jakobsweg. Denn auch hier gibt es alte Pilgerpfade. Sogar ein regelrechtes Jakobspilger-Wegenetz – denn wer sich im 11. Jahrhundert zum Grab des Apostels Jakob in Santiago de Compostela begeben wollte, konnte schließlich kein Flugzeug nehmen: Er musste sich zu Pferd oder eben zu Fuß auf den Weg machen. Von seinem Wohnort aus. So haben sich zwischen Flensburg und Konstanz, Aachen und Görlitz über die Jahrhunderte regelrechte »Pilgerautobahnen« herauskristallisiert, die in jüngerer Zeit verstärkt erforscht und wiederbelebt werden – nicht selten durch den erheblichen persönlichen Einsatz engagierter Menschen, die sich in den deutschen Jakobusbruderschaften zusammenfinden. Diese Organisationen – einige Adressen finden Sie im Anhang – sind zugleich ein hervorragender erster Anlaufpunkt, wenn man sich mit Informationen über die Deutschen Jakobswege eindecken möchte. Auch wenn es überraschend klingt: Für viele von Ihnen dürften es bis zum nächsten Zweig des Deutschen Jakobswegenetzes nur ein paar Kilometer sein – schauen Sie nur einmal auf die Karte im Anhang. Bei mir waren es gerade mal etwas über 20. Inzwischen – nach der Eröffnung eines neuen Wegabschnitts zwischen Dortmund und Aachen im September 2010 – wären es nicht mal fünf. Die Schilderung meines Weges zum »offiziellen« Pilgerpfad finden Sie als »Bonustrack« am Ende des Buches – aus rein dramaturgischen Gründen. Die Message bleibt aber:
Man muss nicht nach Spanien, wenn man den Jakobsweg gehen möchte! Ihr Jakobsweg beginnt vor Ihrer Haustür.
Das bedeutet aber auch, dass dieser Bericht über eine Pilgerreise, die mich 2009, im Jahr der Wirtschaftskrise, zum Pilgerstab hat greifen lassen, nur eine Momentaufnahme sein kann, ein Schlaglicht. Mein Santiago war Trier; Sie werden sich wahrscheinlich ein ganz anderes Ziel aussuchen. Köln? Bayreuth? Frei- oder Magdeburg? Oder – auf den Geschmack gekommen – vielleicht doch die rund 3.000 Kilometer durchmarschieren bis Santiago de Compostela? Denn letztlich soll es hier um Sie gehen. Meine Erfahrungen sollen Ihnen zeigen, dass man den Weg auch als übergewichtige Sofakartoffel mit mäßiger Vorbereitung überleben kann. Sogar als Atheist. Und dass man am Ende eine ganze Menge mit nach Hause nimmt.
Darum kommt es in diesem Buch auch nicht darauf an, was mir oder den Menschen, die ich getroffen habe – und deren Namen zum Teil geändert sind – unterwegs passiert ist. Es wird Ihnen aber zeigen, dass etwas passieren kann! Weil sehr wahrscheinlich auch mit Ihnen etwas passieren wird, wenn Sie diese Reise wagen. Sie werden andere Erfahrungen machen als ich – aber Sie können sicher sein: Der Jakobsweg funktioniert auch zwischen Paderborn und Köln, Rostock und Erfurt oder Marburg und Overath – wenn Sie sich darauf einlassen.
Dazu will ich Sie ermutigen.
Wo immer Ihr Ziel liegt: Wenn Sie da ankommen, sind Sie ein Jakobspilger.
Weisheit – oder auch nicht Und das Grillteller-Wunder vom Gevel-Berg
Mittwoch, 8. April 2009 – Herdecke bis Gevelsberg
Als Erstes zerdeppere ich ein rohes Ei auf dem Frühstückstisch. Dann werfe ich das Milchkännchen runter. Kein Wunder: Ich habe unter meiner Decke gelegen wie ein Stein unter zwei Metern Erde. Falls tatsächlich Gespenster aus dem Schrank gekommen sind, haben sie mich nicht geweckt. Oder es nicht geschafft. Egal: Dafür bin ich tot. Immer noch. Auch deshalb versuche ich heute Morgen, bewusst alles etwas langsamer zu machen als sonst. Schließlich wird es allmählich Zeit, dass ich etwas ruhiger werde: Das ist eine Pilgerreise, da wird man zu einem weiseren Menschen, oder? Und die hetzen nun mal nicht! Auf dem Plan stehen heute Hagen-Haaspe – neun Kilometer, Schwierigkeitsgrad laut Pilgerführer »mittel« – und Gevelsberg, zehn Kilometer in der Kategorie »mittel bis schwer«. Werd’ die Etappen trotzdem zusammenfassen. Neun Kilometer gehen ja gar nicht!
Der Rucksack ist schnell gepackt, aber wieder habe ich das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Kulturbeutel? Als ich ihn aus dem Bad hole, fällt mein Blick auf die Sachen, die ich dort gestern zum Trocknen aufgehängt habe. Ohne durchschlagenden Erfolg, wie sich jetzt zeigt – vielleicht hätte ich die Heizung doch anmachen sollen. Egal: Ins Haus gegenüber gehe ich wie auf Glas. Mit dem Schlüssel in der Hand will meine Gastgeberin, sie heißt Ines Berger, wie ich Zeitungsausschnitten im Hotel inzwischen entnehmen durfte, noch wissen, ob ich was im Gästebuch hinterlassen habe – mit einem Glänzen in den Augen wie bei einem jungen Mädchen, das sich auf ein Weihnachtsgeschenk freut. Ein Foto darf ich leider nicht von ihr machen. Dass ich nicht darauf bestanden habe, ist eines der wenigen Dinge auf dieser Reise, die ich später wirklich bereue.
Neun Uhr! Die Luft riecht frisch, als würde ich in Island auf einem Gletscher stehen; nachts muss es geregnet haben, aber jetzt leuchtet der Himmel wie eine Flasche Wodka Wick Blau. Auch mein Weg zeigt sich zunächst großzügig: Es geht zurück zur Ruhr; am anderen Ufer dann ein Stück nach Westen und zack – bin ich wieder im Grünen. Auf den Bordstein des Wegs hat jemand mit blauer Farbe »UMARME MICH« geschrieben, ein paar Meter weiter folgt das dazugehörige »BITTE«. Alles in Großbuchstaben, aber trotzdem ganz leise. Wer mag das dahin gemalt haben? Hoffentlich nicht der Typ, der sich die heutige Wegführung ausgedacht hat – über den darf ich mich nämlich wundern: Es geht den Kaisberg rauf und danach gleich wieder runter. Das hätte man vielleicht auch einfacher haben können! Immerhin: Auch Karl der Große soll hier oben vorbeigeschaut haben, bevor er sich die Sigiburg genommen hat. Da will ich natürlich nicht zurückstehen. Und langsam gewinnt der Weg wieder an Kraft: Nach etwa drei Kilometern fällt mir auf, wie leicht mir heute Morgen das Aufbrechen gefallen ist. Nach vieren mache ich mir Gedanken über die Hotelbesitzerin. Mir wird klar, dass sie für vieles steht, was mit Christentum eigentlich gemeint ist. Und frage mich, ob das Bild, das ich von Christen habe, vielleicht doch ein wenig zu sehr von den Medien geprägt ist: Da sieht man in erster Linie evangelikale Spinner, Eiferer und durchgeknallte Fanatiker jeder Kajüte, die ihren Kindern alles verbieten, was die Natur ihnen mit einem fröhlichen Augenzwinkern ins Körbchen gelegt hat; das alles garniert mit bigotten Kirchenfunktionären, denen heiliger Anschein und Karriere wichtiger sind als die Menschen. Aber vielleicht müssen die ja auch heiliger sein als heilig: Wer scharfe Schatten werfen will, braucht nun mal Kanten, denke ich. Vielleicht lassen all diese Überheiligen ja nach Feierabend die Sau raus. Ich will’s jedenfalls hoffen. Zum Glück scheint Berger nicht die einzige richtige Christin hier zu sein: In der Nähe des Friedhofs Vorhalle reißt sich eine Frau ein Bein aus, um mir den Weg zu erklären. Ich habe mich zwar gar nicht verlaufen, höre aber trotzdem geduldig zu und bedanke mich.
Schon fast zehn Kilometer auf dem Tacho. Es ist angenehm kühl, der Himmel immer noch blau wie die Augen von Terence Hill: Was will der Pilger mehr? Hinter Vorhalle wird der Weg schnell wieder schön. Wald! Laut Reiseführer sind die Pfade in diesem Gebiet älter als 150 Jahre. Komisch, wie wenig mir Füße und Rücken heute wehtun. 4,4 km/h – nicht übel! O. K. – ich hatte mir gute zehn Prozent mehr vorgenommen … Aber allmählich kehrt in meine Schritte irgendwie so etwas wie Ruhe ein. Auch die Gedanken werden flacher und langsamer wie der Atem eines Zen-Meisters, auch sie schreiten mit kleineren Schritten voran. Tatsächlich erinnert mich Gehen plötzlich ein wenig an Luft holen. Ab und zu sprudeln noch ein paar Bilder von meiner Arbeit und dem ganzen Stress zu Hause in mir hoch, aber im Großen und Ganzen nimmt mich allmählich doch eine Art loungige Gelassenheit an die Hand. Ich wundere mich über das, was ich gestern noch für innere Ruhe gehalten habe und bin gespannt auf das, was da noch kommt!
Irgendwann sind allerdings die Muschel-Hinweise, die bisher in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen an den Bäumen geprangt haben, verschwunden. Nicht so schlimm, ich habe ja meinen GPS-Empfänger und eine gute Karte dabei, ich kann mich also gar nicht verlaufen, selbst wenn ich’s versuchen würde. Allerdings scheint nicht alles in mir dieser Ansicht zu sein: Kaum habe ich gemerkt, dass es ein Problem gibt, stellt sich dieser Druck im Kopf wieder ein, mit dem mein Körper in den letzten Monaten auf Stress reagiert hat. Plötzlich wird mir bewusst, dass diese Kopfschmerzen die letzten zwei Tage verschwunden waren. Aha, das war also der Normalzustand? So fühlt sich das an, wenn nichts ist? Nach ein paar Metern fallen mir ein paar hohe, schlanke Bäume auf, deren Kronen sich im Wind hin und her wiegen, als hätten sie sich etwas Wichtiges zu erzählen. In der Nähe entdecke ich eine Bank und beschließe spontan, Mittagspause zu machen. Setze mich, lehne mich zurück und vergesse den Weg. Strecke die Beine aus. Irgendwie könnte ich diesen Bäumen stundenlang zuschauen. Wow.
Was für ein Schock! Eben lenkte ich meine Schritte noch über verwunschene Pfaden entlang von Feldern, Wiesen und Weidezäunen, wie man sie eher im alpinen Hochgebirge erwarten würde, dann schlägt der Weg einen Haken – und plötzlich befinde ich mich auf einer grauen Straße ohne jegliche Spur einer Bepflanzung. Hagen-Haspe! Mein Gott – ich laufe auf einen ehemaligen Bunker zu. Um den – sagen wir mal: urbanen – Eindruck dieses städtebaulichen Kleinods nicht zu zerstören, haben die Bewohner des Örtchens das Ding bemalt. Aber nicht mit Grünzeug, wie man es anderswo vielleicht machen würde, sondern mit einem Haus, einem Förderturm und irgendwelchen Industrieanlagen. Davor immerhin zwei (echte) Bäume, die sich in dem Gesamtensemble allerdings ausnehmen, als hätte jemand ihre Samen vor Jahren versehentlich da fallen lassen. O. K.: In Haspe lag mal einer der Hagener Richtplätze. Hier warteten Rad und Galgen auf Verurteilte: Solche Orte waren bei den Leuten ja nie sehr beliebt … Kann sich der Charakter eines solchen Platzes bis heute halten? Warum leben Menschen in so einem Ort, wo es doch ganz in der Nähe Kleinode wie Herdecke gibt? Ein paar Meter vor dem Industrie-Bunker finde ich immerhin ein Café, das den schönen Namen »Himmlisch« trägt. Ich werfe meinen Rucksack an die Wand und mich in einen Sessel, der mindestens so bequem ist wie meine Lieblingsjeans, lehne meinen Pilgerstab vorsichtig an den Tisch und bestelle Waffeln mit Sahne und einen Cappuccino. Was für eine Lust, darauf zu warten! Mit stiller Freude lese ich zudem in meinem Pilgerführer, dass der Weg von nun an weitgehend den Höhenlinien folgen soll! Hurra! Waffel essen, weiter! Vor dem Laden sonnt sich meine Kellnerin an einem kleinen Tischchen, auf den kaum ein Aschenbecher passt; sie blinzelt und lächelt mich an, als ich ihr das Geld hinlege.
Hinter Haspe deckt sich die aktuelle Trasse wieder ein kurzes Stück mit dem historischen Wegverlauf. Ich bin also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit genau auf dem Pfad, den Tausende von Pilgern vor mir unter ihren Wanderstab genommen haben. Der Aufstieg dahin ist allerdings ganz schön knackig; endlich hochgeschraubt, bin ich nass wie Froschlaich und leere eine Eineinhalb-Liter-Flasche Mineralwasser fast in einem Zug. Auch danach: von wegen »weitgehend entlang der Höhenlinien«! Hier geht es auf und ab! Mein Weg führt über eine Reihe von Bergen, die nebeneinander liegen wie schlafende Hunde und alle die Namen von Köpfen tragen: Bredder Kopf, Poeter Kopf, Brahms Kopf. Dazwischen geht es immer wieder runter ins Tal. Der »wahre« Jakobsweg läuft längst wieder ein kleines Stück weiter oben. O. K.: Auf diese Weise bleiben mir wenigstens ein paar Höhenmeter erspart; trotzdem möchte ich wissen, was die Leute früher dahin verschlagen hat! Spätestens am Hageböllinger Kopf bin ich schlapp wie ein schlecht gelagerter Fahrradreifen – dabei habe ich da noch den Mühler Kopf und zwei weitere Täler vor mir! Irgendwo finde ich vier Gartenstühle, die jemand über ein paar Bretter miteinander verschraubt hat. Wanderer nimm dir Zeit steht da drauf. Das mach’ ich natürlich gerne! Ein Mülleimer steht leider nicht in der Nähe. Das ist blöd, weil ich seit der letzten Pause die geleerte Wasserflasche mit mir herumschleppe. Na super: Andere Wanderer suchen verzweifelt nach Wasser, ich dagegen nach einem Papierkorb, um endlich dieses doofe Stück Polyethylenterephthalat loszuwerden. Ich bekomme eine düstere Ahnung von dem Bild, das sich dieser junge Engländer in Dortmund wahrscheinlich von mir machen würde …
He, allmählich wird’s jetzt aber wirklich hart. Das viele Auf und Ab zermürbt mich. Der Rucksack drückt, mein Rücken ist völlig vernagelt, ich kann den Kopf kaum noch drehen, irgendjemand hat mir Sand zwischen die Wirbel gestreut. Ich hake nur noch Kilometer ab. Nur vorwärts, vorwärts, irgendwie. Dann, endlich: Häuser, eine Landstraße, Bürgersteige. Blöd nur: Gevelsberg ist lang wie eine tote Anaconda und offenbar überwiegend von finster dreinblickenden Gestalten bevölkert. Zwei dicke Kinder fragen mich, was ich da mache, aber ich habe keine Kraft zu antworten. Mit der Tanknadel im roten Bereich lasse ich mich auf eine Bank in der Nähe der Post fallen wie ein welkes Blatt. Im Adressteil des Pilgerführers finde ich tatsächlich eine Pilgerherberge – Hurra! Allerdings liegt die – am Hageböllinger Kopf! Raaaah! Ich hätte vor vier Kilometern einfach nur rechts statt geradeaus gehen müssen!
Zum zweiten Mal an diesem Tag bin ich im Himmelreich. Danke, Jakobsweg!
Und jetzt? Meine Füße brennen wie Schweröl. Meine Schultern sind schon längst nicht mehr aus Eiche, sondern aus Presspappe: Zeit für Plan B! Den Notfallplan. Ich werde mir die Stelle für die Fortsetzung der Reise morgen merken und mir ein Taxi zur Pilgerherberge nehmen! »Geh zum Bahnhof«, sage ich mir, da stehen garantiert welche. Schlechte Idee: Der Gevelsberger Hauptbahnhof ist etwa so groß wie eine S-Bahn-Haltestelle in Bottrop-Süd. O. K.: Es gibt einen Taxistand. Aber der ist so leer wie der Raum zwischen Erde und Mond. Ich werde hier sterben. Oder? Ich zücke meinen GPS-Empfänger. Das nächste Hotel liegt unendlich weite 500 Meter von hier. Ich beschließe, es zu nehmen, egal, was es kostet. Immerhin spare ich das Taxi.
Die Alte Redaktion wirkt von außen tatsächlich so unscheinbar wie eine Vorort-Druckerei. Aber wenn Betten drinstehen, könnte sie meinetwegen aussehen wie eine Karstadt-Filiale. »Sind Sie Pilger?« »Würde ich sagen.« Ich klopfe mit dem Wanderstab auf den Boden. Den Hut lasse ich auf, weil ich darunter garantiert aussehe wie ein eingeschäumter Teppich. Die Frau an der Rezeption, eine junge, aufgeweckte Mittzwanzigerin mit Kurzhaarfrisur und Brille, blickt zwischen mir und einem Bildschirm hin und her. Ich halte mich an meinem Wanderstab fest, um nicht umzufallen. »Normalerweise ist telefonische Anmeldung ja besser, aber jetzt stehen Sie nun mal vor mir …« »Was kostet das denn?«, frage ich. Die Frau lächelt mir zu. Jetzt nehme ich meinen Hut doch ab und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich lächle einfach zurück.
Das Hotel ist so übersichtlich wie ein altes Bergwerk. Lange Flure, diverse Treppen. Meine – sagen wir: Kammer – ist winzig wie ein Baukran-Kommando-stand, aber sehr adrett. Ein Fenster gibt es nicht. Aber eine Heizung, auf der ich meine Sachen trocknen kann! Ich klettere auf die Matratze und versinke darin wie ein rohes Ei in einem schwarzen Tümpel. Gegen sieben Uhr abends weckt mich mein Magen. Ich raffe mich auf; irgendwo in dem Stollensystem finde ich einen Aushang mit dem Menü für heute Abend: Rotbarschfilet an Basmatireis und Blattspinat. Mist – warum habe ich mir im Wildgehege vorhin kein Reh mitgenommen! Ich will einen Grillteller! Blöderweise regnet es draußen inzwischen in Strömen. Ich gehe zur Rezeption, lasse mir dort etwas resigniert einen Hotelstempel in den Pilgerpass drücken, den Weg zum Rotbarschfilet beschreiben – und verlaufe mich. Irgendwann öffne ich eine schwere Tür, hinter der es verdächtig nach Essen riecht – und lande mitten in einem griechischen Grill. Wie in einem dieser Filme, wo man durch einen Kleiderschrank in ein anderes Leben geht … Es duftet nach Fritten und Gyros! An den Nachbartischen sitzen Leute an winzigen Tischen, die sich unter Fastfood und gut gefüllten Biergläsern biegen. Zum zweiten Mal an diesem Tag bin ich im Himmelreich. Danke, Jakobsweg!
Das verdammte Zen des Wanderns
Gründonnerstag, 9. April 2009 – Gevelsberg bis Remscheid
Ich habe in einem Wäschetrockner übernachtet. Damit meine Klamotten trocknen, habe ich die Heizung auf Volllast laufen lassen … Trotzdem springe ich aus dem Bett wie ein Schalke-Fan bei einem 1:0 gegen München aus dem Sofa und merke erst nach ein paar Minuten, was das für eine Sensation ist: Ich stehe