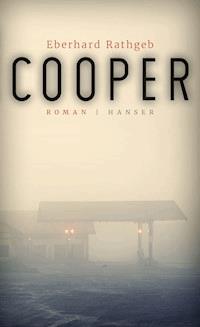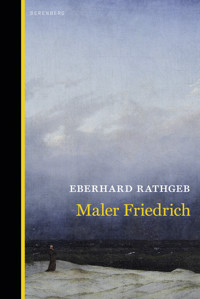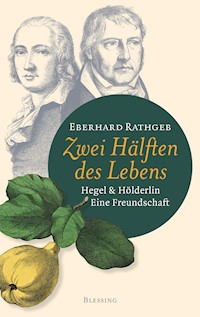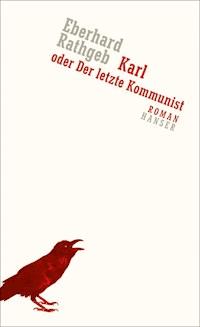Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Eliza ist allein. Ihre Töchter haben keine Zeit für sie, nur der Hund leistet ihr Gesellschaft. Sie ist alt, das Leben ist vorbei, doch die Unruhe, die Fragen bleiben. Als Kind war sie glücklich. Mit ihren Eltern ging sie vor dem 2. Weltkrieg nach Argentinien. Sie liebte ihren Vater, aber sie wusste wenig über ihn. Mit ihrem Mann kehrte sie schließlich nach Deutschland zurück. Jetzt schaut sie sich nachts Filme über den Eichmann-Prozess an, die Beschäftigung mit der Judenvernichtung ist ihre Obsession. Sind Lüge und Unwissenheit die Schwestern des Glücks? Diese Frage steht am Ende dieses melancholischen, mit unaufgeregter Selbstverständlichkeit erzählten Romans. Ein großes Buch über das Alter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Eberhard Rathgeb
Das Paradiesghetto
Roman
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-24688-1
© Carl Hanser Verlag München 2014
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Motiv: Carsten Kaufhold, Vorstadt (2005)
Alle Rechte vorbehalten
Satz im Verlag
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Das Paradiesghetto
1
Sie hatte das Glück nicht gemocht und war mit ihrem Unglück alt und einsam geworden. Sie wusste, dass sie nicht in Frieden sterben würde. Die Unruhe blieb, der Zweifel, das Misstrauen, die Empörung und eine ungewisse Sehnsucht. Das Leben zog sich aus ihr zurück, müde und schwermütig, wie nach einer Niederlage, ganz so, als sei ihr nicht zu helfen gewesen. Sie starb von einem Tag auf den anderen, sie stand einfach auf und ging, die Tür hinter sich zuschlagend, aus der Welt. Die Töchter fühlten sich vom Tod ihrer Mutter überrumpelt.
Jetzt weinten sie am Grab. Sie machten sich Vorwürfe, aber dann redeten sie sich ein, dass sie für ihre Mutter getan hätten, was gute Töchter tun konnten. Sie sahen das alte verhärmte Gesicht vor sich und fassten sich an den Händen, als müssten sie sich noch am Grab vor dem Unglück ihrer Mutter schützen.
Sie hat die Glücklichen gemieden, dachten sie. Nie hätten wir so leben können wie sie. Nur wenn es um unser eigenes Glück ging, drückte sie ein Auge zu, als hätte sie es aufgegeben, uns zu kritisieren. Bei uns und unseren Kindern nahm sie etwas Rücksicht, sie ließ uns machen, es war unser Leben.
Sie schauten auf die Kränze und auf die letzten Worte, die sie für ihre Mutter gefunden hatten.
Sie half, wo sie helfen konnte, sagten sie, aber sie verlor kein gutes Wort über das Glück.
Sie warfen Erde und Blumen auf den Sarg in der Grube und spürten ihren Blick. Sie war tot, aber sie war noch da und würde noch lange bei ihnen bleiben. Die Erinnerung würde sie nicht loslassen.
Wie hätten wir sie trösten können, dachten die Töchter und verließen mit gesenkten Köpfen den Friedhof. Als sie weit genug vom Grab entfernt waren, wagten sie wieder, ins Leben zu schauen, und sagten mit erhobenem Haupt: Jetzt hat sie hoffentlich ihren Frieden gefunden.
Der Pfarrer hatte sie gefragt, wofür sich ihre Mutter interessiert habe. Für Hitler und die Judenvernichtung, hatten sie geantwortet. Er stutzte, nickte mit dem Kopf, als sei es normal, dass sich ein Mitglied seiner kleinen Gemeinde mit Hitler und der Ermordung der Juden beschäftigte, und schwieg. Auch die Töchter schwiegen. Dann sahen sie sich an und sagten, dass ihre Mutter sich auch für ihren Garten interessiert habe. Diese Auskunft gefiel dem Pfarrer besser. Er lächelte und behauptete, die Beschäftigung mit einem Garten sei schön und sinnvoll, und die Töchter, die das Interesse ihrer Mutter für die Nazis und die Juden nie hatten teilen können, waren mit dieser Antwort des Pfarrers zufrieden. In ihrer Trauer vergaßen sie sich zu fragen, ob er hatte sagen wollen, dass die Beschäftigung mit der Judenvernichtung nicht sinnvoll sei.
Als er vor dem Sarg stand, lobte er die Liebe der Verstorbenen für den Garten und erwähnte Auschwitz mit keinem Wort. Den Töchtern fiel gar nicht auf, dass Hitler und die Juden in seiner Rede nicht vorkamen, und wenn es ihnen aufgefallen wäre, sie hätten es ihm nicht übelgenommen, dass er darüber schwieg.
Sie selbst waren es leid gewesen, dass ihre Mutter immer wieder über die Judenvernichtung gesprochen hatte, als seien nicht Jahrzehnte seit dem Ende des Dritten Reiches vergangen und Deutschland nicht ein Land, in dem sie unbeschwert leben konnten. Sie wussten, dass Hitler 1933 an die Macht gekommen war, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg 1939 begonnen hatte und die Nazis sechs Millionen Juden ermordeten.
Was passiert ist, lässt sich nicht ungeschehen machen, sagten sie und verstanden nicht, wieso sie sich wegen der deutschen Vergangenheit das Leben schwermachen sollten.
Wenn man sich immerzu mit der Judenvernichtung beschäftigt, kann man nicht glücklich werden, dachen sie und schauten sich mit ihren verweinten Augen an. Sie atmeten innerlich auf, weil sie mit ihrer Mutter auch Hitler und die Judenvernichtung beerdigt hatten. Nie fragten sie sich, wieso ihre Mutter ständig von den Nazis und den Juden geredet hatte.
Wenn sie an ihre Mutter dachten, stellten sie sich am liebsten eine alte Frau vor, die ihren Garten pflegte und dabei doch Glück empfunden haben musste. Sie muss es gekannt haben, redeten sie sich ein, auch wenn sie so tat, als würde sie sich nicht dafür interessieren.
2
Sie saß im Sessel, die Beine ausgestreckt auf dem niedrigen Tisch vor sich, und schaute in die Leere zwischen den Dingen, die sie überleben würden. Ihr blieb nicht mehr viel Zeit. Sie war alt, ohne Hoffnungen, ohne Illusionen und Wünsche. Eine des Lebens müde Witwe, die Tag für Tag weitermachte, obwohl sie nicht weitermachen wollte.
Der Rollladen der Balkontür war heruntergelassen. Seitdem sie allein lebte, hatte sie Angst vor Einbrechern.
Sollen sie kommen, wenn ich weg bin, oder wenn ich tot bin, dachte sie. Aber nicht, wenn ich im Bett liege und schlafe.
Sie sah sich um.
Bei mir gibt es nicht viel zu holen. Bücher. Aber die werden sie nicht interessieren. Einen Fernseher, einen Computer.
Sie konnte sich nicht vorstellen, dass jemand wegen solcher Lappalien bei ihr einbrechen würde.
Es wäre lächerlich, dachte sie.
Die Einbrecher verschwanden aus ihrem Kopf in die Dunkelheit der Nacht.
Sie hörte den letzten Bus am Haus vorbeifahren. Wer jetzt noch von hier wegwollte, musste eigene Mittel und Wege finden.
Ich komme nur mit einem Notarztwagen weg, dachte sie und stellte sich vor, wie sie auf einer Bahre aus dem Haus getragen und in ein Auto geschoben wurde.
Passen Sie doch auf, herrschte sie die Sanitäter an. Ich falle sonst noch herunter.
Kaum waren sie losgefahren, rief sie: Rasen Sie nicht so. Wollen Sie mich umbringen? Ich lasse mich in ein Krankenhaus bringen, in der Hoffnung, dass ich noch zu retten bin, und dann komme ich auf dem Weg dorthin um.
Oder ich sterbe im Krankenhaus, dachte sie. Wie schnell infiziert man sich dort mit einer Krankheit. Man sollte besser zu Hause bleiben.
Sie hatte ihre Aufenthalte in Krankenhäusern immer gut überstanden und hatte keinen Grund, sich über Ärzte und Krankenschwestern zu beschweren oder sich vor ihnen zu ängstigen.
Im Wohnzimmer brannte nur eine Lampe. Sie versuchte Strom zu sparen.
Ich brauche keine Festbeleuchtung, sagte sie.
Verließ sie ein Zimmer, machte sie das Licht hinter sich aus.
Ich muss das Geld nicht zum Fenster hinauswerfen.
Die Möbel und die Teppiche waren alt und abgenutzt.
Kauf dir neue, baten die Töchter.
Ich bin alt, erklärte sie. Was soll ich mit neuen Möbeln und neuen Teppichen anfangen. Davon werde ich nicht jünger.
Wir alle werden älter, sagten die Töchter, die sich dagegen wehrten, älter zu werden.
Ich brauche nichts mehr, dachte sie. Meine Zeit ist um. Nur der Hund hält mich noch am Leben.
Was würde der Hund ohne mich machen, sagte sie.
Der Hund braucht dich, bestätigten die Töchter.
Sonst braucht mich keiner mehr, dachte sie. Hätte ich keinen Hund, könnte ich gehen. Er zwingt mich, weiterzumachen, mich zu bewegen. Ohne ihn würde ich das Haus nur selten verlassen.
Morgens, mittags und abends stellt er sich vor mich und bettelt, dass ich mit ihm eine Runde drehe, sagte sie.
Auf diese Weise kommst du aus dem Haus, sagten die Töchter, die mit Grauen daran dachten, was passieren würde, wenn ihre Mutter sich nicht mehr auf den Beinen halten könnte. Du musst dich bewegen.
Neue Möbel, dachte sie. Der Fernseher funktioniert und der Computer funktioniert auch. Ich brauche keine neue Waschmaschine, keine neue Spülmaschine, keine neue Kaffeemaschine. Ich komme mit dem aus, was ich habe.
Wer früh gelernt hat, Ansprüche zu stellen, sagte sie, der stellt auch Ansprüche im Alter.
Warum bescheiden sein, wandten die Töchter ein, so leise, dass ihre Mutter sie nicht verstehen konnte.
Die Alten können kaum laufen, dachte sie, und kaufen sich ein neues Auto. Sie können nicht essen, ohne zu sabbern, und kaufen sich eine neue Spülmaschine. Sie können nicht sitzen, ohne einzuschlafen, und kaufen sich neue Sessel. Sie rennen zum Arzt und kaufen sich neue Kleider. Ihre Tage sind gezählt, und sie gehen auf Reisen. Sie klagen, dass sie nicht gut schlafen können, und sind damit beschäftigt, sich ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Sie sind taub und blind und möchten das Leben genießen.
Der Hund ist alt, er hört schlecht, sagte sie, und den Töchtern schien, als wollte sie damit sagen, dass sie sich nicht nur mit durchgesessenen Sesseln zufriedengab, sondern auch mit einem alten und fast tauben Hund.
Eilfertig riefen die Töchter den Hund herbei, und der Hund kam zu ihnen.
Er hört gut, sagten sie zufrieden und warfen ihm einen dankbaren Blick zu.
Er wird nicht mehr lange leben, erwiderte sie.
Da konnte keiner ihr etwas vormachen, sie war alt, sie roch den Tod.
Er kann glücklich sein, wenn er vor mir stirbt, dachte sie und sah den Hund einsam vor ihrem Grab sitzen. Dann sprang er auf und begann mit den Pfoten die Erde wegzukratzen.
Er wird mich ausbuddeln, dachte sie. Es kümmert sich doch sonst keiner um ihn.
Wer bleibt gern allein zurück, sagte sie. Ich weiß, was es bedeutet, allein zu sein. Mir kann keine Witwe etwas vormachen.
Du hast doch uns, warfen die Töchter ein. Wir besuchen dich, wir fragen dich, wie es dir geht, wir rufen dich an.
Es gibt keine lustigen alten Witwen, dachte sie.
Ohne den Hund wäre ich ganz allein, sagte sie. Ein Glück, dass ich den Hund habe. Was würde ich ohne ihn machen.
Ein Glück, dass du den Hund hast, bestätigten die Töchter erleichtert. Was würdest du ohne ihn machen.
Sie ergriffen die günstige Gelegenheit, Abschied zu nehmen, und standen auf.
Bis zum nächsten Mal, sagten sie und sahen ihre Mutter und dann den Hund an.
Wenn sie den Hund nicht hätte, dachten sie und verschwanden.
Sie schaute auf die Armbanduhr. Es war Zeit für sie, ins Bett zu gehen. Das Schlafzimmer lag im ersten Stock. Sie musste eine Treppe hochsteigen.
Das schaffe ich noch, sagte sie stolz.
Sie mochte nicht daran denken, was mit ihr geschehen würde, wenn sie nicht mehr die Treppe hochkommen könnte.
Du musst es schaffen, sagte sie. Dir bleibt nichts anderes übrig. Du kannst nicht im Sessel sitzen bleiben und auf den Tod warten.
Sie wusste nicht, wo sie am liebsten sterben wollte. Sie dachte nicht gern an die Stunde des Todes, und wenn sie daran dachte, zuckte sie mit den Schultern.
Mag er kommen, wann und wo er möchte, dachte sie. Wenn er nur schnell kommt und mich erwischt, solange ich auf meinen Beinen stehen kann.
Müde beugte sie sich nach vorn, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, als horchte sie in sich hinein, auf ihre letzten Herzschläge, und verharrte in dieser gekrümmten Haltung der Demut.
Nur nicht schnell bewegen, dachte sie und wartete auf den passenden Moment, sich aus dem Sessel zu stemmen.
Nur nichts überstürzen. Mir wird sonst schwindelig, und ich kippe um.
Sie rieb sich die Oberarme und die Schenkel.
Die Arme sind noch dran, die Beine sind noch dran. Jetzt werde ich versuchen aufzustehen.
Sie drückte sich hoch und stand dann auf den Füßen, unsicher, als könnte sie sofort wieder in den Sessel zurücksinken.
Fall bloß nicht um, sagte sie und beugte sich etwas nach vorn. Halte dich gerade.
Sie würde sich verletzen, wenn sie zu Boden stürzte, sie würde mit dem Kopf gegen das niedrige Bücherregal schlagen, das neben ihr stand. Vergeblich suchte sie nach einem Halt.
Setz dich wieder hin, ermahnte sie sich.
Nichts wäre einfacher gewesen als das. Sie hätte sich nur in den Sessel fallen lassen müssen. Aber sie gab nicht auf.
Bleib stehen!, rief sie sich zu.
Ich kann nicht im Sessel schlafen, dachte sie. Ich muss ins Bett gehen.
Sie hielt den Kopf schräg und lauschte in sich hinein.
Das Herz funktioniert noch, stellte sie fest.
Das Herz war müde, es gab sich Mühe. Sie sprach ihm und sich Mut zu. Die Knie zitterten, als wären sie noch nicht davon überzeugt, dass sie durchhalten würden. Sie wankte.
Sie bestand nur noch aus Haut und Knochen, sie aß zu wenig. Aber der Körper hielt durch, er war zäh und daran gewohnt, von ihr nicht beachtet zu werden. Er hatte sich gegen ihre Ignoranz am Leben erhalten.
Du darfst nicht sofort nachgeben, sagte sie, als spräche sie zu einem faulen, unwilligen Kind. Du musst durchhalten.
Sie richtete sich auf, straffte den schmerzenden Rücken, mobilisierte alle Kräfte, ein verwundeter Soldat im Feld, der sich nicht geschlagen geben mochte. Die Entscheidung war gefallen. Sie würde sich nicht in den Sessel zurücksinken lassen, sondern ins Bett gehen.
Vergiss nicht, das Licht auszumachen, ermahnte sie sich.
Wie oft war sie die Treppe wieder nach unten und ins Wohnzimmer gegangen, nur um nachzusehen, ob sie das Licht ausgemacht hatte.
Pass auf, wohin du trittst, sagte sie.
Es waren immer die gleichen Sätze, an denen sie sich durch den Alltag bewegte, die ihr Orientierung, Sicherheit und Zuversicht versprachen.
Mich findet hier so schnell keiner, wenn ich umfalle.
Sie stellte sich vor, wie sie auf dem Boden lag, sie konnte sich nicht rühren und hatte Schmerzen. Das Telefon stand weit weg, unerreichbar für sie. Der Hund lief zu ihr und schnüffelte an ihr herum.
Wer sollte mich finden, wenn ich hier liege und mich nicht bewegen kann. Ich kenne niemanden.
Langsam und mit großer Mühe, auf jeder dritten Stufe eine Pause einlegend, schleppte sie sich die schmale steinerne Treppe in das Schlafzimmer hinauf, wo sie irgendwann einschlafen würde, ohne Hoffnung auf den nächsten Morgen.
Stell das Bett ins Wohnzimmer, hatten ihr die Töchter geraten. Das ist bequemer für dich.
Wie sieht das aus, antwortete sie und schüttelte den Kopf.
Als hätte jemand daran Anstoß genommen, wenn eine alte Frau ihr Bett ins Wohnzimmer gestellt hätte. Es sich bequem zu machen war für sie kein Grund, etwas zu tun oder zu lassen.
Dir fällt es doch so schwer, die Treppe hochzusteigen, begannen die Töchter erneut.
Das schaffe ich, macht euch keine Sorgen.
Sie biss die Zähne zusammen. Sie gab nicht schnell auf.
Irgendwann kommst du die Treppe nicht mehr hoch, beharrten die Töchter auf ihrem Vorschlag.
Irgendwann ist das Leben zu Ende, dachte sie.
Wenn ich nicht mehr hochkomme, stelle ich das Bett unten hin, sagte sie. Aber erst wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn ich keinen Fuß vor den anderen setzen kann.
Einschlafen und nicht mehr aufwachen, dachte sie, als sie endlich im Bett lag.
Es ist immer das Gleiche, sagte sie in die Stille des Zimmers hinein, die das ganze Haus ausfüllte. Tagein, tagaus bleibt alles gleich.
Sie richtete sich auf und nahm das Gebiss aus dem Mund.
Und es wird so bleiben. Bis zum Schluss.
Sie sagte lieber Schluss als Tod. Ein Schluss war das Ende einer bestimmten Strecke. Das konnte sie sich vorstellen. Der Tod war ein Anfang von etwas, das sie nicht kannte.
Sie schaute sich im Schlafzimmer um, ein niedriger Tisch, ein Spiegel, ein Schrank, ein Doppelbett und ein Regal.
Ich brauche keinen Spiegel, dachte sie. Ich werde ihn wegwerfen.
Sie verzog den zahnlosen Mund.
Ich bin die Letzte. Alle anderen sind gegangen.
Wir sind doch da, riefen die Töchter aus weiter Ferne.
Übrig geblieben, vergessen, liegengelassen, dachte sie.
Wir denken an dich, riefen die Enkel aus weiter Ferne.
Keiner interessiert sich für mich, sagte sie. Ich bin euch allen eine Last.
Das ist nicht wahr, sagten die Töchter mit schlechtem Gewissen, weil ihnen die alte Mutter oft eine Last war.
Sie sah ihre Töchter an und schmatzte mit den Lippen.
Ihr seid fort, sagte sie. Eine nach der anderen seid ihr weggegangen.
Wir kommen dich bald besuchen, beteuerten die Töchter jedes Mal, wenn sie ihre Mutter anriefen, und legten auf, ohne sich auf einen Tag festgelegt zu haben.
Ihr kommt nicht gern zu mir, fuhr sie fort. Ich bin euch zu alt. Ihr könnt mit mir nichts mehr anfangen.
Das ist nicht wahr, beteuerten die Töchter.
Aber bald ist Schluss, sagte sie, und ihr Blick ging durch die Töchter hindurch und blieb in einer unbestimmten Ferne hängen.
Du wirst noch lange leben, behaupteten die Töchter und lächelten zuversichtlich.
Sie mochte den aufmunternden Beteuerungen nicht weiter zuhören.
Ihr werdet schon sehen, wie es ist, wenn ich nicht mehr da bin, dachte sie.
Ihr Kopf sank auf das flache Kissen, aber sie fand keine Ruhe. Sie war mit ihren Töchtern noch nicht fertig, das letzte Wort war nicht gesprochen.
Auf Wiedersehen sagt ihr, wenn ihr geht, begann sie erneut.
Was sollen wir sonst sagen, rechtfertigten sich die Töchter.
Sie gehen weg und lassen mich in dem Haus zurück wie ein altes Möbelstück, das keiner mehr braucht. Auf Wiedersehen sagen sie und tun unschuldig, dabei müssten sie wissen, dass es vielleicht kein Wiedersehen gibt.
Ihr wollt nicht wahrhaben, dass es ein letztes Mal gibt, sagte sie. Ihr denkt, ihr habt das Leben noch vor euch. Ihr seid jung. Ihr glaubt, ihr habt genug Zeit.
Sie machen sich keine Gedanken über den Tod, dachte sie. Dass irgendwann Schluss ist.
Ich bin vor euch an der Reihe, sagte sie. Davon geht ihr aus. Solange ich lebe, halte ich euch den Tod vom Leib.
Sie werden sich wundern, wenn ich nicht mehr da bin. Dann wird der Tod auf sie zugehen, ohne dass ich ihn davon abhalten kann. Ich werde nicht mehr zwischen ihnen und dem Tod stehen.
Ihr könnt von Glück sagen, dass ich noch lebe, sagte sie.
Ich bin ihnen eine Last geworden. Zieh woanders hin, in eine andere Stadt, sagen sie, um ihr Gewissen zu beruhigen, weil sie mich nicht gern besuchen. Komm zu uns, sagen sie, obwohl es ihnen nicht recht wäre, wenn ich ihr Angebot annähme und zu ihnen zöge.
Ihr wisst genau, dass ich nicht in eine andere Stadt ziehen werde, sagte sie, dass ich nicht zu euch kommen, sondern hierbleiben werde.
Das Haus und den Garten mochte sie nicht verlassen, vor allem nicht das Grab ihres verstorbenen Mannes.
Ich gehe von hier nicht mehr weg.
Sie duldete keine Widerrede, und die Töchter gaben den Versuch auf, sie aus ihrer Einsamkeit zu locken. Keine zehn Pferde, das mussten sie einsehen, würden ihre Mutter von hier wegbekommen.
Was soll ich in der Fremde tun?
Das Leben ist noch nicht zu Ende, sagten die Töchter.
Sie haben keine Ahnung, dachte sie.
Das redet ihr euch ein, sagte sie.
Die Vorstellung, dass ich noch lange leben werde, beruhigt sie, dachte sie und sah die Töchter prüfend an. Sie denken, sie müssten sich dann nicht um mich kümmern. Sie verschieben ihre Besuche von einem Wochenende auf das andere. Kommen wir nicht heute, dann kommen wir bestimmt morgen, sagen sie und besuchen mich wochenlang nicht. Aber ich werde nicht mehr lange leben.
Wenn ich tot bin, sagte sie, steht das Haus leer, und ihr werdet euch wundern, dass so schnell mit mir Schluss war, und dann werdet ihr euch Vorwürfe machen.
Sie lauschte auf Geräusche im Haus und im Garten.
Es ist nichts Verdächtiges zu hören, dachte sie.
In der Nachttischschublade neben ihr lag ein Messer. Die Vorstellung, sich wehren zu können, beruhigte sie, auch wenn sie wusste, dass sie es nie verwenden würde. Sie sah, wie sie das Messer auf Einbrecher richtete: Macht, dass ihr wegkommt. Sie fuchtelte mit dem Messer herum und rief: Ich stech zu, obwohl sie keiner Fliege ein Leid antun konnte. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich es tue, sagte sie, wie eine Lehrerin, die Schülern mit schlechten Noten droht.
Sie schüttelte den Kopf, um die Einbrecher daraus zu vertreiben, und legte in Gedanken das Messer in die Schublade zurück.
Mach dich nicht lächerlich, sagte sie.
Die Beine schmerzten. Sie röchelte, hustete.
Ich muss mich um sein Grab kümmern. Es ist meine Aufgabe. Und der Hund? Was soll er ohne mich machen?
Sie sah in die Eintönigkeit der kommenden Tage. Die Aussicht machte sie traurig, aber sie hielt ihr stand.
Das Leben wird überschätzt, sagte sie.
Das war ihr Standardsatz, mit dem sie die Ansprüche an das Glück zurück in die Ecke trieb.
Sie war alt geworden. Damit hatte sie nicht gerechnet. Das Alter hatte sie überrascht.
Sie fuhr sich mit der Zunge über das Zahnfleisch.
Das Leben ist schnell vorbei, schneller, als man denkt, dachte sie und schloss die Augen.
Reden, ohne dass einer antwortete. Nur für sich sein, ein verlorener Mensch.
Auch ihr werdet das Alter und das Alleinsein kennenlernen, sagte sie zu ihren Töchtern. Und jetzt lasst mich in Ruhe.
Sie schlief nicht mehr gern. Sie dachte daran, wie ihr Mann im Bett neben ihr geschlafen hatte. Sein Atem ging gleichmäßig. Hören, dass er in der Nähe war. Dass sie nicht allein war. Auf seinem Nachttisch stapelten sich Bücher.
Englische Romane, dachte sie. Seine geliebten Engländer.
Sie hatte sich an sein Schnarchen gewöhnt.
Manchmal war es so laut, dass ich davon wach wurde.
Die Tränen über seinen Tod waren versiegt.
Ich werde durchhalten, dachte sie. Ich darf mich nicht gehenlassen.
Die Stille im Haus war kalt und schwer, eine Wand, die sie erdrückte.
Du musst weitermachen, sagte eine freundliche Stimme.
Sie öffnete die Augen. Ihr Vater saß neben ihr auf dem Bett und schaute sie an. Es tat ihr gut, seine Stimme zu hören. Ihr Vater hatte Humor, er wusste, was im Leben zählte.
Meine kluge verständige Tochter, lobte er sie.
Er legte eine Hand auf ihre Schulter. Sie zuckte zusammen. Kaum berührte sie noch jemand.
Meine liebe Tochter, sagte er.
Sie roch seinen Atem. Er war stolz auf sie, und sie war stolz auf sich, weil sie ihren Vater glücklich machte.
Schlaf jetzt ein, sagte er.
Wie er mit mir redet, dachte sie. Ich bin doch kein Kind.
Ich werde es versuchen, versprach sie ihm.
Ihr zahnloser Mund lächelte. Ihr war leicht zumute, sie fühlte sich geborgen, als hätte ein Mensch sich ihrer erbarmt und sie in den Arm genommen. Er stand auf und ging aus dem Zimmer. Sie sah ihm nach. In der Tür drehte er sich um und winkte ihr aufmunternd zu.
Ich bin für dich da, sagte er.
3
Sie besaß nicht viele Fotografien von ihrem Vater. Meistens trug er darauf einen Anzug mit Weste. Die älteste Fotografie von ihren Eltern zeigte den Vater als einen jungen, aufgeweckten Mann, der imstande und willens zu sein schien, in seinem Beruf Erfolg zu haben und sich liebevoll um die Frau an seiner Seite zu kümmern, in deren rundem Gesicht schon damals ein wehleidiger Zug lag, als wüsste sie, dass das Leben, trotz der Liebe und der Bemühungen ihres Mannes, ihre Erwartungen nicht erfüllen werde.
Das junge Paar war rasch zu Wohlstand gekommen, durch den Fleiß und das Wissen des Mannes, der sich nicht scheute, eines Tages ins Ausland zu gehen, weit weg von zu Hause, in ein Land, in dem sie niemanden kannten und dessen Sprache sie noch lernen mussten.
Im Jahr der Machtergreifung Hitlers verließen sie Deutschland. Weder flohen sie vor den Nationalsozialisten, noch gingen sie freiwillig ins Exil. Im Gegenteil, sie fuhren im Auftrag eines großen deutschen Unternehmens nach Südamerika.
Sie waren keine Nazis, dachte sie. Sie haben die Nazis nicht gewählt. Sie haben ihnen nicht zugejubelt. Sie werden gehofft haben, dass der Spuk bald vorüber sei.
Das war ihre Version der Geschichte. Abweichungen ließ sie nicht zu. Ihre Mutter saß zu Hause und führte das zurückgezogene Leben einer Ehefrau, sie kümmerte sich um die Kinder und den Haushalt, da war kein Platz für Politik. Und an ihrem Vater, da war sie sich ganz sicher, hing kein Makel. Sie hatte ihn geliebt, und die Liebe tauchte ihn immer noch in ein warmes helles Licht, das jeden Schatten vertrieb, der auf ihn hätte fallen können.
Es wird schon alles gut werden, sagte der Mann zu seiner Frau, als das Schiff den Hafen verließ und die mehrwöchige Fahrt über den Atlantik begann. Er legte den Arm um sie und drückte sie an sich. Wir werden schon nicht untergehen, sagte er, und sie vertraute ihm, was hätte sie anderes machen sollen. Wir werden ein schönes Leben haben, sagte er. Mach dir keine Sorgen. Man erwartet uns drüben.
Sie zogen in ein großes Haus, und es ging ihnen gut, solange Hitler an der Macht war und das Dritte Reich Krieg führte und aus fast ganz Europa Juden in Konzentrationslager deportiert und ermordet wurden.
Sie wachte früh auf und blieb im Bett liegen, sie genoss die Wärme unter der Decke. Im Zimmer war es kalt.
Mach die Heizung an, sagten die Töchter, die nicht mit ansehen konnten, dass ihre Mutter fror.
Das Öl für die Heizung war teuer gewesen. Arm war sie nicht, aber sie ging mit dem Geld sorgsam um, sie gönnte sich nichts, was nicht notwendig war.
Du kannst es dir leisten, sagten die Töchter, die nicht verstanden, dass ihre Mutter meinte sparen zu müssen.
Sie richtete sich beim Einkaufen nach den Sonderangeboten. Waren Äpfel billig, aß sie vor allem Äpfel, waren Orangen billig, aß sie vor allem Orangen.
Esst Obst, das ist gesund, riet sie ihren Töchtern.
Zu Hause studierte sie die Prospekte mit den Sonderangeboten, die sie im Briefkasten fand.
Man darf das Geld nicht zum Fenster hinauswerfen, sagte sie.
Die Töchter nickten mit dem Kopf, obwohl sie anderer Ansicht waren.
Euch geht es zu gut.
Die Töchter zuckten zusammen, als hätten sie ein Unrecht begangen.
Ihr seid verwöhnt. Wie oft ihr in die Ferien fahrt. Winterferien, Sommerferien, Herbstferien. Wie viele Dinge ihr kauft. Für jedes Kind einen Computer. Für jedes Kind einen Fernseher. Ihr putzt euch heraus, als würdet ihr jeden Tag auf einen Ball gehen.
Das ist nicht wahr, sagten die Töchter. Und warum sollten wir nicht in den Ferien verreisen? Wir möchten etwas von der Welt sehen.
Die Welt, dachte sie, und die Welt wurde zu einer Kugel aus Blei, die sich auf ihre Brust legte und ihr die Luft zum Atmen nahm. Eine Weile verharrte sie starr, wie erschlagen von den dunklen Möglichkeiten eines anderen Lebens, verpassten Chancen, vertriebenem Glück. Dann riss sie sich zusammen, schob die elende Welt und mit ihr das sinnlose Klagen und Jammern weit von sich und stürzte sich auf ihre Töchter.
Wo nehmt ihr die Zeit zum Einkaufen her?, fragte sie. Ihr scheint an nichts anderes zu denken als an eure Einkäufe. Ihr beschäftigt euch den ganzen Tag mit eurem Aussehen, und eure Töchter eifern euch nach. Als gäbe es nichts anderes zu tun.
Sie war wieder ganz bei sich, eine alte Frau, die das Leben nicht auf die leichte Schulter genommen hatte, Ehefrau, Mutter, berufstätig. Keiner durfte ihr einen Vorwurf machen.
Das stimmt nicht, verteidigten sich die Töchter, die wie ihre Mutter die Prospekte mit den Sonderangeboten studierten, darunter auch für Fernreisen.
Ihr Leben setzte sich zusammen aus Aufgaben und Pflichten. Tu etwas, ermahnte sie sich täglich, noch im hohen Alter. Ich kann nicht mehr, sagte sie abends, legte die Füße hoch und genoss die Ruhe, die sie in diesen Minuten vor ihrem eigenen Gewissen hatte.
Als absehbar war, dass Deutschland den Krieg verlieren würde, wurde die deutsche Firma, für die ihr Vater arbeitete, von der argentinischen Regierung enteignet, und er musste sich eine andere Arbeit suchen. Er verdiente nicht mehr so gut wie früher, und die Familie musste in ein kleineres Haus ziehen, das keine zwölf Zimmer hatte. Sie beendete mit Auszeichnung das Gymnasium und ging dann auf die Universität. Ihre Eltern unterstützten sie, vor allem ihr Vater redete ihr gut zu, dass sie etwas lernen und einen Beruf ergreifen solle. Sie war fleißig, klug und ehrgeizig. Sie blieb bei ihren Eltern wohnen und saß als Studentin an demselben Schreibtisch, an dem sie als Schülerin gelernt hatte.
Warum bist du nicht von zu Hause ausgezogen?, fragten die Töchter. Du warst alt genug.
Ich hätte ausziehen können, sagte sie, froh, über die Jahre in Argentinien reden zu können. Ich hätte mir ein Zimmer mitten in der Stadt nehmen können.
Mitten in Buenos Aires, dachte sie, ein Zimmer, sie schaute sich im Schlafzimmer um, so groß wie das hier, das hätte mir gereicht.
Aber ich wollte bei meinen Eltern bleiben, fuhr sie fort, als hätte ich geahnt, dass ich sie nicht mehr lange haben würde.
Weil ihr dann nach Deutschland gegangen seid, ergänzten die Töchter.
Weil wir nach Deutschland gingen, sagte sie und verlor Buenos Aires aus den Augen, die große Stadt, die sie lange vermisst hatte, so wie das Leben, das sie dort geführt hatte.
Deine Eltern sind früh gestorben, sagten die Töchter, die wussten, dass ihre Mutter gern über sie sprach, vor allem über ihren Vater.
Er war ein herzensguter, sie ein wehleidiger Mensch, sagte sie.
Der Vater hatte einen wachen, ihre Mutter einen müden Blick. Sie sah ihren Vater, sie sah ihre Mutter an. Die beiden saßen auf dem Sofa, drüben, im Wohnzimmer. Sie waren alt, wenn auch lange nicht so alt wie sie selbst, und sie beugten sich einander zu, als würden sie sich leise etwas erzählen. Ein Tisch stand vor ihnen, darauf eine Kaffeekanne, zwei Teller und zwei Tassen. Ihr Vater trug einen Anzug. Es musste Sonntagnachmittag sein.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich in eurem Alter sterben werde, sagte sie zu ihren Eltern, als müsste sie sich für ihr hohes Alter bei ihnen entschuldigen. Ihr Vater und ihre Mutter schauten auf und lächelten ihr nachsichtig zu, und es sah so aus, als wollten sie ihr sagen, dass sie sich darüber keine Sorgen zu machen brauche.
Ich wollte nicht so alt werden, wie ich jetzt bin, fuhr sie fort. Ich habe es nie darauf angelegt, alt zu werden. Ich habe mir nie unnötige Sorgen um meine Gesundheit gemacht.
Sie sah zu ihren Töchtern hinüber, die sich ihrer Ansicht nach ständig unnötige Sorgen um ihre Gesundheit machten.
Die Töchter wichen dem skeptischen Blick ihrer Mutter aus. Sie standen nebeneinander am Kopfende des Bettes.
Du hast zügig studiert und sofort zu arbeiten begonnen, sagten sie, um ihre Mutter auf andere Gedanken zu bringen.
Sie schaute noch einmal zu dem alten Sofa hinüber, neben dem auf der einen Seite eine Stehlampe, auf der anderen eine Vitrine mit bemaltem Porzellan gestanden hatte, aber das Sofa war leer, ihre Eltern waren verschwunden.
Sie sind nicht oft zusammen bei mir, dachte sie. Entweder kommt Vater oder Mutter. Selten tauchen sie zu zweit hier auf.
Ich ging ins Kino, in die Oper, ins Theater, sagte sie.
Sie ging ins Kino, in die Oper, ins Theater, wiederholten die Töchter, als könnten sie nicht fassen, was sie gehört hatten.
Wir waren jung und unternehmungslustig, sagte sie. Abends traf ich mich mit Freundinnen. Wir lasen die gleichen Bücher. Französische Romane.
Sie sah ihre Töchter, die keine französischen Romane im Original lasen, nicht einmal englische, vorwurfsvoll an.
Was ist aus ihnen geworden?, fragten sie.