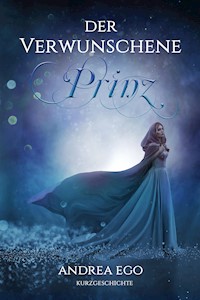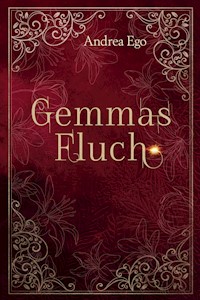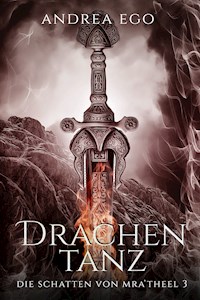4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ich bin eine Seherin - eine, die das Unrecht erkennt, zusammenführt, was zusammengehört, und trennt, was sich nicht mehr braucht. Die junge Priesterin Thanissa erfährt, dass sie als Seherin auserwählt ist, leugnet ihre Bestimmung jedoch. Auf einem heimlichen Ausflug in die Berge gerät sie in Not und wird von einem Mann gerettet. Taio gehört den Rebellen an, die ihre Heimatstadt Zefira zu zerstören versuchen, doch er hilft ihr wider Erwarten, nach Hause zu kommen. Verwirrt und gleichzeitig verunsichert von seinen Erzählungen versucht sie, ihr Leben fortzuführen. Doch nicht nur, dass er ihr nicht mehr aus dem Kopf geht, auch die Wahrheit hinter dem Wohlstand ihrer Heimat überfordert sie. Ein Bündnis mit den Rebellen scheint der einzige Weg, das Unrecht zu beenden, doch weder die Frauen von Zefira noch die Rebellen wollen die Vergangenheit ruhen lassen. Welche Opfer muss sie bringen, um den Teufelskreis zu durchbrechen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Spruch des Orakels
Gewittertanz
Zu viele Fragen
Vertrauen und Verrat
Zuhause
Drohender Dolch
Die Aufgabe einer Seherin
Verbotene Fragen
Gelüftete Geheimnisse
Hochverrat
Der König des Waldes
Die Einsiedlerin
Ein Plan
Zweifel
Falscher Segen
Für einen Kuss
Nur ein Verdacht
Ein roter Fetzen
Ohne Hoffnung
Liebes und Mütterchen
Frieden
roter Mantel
Frühmorgendliches Bad
Des Verrats angeklagt
Zefiras Rache
Regennacht
Jetzt erst recht
Auf nach Zefira
Ein Angebot
Eiskalter Nebel
Unerschöpfliche Macht
Gefangen
Was zusammengehört
Epilog
Danksagung
ANDREA EGO
Das Schicksal der Seherin
Im Herzen der Schweiz, wo ich herkomme und es leckere Schokolade, gute Messer und unglaublich schöne Berge gibt, läuft vieles ein wenig langsamer und anders. Ich liebe unser Tal und die Berge rundherum, die schrulligen Leute und den Herbstwind.
Wir Schweizer werden ohne „ß“ gross. Weil ich unser Schriftbild schön finde, stolz auf diese Schweizer Eigenheit bin und vor allem die Vielfalt der deutschen Sprache liebe, verwende ich konsequent „ss“.
Ich danke euch allen schon im Voraus für das Verständnis, was die Rechtschreibung angeht, und wünsche trotzdem ein schönes Leseerlebnis.
Der Spruch des Orakels
Badamm.
Einen Schritt weiter.
Badamm.
Wieder einen Schritt weiter.
Wie ein Berg baute sich der aus Stein gefertigte Kegel vor uns auf. Der Schein der Fackeln tauchte ihn in sanftes, flackerndes Licht und erhellte die mondlose Nacht. Schatten huschten über die Oberflächen. Frauen tuschelten. Anhija vor mir zitterte.
Wieder ein Trommelschlag, noch ein Schritt.
Die erste der jungen Priesterinnen stand direkt vor dem gähnenden Mund des Kegels, der wie ein Mahnmal in den dunklen Himmel ragte und sich dort verlor. Wir wussten nicht, was uns erwartete. Es gab Gerüchte, die davon erzählten, Priesterinnen hätten den Kegel nicht mehr verlassen. Ich erschauderte. Ihren Knochen wollte ich nicht begegnen, erst recht nicht ihren Geistern.
Der nächste Trommelschlag führte eine meiner Mitschülerinnen in die Dunkelheit hinein. Was sie wohl sah? Wie es ihr erging?
Anhija drehte sich ängstlich zu mir um. In ihren Augen stand nicht nur die Angst um ihre Freundin, sondern auch ganz besonders vor unserem Schicksal. Im Tempel ausgebildet, in den Künsten unterrichtet, fähig, Krankheiten zu erkennen und zu heilen, waren wir im Moment nicht mehr als ein Spielball des Schicksals.
Ein frischer Wind kam auf, umgarnte mein hellbraunes Haar und liess es wieder los. Auf meinen Lippen zeichnete sich ein Lächeln ab, obwohl mir nicht danach war. Ich verspürte keine besondere Lust, das nächste Opfer zu sein, das schon längst überfällig war. Ich schluckte und verdrängte den Gedanken daran. Es wird alles gut, Thanissa.
Die Trommelschläge verstummten, die Zeit dehnte sich zu einer Ewigkeit. Nicht einmal die Frauen neben mir tuschelten. Ich kannte sie, sie tratschten zu gern. Doch einmal im Jahr blieben auch ihre Zungen ruhig, nämlich dann, wenn das Orakel den Priesterinnen ihre Bestimmung verriet.
Ungeduldig verlagerte ich das Gewicht vom einen Fuss auf den anderen und versuchte, trotz der Fackeln einen Blick auf die Sterne zu erhaschen. Sie hatten mich stets beruhigt, egal, wie schlecht es mir ergangen war. Ihr sanftes Licht, das meinen Weg erhellt, aber nicht überstrahlt hatte – leise Begleiter, die niemand bemerkte, die jedoch stets da waren. Ich mochte den Gedanken.
Ein Trommelschlag, so heftig wie der erste Donner eines Gewitters, der sich mit dem grellen Licht des nächsten Blitzes mischte, liess mich zusammenfahren. Mein Herz stieg, brach aus der Brust aus und galoppierte davon.
Hälse reckten sich, die Frauen um uns herum sahen nach oben zur Spitze des Kegels. Als würde sie frei über unseren Köpfen schweben, hob sich Marnas weisses, dünnes Leinengewand vom Heim des Orakels und dem dunklen Himmel ab. Sie war wunderschön.
»Weise.«
Die Menge brach in Jubel aus. Seit fünf Jahren hatte das Orakel keine Weise mehr ernannt. Ihre Zukunft sah rosig aus: Marna durfte den wichtigsten Sitzungen der Anführerinnen beiwohnen, in deren Quartier leben und sich frei in der Stadt bewegen. Bei Fragen würde sie zu Rate gezogen.
Ein wenig beneidete ich sie, auch wenn ich wusste, wie hart sie für ihren Traum gearbeitet hatte. Nur selten entsprach das Orakel dem Wunsch der Tempelschülerin, die sich seinem Urteil stellte.
Der nächste Trommelschlag führte Dhorea in den Kegel. Während der Ausbildung war sie mir nicht besonders aufgefallen, doch die Zeit mit ihr hatte ich in guter Erinnerung. Sie war still und zurückhaltend, aber auf sie war Verlass.
»Dienerin.« Unter normalen Umständen hätte niemand ihre Stimme vernommen, doch dem Orakelkegel war es eigen, einem Klang Fülle zu verleihen, sodass er von der ganzen Stadt gehört wurde.
Die Freude fiel deutlich zurückhaltender aus. Dienerinnen gab es jedes Jahr ein oder zwei, obwohl jeweils nur fünf Priesterinnen in den Tempelmauern ausgebildet wurden, sodass sie sich nach den eigenen Fähigkeiten und dem Urteil des Orakels entfalten konnten.
Innerlich lachte ich verbittert auf. Worin lag die Freiheit, sich selbst zu entfalten, wenn doch das weitere Leben durch eine einzige, in den Kegel gebannte Stimme in eine Richtung gelenkt wurde?
Als Nächstes verschluckte die Dunkelheit Anhija. Sie warf mir einen letzten Blick zu, zögerte und ergab sich schliesslich ihrem Schicksal. Wollten wir leben, hatten wir keine Wahl. Wer sich dem Urteil des Orakels nicht stellte, verlor den Schutz und das Wohlwollen der Stadt.
Ich sandte ein Stossgebet zum Himmel und bat darum, dass Anhija eine Berufung fand, die ihr entsprach. In den letzten Jahren waren wir Freundinnen geworden. Wir hatten alles geteilt, Aufgaben zusammen ausgeführt und uns gegenseitig gedeckt, wenn wir uns vom Tempelgelände geschlichen hatten.
Ich zitterte. An den Innenflächen meiner Hände trat Schweiss aus, und ich wischte sie am einfachen Leinengewand ab, doch nur Augenblicke später hätte ich schon wieder kein Glas mehr halten können. Das Warten zog sich in die Unendlichkeit. Nicht nur, dass ich die Nächste war, auch das Schicksal meiner Freundin versetzte mich in Unruhe. Immer wieder warf ich einen Blick nach oben, um ihr Gesicht, vielleicht auch einen Zipfel ihres vom Wind aufgeblähten Kleides zu erhaschen. Doch sie blieb verschwunden.
Eine Frau ein paar Schritte hinter mir flüsterte ihrer Nachbarin Worte ins Ohr. Selbst das Wispern verstärkte die Spannung, die sich über den Platz legte, auf dem sich die ganze Stadt versammelt hatte. Die Reichen und die Schönen, die Armen und die Arbeiterinnen. Und mittendrin trommelte mein Herz lauter als die Stille.
Anhijas helles Gesicht hob sich gegen den Nachthimmel ab. Es strahlte von innen, als sie der Stadt ihre Bestimmung mitteilte: »Dienerin.« In ihren Zügen mischte sich Erleichterung mit Stolz. Sie hatte es sich so gewünscht, in den Häusern oder vielleicht gar im Tempel dienen zu können, den Menschen ihre Gesundheit zu erhalten oder zurückzuerlangen. Sie würde sich in den Dienst der Stadt Zefira stellen.
Ein wehmütiges Lächeln schlich sich auf meine Lippen. Ich freute mich mit ihr, ja, dennoch … Innerlich seufzte ich und wartete auf den Trommelschlag, der mich zum Opfer machte. Es gab fast jedes Jahr ein Opfer. Nur die letzten vier Jahre hatte keine Priesterin ihr Leben als solches verloren.
Jemanden musste es treffen, irgendwann. Den anderen dreien hatte das Orakel eine Bestimmung angedacht, die sie sich erträumt hatten und mit der sie einiges erreichen konnten. Als Weise und als Dienerinnen standen ihnen viele Wege und Türen offen.
Der Trommelschlag erschütterte den Boden und fegte mich fast von den Beinen. Ich richtete meinen Blick zur Spitze des Kegels, doch Anhija war bereits verschwunden.
Mit einem letzten, tiefen Atemzug trat ich ein.
Es war dunkel, doch es roch nach Wald und Gewitterluft, nach feuchter Erde und nach … Zuhause. Entschlossen schüttelte ich den Gedanken ab. Der Tempel war mein Zuhause, und das hier roch so gar nicht nach Tempel.
»Thanissa, nun ist es also so weit.« Die wohlklingende Stimme drang durch meinen Körper und nahm meinen Geist in Beschlag. »Es freut mich ausserordentlich, dich wiederzutreffen. Als ich dich das erste Mal sah, warst du ein kleines Bündel mit mehr Haaren, als erlaubt sein müssten. Doch in dir sah ich ein Leuchten, das ich erwachen sehen wollte.«
Ich drehte mich um die eigene Achse, um der Stimme einen Namen zu geben, doch undurchdringliche Dunkelheit hüllte mich ein. Nicht einmal den Eingang erkannte ich. Ich war gefangen, dem Urteil des Orakels völlig ausgesetzt.
Ich holte tief Luft und schloss die Augen. »Wie soll das Opfer aussehen?« Niemand wusste, was sich das Orakel als Opfer für eine von uns ersann.
Ein Lachen vibrierte in meiner Brust und mischte sich mit der Angst zu einem rotierenden Klumpen, der meinen Magen in Aufruhr versetzte. »Wieso ein Opfer?«
»Weil es jedes Jahr ein Opfer gibt. Fast.« Ich sah keinen Grund, um den heissen Brei herumzureden.
Wieder lachte das Orakel. »Meine allerliebste Thanissa, eine junge Frau wie dich opfere ich doch nicht. Du wirst Zefira in eine neue Zukunft führen.«
»Ich … Was?«
»Du bist eine Seherin. Dein Herz erkennt das Unrecht, deine Ohren hören die Lüge, deine Augen sehen, wo es schmerzt.« Die Stimme des Orakels klang warm, doch die Offenbarung war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich verlor den Boden unter meinen Füssen, taumelte.
Eine Seherin hatte es seit einer Ewigkeit nicht mehr gegeben. Ich konnte mich nicht einmal an Schriften erinnern, die von dieser Aufgabe erzählten. Man munkelte nur hinter vorgehaltener Hand darüber. Zudem, so wundervoll es auch klang, doch die Aufgabe einer Seherin lastete schwer auf ihren Schultern.
»Sie sieht nicht nur, sie verändert auch. Sie führt zusammen, was zusammengehört, und trennt, was sich nicht mehr braucht.«
»Wieso hört sich das so verlockend an, obwohl es das nicht ist?«, schlüpften mir die Worte aus dem Mund, die sich immer und immer wieder in meinem Kopf drehten. »Warum soll ich das richten, was andere verbogen haben?« Mit jedem Ton wurde die Brust enger, der Knoten im Bauch fester. Jeder Gedanke war ein Hieb in die Magengrube.
Als Seherin war ich verantwortlich. Für alles. Die Erkenntnis machte mir Angst.
»Es gibt so viele fähige Frauen in der Stadt, bitte, ernenne eine von ihnen zu deiner Seherin.«
»Ich habe keine Wahl, Thanissa. Sie sehen nicht wie du. Jede andere hätte sich an dieser Macht erfreut, dir macht sie eine Heidenangst. Am liebsten würdest du dich im Kräutergarten verstecken und dort das Ende des Sturmes abwarten, doch du bist dieses Ende, du musst die Ungerechtigkeit beseitigen.«
Meine Ohren klingelten, Hitze stieg in meinen Kopf. Ich schwankte. Frische Luft. Ich brauchte frische Luft.
Aus dem Nichts tauchte ein halbrunder, erleuchteter Durchgang auf. Ich taumelte auf ihn zu, hielt mich am Rahmen fest und zog mich hinaus. Eine Treppe führte in so engen Windungen hinauf, dass ich mich ducken musste. Ich folgte der Wendeltreppe und fand mich unverhofft auf einer Plattform weit über dem Platz wieder, auf dem die Frauen der Stadt ihre Blicke erwartungsvoll auf mich richteten.
Seherin.
Ich schluckte und schüttelte kaum merklich den Kopf. Ich wollte keine Seherin sein. Ich wollte mich im Kräutergarten des Tempels verkriechen und das Ende des Sturmes abwarten.
Entschlossen hob ich den Blick, reckte das Kinn und straffte die Schultern. »Kräuterkundige.«
Gewittertanz
Der Tempelgarten lag ruhig da, obwohl das Gewitter in den angrenzenden Bergzügen jeden Moment niedergehen konnte. Wilde Windböen trieben die regengetränkten Wolken vor sich her. Mein Leinenkleid tanzte mit ihnen und den feingliedrigen Blüten, die meine Finger streichelten.
Rumanda, meine Lehrmeisterin, kam mit gebückter Haltung auf mich zu. Ihre Glieder waren so alt, wie meine nie werden wollten, dennoch trug sie für jeden ein Lächeln in ihrem Herzen, das die Sonne selbst an stürmischen Tagen zurückbrachte. Wie heute.
»Die Sonne auf deinen Wegen«, begrüsste ich sie. Ich deutete auf eine Bank nicht weit von uns und bot ihr meinen Arm an, um sich einzuhaken.
»Mögen die Schatten fern von deinen bleiben«, erwiderte sie.
Ich schluckte. Die Schatten hatte ich wohl selbst heraufbeschworen, als ich vor zwei Tagen meine Bestimmung verleugnet hatte. Geboren, um zurechtzubiegen, wollte ich lieber mein Kräuterwissen erweitern und an eigenen Heiltränken feilen. Ich wollte nicht, dass alle etwas von mir erwarteten, das ich nicht erfüllen konnte. Selbst das Orakel hatte mir Angst gemacht.
»So hast du mich schon lange nicht mehr begrüsst«, freute sich Rumanda und tätschelte mir dabei den Oberschenkel. »Kräuterkundige also … Das passt zu dir.«
Ich nickte langsam. »Genau das, was ich wollte.«
»Oft gedenkt uns das Orakel eine Bestimmung zu, zu der wir zwar geboren sind, die uns aber über unsere eigenen Grenzen hinausbringt. Oder denkst du, dass Marna es als Weise einfach haben wird?«
Ich schloss die Augen, lehnte mich zurück und genoss das Peitschen der windgetriebenen Haare auf meinen Wangen. Es brachte so etwas wie Normalität zurück in mein Leben. »Sie wollte immer eine Weise sein, nun hat sie ihr Ziel erreicht.«
Die alte Frau kicherte. Trotz ihres Alters versprühte sie eine Lebensfreude, die ich besonders bei jungen Frauen oft vermisste. Die Leichtigkeit trotzte Sorgen und Ängsten, Ungewissheit und Pflichten. »Ist es nicht erstaunlich, dass dieses Jahr jede ihrer gewünschten Bestimmung nachgehen kann?«
Ich zuckte mit den Schultern und versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, während ich auf die Holztür starrte, die ich seit zwei Tagen sah. Unscheinbar war sie in die Mauer eingelassen, die den Tempel vor den umliegenden Wäldern und Hügeln abschottete. Wie oft hatten wir von so einer Tür geträumt, doch da war keine gewesen. Ich hatte nicht als Einzige mehrmals gesucht. Doch seit mir das Orakel meine Bestimmung offenbart hatte, zeigte sie sich mir.
»Vielleicht hat es das Opfer schon früher eingezogen?« Die Erinnerung legte sich wie ein Seil um meinen Hals, zog sich zusammen, sodass ich kaum mehr schlucken konnte. Auch wenn ich mich locker gab. Auch wenn ich tat, als ginge es mich nichts an.
Rumanda drückte mein Bein etwas. »Wer weiss? Vielleicht wird aus einem Segen erst später ein Opfer?«
Falls sie mir Mut machen wollte, misslang es ihr. Doch ich hatte eher das Gefühl, als würde sie nach einem Geheimnis graben. Das Versteck kannte sie schon, doch sie rätselte noch über Inhalt und Tiefe.
»Des Orakels Wege sind schleierhaft«, zitierte ich ihren Lieblingsspruch und entlockte ihr damit ein Schmunzeln.
Sie erhob sich, wischte ihr weisses Kleid sauber und warf mir einen wissenden Blick zu. »Du wirst deinen Weg finden, junge Priesterin, egal, wie ungewöhnlich er ist – denn du siehst ihn.«
Wie zu einer Statue aus weissem Marmor erstarrt, blieb ich auf der Bank sitzen, während sich meine Lehrmeisterin auf den Weg in den Tempel machte. Sie mochte Gewitter nicht, die ich in vollen Zügen genoss. Wie viel wusste sie? Und vor allem: woher?
Ein entferntes Donnern riss mich aus meinen Gedanken. Der Wind kühlte mein erhitztes Gesicht. Ich war eine Sehende, eine, die Missstände behob. Es war eine angesehene Bestimmung, dennoch war es nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich wünschte mir, immer hinter diesen Mauern neue Tränke und Tinkturen brauen zu können, bessere Rezepturen zu entwickeln, sodass die Menschen Zefira besuchten, um meine Heilmittel zu kaufen.
Wie magisch wurde mein Blick von der unscheinbaren, plötzlich aufgetauchten Holztür angezogen. Ich war mir sicher, dass dort eine dicke Wand aus Steinblöcken war und ganz bestimmt keine Tür, die bei einem ersten Angriff nachgeben und die Feinde ungehindert in den Tempel dringen lassen würde. Noch dazu vereinigte sich hier die Stadtmauer mit der Tempelbegrenzung, sodass eine Lücke doppelt gefährlich war.
Und verlockend.
Ich erhob mich und näherte mich der Tür. Mit jedem Schritt wirkte sie noch ein wenig kleiner, als wollte sie sich vor mir verstecken. Als ich meine Hand auf die Klinke legte, erwartete ich einen Schlag. Einen Rückstoss. Irgendetwas, das mich davon abhielt, sie zu berühren, zu öffnen und die Nase an die frische Luft vor den Stadtmauern zu strecken. Doch sie liess sich öffnen, als hätte jemand sie für mich geölt. Die Angeln quietschten nicht, das Holz blieb stumm.
Vor mir sah ich die Weite der Wiese, bis sie mit einer weichen Rundung einen Hügel formte. In der Ferne ragten dunkle Berge zwischen Wald und Wolken hervor. Sie versprachen Regen, Abkühlung und Blitze. Im aufkommenden Wind wogten die Blumen, kitzelten an meinen Händen und verströmten einen betörenden Duft. Ich schloss die Augen. Der Wind heulte über die Ebene.
Meine nackten Füsse erspürten den Untergrund. Schritt für Schritt tasteten sie sich voran, über Steine, trockenes Gras und weiche Blumenbüschel. Gierig sog ich die Luft ein, die Regen und einen klaren Himmel für den morgigen Tag versprach. Ich liebte, wie der Wind mir meine Haare ins Gesicht peitschte, mit meinem Kleid spielte, daran zerrte, als würde er mich nackt sehen wollen.
Meine Hände strichen zwischen den Blumen hindurch, forderten sie zu einem Tanz auf, zärtlich und begierig zugleich. Grashalme schlugen meine Haut, helle Blütenblätter milderten die Pein.
Erste Regentropfen fielen auf mein Gesicht, während ich mich immer weiter von der Stadt und meiner sicheren Heimat entfernte. Es fühlte sich so richtig an. Die Wasserperlen zerplatzten auf meiner Haut und entlockten meiner Kehle ein befreites Lachen. Das war Leben, das war Freiheit.
Ein unbekannter Duft stieg mir in die Nase: feucht und süss und herb zugleich. Es roch nach nassem Boden, festem Gestein und Harz. Holz. Nach würzigen Nadeln. Überrascht öffnete ich die Augen.
Ich stand im Wald, nicht weit von der Wiese entfernt. Mein Mund klappte auf, als ich die kleinen Pflanzen betrachtete, die ihre Blätter direkt neben einem riesigen Baum in die Höhe reckten. Moos überwucherte Steine und tote Äste. Ein Baumstamm wies derart tiefe Risse in seiner Rinde auf, dass ich mich an ihm bis zu seiner Krone hätte hinaufziehen können.
Ich wagte einen Blick zurück. Da lag Zefira, meine Heimat, seit ich denken konnte. Noch bevor sich irgendeine Erinnerung in mir hatte festsetzen können, war ich als Angehörige des Tempels erwählt worden. Sämtliche Mädchen wurden vom Orakel ihrer Bestimmung zugeführt und nur wenige mussten die Prozedur zweimal über sich ergehen lassen – so wie ich.
Entschlossen drehte ich mich ab. Den heutigen Abend, so unfreundlich das Wetter auch war, wollte ich geniessen. Sobald meine wahre Bestimmung ans Licht kam, hatte ich nicht nur eine schwere Strafe, sondern auch unangenehme Fragen zu befürchten. Die Menschen glaubten, eine Seherin könne einen Blick in die Zukunft werfen. Doch das war Unfug. Sobald ich zurück war, würde ich in den Tempelarchiven nach Unterlagen zu den Seherinnen suchen, um selbst eine Ahnung von deren Fähigkeiten zu erhalten.
Doch der heutige Abend gehörte mir.
Ein Blitz erhellte den Wald, sein Donner folgte im gleichen Augenblick, als wollte er mich in die Knie zwingen. Der Regen prasselte auf das Blattwerk über meinem Kopf, sammelte sich auf den Blättern zu dicken Tropfen und prickelte auf meiner Haut, wenn mich einer davon traf.
Befreit lachte ich auf, drehte mich um die eigene Achse und breitete die Arme seitlich aus. Herrlich, diese Freiheit! Im Tempel hatte ich mich nie so beschwingt gefühlt. Übermütig hüpfte ich über einen Stein, lachte und tanzte den kaum erkennbaren Weg entlang, der sich den Hügel hinaufschlängelte.
Aus dem feuchten Waldboden wurde nasser Untergrund. Wie graue Bindfäden rann der Regen auf die Erde und tränkte sie mit seinem Leben spendenden Saft. Mein Herz tanzte mit mir zwischen den Bäumen hindurch, hüpfte aus der Brust und flog zu mir zurück, um mir mit einem dicken Kuss für dieses Erlebnis zu danken.
Unter meinem Fuss brach ein Ast. Ich fiel in die Tiefe. Kein Boden, kein Stein hielt mich auf. Nasses Laub klatschte gegen meine Beine. Panisch suchte ich nach einem Halt für meine Hände. Ich rutschte weiter. Wie ein Blitz durchzuckte mich Schmerz, als ich mit dem Ellbogen gegen eine Kante stiess. Einen lauten Fluch unterdrückend, tastete ich weiter, während mein Oberkörper immer tiefer in das Loch sank, das sich unter mir aufgetan hatte. Endlich packten meine Hände einen dürren, viel zu dünnen Ast. Mein Sturz verlangsamte sich, kam zum Stillstand. Für einige Augenblicke baumelte ich in der Luft.
Ein leises Knacken zerstörte die trügerische Stille und kündigte das Bersten eines weiteren Astes an. Ich fiel erneut. Mit einem Fuss kam ich auf einem Vorsprung an, hakte ein und überschlug mich. Ich schrie.
Die Welt hatte sich unzählige Male um mich gedreht, als mein Sturz zu einem Ende kam. Erst wagte ich nur zu atmen, nahm einen Atemzug nach dem anderen. Trotz einiger schmerzender Stellen gelang es meiner Lunge erstaunlich gut, nach Luft zu schnappen.
Ich setzte mich auf, befreite meinen Arm von nassem Laub und sah mich um. Über mir schimmerte der mit Gewitterwolken verhangene Himmel zwischen Wurzeln hindurch. Das Loch wirkte von hier unten so klein, dass ich mir nicht vorstellen konnte, da hindurchgepasst zu haben.
Entschlossen stand ich auf und tastete die Wände ab. Vom Regen waren sie glitschig, an einer Stelle floss sogar ein Rinnsal über die matschige Erde. Ich fand keinen Halt, an dem ich mich an die Oberfläche ziehen konnte. Selbst die Wurzeln der Bäume waren zu weit entfernt, um sie zu erreichen.
Ich kauerte mich auf den Boden. Die Feuchtigkeit drang erneut in mein Kleid und zehrte an meinen Kräften. Ich zog die Beine an und legte den Kopf auf die Knie, um meine rasenden Gedanken zu beruhigen. Ein falscher Schritt, schon lag ich in einem dunklen Loch und kein Weg führte mehr hinaus.
Über meinem Kopf donnerte das Gewitter nieder. Lichtblitze zuckten über den Himmel, erhellten den Wald und malten schaurige Schatten an die Wände meines Gefängnisses. Vielleicht morgen, wenn es heller war … Ich schluckte. An die Möglichkeit vielleicht morgen auch nicht wollte ich nicht denken.
Ich fror jämmerlich. Meine Beine waren so weich wie warmer Zuckersirup. Ich nieste. Die ganze Nacht über würde ich nicht aushalten.
Wie der nächste Blitz den Himmel durchzuckte mich die Erkenntnis. Wenn ich jetzt nicht handelte, würde ich nie mehr kämpfen. Entschlossen erhob ich mich und tastete mich an der Wand aus verfestigter Erde entlang. Die Dunkelheit nahm zu. Mit meinen Fingern ertastete ich kühlen, harten Fels, im Laufe von Generationen von Wasser bei starken Unwettern geschliffen und gerundet.
Erstaunt hielt ich inne. Schritt für Schritt hatte ich mich von der Absturzstelle entfernt. Gab es tatsächlich einen weiteren Weg aus dem Loch hinaus? Ich stolperte durch eine Höhle, immer tiefer in den Berg, und hielt mich stets links. Falls ich nicht hinausfand oder es keinen Ausweg gab, dann konnte ich mich einfach umdrehen. Wenn ich mich dann rechts hielt, konnte ich die Absturzstelle nicht verfehlen.
Und die frische Luft. Ein kalter Hauch nach feuchter, steiniger Erde schlug mir entgegen, noch kälter als die Nacht sowieso schon war. Mich fröstelte. Zu gern hätte ich mich zu einem Knäuel zusammengerollt und mich vor der Kälte und der Schwärze versteckt, doch ich durfte den Fels nicht loslassen. Ich musste weitergehen, immer tiefer. Und wenn mich meine Beine nicht mehr trugen, musste ich umkehren.
Zur allumfassenden Dunkelheit gesellte sich die Ewigkeit. Die Zeit floss unaufhaltsam dahin, das wurde uns gelehrt, doch jetzt rannte sie so schnell wie ein gefrorener Bach. Ich schluckte und zweifelte an meiner leichtfertigen Entscheidung, die Absturzstelle zu verlassen. Ich sollte umdrehen und …
Stimmen. Tiefe Stimmen. Abrupt blieb ich stehen. Derart tiefe Stimmen hatte ich noch nie gehört. Noch verstand ich kein einziges Wort, dafür waren sie zu leise. Zudem warfen die kahlen Wände ihre Sätze zurück, sodass sie einmal, zweimal, vermischt und unkenntlich an meine Ohren gelangten. Noch war es mehr ein Flüstern, doch je weiter ich mich vorkämpfte, desto deutlicher wurden sie.
Das Licht eines Blitzes erhellte die Höhle, malte gezackte Muster an die Wände und sandte einen Donner hinterher, der mir bis ins Mark fuhr. Ich erstarrte. Das Gestein unter meinen Füssen grollte mit dem Donner. Oder bildete ich mir das ein? Ich schluckte. Spätestens jetzt wünschte ich mir, die Befehle unserer Lehrerinnen befolgt und die Tempelmauern nicht verlassen zu haben. Wie dumm konnte ich sein? Dennoch, da war ein Ausgang. Mein Herz hüpfte aufgeregt und ängstlich zugleich.
Ich wartete, bis sich meine Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt hatten, und schlich weiter. Die Stimmen waren verstummt, doch das schwache Licht verstärkte sich mit jeder Kurve, um die ich bog.
Unerwartet fand ich mich nur wenige Schritte von einem Ausgang entfernt wieder. Davor konnte ich die Schemen einer geheimnisvollen Landschaft ausmachen, geprägt von Bäumen, schroffen Felsen und einem weiten Fluss, der sich am Talboden schlängelte. Mein Mund blieb offen stehen. Einen solchen Anblick … Ich schüttelte den Kopf. So etwas hatte ich noch nie gesehen.
Die höchsten Nadelbäume kratzten an den Bäuchen der Wolken und reizten sie, ihre Wut in der Schlucht zu entlassen. Ein Blitz zuckte über den verhangenen Himmel und brachte rollenden Donner mit sich. Wie versteinert blieb ich stehen. Das Schauspiel faszinierte mich.
Meine Brust glühte schmerzhaft auf. Erschrocken keuchte ich, fasste an mein schmutziges Kleid und krallte die Finger ins Leinen. »Ich gehöre hierher.«
Vehement schüttelte ich den Kopf und schob meine Verwirrung auf das Gewitter, das sich vor der Höhle austobte. Dem Wüten der Blitze folgten Regentropfen, schwer und kühl, die aus dem dunstverhangenen Tal ein wässriges Kunstwerk zauberten. Ich trat aus der Höhle und betrachtete die fruchtbare Gegend, die sich gar nicht so weit von dem Ort entfernt befand, an dem ich aufgewachsen, der unseren Augen jedoch verborgen geblieben war.
»Vielleicht solltest du dort weg.« Ein raues Lachen erklang, dessen Tiefe mich wie die Stimmen vorher überraschte.
Ich blickte nach oben. Etwas seitlich über mir hockte jemand auf einem Felsvorsprung. Das Kinn war dunkel, die Haare kurz und irgendwie fehlten die Rundungen. Verwirrt legte ich den Kopf schief und versuchte, meine Beobachtungen in Einklang mit dem zu bringen, was ich erwartete.
»Bist du stumm? Oder taub?«
Die Stimme vibrierte in meinem Kopf nach. Ich wollte mehr von ihr, mehr von diesem Ton hören, der so warm und rau war, dass ich ihr für immer lauschen wollte. »Ich bin weder taub noch stumm«, antwortete ich. »Wenn, dann stünde ich nicht im Dienst des Tempels.«
Ein Mann! Das musste ein Mann sein! Ein erschrockener Schrei kam über meine Lippen, und ich wich einige Schritte zurück in die Höhle. Ich musste von hier verschwinden!
»Warte! Es ist zu gefährlich.«
Gefährlich war nur er. Es gab keine Männer in Zefira. Sie waren zu schwach. Wenn ein Junge dem Kindesalter entwuchs, verdankte er es den dunklen Kräften, die nach der Macht der Stadt und nach unseren Führerinnen griffen.
Als ich seine Schritte hinter mir hörte, drehte ich mich um und warf ihm wütende Blicke zu. »Geh weg, Sohn des dunklen Lichts!«, zischte ich und hoffte, es würde ihn in die Flucht schlagen.
Mit wenigen Schritten überwand er die Distanz zwischen uns und packte mich fest am Handgelenk. Ein wenig überrascht war ich ob der Wärme seiner Haut, doch bevor ich mich erholen konnte, zerrte er mich nach draussen. Ein Donnern rollte heran, tief und schäumend, ganz anders als jenes, das den Blitzen folgte. Ich sah nach hinten und wurde im selben Moment herumgeschleudert. Der Mann zog mich zur Seite, weg vom Höhleneingang, der sintflutartig Wasser ausspuckte. Es schäumte in die Tiefe, riss einen Baum mit und verschwand im Wald.
Atemlos beobachtete ich das Geschehen, bis mich ein leises Lachen aus meiner Starre riss. Ich wandte mich zu dem Mann um, der mich an sich drückte und frech grinste.
Ich stiess mich von ihm weg. »Was soll das?« Mein Herz pochte laut und viel zu schnell. Bestimmt lag es an der Gefahr, der ich um Haaresbreite entwischt war – dank seiner Hilfe.
»Wie wäre es mit einem Dankeschön?«, fragte er grinsend und suchte die Felswand ab. Flink wie eine Eidechse kletterte er auf den Vorsprung, von dem aus er mich beobachtet und angesprochen hatte. Er schien nicht einmal mit einer Reaktion zu rechnen.
Unschlüssig blieb ich stehen. Noch immer spuckte die Höhle Wasser aus und säuberte sich von Laub, kleinen Steinen und Ästen, die sich im Laufe der Zeit in ihr gesammelt hatten. Im Moment konnte ich nicht nach Hause. Bei dem Gedanken an den Tempel seufzte ich leise. Ob sie mich schon vermissten?
Unwirsch wischte ich die Erinnerung an mein Zuhause beiseite. Darüber konnte ich mir Sorgen machen, wenn ich einen Weg aus diesem Tal gefunden hatte.
Wieder wanderte mein Blick zu dem Mann über mir. Er lehnte sich gegen die Wand, ein Lächeln auf den Lippen, und beobachtete das Gewitter, das sich langsam entfernte und nur den Regen zurückliess.
Er wirkte glücklich.
Beherzt packte ich den Griff, an dem er sich hochgezogen hatte. Auch wenn er sich an die Seite von dunklen Mächten stellte, hatte er mir das Leben gerettet und war der einzige Mensch weit und breit. Im Gegensatz zu ihm mühte ich mich die zwei Manneslängen hoch und kam schnaufend auf dem felsigen Untergrund zu liegen.
Er grinste mich an, ein lustiges Funkeln erhellte seine Augen.
»Werd bloss nicht frech!« Ich rollte mich auf die Seite und setzte mich schliesslich auf. Inzwischen war ich völlig durchnässt, die Farbe meines Kleides war kaum noch zu erkennen und vermutlich standen meine Haare in alle Himmelsrichtungen ab.
Er zuckte mit den Schultern. »Das muss ich nicht. Du bist für uns beide frech genug.«
Mir blieb die Sprache weg. Wie konnte er nur so mit einer Dienerin des Tempels sprechen, noch dazu mit einer Kräuterkundigen? Ich holte Luft, um ihm meine Meinung zu sagen, doch er kam mir zuvor: »Woher kommst du?«
Täuschte ich mich oder wartete er meine Antwort gespannt ab? Seine Kiefermuskeln mahlten kaum erkennbar, doch als würde sich mein Blick daran festkrallen, fiel es mir auf. »Wie du gesehen hast, bin ich munter aus der Höhle spaziert.«
Er lachte auf. »Und wärst da drinnen verreckt, hätte ich dich nicht selbstlos gerettet.«
Wenn ich mich nicht täuschte, zogen sich seine Mundwinkel kaum merklich nach unten. Ein stürmischer Wind brauste durch meinen Bauch, fast so stark wie der Sturm vor dem Gewitter. Wusste er denn nicht, dass ich eine angesehene Priesterin im Tempel von Zefira war?
Dennoch fand ich nicht den Mut, ihm auch nur noch einen Wink zu geben. Wenn er zugehört hatte, wusste er schon zu viel. Vielleicht war es meinem schmutzigen Kleid zu verdanken, dass er mir keine Klinge an den Hals hielt. Ich kannte die Gerüchte. Es gab Rebellen in den Bergen, wilde Horden aus nackten Affen, die immer wieder gegen unsere Stadtmauern stürmten oder sich hineinschlichen.
Ich besah ihn mir genauer. Er wirkte nicht wie ein Affe. Im Grunde genommen war er sogar schön. Vermutlich. Auf jeden Fall fehlten ihm keine Zähne, und Augen hatte er auch beide noch, die Ohren waren an ihrem Platz, und er wirkte kräftig und gesund.
Ich beschloss, ihm meine Herkunft nicht zu verraten. Stattdessen versuchte ich mich an einem freundlichen Lächeln. »Vielen Dank dafür.«
Er hob eine Augenbraue und richtete den Blick auf mich. »Plötzlich so höflich?« Er schien dem Frieden nicht zu trauen. Ich musste mich in Acht nehmen, wollte ich nicht auffliegen.
Ich zuckte mit den Schultern und legte den Kopf schief. »Du hast mir das Leben gerettet. Dass ich dich so angefahren habe, lag vermutlich am Schock und an der Reise hierher.«
Nachdenklich betrachtete er mich, lächelte mich an und entspannte sich sichtlich. Ich liess meinen Atem erleichtert ziehen. Die erste Hürde war geschafft, er misstraute mir nicht mehr – jedenfalls nicht so sehr, dass er mich weiter aushorchen würde.
»Ich liebe diese Stimmung, wenn sich die Wolken an den Berghängen entleeren und die Welt reinwaschen. Und die Regentropfen auf der Haut zu spüren ist so erfrischend.«
Seine vibrierende Stimme nahm meine ganze Aufmerksamkeit gefangen. Fasziniert beobachtete ich ihn, wie er den Wolken auf der Jagd nach dem nächsten Tal zusah und dabei sanft lächelte. Als wollte er seine Worte unterstreichen, stand er auf und trat an den äussersten Rand des Vorsprungs, wo sich ein paar Grashalme mutig über den Abgrund reckten. Im Dämmerlicht prasselten die dicken Tropfen auf seine Haut, durchnässten die wilden Haare und seine Kleider. Ein befreites Lachen ergriff von ihm Besitz, schüttelte ihn durch und war für einen unendlichen Augenblick der Mittelpunkt meiner Welt.
Zu viele Fragen
Er hat mich gerettet. Immer wieder schoss mir dieser eine Gedanke durch den Kopf. Dabei hatte ich mich durch zwei unbedachte Bemerkungen verraten. Ich zog die Beine noch näher an den Körper und legte den Kopf auf die Knie. In Zefira kursierten so viele Gerüchte über die Rebellen, die die Stadt bei jeder Gelegenheit angriffen und an der Grossen Göttin zweifelten.
Ich schluckte und warf ihm einen Seitenblick zu. Er lächelte entspannt, betrachtete den Regen und genoss dessen Rauschen im Laub der Bäume. Er wirkte friedlich und in sich gekehrt, ganz anders, als ich mir einen Rebellen vorgestellt hatte: zottelig, brummig, nur grob der Sprache mächtig.
»Wie heisst du?«, brach ich die Stille, ohne den Blick von ihm abzuwenden.
Sein Lächeln vertiefte sich kaum merklich. »Taio.«
Ich wartete, dass er nach meinem Namen fragen würde, mehr über mich herausfinden wollte. Doch er schwieg, lauschte weiter dem Regen. Schliesslich räusperte ich mich. »Willst du meinen Namen nicht kennen?«
Nun wandte er den Kopf. Seine dunklen Augen leuchteten von innen, als er meine Gesichtszüge musterte, als könnte er in ihnen alles lesen, was er wissen wollte – sogar meinen Namen. »Ist er denn wichtig?«
Ich wandte mich ab und lehnte mich nach hinten, obwohl mein Herz schon wieder so heftig schlug. Es raubte mir den Atem, ich konnte dieses aufgeregte Pochen nicht recht begreifen. »Ich denke, dass wir von unseren Eltern sehr viel auf unseren Weg durchs Leben mitbekommen. Doch nichts bleibt uns bis an unser Ende wie unser Name.«
Wieder liess er sich Zeit mit der Antwort. Vielleicht hatte er nur deshalb eine so gute Aussprache, weil er sich die Worte erst mühsam im Kopf zurechtlegte. »Einen Namen kann man auch ablegen, ebenso wie eine Vergangenheit oder eine Zukunft.« Obwohl er entspannt klang, schwang ein bitterer Hauch in seinen Worten mit.
Augenblicklich stellte ich mir vor, wie er seine Heimat verlassen hatte, vor einer unbekannten Bedrohung geflohen und am Ende hier gelandet war. Trotz meiner Neugier schaffte ich es nicht, ihn danach zu fragen. Eine unsichtbare Grenze hinderte mich daran.
»Erlebst du so was öfter? Den Regen und die Blitze?«, wechselte ich stattdessen das Thema.
Er lachte leise. Mein Herz klopfte heftiger, und ich erblühte innerlich. Ich hatte ihn zu einem Lachen verführt! Diese Schwingung setzte sich tief in meinem Bauch fort und liess mich tanzen, auch wenn ich nicht ein einziges Bein bewegte.
Taio drehte mir den Kopf zu. »Hin und wieder, wenn keine junge Frau neben mir sitzt und wie ein Wasserfall plappert.«
Überrascht starrte ich ihn an, blinzelte. In seinen Augen blitzte es übermütig auf. Das befreite Lachen riss mich mit, forderte mich zum Tanz auf und veranlasste mich für einen Wimpernschlag, alle Sorgen und Bedenken zu vergessen. Unglaublich, wie leicht sich der Moment in seiner Nähe anfühlte.
Lächelnd wandte ich mich ab, gab meinem Bauch die Zeit, die er brauchte, um sich von diesem flatternden Gefühl zu erholen. Die laute Stille, das Prasseln im Nichts – es hatte etwas Befreiendes, selbst wenn ich nur an den Berg gelehnt sass und nichts tat. Kein Unkraut zu rupfen, keine Salbe herzustellen. Ich fühlte mich angekommen.
Taio stand auf und verschwand in einer Einbuchtung im Fels, aus der er mit einem Beutel in der Hand zurückkam. »Hast du auch Hunger?«
Ich starrte auf seinen Vorrat, als würde mich sein Essen vergiften. Mein Magen knurrte. Wahrscheinlich gehörte er den Rebellen an, die ihr Leben damit verbrachten, anderen ihres schwer zu machen oder zu nehmen, wenn ihnen das Glück hold war.
»Keine Sorge«, riss er mich aus meinen Gedanken, als könnte er sie lesen. »Ich würde nicht meinen ganzen Vorrat vergiften, um dir zu schaden. Dafür esse ich zu gern.«
»Wer weiss, vielleicht hast du ja zwei Beutel mitgenommen: einen für Feinde und einen für dich.« Ich hoffte es nicht.
Er lachte leise. »Sind wir denn Feinde?«
Ja. Nein. Die Worte flogen durch meinen Kopf, wie die Schmetterlinge um den Flieder herumflatterten, wenn er dunkelrosa blühte und einen betörenden Duft im Tempelgarten verbreitete. Ein Durcheinander aus Eindrücken und Erzählungen, aus Erlebtem und Gehörtem mischte sich, sodass ich am Ende nicht mehr wusste, was ich glauben sollte.
»Ich denke nicht.« Leise seufzte ich und hoffte, dass er es nicht hörte.
Taio brachte ein Stück dunkles Brot zum Vorschein, dazu ein paar Nüsse und eine Handvoll getrocknete Früchte. Mir lief das Wasser im Mund zusammen.
»Das freut mich.« Seine Erleichterung kaufte ich ihm sogar ab. In aller Ruhe brach er das Brot und gab mir ein Stück.
Gierig biss ich hinein. Seit der Zeremonie, bei der ich zur Seherin ernannt worden war, war mir der Appetit vergangen. Manchmal brachte ich gar nur ein paar Bissen hinunter, so wie heute Mittag. Diese Lust am einfachen, aber nahrhaften Essen hatte ich schon fast vergessen.
Er beobachtete mich mit einem Schmunzeln in den Augen, sagte jedoch nichts.
»Was ist?« Verunsichert sah ich ihn an, um keine Regung zu verpassen. Ich wollte diesen Mann verstehen, der mich so leicht werden liess, dass ich am liebsten hiergeblieben wäre.
Er schüttelte den Kopf und wandte den Blick dem düsteren Himmel zu, der sich in der Dunkelheit der Nacht nicht mehr vom Tal vor unseren Füssen unterschied. »Man könnte meinen, dass die Frauen in Zefira hungern müssten.« Ein anklagender Unterton vibrierte in seiner Stimme mit, den ich diesmal nicht überhören konnte. Als hätte die Stadt sein Leben zerstört.
Ich senkte den Kopf und starrte auf meine Hände. Vielleicht hatte Zefira sein Leben ja zerstört, ohne dass ich davon wusste? Jedenfalls wirkte er nicht wie jemand, der sich der dunklen Macht verschrieben hatte – ein Wunder, denn Jungen entwuchsen dem Kindesalter nur dann, wenn sie sich von der Grossen Göttin abwandten.
Innerlich seufzend, senkte ich die Hand mit dem Brot auf meinen Schoss und schloss die Augen. Am besten verschwand ich auf der Stelle und brachte mich in Sicherheit, solange ich noch konnte. Doch dagegen sträubte sich alles in mir, jedes einzelne Haar an meinem Körper wollte hierbleiben – selbst die ausgefallenen, die sich irgendwo in meinem Kleid versteckten.
Ich schluckte den letzten Bissen Brot, doch er blieb mir im Hals stecken, als mir bewusst wurde, was er wirklich gesagt hatte: Zefira. Er hatte die Stadt genannt, mich in Verbindung mit ihr gebracht. Er wusste, woher ich stammte.
Erschrocken starrte ich ihn an, doch er schien es nicht zu bemerken. Stattdessen blickte er weiter in die Nacht hinaus, als würde er dort die Antworten auf all seine Fragen finden.
»Du weisst, dass ich aus Zefira komme?«, hauchte ich, auch wenn ich es lieber als mein Geheimnis wieder mit nach Hause genommen hätte. Die Gewissheit, dass er es wusste, machte mich verrückt. Ich konnte nur erahnen, was er mit mir vorhatte, welche dunklen Pläne sich hinter der sonnengebräunten Stirn formten.
Nachdenklich nickte er, die Lippen leicht zusammengepresst. Konnte es etwa sein, dass er es lieber nicht gewusst hätte?
Die nächste Frage fiel mir ungleich schwerer, denn sie bedeutete den Bruch zwischen uns, auch wenn es ein Uns eigentlich gar nicht gab. »Du gehörst zu jenen, die Zefira einnehmen wollen?«
Taio senkte den Blick und holte tief Luft. »Lass die Fragen bleiben, damit wir uns heute Nacht nicht streiten.« Auch das war eine Antwort, wenn auch keine, wie ich sie mir gewünscht hatte.
Seine Schwere erinnerte mich an das Orakel, das mir das Ende des Sturmes vorausgesagt hatte. »Vielleicht bleibe ich ja nicht bis morgen?«
Er lachte auf und deutete mit dem Finger zur Höhle, aus der noch immer Wasser floss, wenn auch nicht mehr so sprudelnd wie am Anfang. Dennoch riss die Strömung gefährlich stark, sodass ich meinen wahnwitzigen Plan gleich verwarf, obwohl sich meine Freundinnen und Rumanda bestimmt schon sorgten.
Ich beugte mich vor, um mir eine neue Position zu suchen. Die immer gleichen Felsknubbel drückten in meinen Rücken. »Na gut, deine Gastfreundschaft ist so überwältigend, dass ich einfach nicht anders kann, als zu bleiben«, erwiderte ich und verdrehte gespielt genervt die Augen.
Er warf mir einen nicht zu deutenden Blick aus düsteren Augen zu, ehe er sich sichtlich entspannte. »Und ich dachte, Frauen aus Zefira hätten keinen Humor.«
»Und ich dachte, Männer aus den Wäldern schlachten alle Frauen ab.«
Er blinzelte verwirrt. »Das wäre dumm. Wir brauchen die Frauen, um nicht auszusterben.«
Damit hatte er wohl recht. »Also planst du, mich gefangen zu nehmen und als Zuchtstute zu halten?«
»Zuchtstute? Also bitte, so nennen wir unsere Frauen doch nicht!« Er lachte leise, doch bei Weitem nicht so losgelöst wie noch vor wenigen Augenblicken. »Das sind Perlen – mindestens!«
Mein Blick blieb an seinem traurigen Lächeln hängen. Wieso berührte mich diese Schwere hinter seiner leichten Fassade, obwohl es mir egal sein müsste? Die Worte des Orakels dröhnten in meinen Ohren, als würde es schreiend neben mir stehen. Es hatte mich auserwählt, die Ungerechtigkeiten zu erkennen und aus der Welt zu schaffen.
Ich räusperte mich. »Was verbindest du mit Zefira?«
»Ich möchte nicht darüber sprechen.«
Genervt rollte ich mit den Augen. »Beim Fluch der Grossen Göttin, wieso blockst du alles ab?«
Er brummte und drehte den Kopf weg, als hätte ich ihn in die Enge getrieben. »Weil es keinen Unterschied macht. Zefiras Führung will nicht verhandeln und uns stattdessen ausrotten. Wieso soll ich einer unbedeutenden Frau, die sich verlaufen hat, alles preisgeben?«
Überrascht starrte ich ihn an. Er sah in mir nichts Spezielles. Einerseits beruhigte mich das, hatte ich doch das Gefühl, dass mich seit der Zeremonie alle anders anstarrten, andererseits wäre es schön gewesen, in seinen Augen wenigstens mehr als nur eine unbedeutende Frau zu sein – warum auch immer mir das wichtig war.
»Weil auch eine unbedeutende Frau einen Unterschied machen kann«, erwiderte ich sanft und meinte jedes Wort so, wie ich es sagte. Ich glaubte daran, dass jede etwas verändern konnte, auch wenn der Kampf hart und aussichtslos schien.
Verbittert schnaubte er durch die Nase. Ich hatte nicht erwartet, dass in dem Mann, der mich mit seinem unbeschwerten, herzlichen Lachen zu faszinieren vermochte, so viel Gram steckte.
»So wie die unbedeutenden Männer in euren Katakomben?«, begehrte er auf. »Die nie einen Strahl Sonnenlicht sehen und nur darauf warten, als Samenspender auserwählt zu werden? Die sich damit abfinden, eines Tages auf dem Opferaltar zu landen, um einer Zeremonie Macht zu verleihen? Tag für Tag werden ihnen die Träume genommen, und wenn die Frauen sie selbst ihrer Würde beraubt haben, werden sie kaltblütig aus dem Weg geräumt.«
Unwillkürlich wich ich zurück, rutschte zur Seite. Seinen Ausbruch hatte ich nicht erwartet, die Wut schwappte über ihn hinweg, er warf die Hände in die Luft und funkelte mich zornig an.
»Nicht ohne Grund heisst der Rote Fluss so. Es gibt eine Grube, durch die ein Arm des Flusses führt. Dort hinein wirft die Führung die Leichen, nachdem sie sie in zeremonientaugliche Stücke gehauen hat. Im Namen deiner beschissenen Grossen Göttin!«
Ein dunkler Klumpen zog sich in meinem Bauch zusammen. Erschrocken hielt ich die Luft an, um mich nicht vor Schmerzen zu krümmen. Er sprach die Wahrheit. Ich wusste es tief in mir drin – ein Funke, zum Leben erwacht, um die Veränderung einzuläuten. Doch was Taio voller Schmerz in die Welt hinausschrie, versetzte mich in Angst.
Wieder schnaubte er abfällig, lehnte sich zurück und krallte die Hand in sein Haar. »Und eine unbedeutende Frau will die Veränderung herbeiführen, um die wir seit Generationen kämpfen?«
Ich schwieg. Seinem Zorn war ich nicht gewachsen, selbst wenn ich mich als Seherin offenbaren würde. Das würde ihn höchstens dazu verleiten, mich als Geisel zu nehmen und damit irgendetwas zu erpressen. Doch auch das war keine Lösung.
Die einzige Lösung war Stille. So zog die Nacht an uns vorbei, der Regen wurde schwächer, bis nur noch das schwere Tropfen dicker Wasserperlen von Blättern in kleine Pfützen zu hören war. Die Welt kam zur Ruhe, nahm mich mit auf ihrer Reise in einen leichten Schlaf, die Kälte und Nässe ignorierend.
Vertrauen und Verrat
Dem Rauschen des Laubs im kühlen Morgenwind hätte ich eine Ewigkeit lang zuhören können. So sanft von der Natur geweckt zu werden war mir fremd. Trotz der Gänsehaut auf meinen Armen konnte ich mich nicht von der äussersten, noch trockenen Stelle lösen. Taio hatte mir schon vor einiger Zeit angeboten, mich zu wärmen, doch nur mit den Schultern gezuckt, als ich abgelehnt hatte.
Vielleicht sollte ich sein Angebot doch annehmen.
Ich wagte einen Blick über meine Schulter, obwohl ich seine Umrisse im grauen Licht des anbrechenden Tages nur schemenhaft erkannte. Er lehnte gegen den Stein, die Arme vor der Brust verschränkt und die Beine ausgestreckt.
»Endlich genug gesehen?«, fragte er mit seiner tiefen Stimme, die mich so sehr in ihren Bann zog, dass ich manchmal vergass, seinen Worten eine Bedeutung zu geben. Passierte das bei allen Männern?
Ich neigte den Kopf zur Seite. »Regen ist etwas Kostbares. Er erhält Leben und reinigt die Welt. Diese Kraft zu erleben ist ein Geschenk«, erklärte ich mein Staunen. Dass ich solche Gewitter bisher nur hinter den Tempelmauern erlebt hatte, brauchte er nicht zu wissen.
Er setzte sich aufrecht hin und bedachte mich mit einem intensiven Blick, den ich mehr spürte denn sah. »Ich dachte, Gewitter gibt es überall.«
Ein Lächeln huschte über mein Gesicht. »Nicht in Zefira, jedenfalls nicht so oft. Wir sehen, wie der Regen in den Bergen und Hügeln niedergeht, doch in der Stadt weht einzig dieser Wind, der das Gewitter ankündigt.« Ich machte eine kurze Pause. »Lebst du hier?«
»Ist das ein Verhör?«
Tief holte ich Luft, schüttelte den Kopf und drehte mich weg. Wenn er nicht sprechen wollte, zwang ich ihn nicht dazu. Bald schon ging die Sonne auf, und ich würde mich auf den Heimweg machen – mit knurrendem Magen und dem Gefühl, etwas übersehen zu haben. Doch im Tempel sorgten sie sich bestimmt schon. »Es war nur eine Frage«, murmelte ich und wusste nicht, ob ich darum beten sollte, dass er es hörte, oder darum, dass er es nicht hörte.
»Das Tal ist unser Zuhause. Die Wenigsten mögen Gewitter und verkriechen sich in ihren Hütten, deshalb komme ich oft allein hierher, um es zu geniessen.« Sein Finger deutete auf einen Punkt in der Talsohle. »Dort leben wir. Das Dorf verschwindet unter den Baumkronen, sodass du es von hier aus nicht sehen kannst.«
Im Tal erkannte ich sowieso nichts. Der anbrechende Tag tauchte die tiefer gelegenen Stellen in ein düsteres, schummriges Licht, das Konturen und Farben schluckte. Ich schlang die Arme um meinen Oberkörper, als ein Windzug an meinem noch immer feuchten Kleid zog. Taios Decke wirkte einladend, die Vorstellung seiner Körperwärme, auch wenn es nur wenig war … Ich schluckte und wandte mich ab. Vielleicht diente er diesen unbekannten dunklen Kräften, die schwache Jungen stark machten und Zefira bedrohten. Ich durfte ihm nicht vertrauen.
Er rutschte zu mir, setzte sich hinter mich und deutete auf einen Punkt in der Nähe des Lagers. »Da ist meine Hütte. Von dort aus kann ich diesen Platz sehen, wenn ich will.«
Die tiefe Stimme so nah an meinem Ohr zu hören, löste ein wildes Kribbeln in meinem Bauch aus. Vielleicht war es nur ein Windhauch, doch ich bildete mir ein, seinen Atem auf meiner Wange zu spüren, die Wärme an meinem Rücken. Vor Aufregung brachte ich kein Wort über die Lippen.
»Wie verirrt sich eine Frau wie du hierher?«
Ich schluckte. Nicht um alles in der Welt konnte ich ihm offenlegen, dass ich direkt aus dem Tempel zu den Hügeln gerannt war. Er gehörte den gefürchteten Rebellen an. Jede Information könnte ihn weiterbringen. Würde er noch von meiner Aufgabe als Priesterin erfahren, würde er mich der dunklen Macht opfern oder als Geisel nach Zefira bringen, um etwas zu erpressen. Ich schauderte. Dann wäre wenigstens klar, weshalb das Orakel seit Jahren kein Opfer mehr ernannt hatte. Die erste Seherin in einer ganzen Ewigkeit, und sie rannte mitten in die offenen Arme der Rebellen. Das war für Generationen Opfer genug.
Ich wedelte mit der Hand in der Luft. »Zufall«, entgegnete ich und wandte meinen Blick dem wunderschönen Tal zu.
»Ich verstehe.«
Hoffentlich nicht.
»Gibt es einen Geheimpfad nach Zefira?«
Ich erstarrte. Das klang ganz sicher nach einem Verhör. Mit angehaltenem Atem betete ich zu unserer Göttin, dass er es nicht bemerkte. »Nein«, antwortete ich mit piepsiger Stimme, die jeder Maus Konkurrenz gemacht hätte.
Er lachte, doch es klang angespannt, als wollte er nicht, dass ich seine List durchschaute. Ich wandte mich ihm zu und hielt erschrocken die Luft an. Er fixierte mich mit dunklem Blick. Ehe ich ihn zu deuten wusste, lehnte er sich zurück und sah in das Tal hinunter. Ein Lächeln zeichnete sich auf seinen Lippen ab und brachte die Leichtigkeit zurück, die mich vom ersten Augenblick an fasziniert hatte.
Ich folgte seinem Beispiel und wandte mich zum Tal. Vor Staunen klappte mein Mund auf. So wunderschön, wie sich die Sonne über die entfernten Berggipfel schob, ihre Strahlen zwischen Wolken und Berge auf die sattgrünen Wälder sandte und den Vögeln erste Gesänge entlockte. Als hätte der Regen die Welt rein gespült, glitzerte sie im neuen Tag und erhellte mein Herz. Ein Lächeln breitete sich auf meinen Lippen aus und für einen Moment vergass ich meine Sorgen.
»Jede grössere Stadt hat Geheimwege«, gab Taio zu bedenken.
Verwirrt richtete ich meinen Blick auf ihn und zog die Augenbrauen zusammen. Im Gegensatz zu mir schien er nicht im Geringsten vom Sonnenaufgang beeindruckt, der die Schönheit meiner Heimat – oder wohl eher seiner Heimat – zum Funkeln brachte. »Wenn du es so genau zu wissen scheinst, warum fesselst du mich dann nicht einfach, verschleppst mich in dein Dorf und vierteilst mich bei lebendigem Leib?«
Er blinzelte und starrte mich an, ehe er lächelte und ein Strahlen in seine grünbraunen Augen zauberte, das leise Zweifel in mir aufkeimen liess. »Ich rette doch nicht dein Leben, um dich den Geiern zum Frass vorzuwerfen. Zudem würdest du viergeteilt noch weniger antworten.« Belustigt zwinkerte er mir zu, legte sich auf den Bauch und schwang sich über den Rand des Vorsprungs auf den Boden.
Überfordert starrte ich ihn an. Er hatte gezwinkert! Ich beeilte mich, seinem Beispiel zu folgen, und kletterte hinter ihm zur Höhle hinunter, die mir den Heimweg wies. Wortlos reichte er mir seine Hand und half mir, als ich den letzten Absatz hinuntersprang. »Danke.«
Für einen Mann grinste er viel zu frech. »Na also, so schlimm ist das doch nicht mit dem Danke.«
»Ich bin ja nicht dumm.«
Er schluckte, blickte über seine Schulter zum Rand der Büsche, die zwischen den Steinblöcken einen Platz zum Gedeihen gefunden hatten, und fuhr sich mit den Fingern durch das dunkle Haar. Noch immer hielt er meine Hand. Die Wärme zauberte mir ein Kribbeln in den Arm.
»Manche werden es denken.« Er wies auf einen Punkt seitlich den Hang hinab.
Mein Blick folgte seinem ausgestreckten Arm. Am Anfang erkannte ich nichts, doch dann entdeckte ich die drei Männer, die sich zwischen den Büschen und Bäumen hochkämpften. Vor Angst schnürte sich mir die Kehle zu, und ich wich einen Schritt zurück. »Hast du mich verraten?«
Er stemmte die Hände in die Hüften und betrachtete mich mit einem Blick, der seine eigenen Zweifel und Hoffnungen offenlegte. Zögernd schüttelte er den Kopf. Er steckte in einem ebenso grossen Zwiespalt wie ich.
Meinem Blick ausweichend, seufzte er tief. »Zufall. Manchmal suchen sie mich am Morgen, um zu jagen. Vielleicht haben sie dich auch entdeckt, gestern, als …« Er schluckte. »Als ich dich noch nicht näher kennengelernt hatte. Ich dachte stets, die Priesterinnen seien das Herz des Übels und im Herzen erkaltet.«
Priesterin. Er wusste, wer ich war. Wahrscheinlich war es ihm vom ersten Moment an klar gewesen. Entgeistert entfernte ich mich weiter von ihm, traute meinen Ohren kaum, als unsere Verbindung brach und seine Hand, die eben noch meine gehalten hatte, sank. Er verengte die Augen zu Schlitzen, in denen ich nicht lesen konnte. Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, ihm zu vertrauen, und meiner Angst, schlang ich die Arme um meinen Oberkörper.
»Doch ich glaube nicht, dass dein Herz kalt ist. Wenn du siehst, was den Männern angetan wird, wirst du handeln.« Er sah nach seinen Freunden, legte einen Finger an seine Lippen und nickte in Richtung der Höhle. »Halte dich rechts. Nach kurzer Zeit wirst du eine Einbuchtung erreichen, in der du dich verstecken kannst. Ich werde sie daran vorbeilocken und dir den Weg zum Ausgang zeigen.«
»Wieso sollte ich dir glauben?«, spie ich aus. »Du hast mich verraten!« Er gehörte den Rebellen an, diente einer dunklen Macht. Ich durfte ihm nicht glauben, sondern musste mit dem Schlimmsten rechnen.
Verunsichert fuhr er sich durch die Haare, blickte zu den fremden Männern und wieder zu mir. Dann zuckte er mit den Schultern. »Es ist Zufall. Wirklich. Ich würde doch nicht …« Mit verzweifelt verengten Augen und bittendem Ausdruck schluckte er. »Los, beeil dich!«
Ich hielt es nicht mehr aus. Kopfschüttelnd riss ich mich von ihm los, dachte an Zefiras Licht, das mich all das hier vergessen lassen würde, und rannte in die Dunkelheit hinein. Was auch immer mich hier erwartete, es konnte nicht schlimmer sein, als diesen verlogenen Männern in die Hände zu fallen.
Rechts, rief mein Kopf. Doch traute ich diesem Mann wirklich, der mich auch hätte begleiten können? Er musste vermutet haben, dass seine Freunde ihn besuchen kommen würden, und hatte mich nicht gewarnt.
Mein Herzschlag flog nur so dahin, während ich mich so schnell wie möglich vorwärtstastete. Ich erreichte eine erste Abzweigung nach rechts und hielt inne. Was, wenn er es ernst meinte?
Was, wenn er mich in eine Falle locken wollte?
Verunsichert blickte ich zum Eingang zurück. An den Wänden schimmerte das Tageslicht schon deutlich. Gestern war ich diesem Licht gefolgt, die Höhle hatte eine lang gezogene Rechtskurve beschrieben. Demnach führte mein Weg nun nach links, tiefer in das Labyrinth und die Dunkelheit hinein.
Den Bruchstücken meiner Erinnerung folgend, hastete ich weiter, so schnell es mir im Dunkeln möglich war. Zum viel zu lauten Herzschlag mischten sich die Stimmen der Männer und Taios Lachen.
»Sie wird nicht weit kommen.« Taios Stimme folgte ein Händeschlag. »Wenn sie schlau ist, wird sie in der zweiten Kuhle rechts warten.«
Zweite Kuhle rechts. Mein Atem stockte. War es ein Versehen gewesen, dass er mir ein anderes Versteck gesagt hatte, oder wollte er mich wirklich beschützen?
Ich beschleunigte meine Schritte trotz der Angst, dass ich ausrutschen oder stolpern könnte und die Männer auf mich aufmerksam machen würde. Wenn sie mich erwischten, brauchte ich mir gar keine Hoffnungen mehr zu machen. Also tastete ich mich weiter, stiess mir meinen Zeh an einem herausragenden Knubbel und unterdrückte einen Schmerzenslaut.
»He, da ist ja niemand!«, rief einer der Männer. Seine nasale Stimme liess mich schaudern. Ihm wollte ich auf keinen Fall begegnen.
»Hast du ihr die Flucht ermöglicht?«, fragte nun ein anderer forsch.
Ich schluckte. Falls Taio wegen mir in Schwierigkeiten geriet … Entschlossen schüttelte ich den Kopf und verwarf den Gedanken gleich wieder. Er hatte mich in eine Falle locken wollen, ich brauchte mir keine Sorgen um ihn zu machen. Hätte er mich früher gewarnt, wäre ich schon längst über alle Berge.
Sein tiefes Lachen verfolgte mich durch den Gang, hallte an den Wänden wider und krallte sich um meinen Brustkorb, sodass mir das Atmen schwerfiel. »Die Idiotin wird sich in den Höhlen verlaufen. Das ist keine Flucht, das ist Selbstmord«, antwortete er lauter als nötig.
»Bei uns hätte ihr Tod wenigstens einen Nutzen – und wenn es nur der ist, dass wir Zefira endlich zu einem Eingeständnis zwingen können.«
Ausser Atem drückte ich mich in eine dunkle Ecke und hoffte, dass sich mein Herzschlag bald beruhigte. Wenn ich mich blind in ein riesiges Höhlensystem stürzte, würde ich es nicht überleben, da hatte mein Retter von gestern Abend recht.
Eine bisher unbekannte Stimme lachte. Es klang beängstigend nahe. Am liebsten hätte ich mich tiefer verkrochen, doch das Gestein in meinem Rücken bohrte sich unbarmherzig in mein Fleisch. »Du hättest sie auch einfach festhalten können.«
»Wie denn?«, brummte Taio. »Ich nehme nun mal nicht immer ein Seil mit. Normalerweise fallen keine Frauen aus regengefluteten Höhlen. Hätte ich mich etwa auf sie legen sollen?«
Schatten huschten über die Wände, verzerrten sich zu Ungeheuern, die mir das Blut in den Adern gefrieren liessen. Sie hoben sich nur noch wenig von der Dunkelheit der Höhle ab, doch meine Augen hatten sich an das spärliche Licht gewöhnt. Wenn mich die Männer nur nicht entdeckten. Wenn sie einfach an mir vorbeizogen, ohne den Kopf nach links zu drehen. Dann, vielleicht, könnte ich über die Hügel zurück nach Zefira gelangen. Vermutlich war das sicherer, als mich durch die unbekannten Gänge zu schleichen.
Wieder lachte jemand. »Und ihr das Kleid hochschieben?«
Verwirrt runzelte ich die Stirn. Wieso sollte mir jemand das Kleid hochschieben, wenn er auf mir lag? Ich war so sehr in dieses Bild vertieft, dass ich die Männer im ersten Augenblick nicht entdeckte. Einer nach dem anderen ging an mir vorbei, nur zwei Armlängen entfernt. Ich hielt die Luft an, sandte ein Stossgebet zu unserer Göttin. Es konnte nicht möglich sein, dass ich eben erst zur Seherin ernannt worden war und nun sterben sollte.
Drei Männer schritten an mir vorbei, der vierte folgte in einigem Abstand. Sein Profil erkannte ich im ersten Moment: Taio. Im Gegensatz zu seinen Freunden, die sich vor Freude an der Jagd auf mich kaum zügeln konnten, wirkte er nachdenklich.
Er stoppte. Hoffentlich konnte er meinen Herzschlag nicht hören, der viel zu laut durch meine Brust tobte. Unwirklich langsam drehte er den Kopf nach links.
Ich blinzelte.
Vor Überraschung riss er die Augen auf. Einen Wimpernschlag verharrte er, dann sah er seinen Freunden hinterher, ehe er den Zeigefinger an die Lippen legte.
Wie ein Hase in der Falle presste ich mich fester an die Wand, als würde sie mich in sich aufnehmen, drückte ich nur stark genug.
Blitzschnell packte Taio meine Hand und zerrte mich aus meinem Versteck. Ein erschrockener Laut kam über meine Lippen.
Sein Kopf schnellte zu seinen Freunden herum. »Verdammt, diese blöden Steine!«, fluchte er viel zu laut. »Morgen fallen mir alle Zehen ab, blau und geschwollen, wie sie jetzt schon sind.«
Ich schluckte und ein winziger Hoffnungsschimmer stahl sich in meinen Bauch. Versuchte er gerade, mir zu helfen? Doch wieso hatte er mir dann empfohlen, mich rechts zu halten und es gleich darauf seinen Freunden erzählt?
Unerbittlich zog er mich wenige Schritte mit sich, in Sichtweite seiner Begleiter, doch die drehten sich nicht um, sondern witzelten über seine ungeschickten Füsse. Er schob mich in den nächsten Seitengang hinein und entfernte sich von mir. »Einmal links, einmal rechts«, flüsterte er und verschwand in der Dunkelheit.
Fassungslos starrte ich ihm hinterher, ehe ich mich fasste und zögernd seinem Ratschlag folgte. Er würde die anderen nicht hintergehen, um mich dann doch zu fangen. Einfacher als jetzt gerade hätte er mich nicht ausliefern können.
Die erste Abzweigung führte mich ein paar grobe Stufen hinauf. Ich konnte mich nicht daran erinnern, diesen gestern begegnet zu sein, als ich in die Tiefe gefallen war.
Aus einem schmalen Loch schimmerte Tageslicht. Beinahe hätte ich vor Erleichterung geseufzt, doch ich hielt mich zurück. Das Seufzen einer Frau hätte Taio sicher nicht schnell genug vertuschen können – falls er es überhaupt wollte. Vielleicht genoss er auch einfach die Jagd und gönnte mir nur einen Vorsprung.
Ich ging auf die Knie, als ich direkt vor dem Durchgang zum Licht stand. Auf allen vieren passte ich gerade zwischen lockerem Erdreich und feuchtem Berggestein hindurch.