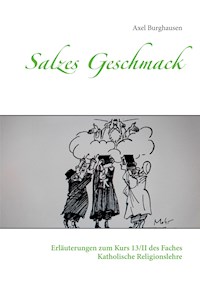2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kann man heute noch an Gott glauben? Und was verstehen Christen unter Gott? Auch in seinem zweiten Band der Reihe über den Religionsunterricht in der Gymnasialen Oberstufe erläutert Axel Burghausen, was seine Schüler von ihm gelernt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Titelbild: Max Beckmann: Selbstbildnis mit Seifenblasen (1900)
www.pinterest.co.uk/pin/201395414561263518
Inhaltsverzeichnis
Vorab: Wir können nicht schweigen
Du sollst dir kein Bildnis machen
1.1 Wofür es sich zu leben lohnt …
1.2 Jeder formt sich den Gott, den er verdient
1.3 Kein Bildnis machen … - Geht das?
Gott er-denken?
2.1 Kann man die Existenz Gottes beweisen?
2.2 Gott im Widerspruch zur heutigen Welterfahrung
2.3 Gott als Projektion des Menschen
2.4 Gott ist weder nichts noch etwas
2.5 … das Wasser sucht die Durstigen ebenfalls
Überwältigt von der Erfahrung Gottes
3.1 Auch Freiheit will gelernt sein
3.2 Kleine Entwicklungsgeschichte des biblischen Monotheismus
3.3 Wenn Gott mit uns ist, wer ist dann gegen uns
3.4 Selig, die vor Gott arm sind
3.5 Drei ist eins und eins ist drei
Wie kann Gott das zulassen?
4.1 Beugt der Allmächtige das Recht?
4.2 Wer Leiden erklärt, leidet nicht
4.3 Kann Gott allmächtig und gütig sein?
Vorab: Wir können nicht schweigen
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ Dieser berühmte Satz des Philosophen Ludwig Wittgenstein verdeutlicht, dass das, was unser Denken und Sprechen ermöglicht, nicht zugleich deren Gegenstand sein könne. Diese Erkenntnis umreißt das Dilemma des Religionsunterrichtes (und aller Theologie). Entweder existiert Gott nicht, dann wäre jede Rede von ihm mindestens Zeitverschwendung, vielleicht Ablenkung oder Manipulation, jedenfalls keine hilfreiche Betätigung in der Schule. Niemand, auch nicht der gläubigste Mensch, kann völlig ausschließen, dass genau das zutrifft.
Oder Gott existiert. Dann sind unsere Gedanken und Worte auch nicht ansatzweise in der Lage, seine Wirklichkeit angemessen zu erfassen. Auch in diesem Falle stellt sich die Frage, warum wir es immer wieder versuchen, obwohl wir wissen, dass alles, was wir sagen, mehr falsch als richtig sein kann (vgl. 2.4).
Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht, die ihr Leben mit Gott bewältigt oder in Auseinandersetzung mit ihm abgearbeitet haben (vgl. auch Jakob in Jgst. 11). Genauer gesagt interpretieren diese Menschen ihre Erfahrungen auf Gott hin, aber dies bleibt kein theoretischer Akt, sondern wird ein lebendiger Vollzug. „Wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben“ (Apg 4,20), antworten Petrus und Johannes, als der Hohe Rat ihnen befehlen will, die Botschaft Jesu Christi nicht mehr zu verkünden. Der Prophet Jeremia spricht von einem inneren Zwang, der ihn treibt, prophetisch zu reden, auch wenn es ihm lauter Nachteile bringt (Jer 20,9).
Weil sich Gott also Menschen geoffenbart hat, deshalb ist es auch für uns gerechtfertigt, über Gottes Handeln zu reden und Rückschlüsse auf sein Wesen zu ziehen. Das Reden über Gott ist immer auch – oder eher zuerst – ein Reden über Menschen, und deren Erfahrungen können wir nachvollziehen. Letztlich bedeutet, an Gott zu glauben, diesen Menschen und ihren Erfahrungen zu vertrauen.
In einer Karikatur von Frank Speth sitzt Gott (Mann mit weißem Bart) über Wolken an einem Tisch (evtl. einem Schultisch), stützt nachdenklich seinen Kopf auf seine rechte Hand und denkt: Manchmal frage ich mich, ob es mich gibt. Das Bild wirft uns in eine paradoxe Situation, denn einerseits beweist dieser Gedanke die Existenz Gottes (nach Descartes: Ich denke, also bin ich), andererseits spiegelt er die Zweifel der Menschen wider und macht deutlich, dass ein Gott, an den nicht geglaubt wird, seine Funktion verlieren kann (im Sinne Nietzsches: Gott ist tot). Vielleicht steckt in der Karikatur aber auch eine Kritik an Gott, der, indem er sich den Menschen bemerkbar gemacht hat, mehr Ungewissheit und Streit geschaffen hat als eine beruhigende Klarheit.
Ähnlich anthropomorph (menschenartig) wie die Karikatur ist eine Vorstellung, die ich seit Jahren mit mir trage. Gott sitzt im Himmel und hört, was ich im Unterricht über ihn sage (oder liest, was ich hier über ihn schreibe). Er stutzt, denkt nach - - - und bricht in ein schallendes Gelächter aus. Gott hat Humor, das ist meine feste Überzeugung, und erträgt, was Theologen über ihn formulieren. Er ermuntert uns sogar dazu, denn sonst hätte er uns nicht Verstand und artikulierte Sprache geschenkt. Wenn manche muslimische Schüler Schwierigkeiten haben, sich auf atheistische Fragestellungen oder die Theodizee-Frage einzulassen („In unserer Religion ist uns das nicht erlaubt“), weise ich auf diesen Tatbestand hin. Gott wollte, dass wir über ihn reflektieren, und er lässt es zu, dass wir ihn in Frage stellen.
So problematisch es also sein mag, über eine Wirklichkeit zu reden, über die nicht angemessen geredet werden kann, so ist es dennoch notwendig. Auch ich kann nicht schweigen, also werde ich reden …
(Auch dieses Buch hält die Erläuterungen für meine Schüler im Religionsunterricht in schriftlicher Form fest. Besprochene Bilder können im Internet eingesehen werden.)
1 Du sollst dir kein Bildnis machen
1.1 Wofür es sich zu leben lohnt …
Grundlage: unterschiedliche Medien
In einer Karikatur von Erik Liebermann steht ein Mann, eine Aktentasche und einen Globus in den Händen, an der Rezeption eines Hotels und fragt die erstaunt blickende Angestellte: „Mal zwei Fragen: Wo bin ich und wer hat mich geschickt?“ Wer sich „verorten“ will, benötigt in der Tat die Kenntnis von Ausgangs- und Zielpunkt, und indem er sein Ziel selber wählt, definiert er seine Identität. Der Witz dieser Karikatur besteht darin, dass eine Rezeption oder ein Informationsschalter zwar Hilfestellungen auf bestimmten Teilstücken dieses Weges leisten, das Ziel aber nicht für den Einzelnen bestimmen können. Der Wunsch, sich orientieren zu lassen, statt sich selber zu orientieren, spiegelt aber die von vielen wahrgenommene Unübersichtlichkeit des Lebens wider.
Ähnliche Überlegungen stellt Abschaffel, der Protagonist in Wilhelm Genazinos Roman „Falsche Jahre“ (1979) an. Angesichts der vielen Reisenden am Bahnhof fragt er sich, ob sich durch ihr Unterwegs-Sein irgendetwas an ihrem Leben ändere oder ob sie nur vor der Erkenntnis ihrer Nichtigkeit wegliefen. Er selber sieht sein gegenwärtiges Leben als „Restbestand von etwas Größerem, aus dem vor vielen Jahren leider nichts gemacht worden war“, ein verfehltes Leben. In der Bahnhofshalle beobachtet er einen Mann, der unentwegt Abfälle zusammenkehrt, während hinter ihm neue Abfälle zu Boden geworfen werden. Zunächst bewundert er ihn, weil er trotz seines ewigen Misserfolgs so viel Vertrauen in den Sinn seiner Arbeit habe. Später geht ihm auf, dass der Mann einfach nur ausführe, wofür er bezahlt wird, und seiner Tätigkeit gegenüber gleichgültig sei.
Mich erinnert diese Textpassage an den Essay „Der Mythos des Sisyphos“ (1942) von Albert Camus. Sisyphos muss als Strafe einen schweren Felsbrocken mit großer Kraftanstrengung einen Hügel hinaufrollen. Oben angekommen, rollt der Brocken wieder herunter, und die Anstrengung beginnt von Neuem. In diesem griechischen Mythos spiegelt sich für Camus die Entfremdung des Menschen, der oft keinen eigenständigen Zugriff auf seine Existenz und seine Tätigkeit habe. Indem Sisyphos die Absurdität seiner Existenz annehme, stelle er sich über das bloße Schicksal und könne glücklich sein.
Der Maler Max Beckmann wuchs ohne Vater, unter einem unzugänglichen Vormund, im Schatten seines erfolgreichen Bruders, niedergedrückt von schulischen Misserfolgen auf. Er empfand sich als Stiefkind des Lebens, allein und einsam. Zugleich entwickelte er angesichts der Natur und der Gedichte des zeitgenössischen Dichters Richard Dehmel die Sehnsucht nach Größe und Entgrenzung. Sein Selbstbildnis mit Seifenblasen (ca. 1900, s. Titelbild) illustriert diese Spannung. Der 16-Jährige sitzt auf einer Anhöhe über einer weiten Landschaft auf einem Stuhl, isoliert von jeglichem Treiben. Während er die Pfeife noch in der Hand hält, schaut er sinnend den von ihm produzierten Blasen hinterher. Sein Blick richtet sich nach oben, fern aller irdischen Realität. Bei Dehmel konnte er lesen: „… nur noch in sich/sucht die Allmacht der Mensch,/der dem Schicksal gewachsen ist“. Vom 18-jährigen Beckmann ist die Aussage an eine Kommilitonin (Mitstudentin) überliefert: „Jetzt male ich noch zwei Jahre – dann bin ich der größte Maler. Dann dichte ich, dann mache ich Musik und dann erschieße ich mich.“
Die damals 15-jährige Indira Ceylan veröffentlichte in der Zeitschrift „Ibibik“ ihre Überlegungen zur Frage: Warum lebe ich? Im ersten Abschnitt, der viele Fragesätze enthält, verweist sie darauf, dass sie meistens nicht an die Frage nach dem Sinn denkt, dass sie diese Frage aber in bestimmten Situationen beschäftigt. Ihre Fragehaltung macht deutlich, dass sie nicht bereit ist, bestehende Antworten der Religion oder ihrer Familie unbefragt zu übernehmen. Sie äußert für ihr Leben den Wunsch, zufrieden zu sein und sich nichts vorwerfen zu müssen. Aber auch die Zufriedenheit ändere sich mit der persönlichen Entwicklung. So sieht sie letztlich den Sinn des Lebens darin herauszufinden, worin der Sinn besteht.
Mich erinnert dieser Text an einen asiatischen Weisheitsspruch: „Verstehe, dass das Leben eine Reise ist, und lerne, an ihrem Ende zu lächeln.“
Die Schülerin Manuela Reeg schrieb im Rahmen einer freiwilligen Arbeit im Fach Katholische Religionslehre über ihren Glauben (2014). Sie setzt sich mit der Forderung der Gottesliebe auseinander. Liebe bedeute für sie eine außergewöhnlich gesteigerte Emotionalität, und die könne sie für Gott nicht aufbringen. Sie glaube, dass er existiere, sie sehe aber auch das unverschuldete Leid in der Welt und Gottes Verantwortung dafür. Außerdem sei es schwierig, jemanden zu lieben, bei dessen Existenz man doch nicht sicher sei.