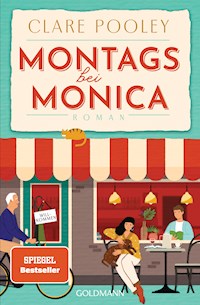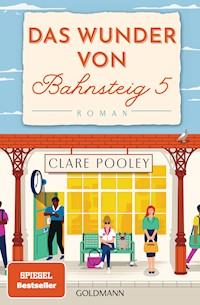
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue herzerwärmende Roman der SPIEGEL-Bestsellerautorin von »Montags bei Monica«.
»Schöner kann ein Wohlfühlroman nicht sein!« Sophie Cousens
Jeden Morgen nehmen sie denselben Zug nach London, die Passagiere in Wagen 3. Iona, eine Ratgeberkolumnistin und extravagante Erscheinung, hat sich sogar Namen für ihre Mitreisenden ausgedacht: Der-einsame-Teenager, Die-hübsche-Leseratte oder Der-arrogante-Breitbeinige. Als routinierte Pendler wechseln sie kein Wort miteinander. Bis sich der Breitbeinige eines Tages an einer Weintraube verschluckt und womöglich erstickt wäre, hätte ein junger Mann ihn nicht gerettet. Dieser Einsatz des Krankenpflegers Sanjay bewirkt ein Wunder: Die Menschen im Zug beginnen miteinander zu reden. Aus sechs Fremden, die nichts gemeinsam haben als ihren Arbeitsweg, wird eine Gemeinschaft, in der alle füreinander da sind. Denn Hilfe braucht jeder von ihnen ...
»Ein wunderbares Meisterwerk! Warmherzig, humorvoll, berührend und mit unvergesslichen Figuren.« Rosie Walsh
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Jeden Morgen nehmen sie denselben Zug nach London, die Passagiere in Wagen 3. Iona, eine exzentrische Ratgeberkolumnistin, hat sich bereits Namen für ihre Mitreisenden ausgedacht: Der-einsame-Teenager, Die-hübsche-Leseratte oder Der-arrogante-Breitbeinige. Als routinierte Pendler wechseln sie kein Wort miteinander. Bis sich der Breitbeinige eines Tages an einer Weintraube verschluckt und womöglich erstickt wäre, hätte ein junger Mann ihn nicht gerettet. Dieser Einsatz des Krankenpflegers Sanjay bewirkt ein Wunder: Die Menschen im Zug beginnen miteinander zu reden. Aus sechs Fremden, die nichts gemeinsam haben als ihren Arbeitsweg, wird eine Gemeinschaft, in der alle füreinander da sind. Denn Hilfe brauchen sie alle …
Autorin
Clare Pooley hat zwanzig Jahre lang in der Werbebranche gearbeitet, bevor sie sich ganz ihrer Familie und ihren Kindern widmete. An ihren Büchern arbeitet sie am heimischen Küchentisch. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern, einem Hund und einem Afrikanischen Zwergigel in London.
Weitere Informationen zur Autorin finden Sie unter
clarepooley.com, @cpooleywriter und @clare_pooley
Von Clare Pooley bei Goldmann lieferbar:
Montags bei Monica. Roman
Das Wunder von Bahnsteig 5. Roman
Clare Pooley
Das Wunder
von Bahnsteig 5
Roman
Aus dem Englischen
von Stefanie Retterbush
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel
»The People on Platform 5«
by Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, London.
Transworld is part of the Penguin Random House group of companies.
Die deutsche Fassung der Passagen aus William Shakespeare, Romeo und Julia, stammt aus der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2022
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Clare Pooley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München,
unter Verwendung einer Umschlagillustration von © Nathan Burton
www.nathanburtondesign.com
Redaktion: Regina Carstensen
AB· Herstellung: ik
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-24726-3V003
www.goldmann-verlag.de
Für meine Tochter Eliza
Mögest du immer »mehr Iona sein«.
Züge sind etwas Wunderbares.
Auf einer Zugreise sieht man Natur und Menschen,
Orte und Kirchen und Flüsse,
ja, das ganze Leben.
AGATHACHRISTIE
Iona
08:05 Hampton Court nach Waterloo
Bis zu dem Moment, als sich ein Mann gleich vor ihren Augen im 8:05-Uhr-Zug zu sterben anschickte, war es für Iona eigentlich ein Tag wie jeder andere gewesen.
Wie immer hatte sie um halb acht das Haus verlassen. Auf hohen Absätzen brauchte sie ungefähr zwanzig Minuten zum Bahnhof, meistens war sie also eine Viertelstunde vor Abfahrt ihres Zuges nach Waterloo da. Mit den Louboutins zwei Minuten später.
Frühzeitig da zu sein, war unerlässlich, wollte sie ihren Lieblingsplatz ergattern, und das wollte sie. Was Mode, Filme oder auch Patisserie anging, war Abwechslung etwas Herrliches, aber nicht auf dem alltäglichen Arbeitsweg.
Vor einer ganzen Weile schon hatte Ionas Chefredakteur versucht, ihr die Arbeit im Homeoffice schmackhaft zu machen. Das sei, wie er ihr versicherte, gerade der allerletzte Schrei, und alles, was sie im Büro zu tun hätte, ließe sich schließlich genauso gut von woanders erledigen. Zuerst hatte er sie mit der Aussicht auf eine Stunde länger ausschlafen und freie Arbeitszeiteinteilung zu ködern versucht, und als das alles nichts nützte, wollte er sie mittels einer grässlichen Methode namens Hot Desking vergraulen, was – wie sie dann erfahren musste – Managersprech dafür war, sich den Schreibtisch mit anderen Kollegen teilen zu müssen. Teilen hatte Iona schon als Kind nicht gut gekonnt. Der kleine Zwischenfall mit der Barbiepuppe war ihr lebhaft im Gedächtnis geblieben, und ihren Klassenkameraden vermutlich auch. Nein, es gab doch gewisse Grenzen. Zum Glück lernten Ionas Kollegen erstaunlich schnell, welchen Schreibtisch sie bevorzugte, und aus heiß wurde unversehens ziemlich frostig.
Iona ging gerne ins Büro. Sie mochte den Kontakt zu den Jungspunden, bei denen sie sich den neuesten Jugendslang abhörte, von denen sie die angesagtesten Songs vorgespielt bekam und sie sich sagen ließ, was sie sich unbedingt als Nächstes auf Netflix anschauen musste. Bea, das Herzchen, war ihr in dieser Hinsicht leider keine große Hilfe.
Und trotzdem wäre sie heute lieber zu Hause geblieben. Sie hatte nämlich einen Termin zu einer Rundum-Beurteilung bei ihrem neuesten Chefredakteur, was entschieden zu vertraulich klang. In ihrem Alter (siebenundfünfzig) ließ man sich lieber nicht allzu genau unter die Lupe nehmen, schon gar nicht aus jedem nur erdenklichen Winkel. Manches blieb besser der Fantasie überlassen. Oder gänzlich unbetrachtet, wenn man ganz ehrlich war.
Und außerdem, was wusste der schon? Ähnlich wie Polizisten und Ärzte schienen Chefredakteure neuerdings jünger und jünger zu werden. Ihr derzeitiger war – man glaubte es kaum – nach der Erfindung des Internets gezeugt worden. Nie hatte er in einer Welt gelebt, in der Telefone unverrückbar an der Wand hingen und man Fakten in der Encyclopædia Britannica nachschlug.
Ein bisschen wehmütig dachte Iona an die jährlichen Personalgespräche damals ganz am Anfang ihrer journalistischen Laufbahn vor beinahe dreißig Jahren. Damals hießen die natürlich noch nicht »Personalgespräche«, sondern »Lunch-Treffen« und fanden im Savoy Grill statt. Der einzige Wermutstropfen bestand darin, sich regelmäßig die schwitzigen, speckigen Wurstfinger ihres Chefredakteurs möglichst taktvoll vom Bein zu pflücken, aber das war sie gewohnt, und das war die Sole Meunière beinahe wert, die erst von einem dienstbaren Kellner mit französischem Akzent gekonnt von den Gräten gelöst und dann mit einer gut gekühlten Flasche Chablis hinuntergespült wurde. Sie überlegte, wann sie das letzte Mal von irgendwem – außer Bea – unter dem Tisch begrapscht worden war, und konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern. Seit den Neunzigern jedenfalls nicht mehr.
Iona schaute prüfend in den Flurspiegel. Sie hatte sich heute für ihr rotes Lieblingskostüm entschieden – das, das unüberhörbar Taffe Karrierefrau und Denk nicht mal im Traum dran, Freundchen schrie.
»Lulu!«, rief sie, nur um feststellen zu müssen, dass die Französische Bulldogge bereits zu ihren Füßen saß und wartete. Auch so ein Gewohnheitstier. Sie bückte sich und hakte die Leine in Lulus knallpinkem Halsband ein, auf dem in großen Strassbuchstaben ihr Name prangte. Bea fand Lulus Accessoires eher peinlich. Sie ist ein Hund, Schätzchen, kein Kind, hatte sie immer wieder eingewendet. Als ob Iona das nicht wüsste. Die Kinder heutzutage waren egoistisch, faul und verzogen, so ganz anders als ihre bezaubernde kleine Lulu.
Iona machte die Haustür auf und rief wie jeden Tag die Treppe hinauf: »Bye bye, Bea! Ich muss zur Arbeit! Du fehlst mir jetzt schon!«
Am Hampton Court in die Bahn zu steigen, hatte einen entscheidenden Vorteil: Es war die Endstation. Oder die Anfangsstation, je nachdem, von wo man es betrachtete. Wenn das mal keine Lektion fürs Leben ist, dachte Iona. Ihrer Erfahrung nach entpuppten sich die meisten Enden letztlich als verkappte Anfänge. Das sollte sie sich für ihre Kolumne notieren. Die Züge waren also – wenn man nur früh genug da war – eigentlich immer recht leer. Was hieß, dass Iona ihren Lieblingsplatz (siebte Reihe rechts, Blick in Fahrtrichtung, an einem Tisch) in ihrem Lieblingswagen, Wagen Nummer drei, besetzen konnte. Iona mochte ungerade Zahlen lieber als gerade. Sie konnte es nicht leiden, wenn etwas zu rund oder glatt und geleckt war.
Iona nahm Platz, setzte Lulu auf den Sitz neben sich und fing an, ihre Utensilien vor sich auszubreiten. Die Thermoskanne mit grünem Tee, der nur so wimmelte vor den den Alterungsprozess hinauszögernden Antioxidantien; eine Porzellantasse mit passender Untertasse, weil Tee aus Plastikbechern zu trinken schlicht undenkbar war; ihre neueste Post und ihr iPad. Bis Waterloo waren es gerade mal zehn Haltestellen, eine sechsunddreißigminütige Fahrt, perfekt zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Tag.
Während der Zug sich im Laufe der Fahrt zusehends füllte, arbeitete Iona unbeeindruckt in ihrer kleinen Seifenblase selig vor sich hin, in angenehmer Anonymität und gänzlich unbemerkt. Eine unter Tausenden unscheinbaren Pendlern, von denen keiner auch nur im Geringsten auf sie achtete. Niemand sprach sie an oder redete überhaupt mit irgendwem. Alle kannten die zweite der ehernen Pendlerregeln: Jemandem zuzunicken, dem man häufiger begegnet, oder ihm oder ihr – in extremis – kurz zuzulächeln oder angesichts einer Lautsprecherdurchsage des Zugführers entnervt die Augen zu verdrehen, ist statthaft, aber ansprechen tut man ihn oder sie unter gar keinen Umständen. Es sei denn, man ist bekloppt. Und das war sie nicht, ganz gleich, was die Leute auch dachten.
Ein eigenartiges Geräusch riss Iona aus ihren Gedanken. Sie schaute auf und sah einen Mann, den sie schon öfter bemerkt hatte. Sonst nahm er morgens eine andere Bahn, aber auf dem Heimweg sah sie ihn häufig im 18:17-Uhr-Zug ab Waterloo. Er war ihr wegen seiner exquisiten Maßanzüge aufgefallen, derentwegen sie ihn unter anderen Umständen sicher glühend beneidet hätte. Nur wurde der perfekte erste Eindruck leider vollkommen ruiniert von seiner unangenehmen, unübersehbar vor sich hergetragenen Hoppla-hier-komm-ich-Manier, wie man es nur bei heterosexuellen, weißen, ausnehmend gut situierten Männern fand. Leicht erkennbar an den unvermeidlich breit gespreizten Beinen und den übertrieben lauten Telefonaten über Märkte und Positionen. Einmal hatte sie mit angehört, wie er seine Frau als Hausdrachen bezeichnete. In Surbiton stieg er immer aus, was so gar nicht zu ihm passen wollte. Iona hatte all ihren Mitreisenden Spitznamen verpasst, und er war der Smarte Sexist aus Surbiton.
Momentan machte er allerdings einen nicht ganz so selbstgefälligen Eindruck wie üblich. Vielmehr schien er in höchster Not. Vornübergebeugt saß er da, die Hände um den Hals gekrallt, und gab eigenartig beunruhigende Geräusche von sich, ein Röcheln irgendwo zwischen Husten und Erbrechen. Das Mädchen neben ihm – ein hübsches junges Ding, roter Zopf und Pfirsichteint, den sie heute noch als selbstverständlich hinnahm und der irgendwann zu einer sehnsüchtigen Erinnerung verblassen würde – fragte sichtlich beunruhigt: »Alles in Ordnung?« Es war ganz offensichtlich nicht alles in Ordnung. Er schaute auf und schien etwas mitteilen zu wollen, aber die Worte blieben ihm wortwörtlich im Halse stecken. Hilflos deutete er auf den halb gegessenen Obstsalat vor sich auf dem Tisch.
»Ich glaube, er hat eine Erdbeere im Hals stecken. Oder eine Traube«, mutmaßte das Mädchen. Augenscheinlich handelte es sich um einen Notfall. Da war es wohl eher nebensächlich, um welche Obstsorte es im Genauen ging. Das Mädchen legte das Buch, in dem es bis eben gelesen hatte, beiseite und klopfte ihm auf den Rücken, mittig zwischen den Schulterblättern. Ein sachtes Tätscheln, sonst oft von Worten wie So ein Feiner und Ein ganz ein braver Hund begleitet und so gar nicht das, was die gegenwärtige Situation erforderte.
»Moment, so geht das nicht«, rief Iona, beugte sich kurzerhand über den Tisch und haute ihm mit der geballten Faust auf den Rücken, was ihr angesichts der Umstände wesentlich mehr Freude bereitete, als sie zuzugeben bereit gewesen wäre. Im ersten Moment blieb er still, und sie dachte schon, nun sei alles gut, aber dann fing er wieder an zu japsen. Dazu wurde er fleckig lila im Gesicht, und alle Farbe wich aus seinen Lippen.
War das das Ende, würde er hier sterben, im 8:05-Uhr-Zug? Noch vor Waterloo?
Piers
08:13 Surbiton nach Waterloo
Piers’ Tag verlief überhaupt nicht nach Plan. Zum einen war das nicht sein Zug. Er war sonst immer gerne in der City, noch bevor die Märkte öffneten, aber sein ganzer Tagesablauf war schon frühmorgens auf den Kopf gestellt worden, weil Candida ihr Au-pair am Vortag vor die Tür gesetzt hatte.
Magda war bereits das dritte Au-pair in diesem Jahr, und Piers hatte die leise Hoffnung gehegt, sie würde zumindest bis zum Ende des Schuljahrs durchhalten. Dann allerdings waren sie früher als geplant von einem katastrophalen Wochenende en famille nach Hause gekommen, nur um Magda mit dem Gärtner im Bett zu erwischen, auf dem Nachttischchen neben ihnen, auf einer gebundenen Ausgabe des Grüffelo, Kokainspuren und ein aufgerollter Geldschein. Piers hätte Candida vielleicht noch beschwatzen können, es bei einigen gewählten Worten zu belassen, zumal Magda ja nicht im Dienst gewesen war, aber dass das Lieblingsvorlesebuch der Kinder derart entweiht worden war, konnte sie dem Mädchen einfach nicht verzeihen. Wie soll ich den Kindern je wieder daraus vorlesen, ohne die Bilder im Kopf, wie Tomaso Magdas tiefen, dunklen Wald ergründet?, hatte Candida außer sich vor Wut gebrüllt.
Und als Piers dann schließlich in den Zug nach Surbiton gestiegen war, war alles vollends den Bach runtergegangen. Der einzige freie Platz weit und breit war nämlich, wie er schließlich feststellen musste, an einem Vierertisch gegenüber dieser komischen Eule und ihrem schnaufenden Köter mit dem Pfannkuchengesicht. Die beiden sah Piers sonst morgens eigentlich nie, aber auf der Heimfahrt war ihr Anblick ein allzu vertrautes Ärgernis. Er war augenscheinlich nicht der einzige Fahrgast, der dieser Schabracke geflissentlich aus dem Weg ging, saß sie doch oft genug ganz allein inmitten der einzigen freien Plätze.
Und heute wirkte die kauzige Hundetante noch lächerlicher als sonst, in ihrem knallroten Tweed-Kostüm mit Schulterpolstern, das sich sicher auch gut als Bezugsstoff für Grundschulmöbel geeignet hätte.
Rasch überschlug Piers im Kopf die diversen Vor- und Nachteile, bis Waterloo mit einem Stehplatz vorliebzunehmen, statt sich dem trutschigen Sofa auf Stöckelschuhen gegenüberzusetzen. Bis er unvermittelt bemerkte, dass das Mädchen neben dem fraglichen freien Platz einfach unverschämt gut aussah. Er war sich ziemlich sicher, sie auch schon mal im Zug gesehen zu haben. Piers fiel wieder die kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen auf – eine winzige Unvollkommenheit, durch die aus einem hübschen, aber nichtssagenden Gesicht ein unwiderstehlicher Hingucker wurde. Vielleicht hatte er ihr sogar zugezwinkert – einer dieser wortlosen Augenblicke spontaner Verbundenheit, wenn man sich, wie sie, zwei gut aussehende, erfolgreiche Berufspendler, unversehens in einem Meer der Mittelmäßigkeit wiederfand, wie ein Formel-Eins-Rennwagen auf einem Lidl-Parkplatz.
Sie musste schätzungsweise Ende zwanzig sein und trug einen engen knallpinken Rock, unter dem bestimmt atemberaubende Beine zu sehen wären, wenn nur der leidige Tisch nicht wäre, und dazu ein weißes T-Shirt und einen schwarzen Blazer. Bestimmt arbeitete sie in einem dieser angesagten Media-Jobs, wo die ganze Woche Smart Casual angesagt war, nicht bloß freitags. Dieser entzückende Anblick nahm ihm die Entscheidung ab, und er setzte sich.
Piers zog das Handy heraus, um einen Blick auf seine Börsenpositionen zu werfen. Letzte Woche hatte er so viel Geld verloren, dass diese Woche einfach spektakulär werden musste. Er schickte ein stummes Stoßgebet an die Götter des Marktes, während er eine Traube aus dem kleinen Obstsalat pulte, den er eben im Supermarkt neben dem Bahnhof gekauft hatte, und sie mit der Gabel aufspießte. Heute Morgen hatte er eine halbe Ewigkeit gebraucht, die Kinder zum Frühstücken zu bewegen, immer wieder unterbrochen von Wo ist Magda! Ich will meine Magda-Geheul, weswegen er ganz vergessen hatte, selbst zu frühstücken. In der Backwarenabteilung war er unschlüssig vor einem Pain au Chocolat stehen geblieben, aber Candida hatte ihm kürzlich sämtliches Gebäck strengstens verboten, weil sie meinte, er würde fett werden. Fett?!? Für sein Alter war er noch erstaunlich gut in Form. Trotzdem zog er mit Blick auf das hübsche Mädchen neben ihm vorsichtshalber den Bauch ein.
Ungläubig starrte Piers die Zahlen vor sich auf dem Display an. Da stimmte doch was nicht? Dartington Digital war ein todsicherer Tipp gewesen. Erschrocken schnappte er nach Luft und merkte, wie sich etwas hinten in seinem Hals festsetzte. Er versuchte durchzuatmen, doch das Ding flutschte nur noch weiter nach unten. Er probierte es mit husten, aber das schien überhaupt nichts auszurichten. Ganz ruhig, sagte er sich. Denk nach. Es ist bloß eine Traube. Aber im selben Augenblick rissen ihn Angst und Hilflosigkeit mit wie ein Tsunami.
Verzweifelt haute Piers mit den Händen auf den Tisch und stierte die Frauen ringsum mit weit aufgerissenen Augen flehend an, ein stummer Hilfeschrei. Jemand klopfte ihm auf den Rücken, aber so sanft, dass es mehr ein Streicheln war als das beherzte Draufhauen, das in dieser Situation eigentlich gefordert war. Dann, Gott sei Dank, ein energisches, festes Klopfen, das doch ganz bestimmt die Traube des Anstoßes entfernen müsste? Mit einem Gefühl unbeschreiblicher Erleichterung merkte er, wie sie sich löste, nur um gleich darauf wieder an Ort und Stelle zurückzurutschen.
Ich kann nicht einfach so sterben, nicht jetzt, nicht hier, dachte er. Nicht in diesem potthässlichen Pendlerzug, umgeben von Nobodys und Spinnern. Und dann kam ihm ein noch schlimmerer Gedanke: Wenn ich heute sterbe, wird Candida alles erfahren. Sie wird herausfinden, was ich hinter ihrem Rücken getrieben habe, und unsere Kinder werden in dem Wissen aufwachsen, was für ein Loser ihr Vater war.
Hilflos über den Tisch gebeugt, konnte Piers so eben aus den Augenwinkeln sehen, wie das rote Kostüm aufstand, ein Anblick wie ein Vulkanausbruch, und laut durch den ganzen Wagen tönte: »Ist ein Arzt an Bord?« Bitte, bitte, flehte er, lass einen Arzt an Bord sein. Er würde alles darum geben, um nur endlich wieder frei durchatmen zu können. Hörst du, Universum? Du kannst alles haben. Alles, was du willst.
Piers kniff die Augen zusammen, aber er sah immer noch rot – entweder der Nachglanz des blutroten Tweeds oder die zerplatzenden Äderchen hinter den Augäpfeln.
»Ich bin Krankenpfleger!«, hörte er es irgendwo aus der Menge rufen. Dann, Sekunden später, die ihm wie eine Ewigkeit vorkamen, legten sich von hinten zwei starke Arme um ihn, und er wurde von seinem Sitz gerissen, während zwei Hände sich unerbittlich in seinen Bauch bohrten – einmal, zweimal, dreimal.
Sanjay
08:19 New Malden nach Waterloo
Heute ist der Tag, dachte Sanjay. Er war auf dem Weg zum Bahnhof New Malden, um dort wie gewohnt in den Zug zu steigen. Der Tag, an dem er endlich all seinen Mut zusammennehmen und das Mädchen im Zug ansprechen würde. Er hatte sich sogar schon überlegt, was er zu ihr sagen wollte. Fast immer hatte sie ein Buch dabei. Ein richtiges echtes Buch aus Papier, kein Kindle oder Hörbuch. Einer der vielen Gründe, warum Sanjay der Überzeugung war, sie müssten füreinander geschaffen sein. Letzte Woche hatte sie einen Roman namens Rebecca gelesen, also hatte Sanjay sich im Buchladen um die Ecke ein eigenes Exemplar besorgt und am Wochenende die ersten beiden Kapitel gelesen. Und darum würde er sie heute, sofern sie das Buch noch las, auch fragen können, was sie von Mrs Danvers hielt. Der perfekte Gesprächseinstieg. Originell, unaufdringlich und geistreich.
Sanjay hielt Ausschau nach seinen beiden Mitbewohnern. Sie arbeiteten im selben Krankenhaus wie er, hatten aber gerade Nachtdienst, sodass sie sich morgens oft begegneten – Sanjay auf dem Weg zur Arbeit, frisch und munter und recht gut ausgeruht, James und Ethan auf dem Heimweg, blass, erschöpft und umweht vom einem strengen Desinfektionsmittelgeruch. Wie ein Fenster in Sanjays unmittelbare Zukunft.
Sanjay stand auf dem Bahnsteig unweit der Snack-Theke, wo Wagen drei normalerweise hielt, in dem sie, wie er nach wochenlangem Versuch und Irrtum herausgefunden hatte, am häufigsten saß. Tolles Buch, ging er seinen Text noch mal im Kopf durch. Wie findest du Mrs Danvers? Ich bin übrigens Sanjay. Bist du oft hier im Zug? Wobei, nein, lieber nicht. Das klang doch eher gruselig.
Kaum in den Zug gestiegen, glaubte Sanjay wirklich, heute müsse sein Glückstag sein. Denn da saß sie, am Tisch mit der Regenbogen-Lady, ihrem Hund und einem etwas moppeligen Anzugträger mittleren Alters. Den sah Sanjay auch nicht zum ersten Mal. Einer dieser arroganten Schnösel, wie Sanjay sie nur zu gut aus der Notaufnahme kannte, wenn mal wieder einer von ihnen mit geplatztem stressbedingtem Magengeschwür eingeliefert wurde oder mit Verdacht auf Herzinfarkt von der langjährigen Hobby-Kokserei, und schrie: Ich bin privatversichert! Augenscheinlich hielt er sich für etwas Besseres als der gemeine Pöbel, und Privatsphäre schien ihm ein Fremdwort zu sein.
Die Regenbogen-Lady hingegen mochte Sanjay sehr. Wie oft hatte er sie schon auf dem Weg zur Arbeit gesehen, aber noch nie hatte er ein Wort mit ihr gewechselt. Natürlich nicht. In einer Welt, in der alle Schwarz trugen, Dunkelblau oder gedecktes Grau, leuchtete sie in Smaragdgrün, Türkisblau und Veilchenlila. Und auch heute enttäuschte sie ihn nicht. Sie trug ein Kostüm aus knallrotem Tweed, in dem sie aussah wie eins der Erdbeerbonbons, die in den großen Quality-Street-Dosen immer ganz unten liegen blieben.
Ob er sie bitten sollte, den Hund auf den Schoß zu nehmen, damit er sich zu ihnen setzen konnte? Der Hund hatte schließlich vermutlich keine Jahreskarte, und ein Haustier auf dem Sitz ging bestimmt gegen sämtliche Sicherheits- und Hygienevorschriften. Das Problem dabei war nur, dass Sanjay die Regenbogen-Lady gleichermaßen bewunderte und fürchtete. Und da war er nicht der Einzige. Ganz gleich, wie voll der Zug auch war, kaum jemand wagte es, sie zu bitten, den Hund vom Sitz zu nehmen. Und wer es doch einmal wagte, machte denselben Fehler bestimmt kein zweites Mal. Nicht mal der Schaffner.
Und so stand er dann da und klammerte sich an eine Metallstange, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und überlegte krampfhaft, wie er unauffällig nahe genug an das Mädchen heranrücken könnte, um sie in ein Gespräch zu verwickeln. So was hatte er noch nie gemacht. Bisher hatte er sich nur mit Frauen verabredet, die er vom College kannte, von der Arbeit oder von einer Dating-App, wo man sich erst mal ein paar Tage lang belangloses Zeug schrieb und sich gründlich auf den Zahn fühlte, ehe man sich im wahren Leben verabredete. Das hier war Old School, und es war ein Albtraum. Es gab gute Gründe, warum das heutzutage niemand mehr machte.
Dafür, dass sich da gut und gerne achtzig Menschen auf engstem Raum in eine Sardinenbüchse gequetscht auf den Füßen standen, war es, wie immer, erstaunlich still. Man hörte nur das Rattern der Räder auf den Schienen, ein blechernes Scheppern aus irgendwelchen Kopfhörern und gelegentliches Hüsteln. Doch dann durchbrach unvermittelt eine Stimme die Stille wie ein Donnerschlag:
»Ist ein Arzt an Bord?«
Seine Gebete waren erhört worden, wenn auch auf eher unerwartete, ungewöhnliche Weise. Er räusperte sich und sagte so selbstsicher und souverän, wie er nur konnte: »Ich bin Krankenpfleger!«
Die Menge teilte sich ehrerbietig, Menschen verbogen sich, um ihm den Weg freizumachen, und er wurde durch eine Wolke unterschiedlichster Gerüche – Kaffee, Parfum, Schweiß – direkt vor die Füße der Regenbogen-Lady gespült und zu dem Mädchen und dem Mann, der offensichtlich gerade dabei war zu ersticken. Dieses Szenario hatten sie gleich im ersten Jahr der Ausbildung behandelt. Notfallmedizin, Modul eins: Der Heimlich-Griff.
Sanjays Ausbildung kam ihm nun zugute. Ohne weiter nachzudenken und mit weitaus mehr Kraft, als er sich selbst zugetraut hätte, hob er den Mann von hinten aus dem Sitz, schlang ihm die Arme um den Bauch und zog dann zu, so fest er konnte, mitten ins Zwerchfell. Dreimal. Es war, als hielte der ganze Zug gespannt den Atem an. Und dann, mit einem heftigen Huster, spuckte der Mann die Traube aus, die im hohen Bogen über den Tisch flog und mit einem satten Klatscher in der Teetasse der Regenbogen-Lady landete.
Klirrend tanzte die Tasse auf der Untertasse, um sich dann wieder zu beruhigen, während der ganze Wagen spontan zu applaudieren begann. Sanjay merkte, wie er rot wurde.
»Aha, eine Traube also«, stellte die Regenbogen-Lady mit Blick in ihre Teetasse fest, als wäre das alles ein Kinderspiel, bei dem es darum ging, das verborgene Ding im Sack zu erraten.
»Danke vielmals. Ich glaube, Sie haben mir gerade das Leben gerettet«, röchelte der Mann, dem das Sprechen sichtlich schwerfiel. Es war, als müssten sich die Worte erst den Weg um den Geist der ausgespuckten Traube suchen. »Wie heißen Sie?«
»Sanjay«, sagte Sanjay. »Gern geschehen. Ist schließlich mein Job.«
»Ich bin Piers. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken«, keuchte er, während er langsam wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht bekam.
NÄCHSTERHALT, WATERLOO, verkündete die Lautsprecherstimme. Sanjay wurde panisch. Da klopften ihm wildfremde Menschen auf den Rücken, drängten sich um ihn und beglückwünschten ihn, dabei gab es in diesem Zug nur einen Menschen, mit dem er gerne reden wollte. Und er ließ sich diese einmalige Gelegenheit entgehen. Alle sprangen auf und drängten zur Tür, schoben und rissen ihn mit wie einen widerstrebenden Lemming, der unaufhaltsam auf eine Klippe zugetrieben wird. Verzweifelt drehte er sich zu ihr um.
»Wie findest du Mrs Danvers?«, platzte es auf ihm heraus. Verdattert guckte sie ihn an. Sie hatte das Buch heute gar nicht dabei. Stattdessen hatte sie ein Exemplar von Michelle Obamas Autobiografie in der Hand. Bestimmt hielt sie ihn jetzt für einen irren Stalker. Vielleicht war er ein irrer Stalker.
Er hatte es vergeigt. Das war’s dann wohl.
Emmie
Emmie war viel zu aufgewühlt, um einfach ins Büro zu gehen, also huschte sie rasch in ihr gemütliches kleines Lieblingscafé und kramte ihre eigens mitgebrachte Thermostasse aus der Tasche.
»Hey Emmie!«, begrüßte sie der Barista. »Wie geht’s, wie steht’s?«
»Nicht so gut, ehrlich gesagt«, antwortete Emmie, noch ehe sie sich auf die Lippen beißen und stattdessen mit der gesellschaftlich geforderten Standardfloskel auf diese Frage antworten konnte, Gut, danke! nämlich. Schon aus Prinzip hasste sie die Vorstellung, zu den Leuten zu gehören, die ständig über ihre unerheblichen Erste-Welt-Probleme jammerten, während draußen Menschen unter Brücken schliefen oder sich abstrampelten, Essen für ihre Kinder auf den Tisch zu bringen.
Der Barista unterbrach seine Arbeit und runzelte die Stirn, als wartete er darauf, dass sie das weiter ausführte.
»Eben im Zug wäre beinahe jemand gestorben. An einer Traube erstickt«, erklärte Emmie.
»Aber er lebt noch, ja?«, fragte der Barista. Emmie nickte. »Keine bleibenden Schäden?« Sie schüttelte den Kopf. »Na also, dann ist das doch ein Grund zum Feiern! Mit einer Zimtschnecke vielleicht?«
Emmie konnte nicht einmal ansatzweise erklären, warum ihr gerade nicht nach feiern zumute war. Der Tag hatte ganz gewöhnlich angefangen, mit ihren Dehn- und Dankbarkeitsübungen, und dann – ZACK! – war sie, noch vor der Einfahrt in Waterloo, mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert worden. Die beklemmende Erkenntnis, dass man selbst als quietschfideler, quicklebendiger Mensch so aus heiterem Himmel von jetzt auf gleich … nicht mehr sein konnte.
Und was hatte sie gemacht, während der Mann auf dem Platz neben ihr um sein Leben rang? Emmie, die sich immer als pfiffige, patente, anpackende Person gesehen hatte, hatte bloß dagesessen und hilf- und tatenlos mit angesehen, wie zwei wildfremde Menschen ihm das Leben retteten. Als es darauf ankam, hatte ihr Fluchtinstinkt eingesetzt. Von Kampfbereitschaft keine Spur. Sie hatte nur einen Gedanken gehabt: Was, wenn ich das wäre? Was, wenn ich heute vor einen Bus laufe, von Terroristen in die Luft gejagt oder von einem Kurzschluss im Computerkabel einen tödlichen Stromschlag verpasst bekommen würde? Was würde bleiben? Was habe ich erreicht im Leben?
Emmie musste an das Projekt denken, an dem sie seit einigen Wochen arbeitete – eine vollintegrierte digitale Anzeigenkampagne für eine Toilettenpapiermarke, die ganz neu auf den Markt drängte. In ihrer Trauerrede würde es heißen: Dank Emmies strategischem und kreativem Genie durften nicht wenige Menschen in den Genuss weich wattierten, zart duftenden Luxus-Toilettenpapiers kommen.
Als Teenager hatte sie mal einen ganzen Monat lang in einem Baum campiert, um einen heimischen Wald vor der Abholzung zu bewahren, und in den Schulferien hatte sie in einer Suppenküche ausgeholfen. Ihr Spitzname damals war Hermine gewesen, weil ihre Freunde immer behaupteten, hätte es Hauselfen an ihrer Schule gegeben, Emmie hätte sich für ihre Freilassung eingesetzt. Und nun stand sie da, mit neunundzwanzig, und tat nichts, was ihre kleine Ecke von Thames Ditton auch nur im Geringsten verändert hätte, geschweige denn die ganze Welt. Nein, stattdessen sah sie untätig zu, wie andere beinahe erstickten.
Emmie musste an den Krankenpfleger im Zug heute Morgen denken. Er hatte so ruhig gewirkt. So fähig. So – sie verzieh sich diesen kleinen Augenblick der Oberflächlichkeit – gut aussehend. Der bewegte wirklich etwas. Schon auf dem Weg zur Arbeit hatte er ein Menschenleben gerettet.
Vielleicht sollte sie sich zur Krankenschwester umschulen lassen? Oder war es dafür längst zu spät? Das womöglich nicht, aber dass sie geradezu berüchtigt dafür war, schon beim Anblick von Nasenbluten oder einem eingewachsenen Zehennagel spontan in Ohnmacht zu fallen, sollte sie eventuell als Zeichen deuten, lieber keine medizinische Laufbahn einzuschlagen.
Was hatte der schnuckelige Lebensretter und Held aus dem wahren Leben ihr noch nachgerufen, als sie aus der Bahn gestiegen war? Es hatte sich fast angehört wie Wie findest du Mrs Danvers? Aber das konnte nicht sein, das ergab doch überhaupt keinen Sinn. Dieses ganze Drama am Morgen machte sie schon völlig konfus.
Emmie setzte sich an ihren Schreibtisch und stöpselte den Laptop ein, aufgekratzt von einer Mischung aus Koffein, Adrenalin und wilder Entschlossenheit. Von jetzt an wollte sie ihre Erfahrung und ihr Talent für etwas Gutes einsetzen. Vielleicht konnte sie sich um den Auftrag für ein Charity-Projekt bemühen? Und könnte Joey bequatschen, es umsonst zu machen? Wenn sich damit ein paar Preise für die Kreativarbeit abräumen ließen, würde er bestimmt nicht nein sagen.
Sie öffnete ihre E-Mails und wollte nur rasch nachschauen, ob etwas Wichtiges dabei war, um dann eine Prioritätenliste zu schreiben und sich um ihr neues Projekt zu kümmern.
Fix überflog Emmie die ungelesenen Nachrichten. Eine ganz oben in der Liste fiel ihr ins Auge, und sie musste lächeln, als sie den Absender las: [email protected]. In der Betreffzeile stand: Du. War die womöglich von einem Headhunter? Sie öffnete die Mail und überflog den Text.
INDEMPINKENROCKSIEHSTDUAUSWIEEINFLITTCHEN. WIESOLLDICHDAIRGENDWERERNSTNEHMEN? EINFREUND.
Emmie fuhr mit ihrem Stuhl herum, als könnte der Schreiber dieser Zeilen unmittelbar hinter ihr stehen und ihr beim Lesen über die Schulter schauen. Aber da war natürlich niemand.
Emmie las die Mail noch mal, und plötzlich war all der fröhliche Tatendrang von vorhin verpufft, und Wut, Scham und Verlegenheit überrollten sie wie eine Welle. Ihr Blick ging zu dem Rock, den sie morgens eigens ausgesucht hatte. Kess hatte sie sich gefühlt in ihrem knallpinken Bleistiftrock, erfolgreich und sexy. Jetzt wollte sie ihn sich am liebsten vom Leib reißen und in den Büromülleimer pfeffern.
Im offenen Großraumbüro wimmelte es schon vor Menschen. Ihre Kollegen. Ihre Freunde. Menschen, die sie schätzte und von denen sie eigentlich immer gedacht hatte, dass die sie auch schätzten. Sie schaute in ihre Gesichter, beobachtete ihre Körpersprache auf der Suche nach einem Hinweis, wer ihr diese Mail vor – sie schaute auf den Zeitstempel – ziemlich genau zehn Minuten geschickt haben könnte. Aber es war alles wie immer.
Nur dass Emmie plötzlich das Gefühl hatte, sie werde sich in diesem Büro nie wieder so fühlen wie immer.
Iona
18:17 Waterloo nach Hampton Court
Iona war das Herz in die Hose gerutscht, und ihr hatte gleich Böses geschwant, als sie sah, dass beim Termin mit ihrem Chef auch eine Dame aus der Personalabteilung dabei war. Brenda – die Chefin des »Personalmanagements«, das bei Iona immer noch schnöde »Personalabteilung« hieß, aber irgendwann in den Neunzigern umbenannt worden war – saß neben ihrem Chefredakteur im Konferenzraum am Tisch und guckte dienstlich. Das hatte allerdings erst einmal nichts zu bedeuten, dienstlich guckte Brenda nämlich immer. Aber es verstärkte nur Ionas unheilvolles Gefühl drohenden Ungemachs.
»Hallo allerseits«, sagte Iona munter und verfluchte sich für das leichte Zittern in der Stimme. »Wobei, sagt man das bei zweien überhaupt? Vielleicht hätte ich besser Hallo, ihr beiden gesagt oder Hi, ihr zwei.« Sie plapperte wirres Zeug. Iona riss sich zusammen und schaute ihren Chefredakteur an, vergeblich hoffend, wenn sie den Blickkontakt mit Brenda vermied, könnte die sich vielleicht einfach in Luft auflösen. Ihr Chefredakteur hieß Ed. Sehr passend irgendwie, wie die Abkürzung vom englischen »editor« für Redakteur. Ob er seinen Namen geändert hatte, damit er besser zu seinem Beruf passte? Zuzutrauen wäre es ihm.
»Ähm, lässt du den Hund bitte draußen, Iona?«, sagte Ed und zeigte mit dem Finger auf ihre liebste Lulu wie einer aus einem Erschießungskommando. War er ja vielleicht auch.
Iona verdrückte sich rückwärts durch die geöffnete Tür, damit ihr niemand in den Rücken schießen konnte.
»Könntest du ein paar Minuten auf sie aufpassen?«, fragte sie Eds »Assistentin der Geschäftsführung«, das neuzeitliche Pendant zur Sekretärin, nur ohne Steno. Sie wirkte erfreulich erfreut. Ganz bestimmt eine nette Abwechslung von ihrem sonstigen Job als Eds unterbezahlte und unterschätzte Handlangerin. »Am liebsten mag sie es, hinter den Ohren gekrault zu werden, da, wo das Fell so seidig ist.« Und dann, weil sie immer zu viel redete, wenn sie nervös war, setzte sie noch hinterher: »Aber mögen wir das nicht alle?«, und anschließend lachte sie hoch und schrill. Eds Assistentin zuckte zusammen und zog erschrocken den Kopf ein.
»Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde!«, murmelte Iona leise vor sich hin, während sie wieder hineinging, kerzengerade, mit hoch erhobenem Kopf, genau so, wie sie seinerzeit auf die Bühne gegangen war.
»Setz dich, setz dich«, sagte Ed leutselig und wies auf eine Reihe knallbunter leerer Stühle, die um den Konferenztisch herumstanden. Iona entschied sich für den zu seiner Rechten, in der Hoffnung, die Kombination aus mandarinenorangem Stuhl und purpurrotem Kostüm könnte Brendas Netzhaut irreversiblen Schaden zufügen. Dann nahm sie Notizblock und Bleistift aus der Handtasche. Sie hatte nicht vor, sich Notizen zu machen, aber der Bleistift könnte vielleicht noch gelegen kommen, um ihn Ed in den Handrücken zu rammen, wenn es denn sein musste. Ein aufheiternder Gedanke.
»Also, bevor es an die detaillierte Beurteilung geht, möchte ich mit dir kurz über die Gesamtsituation sprechen«, sagte Ed, legte die Fingerspitzen aneinander und schaute ganz ernst, wie ein Schuljunge, der Bankdirektor spielt. Und dann rasselte er die sinkende Auflagenhöhe, den zurückgehenden Umsatz, die gestiegenen Produktionskosten herunter, und die Zahlen trudelten um Iona durch die Luft wie radioaktive Pollen im Wind, während sie sich bemühte, intelligent und interessiert zu gucken.
»Die Sache ist die«, sagte er schließlich, »wir müssen uns mehr auf unser digitales Angebot konzentrieren und eine jüngere Zielgruppe ansprechen, was heißt, wir müssen dafür sorgen, dass sämtliche unserer Inhalte modern und relevant sind. Und offen gestanden fragen wir uns, ob ›Frag Iona‹ nicht vielleicht ein bisschen …« Er unterbrach sich und schien einen Moment nach dem richtigen Adjektiv zu suchen, und entschied sich dann für: »… zu altmodisch sein könnte.« Offenkundig war Ed nicht einmal bei seinen Beleidigungen in der Lage, ein kleines bisschen kreatives Flair an den Tag zu legen.
Iona wurde übel. Schluss damit, sagte sie sich streng. Steh auf und kämpfe wie eine Frau. Denk an Boudicca, Königin der Kelten. Und so sammelte sie ihre abgerissenen Truppen um sich und erklomm ihren Streitwagen.
»Willst du damit sagen, ich sei zu alt, Ed?«, fragte sie und unterbrach sich dann kurz, um den Anblick der Personaltante zu genießen, aus deren Gesicht alle Farbe wich, sodass man sehr schön den Ansatz ihres Mehrfachkinns sehen konnte und die Grenze, wo das Make-up aufhörte. »Als Zeitschriftentherapeutin ist Lebenserfahrung nämlich unerlässlich. Und ich habe alles schon erlebt. Sexismus, Altersdiskriminierung, Homophobie.« Sie ließ die Wörter fallen wie Landminen, und das waren sie natürlich auch. Käme noch eine Behinderung dazu, was in ihrem Alter ja durchaus möglich wäre, hätte sie praktisch ein Full House möglicher Diskriminierungsgründe. Dann mal viel Spaß beim Umschiffen, Brenda vom Personalmanagement.
»Natürlich nicht«, sagte Ed. »Ich gebe dir bloß eine Challenge.« Iona wusste augenblicklich, dass »Challenge« nichts anderes bedeutete als »Ultimatum«. »Vielleicht wäre es ja auch eine Option für dich, ein bisschen kürzerzutreten. Mehr Zeit mit den Enkelkindern zu verbringen.« Sie starrte ihn durchdringend an und ließ die Knöchel knacken, was Ed nicht ausstehen konnte.
Brenda räusperte sich und fummelte an ihrem Schlüsselband herum. »Ach. Keine Enkel. Natürlich nicht«, stammelte Ed. Sagte er »natürlich nicht«, weil sie eindeutig zu jung war für Enkelkinder? Oder zu lesbisch?
»Wir wollen ja nichts überstürzen. Warten wir doch noch einen Monat ab und schauen, ob du deine Seiten neu erfinden kannst. Modernisieren, ins 21. Jahrhundert bringen. Es muss knistern, es muss sprühen. Denk Millennial. Das ist die Zukunft.« Er zwang sein Gesicht, das dabei beinahe zu zerspringen drohte, zu einem Lächeln.
»Klar«, meinte Iona und notierte KNISTERN auf ihrem Notizblock, gefolgt von WICHSER. »Aber ich möchte noch mal daran erinnern, Ed, wie wichtig Problemseiten für Zeitschriften sind. Die Menschen brauchen so was. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Menschenleben daran hängen. Und unsere Leser lieben sie. Nicht wenige sagen sogar, dass sie die Zeitschrift nur meinetwegen kaufen.« Nimm das, erbärmlicher römischer Zenturio.
»Bestimmt war das mal so, Iona«, sagte Ed, nahm sein Schwert und stieß es ihr mitten ins Herz. »Aber wann hat jemand das letzte Mal so was gesagt? Hm?«
Iona kehrte nicht gleich wieder zurück an ihren Schreibtisch. Stattdessen marschierte sie schnurstracks zur Toilette, die Augen fest auf den quadratisch-praktisch-hässlichen Teppich geheftet, der unter den Füßen noch ein bisschen klebte von der verschütteten Fruchtbowle der letzten Firmenfeier. Sie schloss sich in eine der Kabinen ein und setzte sich auf den heruntergeklappten Sitz, Lulu auf dem Schoß, und atmete die Mischung aus kiefernfrischen Chemikalien, diversen Körperausscheidungen und Hund ein. Unvermittelt fing sie an zu weinen. Kein hübsches, adrettes Weinen, nein, explosive Schluchzer, begleitet von reichlich Schnodderfluss und zerlaufender Wimperntusche. Dieser Job war ihr Leben. Ihr Grund, morgens aufzustehen. Er gab ihrem Leben einen Sinn. Er machte sie aus. Das war sie. Was war sie ohne ihn? Und wer sollte sonst eine Zeitschriftentherapeutin einstellen, die mit Riesenschritten auf die sechzig zuging und seit dreißig Jahren im selben Job war? Wie hatte es trotz überschwänglicher Lobhudeleien, Fan-Gefolge und Preisverleihungen nur so weit kommen können?
Iona versuchte, ein bisschen gerechten Zorn heraufzubeschwören, aber sie war einfach zu müde. Die guten alten Zeiten, als sie fieberhaft eine Gesellschaftskolumne und eine Beratungsseite sowie gelegentliche Restaurantkritiken und Reiseartikel hatte jonglieren müssen, waren anstrengend genug gewesen, aber nicht genug zu tun zu haben, war tausendmal schlimmer. Sie war es leid, ständig ein Selbstbewusstsein versprühen zu müssen, das sie schon seit Jahren nicht mehr hatte. Sie war es leid, immer beschäftigt tun zu müssen, obwohl man ihr – bis auf die Fragenseite – sämtliche Zuständigkeiten nach und nach gestrichen hatte.
Sie hatte sich angewöhnt, jede noch so popelige Aufgabe endlos in die Länge zu ziehen, und hatte ihren Computermonitor so gedreht, dass niemand mitbekam, wie sie, statt zu arbeiten, Fantasie-Trips mit Bea zu traumhaften tropischen Korallenatollen plante oder auf Facebook alte Schulfreundinnen stalkte.
Natürlich war das Leben kein Wettbewerb. Wäre es aber doch einer, hatte Iona geglaubt, eigentlich ganz gut dazustehen. In der Vergangenheit hatte sie insgeheim oft die Lebensentscheidungen ihrer Altersgenossinnen belächelt, die – eine nach der anderen – auf dem Standstreifen der Karriereautobahn zum Stehen gekommen waren, um Kinder in die Welt zu setzen und undankbare, ichbezogene Ehemänner zu betüddeln, die früher irgendwann vielleicht mal ganz passabel ausgesehen hatten, aber inzwischen Bierbäuche, Nasenhaare und Nagelpilz angesetzt hatten.
Aber wenn sie sich jetzt die Schulabschlussfotos der Kinder anschaute, die Mehrgenerationenfeste an blank geschrubbten Holztischen und, ja, sogar die verschrumpelten neugeborenen Enkelkinder, die blicklos in die Kamera blinzelten, musste sie sich fragen, ob am Ende nicht womöglich doch die anderen die Gewinner waren. Zumindest saßen die nicht auf dem Klo und heulten ihrem Schoßhund den Pelz nass.
Iona hörte die Tür zur Damentoilette aufgehen und dann zwei Paar hohe Absätze auf den Fliesen klackern. Sie zog die Füße auf den Sitz und die Knie an die Brust und vergrub das Gesicht noch tiefer in Lulus Fell, damit man sie nicht schluchzen hörte.
»Himmel, wie ich Montage hasse«, hörte sie eine der Frauen sagen.
Und merkte, sehr zu ihrer Erleichterung, dass es bloß Marina war, eine der Kulturredakteurinnen. Sie und Marina waren recht gut miteinander befreundet, obschon Marina beinahe dreißig Jahre jünger war als sie. Sie trafen sich gerne zum Plaudern am Wasserspender und waren schon ein paarmal zusammen zum Mittagessen gewesen. Marina erzählte Iona den neuesten Büroklatsch, und Iona gab Marina kostenlose Ratschläge für ihr verzwicktes Liebesleben. Sie und Marina schätzten einander auch als Kolleginnen, als Karrierefrauen im Zenit ihrer Macht. Vielleicht sollte sie aus ihrem stillen Versteck schlüpfen und ihrer Freundin das Herz ausschütten. Geteiltes Leid und so. Vielleicht könnte sie ein gemeinsames Mittagessen vorschlagen. Mit alkoholischer Stärkung.
»Ich auch«, erwiderte Brenda-vom-Personalmanagement. »Wobei, Mittwoche mag ich noch weniger. Nicht Fisch, nicht Fleisch.«
»Hey, worüber haben du und Ed eigentlich mit dem alten Dinosaurier geredet?«, fragte Marina. »Wollt ihr sie endlich aussterben lassen? Was soll’s denn sein? Eine kleine Eiszeit oder lieber ein Meteoriteneinschlag?«
So viel zu schwesterlicher Solidarität.
Iona war heilfroh, dass ihr Zug nach Hause schon auf Gleis 5 in Waterloo Station auf sie wartete. Wenigstens dieser Teil des Tages war angenehm vorhersehbar. Wie gewohnt stieg sie in ihren Wagen, um dann unvermittelt laut loszufluchen und versehentlich die arme Lulu – die empört aufquiekte – viel zu fest an sich zu drücken. Da war Traube-im-Hals – wie hieß er noch gleich? – Piers. Das war’s. Er saß auf der anderen Seite des Gangs, genau gegenüber vom einzigen freien Platz. Bestimmt würde er ihr ein Gespräch aufzwingen, und so sehr sie sich sonst an überschwänglicher Dankbarkeit berauschen konnte, wollte sie doch gerade bloß still und ungestört dasitzen und sich eine heile Welt erträumen, in der sie noch gebraucht wurde.
Seufzend setzt Iona sich. Dann öffnete sie die Handtasche und nahm das Glas heraus und die Flasche mit dem fertig gemixten Gin Tonic und das wiederverschließbare Plastiktütchen mit den Zitronenscheiben. Und wartete unterdessen auf die unvermeidliche Unterbrechung. Aber nichts geschah. Verstohlen schaute sie rüber zu Piers, der sich in seinem Sitz zurücklehnte, als könnte er ihn mit schierer Willenskraft verbiegen, und die Beine derart ausgebreitet hatte, dass die alte Dame neben ihm gegen das Fenster gedrückt wurde wie ein Raffrollo. Sein Blick traf Ionas, und sie dachte erst, er wolle etwas sagen, aber dann wandte er sich ab und guckte auf sein Handy, auf das er dann mit diktatorischem Eifer und ausgestrecktem Zeigefinger einhackte.
Iona kam sich komisch vor. Und ärgerte sich dann, dass sie sich über einen solchen … Lackel aufregte. Dabei wäre es doch sicher angebracht – ja, geradezu gefordert – beim Wiedersehen mit einem Menschen, der nur ein paar Stunden zuvor mitgeholfen hatte, einem das Leben zu retten, danke zu sagen. Oder wenigstens zu grüßen? Ein kurzes Nicken womöglich? Oder hatte er sie nicht erkannt? Eher unwahrscheinlich, oder? Eins hatte man Iona nie vorwerfen können, und das war, keinen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
»Schatz«, plärrte er ins Telefon, in einem Ton und einer Lautstärke, die keinerlei Rücksichtnahme auf die ungestörte Ruhe seiner Mitreisenden zeigten. »Könntest du eben kurz in den Keller gehen und eine Flasche Pouilly-Fumé raufholen und kühlstellen? Nein, nicht den. Den Grand Cru. Einen von denen, die wir aus diesem grässlichen Landhausurlaub mit den Pinkertons an der Loire mitgebracht haben.«
Lulu, die auf Ionas Schoß saß, fing an zu knurren. Iona spürte, wie sich der kleine Hundebrustkorb weitete wie ein Dudelsack, der sich mit Luft füllte, und dann drehte sie sich schwungvoll zu Piers um und stieß eine Salve hoher, spitzer Beller aus.
Piers hackte unbeeindruckt auf sein Handy ein, beendete das Gespräch, ohne sich zu verabschieden, und funkelte dann Iona finster an.
»Was zum Teufel hat die blöde Töle?«
Iona war es ja gewohnt, dass die Leute unhöflich zu ihr waren, und sie könnte – vielleicht – auch Piers Undankbarkeit und sein ungehobeltes Benehmen ignorieren, aber Lulu musste sich nicht von ihm beleidigen lassen.
»Lulu«, sagte sie, »ist nicht blöde. Sie ist ganz im Gegenteil äußerst intelligent. Außerdem ist sie Feministin, und als solche denunziert sie toxische Männlichkeit, wo immer sie sie sieht.«
Piers klappte die Kinnlade herunter, und er griff nach seinem Evening Standard, den er sich dann wie einen Schleier vors Gesicht hielt. Iona war sich ziemlich sicher, dass sie einander nie wieder eines Blickes würdigen, geschweige denn ein Wort miteinander wechseln würden. Dem Herrn sei Dank dafür.
Sanjay
Vor zwei Monaten war Sanjay von der Notaufnahme in die Onkologie gewechselt. In vielerlei Hinsicht war das eine Verbesserung. Die Arbeit in der Notaufnahme war hektisch, chaotisch und unbeschreiblich stressig, ständig piepste und schrillte es, Menschen weinten, abgehackte Anweisungen wurden gebellt. Inmitten des Chaos war er sich immer ein wenig verloren vorgekommen. Ein kleines Kind mit Gipsarm wieder nach Hause zu schicken, verarztet und mit einem Aufkleber fürs Tapfersein, war schön und gut, aber wie oft wurden seine Patienten auf andere Stationen verlegt, und er erfuhr gar nicht mehr, was aus ihnen wurde. In der Notaufnahme konnte man keine Beziehung aufbauen zu den Patienten, man betrat die Bühne zum dramatischen Höhepunkt der Geschehnisse und verschwand wieder, bevor die Geschichte zu Ende war.
In der Onkologie konnte Sanjay seine Stärken besser ausspielen, und darum hatte er auch um den Wechsel gebeten. Hier sah er seine Patienten tagein, tagaus wochen-, manchmal monatelang. In einigen Fällen sogar über Jahre. Die Stammpatienten kannte er schon – genau wie die Namen ihrer Kinder und Enkelkinder, ihre Wunsch- und schlimmsten Albträume und wie man ihnen die Behandlung so angenehm wie nur möglich machen konnte. Darum hatte er sich für diesen Beruf entschieden – um nicht nur den Körper zu heilen, sondern auch Geist und Seele. Das hatte er genau so in seine Bewerbung geschrieben. Für ihn war das kein abgedroschener Kalenderspruch, sondern ernst gemeinte Herzensangelegenheit.
Dabei gab es nur ein Problem, wie Sanjay nun zu seinem Leidwesen feststellen musste: Je tiefer er sich in das Leben seiner Patienten verstrickte, umso härter traf es ihn, wenn es mal kein Happy End gab. Für jede Handvoll Patienten, die er mit einer gutartigen Zyste nach Hause schickte oder mit einer Fünf-Jahre-krebsfrei-Entwarnung, gab es einen mit einem unheilbaren Rückfall, Metastasen in der Leber, den Knochen, dem Gehirn. Mütter mit kleinen Kindern, denen er hilflos dabei zusehen musste, wie sie mit jeder Chemo-Behandlung schwächer und schwächer wurden, wie ihnen die Haare ausfielen, die Wimpern und die Augenbrauen, und ihnen erst der Sinn für Humor abhandenkam und schließlich alle Hoffnung.
Die Ärzte, mit denen Sanjay zusammenarbeitete, schienen immun dagegen. Die konnten sich abgrenzen. Die hatten tagtäglich mit Tragödien, Ungerechtigkeit und zerstörten Lebensträumen zu tun, sie zogen am Ende des Tages den weißen Kittel aus und gingen noch ein, zwei Bier trinken, unbeschwert und sorglos, wie es schien. Wie machten die das bloß? Sanjay kannte keine Grenzen, bei ihm war irgendwie alles eins. Er konnte nichts dagegen tun, dass Beruf und Privatleben sich bei ihm heillos miteinander vermischten. Manchmal wachte er mitten in der Nacht auf und musste an die Tumormarker in Mr Robinsons letztem Blutbild denken, oder ihm fielen unvermittelt die großflächig verstreuten dunklen Schatten auf Mrs Greens PET-Scan ein, wenn er gerade beim Abendessen saß.
»Danke schön«, sagte Mrs Harrison (»Sagen-Sie-doch-Julie«), während er einen Wundverband auf die Stelle klebte, an der die Biopsie durchgeführt worden war, gleich unter der linken Achselhöhle. »Meinen Sie, es ist alles okay?« Sie schaute ihn an, und in ihrem Blick mischten sich Hoffnung und Angst.
»Am besten versuchen Sie, gar nicht daran zu denken, Julie«, wich er geschickt der Frage aus und kramte in der Ablage im Kopf nach den passenden Worten. »Neun von zehn Knubbeln in der Brust entpuppen sich als gutartig. Aber gut, dass Sie gleich zum Arzt gegangen sind, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.«
Das stimmte natürlich, aber Sanjay hatte das Gesicht des Assistenten am Sonografen gesehen, als er die – beunruhigend große und unregelmäßige – dunkle Masse auf dem Monitor vermessen hatte. Julie hatte das sicher nicht bemerkt, aber Sanjay kannte inzwischen die kleinsten Anzeichen: ein unmerkliches Augenzusammenkneifen oder wie die Finger die Computermaus umklammerten.
»Ich weiß, ich weiß, aber ich mache mir solche Sorgen wegen der Kinder. Die sind doch noch so klein. Sechs und vier. Möchten Sie sie mal sehen?«, fragte Julie eifrig und zog das Handy heraus. Sanjay wollte die Fotos lieber nicht sehen. Das machte alles nur noch schlimmer. Könnte er sich doch bloß auf die Fallzahlen konzentrieren, die Prognosen und Behandlungspläne, und nicht auf trauernde Kinder und »In diesem Leben will ich unbedingt noch …«-Wunschlisten, die sich nicht mehr erfüllen ließen.
»Unbedingt«, erklärte er mit einem beherzten Lächeln.
Und dann betrachtete er hingerissen die Fotos von zwei glücklichen, unbeschwerten Kindern mit entzückenden Zahnlücken, die nicht ahnten, dass ihre ganze Welt bald in sich zusammenzustürzen drohte, und schickte Julie schließlich mit der strikten, wenn auch unmöglich zu befolgenden Anweisung nach Hause, sich nicht allzu viele Sorgen zu machen, sich abzulenken und bis zu ihrem Termin zur Besprechung des Laborbefunds in fünf Tagen am besten gar nicht mehr daran zu denken.
Danach huschte Sanjay ins leere Familienzimmer, auch bekannt als Raum-für-ganz-schlechte-Nachrichten. Man bat Paare nicht, »im Familienzimmer Platz zu nehmen«, wenn es Gutes zu verkünden gab. Sanjay holte sich am Wasserspender in der Ecke einen Becher Wasser und setzte sich in einen der Sessel, umtanzt vom Nachhall von Worten wie tödlich, durchsetzt, keine lebensverlängernden Maßnahmen oder Sterbebegleitung. Ob all der Schrecken, die Angst und der Kummer im Laufe der Zeit in die Stuhlpolster gesickert waren? Er stellte sich vor, wie sie aus Kissen und Vorhängen trieften, ein giftiger, glitschiger Schleim, der unaufhaltsam bis unter die Decke stieg und ihn erstickte.
Unvermittelt zitterten ihm die Hände, und Wasser aus seinem Becher schwappte auf den Boden. Er stellte den Becher ab und gab sich alle Mühe, tief und ruhig durchzuatmen. Es fühlte sich an, als wollte sein Herz sich aus dem Brustkorb stemmen. Er drückte den Handballen aufs Brustbein, so fest, dass er sicher einen blauen Fleck bekommen würde, als könnte er sein Herz damit wieder an den rechten Fleck zwingen.
Was würde Julie wohl sagen oder all die anderen Menschen aus dem Zug am Montag, die in ihm den Helden gesehen hatten, wenn sie wüssten, dass er unter diesen stets wiederkehrenden, lähmenden Panikattacken litt? Was, wenn sie ihn so sehen könnten, wie er sich im Familienzimmer versteckte, auf der Toilette oder in einer Abstellkammer, um, den Kopf zwischen den Händen, vornübergebeugt abzuwarten, bis er wieder atmen konnte?
Was taugte schon ein Pfleger auf der Krebsstation, der sich vor dem Tod fürchtete?
Vermutlich war es besser so, dass er das mit dem hübschen Mädchen im Zug vermasselt hatte. Selbst wenn sie sich mit ihm verabredet hätte, hätte sie bestimmt schnell gemerkt, was für ein Hochstapler er war, und dann hätte sie ihn ohnehin abserviert.
Martha
08:13 Surbiton nach Waterloo
Auf Zehenspitzen schlich Martha an der geschlossenen Schlafzimmertür vorbei und versuchte das gedämpfte Stöhnen und rhythmische Bollern des Betthaupts gegen die Wand, das von drinnen zu hören war, geflissentlich zu ignorieren. Schlimm genug, sich vorstellen zu müssen, wie alte Leute es miteinander trieben; schlimmer noch, wenn eine der Beteiligten die eigene Mutter war. Und noch viel schlimmer, wenn der andere nicht der eigene Vater war.
Ihr derzeitiger Hausfreund, Richard (»Nenn mich bitte nicht Dick, haha«), schien so schnell nicht wieder verschwinden zu wollen. Martha zählte die Monate an den Fingern ab. Beinahe ein Jahr lang umschwirrte er ihre Mutter jetzt schon, und nach und nach entdeckte Martha immer mehr Männerkram im Haus. Rasierschaum im Badezimmer, Boxershorts im Wäscheschrank und sogar eine kleine Werkzeugkiste im Flur, die zwar nie benutzt wurde, aber, wie sie vermutete, etwas Männlich-Zupackendes ausstrahlen sollte.
Martha fragte sich, ob Richard wohl wusste, wie alt ihre Mutter wirklich war, oder ob Kate wieder das Märchen erzählt hatte, sie sei damals bei Marthas Geburt ja »blutjung gewesen. Kaum zwanzig«. Bald hatte sie Geburtstag, vielleicht sollte Martha ihr einen Kuchen backen und obendrauf in knallbunten Großbuchstaben schreiben: ALLESLIEBEZUMFÜNFUNDVIERZIGSTENGEBURTSTAG. Das würde ein Tamtam geben, schon allein deshalb, weil ihre Mutter seit der Jahrtausendwende keinen raffinierten Zucker mehr angerührt hatte.
Wobei es vielleicht gar keine so gute Idee wäre, ihn zu vergraulen. Der Nächste könnte noch schlimmer sein. Und einen Nächsten würde es geben, so sicher wie das Amen in der Kirche, denn ihre Mutter hasste, genau wie Mutter Natur selbst, die Leere. Wobei es so was bei ihnen zu Hause ohnehin gar nicht gab. Da herrschte das reinste Chaos.
Wie ferngesteuert trottete Martha zum Bahnhof und musste an die letzten Textnachrichten denken, die sie und Freddie sich gestern Abend geschickt hatten. Sie mochte ihn. Auch wenn er nicht zu den coolen Kids gehörte. Ein bisschen linkisch war er, ein Außenseiter, aber das konnte sie ihm wohl kaum ankreiden. Und eigentlich war er ziemlich clever und unerwartet witzig.
In Ohnmacht fiel sie bei Freddie vor Verzückung nicht, so wie die Heldinnen in Jane-Austen-Romanen. Kein Herzklopfen, kein wogender Busen, keine Korsettschnüre, die es zu lockern galt. Wobei sie natürlich ohnehin kein Korsett trug, und zum Wogen waren ihre Brüste nicht groß genug. Aber einen Jungen zu haben, über den man reden konnte, das war wichtig. Das hatte sie inzwischen gelernt. Wenn die angesagten Mädels irgendwo flüsternd und kichernd zusammengluckten, hätte sie nun auch endlich jemanden zum Flüstern und Kichern. Sie würde dazugehören. An den Gedanken klammerte sie sich wie an eine tröstende Wärmflasche.
Oft war es Martha, als hörte sie David Attenboroughs Stimme im Kopf, wie er eine Naturdoku kommentierte. Sie war die Beobachterin, die fremdartige Geschöpfe studierte, unbekannte Tierarten, und dabei versuchte, Verhaltensweisen und Rituale zu ergründen, um sich frei zwischen ihnen bewegen zu können, ohne ausgestoßen oder drangsaliert zu werden. Ob das bei anderen Teenagern angeboren war? Oder taten die sich genauso schwer, die ungeschriebenen Gesetze und Regeln zu durchschauen? Regeln, die sich immer dann zu ändern schienen, wenn man sie eben erst kapiert hatte. Welche Markenklamotten man tragen, welche Musik man hören, welchen Leuten man in den sozialen Medien folgen, welche Schauspieler man anhimmeln musste. Es war das reinste Mienenfeld.
Der Zug war beinahe voll, als er in den Bahnhof Surbiton einfuhr. Es gab nur noch einen einzigen freien Platz im ganzen Wagen, und auf den hielt Martha nun zu. Gerade als sie sich setzen wollte, kam ihr einer dieser typischen Banker-Alpha-Affen-Männchen entgegen, stürzte nach vorne und schubste sie unsanft beiseite. Dann breitete er sich ungeniert auf dem Sitz aus, nahm den Laptop aus der Aktentasche und klappte ihn auf dem Tisch vor sich auf, wie ein Hund, der das Bein an einem Laternenpfahl hebt, um sein Revier zu markieren.
»Na toll«, murrte Martha und merkte gar nicht, dass sie das laut gesagt hatte, bis er sich zu ihr umdrehte und sie ansah.
»Sorry, Kleine«, sagte er mit einem süffisanten Grinsen, dass er selbst bestimmt für einnehmend hielt. »Es gibt im Leben nun mal Gewinner und Verlierer, und diesmal – bist du die Verliererin.«
Martha wurde rot. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie wollte einfach nur weg, aber die Gänge waren verstopft. Das Handy summte in ihrer Tasche. Einmal, zweimal, dann eine ganze Benachrichtigungssalve. Sie zog es heraus und sah darauf, dankbar für die kleine Ablenkung. Die Chatgruppe der zehnten Klasse explodierte förmlich mit irgendeinem brandheißen neuen Klatsch.
Martha scrollte zurück durch die Nachrichten. Die Wörter verschwammen, und ihr Magen verkrampfte sich. Das konnte doch nicht sein, oder? Nein. Nein. Nein. Das konnte nicht sie sein. Das grenzte ja schon an Verfolgungswahn. Endlich kam sie zum Auslöser für das ganze elektronische Geplapper – das Gelächter, das Gejohle, den Ekel, die Empörung –, und ihr drehte sich der Magen um. Ein Schwall Galle stieg ihr unaufhaltsam in den Hals.
»Verdammte Scheiße!«, brüllte der Sitzdieb. Sie hatte ihm im hohen Bogen über die Tastatur gekotzt. »Hast du eine Ahnung, was so ein Laptop kostet?«
Martha hörte ein leises Winseln auf der anderen Seite, und als sie sich umdrehte, sah sie sich einer nur allzu bekannten Französischen Bulldogge gegenüber, die Martha bis in die Seele zu schauen schien.
»Wie können Sie es wagen!«, schimpfte die Dame mit dem Hund auf dem Arm. Martha zog im Glauben, das Kreischen gelte ihr, den Kopf ein, und merkte dann erst, wie die Dame den dreisten Sitzdieb neben ihr wütend anfunkelte. »Sehen Sie denn nicht, dass dem armen Kind schlecht ist? Herrje, ich hätte der Welt einen Gefallen tun und Sie neulich einfach ersticken lassen sollen.«
»Der Geschädigte bin ja wohl eindeutig ich!«, maulte der Mann und wies angewidert auf seinen besudelten Laptop.
»Tja, es gibt im Leben Gewinner und Verlierer, und diesmal sind Sie der Verlierer«, meinte die Dame mit der Zauberhandtasche ungerührt, worüber Martha sonst sicher hätte schmunzeln müssen.
Während die beiden Erwachsenen sich ausgewählte Beleidigungen an den Kopf warfen, musste Martha unvermittelt an eine Szene aus Jurassic World denken, in der der T-Rex und der Indominus Rex aufeinander losgehen und so den wehrlosen Menschen die Gelegenheit geben, unbemerkt zu entkommen. Sobald sich die Türen am nächsten Halt öffneten, drängelte Martha sich aus dem Wagen und lief los.
Sie schlängelte sich durch die Pendlermassen, während ihr die Magensäure noch in der Kehle brannte, und spürte den endlosen Benachrichtigungsstrom, der ihr Telefon zersiebte wie Schrapnell. Vor manchen Dingen konnte man nicht davonlaufen.
Iona
08:05 Hampton Court nach Waterloo