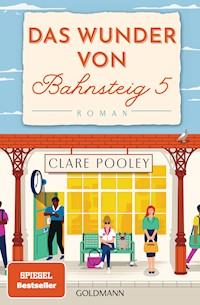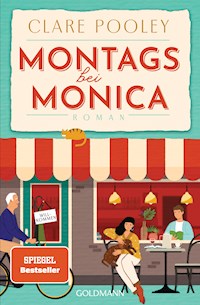13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Sie mögen nicht mehr die Jüngsten sein, aber für eine gute Sache stürzen sie sich in jedes Abenteuer ...
Daphne weiß: Das Alter ist nur eine Zahl. Sie weiß auch, dass es sie im Alltag unsichtbar macht – durchaus ein Vorteil bei ihrer Vergangenheit ... Doch an ihrem 70. Geburtstag spürt sie, dass ihrem Leben etwas fehlt: Freunde. Kurz entschlossen tritt Daphne einem Seniorenclub bei. Aber Tee trinken und über alte Zeiten plaudern, ist nichts für sie. Zum Glück sehen die anderen Mitglieder das ähnlich, darunter ein erfolgloser Schauspieler mit Hang zum Ladendiebstahl und eine Guerilla-Strickerin. Gemeinsam entdecken sie ihre Lebenslust und ihren Abenteuergeist. Als das Gemeindezentrum geschlossen werden soll, in dem sich die Gruppe trifft, entwickeln sie prompt einen Rettungsplan. Mit Hilfe eines Teenagers und eines betagten Hundes werden sie allen zeigen, was in ihnen steckt. Sofern alte Sünden und die Polizei sie nicht vorher einholen.
Ein wunderbar humorvoller Roman darüber, dass wahre Freundschaft kein Alter kennt.
»Clare Pooley ist die Königin des Wohlfühlromans. Lesefreude pur!« Phaedra Patrick
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Ähnliche
Buch
Drei Mal pro Woche mit älteren Herrschaften Tee trinken, Karten spielen und über die guten alten Zeiten plaudern. So stellt sich die schüchterne Mittfünfzigerin Lydia ihren Job als Leiterin eines Seniorentreffs vor. Tatsächlich muss sie einen erfolglosen Schauspieler mit Hang zum Ladendiebstahl, eine Dame mit mysteriöser Vergangenheit und eine Guerilla-Strickerin in Schach halten. Lydias Aufgabe entwickelt sich immer mehr zum Abenteuer – erst recht, als das Gemeindezentrum geschlossen werden soll, in dem sich die Gruppe immer trifft. Um das zu verhindern, entwickeln sie einen verrückten Rettungsplan. Selbst wenn der scheitern sollte, so hätten sie doch der Welt und sich selbst gezeigt, was noch in ihnen steckt. Sofern ihre Vergangenheit und die Polizei sie nicht vorher einholen ...
Autorin
Clare Pooley hat zwanzig Jahre lang in der Werbebranche gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben und ihrer Familie widmete. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und zwei Border Terriern in London, wo ihre Bücher am heimischen Küchentisch entstehen.
Weitere Informationen zur Autorin finden Sie unter
clarepooley.com, @cpooleywriter und @clare_pooley
Von Clare Pooley bei Goldmann lieferbar:
Montags bei Monica. Roman
Das Wunder von Bahnsteig 5. Roman
Wie man würdelos altert. Roman
Clare Pooley
Wie man würdelos altert
Roman
Aus dem Englischen
von Stefanie Retterbush
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »How to Age Disgracefully« by Bantam Press an imprint of Transworld Publishers, London.
Transworld is part of the Penguin Random House group of companies.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2024
Copyright © der Originalausgabe
2024 by Quilson Ltd
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München,
unter Verwendung einer Umschlagillustration von © Monique Aimee
Redaktion: Regina Carstensen
AB· Herstellung: ik
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-31280-0V001
www.goldmann-verlag.de
Meiner Mutter Janet (80)
und meiner Tochter Matilda (15),
beide lebende Beweise, dass das Alter für unglaubliche, inspirierende Frauen keine Rolle spielt.
Geh nicht mit Sanftmut in diese gute Nacht
Das Alter sollte brennen, rasen, wenn der Tag sich neigt
Wüte, wüte, mit aller Macht!
DYLANTHOMAS
Prolog
Police Constable Penny Rogers hatte dem Kleinbus über mehrere Meilen an der Stoßstange geklebt, mit heulendem Martinshorn und blinkendem Blaulicht, bis er endlich irgendwann auf dem Seitenstreifen der Schnellstraße zum Stehen gekommen war. Waren die da drin denn alle blind und taub? Energisch marschierte sie auf den Bus zu. Ein Blick auf die bunt zusammengewürfelte Truppe, und sie musste sich eingestehen, dass das durchaus sein konnte. Die Mehrheit der Passagiere schien deutlich über siebzig, während die anderen – eigenartigerweise – nicht älter als vielleicht fünf sein konnten.
Die Hydrauliktür des Busses öffnete sich unter unwilligem Zischen und Schuddern, und dahinter, auf dem Fahrersitz, sah man eine Frau um die fünfzig mit hochrotem Gesicht und Schweißperlen auf der Stirn sitzen.
»Wieso hat das so lange gedauert?« Penny kletterte in den Bus. Man merkte ihr die Verärgerung an.
»Tut mir schrecklich leid, Officer. Ich habe nach einer Tankstelle gesucht, dringende Toilettenpause. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie oft die alle aufs Klo müssen.« Die Frau deutete mit einer ruckartigen Kopfbewegung auf ihre Passagiere, die Penny mit verstörender Eindringlichkeit schweigend musterten.
Und als wäre das noch nicht genug, waren die drei Kinder auch noch als Polizisten verkleidet. Wollten die sie auf den Arm nehmen?
»Ein Wunder eigentlich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind«, fuhr die Fahrerin fort. »Und als Sie dann kamen mit Ihrem Blaulicht und die anderen Autos brav Platz gemacht haben, da dachte ich mir, Sie wollen uns vielleicht netterweise zur nächsten Tankstelle eskortieren. Bis mir irgendwann aufgegangen ist, dass Sie natürlich nichts von Kylies voller Windel oder Rubys schwacher Blase ahnen konnten. Und so hartnäckig, wie Sie waren, dachte ich mir, es ist wohl besser, wenn ich eben anhalte.«
»Ich glaube nicht, dass du solche sensiblen medizinischen Daten einfach ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen an Dritte weitergeben darfst, Lydia. Nicht ohne Durchsuchungsbefehl. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?«, fragte eine zierliche, ziemlich streitlustig wirkende Dame, die, wie Penny vermutete, wohl Ruby sein musste.
»Ich bin doch nicht zu schnell gefahren, oder?«, erkundigte die Fahrerin sich besorgt.
»Nein. Wenn überhaupt, sind Sie fast schon gefährlich langsam gefahren. Aber wir haben Anweisung, das Fahrzeug anzuhalten. Einer der Insassen Ihres Busses wird von der Met gesucht. Die haben da wohl einige Fragen«, klärte Penny sie auf.
Die Fahrerin wurde weiß wie eine Wand und wischte sich die Hände nervös an der Hose ab, was verschmierte Schweißflecken auf der hellblauen Jeans hinterließ. Dann fasste sie sich mit den Händen an die Knie und schluckte schwer.
»Oje«, jammerte sie. »Dann hat er mich also angezeigt? Dachte ich mir fast. Mir sind die Sicherungen durchgebrannt, wirklich. Zwanzig Jahre abfällige Bemerkungen, Kritik oder – noch schlimmer – übersehen und ignoriert werden, da ist mir schließlich der Kragen geplatzt. Wobei, vermutlich war ich irgendwie auch selbst schuld.«
»Es war nicht deine Schuld, Lydia«, widersprachen ihr die Passagiere merklich entnervt wie im Chor. Es hörte sich an, als sagten sie das nicht zum ersten Mal, sondern müssten es immer wieder herunterbeten wie ein Mantra.
Die Fahrerin achtete nicht auf sie, zog ein Taschentuch aus dem Ärmel und wischte sich damit die Schweißperlen von der Stirn.
»Die Diashow war der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, wenn Sie so wollen«, krächzte sie mit belegter Stimme. »Nehmen Sie mich jetzt mit? O Gott, was sollen die Mädchen bloß denken? Die eigene Mutter, eine gemeine Verbrecherin …«
Pennys Blick ging zu der Fotokopie in ihren Händen und dann wieder zu der Fahrerin, die leise schluchzend über das Kunstlederlenkrad gebeugt in sich zusammengesunken war, während ihre Wimperntusche sich langsam auflöste. Sie fragte sich, was diese halb gare Kriminelle wohl angestellt haben mochte, hatte aber weder Zeit noch Nerven, der Sache nachzugehen. Sie stiefelte ein paar Schritte den Gang entlang nach hinten und suchte unter den Mitreisenden links und rechts nach einem ganz bestimmten Gesicht.
»Lydia, Liebes«, sagte ein dünner Greis, der ungefähr in der Mitte des Busses saß, zu der schluchzenden Busfahrerin. »Ich glaube nicht, dass sie dich suchen. Die wollen mich. Nach all den Jahren bin ich beinahe froh, dass es endlich vorbei ist. Es war schon fast so was wie eine Sucht. Immer riskanter musste es sein, immer spektakulärer, gefährlicher. Und wofür? Nur für den Kick, für den Augenblick. Ich hätte beim Bingo bleiben sollen, wie alle stinknormalen Pensionäre. Ich glaube, wenn sie mich nicht erwischt hätten, hätte ich nie damit aufgehört. Aber jetzt ist Schicht im Schacht. Auf frischer Tat ertappt.«
Der Mann machte Anstalten, sich auf die Füße zu mühen, und streckte Penny die Hände hin, damit sie ihm Handschellen anlegen konnte. Auf dem Sitz gleich neben ihm lag ein engelsgleicher kleiner blonder Junge, der tief und fest und selig schlief. Der viel zu große Polizeihelm war ihm über die Augen gerutscht. Die Arme hatte er um einen uralten struppigen Köter unbestimmbarer Rasse geschlungen. Fast, als spürte er, was für ein Drama sich um ihn herum abspielte, schlug der Junge unvermittelt die Augen auf und starrte Penny wie vom Donner gerührt an.
»WEG, SCHNELLWEGMITDEMZEUG! SCHEISSE, DASISTEINEVERDAMMTERAZZIA!«, brüllte er, wovon der Hund aufwachte. Der konnte, wie sich schnell herausstellte, ganz schön laut bellen für so einen kleinen Hund. Penny machte vor Schreck einen Satz nach hinten. Der ganze Bus applaudierte.
»Schnauze, Maggie Thatcher!«, kläffte eine alte Frau von ganz hinten. Bestimmt war sie dement, wenn sie nicht mal wusste, wer der aktuelle Premierminister war und dass der nicht mit im Bus saß.
»Bravo, Lucky! Wir haben immer gewusst, dass du es kannst!«, jubelte der Mann, dessen Verhaftung gerade vereitelt worden war. Sobald er Pennys Miene sah, setzte er rasch hinterher: »Sorry, aber das war gerade das erste Mal, dass er überhaupt irgendwas gesagt hat, dabei ist er schon fast fünf. Nicht gerade die feinste Wortwahl, muss ich zugeben. Vielleicht hätte er es besser mit einem ›Hallo‹ versuchen sollen oder einem ›Danke schön‹, aber hey ho. Man nimmt, was man kriegen kann.«
»Was hat er damit gemeint – schnell weg mit dem Zeug?«, wollte Penny wissen und rieb sich die Stirn. Dahinter braute sich gerade ein Spannungskopfschmerz aus der Hölle zusammen. Und die Tequilashots, die sie gestern Abend beim Pub Quiz geext hatte, machten es auch nicht besser. Nächstes Mal sollte die Met ihre Rennerei doch selber machen.
»Wer weiß, meine Liebe. Luckys bisheriges Leben ist ein einziges großes Fragezeichen. Einen unpassenderen Namen hätte man dem Unglücksraben nicht geben können«, sagte der alte Mann. »So oder so, mich hat er damit nicht gemeint. Von meinem unrechtmäßig angeeigneten Diebesgut ist nichts hier an Bord dieses Busses. Na ja, zumindest nicht viel.«
»Hören Sie«, sagte Penny und seufzte schwer. »Ich weiß ja nicht, was Sie angestellt haben, und ich will es auch gar nicht wissen, aber ich bin nicht Ihretwegen hier. Und Ihretwegen auch nicht«, sagte sie mit einem Nicken zu der noch immer leise schluchzenden Busfahrerin.
»Schickt Sie das Jugendamt?«, mischte sich eine Stimme von ganz hinten ein. Ein Junge im Teeniealter mit einem herzallerliebsten kleinen Mädchen auf dem Schoß – der Ähnlichkeit nach vermutlich seine kleine Schwester. »Ich hatte keine andere Wahl, wirklich, und ich schwöre, ich mache es auch ganz bestimmt nie, nie wieder.«
»Wenn die Stadt Sie schickt, können Sie denen schöne Grüße ausrichten, das ist keine Sachbeschädigung, das ist Kunst. Und sie sind allesamt Banausen, wenn sie das nicht selbst sehen«, schimpfte die Frau, die wohl Ruby sein musste. Sie war von Kopf bis Fuß in mehrere Lagen kunterbunter Strickwaren gewickelt.
Das Hämmern in Pennys Schläfen wurde schlimmer. Sie spürte den Kopfschmerz Anlauf nehmen und sich von innen krachend gegen die Schädeldecke werfen.
»Also, ich lasse mich bestimmt nicht noch mal befragen«, erklärte eine andere alte Dame mit türkisblauen Haaren, die frappierend an ein Blaulicht erinnerten. »Wie oft muss ich euch denn noch sagen, die sind alle eines natürlichen Todes gestorben! Ich habe halt besonderes Pech mit meinen Ehemännern.«
»Nicht so viel Pech wie die mit dir«, brummte der alte Mann.
»WÜRDENSIEJETZTBITTEALLEAUFHÖRENMITDENUNGEFRAGTENGESTÄNDNISSEN!«, brüllte Penny verzweifelt. Sie hielt ein fotokopiertes Bild in die Höhe und wedelte damit herum. »Das hier ist die gesuchte Person.«
Schlagartig wurde es totenstill. Wie auf Kommando drehten sich alle um und starrten auf den Sitzplatz gleich hinter der Fahrerin. Den nun leeren Sitzplatz. Nur um augenblicklich zur offenen Bustür zu glotzen und dann hinaus auf die Straße.
Auch Penny drehte sich um. Der Verkehr kroch im Schneckentempo an ihnen vorbei, wie immer, wenn irgendwo ein Polizeiauto stand. Dachten die ernsthaft, sie wüsste nicht, dass sonst kein Mensch so langsam fuhr?
Eine Hupe plärrte, lang und aufgebracht, und es war unübersehbar, wem sie galt.
Wer hätte gedacht, dass jemand in dem Alter noch in der Lage wäre, so fix und behände über den Mittelstreifen zu hechten?
Drei Monate zuvor
Daphne
»Also, wie wollen wir meinen Siebzigsten feiern?«, fragte Daphne Jack. Was natürlich Blödsinn war, schließlich konnte Jack schon seit fünfzehn Jahren keinerlei Fragen mehr beantworten.
Daphne redete nicht nur regelmäßig mit Jack, nein, sie redete auch mit ihren Zimmerpflanzen und den Menschen auf den Fotos, die überall in der Wohnung hingen und standen, und oft brüllte sie auch Schauspieler und Moderatorinnen im Fernsehen an. Mit ihren Nachbarn hingegen redete sie gar nicht. Nie. Es sei denn, es gab irgendwelche dringenden organisatorischen Dinge zu besprechen wie neulich die Renovierung der »Gemeinschaftsteile« des Hauses.
»Gemeinschaftsteile?«, hatte sie Jack empört entgegengeschleudert und dabei den Brief der Hausverwaltung über ihrem Kopf geschwenkt. »Was ist das überhaupt für ein Wort? Klingt, als seien wir hier in einem zweitklassigen Bordell.«
Aber obschon Daphne jeglichen Kontakt zu ihren Nachbarn – und eigentlich allen Menschen – geflissentlich zu vermeiden versuchte, wusste sie alles über sie. Sie hätte jetzt behaupten können, das sei nun mal ihre Art der Nachbarschaftspflege, aber wenn sie ganz ehrlich war, genoss sie das Machtgefühl, das aus dieser ungleichen Informationsverteilung resultierte. Wenn man mehr über andere wusste als sie über einen selbst, hatte man sie in der Hand. Ein wunderbares Gefühl von Sicherheit.
Ihre Informationen bezog Daphne von einer Webseite, über die sie vor ein paar Jahren gestolpert war, mit dem schönen Namen DeineNachbarn.com. Unglaublich, wie viele davon sich in der Hammersmith-Gruppe tummelten. Außerdem hatte Daphne festgestellt, dass man sich ganz herrlich heimlich im Hintergrund halten und die lautstark bekundeten Meinungsverschiedenheiten belauschen konnte, ohne sich selbst je zu erkennen geben zu müssen.
Jeden Morgen, während sie ihren Toast mit Orangenmarmelade aß, scrollte Daphne durch die neuesten Posts und sah auf Aufnahmen von Überwachungskameras, wie Amazon-Pakete dreist vor Haustüren weggeklaut wurden, las hitzige Debatten über Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und Anwohnerparken oder überflog die lange Liste grässlicher, geschmackloser und nicht selten demolierter Dinge, die die Leute zum Verkauf anboten, wohl hoffend, irgendein Idiot werde noch gutes Geld dafür bezahlen.
Gestern Morgen hatten sie sich über Stadtfüchse in die Wolle bekommen. Die Debatte entzündete sich daran, ob Füchse nun gern gesehene Fellfreunde waren, denen man Futter in den Garten stellte, oder räudiges Ungeziefer, das Krankheiten einschleppte und nichts als Chaos hinterließ. Wie immer konnte man gar nicht so schnell gucken, wie die Diskussion eskalierte und aus dem nüchternen, vernünftigen Meinungsaustausch eine mit Flüchen gespickte Schimpftirade wurde, die darin gipfelte, dass einer der Anwohner drohte, Polizei und Tierschutzverein einzuschalten, und der andere, den Nachbarsgarten mit Fuchsscheiße zu überziehen; sollten sie doch mal sehen, wie das war. Schließlich, endlich, nachdem etliche Kommentatorinnen irrtümlich mit »Karen« angesprochen worden waren, sah der Admin sich gezwungen, den ganzen Thread zu löschen, woraufhin alle wieder einträchtig in das allgemeine Gemecker über die Müllabfuhr einstimmten.
Daphne ging auf die Webseite, bemüht, ihre Tastatur nicht vollzukrümeln. Was sie an diesem Geburtstagsmorgen wohl an neuen Gerüchten und Skandalen erwartete?
Aber heute Morgen waren Posts und Kommentare, sehr zu Daphnes Erstaunen und heimlichem Verdruss, allesamt freundlich und handzahm. Eine Reinigungskraft, die Arbeit suchte, eine Frau, die fragte, wie sie ihren Ehering wieder aus dem Siphon unter der Küchenspüle bekam, und jemand, der einen Esstisch mit passenden Stühlen verkaufen wollte, ausgerechnet in einer Gegend, in der die meisten vermutlich gar kein Esszimmer mehr hatten. Daphnes zweitliebste Lieblingsseite war nämlich Immomove.co.uk, und darum wusste sie nur zu gut, dass sämtliche Esszimmer in der näheren und weiteren Umgebung längst in Homeoffices, Fitnessräume oder »Mediacenter« umgewandelt worden waren. Was, fragte sie sich, machte man eigentlich in einem Mediacenter? Meditieren? Mediieren? Wer wusste es schon.
Daphne scrollte weiter durch die neuesten Posts, konnte sich aber partout nicht konzentrieren. Siebzig, ging es ihr immer wieder durch den Kopf. Siebzig. Sie konnte doch unmöglich schon so alt sein, oder? Gefühlt war sie deutlich jünger, und sie mochte es noch immer nicht so recht glauben. Wann zum Kuckuck war sie eine alte Frau geworden? Wo war die Zeit bloß hin?
So hatte Daphne sich das nicht vorgestellt. Eigentlich hatte sie immer gedacht, sie würde ihren Lebensabend im trauten Kreis von Freunden und Familie verbringen. Na ja, vielleicht nicht unbedingt im trauten Kreis, aber immerhin unter Menschen, die sie kannte und denen sie genetisch, aufgrund der gemeinsamen Geschichte oder gemeinsamer Finanzen und Immobilien, irgendwie verbunden war. Und nun saß sie da, mutterseelenallein, stalkte ihre Nachbarn und redete mit den Zimmerpflanzen. Mit allen, außer der Yucca-Palme. Der hatte sie noch nie so recht getraut.
Zugegeben, ihre Wohnung war ein Traum, mit Panoramablick über die Themse, die sich majestätisch wand, mit Hammersmith Bridge zur Rechten und Putney Bridge zur Linken, und am gegenüberliegenden Ufer das imposante Harrods Furniture Depository, das in Lachsrosa und Terrakotta schimmerte. Aber war ihr Appartement ihr anfangs noch wie eine sichere Zuflucht erschienen – ein schützender Kokon –, war es ihr nach und nach zum Gefängnis geworden. Wenn auch einem äußerst luxuriösen. Seit sie vor fünfzehn Jahren hier eingezogen war, ging sie höchstens ein-, zweimal die Woche zum Einkaufen vor die Tür, und in letzter Zeit hatte sie immer häufiger das Gefühl, dass die Wände näher kamen und sie über kurz oder lang zerquetschen würden wie eine Fliege, zusammen mit all ihren Möbeln, bis bloß noch ein winziger komprimierter Würfel übrig blieb.
Vielleicht wurde es Zeit, dass sie sich, zum Teufel mit den Konsequenzen, wieder in die weite Welt hinauswagte und womöglich sogar ein paar neue Freundschaften schloss? Oder wenigstens Bekanntschaften. Und welcher Tag wäre besser für ein solches Abenteuer als ihr eigener Geburtstag?
Das Problem dabei war bloß, Daphne mochte andere Menschen nicht sonderlich, und außerdem hatte sie keinen Schimmer, wie man als Erwachsener neue Freundschaften schloss. Man konnte ja schließlich nicht gut irgendwen fragen, ob er oder sie Hüpfkästchen spielen wollte, oder wildfremden Menschen einfach ein Zitronenbrausebonbon anbieten. Vermutlich würden die sie den Behörden als verrückt melden oder auf DeineNachbarn.com anschwärzen.
Nein, Daphne brauchte einen Plan. Was eigentlich kein Problem sein sollte, schließlich war sie eine der besten Strateginnen, die sie kannte. Stundenlang hatten sie und Jack früher vor detailliert gezeichneten Flowcharts gestanden, den Filzstift im Anschlag, die ganze Sache von allen Seiten beleuchtet, verschiedene Alternativen eingefügt, Eventualitäten berechnet, Notanker eingerichtet, Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Hatten Stresstests gemacht und dann noch mal ganz von vorne angefangen, so lange, bis Namen, Orte, Zeiten, Codewörter, Pfeile und Symbole sie bis in ihre Träume verfolgten, wo sie wild durcheinanderwirbelten und zu neuen Mustern verschmolzen, was manchmal letztendlich sogar den Durchbruch gebracht hatte.
In diesen Momenten, dachte sie, hatte sie Jack wohl am meisten geliebt. An diesen endlos langen Abenden, wenn sie einander Ideen zuspielten wie Bälle bei einem Tennismatch, bis am Ende etwas Spektakuläres, Atemberaubendes entstanden war.
Ob sie das auch ohne ihn hinbekam?
Was für eine Frage! Eigentlich war sie immer schon das Hirn hinter den ganzen Operationen gewesen. Wobei weder Jack noch sonst irgendwer das je zugegeben hätte. Und außerdem war es ja wohl kein allzu kompliziertes Unterfangen, oder? Neue Freunde finden. Sogar eine Fünfjährige kriegte das hin!
Daphne nahm einen Mantel und ihre Handtasche vom Garderobenhaken an der Wohnungstür. Sie würde jetzt erst mal losgehen und ein Whiteboard besorgen und Stifte. Und dann würde sie einen Plan aushecken.
Art
An jedem ersten Montag im Monat rief Art Andrews seinen Agenten an, aber in den vergangenen Monaten war der seltsamerweise zunehmend schwerer und schwerer zu erreichen gewesen. Laut seiner Assistentin, die sich bei jeder Gelegenheit vor ihn warf wie eine Löwenmutter, war er immer gerade in einer wichtigen Besprechung oder am Set oder beim Golfen, und er hatte Art, trotz ihrer anderslautenden Versprechungen, auch bis heute nicht zurückgerufen. Nicht mal sein Hausarzt war so schwer an die Strippe zu bekommen.
Art beschlich langsam der Verdacht, dass er ihm bewusst aus dem Weg ging. Ihn »ghostete«, wie man heutzutage so schön sagte. Er war einer von Jaspars ersten Klienten gewesen, damals, vor beinahe vierzig Jahren, aber er hatte in seiner Karriere mehr »pausiert« als geschauspielert, darum hatte er es nie ganz nach oben auf die Prioritätenliste seines Agenten geschafft. Und jetzt schien er gar nicht mehr auf der Liste zu stehen.
Eine Weile hatte Art noch Nischenaufträge bekommen, als mürrischer alter Mann im Rollstuhl oder als Herzinfarkt- oder Schlaganfallpatient in der einen oder anderen Krankenhausserie. Und er hatte sich einen Namen gemacht mit seiner ungemein überzeugenden Darstellung eines Alzheimerkranken im Endstadium. Wie viele Schauspieler konnten schon auf Kommando glaubhaft sabbern?
Wann immer Art ein Rollenangebot bekam, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass er am Ende der Folge nicht mehr am Leben sein würde. Mehr als einmal war er von einem nahen Verwandten mit einem Kissen erstickt worden. Manchmal war er schon zu Beginn der Geschichte tot. Wieder und wieder hatte er geduldig die Leiche gespielt, über der die Geschwister sich um das Erbe stritten, immer krampfhaft bemüht, nicht zu niesen. Bei seinem letzten Engagement hatte er einen der Weißen Wanderer in einem Game-of-Thrones-Spin-off gespielt und hatte im Pulk der Untoten immer geradeaus schlurfen müssen, um sich in der Nachbearbeitung schließlich im Feueratem eines Drachen in Rauch aufzulösen.
Aber in letzter Zeit ließen auch diese alles andere als glamourösen Verpflichtungen vergeblich auf sich warten.
Art griff nach dem Telefon. Kampflos würde er seine Karriere nicht drangeben. Er wählte die Nummer seines Agenten.
»Shelbourne Talentagentur«, zirpte Jaspars Assistentin.
»Hallo«, sagte Art. »Hier spricht Mr Shelbournes behandelnder Arzt. Es geht um die Ergebnisse seiner letzten Untersuchungen. Ist Mr Shelbourne zu sprechen?«
»Ich weiß gar nichts von irgendwelchen Untersuchungen«, entgegnete die Assistentin. Sie klang zögerlich, fast schon misstrauisch. »Wenn Sie mir Ihre Nummer geben möchten, kann er Sie gleich zurückrufen!«
»Es ist leider ziemlich dringend und etwas … nun ja, heikel«, sagte Art. »Und im OP wartet schon ein Patient wegen einer äußerst verzwickten Phalloplastik auf mich.« Ein Glück, dass Art im Laufe der Jahre in so vielen Folgen von Notaufnahme und Stadtkrankenhaus mitgespielt hatte und dabei gleich reihenweise von arroganten, übergriffigen Ärzten untersucht worden war, dass ihm die Rolle förmlich zuflog. Sollte er eigentlich in seinem Lebenslauf ergänzen.
»Ähm, okay, ich stelle Sie durch, Dr. …«
»Clooney«, antwortete Art. Der erste Name, der ihm in den Kopf kam.
Es wurde kurz still am anderen Ende der Leitung, dann hörte er Jasper sagen: »Dr. Clooney?«
»Hi Jasper. Hier ist Art«, sagte er.
»Ach, Herr im Himmel«, schimpfte sein Agent. »Was soll die Maskerade? Und was Besseres als Clooney ist dir nicht eingefallen?«
»Sorry, mein Lieber«, meinte Art. »Du bist in letzter Zeit bloß ein bisschen schwer zu erreichen gewesen.«
Jaspar seufzte. Kein gutes Zeichen. »Leider hagelt es momentan nicht unbedingt Angebote für dich, altes Haus. Aber du bist ja inzwischen auch« – er unterbrach sich, und Art konnte sich genau vorstellen, wie Jaspar in seinem angestaubten Lebenslauf blätterte – »fünfundsiebzig. Du solltest ein bisschen die Beine hochlegen! Golfspielen lernen! Mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen!«
Art hatte seine Enkelkinder noch nie gesehen, aber das war jetzt kaum der richtige Moment, in dieser alten Wunde herumzustochern.
»Aber ich will noch nicht in Rente gehen, Jaspar«, sagte er. »Ich habe noch so viel zu geben.« Und fast keinen Penny mehr auf dem Konto, dachte er bei sich. »Und fünfundsiebzig ist auch eigentlich noch kein Alter, oder? Der Präsident der Vereinigten Staaten ist älter als ich. Die Queen, Gott hab sie selig, hat bis zu ihrem Tod mit sechsundneunzig noch gearbeitet. Die Rolling Stones sind in meinem Alter, und die spielen vor ausverkauften Stadien.«
»Wetten, die zahlen astronomische Versicherungsbeiträge«, meinte Jasper, obschon das rein gar nichts zur Sache tat.
»Hast du nicht irgendwas für mich?«, fragte Art und gab sich alle Mühe, nicht zu klingen, als bettelte er. Auch wenn er das tat.
»Augenblick mal«, brummte Jaspar mit einem weiteren tiefen Seufzen, aber immerhin hörte man ihn im Hintergrund herumrascheln.
»Nein. Das Einzige, was ich hier sehe, das irgendwie passen könnte, ist eine Talentshow im Fernsehen, für die noch Kandidaten gesucht werden. Mein Hund und ich heißt sie. Sie haben angefragt, ob irgendeiner unserer Künstler vielleicht einen begabten Hund hat und eine kleine Nummer einstudieren möchte. Ich nehme an, du hast nicht zufällig …?«
»Nein«, sagte Art. »Leider nicht.«
»Schade eigentlich. Für die Gewinner gibt’s hunderttausend Pfund Preisgeld. Und dann natürlich die Visibility. Tja, das war’s leider vorerst«, erklärte Jaspar in einem Ton, den Art nur zu gut kannte. Dem Kommen-wir-zum-Ende-dieses-Gesprächs-Ton. »Aber ich rufe dich sofort an, sollte sich irgendwas Passendes ergeben.«
Was, wie Art wusste, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein würde.
»Sicher«, sagte er. »Danke, Jaspar. Wir hören uns.«
Art legte auf und ging zum Schrank mit seinem Notfallwhiskey, bevor ihm siedend heiß einfiel, dass er die Flasche ja längst geleert hatte, irgendwann in einer langen, dunklen Seelennacht, während er Kerry auf Facebook gestalkt hatte. Er zog den Mantel über und machte sich auf den Weg zum Schnapsladen.
Kaum auf die King Street eingebogen, sah Art eine ganz reizende alte Dame, die weißen Haare zu einem unordentlichen Dutt hochgesteckt und mit der Figur einer pensionierten Balletttänzerin, die sich mit einem absurd großen, unhandlichen Whiteboard abmühte. Immer wieder musste sie die Seite wechseln, auf der sie es trug, und schaffte es dabei ein ums andere Mal, arglose Passanten nur um Haaresbreite zu verfehlen.
Art war stets bemüht, anderen zu helfen, die gebrechlicher waren als er oder schlechter dran. Weil es richtig war und er sich dabei wie ein guter Mensch vorkam. Das Problem war bloß, dass ihm immer weniger solcher hilfsbedürftigen Menschen begegneten, bei denen das der Fall war. Aber da, gleich vor ihm, war eine Dame, die beinahe so alt sein musste wie er, und deutlich fragiler.
»Darf ich Ihnen damit ein bisschen unter die Arme greifen?«, fragte er galant, fast schon wie ein Kavalier der alten Schule.
»Sehe ich aus, als würde ich das nicht auch alleine schaffen?«, blaffte sie zurück, so ganz und gar nicht reizend.
»Ehrlich gesagt, ja«, stammelte er.
»Meinen Sie, ich bin unfähig, bloß weil ich alt bin? Oder weil ich eine Frau bin?«, fragte sie streng und fixierte ihn mit einem Blick wie Stahl.
Art überlegte, die Segel zu streichen und die mürrische alte Schabracke ihrem ungewissen Schicksal zu überlassen, aber da er sich nun schon mal vorgenommen hatte, den Kavalier zu spielen und nebenher ein bisschen gutes Karma zu sammeln, wollte er sich nicht so einfach abschütteln lassen.
»Ich halte Sie durchaus nicht für unfähig«, sagte er. »Sie sind bloß deutlich kleiner als das Whiteboard. Ich könnte Ihnen helfen, es nach Hause zu tragen, wenn Sie möchten?«
»Damit Sie wissen, wo ich wohne?«, zischte sie und stierte ihn an, als sei er ein Schwerverbrecher. War er aber nicht. Zumindest nicht so richtig. »Halten Sie mich für beschränkt? Und selbst wenn ich Hilfe bräuchte, würde ich bestimmt niemanden bitten, der sich so« – sie unterbrach sich, musterte ihn von Kopf bis Fuß und entschied sich schließlich für »unmodisch kleidet.«
Unmodisch?!?
»Hören Sie, ich will Ihnen doch nur helfen«, versuchte Art zu beschwichtigen. »Das Ding ist viel zu groß, um es ganz allein zu schleppen.« Art griff nach einer Ecke des Whiteboards, das mittlerweile auf dem Bürgersteig stand.
»FINGERWEGVONMEINEMEIGENTUM!«, zeterte die Alte, woraufhin im Umkreis von zehn Metern mehrere Passanten stehen blieben und ihn böse anguckten.
»Kampf! Kampf! Kampf!«, skandierten zwei Jungs, um sich dann unter hysterischem Gekicher über ihren Fahrradlenker zu krümmen.
»So, und jetzt aus dem Weg, bevor ich die Polizei rufe«, blaffte die Frau.
»Natürlich, Mylady«, sagte Art mit einer Verbeugung, die er damals perfektioniert hatte, als er in einer Folge von Blackadder einen von vielen nicht näher bezeichneten, textlosen Höflingen gespielt hatte, und bücklingte dabei rückwärts vom Bürgersteig auf die Straße, wo er augenblicklich beschimpft und beinahe von einem Mann auf einem Moped mit Deliveroo-Rucksack auf dem Rücken niedergemäht wurde, der aussah wie eine unwahrscheinlich flinke Schildkröte.
Er sah der Frau nach, wie sie die Straße hinunterging, links und rechts Fußgänger aus dem Weg schubsend, und alle drei, vier Meter stehen bleiben musste, um das Whiteboard eben anzustellen, nur um es gleich darauf wieder hochzuwuchten.
Wäre Art nicht so ein netter Mensch gewesen, hätte er ihr gewünscht, dass das Ding ihr auf den Fuß fällt.
Daphne
Zu Hause stellte Daphne das Whiteboard nur ein paar Schritte von ihrem Bett entfernt auf, damit sie es gleich morgens beim Aufwachen sah und ihr Ziel nicht aus den Augen verlor. Sie zog den Deckel von dem dicken schwarzen Marker, den sie gekauft hatte, und schnüffelte daran. Ah, der Duft von Ziel und Zweck, von unendlichen Möglichkeiten, von einer verheißungsvollen Zukunft.
FREUNDEFINDEN, schrieb sie, und das leise Quietschen des Markers auf der Tafel jagte ihr einen vorfreudigen Schauer über den Rücken. Wie ihr das gefehlt hatte, eine neue Herausforderung. Und sie wusste nur zu gut, was für eine Herausforderung das für sie werden würde, vor allem nach dem unerfreulichen Zusammenstoß mit diesem lästigen, penetranten, aufgeblasenen alten Trottel auf der King Street. Bisher hatte sie in ihrem Leben anderen Menschen meist misstraut und stets angenommen, alle müssten bei allem, was sie taten, irgendwelche Hintergedanken haben. Bei ihr war das zumindest immer so gewesen. Aber sie nahm an, um neue Freundschaften zu schließen, musste man anderen Menschen wenigstens ein Quäntchen Vertrauen entgegenbringen. Im Zweifel für den Angeklagten und nicht gleich damit drohen, die Polizei zu rufen.
ANDERENVERTRAUEN, schrieb sie in Blau an die Tafel. Und dann, weil ihr wieder einfiel, wie sie ihren edlen Samariter vorhin angebrüllt hatte, setzte sie noch KEINGEBRÜLL, KEINEBÖSENBLICKE in Klammern dahinter. Dann legte sie den Kopf schief und zog, den Blick auf die Worte an der Tafel geheftet, den Deckel von einem grünen Stift, setzte ein Sternchen hinter BÖSEBLICKE und vermerkte *außer bei schwerwiegender Provokation ganz unten an den Rand.
So, aber woher sollte sie nun die noch Unbekannten nehmen, denen sie vertrauen und die sie nicht böse angucken sollte?
EHRENAMT?, notierte sie mit rotem Stift. Aber Sinn der ganzen Übung musste doch eigentlich sein, Menschen kennenzulernen, mit denen sie zumindest ein paar Gemeinsamkeiten hatte, oder etwa nicht? Sie war viel zu ichbezogen, um ihre Zeit mit Bedürftigen zu verschleudern, und verabscheute aus Prinzip jeden, der das tat. Sie griff zum Whiteboard-Radierer und wischte das Wort wieder weg.
VIELLEICHTEINNEUESHOBBY?, protokollierte sie stattdessen. Aber was? Die einzigen Hobbys, die sie in ihrem Leben gehabt hatte, waren nicht gerade geeignet, neue Freunde zu finden. Eher ganz im Gegenteil.
MITGLIEDINEINEMCLUBWERDEN?, fügte sie der Liste hinzu und musste dann schnauben, weil ihr das Zitat von Groucho Marx wieder einfiel: »In einem Club, der mich aufnimmt, will ich kein Mitglied sein.« Wenn das mal nicht den Nagel auf den Kopf traf.
DASINTERNETNUTZEN?, setzte sie schwungvoll ganz ans Ende, steckte die Deckel wieder auf ihre neuen Stifte und legte sie dann ordentlich in Reih und Glied unten auf die Ablage der Tafel. Anschließend trat sie ein paar Schritte zurück und betrachtete zufrieden ihr farbkodiertes Meisterwerk.
»Das Internet nutzen«, las sie laut vor. Das war doch was, womit sie gleich anfangen konnte, oder?
Daphne liebte das Internet. Die jungen Leute heutzutage hatten ja keine Ahnung, was für Glückspilze sie waren, jederzeit und überall auf dieses unendliche Meer an Informationen zugreifen zu können. In der Anfangszeit von Daphnes Karriere hatte sie oft tagelang die Microfiches ihrer kleinen Leihbücherei durchforsten, möglichen Hinweisen nachgehen, Informanten in die Mangel nehmen und mit Polizeibeamten flirten müssen. Heute waren die meisten Informationen, die sie damals gebraucht hatte, jederzeit frei verfügbar. Man musste nur wissen, wo man danach suchte. Und Daphne wusste immer, wo sie suchen musste. Bestimmt würde das World Wide Web auch die eine oder andere neue Freundschaft für sie ausspucken.
Sie ging zu ihrem ausladenden, quadratischen, lederbespannten Schreibtisch für zwei. Ironisch, irgendwie, hatte sie doch schon lange niemanden mehr, der ihr daran gegenübersaß. Sie klappte den Deckel des Laptops hoch, und sofort erschien die letzte Seite, auf der sie gewesen war: DeineNachbarn.com. Sie schob den Eingabepfeilhoch hoch zur Suchleiste und tippe zwei Worte: Freunde finden.
Sofort erschien eine ellenlange Liste von Posts auf ihrem Bildschirm, die Worte »Freunde« und »finden« mit Fettdruck hervorgehoben. Sie scrollte nach unten, bis ihr Blick an der Frage SINDSIEÜBERSIEBZIG? hängen blieb. Und obschon sie sich längst nicht so alt fühlte, war sie das natürlich neuerdings. MÖCHTENSIENEUEFREUNDSCHAFTENSCHLIESSEN? Bei der lausig formulierten Frage war Daphne sich schon nicht mehr so ganz sicher, aber da sie wild entschlossen war, es zumindest zu versuchen, las sie weiter.
WARUMNICHTMALIMSENIORENCLUBDESMANDELCOMMUNITYCENTREVORBEISCHAUEN? RUFENSIEANODERSCHREIBENSIELYDIAUNTER 07980 344 562, las sie. Ihr Blick ging zum Whiteboard und den Worten MITGLIEDINEINEMCLUBWERDEN? Mehrere Minuten lang starrte sie den Post bloß an und trommelte mit den Fingern auf dem Schreibtisch. Vielleicht sollte sie sich diesen Seniorenclub mal anschauen. Das Mandel Community Centre lag gleich um die Ecke: ein niedriger, heruntergekommener Bau wie ein Geschwür inmitten all der hübschen viktorianischen Häuschen zwischen King Street und der A4. Einmal war keinmal, und wenn es so furchtbar war, wie sie befürchtete, würde es bei einmal und nie wieder bleiben.
Daphnes Blick ging rüber zu ihrem Telefon, das auf dem Art-déco-Konsolentisch im Flur gleich hinter der Wohnungstür stand, fest in der Wand verkabelt. Seit weit über zehn Jahren hatte sie bis auf den gelegentlichen Handwerker mit niemandem mehr telefoniert, und allein bei dem Gedanken, eine Wildfremde anrufen und dabei wie ein geselliger, aufgeschlossener Mensch klingen zu müssen, den man in seinem Club haben wollte, wurde ihr ganz flau. Das würde garantiert eine Blamage.
Nein, eine etwas distanziertere Kommunikationsform wäre fraglos vorzuziehen. Dann konnte sie sich kurzfassen und gleich zum Punkt kommen. Aber mit ihrem Festnetztelefon konnte man keine Nachrichten verschicken. Sie wollte nicht gleich an der ersten Hürde ins Stolpern geraten. Nicht in ihrem Alter – wie leicht konnte man sich da die Hüfte brechen.
Damals, zu ihrer Zeit, hatte Daphne selbstverständlich ein Mobiltelefon gehabt. Das allerneueste Blackberry mit allen Schikanen. Damit hatte sie nicht bloß Nachrichten verschicken können, sondern sogar E-Mails! Aber das hatte sie bei ihrem Umzug hierher entsorgen müssen, am 26. April 2008. Sie hatte den Transporter mit den geretteten Relikten aus ihrem vorherigen Leben auf der Brücke angehalten und ihr heiß geliebtes Blackberry in die kalten, dunklen Fluten der Themse geschleudert.
Und hatte es nie ersetzt. Schließlich hieß es Mobiltelefon. Wenn man nie aus dem Haus ging und mit niemandem redete, wozu brauchte man dann so was?
Aber heute war ihr Geburtstag. Und nicht bloß irgendeiner – nein, ein GROSSER runder. Und darum würde sie sich morgen selbst ein kleines Geschenk gönnen: ein funkelnagelneues Mobiltelefon. Und dann, ja dann würde sie zu einem Treffen von diesem Seniorenclub gehen.
Der Mann im Mobilfunkladen war keiner. Es war ein Junge. Das Gesicht voller Akne, Pickel so dick und gelb, dass man sie am liebsten auf der Stelle ausquetschen wollte. Daphne überlegte, dem Ärmsten ihre Hilfe anzubieten, aber das ginge dann offensichtlich doch etwas zu weit. Mit einem Paukenschlag vom jahrelangen Einsiedlertum zu Handgreiflichkeiten in anderer Leute Gesichter wäre ein bisschen zu viel des Guten. Eins nach dem anderen, Daphne.
Der Milchbubi schaute auf, als sie an den Tresen trat. Grinste der etwa? Sah fast so aus.
»Ich möchte ein Mobiltelefon kaufen«, verkündete Daphne. »Ich denke doch, da bin ich hier richtig.«
»So was von«, antwortete der Junge. Und wie der grinste. »Was für ein Telefon hätten Sie denn gerne?«
Mit der Frage erwischte er Daphne irgendwie eiskalt, aber da sie sich das vor diesem Kind bestimmt nicht anmerken lassen würde, überflog sie rasch die ausgestellten Modelle. Nichts, was auch nur entfernt an ihr altes Blackberry erinnerte. Heutzutage schien alles von Apple zu sein. Woher eigentlich diese Unsitte, neue Technologien nach Zutaten für ein Crumble zu benennen?
»Das Rote«, sagte sie und deutete auf ein dünnes, hochmodern wirkendes Telefon in einer der Vitrinen. Rot hatte sie immer schon gemocht. Das war sehr sie.
»Das ist das iPhone 14 Plus, mit Dualkamerasystem, Gesichtserkennung und 512 Gigabyte Speicherplatz«, dozierte er. »Ich weiß nicht, ob Sie so ein leistungsfähiges Gerät brauchen. Wofür soll es denn sein?«
Was für eine unverschämte Frage. Es ging ja wohl niemanden etwas an, wofür Daphne ihr neues Telefon brauchte. Ein Glück, dass ihr die Worte wieder einfielen, die sie erst tags zuvor an das Whiteboard geschrieben hatte – KEINEBÖSENBLICKE –, also setzte sie rasch ein wohlwollendes Lächeln auf. Dachte sie zumindest. Ein Blick in das erschrockene Gesicht des Jungen, und ihr ging auf, dass ihr das offenbar nicht ganz gelungen war.
»Das ist perfekt«, sagte sie. »Packen Sie es mir ein, ich zahle bar.«
»Whoa! Nicht so schnell«, sagte er und hob die Hände, als sei sie ein nervöses Pferd, das jederzeit zubeißen oder austreten konnte. Und sie hatte plötzlich den beinahe unwiderstehlichen Drang, genau das zu tun. Aber es half nichts. Sie brauchte dieses Telefon.
»Erst müssen Sie einen Vertrag abschließen«, erklärte der Junge, rief eine Seite auf seinem Monitor auf und drehte ihn dann zu ihr um. »Ich brauche Namen, Adresse, Kontoverbindung, Geburtsdatum, Kreditwürdigkeit et cetera, et cetera.«
»Tut mir leid, sehr junger Mann, aber wir kennen uns kaum, und ich werde Ihnen ganz bestimmt nicht all diese privaten und hochsensiblen Daten auf die Nase binden. Das hier ist ein gewöhnlicher Kaufvertrag. Sie sagen mir, was das Telefon kostet, ich gebe Ihnen das Geld bar auf die Hand, stecke das Telefon in die Handtasche und gehe nach Hause. Capisce?«, setzte sie hinterher. Ein kleines Sopranos-Zitat als Sahnehäubchen, sozusagen.
Der Junge seufzte. »Okay, dann also Prepaid. Das wären dann 949 Pfund plus die Kosten für die SIM-Karte.«
Daphne brauchte alles an Selbstbeherrschung, um nicht allzu erschrocken aus der Wäsche zu gucken, während sie rasch überlegte, wie viel Bargeld sie sich morgens aus dem Safe in die Handtasche gestopft hatte.
»Kennen Sie sich damit aus?«, erkundigte sich der Junge.
»Also bitte, wieso denken bloß alle, wenn sie jemanden in meinem Alter sehen, wir seien alle hoffnungslos von gestern, was Technik angeht?«, schimpfte sie. »Das ist Schubladendenken, ganz zu schweigen von unhöflich und herablassend.«
»Dann kennen Sie sich also damit aus?«, meinte der Junge.
»Nein«, gestand Daphne.
Zwei Stunden später hatte der junge Verkäufer eine Migräne und musste sich für den Rest des Tages krankmelden.
Daphne hingegen war nun stolze Besitzerin eines Smartphones, das sie sogar bedienen konnte, hatte gerade ihre erste Textnachricht seit 2008 verschickt – an eine Frau namens Lydia – und war mit Feuereifer dabei, ihr Leben auf den Kopf zu stellen.
Art
Am Gemüseladen angekommen, ging Art ein bisschen langsamer. Draußen auf dem Bürgersteig lockte frisches Obst und Gemüse in riesigen Körben. Glänzende grüne Äpfel, Bananenbüschel, Möhren mit Grün und zu einer Pyramide aufgetürmte knubbelige Kürbisse, bei denen man gar nicht anders konnte, als gleich an Halloween zu denken. Art kribbelte es in den Fingern. Es wäre ein Kinderspiel, einfach die Hand auszustrecken, nach einem der kunstvoll drapierten Pfirsiche zu greifen und ihn in den Ärmel zu stopfen. Er spürte schon fast den samtigen Pelz in der Handfläche.
So war das immer, wenn er zu viel Zeit hatte. Das tat ihm nicht gut. Er kam bloß auf dumme Ideen. Entschlossen ballte er die Hände zu Fäusten und öffnete sie wieder, dann vergrub er sie ganz tief in den Manteltaschen, damit sie keine Dummheiten anstellten.
Wieder einmal verfluchte Art seinen Agenten. Und mit ihm die gesamte Film- und Fernsehindustrie. Wie konnte es sein, dass ein Viertel der Bevölkerung im Vereinigten Königreich über sechzig war und bloß so einen verschwindend geringen Anteil der Rollen ausmachte? Die Produzenten, Regisseure und Autoren schienen wild entschlossen, sämtliche Fältchen aus ihren Hochglanz-Fantasiewelten wegzuretuschieren. Es sei denn, es gehörte irgendwie zur Handlung oder zur Vorgeschichte einer Figur, oder man brauchte einen belanglosen Pappaufsteller-Schurken.
Den Blick stur auf die Straße vor sich geheftet, marschierte Art weiter und schaute erst wieder hoch, als er an der kleinen Ladenzeile vorbei war, an die sich das Bürgerzentrum anschloss. Vor dem Anschlagbrett draußen blieb er stehen. In der Mitte zwischen diversen Ankündigungen und Annoncen prangte ein Plakat mit der Frage
SINDSIEÜBERSIEBZIG?
in Großbuchstaben und fetter schwarzer Schrift.
Und wie er das war. Endlich gehörte er mal zur Zielgruppe. Bestimmt wollten die Sterbeversicherungen verkaufen oder einen Platz im Altersheim. Er las weiter.
MÖCHTENSIENEUEFREUNDSCHAFTENSCHLIESSEN?
WARUMNICHTMALIMSENIORENCLUBDESMANDELCOMMUNITYCENTREVORBEISCHAUEN?
RUFENSIEANODERSCHREIBENSIELYDIAUNTER 07980 344 562.
Vielleicht sollte er sich diesen Club mal anschauen. Wer weiß, womöglich gab es da Essen und Getränke umsonst! Mit ein bisschen Glück vielleicht auch Kuchen. Und wenn er sich ein paar Stunden im warmen Bürgerzentrum herumdrückte, konnte er zu Hause Heizkosten sparen. Es war schon beinahe November, und in seinem Häuschen war es eisig kalt.
Art zog das Handy aus der Tasche und knipste ein Foto von der Notiz, damit er später bei dieser Lydia anrufen konnte. Das kam ihm gerade recht. Etwas zu tun haben und nicht mehr so viel Zeit totschlagen müssen. Er sollte versuchen, William zu überreden, dass er mitkam, als moralische Unterstützung, und damit die nicht dachten, er hätte überhaupt keine Freunde.
William zu überreden war schwieriger gewesen als erwartet. Irgendwann hatte Art die Mitleidskarte ziehen und das ganze peinliche Gespräch mit Jasper Wort für Wort wiederholen müssen, nur um sich daraufhin das brüllende Gelächter seines ältesten Freundes anzuhören, der nur immer wieder »Dr. Clooney« und »Phalloplastik« gestammelt hatte.
Jetzt, zwei Tage später, standen sie auf der anderen Straßenseite, gleich gegenüber vom Bürgerzentrum, auf dem Weg zum Gründungstreffen des neuen Seniorenclubs. Ein ganzer Nachmittag unter Gleichgesinnten bei … ja, wobei eigentlich? Bei irgendwas Interessantem, ganz bestimmt.
Art wollte schon aufgeregt über die Straße hüpfen wie ein kleiner Junge mit einem Luftballon an einer Schnur, da sah er plötzlich etwas – jemanden – aus den Augenwinkeln, und mit einem Mal ging seiner guten Laune schlagartig die Puste aus.
William wollte losgehen, aber Art hielt ihn mit ausgestrecktem Arm davon ab.
»Warte!«, sagte er. »Das ist vermutlich doch keine so gute Idee.«
»Was redest du denn da?«, fragte William. »Du wolltest doch unbedingt hierhin! Und jetzt stehen wir hier. Also, worauf warten wir noch?«
»Es ist wegen ihr«, brummte Art und deutete auf die Frau, die gerade die Türen zum Bürgerzentrum aufzog. »In einem Club, der die aufnimmt, will ich kein Mitglied sein. Die ist gemeingefährlich.«
»Gemeingefährlich?«, wiederholte William und verrenkte sich fast den Hals, um die Frau auf der anderen Straßenseite zu mustern. »Jetzt werde aber nicht albern. Die ist nicht viel jünger als wir. Und zart wie ein Püppchen. Wenn du mich fragst, sieht sie ganz süß aus. Vielleicht ein bisschen überkandidelt.«
William machte einen Schritt vom Bürgersteig auf die Straße, nur um gleich wieder von Art zurückgerissen zu werden.
»Das denkst du«, zischte Art eindringlich. »Aber die ist garstig. Womöglich bösartig. Hat mich schrecklich beschimpft, wegen einer Meinungsverschiedenheit über so eine blöde Tafel.«
»Wo soll das gewesen sein? In einem Klassenzimmer?«, fragte William.
»Nein! Ich bin die King Street langgelaufen, da habe ich gesehen, wie sich jemand mit so einer Aufstelltafel abmüht. Und du weißt ja, ich helfe immer gerne«, erklärte Art. William verdrehte bloß die Augen. Gar nicht nett von ihm.
»Jedenfalls habe ich ihr angeboten, ihr die Tafel nach Hause zu tragen, und sie war furchtbar unhöflich. Und undankbar. Hat sogar gedroht, die Polizei zu rufen«, sagte Art und zog vor Empörung die Schultern hoch. »Und sie hat mich unmodisch genannt.«
William schnaubte und glotzte dann vielsagend auf den Mantel, den Art trug. Den mit dem großen Loch unter der Achsel und dem hartnäckigen Soßenfleck am Aufschlag.
»Jetzt stell dich nicht so an, Art«, sagte er mit versöhnlichem Ton. »Das klingt nach einem Missverständnis, einem dummen Fehler. Bestimmt entschuldigt sie sich gleich erst mal bei dir. So, und jetzt komm schon. Mir wurde Kuchen versprochen.«
»Also schön«, brummte Art widerstrebend. »Aber wenn es keinen Kuchen gibt, gehen wir wieder.«
Lydia
Als sie sich bei der Kommune auf den Job, dreimal die Woche den neuen Seniorenclub zu leiten, beworben hatte, da hatte Lydia sich ausgemalt, sie würde es mit einem Haufen pfiffiger, patenter und engagierter Pensionäre zu tun haben. Die mit dem Fuß zum Takt alter Beatles-Songs klopften, während sie über ihren Alltag im Blitzkrieg und die Nahrungsmittelrationierung plauderten. Die fröhlich wetteifernd Bingo spielten und stundenlang die Köpfe über vielteiligen Puzzles zusammensteckten.
Doch wenn Lydia sich die wild zusammengewürfelte Truppe vor sich so anschaute, wollte die so gar nicht zu den vergnüglichen Szenen in ihrer Fantasiewelt passen.
»Sie müssen entschuldigen, aber soweit ich weiß, sind Hunde hier nicht erlaubt«, sagte sie zu einer Frau, die sich ihr als »Pauline-Schuldirektorin-im-Ruhestand« vorgestellt hatte.
»Soweit Sie wissen«, bemerkte Pauline spitz und guckte sie so böse an, als sei sie ein Schulmädchen und gerade beim Rauchen hinter dem Fahrradschuppen erwischt worden. »Das reicht mir nicht! Zeigen Sie mir, wo genau in der Hausordnung Hunden ist der Zutritt verboten steht. Bis dahin bleibt sie hier.«
Pauline kehrte der stammelnden Lydia abrupt den Rücken, ging rüber zum Tisch und setzte sich auf einen der Stühle. Ihren Hund band sie am Stuhlbein fest.
Übers Wochenende hatte Lydia, als Vorbereitung auf ihren neuen Job, Die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen gelesen, aber sie fühlte sich immer noch heillos überfordert und nicht das kleinste bisschen effektiv. Zum Glück war sie Britin und konnte immer noch auf die gute alte Tradition des Teekochens verfallen, wenn ihr alles zu viel wurde. Eine Gewohnheit, die sie aus dem Effeff beherrschte, und effektiv noch dazu. Lydia goss jedem der sechs Gründungsmitglieder ihres neuen Clubs eine Tasse Tee ein, gab, je nach Wunsch, Milch und Zucker dazu, und schaute zwischendurch auf ihre Namensliste.
Neben Pauline wären da noch Art – Schauspieler, angeblich, wobei er ihr überhaupt nicht bekannt vorkam – und sein Freund William, pensionierter Paparazzo. Dann Ruby, die mit einer riesengroßen ausgebeulten Tasche voller Wollknäuel und Stricknadeln gekommen war. Neben Ruby saß Anna mit ihren grellbunt gefärbten Haaren, die sich mithilfe eines Rollators fortbewegte und dabei gnadenlos alles und jeden niederpflügte, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und dann Daphne, die kaum ein Wort sagte und alle anderen anscheinend für unter ihrem Niveau hielt. Um den Hals trug sie taubeneigroße falsche Smaragde. Ein bisschen deplatziert für einen Nachmittagstee. Es sei denn, man war im Ritz, und das waren sie hier ganz bestimmt nicht.
Endlich hatte Lydia allen eine Tasse Tee und dazu ein ordentliches Stück von ihrem Schoko-Fudge-Kuchen serviert, den sie eigens zur Feier des Tages gebacken hatte, und setzte sich. Alle starrten sie schweigend an, und ihr ging auf, dass man wohl von ihr erwartete, etwas zu sagen.
»Ähm, also, was haben Sie sich denn so vorgestellt, was wir zusammen unternehmen wollen?«, fragte sie. »Wir haben leider ein sehr begrenztes Budget, aber die besten Dinge im Leben gibt’s ohnehin umsonst, nicht wahr?« Sie schaute von einem zum anderen und sah in sechs ausdruckslose Gesichter. »Ich dachte, Bingo vielleicht? Bridge? Oder einen Strickkreis? Malen? Oder wir könnten auch zusammen singen?«
Alle glotzten sie bloß wortlos an.
Bitte, sagt doch irgendwas, dachte sie verzweifelt.
»Ich will ganz ehrlich sein, das ist wirklich hinterletztes Schubladendenken«, bemerkte William. »Warum denken die Leute immer, wenn man erst mal über siebzig ist, will man auf einen Schlag nur noch Bingo spielen und stricken?«
Zustimmendes Gemurmel kam aus dem Sitzkreis, bis auf Ruby, die brummte: »Wieso, habt ihr was gegen Stricken?«
Lydia seufzte. »Tja, was würden Sie denn stattdessen lieber machen?«, fragte sie.
»Fallschirmspringen«, sagte Art, den Mund voller Kuchenkrümel.
»Zielschießen«, schlug Daphne vor.
»Dachte ich mir«, knurrte Art, und der Blick, mit dem Daphne ihn bedachte, war überraschend bösartig für so ein zierliches Persönchen.
»Speed Dating«, warf Ruby ein. »Und Stricken.«
»Karate«, rief William.
»Synchronschwimmen. Oder Go-Kart-Fahren«, sagte Anna und stampfte nachdrücklich mit dem Rollator auf den Boden.
»Ach, Grundgütiger«, schimpfte Pauline.
Was sollte sie dazu sagen? Bei ihrem fast nicht existenten Budget war es unmöglich, von den bürokratischen Hürden mal ganz abgesehen, Senioren am Fallschirm aus einem Flugzeug springen zu lassen.
»Noch Tee?«, fragte sie.
»Gerne, Lydia«, sagte Art und hielt ihr die leere Tasse hin. »Aber meinen Sie nicht auch, nächstes Mal sollten wir auf was Stärkeres umsteigen? Cocktails vielleicht?«
»Grandiose Idee!«, sagte William und schlug Art auf den Rücken, so begeistert, dass der Tee auf die Untertasse schwappte. »Ich könnte meinen Cocktailwagen rüberrollen, sollte Ihr Budget dafür nicht reichen. Ich wohne gleich um die Ecke.«
»Cocktails!«, kreischte Pauline, ehe Lydia einwenden konnte, dass ein Haufen Rentner, die sich mit Spirituosen besoffen, vielleicht nicht ganz das war, was die von der Kommunalverwaltung sich unter einem Seniorenclub vorstellte.
»Alkohol? Nachmittags? Unter der Woche? Hat man so was schon gehört!«, schimpfte Pauline empört weiter.
Lydia sah, wie Daphne die Augen verdrehte, in ihre Handtasche griff und ein Päckchen Zigaretten herausholte. Zunehmend alarmiert beobachtete sie, wie Daphne die Schachtel aufklappte, eine Zigarette herausklopfte und sie in einen Zigarettenhalter steckte – benutzte die überhaupt noch wer? Den klemmte sie sich in den Mundwinkel. Sie wollte die doch nicht etwa anzünden, oder? Ach herrje. Doch, wollte sie.
»MACHENSIEDIEAUS!«, krakelte Pauline. »Widerliche Angewohnheit und noch dazu in öffentlichen Gebäuden strengstens verboten. Wäre ich doch bloß zu Hause geblieben.«
Art flüsterte William was zu, und William gluckste.
»Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann sagen Sie es bitte laut vor der gesamten Klasse!«, kommandierte Pauline, und ihre Augen wurden ganz schmal.
»Danke, Pauline«, sagte Lydia und versuchte, ein bisschen energischer und chefinnenmäßiger zu klingen, als ihr zumute war. »Aber wir sind hier nicht in Ihrem Klassenzimmer.«
»Tja, das sieht man«, bemerkte Pauline pikiert. »Ich wäre bestimmt nicht so oft als beste Schulleiterin ausgezeichnet worden, wenn ich meine Schulklassen so lax geleitet hätte. Haben Sie überhaupt eine richtige Ausbildung? Sie haben nicht mal den Hauch von natürlicher Autorität. Was um alles auf der Welt hat sich die Kommunalverwaltung bloß dabei gedacht, Ihnen die Kursleitung zu übertragen?«
Pauline deutete anklagend mit dem Zeigefinger auf Lydia, und Lydia, die stets bemüht war, immer nur das Beste über andere zu denken, fuhr unvermittelt ein böser, böser Gedanke durch den Kopf.
Fahr zur Hölle, undankbare alte Schachtel, dachte sie, und just im selben Augenblick knirschte es gewaltig, und exakt über Paulines Kopf löste sich ein Teil der Zimmerdecke des Mandel Community Centre und ging krachend auf sie nieder.
Kaum hatte der Staub sich gelegt und in großen Wolken auf den Teetisch getürmt, der mit einem Mal aussah wie eine Szene aus Scarface, war klar: Pauline war tatsächlich zur Hölle gefahren. Oder irgendwo in die Gegend.
Lydia war sich beinahe sicher, dass es unmöglich war, jemanden mit schierer Gedankenkraft ins Jenseits zu befördern, aber das war schon eine ziemlich gruselige Gleichzeitigkeit.
Alle saßen da wie erstarrt, staubbedeckt und die Teetassen noch in der Hand, wie die versteinerten Überreste der unglückseligen Einwohner von Pompeji. Niemand wagte das bedrückende, schockierte Schweigen zu brechen. Pauline lag mit lila angehauchtem Gesicht und offenem Mund stocksteif auf ihrem umgekippten Stuhl, die vernünftigen flachen Schuhe hoch in die Luft gestreckt. Plötzlich regte sich etwas neben ihr, und der kleine Hund, den Lydia schon ganz vergessen hatte, schüttelte sich Staub und Schutt aus dem Fell und fing leise an zu winseln.
Noch ehe Lydia begriffen hatte, was da eben passiert war, und irgendwas unternehmen konnte, hatte Daphne schon das Kommando übernommen – sie rief den Rettungswagen, verscheuchte alle von dem ausgefransten, klaffenden Loch in der Decke und prüfte vergebens, ob Pauline noch irgendwelche Lebenszeichen zeigte.
Man könnte also mit Fug und Recht behaupten, dass Lydias Wiedereinstieg in den Beruf nach zwanzig Jahren Kinderpause nicht unbedingt ein durchschlagender Erfolg gewesen war. Blieb eigentlich nur zu hoffen, dass es ab jetzt besser wurde.
Ziggy
Ziggy dachte ein bisschen wehmütig daran, wie er früher immer gemurrt hatte, wenn er morgens aufstehen und sich fertig machen musste, um um halb neun aus dem Haus zu sein und in die Schule zu gehen. Er hatte ja gar nicht geahnt, was für ein Glückspilz er war.
Montags, mittwochs und donnerstags musste seine Mutter immer schon um fünf zur Arbeit. Zu einem der drei Jobs ihrer, wie sie es scherzhaft nannte, »Portfolio-Karriere«. Da putzte sie frühmorgens Büros, und er musste sich ganz allein um Kylie kümmern.