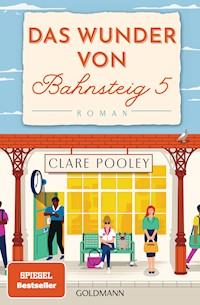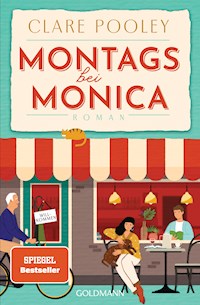
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bezaubernder Wohlfühlroman, der Nähe, Wärme und das Zusammensein feiert!
»Eine Art ›Tatsächlich ... Liebe‹ in Romanform und ein wahres Wundermittel gegen das Gefühl der Einsamkeit in unserer Welt.« Globe and Mail
Julian ist es leid, seine Einsamkeit vor anderen zu verstecken. Der exzentrische alte Herr schreibt sich seine wahren Gefühle von der Seele und lässt das Notizheft in einem kleinen Café liegen. Dort findet es Monica, die Besitzerin. Gerührt von Julians Geschichte, beschließt sie, ihn aufzuspüren, um ihm zu helfen. Und sie hält ihre eigenen Sorgen und Wünsche in dem Büchlein fest, ohne zu ahnen, welch heilende Kraft in diesen kleinen Geständnissen liegt: Als das Notizbuch weiterwandert, wird aus den sechs Findern ein Kreis von Freunden. Monicas Café wird dabei ihr zweites Zuhause, und auf Monica selbst wartet dort das ganz große Glück …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Julian Jessop, ein exzentrischer, einsamer Künstler Ende siebzig, glaubt, dass die meisten Menschen nicht ehrlich zueinander sind. Aber was würde geschehen, wenn sie es wären? Um das herauszufinden, gibt er in einem schlichten grünen Notizheft seine Nöte und Sorgen preis und lässt das Heft einem Café zurück. Dort findet es dessen Eigentümerin, die patente, aber ebenfalls einsame Monica. Sie fügt ihren eigenen Eintrag hinzu und legt das Heft in der Bar gegenüber ab. Nach und nach vertrauen weitere Menschen dem grünen Heft auf seiner Reise geheime Wahrheiten über sich an. Berührt von den Sorgen der anderen, beginnen sie, einander zu helfen. So wird aus sechs Fremden langsam eine liebevolle Gemeinschaft, die das kleine grüne Notizbuch in Monica’s Café zusammenführt – mit überraschenden Konsequenzen für alle.
Autorin
Clare Pooley hat zwanzig Jahre lang in der Werbebranche gearbeitet, bevor sie sich ganz ihrer Familie und ihren Kindern widmete. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern, einem Hund und einem Afrikanischen Zwergigel in London.
Weitere Informationen zur Autorin unter clarepooley.com
Clare Pooley
Montags bei Monica
Roman
Aus dem Englischen
von Stefanie Retterbush
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Authenticity Project« by Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, London. Transworld is part of the Penguin Random House group of companies.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2021
Copyright © der Originalausgabe
2020 by Clare Pooley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München
Umschlagillustration: FinePic®, München
Redaktion: Regina Carstensen
AB • Herstellung: ik
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-27888-5V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Meinem Vater Peter Pooley,
der mich die Liebe zu Worten gelehrt hat
Monica
Sie hatte das kleine Notizbüchlein zurückgeben wollen. Kaum hatte sie es ganz allein auf dem Tisch liegen sehen, hatte sie es sich geschnappt und war seinem flamboyanten Besitzer nachgelaufen. Doch der war wie vom Erdboden verschluckt. Recht flink für sein Alter. Vielleicht wollte er aber auch nicht gefunden werden.
Es war ein schlichtes blassgrünes Schreibheft, wie Monica es früher in der Schule gehabt hatte. Darin hatte sie immer akribisch notiert, was sie als Hausaufgabe aufbekommen hatten. Ihre Freundinnen verzierten ihre Heftchen mit Graffiti oder Herzchen und Blümchen und kritzelten den Namen ihres jeweiligen Schwarms darauf, aber Monica war derartiges Gekrakel ein Graus. Gute Schreibwaren waren ihr heilig.
Vorne auf dem Heft standen zwei Worte, fast wie gemalt, in kalligrafisch verschnörkelter Schönschrift:
Projekt Aufrichtigkeit
Unten in der Ecke das Datum: Oktober 2018. Vielleicht fand sich drinnen eine Adresse oder wenigstens ein Name, damit sie es seinem Besitzer zurückgeben konnte. Es wirkte zwar unscheinbar, strahlte aber trotzdem Bedeutsamkeit aus.
Sie schlug die schmale Kladde auf. Auf der ersten Seite standen nur einige wenige Absätze.
Wie gut kennen Sie die Menschen um sich herum? Wie gut kennen die Sie? Wissen Sie überhaupt, wie Ihre Nachbarn heißen? Würden Sie es merken, wenn etwas mit ihnen nicht stimmte, wenn sie tagelang nicht aus dem Haus gegangen wären?
Ein jeder von uns erzählt Lügen über sein Leben. Was würde passieren, wenn man stattdessen die Wahrheit sagte? Die eine große Wahrheit, die Sie ausmacht, durch die sich alles andere zusammenfügt wie die Teile eines Puzzles? Nicht im Internet, sondern vor den Menschen aus Fleisch und Blut, denen wir täglich begegnen?
Womöglich würde gar nichts passieren. Oder aber die Geschichte könnte Ihr ganzes Leben verändern oder das eines anderen Menschen, den Sie noch gar nicht kennen.
Ich möchte es herausfinden.
Auf der nächsten Seite stand noch etwas, und Monica konnte es kaum erwarten weiterzulesen, aber es war gerade Hochbetrieb im Café, und sie durfte die Zügel jetzt nicht schleifen lassen. Zum Wahnsinn führt der Weg. Entschlossen stopfte sie das Büchlein zu den Speisekarten und den Flyern diverser Zulieferer gleich neben der Theke. Nachher, wenn sie hier fertig war, würde sie es in Ruhe lesen.
In ihrer Wohnung über dem Café kuschelte Monica sich gemütlich aufs Sofa, ein großes Glas Sauvignon Blanc in der einen Hand und das vergessene Schreibheft in der anderen. Die Fragen, die sie heute Morgen gelesen hatte, waren ihr seither nicht mehr aus dem Kopf gegangen und hatten nachdrücklich nach Antworten verlangt. Den ganzen Tag hatte sie mit Leuten geredet, ihnen Kaffee und Kuchen serviert, mit ihnen über das Wetter geplaudert und über den neuesten Promi-Klatsch, aber wann hatte sie das letzte Mal irgendwem etwas erzählt, das wirklich wichtig war? Und was wusste sie eigentlich über diese Menschen, außer ob sie ihren Kaffee mit Milch oder ihren Tee mit Zucker tranken? Sie schlug das Heft auf der zweiten Seite auf.
Ich heiße Julian Jessop. Ich bin neunundsiebzig Jahre alt, und ich bin Künstler. Seit siebenundfünfzig Jahren wohne ich in den Chelsea Studios in der Fulham Road.
Das sind die nackten Tatsachen, aber nun zur Wahrheit: ICH BIN EINSAM.
Oft spreche ich tagelang mit keiner Menschenseele. Manchmal, wenn ich dann doch etwas sagen muss (beispielsweise, weil mich jemand anruft, um mit mir über Restschuldversicherungen zu reden), krächze ich wie ein Rabe, weil meine arme vernachlässigte Stimme sich in meiner Kehle zum Sterben zusammengeringelt hat wie ein Tausendfüßler.
Mit dem Alter bin ich unsichtbar geworden. Was mich besonders trifft, weil ich früher immer im Mittelpunkt stand. Jeder kannte mich. Wenn ich einen Raum betrat, brauchte ich mich nicht vorzustellen. Ich stand einfach nur in der Tür, während ein Raunen und ein Wispern durch den Raum ging, dem dann verstohlene Blicke folgten.
Früher konnte ich stundenlang vor dem Spiegel stehen und bin stets langsam an Schaufenstern vorbeiflaniert, um ganz beiläufig den modischen Schnitt meiner Jacke oder die flotte Haartolle zu bewundern. Wenn mein Spiegelbild mir heute irgendwo unerwartet auflauert, erkenne ich mich darin kaum wieder. Ironie des Schicksals, dass Mary, die das unausweichliche Altern mit so viel mehr Würde und Gelassenheit ertragen hat, gerade einmal sechzig Jahre alt geworden ist, während ich immer noch da bin und meinen allmählichen und doch unaufhaltsamen Verfall tatenlos mit ansehen muss.
Als Künstler beobachte ich die Menschen. Ich studiere Details, analysiere ihre Beziehungen, und ich habe festgestellt, es gibt ein Gleichgewicht der Kräfte. Meist wird ein Partner mehr geliebt, während der andere mehr Liebe gibt. Ich war wohl derjenige, der mehr geliebt wurde. Längst habe ich einsehen müssen, dass ich Mary damals nicht zu schätzen wusste. Mary mit ihrer gewöhnlichen, braven, rotbackigen Hübschheit und der verlässlichen Liebenswürdigkeit. Zu schätzen gelernt habe ich sie erst, als sie nicht mehr da war.
Monica blätterte um und trank einen Schluck Wein. Julian war ihr nicht unbedingt auf Anhieb sympathisch, aber irgendwie tat er ihr leid. Wobei ihm Abneigung vermutlich lieber wäre als Mitleid. Sie las weiter.
Als Mary noch hier wohnte, brummte unser Häuschen nur so vor Leben. Es ging zu wie in einem Bienenstock. Die Nachbarskinder gingen bei uns ein und aus, von Mary großzügig mit Geschichten, guten Ratschlägen, Limonade und Monster-Munch-Chips versorgt. Immer saß mindestens einer meiner weniger erfolgreichen Künstlerfreunde unangekündigt mit am Esstisch, genauso wie mein jeweils neuestes Modell. Mary gab sich stets allergrößte Mühe, den anderen Frauen in meinem Leben mit ausgesuchter Höflichkeit zu begegnen, weshalb ich wohl der Einzige war, dem auffiel, dass sie nie ein Schokolädchen zum Kaffee angeboten bekamen.
Bei uns war unentwegt etwas los. Ein großer Teil unseres trubeligen Lebens spielte sich im Chelsea Arts Club und in den Bistros und Boutiquen in der King’s Road und auf dem Sloane Square ab. Als Hebamme musste Mary ständig Überstunden machen, während ich kreuz und quer durchs ganze Land tingelte, um Menschen zu porträtieren, die sich für wichtig genug hielten, um sich für die Nachwelt verewigen zu lassen.
Seit den späten Sechzigern trafen wir uns jeden Freitagnachmittag um Punkt 17 Uhr auf dem Brompton Cemetery, dem Friedhof gleich bei uns um die Ecke. Mitten zwischen Fulham, Chelsea, South Kensington und Earl’s Court gelegen, war das der ideale Treffpunkt für all unsere Freunde. Um das Grab von Admiral Angus Whitewater versammelt planten wir dann gemeinsam das bevorstehende Wochenende. Den Admiral kannten wir zwar nicht, aber die imposante, auf Hochglanz polierte schwarze Marmorplatte, die seine letzte Ruhestätte zierte, kam uns als Tisch für unsere Drinks gerade recht.
Man könnte fast sagen, ich bin mit Mary gestorben. Telegramme und Briefe mit Beileidsbekundungen habe ich allesamt ignoriert. Ich habe die Farbe auf der Palette eintrocknen lassen, und in einer nicht enden wollenden, unerträglich langen Nacht habe ich alle unvollendeten Leinwände zerstört. Ich habe sie zu kunterbunten Luftschlangen zerrissen und dann mit Marys Schneiderschere zu Konfetti zerschnipselt. Als ich irgendwann doch wieder aus meinem Kokon gekrochen kam, waren fünf Jahre vergangen. Die Nachbarn waren umgezogen, unsere Freunde hatten mich aufgegeben, und mein Agent hatte mich abgeschrieben. Und ich musste einsehen, dass ich unsichtbar geworden war. Ich hatte mich zurückverwandelt. Aus dem schillernden Schmetterling war eine unansehnliche Raupe geworden.
Noch immer trinke ich jeden Freitag am Grab des Admirals Marys Lieblingsdrink, ein Glas Baileys Irish Cream, aber heute prosten mir nur noch die Geister der Vergangenheit zu.
Das ist meine Geschichte. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an und werfen Sie sie in den Müll, wenn Sie wollen. Oder geben Sie sich einen Ruck und schreiben Sie Ihre Wahrheit auf diesen Seiten nieder und reichen Sie das kleine Büchlein weiter. Vielleicht erleichtert es Sie ebenso wie mich.
Was weiter wird, liegt ganz bei Ihnen, werter Leser.
Monica
Natürlich hatte sie ihn gleich googeln müssen. Laut Wikipedia war Julian Jessop Porträtmaler und in den Sechzigern und Siebzigern berühmt und sogar ein kleines bisschen berüchtigt gewesen. Er war ein Schüler von Lucian Freud am Slade gewesen. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken wollte, hatten die beiden sich nicht nur wechselseitig Beleidigungen an den Kopf geworfen, sondern auch wechselseitig die Frauen zugespielt. Lucian hatte den Vorteil der wesentlich größeren Bekanntheit, wohingegen Julian siebzehn Jahre jünger war. Monica musste an Mary denken, wie sie nach einem anstrengenden Arbeitstag, bei dem sie anderen Frauen geholfen hatte, ihre Kinder auf die Welt zu bringen, müde und erschöpft nach Hause gekommen war und sich wieder einmal hatte fragen müssen, wo ihr Mann wohl abgeblieben war. Ehrlich gesagt klang sie ein bisschen wie ein williger Fußabtreter. Warum hatte sie ihn nicht einfach verlassen? Es gab schließlich, sagte Monica sich wie so oft, für eine Frau Schlimmeres, als Single zu sein.
Eins von Julians Selbstporträts hatte sogar kurz in der National Portrait Gallery gehangen, in einer Ausstellung mit dem Titel Die Londoner Schule Lucian Freuds. Monica klickte auf das Bild, um es sich in der Vergrößerung anzusehen, und da war er, der Mann, den sie gestern Morgen im Café gesehen hatte, nur ganz glatt und faltenlos wie eine Rosine, die sich wie von Zauberhand in eine Traube zurückverwandelt hatte. Julian Jessop im Alter von ungefähr dreißig Jahren, mit nach hinten gekämmten blonden Haaren, markanten Wangenknochen, selbstgefälligem Grinsen und durchdringendem Blick aus blauen Augen. Als er sie gestern angeschaut hatte, war es ihr vorgekommen, als blickte er in die Untiefen ihrer Seele. Ein bisschen verstörend, wenn man gerade dabei war, mit dem Gast die diversen Vorzüge von Blaubeermuffins und Millionaire’s Shortbread gegeneinander zu verhandeln.
Monica schaute auf die Uhr. Zehn vor sechs.
»Benji, könntest du hier für eine halbe Stunde die Stellung halten?«, fragte sie ihren Barista. Ohne sein zustimmendes Nicken abzuwarten, schlüpfte sie in ihren Mantel. Im Vorbeigehen ließ Monica den Blick über die Tische schweifen und pickte einen großen Krümel von einem Red Velvet Cupcake von Tisch zwölf. Wie konnte man so was bloß übersehen? Sie trat nach draußen auf die Fulham Road und schnippte einer Taube den Krümel zu.
Sonst setzte sich Monica in den Doppeldeckerbussen eigentlich nie nach oben. Sie brüstete sich immer gerne mit der strikten Einhaltung sämtlicher relevanter Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen, und in einem sich bewegenden Fahrzeug Treppen zu steigen, hielt sie für ein unnötiges Risiko. Aber diesmal brauchte sie einen erhöhten Aussichtspunkt.
Monica beobachtete, wie der blaue Punkt auf Google Maps ganz allmählich die Fulham Road hinunterkroch und auf Chelsea Studios zuhielt. Der Bus machte am Fulham Broadway halt und fuhr dann weiter zur Stamford Bridge. Vor ihr ragte das gigantische, hochmoderne Mekka der Chelsea-London-Fans imposant in den Himmel, und dort, in seinem Schatten, unglaublich eingezwängt zwischen den separaten Eingängen für die Fans des Heim- und des Gastvereins, lag eine entzückende kleine Ansammlung von Atelierwohnungen und winzigen Cottages, verborgen hinter einer unauffälligen Mauer, an der Monica sicher schon hundertmal vorbeigegangen sein musste.
Froh über den zäh fließenden Verkehr versuchte Monica im Vorbeifahren auszukundschaften, welches der Häuschen wohl Julians sein mochte. Eins stand ein wenig abseits und sah etwas verwahrlost aus, fast wie Julian selbst. Sie hätte ihre gesamten Tageseinnahmen darauf verwettet, dass es das sein musste. Etwas, was man in ihrer gegenwärtigen finanziellen Lage nicht leichtfertig machte.
An der nächsten Haltestelle hopste Monica aus dem Bus und schwenkte gleich nach links zum Brompton Cemetery. Es dämmerte bereits, und das letzte Abendlicht warf lange Schatten. Eine herbstliche Kühle lag in der Luft. Der Friedhof war einer von Monicas Lieblingsorten – eine Oase der Ruhe inmitten der hektischen Großstadt. Sie mochte die verschnörkelten, protzigen Grabsteine – die letzte Möglichkeit, es allen noch mal so richtig zu zeigen. Ich nehme deine Marmorgrababdeckung mit dem ungewöhnlichen Bibelzitat und lege einen lebensgroßen Jesus am Kreuz obendrauf. Sie mochte die steinernen Engel, denen nicht selten lebenswichtige Körperteile fehlten, und die altmodischen Namen auf den viktorianischen Grabmälern – Ethel, Mildred, Alan. Wann war es eigentlich aus der Mode gekommen, kleine Jungs Alan zu nennen? Und wo sie gerade dabei war, nannte heutzutage überhaupt noch jemand seine Tochter Monica? Schon 1981 waren ihre Eltern Sonderlinge gewesen, weil sie angesagte Mädchennamen wie Emily, Sophie und Olivia verschmähten und ihre Tochter stattdessen Monica tauften. Monica: ein aussterbender Name. Sie hatte sofort den Filmabspann auf der Kinoleinwand vor Augen: Die letzte Monicanerin.
Schnellen Schrittes lief sie vorbei an den Gräbern gefallener Soldaten und weißrussischer Immigranten und spürte förmlich die im Unterholz versteckten Wildtiere – die grauen Eichhörnchen, die Stadtfüchse und die nachtschwarzen Raben –, die die Gräber bewachten wie die Seelen Verstorbener.
Wo lag der Admiral? Monica ging nach links, immer auf der Suche nach einem alten Mann mit einer Flasche Baileys Irish Cream in der Hand. Warum, wusste sie selbst nicht so genau. Ansprechen wollte sie ihn nicht, zumindest noch nicht. Sie vermutete, es wäre ihm peinlich und unangenehm, so unvermittelt überfallen zu werden. Und sie wollte es sich nicht gleich mit ihm verderben.
Monica steuerte auf den Nordeingang des Friedhofs zu und blieb, wie jedes Mal, kurz am Grab von Emmeline Pankhurst stehen, um ihr in stummer Dankbarkeit zuzunicken. Dann schlug sie einen Bogen und war, einem kaum genutzten Pfad folgend, bereits auf halbem Weg zurück, als sie aus den Augenwinkeln eine Bewegung rechts von sich erhaschte. Dort saß (fast schon frevlerisch anmutend) mitten auf einem gravierten Grabstein Julian höchstselbst mit einem kleinen Glas in der Hand.
Mit gesenktem Kopf huschte Monica vorbei, um nur keine ungewollte Aufmerksamkeit zu erregen. Als er dann, keine zehn Minuten später, verschwunden war, marschierte sie schnurstracks zurück, um die Inschrift auf dem Grabstein zu lesen.
ADMIRAL ANGUS WHITEWATER
AUS DER PONT STREET
GESTORBEN AM 5. JUNI 1963 IM ALTER VON 74 Jahren
GEACHTETER ANFÜHRER, GELIEBTER EHEMANN
UND VATER UND LOYALER FREUND.
UND AUCH BEATRICE WHITEWATER
GESTORBEN AM 7. AUGUST 1964 IM ALTER VON 69 JAHREN
Monica sträubten sich vor Ärger die Nackenhaare. Dem Admiral waren mehrere glühende Adjektive an den Namen gehängt worden, während seine Frau sich mit ihrem Sterbedatum und einem bescheidenen Plätzchen für die Ewigkeit unter dem protzigen Grabstein ihres Gatten begnügen musste.
Monica blieb eine ganze Weile vor dem Grabmal stehen und versuchte, sich die kunterbunte Truppe vorzustellen, die hier früher jede Woche zusammengekommen war, mit Beatles-Frisuren, Miniröcken und Schlaghosen, wie sie miteinander gelacht und diskutiert hatten, und kam sich plötzlich sehr einsam vor.
Julian
Julian schlurfte in Einsamkeit und Alleinsein herum wie in einem Paar alter, schlecht sitzender Schuhe. Aus reiner Gewohnheit eigentlich – in gewisser Hinsicht waren sie sogar ganz bequem. Aber im Laufe der Zeit hatten sie unmerklich begonnen, ihn zu verbiegen, hatten ihm Schwielen und Hühneraugen beschert, die er nun nicht wieder loswurde.
Es war zehn Uhr morgens, also spazierte Julian gerade die Fulham Street entlang. Die ersten fünf Jahre nach Mary war er oft nicht einmal aufgestanden, bis Tage und Nächte zur Unkenntlichkeit miteinander verschmolzen und die Wochen alle Konturen verloren hatten. Irgendwann war er dahintergekommen, von welch immenser Wichtigkeit ein geregelter Tagesablauf war. Wiederkehrende Verrichtungen waren wie Bojen, an die man sich klammern konnte, um nicht unterzugehen.
Jeden Morgen verließ er zur selben Zeit das Haus und spazierte eine Stunde lang durch die Straßen der Nachbarschaft und erledigte seine Besorgungen. Heute stand auf seiner Liste:
Eier
Milch (1 Karton)
Angel Delight, Butterkaramell, wenn mögl. (Angel Delight, ein Dessertcreme-Pulver zum Anrühren, ist immer schwerer zu finden)
Und da heute Samstag war, würde er sich eine Modezeitschrift gönnen. Diese Woche war die Vogue dran. Die war ihm die liebste.
Manchmal, wenn kaum Kundschaft im Laden war, unterhielt er sich mit dem Zeitschriftenverkäufer über die neuesten Schlagzeilen oder das Wetter. An solchen Tagen kam Julian sich beinahe wie ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft vor, jemand mit Freunden und Bekannten, die ihn und seine Meinung schätzten. Einmal hatte er sogar einen Zahnarzttermin ausgemacht, nur so zum Zeitvertreib, weil er nichts Besseres zu tun hatte. Nachdem er die ganze Zeit mit offenem Mund dagesessen hatte und nicht in der Lage gewesen war, auch nur ein einziges Wort mit Mr Patel zu wechseln, der mit diversen Metallinstrumenten und einem Schlauch, der schmatzende Sauggeräusche von sich gab, stundenlang in seinem Mund herumhantiert hatte, war ihm aufgegangen, dass das keine besonders gute Idee gewesen war. Mit klingelnden Ohren von der geharnischten Standpauke über Zahnfleischpflege und dem festen Entschluss, so schnell nicht wiederzukommen, hatte er die Praxis verlassen. Wenn ihm die Zähne ausfielen, dann sollte es eben so sein. Alles andere hatte er ja auch verloren.
Julian blieb kurz stehen, um durch das Schaufenster in Monica’s Café zu spähen, in dem sich bereits die Gäste drängten. Er lief diesen Weg schon so lange Jahre, dass er die vielen verschiedenen Inkarnationen, die der Laden im Laufe der Zeit durchgemacht hatte, lebhaft vor Augen hatte. Es war, als schälte man beim Renovieren übereinandergeklebte Tapetenschichten von den Wänden. Damals, in den Sechzigern, war es der Eel and Pie Shop gewesen, bis Aal aus der Mode gekommen und stattdessen ein Plattenladen eingezogen war. In den Achtzigern hatte an seiner Stelle eine Videothek eröffnet, und danach, bis vor ein paar Jahren, war es ein Süßigkeitenladen gewesen. Aale, Vinyl und VHS-Kassetten – allesamt auf dem Schutthaufen der Geschichte gelandet. Selbst Süßigkeiten galten heutzutage als Teufelszeug, weil die Kinder ihretwegen angeblich immer dicker und dicker wurden. Aber lag das wirklich an den Süßigkeiten? Oder waren nicht eigentlich die Kinder selbst schuld oder vielmehr ihre Erziehungsberechtigten?
Jedenfalls hatte er sich den richtigen Platz ausgesucht, um Projekt Aufrichtigkeit in die weite Welt zu entlassen. Es hatte ihm gefallen, dass er einfach einen Tee mit Milch bestellen konnte, ohne alle möglichen hoch komplizierten Fragen beantworten zu müssen, wie, welche Teeblätter er bevorzugte und was für eine Milch er gerne hätte. Der Tee war ihm in einer Porzellantasse serviert worden, und niemand hatte ihn nach seinem Namen gefragt. Julians Name war es gewohnt, schwungvoll unten auf eine Leinwand gemalt zu werden. Er fühlte sich nicht wohl, so lieblos auf einen To-go-Becher gekritzelt, wie sie es bei Starbucks gemacht hatten. Es schüttelte ihn bei der Erinnerung daran.
Er hatte in einem weichen, abgewetzten Ledersessel gesessen, ganz hinten in einer besonders gemütlichen Ecke von Monica’s Café, umgeben von raumhohen Bücherregalen. Er hatte gehört, wie sie das Eckchen »ihre Bibliothek« nannte. In einer Welt, in der alles elektronisch und Papier ein immer rascher schwindendes Medium war, erschien Julian die Bibliothek, wo sich der Duft alter Bücher mit dem Aroma von frisch gemahlenem Kaffee vermischte, herrlich nostalgisch.
Julian fragte sich, was wohl mit der kleinen Kladde geschehen war, die er hier liegen gelassen hatte. Oft kam es ihm vor, als sei er dabei, spurlos zu verschwinden. Eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft würde sein Kopf schließlich untergehen, versinken und dabei kaum das Wasser kräuseln. Durch dieses Büchlein würde wenigstens ein Mensch ihn sehen – so, wie er wirklich war. Und alles niederzuschreiben war eine Wohltat gewesen, fast wie die Schnürsenkel unbequemer, zu enger Schuhe zu lockern und befreit mit den Zehen zu wackeln.
Er ging weiter.
Hazard
Es war Montagabend, und es wurde langsam spät, aber Timothy Hazard Ford, von allen nur Hazard genannt (wie sollte man auch anders heißen, wenn der zweite Vorname schon »Gefahr« lautete), drückte sich vor dem Nachhausegehen. Aus eigener leidvoller Erfahrung wusste er, dem nach einem ausschweifenden Wochenende unvermeidlich folgenden Tief konnte der nur entgehen, der einfach unbeirrt weitermachte. Langsam, aber beständig hatte er begonnen, den Wochenbeginn immer weiter nach hinten zu verschieben, bis die Wochenenden sich beinahe in der Mitte trafen. Mittwochs gab es nun ein kurzes Intermezzo des Grauens, bevor dann am Donnerstag alles wieder von vorne losging.
An diesem Abend hatte Hazard seine Arbeitskollegen nicht überreden können, mit ihm zusammen die Bars in der City unsicher zu machen, also war er notgedrungen nach Fulham zurückgefahren und hatte einen kleinen Abstecher zu seinem Stammlokal gemacht. Rasch schaute er sich in der spärlich besuchten Weinbar nach einem bekannten Gesicht um. Sein Blick blieb an einer gertenschlanken Rotblonden hängen, die die Beine um den Barhocker geschlungen hatte und sich gerade über den Tresen beugte und dabei wie ein mondäner Knickstrohhalm aussah. Er war sich ziemlich sicher, dass sie die Trainingspartnerin eines der Mädels war, mit dem sein Kumpel Jack mal was hatte. Er hatte keinen Schimmer, wie sie hieß, aber sie war die Einzige hier, die er anquatschen konnte, um sich mit ihr zu betrinken, und das machte sie unversehens zu seiner allerbesten Freundin.
Hazard ging hin und setzte ein Lächeln auf, das speziell für diese Gelegenheiten reserviert war. So etwas wie ein siebter Sinn ließ sie aufschauen, und als sie ihn sah, grinste sie und winkte. Bingo. Funktionierte jedes Mal.
Sie hieß Blanche, wie er dann erfuhr. Blöder Name, dachte Hazard. Und er musste es schließlich wissen. Träge ließ er sich auf den Barhocker neben ihr sinken und griente und nickte, als sie ihn ihren Freunden vorstellte, deren Namen in der Luft um seinen Kopf schwebten wie Seifenblasen, um gleich wieder zu zerplatzen, ohne den geringsten Eindruck zu hinterlassen. Hazard scherte sich einen Teufel darum, wie die hießen, ihn interessierte nur ihre Trinkfestigkeit und vielleicht noch ihre Prinzipien. Je weniger, desto besser.
Sofort verfiel Hazard auf seine übliche Vorgehensweise. Er zog ein dickes Bündel Geldscheine aus der Hosentasche und spendierte mit großer Geste für alle eine Runde, wobei er aus einem Glas gern gleich eine ganze Flasche machte und statt Wein Champagner bestellte. Dann zauberte er einige seiner beliebtesten Anekdoten aus dem Hut. Er ging die lange Liste seiner Bekanntschaften durch, um schließlich über jeden, den ein anderer aus der Runde kannte, einen bunten Kübel Klatsch und Tratsch auszugießen oder gar irgendwelche haarsträubenden Geschichten frei zu erfinden.
Rasch hatte das Grüppchen sich um Hazard geschart, so wie immer eigentlich. Aber als die große Bahnhofsuhr hinter der Theke lauter und lauter tickte, begann die Menge ganz allmählich, sich merklich auszudünnen. Muss los, ist ja erst Montag,hieß es. Oder Hab morgen einen wichtigen Termin.Oder Bin noch was angeschlagen vom Wochenende, ihr kennt das ja.Irgendwann waren nur noch Hazard und Blanche übrig, dabei hatte der Abend gerade erst angefangen. Als Hazard merkte, dass Blanche sich auch auf den Heimweg machen wollte, packte ihn die nackte Panik.
»Hey, Blanche, es ist noch so früh. Hast du nicht Lust, mit zu mir zu kommen?«, schlug er vor und legte ihr vertraulich die Hand auf den Arm. Eine kleine Geste, die alles verhieß und doch nichts versprach.
»Klar, warum nicht?«, antwortete sie, genau wie erwartet.
Die Drehtür der Bar spuckte sie hinaus auf die Straße. Hazard legte einen Arm um Blanche, und gemeinsam gingen sie über die Straße und schlingerten den Bürgersteig entlang, ohne sich darum zu scheren, dass niemand mehr an ihnen vorbeikam.
Die kleine Brünette, die dastand wie ein Verkehrshindernis, übersah er glatt. Bis es zu spät war. Unsanft rasselten sie zusammen, und erst dann merkte er, dass sie ein Glas Rotwein in der Hand gehabt hatte, der ihr nun recht komisch über das Gesicht lief und auf den Boden tropfte, aber, viel ärgerlicher, auch sein teures Savile-Row-Hemd tränkte wie Blut aus einer klaffenden Schnittwunde.
»Ach, verdammte Scheiße«, schimpfte er erbost und stierte die Übeltäterin böse an.
»Hey, Sie haben mich angerempelt!«, protestierte diese indigniert. Ein Tropfen Wein hing zitternd an ihrer Nasenspitze wie ein unwilliger Fallschirmspringer, um dann schließlich doch herunterzufallen.
»Ja, was zum Teufel haben Sie sich auch dabei gedacht, mit einem Glas Wein so dämlich mitten auf dem Gehweg herumzustehen?«, brüllte er sie an. »Können Sie nicht drinnen trinken wie jeder andere normale Mensch auch?«
»Komm, lass es, gehen wir«, säuselte Blanche und kicherte so dümmlich, dass ihm ganz anders wurde.
»Blöde Schlampe«, knurrte Hazard Blanche zu, so leise, dass die so bezeichnete blöde Schlampe ihn nicht hören konnte. Blanche kicherte wieder dämlich.
Mehrere Gedanken kollidierten klirrend in seinem Hirn, als Hazard vom schrillen Klingeln seines Weckers unsanft aus dem Schlummer gerissen wurde. Erstens: Du kannst unmöglich mehr als drei Stunden geschlafen haben. Zweitens: Dir geht’s heute noch beschissener als gestern, was in drei Teufels Namen hast du dir dabei bloß gedacht? Und drittens: Da liegt eine Blondine in deinem Bett. Keine Lust, mich mit der rumzuschlagen, und ihren Namen habe ich auch schon wieder vergessen.
Zum Glück fand Hazard sich nicht zum ersten Mal in dieser unangenehmen Lage wieder. Er haute auf den Wecker. Die Blondine schlief tief und fest weiter, den Mund geöffnet wie eine japanische Sexpuppe. Vorsichtig hob er ihren Arm am Handgelenk hoch und nahm ihn von seiner Brust. Die Hand hing schlaff herunter wie ein toter Fisch. Behutsam drapierte er sie auf den zerwühlten, verschwitzten Laken. So viel von ihrem Gesicht klebte am Kissen – das Lippenrot, das Schwarz um die Augen und das Elfenbein ihrer Haut –, er wunderte sich fast, dass überhaupt noch etwas davon übrig war. Lautlos schlüpfte er aus dem Bett und zuckte schmerzlich zusammen, als sein Hirn von innen gegen den Schädel klackerte wie eine Kugel im Flipperautomaten. Er ging zur Kommode in der Zimmerecke, und tatsächlich, wie erhofft lag da ein kleines Fitzelchen Papier, und darauf gekritzelt stand: SIE HEISST BLANCHE. Teufel auch, er war wirklich gut.
So schnell und leise wie nur irgend möglich sprang Hazard unter die Dusche und zog sich an, suchte einen neuen Zettel und schrieb eine kleine Nachricht:
Liebste Blanche, du hast so friedlich geschlafen und so wunderschön dabei ausgesehen, dass ich dich nicht wecken konnte. Danke für letzte Nacht. Du warst umwerfend. Bitte zieh die Wohnungstür hinter dir ins Schloss, wenn du gehst. Ruf mich an.
War sie umwerfend gewesen? Ab ungefähr zehn Uhr war seine Erinnerung ein wenig verschwommen. Das war, nachdem er seinen Dealer angerufen hatte (der noch schneller geliefert hatte als sonst, wohl weil Montag war). Aber es war ihm eigentlich auch schnurzegal. Er schrieb seine Mobilnummer unten auf den Zettel und vertauschte dabei mit Bedacht zwei Ziffern, damit Blanche ihn unter keinen Umständen erreichen konnte, dann legte er ihn auf das Kissen gleich neben seinen unwillkommenen Gast in der Hoffnung, wenn er wieder nach Hause kam, wären beide spurlos verschwunden.
Noch leicht benebelt trottete er zur U-Bahn. Obwohl schon Oktober war, trug er eine Sonnenbrille, um seine Augen vor dem bleichen Licht des anbrechenden Tages zu schützen. Am Unfallort des Vorabends angekommen blieb er kurz stehen. Er war sich ziemlich sicher, noch ein paar Spritzer blutroten Weins auf dem Bürgersteig ausmachen zu können wie Spuren am Tatort eines Raubüberfalls. Ein ungebetenes Bild drängte sich auf: eine hübsche, kesse Brünette, die ihn so finster anfunkelte, als verabscheute sie ihn aus allertiefstem Herzen. So sahen Frauen ihn sonst nie an. Hazard mochte es nicht, verabscheut zu werden.
Und dann kam ihm unvermittelt ein Gedanke, der ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf: Er verabscheute sich selbst. Abgrundtief. Bis zum allerletzten Molekül, dem winzigsten Atom, dem mikroskopisch kleinsten subatomaren Partikel.
Es musste sich etwas ändern. Nein, alles musste sich ändern.
Monica
Monica hatte immer schon eine Schwäche für Zahlen gehabt. Sie liebte ihre schlichte Logik, die verlässliche Vorhersehbarkeit. Für sie gab es kaum etwas Befriedigenderes, als zwei Seiten einer Gleichung auszugleichen, x aufzulösen und y zu überprüfen. Aber die Zahlen auf dem Papier, die sie jetzt vor sich hatte, wollten partout nicht tun, was sie sollten. Ganz gleich, wie oft sie die Zahlen in der linken Spalte (Einnahmen) auch aufaddierte, sie wollten einfach nicht ausreichen, um die rechte Spalte (Ausgaben) abzudecken.
Monica musste an ihre Zeit als Unternehmensanwältin denken, als Zahlenaddieren zwar eine lästige Pflicht war, aber nichts, das ihr nachts den Schlaf raubte. Jede Stunde, die sie über dem Kleingedruckten eines Vertrags brütete oder endlose Statuten studierte, hatte sie ihren Klienten mit zweihundertfünfzig Pfund in Rechnung gestellt. Heute müsste sie einhundert mittelgroße Cappuccinos verkaufen, um auf dieselbe Summe zu kommen.
Wie hatte sie sich nur so leichtfertig dazu hinreißen lassen können, ihr Leben derart auf den Kopf zu stellen, und das auch noch aus einer Gefühlsduselei heraus? Sie, der es schon schwerfiel, sich mittags für ein Sandwich zu entscheiden, ohne im Kopf die jeweiligen Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und Preise, Nährwerte und Kalorienzahlen zu vergleichen.
Monica hatte jedes einzelne Café auf dem Weg zwischen ihrer Wohnung und der Kanzlei ausprobiert. Da gab es die seelenlosen Hipster-Tempel, die abgewirtschafteten, heruntergekommenen Läden-von-gestern und die austauschbaren, massenproduzierten Ketten. Und jedes Mal, wenn sie wieder viel zu viel Geld für einen überteuerten, bestenfalls mittelmäßigen Coffee to go hingeblättert hatte, sah sie ihr perfektes kleines Café vor Augen. Ohne polierten Beton, Spritzgusskunststoff, Aufputz-Rohrleitungen oder Lampen und Tischen im Industrial Style. Nein, man sollte das Gefühl haben, nach Hause zu kommen. Gemütlich sollte es sein, mit kunterbunt zusammengewürfelten Sesseln, ausgesuchten Kunstwerken an den Wänden, Zeitungen und Büchern. Büchern überall, nicht bloß als Requisiten, sondern zum Schmökern und Mit-nach-Hause-Nehmen, wenn man denn dafür ein anderes daließ. Der Barista würde einen nicht nach dem Namen fragen, um ihn falsch auf einen Becher zu krakeln, er (oder sie, dachte Monica rasch bei sich) wüsste längst, wie der Kunde hieß. Er oder sie würde sich freundlich nach den Kindern erkundigen und nach der ebenfalls namentlich bekannten Katze.
Und dann war sie eines Tages die Fulham Street entlanggelaufen und hatte gesehen, dass der verstaubte alte Süßigkeitenladen, der dort schon seit Ewigkeiten war, endgültig eingepackt hatte. Ein großes Schild im Schaufenster verkündete, der Laden sei ZU VERMIETEN. Irgendein Scherzkeks hatte ein S über das T gepinselt.
Immer wenn Monica fortan an dem leeren Ladenlokal vorbeikam, hörte sie die Stimme ihrer Mutter. In ihren letzten Lebenswochen, die nach Verfall und Krankheit gestunken hatten und begleitet waren vom ständigen Piepsen medizinischer Apparate, hatte sie mit zunehmender Dringlichkeit versucht, ihrer Tochter ihre Lebenserfahrung und ihre gesammelten Weisheiten weiterzugeben, bevor es zu spät war. Hör gut zu, Monica. Schreib dir das auf, Monica. Merk dir das, Monica. Emmeline Pankhurst hat sich nicht an dieses Geländer gekettet, damit wir ein Leben lang ein winziges Rädchen in jemand anderes Getriebe bleiben. Stell selbst was auf die Beine. Schaff etwas Neues. Stell Menschen ein. Sei furchtlos. Tu etwas, das du aus ganzem Herzen liebst. Damit es die Mühe wert ist. Und das hatte sie dann getan.
Monica wünschte, sie hätte das Café nach ihrer Mutter benennen können, aber die hatte Charity geheißen, was so viel wie Nächstenliebe hieß, und ihrem Café einen Namen zu geben, der klang, als bräuchte man dort nichts zu bezahlen, schien ihr keine geniale Geschäftsidee. Es war, wie sich bald herausstellen sollte, auch so schon schwer genug.
Nur weil mit diesem Café für sie ein Traum in Erfüllung gegangen war, hieß das nicht, dass alle anderen es genauso grandios fanden. Oder zumindest genügend Gäste, um die laufenden Kosten zu decken. Ewig konnte sie das fehlende Geld nicht zuschießen. Das würde die Bank nicht zulassen. Ihr pochte der Schädel. Sie ging zur Theke und goss sich den letzten Schluck Rotwein in ein großes Glas.
Sein eigener Herr zu sein war schön und gut, sagte sie ihrer Mutter in Gedanken, und sie liebte dieses Café, in das sie ihr ganzes Herzblut gesteckt hatte, sehr. Aber man war auch sehr einsam. Ihr fehlte der Büroklatsch draußen auf dem Gang oder sich spätabends beim Überstundenmachen mit den Kollegen eine Pizza zu teilen, und sie ertappte sich sogar dabei, wie sie sehnsuchtsvoll an die Team-Building-Maßnahmen, den für Außenstehende unverständlichen Büro-Slang und die unentzifferbaren Drei-Buchstaben-Akronyme dachte. Sie mochte ihre Mitarbeiter im Café, aber die blieben immer ein wenig auf Distanz, weil Monica ihre Chefin und damit für ihren Lebensunterhalt verantwortlich war. Dabei konnte sie sich selbst gerade so über Wasser halten.
Sie musste an die Fragen denken, die der Schreiber – Julian – in dem Büchlein gestellt hatte, das er just auf diesem Tisch liegen gelassen hatte. Eine gute Wahl, wenn man sie fragte. Monica konnte nicht anders, als die Gäste in ihrem Café nach den Sitzplätzen zu beurteilen, die sie sich aussuchten. Wie gut kennen Sie die Menschen um sich herum? Wie gut kennen die Sie?
Sie musste an all die Menschen denken, die heute hier ein und aus gegangen waren, angekündigt vom fröhlichen Schrillen der Türglocke, das jede Ankunft und jeden Abschied begleitete. Sie alle waren mehr denn je mit Tausenden anderer Menschen verbunden, mit Freunden und Freunden von Freunden in den sozialen Netzwerken. Aber fühlten sie sich, genau wie sie, manchmal einsam? Als hätten sie niemanden zum Reden? Nicht über den neuesten Tratsch, welcher Promi aus welchem Haus, von welcher Insel oder aus welchem Dschungel gewählt worden war, sondern über die wirklich wichtigen Dinge im Leben – die Dinge, die einen nachts nicht schlafen ließen. Wie Zahlen, die einfach machten, was sie wollten.
Monica schob die Unterlagen wieder in den Ordner und zog ihr Handy heraus, ging auf Facebook und scrollte ein bisschen durch ihre Timeline. Noch immer keine Spur von Duncan, mit dem sie bis vor ein paar Wochen ein kleines Techtelmechtel gehabt hatte, auf keinem ihrer Social-Media-Accounts. Er hatte sich einfach klammheimlich aus dem Staub gemacht. Duncan, der Veganer, der sich sogar geweigert hatte, Avocados zu essen, weil die Bauern angeblich Bienen zur Bestäubung ausbeuteten, der aber anscheinend überhaupt nichts dabei gefunden hatte, mit ihr ins Bett zu gehen und dann einfach spurlos zu verschwinden. Das Seelenheil einer Biene war ihm wichtiger als ihres.
Sie scrollte weiter, wohl wissend, dass das kein Trost war, sondern eher eine leichte Form von Selbstverletzung. Hayley hatte ihren Beziehungsstatus zu »verlobt« geändert. Wow. Pam hatte ein Status-Update über ihr Leben als Dreifachmutter gepostet, Selbstbeweihräucherung, nur notdürftig als Selbstironie bemäntelt. Und Sally hatte ein Ultraschallbild gepostet – zwölfte Woche.
Ultraschallbilder. Warum postete man so was? Erstens sahen sie alle gleich aus, und zweitens war auf keinem davon auch nur ansatzweise ein Kind zu erkennen. Sie erinnerten eher an eine Wetterkarte, die ein Hochdruckgebiet über der Biskaya ankündigte. Und doch stockte Monica jedes Mal aufs Neue der Atem, wenn sie eins sah, und die Sehnsucht überkam sie wie eine alles verschlingende Woge, dicht gefolgt von nagendem Neid. Manchmal kam sie sich vor wie ein uralter Ford Fiesta, der am Straßenrand schlappgemacht hatte, während alle anderen auf der Überholspur an ihr vorbeibrausten.
Eine HELLO! war auf einem der Tische liegen geblieben, darauf eine reißerische Schlagzeile über die »Babyfreuden« einer Schauspielerin, die noch mit dreiundvierzig Mutter geworden war. Monica hatte in ihrer Kaffeepause kurz in der Zeitschrift geblättert, immer auf der Suche nach Hinweisen, wie die Frau das hinbekommen hatte. Künstliche Befruchtung? Eizellspende? Hatte sie ihre Eier vor Jahren einfrieren lassen? Oder hatte es einfach so geklappt? Wie viel Zeit ihren eigenen Eierstöcken wohl noch blieb? Oder hatten die womöglich schon klammheimlich die Koffer gepackt, um sich demnächst als lustige Rentnerinnen an der Costa Brava zur Ruhe zu setzen?
Monica nahm ihr Weinglas und ging durch das Café, schaltete die Lampen aus und rückte die Stühle zurecht. Dann trat sie hinaus auf die Straße – mit dem Schlüssel in der einen Hand und dem Glas in der anderen –, schloss die Tür zum Café ab und drehte sich dann um, um die Tür zu ihrer Wohnung über dem Café aufzuschließen.
Da, plötzlich, aus heiterem Himmel, rempelte ein Schrank von einem Kerl, eine Blondine wie einen Seitenwagen im Schlepptau, sie so heftig und unvermittelt an, dass ihr die Luft wegblieb und das Glas Wein, das sie in der Hand hielt, ihr mitten ins Gesicht und ihm über das Hemd schwappte. Der Rioja rann ihr in Strömen über die Nase und tropfte ihr vom Kinn. Prustend erwartete sie eine Entschuldigung.
»Ach, verdammte Scheiße«, schimpfte er. Monica verspürte unvermittelt ein heißes Brennen in der Brust. Sie wurde knallrot und biss die Zähne zusammen.
»Hey, Sie haben mich angerempelt!«, protestierte sie indigniert.
»Ja, was zum Teufel haben Sie sich auch dabei gedacht, mit einem Glas Wein so dämlich mitten auf dem Gehweg herumzustehen?«, brüllte er sie an. »Können Sie nicht drinnen trinken wie jeder andere normale Mensch auch?« Sein symmetrisches Gesicht hätte man fast als klassisch schön bezeichnen können, wäre es nicht von diesem hässlichen hämischen Grinsen verzerrt gewesen, das es regelrecht entstellte. Die Blondine zog ihn weg und kicherte dümmlich.
»Blöde Schlampe«, hörte sie ihn zischen, gerade laut genug, dass sie es verstand.
Monica schloss die Tür zu ihrer Wohnung auf. Schatz, ich bin da, rief sie wie immer beim Hereinkommen lautlos in die leere Wohnung und dachte fast, sie müsse weinen. Sie stellte das leere Weinglas auf das Abtropfbrett in ihrer kleinen Küche und wischte sich mit einem Geschirrtuch den Wein aus dem Gesicht. Wie gerne würde sie mit jemandem reden, aber sie wusste beim besten Willen nicht, wen sie anrufen sollte. Ihre Freunde hatten alle genug um die Ohren, die lebten ihr eigenes Leben und konnten sich sicher Schöneres vorstellen, als sich abends ihr wehleidiges Gejammer anzuhören. Ihren Dad anzurufen ging auch nicht, weil Bernadette, ihre Stiefmutter, sie als lästiges Anhängsel aus längst vergangenen Zeiten betrachtete und alles daransetzte, sie von ihrem Dad fernzuhalten. Bestimmt würde sie behaupten, ihr Dad sei beschäftigt, er schreibe und dürfe nicht gestört werden.
Ihr Blick blieb am Couchtisch hängen, wo sie es vor ein paar Tagen hingelegt hatte: das blassgrüne Büchlein mit der Aufschrift Projekt Aufrichtigkeit. Sie nahm es und schlug die erste Seite auf. Ein jeder von uns erzählt Lügen über sein Leben. Was würde passieren, wenn man stattdessen die Wahrheit sagte? Die eine große Wahrheit, dieSie ausmacht, durch die sich alles andere zusammenfügt wie die Teile eines Puzzles?
Ja, warum eigentlich nicht?, dachte sie und wurde ganz kribbelig beim Gedanken daran, einmal etwas völlig Unbesonnenes zu tun. Es dauerte eine Weile, bis sie einen ordentlichen Stift gefunden hatte. Es schien ihr irgendwie respektlos, Julians penible Schönschrift mit dem Gekritzel eines billigen Kulis zu entstellen. Sie blätterte um auf die nächste leere Seite und fing an zu schreiben.
Hazard
Hazard fragte sich, wie viel Lebenszeit er wohl schon über Toilettenkästen kauernd verplempert hatte. Alles zusammen bestimmt ganze Tage. Wie viele potenziell tödliche Bakterien er wohl zusammen mit einer grob gehackten Line feinsten kolumbianischen Schnees geschnupft hatte? Und wie viel davon war tatsächlich Koks gewesen und kein Babypuder, Rattengift oder Abführmittel? Alles Fragen, die ihn nicht mehr lange beschäftigen mussten, denn das hier war das letzte Gramm Koks, das er je kaufen würde.
Hazard kramte in den Hosentaschen nach einem Geldschein, bis ihm wieder einfiel, dass er seinen letzten Zwanziger für die Flasche Wein hingeblättert hatte, die er gerade zur Hälfte ausgetrunken hatte. In diesem schicken, überteuerten Schuppen bekam man für zwanzig Pfund bloß eine fiese Plörre, mehr Spiritus als edles Tröpfchen. Aber das Zeug tat seine Wirkung. Hazard krempelte sämtliche Taschen auf links und fand schließlich einen zusammengefalteten Zettel in der Jacke. Eine Kopie seines Kündigungsschreibens. Tja, wenn das mal nicht Ironie des Schicksals ist, dachte er, riss eine Ecke heraus und drehte daraus ein kleines Röhrchen.
Ein beherztes Schniefen, und Hazard schmeckte das vertraute chemische Brennen im Hals. Ein paar Minuten später wich die nervöse Gereiztheit zwar keiner euphorischen Hochstimmung (die Zeiten waren längst vorbei), aber zumindest einem gelösten Wohlbefinden. Er zerknüllte das Papierröhrchen und warf es zusammen mit dem kleinen Plastiktütchen, in dem das Pulver gewesen war, in die Toilettenschüssel – und sah zu, wie beides von den Untiefen der Londoner Kanalisation verschluckt wurde.
Behutsam nahm Hazard den schweren Porzellandeckel vom Toilettenkasten und lehnte ihn gegen die Wand. Dann zog er sein iPhone – natürlich das allerneueste Modell – aus der Hosentasche und ließ es in das nachlaufende Wasser im Kasten plumpsen. Mit einem satten Klatschen sank es bis auf den Grund. Hazard legte den Deckel wieder auf, das Telefon blieb allein im Dunkeln. So, jetzt konnte er seinen Dealer nicht mehr anrufen. Oder irgendwen, der seinen Dealer kannte. Die einzige Nummer in diesem Handy, die er auswendig konnte, war die seiner Eltern, und das war die einzige Nummer, die er brauchen würde. Obwohl er bei seinem nächsten Anruf bei ihnen einiges gutzumachen hatte.
Rasch warf Hazard einen Blick in den Spiegel und wischte die verräterischen weißen Puderreste aus den entzündeten Nasenlöchern, dann marschierte er zu seinem Tisch zurück, mit etwas schwungvollerem Schritt als vorhin auf dem Weg zur Toilette. Sein Optimismus war teils körperfremden Substanzen zuzuschreiben, aber darunter mischte sich ein Gefühl, das er lange nicht mehr gehabt hatte – ein Anflug von Stolz.
Verdattert guckte er auf den Tisch. Irgendwas war anders. Die Flasche Wein stand noch da, genau wie die beiden Gläser (damit es aussah, als erwartete er noch jemanden, statt sich alleine zu betrinken) und der eselsohrige Evening Standard, den zu lesen er vorgegeben hatte. Aber da war noch etwas. Ein Notizbüchlein. So eins hatte er damals als Frischling auf dem Parkett auch gehabt, vollgekritzelt mit wertvollen Infos, die er in der Financial Times aufgeschnappt hatte, und heißen Tipps, die ihm die Veteranen zugeworfen hatten wie einem etwas überdrehten Hündchen die Leckerlis. Aber auf diesem stand groß Projekt Aufrichtigkeit. Klang nach einem Haufen New-Age-Quark. Er schaute sich um, ob irgendwer, der esoterisch genug aussah, das Heft vielleicht versehentlich liegen gelassen hatte, sah aber nur die üblichen Unter-der-Woche-Trinker, die versuchten, hier den Stress eines langen Arbeitstages hinter sich zu lassen.
Hazard schob das Büchlein bis zur Tischkante, damit sein rechtmäßiger Besitzer es sofort sah, wenn er es suchte, dann widmete er sich wieder der ernst zu nehmenden Aufgabe, die Weinflasche zu leeren. Seine letzte Weinflasche. Denn Koks und Wein gehörten zusammen wie Fish and Chips, wie Spiegeleier und Speck, wie Ecstasy und Sex. Wollte er mit dem einen aufhören, musste er auch das andere drangeben. Gleiches galt für seinen Job. Denn nachdem er jahrelang völlig high die Aktienmärkte gesurft hatte, wusste er nicht, ob er das nüchtern überhaupt noch ertragen konnte. Oder wollte.
Nüchtern. Ein grässliches Wort. Ernst, ehrlich, gemessen, getragen, besonnen, bedeutsam – und so ganz anders als Hazard selbst, der eher ein Fall von »wie der Name schon sagt« war. Hazard legte eine Hand fest auf das rechte Bein, das unter dem Tisch hibbelig auf und ab wippte. Erst da merkte er, dass er mit den Zähnen knirschte. Er hatte seit sechsunddreißig Stunden nicht mehr richtig geschlafen, seit der Nacht mit Blanche. Sein Kopf stand unter Strom und gierte ständig nach neuer Stimulation und kämpfte gegen seinen Körper, der müde war bis auf die Knochen und nach seligem Vergessen lechzte. Hazard war, wie ihm da aufging, das alles müde. Sein Leben und die ständige Achterbahnfahrt aus Aufputsch- und Beruhigungsmitteln, die schmierigen Anrufe bei seinem Dealer, das andauernde Schniefen und das immer heftigere Nasenbluten. Wie hatte es nur so weit kommen können, dass aus einer Line, die er gelegentlich bei Partys gezogen und die ihm das Gefühl gegeben hatte, unbesiegbar zu sein und fliegen zu können, eine Unverzichtbarkeit geworden war, ohne die er es morgens nicht mehr aus dem Bett schaffte?
Da niemand das herrenlose Heft zu vermissen schien, schlug Hazard es auf. Dicht gedrängte Zeilen füllten die erste Seite. Er versuchte, das Geschriebene zu entziffern, doch die Buchstaben tanzten wild durcheinander. Hazard kniff ein Auge zu und probierte es noch einmal. Die Worte setzten sich wieder etwas geordneter zusammen. Er blätterte weiter und sah, dass es zwei verschiedene Handschriften waren – zuerst eine feine verschnörkelte Schönschrift, dann eine bodenständigere, rundere, ordentlichere Alltagsschrift. Hazards Neugier war geweckt. Aber einäugig zu lesen war anstrengend, und man sah dabei aus wie ein Depp, also klappte er das Heft zu und steckte es in die Jackentasche.
Vierundzwanzig Stunden später kramte Hazard in seiner Jacke nach einem Kugelschreiber und stieß dabei unversehens auf die Kladde. Es dauerte eine Weile, bis ihm wieder einfiel, wie sie dorthin gekommen war. Sein Hirn war Matsch. Er hatte hämmernde Kopfschmerzen, und obwohl er müder war denn je in seinem Leben, fand er einfach keinen Schlaf. Er lag im Bett inmitten der verschwitzten, zerknüllten Laken und der Bettdecke, umklammerte das Büchlein und fing an zu lesen.
Wie gut kennen Sie die Menschen um sich herum? Wie gut kennen die Sie? Wissen Sie überhaupt, wie Ihre Nachbarn heißen? Würden Sie es merken, wenn etwas mit ihnen nicht stimmte, wenn sie tagelang nicht aus dem Haus gegangen wären?
Hazard grinste in sich hinein. Er war ein Kokser. Der einzige Mensch, für den er sich interessierte, war er selbst.
Was würde passieren, wenn man stattdessen die Wahrheit sagte?
Ha! Vermutlich würde er verhaftet. Zumindest gefeuert. Wobei, dafür war es jetzt ein bisschen zu spät.
Hazard las weiter. Er mochte Julian irgendwie. Wäre er vierzig Jahre älter oder Julian vierzig Jahre jünger, hätte er sich gut vorstellen können, dass sie Freunde geworden wären, dass sie gemeinsam um die Häuser gezogen, Frauen abgeschleppt und richtig auf die Pauke gehauen hätten. Aber er konnte sich nicht vorstellen, seine eigene Geschichte zu erzählen (die Wahrheit wollte er sich ja nicht einmal selbst eingestehen, geschweige denn sie jemand anderem auf die Nase binden). Aufrichtigkeit war etwas, auf das er verzichten konnte. Seit Jahren schon versteckte er sich davor. Er blätterte um. Wer, fragte er sich, hatte das Büchlein wohl vor ihm gefunden?
Ich heiße Monica, und ich habe dieses Heft in meinem Café gefunden.
Nachdem Sie Julians Geschichte übers Unsichtbarsein gelesen haben, stellen Sie sich ihn bestimmt als typischen Rentner vor, ganz in Beige, mit Strickweste und orthopädischen Schuhen. Nun, lassen Sie sich das gesagt sein, Julian ist alles andere als eine graue Maus. Ich habe gesehen, wie er in das Heft geschrieben hat, das er bei mir liegen gelassen hat, und er ist der am wenigsten unsichtbare Endsiebziger, den man sich nur vorstellen kann. Er sieht aus wie eine Mischung aus Gandalf (nur ohne Bart) und Rupert Bär, mit senfgelbem Hausrock aus Samt und karierter Hose. Es stimmt allerdings, dass er mal ein echt flotter Feger war. Wenn Sie mir nicht glauben, sehen Sie sich sein Selbstporträt an. Es hing eine Weile in der National Portrait Gallery.
Hazard tastete nach seinem Mobiltelefon, um Julians Porträt zu googeln, bis ihm einfiel, dass er es im Wasserkasten des Klosetts in der Weinbar um die Ecke versenkt hatte. Warum bloß hatte er das gestern für einen genialen Geistesblitz gehalten?
Ich bin leider nicht annähernd so interessant wie Julian.
Daran hatte Hazard überhaupt keinen Zweifel. Man merkte es gleich an ihrer peniblen, pedantischen Schrift, dass sie ein verklemmter Albtraum sein musste. Immerhin war sie keine dieser Tussis, die Smileys in die Os malten.
Dies ist meine Wahrheit, öde, vorhersehbar und biologisch vorherbestimmt: Ich möchte ein Kind. Und einen Mann. Vielleicht auch einen Hund und einen Volvo. Die ganze Klischee-Kleinfamilien-Kiste, wenn ich ehrlich bin.
Hazard war nicht entgangen, dass Monica einen Doppelpunkt verwendet hatte. Er wirkte ein wenig deplatziert. Hazard hätte nicht gedacht, dass sich heutzutage irgendwer noch um korrekte Grammatik scherte. Wer schrieb denn überhaupt noch? Von Kurznachrichten und Emojis mal abgesehen.
Herrje, das klingt ja gruselig, wenn es erst mal dasteht. Dabei bin ich Feministin. Ich verwahre mich gegen die Vorstellung, als Frau einen Mann zu brauchen, als bessere Hälfte, als Ernährer und Beschützer oder auch nur als Handwerker im Haus. Ich bin Geschäftsfrau, und ganz unter uns, ich habe einen leichten Kontrollzwang. Bestimmt gäbe ich eine völlig miserable Mutter ab. Aber wie sehr ich mich auch bemühe, die Sache rational zu betrachten, habe ich trotzdem das Gefühl, als hätte sich in meinem Leben ein Loch aufgetan, das täglich größer wird und droht, mich irgendwann mit Haut und Haaren zu verschlingen.
Hazard unterbrach sich kurz und warf zwei weitere Paracetamol ein. Er wusste nicht so recht, ob er gerade den Nerv dazu hatte, sich mit tickenden biologischen Uhren herumzuschlagen. Eine der Tabletten blieb ihm im Hals stecken, und er musste würgen. Auf dem Kissen neben ihm sah er ein einzelnes langes blondes Haar liegen wie ein Souvenir aus einem anderen Leben. Er warf es auf den Fußboden.
Früher war ich Anwältin in einer großen, angesehenen Kanzlei in der City. Ich habe mich dumm und dämlich verdient und brauchte dafür nichts weiter zu tun, als die Frauenquote in den Unternehmen unserer Klienten kosmetisch zu verschönern und mein Leben gegen verrechnungsfähige Stunden einzutauschen. Ich habe mehr oder weniger jeden wachen Augenblick gearbeitet, oft auch abends und an den Wochenenden. Hatte ich ausnahmsweise mal frei, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, um mir den Stress von der Seele zu strampeln. Mein Sozialleben bestand ausschließlich aus Firmenfeiern und Klientenbespaßung. Ich habe mir einzureden versucht, noch mit meinen alten Schulkameraden und Kommilitonen befreundet zu sein, weil ich ja auf Facebook regelmäßig ihre Status-Updates gelesen habe, dabei hatte ich die meisten von ihnen seit Jahren nicht mehr gesehen.
So hätte es ewig weitergehen können, ein Hamster im Laufrad, ein Rädchen im Getriebe, immer brav auf Beförderungen und leere Lobhudeleien aus, wäre da nicht etwas gewesen, was meine Mum zu mir gesagt hat, und eine Frau namens Tanya.
Ich habe Tanya nie persönlich kennengelernt, zumindest nicht dass ich wüsste, aber ihr Leben war nicht so viel anders als meins – eine aufstrebende junge Anwältin in der City, gerade einmal zehn Jahre älter als ich. Eines Sonntags ging sie wie gewöhnlich in die Kanzlei. Ihr Chef war da. Er sagte ihr, sie solle nicht jedes Wochenende im Büro verbringen, sie bräuchte doch auch ein Leben außerhalb der Kanzlei. Das war nur gut gemeint, aber das Gespräch muss Tanya zutiefst erschüttert haben. Ihr muss aufgegangen sein, wie leer und sinnlos das alles war, denn am nächsten Sonntag ist Tanya wieder in die Kanzlei gegangen. Sie fuhr mit dem Aufzug bis ganz nach oben und sprang vom Dach. Die Zeitungen brachten ein Foto von ihr bei ihrer Abschlussfeier, wie sie zwischen ihren stolzen Eltern stand, mit hoffnungsvollem Blick und erwartungsvoll glänzenden Augen.
Ich wollte nicht wie Tanya enden, aber ich musste mir eingestehen, dass ich auf dem besten Weg dazu war. Ich war fünfunddreißig Jahre alt, Single und hatte außer meiner Arbeit nichts vorzuweisen im Leben. Als meine Großtante Lettice dann starb und mir unverhofft ein kleines Erbe hinterließ, legte ich meine nicht unerheblichen Ersparnisse obendrauf und tat zum ersten und bisher einzigen Mal in meinem Leben etwas völlig Unerwartetes: Ich habe gekündigt. Und dann habe ich den Mietvertrag für ein altes, heruntergekommenes Ladenlokal in der Fulham Street unterzeichnet, in dem früher ein Süßigkeitenladen war, und habe dort ein Café eröffnet und es Monica’s genannt.
Monica’s Café. Das kannte Hazard. Das war genau gegenüber von jener Bar, in der er das Büchlein gefunden hatte. Drin gewesen war er noch nie. Ihm waren anonyme Kaffeeketten lieber, wo die ständig wechselnden Baristas sich garantiert nicht merkten, wie oft er morgens verkatert hereingestolpert kam oder wie oft er den Geldschein erst ausrollen musste, eher er ihn über den Tresen reichte. Monica’s wirkte schon von außen so furchtbar gemütlich. So vollwertig. Alles bio und nach Omas Rezepten. In solchen Läden kam Hazard sich vor wie ein verlotterter Liederling. Allein dieser Name. Monica’s. Was für ein Abtörner. So hießen Lehrerinnen. Oder Wahrsagerinnen. Vielleicht auch Puffmütter. Madame Monica, Massagen mit Happy End. Kein guter Name für ein Café. Er las weiter.
Mein eigener Chef zu sein, statt nur ein Name an einer Bürotür, gefangen in einer starren Unternehmenshierarchie, hat durchaus seinen Reiz (und ist eine unglaubliche Lebenserfahrung; sagen wir einfach so, Benji ist nicht mein erster Barista). Aber noch immer ist da dieses klaffende Loch in meinem Leben. Ich weiß selbst, wie altmodisch das klingt, aber insgeheim wünsche ich mir doch, das Märchen würde wahr. Ich will den Prinzen auf dem weißen Ross und ein Happy End mit »Und wenn sie nicht gestorben sind …«.
Tinder habe ich schon ausprobiert. Ich hatte unzählige Dates. Ich gebe mir allergrößte Mühe, nicht zu wählerisch zu sein und darüber hinwegzusehen, wenn er keinen Dickens gelesen oder schmutzige Fingernägel hat oder mit vollem Mund redet. Ich hatte schon etliche Beziehungen, und bei dem einen oder anderen habe ich wirklich gedacht, es könnte etwas Ernstes sein. Aber am Ende habe ich bloß wieder die gleiche lahme Ausrede gehört, das altbekannte: »Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich bin einfach noch nicht reif für eine feste Beziehung …« Bla, bla, bla. Und kein halbes Jahr später bekomme ich auf Facebook die Mitteilung, dass derselbe Kerl seinen Beziehungsstatus zu »verlobt« geändert hat, und ich weiß, es lag DOCH an mir. Aber ich weiß nicht, warum.
Hazard hatte da so eine vage Vermutung.
Mein ganzes Leben lang habe ich Pläne gemacht. Immer hatte ich alles unter Kontrolle. Ich schreibe Listen, ich setze mir Zwischenziele und Termine, ich setze meine Ideen in die Tat um. Aber inzwischen bin ich siebenunddreißig, und die Zeit läuft mir unaufhaltsam davon.
Siebenunddreißig. Hazard ließ sich die Zahl durch das vernebelte Hirn gehen. Da würde er definitiv nach links wischen, obwohl er selbst schon achtunddreißig war. Er musste daran denken, wie er einem seiner Kumpels bei der Bank erklärt hatte, dass sei wie in der Obstabteilung im Supermarkt (auch wenn er nie Obst kaufte oder überhaupt in den Supermarkt ging), man kaufe ja auch nicht die überreifen Pfirsiche, die kurz vorm Verschimmeln sind. Seiner Erfahrung nach machten ältere Frauen bloß Scherereien. Sie hatten Erwartungen. Fixe Vorstellungen. Und meistens dauerte es nicht lange, bis sie mit einem »reden« wollten. Dann wurde man genötigt, sich zu erklären, zu sagen, wo die Beziehung hinführen sollte. Als sitze man in einem 22er Bus in Richtung Piccadilly. Es schüttelte ihn.
Jedes Mal, wenn Freunde auf Facebook ein Ultraschallbild posten, klicke ich auf »Like« und rufe sie an und schwärme überschwänglich, wie sehr ich mich mit ihnen freue, aber eigentlich will ich mich am liebsten heulend in einer Ecke verkriechen und schreien: Warum die und nicht ich? Und dann muss ich ganz dringend in die Kurzwarenabteilung von Peter Jones gehen. Das ist das Einzige, was hilft. Denn wo könnte man besser entspannen als in einer Kurzwarenabteilung, umgeben von Sticktwistdocken, Häkelnadeln und bunten Knöpfen?
Sticktwistdocken? Was sollte das für ein Wort sein? Und überhaupt, eine Kurzwarenabteilung? Gab es die heutzutage noch? Kauften nicht alle lieber die Klamotten von der Stange bei Primark? Was für eine eigenartige Entspannungstechnik. Viel ineffektiver, als einfach einen doppelten Wodka zu exen. Ach, verflixt und zugenäht, warum musste er ausgerechnet jetzt an Wodka denken?
Meine biologische Uhr tickt so laut, dass ich nachts nicht schlafen kann. Dann liege ich da und verfluche meine Hormone, die ein wandelndes Klischee aus mir machen.
So, jetzt ist es raus. Julian hat gefragt. Ich hoffe, ich werde das nicht irgendwann noch bereuen.
Und was Julian angeht, habe ich da so eine Idee.
Natürlich, dachte Hazard. Eine Idee und einen Plan. Er kannte diesen Typ Frau. Bestimmt war der Plan in mehrere Punkte und Unterpunkte gegliedert, nummeriert und mit Pfeilen versehen. Das erinnerte ihn an eine seiner Exfreundinnen, die ihn eines unvergesslichen Abends mit einer PowerPoint-Präsentation zum Stand ihrer Beziehung überrascht hatte – Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren. Danach hatte die Sache recht schnell ein jähes Ende gefunden.
Ich weiß schon, wie ich ihn aus seinem Schneckenhaus locken kann. Ich habe eine Suchanzeige aufgesetzt: Ich suche einen örtlichen Künstler zur Leitung eines wöchentlichen Abendkunstkurses im Café. Die Anzeige habe ich ins Schaufenster gehängt. Nun brauche ich nur noch abzuwarten, bis er hereinspaziert kommt und sich bei mir bewirbt. Das Heft werde ich in der Weinbar gegenüber liegen lassen. Da Sie es mitgenommen haben, liegt es nun ganz in Ihren Händen, wie es weitergeht.
Hazard guckte auf seine Hände. Nicht unbedingt das, was man sich unter »zu treuen Händen« vorstellte. Seit den Exzessen vor vierundzwanzig Stunden, als er auch das Heft gefunden hatte, zitterten sie unaufhörlich. Mist, verdammter. Warum ausgerechnet er? Von allem anderen einmal abgesehen, würde er übermorgen das Land verlassen. Auf dem Weg zur U-Bahn würde er an Monica’s Café vorbeikommen. Er könnte rasch auf einen Kaffee hineingehen, sie sich ein bisschen genauer anschauen und ihr das Büchlein in die Hand drücken, damit sie es an einen geeigneteren Kandidaten weiterreichen konnte.
Gerade als Hazard das Heft zuklappen wollte, sah er, dass Monica noch etwas auf die nächste Seite geschrieben hatte.
PS: Ich habe das Heft in Schutzfolie eingeschlagen, damit nichts drankommt, aber bitte lassen Sie es trotzdem nicht im Regen liegen.
Zu seinem eigenen Erstaunen musste Hazard grinsen.
Julian
Im Hineingehen riss Julian den handgeschriebenen Zettel ab, der an seiner Haustür klebte. Er machte sich nicht die Mühe, ihn zu lesen, er konnte sich schon denken, was draufstand. Und außerdem war alles in Großbuchstaben geschrieben. Fast kam es ihm vor, als schreie der Zettel ihn rüde an. Mit so etwas Niveaulosem gab er sich gar nicht erst ab.
Julian machte sich eine Tasse Tee, setzte sich in einen Sessel, löste die Schnürsenkel, streifte die Schuhe ab und legte die Füße in die ausgebeulte Delle des abgewetzten, brokatbezogenen Fußschemels vor ihm. Dann griff er zu seiner neuesten Hochglanzzeitschrift – Harper’s Bazaar. Die musste er sich sorgfältig einteilen, damit er bis zum Ende der Woche etwas davon hatte. Er vertiefte sich gerade in die Seiten, als er von einem Klopfen am Fenster aus seiner Lektüre gerissen wurde. Er versank noch tiefer im Sessel, damit man seinen Kopf nicht sah. Findig, wie er war, hatte er in den vergangenen fünfzehn Jahren ständig neue Methoden ersonnen, ungewollte Besucher abzuwimmeln. Dass die Fenster im Laufe dieser Zeit kaum geputzt worden waren und nun so trüb waren wie Milchglas, kam ihm dabei zugute. Eine sehr willkommene Folge seiner Faulheit.
Julians Nachbarn wurden indes immer zudringlicher bei ihren lästigen Versuchen, seiner irgendwie habhaft zu werden. Seufzend legte er die Zeitschrift beiseite und griff nach dem Zettel, den man ihm hinterlassen hatte. Er überflog ihn und zog angewidert den Kopf ein, als er das Ausrufezeichen hinter seinem Namen sah.
MR JESSOP!
WIR MÜSSEN REDEN!
WIR (IHRE NACHBARN) MÖCHTEN DAS ANGEBOT DES GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMERS ANNEHMEN.
DAZU BRAUCHEN WIR IHRE ZUSTIMMUNG,
OHNE GEHT ES NICHT.
BITTE SETZEN SIE SICH DRINGENDST MIT PATRICIA ARBUCKLE IN HAUSNUMMER 4 IN VERBINDUNG!