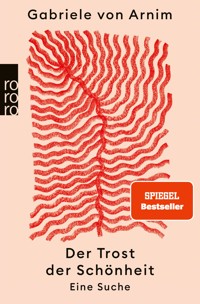21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wahlsiege extremistischer Parteien, Angriffe auf Politiker, offener Antisemitismus und Fremdenhass: Wir spüren immer deutlicher, Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind keine Selbstverständlichkeit, sie müssen geschützt und verteidigt werden. Die Bedrohung ist konkret, doch was ist es eigentlich genau, das es zu verteidigen gilt und wofür es sich zu kämpfen lohnt? Was steht hier und jetzt auf dem Spiel, für jeden Einzelnen und jede Einzelne? Das ist der Ausgangspunkt für 26 Autorinnen und Autoren, die sich dem Thema auf sehr unterschiedliche, dabei durchweg persönliche und stets erhellende Weise widmen. Mit Beiträgen von Gabriele von Arnim, Lukas Bärfuss, Marcel Beyer, Jan Brandt, Dietmar Dath, Thea Dorn, Tomer Dotan-Dreyfus, Can Dündar, Dana Grigorcea, Dinçer Güçyeter, Daniel Kehlmann, Per Leo, Michael Maar, Tanja Maljartschuk, Colum McCann, Matthias Nawrat, Ronya Othmann, Necati Öziri, Kathrin Röggla, Sasha Marianna Salzmann, Jochen Schmidt, Clemens J. Setz, Ulrike Sterblich, Antje Rávik Strubel, Deniz Utlu und Stefanie de Velasco.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Demokratie
Wofür es sich jetzt zu kämpfen lohnt
Über dieses Buch
Wahlsiege extremistischer Parteien, Angriffe auf Politiker, offener Antisemitismus und Fremdenhass: Wir spüren immer deutlicher, Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind keine Selbstverständlichkeit, sie müssen geschützt und verteidigt werden. Die Bedrohung ist konkret, doch was ist es eigentlich genau, das es zu verteidigen gilt und wofür es sich zu kämpfen lohnt? Was steht hier und jetzt auf dem Spiel, für jeden Einzelnen und jede Einzelne? Das ist der Ausgangspunkt für 26 Autorinnen und Autoren, die sich dem Thema auf sehr unterschiedliche, dabei durchweg persönliche und stets erhellende Weise widmen.
Vita
Mit Beiträgen von Gabriele von Arnim, Lukas Bärfuss, Marcel Beyer, Jan Brandt, Dietmar Dath, Thea Dorn, Tomer Dotan-Dreyfus, Can Dündar, Dana Grigorcea, Dinçer Güçyeter, Daniel Kehlmann, Per Leo, Michael Maar, Tanja Maljartschuk, Colum McCann, Matthias Nawrat, Ronya Othmann, Necati Öziri, Kathrin Röggla, Sasha Marianna Salzmann, Jochen Schmidt, Clemens J. Setz, Ulrike Sterblich, Antje Rávik Strubel, Deniz Utlu und Stefanie de Velasco.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
S. 206–216: «The Democracy of Listening» Copyright © 2024 by Colum McCann
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-02309-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Gabriele von Arnim • Vorwort: Warum Demokratie?
Momente der Entscheidung
Thea Dorn • Auf dem Rücken des Fisches
Matthias Nawrat • Orwells Wespe
Daniel Kehlmann • Virtuelle Freunde. Über Künstliche Intelligenz
Die Feinde der offenen Gesellschaft
Necati Öziri • Bestandsaufnahme, Juli 2024
Kathrin Röggla • Verfahren im Schneckentempo
Lukas Bärfuss • Sommer der Demokratie
Deniz Utlu • Du und ich
1. Kapitel
2. Kapitel
Worte in Zeiten des Krieges
Tanja Maljartschuk • Die Krümel der Freiheit
Ronya Othmann • Im Gegenlicht oder Wofür es sich zu streiten lohnt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Per Leo • Boe & Bö Universal Ltd. – die Lobby der Demokratie
Tomer Dotan-Dreyfus • Dämmerung
1. Als wir einmal am Ozean waren
2. Als ich in die Wüste kam
3. Der Rant
4. Carlos’ Antwort
Leben in der real existierenden Demokratie
Jan Brandt • Aus dem Familienalbum einer Schnecke
Trumpstarre
In der Mitte der Menge
Ein paar Stunden Frieden
Schisssteller
Ewige Studenten
Demonstrationsfreiheit
Ladeschütze Brandt
Ulrike Sterblich • Das größte Nichtstun. Zehn Jahre Zuhören in Deutschland
Antje Rávik Strubel • Ausleben. Aushalten.
Jochen Schmidt • Klassentreffen in Thüringen
Die Kunst, Grenzen zu überwinden
Sasha Marianna Salzmann • Das Entweder- oder verlernen
Colum McCann • Die Demokratie des Zuhörens
Marcel Beyer • Lingua franca
Heldinnen und Helden der Freiheit
Can Dündar • Jetzt braucht es Mut
Stefanie de Velasco • Querido Abuelo, …
Dana Grigorcea • Freiheit im Anderswo
Wir haben die Wahl – oder?
Clemens J. Setz • Meine Umwege zur Demokratie
Dietmar Dath • Hände hoch, ihr habt die Wahl!
Eins: Kindersouveränität
Zwei: Hässliche Züge der Zeitgeschichte
Drei: Ein Klecks Demokratietheorie
Vier: Welche Wahl hat hier heute wer?
Michael Maar • Ja. Demokratie
Dinçer Güçyeter • Was hängt da an der Wand?
Beiträgerinnen und Beiträger
Gabriele von Arnim
Vorwort: Warum Demokratie?
Demokratie ist für mich unverzichtbar, weil sie, wie keine andere Staatsform, die Menschenwürde schützt.
Gerhart Baum
Seit achtzehn Jahren, so konstatiert es die Organisation Freedom House, die 1941 unter anderem von Eleanor Roosevelt begründet wurde und seither weltweit die Freiheitsgrade misst, schwinde die Demokratie kontinuierlich dahin. In zweiundfünfzig Staaten seien in den letzten Jahren politische Rechte und bürgerliche Freiheiten beschnitten worden, während es in nur einundzwanzig Nationen Verbesserungen gab.
Wir lesen es täglich. Autoritäre Bewegungen und rechtsextreme Parteien gewinnen immer mehr Zustimmung, immer mehr Wahlen. Und das, obgleich sie bekanntlich Menschenwürde, politische Rechte und Freiheiten eben nicht schützen. Weil es ihnen nicht um das Menschenwohl geht, sondern um Ideologien, nicht um Minderheitenschutz, sondern um Macht. Die nicht die bürgerliche Würde wiederherstellen wollen, sondern den nationalen Stolz, indem sie – hier, in Deutschland – die deutsche Geschichte verharmlosen, Geschichtsbewusstsein denunzieren, perfide Begriffe wie «Schamkultur» und «Schuldkult» in den Diskurs einführen.
Sie wollen stolz sein auf ihr Land – doch ihr Weg zum Stolz ist nicht Weltoffenheit, Menschenfreundlichkeit, Zukunftsgestaltung, sondern Hass, Verunglimpfung, Lügengebilde.
Der Auftrag der Demokratie ist es, Menschenwürde, Meinungsfreiheit, Rechtssicherheit zu schützen, freie Wahlen, Bildung für alle, soziale Sicherheit möglich zu machen. Das sind hohe Werte, hehre Worte, die man leicht sagt und bei denen man nicht immer mitbedenkt, was es bedeutet, sie zu leben. Dass Demokratie kein Zustand ist, sondern ein Prozess, dass man sich auch selbst engagieren muss, um diese Werte zu bewahren. Oft bleiben die Begriffe abstrakt, abgehoben, werden zu selten aus der Sphäre der politischen Theorie in den persönlichen und privaten Alltag geholt.
Deshalb war es die Idee für diesen Band, Demokratie zu erzählen. Von sich zu erzählen. Dem eigenen Verhältnis zur Demokratie, von den unmittelbaren Erfahrungen mit der Freiheit, den Rechten und Pflichten, von der eigenen Lethargie oder dem Engagement, dem Frust und der Lust, in einer Demokratie zu leben.
Denn immer steht der Mensch im Mittelpunkt der Gesellschaft. Er ist die Gesellschaft. «Der Mensch, der einzelne Mensch», schreibt die große Swetlana Alexijewitsch in ihrem Buch «Secondhand-Zeit», «hat mich schon immer fasziniert. Denn im Grunde passiert alles dort.»
Manchmal frage ich Freunde, welches innere Bild sie sehen, wenn sie das Wort «Demokratie» hören.
Bundesrepublik, sagt eine, die in der DDR aufwuchs.
Deutschland in Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg, sagt die Nächste, die den Weg in ein demokratisches Deutschland mitgegangen ist.
Polyphonie, Gemeinschaft, Verantwortung, sagt eine andere, die in korrupten, drogenvergifteten Ländern gelebt hat.
Nächtliche Seelenruhe, weil man keine Angst haben muss, von Schergen abgeholt zu werden, sagt ein Anwalt.
Schulstunden, in denen wir Demokratie geübt haben, sagt eine Amerikanerin, da habe sie gelernt, was Freiheit, Mitsprache und Kompromiss bedeuten.
Als ich mich selbst befragte, tauchten die Worte «Erleichterung» und «Hoffnung» auf. Erleichterung, in einer freien Gesellschaft leben zu können, und Hoffnung, dass sich das System Demokratie hin zu mehr Teilhabe, Gerechtigkeit, Bürgernähe entwickelt.
Denn nein, Demokratie ist nicht die gute Fee, die mit einem Zauberstab die Welt heilt. Auch hier erleben wir verletzende Wirklichkeiten. Kinderarmut, sexualisierte Gewalt, Femizide, eine skandalöse Schere zwischen Arm und Reich, um nur einige Beispiele zu nennen. Wahrlich nicht immer wird die Würde des Menschen gewahrt. Weil es uns so oft nicht gelingt, den anderen und uns als Mensch wahrzunehmen, uns gemeinsam als Menschen wahrzunehmen und sich gegenseitig zu würdigen.
Demokratie muss man lernen, muss man üben. Als Bürger und auch als Politikerin. Wenn Volksvertreter die Verunsicherung und oft auch Überforderung so vieler nicht wahrnehmen und nicht darauf reagieren, wenn sie in dieser «Zeit der Verluste» (Daniel Schreiber), in der immer mehr Gewissheiten verloren gehen, Beschlüsse nicht gründlich erklären, driftet ein Teil ihrer Wähler ab in Systemverweigerung und Radikalität.
Oft wissen diejenigen am besten, was Demokratie bedeutet, die Diktaturen entkommen sind. Weil sie endlich frei atmen und denken und singen und reden können. Weil sie nicht mehr tagtäglich befürchten müssen, staatlicher Willkür ausgesetzt zu sein. Und oft begreifen wir erst, wie privilegiert wir sind, in einer Demokratie zu leben, wenn Geflüchtete erzählen aus ihren Leben in ihren Ländern. Begreifen erst, was Freiheit ist, wenn Unfreiheit ein Gesicht bekommt, eine Geschichte. Wenn Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsverteidigerinnen drangsaliert und inhaftiert werden, gedemütigt und gefoltert. Wenn Respekt und Achtung nichts gelten. Denn sie sind die Hüter der Menschenwürde – gemeinsam mit Rücksicht und Anerkennung, Meinungsfreiheit und Rechtssicherheit. Und mit Fantasie, einer inneren Vorstellungskraft, um andere Leben denken, anderes Denken verstehen zu können, Diversität als Lebendigkeit zu empfinden.
All das, wovor die extreme Rechte sich zu fürchten scheint.
Eine Weile habe ich gedacht, der Rückwärtsruck sei der Aufstand derjenigen, die ahnen, dass ihre Zeit vorbei ist. Die sich noch einmal krakeelend wehren müssen, bevor sie untergehen. Ein raues, radikales Zwischenspiel.
Inzwischen fürchte ich, dass dieses Zwischenspiel das eigentliche Stück von der Bühne fegen könnte, wenn wir nicht endlich anfangen, die Wirklichkeit zu sehen. Menschenwürde zu leben. Alle. Wenn wir nicht gemeinsam versuchen, der Zukunftslust Kraft einzuatmen, um die Zukunftsangst zu vertreiben.
Menschen machen Systeme. Und Systeme prägen Menschen, verändern sie. Und verführen dazu – in Diktaturen aus Angst, in Demokratien aus Lethargie –, nicht richtig hinzuschauen, nicht wahrzunehmen, was in der Gesellschaft geschieht, in der man lebt.
Und gerade jetzt, angesichts von so vielen Krisen, Kriegen, Gewalt und Unterdrückung, möchte man ja immer wieder innerlich abschalten.
Der Weltschrecken ist zu groß, um ihn auszuhalten, sagt mir ein Freund.
Aushalten ist die einzige Chance, damit umgehen zu können, sagt eine Freundin.
Viele überlassen sich der Furcht – alles zu unübersichtlich, zu komplex, zu bedrohlich – und üben sich in Wirklichkeitsabwehr. Selbst die Klimakatastrophe, längst wissenschaftlich erforscht und belegt und überall spürbar, wird wider alle Fakten geleugnet. Man fürchtet sich vor allem vor Geflüchteten und Wohlstandsverlust, röhrt wie ein wunder Hirsch, fällt gar das Wort «Verzicht». Fragen wir doch mal anders, fragen wir, wie wir uns die Zukunft wünschen, in der wir leben wollen, und suchen dann nach Wegen dorthin. Uns fehlt ein gemeinsames Narrativ, eine verlockende Erzählung von dem, was wir doch (fast) alle wollen: Frieden, Gewaltfreiheit, grüne Städte, soziale Gerechtigkeit usw. Womöglich ließe sich ja doch ein mehrheitsfähiges gemeinsames Wollen formulieren und danach handeln. Wenn auch Verzicht dazugehört, würden wir vielleicht auch Verzicht akzeptieren. Die ewigen Beschwichtigungen der Regierung, dass die Probleme gelöst würden, ohne dass uns etwas abgefordert werde, sind doch reine Augenwischerei. Und wer kann denn bitte mit Sicherheit sagen, dass uns für ein gemeinsames Ziel nicht etwas zuzumuten ist? Dass wir uns nicht etwas zumuten würden?
Der Umweltforscher Wolfgang Sachs spricht in einem «Zeit»-Interview von gesellschaftlicher Genügsamkeit, manchmal spricht er in seiner vorsichtigen Art auch von «frugalem Wohlstand».
Schon Mahatma Gandhi hat gesagt: «The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.»
Es gäbe so viele Möglichkeiten, und es gibt so viele Ansätze und Projekte, sich fantasievoll einer Zukunft zuzuwenden, stattdessen aber wird auf so vielen Ebenen im öffentlichen Raum – nicht nur beim Klima – in den gesellschaftspolitischen Rückwärtsgang geschaltet.
Als ich kürzlich einer Freundin erzählte, dass die Berliner Senatorin für Verkehr auf die Frage, warum sie entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen den Autoverkehr nicht eindämmen wolle, geantwortet habe: «Weil wir in einem freiheitlichen Land leben», hat sie wutentbrannt aufgeheult. Und ich musste an einen Freund denken, der vor vielen Jahren – in München war gerade Ozonalarm – das Debakel in einem unvergesslichen Satz zusammenfasste: «Autos dürfen draußen spielen, Kinder müssen drinnen bleiben.»
Wenn wir die Wirklichkeit nicht sehen wollen, katapultieren wir uns hinein in eine gesellschaftliche und individuelle Erstarrung.
Eine freie Gesellschaft aber braucht freie Menschen, die sich nicht zurückziehen in ihre festgemauerten Meinungen wie in ihre Wohnung und meinen, dort gut und sicher aufgehoben zu sein. Eine freie Gesellschaft braucht Menschen, die sich trauen, Fenster und Türen zu öffnen, in die Welt zu gucken, sie neu zu denken, Menschen, die Veränderungen akzeptieren und auch die Furcht vor Ungewissheit aushalten.
Denn wir brauchen nicht nur neue institutionelle Formen der Demokratie, etwa mehr Bürgerräte, brauchen nicht nur ein Wirtschaftssystem, in dem Umverteilung kein Tabu ist. «Millionen Menschen», sagt der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung», «sind nur eine Krise, Kündigung oder Krankheit von der Armut entfernt.» Eine freie Gesellschaft braucht auch Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Vorstellungskraft, Empathie.
Der Philosoph Karl Jaspers hat das Wegschauen im nationalsozialistischen Deutschland die «Fantasielosigkeit des Herzens» genannt.
Ein Satz, der mir immer wieder einfiel, als nach dem 7. Oktober so viele Juden und auch Muslime die gesellschaftliche und Freundeskälte in ihrer Umgebung erschreckt beklagten und davon erzählten, wie allein sie sich fühlten, wie unverstanden, wie ausgegrenzt. Und dann haben sich Fronten gebildet. «Auf welcher Seite stehst du?», bin auch ich gefragt worden. «Seit wann», schreibt Lena Gorelik in ihrem Beitrag zu der unbedingt zu lesenden Anthologie «Trotzdem sprechen», die sie mit herausgegeben hat, «seit wann ist der Empathie ihr innewohnender Universalismus abhandengekommen, ist es verdächtig, dass Trauer Menschen gilt?»
Vielleicht müssen wir alle offen und verletzlich bleiben oder es werden und zugeben. Wir haben doch alle Angst und Zuversicht, Sehnsucht und Eigensinn. Vielleicht müssen wir die Lebenskunst, Ambivalenzen im Privaten auszuhalten, auf die gesellschaftliche Ebene transportieren.
Die «Zeit» veröffentlichte im Juli 2023 einen Artikel mit dem Titel «Emotionale Taubheit: Ich, Mann, abgestumpft», in dem ein junger Mann die Geschichte der Erziehung zum Nichtfühlen erzählt. Immer geht es nur ums Funktionieren, geht es darum, darin gut zu sein, gut drauf zu sein. Fühlen macht Angst. Also ab in den scheinbaren Schutz der Verpanzerung.
Bei Frauen ist es etwas anders. Aber auch sie können mitreden. Jedenfalls Frauen meiner Generation. Die unter dem Diktum des «Bloß nichts fühlen» aufgewachsen sind.
Nach einer Lesung aus meinem Buch «Der Trost der Schönheit» kam ein Mann zu mir, um mir zu erklären, warum so wenige Männer zu meinen Lesungen kämen. Schon der Titel, sagte er, Trost, das sei nichts für Männer.
Trost braucht, wer schwach ist, und Männer sind offenbar eo ipso stark. Wie traurig!
Was hat das alles mit Demokratie zu tun?
Der Arzt und Traumaforscher Gabor Maté, der kürzlich im Pierre-Boulez-Saal in Berlin einen beeindruckenden und bewegenden Vortrag hielt, sagt: «Tatsache ist, dass viele Menschen die Realität leugnen. Und die Neigung, die Realität zu leugnen, kommt aus schmerzhaften Erfahrungen.»
Wer nicht hinschaut und hinfühlt, ist anfälliger für politische Verführungen und Manipulationen – die einen wollen einfache Antworten auf komplizierte Fragen, die anderen wollen ihre Privilegien schützen. Wollen sich unverfroren in Gegenden, die ohnehin schon unter Wassermangel leiden, riesige Villen mit Schwimmbad bauen. Wollen möglichst wenig Steuern zahlen. Gemeinwohl ist ihnen ein Fremdwort. Wie andere leben, interessiert sie nicht. Darf sie nicht interessieren, es könnte sie ja beschämen. Dieses Gesellschaftsverständnis ist nicht nur erbarmungslos, sondern auch dumm. Denn soziale Ungleichheit zu mindern, ist auch im Interesse der Privilegierten, weil nur so eine lebendige Zukunft möglich ist. Der schon einmal zitierte Wolfgang Sachs hat das großartige Wort «Reichtumslinderung» erfunden – wohl um das Wort «Steuererhöhungen» zu vermeiden.
Als vor Kurzem mein Enkel mich fragte, was ich heute meinem früheren Selbst auf den Weg geben würde, habe ich keine Sekunde gezögert mit der Antwort: Aufwachen. Aufwachen für die Welt und sich selbst darin.
Denn es sind auch die Demokratiedöser, die unsere Freiheit verspielen. Sie sind die Mehrheit. Sie lassen die Demokratie zugrunde gehen, weil sie meinen, sie sei da, um zu bleiben. Und kümmern sich nicht weiter. Wenn wir das Bild, das seit Jahrzehnten an derselben Stelle im Flur hängt, nicht mehr sehen, ist es Zeit, es umzuhängen. Es ist Zeit, hinzuschauen, aufzuwachen.
Warum hat sich nicht herumgesprochen, was geschieht, wenn autoritäre Parteien an die Macht kommen? Warum glaubt der Mensch nicht, was er sieht, was er sehen könnte, wenn er hinschaute? Denken denn tatsächlich alle, die ultrarechts wählen, dass sie ausgenommen werden von der dort propagierten Menschenverachtung? Dass sie sicher sind, weil sie mitmachen?
Allemal Deutsche sollten sensibilisiert sein. Denn vor der Menschenvernichtung im Nationalsozialismus war die Menschenverachtung, denunzierte man seine Nachbarn, stand hinter zugezogenen Gardinen, wenn wieder eine jüdische Familie abgeholt wurde.
Aber es waren ja immer die anderen.
Bis man selbst dran war.
Weil man etwas «Falsches» gesagt, einen Hitlergruß schlampig ausgeführt, eine kleine Freiheit für sich beansprucht hatte.
Der Theologe Martin Niemöller hat den Weg in aller Kürze und Präzision benannt, den eine Gesellschaft geht, wenn der Einzelne sich selbst geschützt wähnt und nur die anderen für gefährdet hält:
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.
«Die anderen» aus der eigenen Sicherheitszone auszuschließen – auch das ist Realitätsverweigerung. Ist Angstabwehr.
Was haben wir versäumt, die wir seit Jahrzehnten besorgt auf das schauen, was im Land geschieht? Wie sich zu den unheilbaren alten Nationalsozialisten immer mehr und immer radikalere neue Rechtsextreme gesellten.
Wenn man die Reden, Artikel, Vorträge liest und hört, die so viele vor zwanzig oder dreißig Jahren geschrieben und gehalten haben, erbleicht man. Man könnte jeden dritten Satz heute wiederholen. Nur mit noch bangerer Dringlichkeit.
Wir haben alles gewusst und alles gefürchtet. Und offenbar in dieser Hinsicht wenig erreicht. Die Welt ist auf zu vielen Ebenen politisch nicht aufgeklärter, weitgeistiger, offener geworden, sondern wird gerade wieder beschränkter, enger, kleingeistiger.
Wir könnten jetzt einfach resignieren, traurig aufgeben und der Demokratie zum Abschied zuwinken. Aber das geht nicht. Denn jetzt, gerade jetzt, ist die Zeit des trotzigen «Dennoch» gekommen. Die Zeit der Auflehnung oder jedenfalls der Zivilcourage.
Noch können wir lautstark protestieren. Noch können wir unsere Stimmen erheben, um zu fragen, zu widersprechen, zu erzählen, zu fantasieren, zu planen – in der Familie, in der Nachbarschaft, bei Kollegen. Noch ist Zivilcourage der Gratismut der Demokratie. Jeder kann sie haben. Jeder kann sprechen. Zivilcourage ist nicht nur das Gegenteil von Feigheit, sondern auch das Gegenteil von Lethargie und Schweigen. Und wenn die Resignation röchelt: Ich kann nicht mehr, und kapitulieren will, dann weiß die Zivilcourage: Das können wir uns nicht leisten. Wehrhafte Demokratie heißt, sich zu wehren gegen die Angriffe, denen sie ausgesetzt ist.
Reden wir also, sprechen wir miteinander. Bilden wir kleine Kreise, üben wir Einhegung statt Ausgrenzung, erzählen einander, was wir machen, brauchen, hoffen, planen. Geben einander Halt und Kontra. «Wenn wir streiten», schreibt Mirjam Zadoff in dem schon erwähnten Band «Trotzdem sprechen», «sind wir verwickelt und aufeinander bezogen. Immerhin.»
Irgendwo habe ich kürzlich die Geschichte von «Heikes Kiosk» gelesen. Ein Ort, an dem man sich trifft und Kaffee trinkt und redet. Wo man sich kennt und sich zuhört, sich streitet und sich gegenseitig hilft, eben weil man sich kennt und einander zuhört.
Genau solche Orte brauchen wir. Die für jeden zugänglich sind. An denen jeder mitreden kann. Auch und gerade, wer sonst allein zu Hause hockt und sich mit TikTok unterhält. Jeder vierte Erwachsene in Deutschland sagt von sich, sehr einsam zu sein. Und auch das hat gesellschaftspolitische Auswirkungen. Wer soll sich denn interessieren für einen demokratischen Prozess, für Wahlen, für aktive Teilnahme, wenn man sich nirgendwo als Teilhaber fühlt?
Je mehr wir bombardiert werden mit Informationen, mit Reels, mit Posts, desto mehr müssen wir aufwachen. «Attention fracking» nennt man in den USA die digitale Informationsüberschwemmung und überlegt dort bereits, wie man Aufmerksamkeit und Wahrnehmung auch und gerade in Schulen lehren könnte.
Wir kennen das doch alle. Es hilft ja schon, mal eine halbe Stunde aus dem Fenster in den Himmel zu schauen und den schlendernden Wolken zuzusehen. Jede einzelne Wolke auf ihrem Weg zu begleiten. Es entsteht ein anderes Welt- und ein anderes Ich-Gefühl. Oder besser noch ein Ich-in-der-Welt-Gefühl.
Willkommen in unserem polyphonen Buch der Demokratie.
Momente der Entscheidung
Thea Dorn
Auf dem Rücken des Fisches
Es gibt eine Geschichte, die mich seit meiner Kindheit fasziniert: Ein Schiff landet vor einer Insel, die ein Paradies inmitten der bedrohlichen Weiten und Tiefen des Meers zu sein scheint. Die Seeleute gehen an Land, richten sich ein und bewundern die fruchtbar-friedliche Natur, die sie umgibt. Doch plötzlich schreit der Kapitän: «Wir sind verloren! Was wir für eine Insel gehalten haben, ist in Wahrheit ein riesenhafter Fisch! Durch unsere Feuer und unser Getrampel haben wir ihn geweckt. Gleich wird er untertauchen und uns alle mit in die Tiefe reißen.»
Wer, wie ich, als Vertreter der Generation X das aus globaler und menschheitshistorischer Sicht unwahrscheinliche Glück hatte, in eine liberal-demokratisch organisierte Gesellschaft hineingeboren worden zu sein, konnte sich jahrzehntelang der Illusion hingeben, er lebe auf einer durch nichts zu erschütternden Insel, falls er sich überhaupt bewusst gemacht hat, dass «der freie Westen» aus nichts als Inseln inmitten eines Meers aus weniger freiheitlichen Gesellschaftssystemen besteht.
Seit einigen Jahren fühlt es sich allerdings an, als entpuppten sich unsere seligen Demokratieinseln als der sagenhafte Riesenfisch, der dabei ist unterzutauchen. Man muss noch nicht einmal in Strandnähe wohnen, um zu sehen, wie das Wasser steigt. Derweil geht es auf den meisten Inseln so laut, gereizt und krawallig zu, wie es nur Menschen zustande bringen, die entweder die Möglichkeit ignorieren, sie könnten auf dem Rücken eines Fisches leben, oder die es tatsächlich darauf anlegen, mit dem Fisch in den Meerestiefen zu verschwinden.
Wer beginnt, sich für die Geschichte der Demokratie zu interessieren, findet schnell heraus, dass der Fisch bislang noch jedes Mal abgetaucht ist: mal für sehr lange Zeit wie nach dem Ende der athenischen Demokratie beziehungsweise nach dem Übergang des Römischen Imperiums vom zumindest republikartigen Gebilde zur uneingeschränkten Kaiserdiktatur; mal für kurze, umso mörderischere Zeit wie im 20. Jahrhundert in Deutschland; mal ist er nur kurz aufgetaucht wie in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion; mal ist er so langsam abgetaucht, dass es anfangs kaum jemand wahrhaben wollte, wie in Venezuela zu Beginn dieses Jahrhunderts.
Es ist gut, sich von der Illusion, unerschütterlich Festes unter den Füßen zu haben, zu verabschieden. Dennoch sollte man, bevor man sich mit dem Abtauchen beschäftigt, erst einmal versuchen, das Wunder zu verstehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Menschen sich mehr oder minder dauerhaft auf dem Rücken des Fisches einrichten konnten.
Dazu muss man sich von einer zweiten Illusion verabschieden: Demokratien funktionieren nicht «einfach so». Die Hoffnung, es genüge, demokratische Spielregeln zu etablieren, diese als demokratische Institutionen zu befestigen, und schon würde eine Art unsichtbare Hand dafür sorgen, dass es mit der Demokratie immer weitergeht, ist trügerisch.
Ich vermute, es ist ein doppeltes Ethos, ohne das sich keine Demokratie dauerhaft über Wasser halten kann.
Zum einen benötigen Demokratien einen emphatischen Begriff von Selbstständigkeit, Mündigkeit, Autonomie. Geht man zurück zu den Anfängen im Athen des 6. Jahrhunderts v. Chr., scheint es so gewesen zu sein, dass eine immer größere Gruppe von Männern nicht mehr eingesehen hat, warum sie die Regierungsgeschäfte einer kleinen Gruppe von Männern überlassen soll, mit deren Handeln sie zunehmend unzufrieden war. Die Forderung scheint jedoch weniger gewesen zu sein: «Macht das mal besser, und zwar sofort!» Vielmehr fing man an, es überhaupt für unwürdig zu halten, bevormundet zu werden; über die Belange des eigenen Lebens und Zusammenlebens nicht selbst zu entscheiden.
Zum Glück für die Demokratie gab es damals hellsichtige Mitglieder der herrschenden Adelselite wie Solon, Kleisthenes und Ephialtes, die nicht länger versuchten, dieses Aufbegehren «von unten» mit immer drakonischeren Maßnahmen zu unterdrücken, sondern die erkannten, dass es nur eine Lösung gibt: die Unzufriedenen mit in die Verantwortung zu nehmen oder die Regierungsgeschäfte sogar ganz den Bürgern anzuvertrauen. Sollte es im klassischen Athen so etwas wie Anspruchsdenken gegeben haben, war es jedenfalls nicht der Anspruch, von «denen da oben» etwas geliefert zu bekommen. Es war der Anspruch, in dem Maße bei politischen Entscheidungen mitzureden, in dem man sich selbst für die Polis einsetzte. Und «für die Polis einsetzen», das bedeutete im antiken Athen vor allem: als Soldat in den Krieg ziehen.
Es wirft für uns Heutige ein einigermaßen verstörendes Licht auf die Entstehung der Demokratie, dass die ersten Demokratisierungsschübe der Menschheit die Folge davon waren, dass sich die Gruppe der Kriegsdienstleistenden erweiterte. Waren es im antiken Griechenland anfangs nur Adlige, die sich die kostspielige Militärausrüstung leisten konnten, entstand um 700 v. Chr. der neue Kriegertypus des Hopliten: Infanteristen, die ab sofort die Hauptlast des Kampfes trugen. Ihren Durchbruch erlebte die athenische Demokratie allerdings erst im 5. Jahrhundert v. Chr. nach dem Ausbau der Kriegsflotte: Die neuen Schiffe benötigten Ruderer in großer Zahl, und als Ruderer musste man lediglich Muskelkraft und Leidensfähigkeit mitbringen, was den Militärdienst auch für die Mehrzahl der Athener öffnete, die sich eine Hoplitenausrüstung nach wie vor nicht leisten konnten.
Warum die Ausweitung der Gruppe derjenigen, die ihr Gemeinwesen verteidigten, nur in Athen und nicht an anderen Orten der Welt zur Entstehung von Demokratie führte, wird vermutlich für immer ein historisches Geheimnis bleiben. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es auch in Athen nie zu einer Demokratisierung gekommen wäre, hätte nicht eine wachsende Zahl von Bürgern das Selbstvertrauen entwickelt, nicht nur in Fragen der eigenen Lebensgestaltung, sondern auch über die öffentlichen Belange ihrer Polis entscheiden zu können, und hätten nicht einzelne Reformer innerhalb der herrschenden Elite den Bürgern dies auch tatsächlich zugetraut. Die erste Demokratie der Welt war eine doppelte Vertrauenssache: Gewachsenes bürgerliches Selbstvertrauen «von unten» stieß auf Vertrauen «von oben».
Neben diesem (Selbst-)Vertrauen kommt keine Demokratie ohne einen emphatischen Begriff von Gleichheit aus. Auch hier lohnt es sich, einen Blick auf die Anfänge in Athen zu werfen. Die beiden Grundprinzipien der regierenden Volksversammlung waren Isonomia und Isegoria – Gleichberechtigung und gleiches Rederecht für alle, wobei das Rederecht durch den Zusatz der Parrhesia weiter gestärkt wurde: das Recht, seine Meinung öffentlich kundzutun, ohne Repressalien fürchten zu müssen. In gewisser Weise sind die Gleichheitsprinzipien eine logische Folge des Mündigkeitsvertrauens: Wenn ich den anderen für voll nehme, habe ich keinen Grund, ihm weniger politische Rechte einzuräumen als mir selbst oder ihn zum Schweigen zu bringen.
Zur Wahrheit über die athenische Demokratie gehört aber auch, dass sie diesen Mündigkeits- und also Gleichheitsrespekt nur freien Männern entgegenbrachte. Die «Klassenfrage» hatte man zwar gelöst, indem etwa ärmeren Bauern aus dem attischen Umland eine Art Sitzungsgeld gezahlt wurde, damit auch diese es sich leisten konnten, nach Athen zu reisen, um an den Volksversammlungen teilzunehmen. Sollte im antiken Athen irgendwer skandiert haben: «Wir sind das Volk», hatte dies jedoch die Nebenbedeutung: Frauen und Sklaven (beiderlei Geschlechts) gehören nicht dazu. Das Volk der athenischen Demokratie, der Demos, umfasste mitnichten die gesamte Bevölkerung der Polis.
Auch war der «Herr Demos von der Pnyx» – wie der Komödiendichter Aristophanes das athenische Volk nach seinem politischen Versammlungsort einmal nannte – ein notorischer Kriegstreiber. Er kannte keine Skrupel, Nicht-Griechen als verachtenswerte Barbaren zu unterjochen, und selbst mit anderen Griechen sprang er brutal um: Im Jahre 428 v. Chr. etwa beschloss der Herr Demos von der Pnyx in einem vorbildlich basisdemokratischen Prozess die Massenhinrichtung von Bürgern der abtrünnigen Polis Mytilene.
Der Gedanke, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, «that all men are created equal», wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 heißt, lag der Mutter aller Demokratien fern.
Und damit sind wir an einem der wundesten Punkte des demokratischen Wunders angelangt: Selbst die Mutter der neuzeitlichen, verfassungsbasierten Demokratien, ebenjene Vereinigten Staaten von Amerika, kannte die politische Gleichheit aller Menschen für allzu lange Zeit nur auf dem Papier. Der Herr Demos vom Capitol Hill brauchte einen Bürgerkrieg, bevor er sich zu der Einsicht durchrang, dass auch schwarze amerikanische Männer zum Volk gehören; die Einsicht, dass Frauen (jeglicher Hautfarbe) ebenfalls zum Volk gehören, setzte sich erst nach dem Ersten Weltkrieg durch.
Pseudouniversalistische Gleichheit war allerdings keine US-amerikanische Spezialität: Das bereits im 17. Jahrhundert glorreich revolutionierte Großbritannien räumte seinen weiblichen Bürgern das Stimm- und Wahlrecht ebenfalls erst nach dem Ersten Weltkrieg ein. Das Volk von «Liberté, Égalité, Fraternité» meinte das mit der «Brüderlichkeit» für eineinhalb Jahrhunderte durchaus wörtlich: Erst seit April 1944 dürfen Französinnen wählen und in politische Ämter gewählt werden. Und in der stabilsten Demokratie Europas, der Schweiz, hat das Wort «Eidgenossin» gar erst seit 1971 eine reale Bedeutung.
Einige der schmählichsten Kapitel Demokratiegeschichte wurden allerdings doch in den USA zwischen 1885 und 1965 geschrieben. Der Bürgerkrieg brachte nicht nur die offizielle Abschaffung der Sklaverei: 1870 wurde die US-amerikanische Verfassung um den Zusatzartikel 15 erweitert, was bedeutete, dass nun auch die ehemaligen Sklaven männlichen Geschlechts volles Stimm- und Wahlrecht hatten. Schätzungen zufolge ließen sich in den ehemals konföderierten Südstaaten bis zu 90 Prozent der afroamerikanischen Neubürger in Wählerlisten eintragen, obwohl sie dies vielerorts nur unter Aufsicht von Bundestruppen tun konnten, die ihre demokratischen Rechte gegen einen weißen Mob schützten. In Staaten wie Mississippi, South Carolina und Louisiana führte dies dazu, dass Schwarze plötzlich die Mehrheit der Wähler stellten. In den Repräsentantenhäusern von Louisiana und South Carolina waren in der ersten Hälfte der 1880er-Jahre 40 Prozent der Abgeordneten schwarz.
Der Emanzipationstriumph sollte nicht lange währen. Der weiße Herr Südstaaten-Demos schlug brachial zurück: Zwischen 1885 und 1908 änderten alle elf der ehemals konföderierten Staaten ihre Verfassungen und Wahlgesetze so, dass Afroamerikaner abermals aus dem demokratischen Prozess ausgeschlossen wurden. Auf dem Papier beinhalteten diese neuen Wahlgesetze neutral wirkende «Kopfsteuern» und Lese- und Schreibtests. In der Praxis, in der die allergrößte Mehrheit der Schwarzen unverändert am untersten Ende der Einkommensskala zu finden war und nach wie vor vom Zugang zu Bildung ausgeschlossen blieb, führten die Gesetze dazu, dass die Wahlbeteiligung von Afroamerikanern von rund 60 Prozent im Jahr 1880 auf nur noch 2 Prozent im Jahr 1912 sank.
1915 erklärte der Supreme Court diese Südstaatengesetze für verfassungswidrig, doch die Bundesregierung in Washington unternahm nichts, um die Einhaltung der Verfassungsnorm durchzusetzen. Der Norden, der im Bürgerkrieg (auch) für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft hatte, war zwar bereit, schwarze Soldaten im Ersten Weltkrieg an die Front zu schicken – einen neuerlichen Bürgerkrieg mit dem eigenen Süden wollte man jedoch nicht riskieren. Und so blieben die Schwarzen in den Südstaaten bis 1965 auch ihrer demokratischen Partizipationsrechte de facto beraubt. Erst die Bürgerrechtsbewegung erkämpfte den Voting Rights Act, der – zusammen mit dem Civil Rights Act von 1964 – zumindest dem institutionell festgeschriebenen Rassismus in den Südstaaten ein Ende setzte. Was diese Bundesgesetze nicht verhindern konnten: dass ein nicht unerheblicher Prozentsatz des Demos – nicht nur in den Südstaaten – nach wie vor rassistisch fühlt und denkt.
Die kurzen Ausflüge in die lange Geschichte der Demokratie zeigen: Das demokratische «Wir sind das Volk»-Pathos ist durchaus kein Zwilling des universalistischen Gleichheitspathos. Zwar beinhaltete bereits das antike «Wir sind das Volk» einen gewissen Begriff von Gleichheit, denn hätten sich die Bürger Athens im Vergleich zu den sie regierenden Eliten weiterhin als unterlegen oder minderwertig empfunden, wäre es nicht zu den ersten Demokratisierungsschüben der Menschheit gekommen. Diese Gleichheit war jedoch die Gleichheit unter Männern ähnlicher Provenienz. Die naturrechtliche Vorstellung, dass alle Menschen «gleich geschaffen» sind und deshalb allen Menschen der gleiche Respekt gebührt, ist die erheblich jüngere Schwester der Demokratie. Zwar wurde sie von ihrem mächtigen älteren Bruder ab dem 18. Jahrhundert gern ins Sonntagskleidchen gesteckt und auf der Bühne nach vorn geschoben, um ihr Sprüchlein von der Gleichheit aller Menschen aufzusagen. In der Wirklichkeit kam sie bis weit in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts kaum zum Zug.
Was bedeutet dies alles nun für die gegenwärtige Lage auf dem Rücken des Demokratiefisches? Wenn ich es richtig sehe, verschärfen sich die Kämpfe um beide Grundprinzipien, ohne die keine Demokratie bestehen kann: sowohl um die Frage, wem der Respekt als Gleiche gebührt, als auch, damit zusammenhängend, um die Frage, ob die Eliten den Demos und ob der Demos sich selbst noch in einem emphatischen Sinne für mündig hält.
In den vergangenen Jahrzehnten haben alle Demokratien gewaltige Inklusionsschübe erlebt. Wie im antiken Athen geschahen diese, weil es Druck «von unten» gab – in dem Sinne, dass die bislang immer noch Ausgeschlossenen nun wirklich nicht mehr einsehen wollten, warum sie nicht voll und ganz zum Demos dazugehören sollen – und weil diese Inklusion «von oben» gefördert wurde, und zwar von den universalistisch-liberal denkenden Teilen der Elite. Diese erkannten, dass die «freie Welt» auf lange Sicht ihre Glaubwürdigkeit verliert, wenn das Gleichheitspathos nur bei Sonntagsreden gilt, während in Wirklichkeit ein ganzes Bündel an Kriterien vom «falschen» Geschlecht über die «falsche» sexuelle Orientierung bis hin zur «falschen» Herkunft oder Hautfarbe aus der Mehrheit der Bürger Bürger zweiter Klasse macht.
Vermutlich war es schon immer so, dass auf jeden Emanzipations- und Inklusionsschub ein Backlash folgte. Der Herr Demos ist nur allzu bereit zu vergessen, dass auch er irgendwann selbst einmal Paria gewesen ist, und noch bereiter, seine mittlerweile angestammte Vorherrschaft gegen all diejenigen zu verteidigen, die neuerdings ebenfalls nach Mitsprache, Einfluss und Macht streben. Betrachtet man den gegenwärtigen Backlash vor dem Hintergrund der Demokratiegeschichte, könnte man auch sagen: Der erstarkende Rechtspopulismus verteidigt das – mit den Anfängen der Demokratie etablierte – Gewohnheitsrecht, den Demos nicht nur über Gleichheit, sondern ebenso über Ausschluss zu definieren.
Man ist kein Paranoiker, wenn man davon ausgeht, dass etliche, die heute als Populisten auftreten, Autoritäres und in diesem Sinne Antidemokratisches im Schilde führen. Dennoch scheint es mir nicht besonders klug, wenn der politische Gegner den Rechtspopulisten reflexhaft vorwirft, sie seien nicht demokratisch. Denn es ist nicht die Demokratie, die der Rechtspopulist verachtet, im Gegenteil, er benutzt sie ja, um seine Privilegien abzusichern: Es ist der liberale Universalismus, den er bezweifelt bis verachtet.
Man mag diese Unterscheidung im 21. Jahrhundert für begriffliche Haarspalterei halten: Wer ernsthaft für eine «illiberale Demokratie» eintritt, wie es etwa Viktor Orbán in Ungarn tut, der will ein politisches System, das er ehrlicherweise «Volksdiktatur» nennen sollte. Dennoch sei daran erinnert: Die Geburt der Demokratie ist nicht aus dem Geist des Naturrechts, den Idealen einer universalen Menschlichkeit, erfolgt, sondern aus dem Anspruch zunehmend selbstbewusster Bürger, nicht länger Unterworfene zu sein, aus dem Anspruch, sowohl über die eigene Lebensführung als auch über die Belange des Gemeinwesens selbst zu entscheiden.
Aus diesem Grund scheint mir die Krise, in die das Pathos der Autonomie, der Mündigkeit, seit einer Weile geraten ist, ebenso bedrohlich für die Zukunft unserer Demokratien zu sein wie die Angriffe auf das universalistische Gleichheitspathos.
Die vermutlich größten Erkenntnisse und Fortschritte hat die Menschheit auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und Technologien und damit der Naturbeherrschung gemacht, vor allem im Bereich der Medizin. Immer mehr Gefahren für Leib und Leben, die lange unerkannt und unabwendbar waren wie Bakterien und Viren – aber auch zu viel Zucker, Fett, Salz oder Sonnenbestrahlung, zu wenig Bewegung und zu wenig Schlaf, Alkohol und Tabak generell –, sind heute beherrschbar oder zumindest offengelegt und mit entsprechenden Warnungen versehen. In dem Maße, in dem diese Erkenntnisfortschritte und Warnhinweise zunehmen, scheint das Pathos von Selbstständigkeit, Mündigkeit, Autonomie abzunehmen. Stattdessen wächst der Wunsch, möglichst umfassend behütet und geschützt zu sein.
Zusätzlich zu den transparenter und beherrschbarer gewordenen Gefahren der Natur hat die Menschheit selbst einen neuen Gefahrentypus geschaffen: Im Angesicht von atomarer Bedrohung und einem beschleunigten Klimawandel zielen die Sehnsüchte vieler ebenfalls eher dahin, dass jemand diese Großgefahren effizient einhegt, denn auf Autonomie.
Aus der Perspektive von Teilen der Eliten entspricht diese gestiegene Sehnsucht nach Sicherheit der Auffassung, die zu lösenden Probleme der Gegenwart seien so immens, ja so «apokalyptisch», dass die besten und schnellsten Lösungswege nicht mittels demokratischer Prozesse gefunden werden können, sondern indem auf Experten gehört wird, die wissen, was zu tun ist, und entsprechende Vorgaben machen. Idealerweise gelten innerhalb dieser Experten-Community zwar die urdemokratischen Prinzipien von Isegoria und Parrhesia – des gleichen Rederechts und des Rechts, für abweichende Positionen nicht sanktioniert zu werden –, nach außen hin wird allerdings häufig ein Experten- und Wissenschaftsbild vermittelt, das sich auf die rüde Formel bringen lässt: Die Ahnungslosen sollen’s Maul halten und machen, was «die» Wissenschaft ihnen sagt. Und wenn sie ihr Maul nicht halten wollen, dann soll man zumindest versuchen, ihnen das Maul zu verbieten.
Aufseiten derjenigen, die sich sowohl einem liberalen Universalismus als auch einer universalistischen Vernunft verpflichtet fühlen, hat sich ein doppeltes Misstrauen gegen das Volk eingebürgert – eben weil es «strukturell» dazu neigt, sowohl gegen die Gebote einer allumfassenden Menschlichkeit als auch der Vernunft zu verstoßen.
Nun ist die Ansicht, der «Pöbel» sei zu dumm und/oder moralisch zu verkommen, um das Richtige zu erkennen, nicht erst mit den Gleichheitskonflikten und Großgefahren der Gegenwart entstanden. Sie ist mindestens so alt wie die Demokratie selbst. Platon etwa hielt Demokratie rundheraus für Pöbelherrschaft und meinte, zeigen zu können, der beste Staat sei derjenige, in dem allein die Philosophen das Sagen hätten. Ruft man sich ins Gedächtnis, dass der Herr Demos von der Pnyx Platons weisen, integren Lehrer Sokrates aus Hass und Angst vor dem allzu Freigeistigen zum Tode verurteilt hat, kann man vielleicht sogar verstehen, warum Platon die Demokratie für eine Gefahr hielt.
Das Neue am gegenwärtig grassierenden Misstrauen gegen das Volk seitens relevanter Teile der Eliten scheint mir zu sein, dass dieses Misstrauen ausgerechnet als Verteidigung der Demokratie ausgegeben wird – womit die Kategorien nun doch in erhebliche Verwirrung geraten sind.
Wie aber sollen wir herauskommen aus diesem Teufelskreis, dass im selben Maße, in dem immer mehr von «denen da oben» immer mehr von «denen da unten» für unzurechnungsfähig und böswillig halten, sich «die da unten» tatsächlich immer trotziger und böswilliger aufführen? Denn wie das bei Kreisen so ist: Man kann nicht sagen, wo er anfängt und wo er aufhört.
Vielleicht hilft es fürs Erste, wenn die Eliten sich klarmachen, dass zwischen dem demokratischen Prinzip und dem Prinzip universaler Menschenwürde ein Spannungsverhältnis besteht und es deshalb nicht darum gehen kann, eines der beiden Prinzipien zu verabsolutieren. Lebendig und überlebensfähig sind Demokratien, die, statt zu verabsolutieren, erkennen, dass jede liberal-demokratische Gesellschaft stets aufs Neue aushandeln muss, wie sich beide Prinzipien halbwegs friedlich austarieren lassen. So wie eine durch immer weniger rationale Gebote und liberale Normen eingehegte Demokratie destruktiv und tyrannisch wird, birgt die gegenteilige Stoßrichtung, die Grenzen, innerhalb derer noch demokratisch entschieden werden darf, immer enger zu ziehen, die Gefahr, der Demokratie den Garaus zu machen. Eine heterogene, globalisierte, hoch technologisierte Gesellschaft kann es sich nicht leisten, die Prinzipien von Universalismus und Rationalität in den Wind zu schießen. Eine Demokratie, in der immer weniger Macht vom Volke ausgehen darf, verwandelt sich in einen pseudoliberalen, szientistisch-technokratischen Fürsorge- und Obrigkeitsstaat.
Vielleicht können wir unseren Fisch davon abhalten, weiter unterzutauchen, wenn die Eliten einsehen, dass die «Stimme des Volkes» in einer liberalen Demokratie weder «Vox Dei» noch «Vox Rindvieh» ist, und wenn sich das Volk seinerseits daran erinnert, dass Mündigkeit in einem triftigen Sinne nur reklamieren kann, wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen: sowohl für sein eigenes Leben als auch für das Gemeinwesen, dem er angehört.
Matthias Nawrat
Orwells Wespe
In einem Essay von 1940 beschreibt George Orwell, Rationalist englischer Schule, eine Situation am Frühstückstisch in seiner Kindheit. Mit dem Essen fertig, beobachtet das Kind an einem Sonntagmorgen eine Wespe, die auf seinem Teller an einem Marmeladenklecks saugt, und aus einer Laune und aus wissenschaftlicher Neugier schneidet es das Insekt mit einem Messer in zwei Teile. Die Wespe saugt aber einfach weiter an der Marmelade, scheint von ihrem Fest so eingenommen, dass sie nicht merkt, was ihr widerfahren ist. Erst als sie wegfliegen will, zeigt sich, in welch misslicher Lage sie steckt.
Orwell vergleicht die Lage der Wespe mit der Situation des europäischen Menschen seiner Zeit, dessen Seele weggeschnitten wurde, ohne dass er es bemerkt hätte. Im Folgenden kritisiert er, dass der berühmte Satz von Marx, dem zufolge die Religion Opium für das Volk sei, aus dem Kontext gerissen und eigentlich immer falsch zitiert worden sei. Die ganze Stelle laute nämlich: «Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.»[1]
Für Orwell besteht kein Zweifel, dass Religion als Blendwerk dekonstruiert werden muss, da sie die Armen arm gehalten und die Reichen nur reicher gemacht hat. Ähnliches gilt seiner Ansicht nach für die Heilslehren des Kapitalismus, des Faschismus und des Kommunismus, die durch ihre Versprechen Unterdrückung maskierten. Und so fragt er 1940, unter dem Eindruck der ideologischen Grabenkämpfe und der Unmenschlichkeit seiner Zeit, ob die Welt von jetzt an herzlos und von Stacheldraht und Hass durchzogen, der Mensch seelenlos bleiben müsse oder ob wir nicht doch noch etwas anderes in uns trügen.[2]
Man kann sich auch heute wieder fragen, was mit uns Europäerinnen und Europäern geschieht. In was für einer Welt wir leben, im Zeitalter des Internets, der kapitalistischen Globalisierung, der Putins, Trumps, Orbáns oder Höckes, in einer Zeit, in der die durch unser Saugen am Marmeladenklecks herbeigeführten klimatischen Veränderungen uns auf einen neuen Abgrund zusteuern, in der auch Europa in Brand gesteckt zu werden droht von Demokratiefeinden, die sich auf der gerechten Seite der Geschichte wähnen. Sind wir wie die Wespe, die nicht bemerkt, dass ein Teil ihres Körpers abgetrennt wurde?