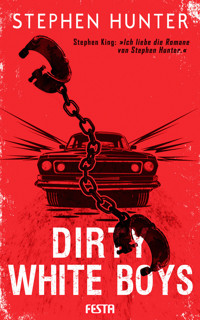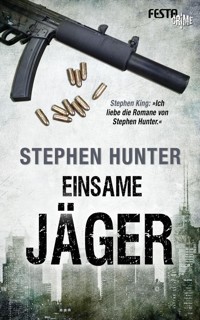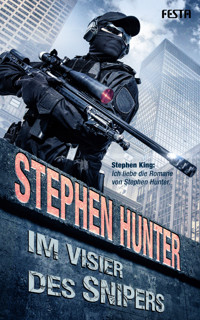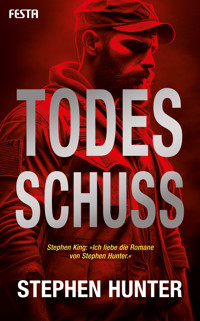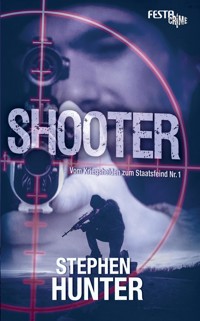4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bob Lee Swagger, der Scharfschütze aus dem Hollywood-Blockbuster SHOOTER, macht Asien unsicher! Der Japaner Philip Yano sucht nach dem Schwert, mit dem sein Vater 1945 in der Schlacht um die Insel Iwojima einen amerikanischen Soldaten erstach. Die Spur führt ihn in die USA zu Bob Lee Swagger – dessen eigener Vater an der blutigen Schlacht beteiligt war. Tatsächlich findet Swagger das Schwert und fliegt nach Tokio, um es dem rechtmäßigen Besitzer zu übergeben. Dabei stellt sich heraus, dass die Waffe von historischer Bedeutung ist. Schnell wird die von Yakuza beherrschte Unterwelt Tokios aufmerksam. Nachdem Swagger die hohe Kampfkunst der Samurai erlernt hat, kommt es zu seinen bisher blutigsten Kampf … Booklist Review: »Wahrscheinlich Hunters brutalster Roman, und das will bei ihm etwas heißen.« Nelson Demille: »Stephen Hunter ist eine Klasse für sich.« Rocky Mountain News: »Der beste lebende Autor knallharter Thriller.« Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Patrick Baumann
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The 47th Samurai
erschien 2007 im Verlag Simon & Schuster.
Copyright © 2007 by Stephen Hunter
Copyright © dieser Ausgabe 2017 by Festa Verlag, Leipzig
Lektorat: Alexander Rösch
Titelbild: www.designomicon.de – Anke Koopmann
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-531-4
www.Festa-Verlag.de
www.Festa-Crime.de
Mit Dank, Achtung und Anerkennung den Samurai des japanischen Kinos gewidmet:
Masaki Kobayashi, Hideo Gosha, Akira Kurosawa, Hiroshi Inagaki, Kenji Misumi, Tokuzo Tanaka, Kimiyoshi Yasuda, Kihachi Okatomo, Tadashi Sawashima, Toshiya Fujita, Haruki Kadokawa, Yoji Yamada, Kazuo Kuroki, Yojiro Takita, Ryuhei Kitamura, Satsuo Yamamoto
und
Takashi Shimura, Isao Kimura, Toshiro Mifune, Yoshio Inaba, Daisuke Kato, Mioru Chiaki, Seiji Miyaguchi, Tatsuya Nakadai, Shintaro Katsu, Raizo Ichikawa, Tomisaburo Wakayama, Tetsura Tambo, Sonny Chiba, Meiko Kaji, Michyio Aratama, Yunosuke Ito, Yuzo Kayama, Machiko Kyo, Kashiro Matsumoto, Akihiro Tomikawa, Kiichi Nakai, Koichi Sata, Aya Ueto, Masatoshi Magase, Mieko Harada, Hiroyuki Sandada
und
dem großartigen Shinobu Hashimoto
1 — Die Insel
20. Jahr, zweiter Monat, 21. Tag der Ära des Himmlischen Friedens
21. Februar 1945
Stille breitete sich im Bunker aus. Staub rieselte von der Decke. Der schwefelige Geruch nach faulen Eiern überlagerte alles andere.
»Captain?«
Es war ein Gefreiter. Takahashi, Sugita, Kanzaki, Asano, Togawa, Fukuyama, Abe – wer behielt da noch den Überblick? Es hatte schon so viele Namen gegeben.
»Captain, der Beschuss hat aufgehört. Heißt das, sie kommen?«
»Ja«, erwiderte er. »Das heißt, sie kommen.«
Der Offizier hieß Hideki Yano. Ein Captain des 145. Infanterieregiments, zweites Bataillon unter Yasutake und Ikeda, ein Teil von Kuribayashis 109. Division.
Die Decke war niedrig und es stank nach Schwefel und Fäkalien, weil alle Männer wegen des verschmutzten Wassers die Ruhr hatten. Es handelte sich um eine typische Festungsanlage der Kaiserlichen Armee, einen flachen Betonbunker. Über lange Monate hatte man diesen mit Eichenstämmen aus dem einzigen Eichenwald der Insel verstärkt, der inzwischen nicht mehr existierte.
Mittlerweile behalf man sich damit, Sand über ihn zu schütten. Es gab drei Schießscharten. Hinter jeder ruhte eine Typ-96-Maschinenkanone auf einem Stativ, die von einem Richtschützen und mehreren Ladeschützen bedient wurde. Jedes Schussfeld deckte fächerförmig Hunderte Meter einer eintönigen Landschaft ab, geprägt von schwärzlichen Sandhügeln und spärlicher Vegetation. Der Bunker unterteilte sich wie die Hülle eines Perlboots in drei Kammern. Selbst wenn eine oder zwei dieser Kammern zerstört wurden, konnte die letzte Kanone noch bis zum Ende weiterfeuern. Überall schmückten die jüngsten Weisungen aus dem Hauptquartier von General Kuribayashi die Wände, Auszüge aus einem Dokument mit dem Titel ›Schlachtgelübde der Tapferkeit‹. Darin wurden die Pflichten eines jeden Soldaten gegenüber dem Kaiserreich zusammengefasst:
Vor allem anderen widmen wir uns der Verteidigung dieser Insel.
Wir wollen mit Bomben die feindlichen Panzer stürmen und sie zerstören.
Wir wollen uns mitten unter die Feinde schleichen und sie vernichten.
Mit jeder Salve werden wir, ohne Fehl, den Feind töten.
Jeder Mann nimmt die Pflicht auf sich, zehn feindliche Kämpfer zu töten, ehe er selbst in den Tod geht.
»Ich habe Angst, Captain«, gestand der Gefreite.
»Die habe ich auch«, antwortete Yano.
Draußen setzte sich das kleine Reich des Captains fort. Sechs Gräben mit Nambu-Maschinengewehren, jeder bemannt mit einem Schützen, einem Ladeschützen und zwei oder drei Gewehrschützen, die die Flanken bewachten. In weiteren Vertiefungen lauerten Märtyrer mit Gewehren. Für sie gab es kein Entrinnen; sie wussten, dass sie bereits so gut wie tot waren. Sie lebten nur noch, um diese zehn Amerikaner zu töten, bevor sie ihr eigenes Leben opferten. Diese Männer hatte es am schlimmsten erwischt. In den Bunker konnten keine Granaten eindringen. Er bestand aus 1,20 Meter dickem Beton, von Stahlstangen durchzogen. Aber dort draußen konnten die Geschosse der Schiffsartillerie der Flotte vor der Küste einen Mann in Sekundenschnelle zerfetzen. Bei einer präzise treffenden Granate fand niemand mehr Zeit für ein Todesgedicht.
Der unmittelbar bevorstehende Angriff verlieh dem Captain neue Energie. Er schüttelte die monatelange Erstarrung ab, die Verzweiflung, die Gedanken an das miese Essen, den ständigen Durchfall und die Sorgen. Jetzt nahte endlich der Moment des Ruhms.
Nur dass er nicht länger an den Ruhm glaubte. Das taten nur Narren. Alles, woran er noch glaubte, war die Pflicht.
Er schwang selten große Reden. Aber jetzt rannte er von Stellung zu Stellung, vergewisserte sich, dass jedes Maschinengewehr gespannt und richtig ausgerichtet war, dass die Lader mit frischen Munitionsgurten bereitstanden und die Gewehrschützen kauernd darauf warteten, jeden amerikanischen Dämon auszuschalten, der sich hierher verirrte.
»Captain?«
Ein Junge zog ihn beiseite.
»Ja?« Wie lautete sein Name? Auch an ihn konnte er sich nicht erinnern. Aber sie alle waren gute Kerle, Jungs aus Kagoshima. Die Leute der 145. wurden aus Kyushu eingezogen, der Heimat der besten Soldaten Japans.
»Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich brenne darauf, für den Kaiser zu sterben«, behauptete der junge Obergefreite.
»Das ist unsere Pflicht. Du und ich, wir sind nichts. Unsere Pflicht ist alles.«
Aber der Junge wirkte trotzdem unruhig.
»Ich habe Angst vor den Flammen. Ich habe solch eine Angst vor Feuer. Erschießen Sie mich, wenn ich brenne?«
Alle fürchteten sich vor den Flammenwerfern. Diese schrecklichen Biester kämpften unehrenhaft. Sie brachen Goldzähne aus den Mündern toter Japaner, bleichten japanische Schädel, machten Aschenbecher aus ihnen und schickten sie nach Hause. Sie töteten die Japaner nicht mit Anstand, mit Gewehr und Schwert – sie hassten die Klinge! –, sondern oft aus meilenweiter Entfernung mit den großen Schiffsgeschützen, mit den Flugzeugen. Und dann, im Näherkommen, setzten sie diese schrecklichen Schläuche ein, die brennendes Benzin verspritzten, das einem Mann das Fleisch von den Knochen brannte und ihn langsam hinrichtete. Wie konnte ein Krieger ehrenhaft sterben, wenn man ihn in Brand steckte?
»Oder mit dem Schwert, Captain. Ich flehe Sie an. Wenn ich brenne, dann köpfen Sie mich.«
»Wie ist dein Name?«
»Sudo. Sudo aus Kyushu.«
»Sudo aus Kyushu. Du wirst nicht durch Feuer sterben. Das verspreche ich dir. Wir sind Samurai!«
Das Wort Samurai ließ nach wie vor jeden Mann Haltung annehmen. Es stand für Stolz, Ehre, Selbstaufopferung. Es war mehr wert als das Leben. Das, was ein Mann sein musste, wofür er zu sterben bereit war. Das hatte er sein ganzes Leben lang gewusst; sich danach gesehnt, so wie er sich nach einem Sohn sehnte, der diesem Ideal gerecht wurde.
»Samurai!«, rief der Junge mit Leidenschaft. Er fühlte sich ermutigt, denn er glaubte daran.
Die Able-Kompanie führte den Hauptangriff. Sie war ganz einfach an der Reihe. Die Kompanien Charlie, Item und Hotel beteiligten sich mit Unterstützungsfeuer und Flankiermanövern an der Attacke und sollten den Artilleriebeschuss koordinieren, aber die Able ging diesmal voran. Geleitete sie in die Schlacht. Semper fi und dieser ganze herrliche Blödsinn.
Aber es gab ein Problem. Es gab immer eins. Heute dieses: Der kommandierende Offizier der Able-Kompanie zitterte. Ganz neu bei der 28. eingestiegen, Gerüchten zufolge der Sohn eines Vaters mit Beziehungen, der ihn auf diesen Posten gehievt hatte. Sein Name lautete Culpepper. Ein Collegeboy aus irgendeiner schicken Stadt, der ein bisschen wie eine Frau redete. Niemand konnte genau sagen, woran es lag; er schien nicht schwul zu sein oder so was – einfach nur ein bisschen anders als die übrigen Offiziere. Durch die Bank vornehm – aus einer vornehmen Stadt, aus einem vornehmen Haus, der Sohn vornehmer Eltern. War Culpepper der Aufgabe gewachsen? Niemand wusste das, aber der Bunker musste zerstört werden, sonst saß das Bataillon den ganzen Tag hier fest und die großen Kanonen auf dem Suribachi zerschmetterten mit ihren Salven weiterhin den Landekopf. Deshalb hatte Colonel Hobbs den First Sergeant seines Bataillons, Earl Swagger, angewiesen, Captain Culpepper an diesem Morgen zu begleiten.
»Culpepper, hören Sie auf den First Sergeant. Er ist ein alter Hase. Er kennt sich aus. Hat schon viele Strände gestürmt. Er ist der beste Anführer, den ich habe, verstehen Sie?«
»Ja, Sir.«
Der Colonel nahm Earl beiseite.
»Earl, helfen Sie Culpepper. Lassen Sie nicht zu, dass er stehen bleibt, seine Jungs müssen sich ununterbrochen bewegen. Tut mir leid, dass ich Ihnen das antun muss, aber ich brauche jemanden, der diese Jungs den Hügel hinaufbringt, und Sie sind der Beste, den ich dafür habe.«
»Ich bring sie rauf, Sir«, versprach Swagger. Er wirkte wie ein 140-prozentiges Mitglied des United States Marine Corps, mit jeder Faser seines Körpers. Eine sehnige Bohnenstange von einem Mann, alterslos, wie Sergeants es sind, ein Veteran der Schlachten um Guadalcanal, Tarawa und Saipain – manche behaupteten sogar, er sei schon an den Schlachten um Troja, die Thermopylen, Agincourt und die Somme beteiligt gewesen. Man sagte, niemand könne so gut mit einer Thompson umgehen wie der First Sergeant. Angeblich hatte er die Japsen schon vor dem Krieg in China bekämpft.
Swagger kam aus dem Nichts. Er hatte keine Heimatstadt, keine Erinnerungen, an denen er andere teilhaben ließ, keine Geschichten aus der guten, alten Zeit, als ob es für ihn nie eine gute, alte Zeit gegeben hätte. Es hieß, er habe bei seiner letzten Rückkehr in die Heimat, auf einer Art Werbetour für Kriegsanleihen, ein Mädchen geheiratet. Angeblich eine Augenweide, aber er zeigte nie Fotos herum oder redete über sie. Mehr als Listigkeit, Energie und Konzentration gab er nach außen nicht preis und wirkte unzerstörbar. Einer dieser Profis, die das besaßen, was man als Funkeln in den Augen bezeichnete. In der Lage, jedem Soldaten, jedem Lieutenant Mut zu machen, der noch grün hinter den Ohren war, egal in welcher Situation. Swagger war ein regelrechter Kriegsfürst und wenn ihm Unheil drohte, registrierte er es entweder gar nicht oder es kümmerte ihn nicht sonderlich.
Culpepper hatte einen Plan.
Swagger gefiel dieser Plan nicht.
»Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Captain, das ist zu kompliziert. Da werden Ihre Leute am Ende überall rumrennen und nicht wissen, was sie zu tun haben, während die Japsen einfach dahocken und auf sie zielen. Ich schlage vor, die Able nicht in Staffeln, sondern in Züge einzuteilen. Ich würde eine gute Feuerbasis errichten und meine Flammenwerfer nach rechts schicken, versuchen, sie auf diese Art dicht heranzubringen. Die Flammenwerfer, Sir, die sind der Schlüssel.«
»Ich verstehe«, behauptete der bleiche, dünne und ernste junge Mann, der sich wirklich bemühte. »Ich glaube, dass die Männer in der Lage sind …«
»Sir, sobald die Japsen uns kommen sehen, bricht da draußen die Hölle los. Das sind zähe, kleine Mistkerle, die wissen, was sie tun. Das können Sie mir glauben. Wenn Sie erwarten, dass die Männer sich Manöverpläne merken können, die auf Orientierungspunkten im Gelände beruhen, werden Sie enttäuscht sein. Es muss simpel, hart und elementar erledigt werden. Nicht zu viel, was man sich merken muss, sonst knallen die Japsen Ihre Jungs ab wie Kröten auf einem flachen Stein. Das verdammt noch mal Wichtigste ist, dass die Flammenwerfer nah rankommen. An Ihrer Stelle würde ich das beste Flammenwerferteam durch diese Senke an der rechten Seite schicken.«
Sie standen im Kommandoposten ein paar Hundert Meter hinter der Frontlinie und vertieften sich in eine verschmierte Geländekarte. »Mit einem BAR und einem Tommygunner, die den Leuten Deckung geben, und Ihrem besten Unteroffizier als Anführer. Behalten Sie Ihr anderes Team hinten. Währenddessen ballert Ihre Feuerbasis aus allen Rohren. Setzen Sie die Bazookas ein. Die Schießscharten der Gegner sind winzig, aber wenn man da ’ne Bazooka-Rakete durchschießt, werden die Japsen das schon merken. Sir, vielleicht sollten Sie mich das Flammenwerferteam anführen lassen.«
Der Colonel sagte: »Earl sollte sie anführen. Hören Sie auf seinen Rat, Captain. Ich will ihn heute Nachmittag wiederhaben.«
»Aber …«, setzte der junge Captain zum Protest an.
»Sergeant Tarsky ist ein guter Mann und ein guter Unteroffizier. Lassen Sie ihn ein paar Leute zur linken Seite bringen, wenn wir aufbrechen. Er muss für eine Menge Feuer sorgen und die Leute hier vorne, die müssen auch die Waffen sprechen lassen. Ich brauche eine Menge Deckungsfeuer. Ich gehe mit dem Flammenwerferteam rechts hoch. Die Japsen werden in ihren Affenlöchern hocken, aber ich entdeck sie da schon. Ich weiß, wonach ich schauen muss. Dann kann der Mann mit dem BAR sie von außerhalb ihrer Reichweite wegputzen. Anschließend schleichen wir näher ran und räuchern sie aus, und dann, wenn wir da oben sind, grillen wir ihren Bunker.«
Culpepper zögerte für einen Moment. Ihm wurde klar, dass dieser hartgesottene, pflichtbesessene Hinterwäldler aus irgendeinem Fliegenschiss von einem Kaff, von dem noch nie jemand gehört hatte, vollkommen recht hatte. Und er begriff, dass sein eigenes zimperliches, kleines Ego hier draußen nichts zählte.
»Legen wir los, First Sergeant.«
Die Typ-92-Maschinengewehre verschossen Leuchtspurmunition im Kaliber 7,7 Millimeter. Weißglühende Blitze durchschnitten Nebel und Staub. Durch die Schießscharten konnte man keine Menschen ausmachen, jedenfalls nicht richtig – aber man fühlte, wie sie Schritt für Schritt durch das Chaos manövrierten. Wo Kugeln einschlugen, ließen sie schwarze Sandwolken aufsteigen.
»Da«, sagte der Captain und deutete auf eine Stelle. Der Schütze drehte an der Verstellschraube und korrigierte die Zielrichtung nach rechts. Der gerippte Lauf drehte sich auf dem Stativ. Die Waffe ruckte und warf Patronenhülsen aus, die Leuchtspurgeschosse peitschten, und im Dunst zeichneten sich Umrisse von Gestalten ab, die inmitten des Schwefelgestanks taumelten und fielen.
»Captain!«, schrie jemand aus der ganz links gelegenen Schützenkammer.
Der Captain hielt sein Schwert so, dass es nicht klappern konnte, und rannte durch den Verbindungstunnel.
»Ja?«
»Captain, Yamaki sagt, er hat gesehen, wie Männer nach links gegangen sind. Nur ganz kurz. Sie hätten sich direkt von unserer Position wegbewegt.« Der Raum war vom Rauch des Schießpulvers erfüllt, dünn und beißend. Er griff die Nase an und brachte die Augen zum Tränen.
»Flammenwerfer?«
»Konnte ich nicht erkennen, Captain.«
Aber es musste so sein. Der Kommandant der Amerikaner hätte seine Leute nicht direkt vor ihre Gewehre laufen lassen. Das taten diese kleinen Teufel nie; sie hatten nicht den Mumm dazu und waren auch nicht erpicht darauf, vorzeitig zu sterben. Sie starben, wenn es notwendig wurde, aber sie sehnten sich nicht danach. Ein ruhmvoller Tod bedeutete ihnen nichts.
Der Captain forschte nach einer Lösung.
Der Feind kam entweder von links oder von rechts. Links hielt er für die wahrscheinlichere Option. Dort gab es bessere Deckung, dichtere Vegetation und damit größere Hindernisse, um nicht unter direkten Beschuss genommen zu werden, weil der Hügelkamm dort steiler aufragte. Am meisten Gefahr drohte ihnen durch Granaten. Aber die Amerikaner fürchteten die japanischen Granaten nicht, weil diese so schwach und fehleranfällig waren.
Der Captain versuchte sich in seinen Gegenspieler hineinzuversetzen. In seiner Vorstellung war ein weißer Mann unglaublich groß, haarig und hatte rosafarbene Haut. Er stellte ihn sich als Cowboy oder Gespenst vor, aber er wusste, dass er trotzdem über Intelligenz verfügen musste. Die Japaner hatten im Laufe der Jahre durch schmerzliche Erfahrung gelernt, dass die Amerikaner zwar keine Ehre besaßen, dafür aber Intelligenz. Sie waren nicht dumm, definitiv keine Feiglinge und es schien unendlich viele von ihnen zu geben.
Alles lief auf die Frage hinaus, ob der Gegner nach links oder rechts ging. Der Captain kannte die Antwort: nach rechts. Er ging nach rechts. Auf diesem Weg ließ er die Flammenwerfer vorrücken, denn das war weniger berechenbar: Auf dieser Seite gab es wenig Deckung, er stieß unterwegs auf Schützenlöcher, aber die stellten ihn vor keine größeren Schwierigkeiten. Gefährlicher, keine Frage, aber ein kluger Kämpfer befand sich dort im Vorteil, wenn er sich die Eigenheiten des Geländes zunutze machte und aggressiv operierte.
»Ich kümmere mich darum. Ihr Männer feuert weiter. Ihr werdet keine ganzen Ziele ausmachen können, nur Schemen. Schießt auf die Schemen. Seid Samurai!«
»Samurai!«
Der Captain stürmte in die zentrale Kammer zurück.
»Die kleine Waffe«, befahl er. »Schnell.«
Ein Unteroffizier brachte ihm die Maschinenpistole des Typs 100; eine 8-Millimeter-Waffe, deren Grundentwurf die Japaner von den Deutschen gestohlen hatten. Sie verfügte über einen Holzschaft, einen ventilierten Lauf und einen Magazinschacht, bei dem das Magazin links vom Verschluss seitlich eingesteckt wurde. Diese Waffen galten als Schätze; es waren nie genug von ihnen zur Hand. Was könnten wir mit einer Million davon erreichen! Dann wären wir heute schon in New York! Der Captain hatte sich persönlich bei General Kuribayashi dafür einsetzen müssen, dass man seiner Position eine dieser Waffen zuteilte.
Er warf sich ein Bandelier mit zahlreichen Beuteln und Etuis über, gefüllt mit Granaten und Magazinen, und schnallte es sich fest um den Leib. Vorsichtig löste er das Schwert vom Gürtel und legte es beiseite.
»Ich will dem Trupp der Flammenwerfer einen Hinterhalt legen, um sie weit vor unseren Linien abzufangen. Gebt mir Deckung.«
Er drehte sich um, nickte einem Gefreiten zu, der für ihn die schwere Stahltür an der Hinterseite des Bunkers entriegelte, und stieg hinaus.
»Wie heißt du, Kleiner?«
»MacReedy, First Sergeant.«
»Kannst du mit dem Ding schießen?« Earl zeigte auf das mehr als sieben Kilogramm schwere Automatikgewehr, das der junge Mann hielt.
»Ja, First Sergeant.«
»Was ist mit dir, Junge? Kannst du dafür sorgen, dass er immer Munition hat und schussbereit ist?«
»Ja, First Sergeant«, versicherte MacReedys Munitionsträger, der mit Gurten voller BAR-Magazine beladen war.
»Okay, wir werden Folgendes machen: Ich kriech den Hang hoch und schau mir die Senke an. Wenn ich ’n Affenloch seh, schieß ich mit ’ner Leuchtspurkugel drauf. Du begleitest mich und gehst in ’nen stabilen Liegendanschlag. Wo die Leuchtspurkugel landet, zielst du fünfmal mit Kaliber 30 hin. Orientier dich möglichst genau an meiner 45er-Leuchtspur. Die kommt nicht durch diese Baumstämme durch, die sie als Schutzmauern benutzen, aber die Kaliber 30 schon, weil sie dreimal so schnell fliegt. Dein Kumpel hier wird dir Magazine anreichen, wenn dir die Muni ausgeht. Er nimmt dir die leeren ab und gibt dir die vollen. Hast du verstanden, Junge?«
»Verstanden, First Sergeant«, bestätigte der Ladeschütze.
»Und ihr mit dem Flammenwerfer, ihr bleibt hinten. Wir müssen da erst aufräumen, bevor ich euch auf den Kamm lassen kann, damit ihr euch an die Arbeit macht. Okay?«
Sein loser Verband von Soldaten, der sich direkt am Aufstieg versammelt hatte, stieß zögernd ein zustimmendes Gemurmel aus, gefolgt von leisem »Ja, First Sergeant«.
»Und noch was. Hier draußen, wo’s Japsen gibt, bin ich Earl. Vergesst den ganzen First-Sergeant-Scheiß. Kapiert?«
Damit machte Earl sich auf den beschwerlichen Weg. Er kroch durch Vulkanasche und schwarzen Sand, durch einen Nebel aus nach Schwefel stinkendem Staub, der ihm in Nase und Mund drang und ihn über und über mit Körnchen bedeckte. Er presste seine Thompson so eng an sich, als sei sie eine Frau, spürte, dass die beiden Schützen mit dem Browning Automatic Rifle noch in seiner Nähe waren, und beobachtete, wie die Leuchtmunition der Japaner grell über ihnen aufflackerte. Hin und wieder schlug eine Mörsergranate ein, aber meistens wurde die Luft nur von Staub erfüllt, von kurzen Lichtblitzen durchzuckt, so schnell, dass man nicht sicher sein konnte, sie wirklich gesehen zu haben.
Er war glücklich.
Im Krieg konnte Earl alles hinter sich lassen. Sein tobender Vater, inzwischen längst tot, schrie ihn nicht mehr an, seine mürrische Mutter entzog sich ihm nicht mehr. Er war nicht mehr der Sohn des Sheriffs, den so viele hassten, weil sie seinen Vater fürchteten, sondern nur noch der First Sergeant. Das löste eine tiefe Zufriedenheit in ihm aus. Das United States Marine Corps übernahm jetzt die Rolle von Vater und Mutter. Das Corps hatte ihn aufgenommen, ihn geliebt und gepflegt und einen Mann aus ihm gemacht. Er wollte es nicht enttäuschen und bis zum Tod für seine Ehre kämpfen.
Earl erreichte den höchsten Punkt des kleinen Hügelkamms und reckte den Hals. Vor ihm fräste sich eine Mulde durch den Sandboden, die bis zur kargen Leere eines höher gelegenen Bergkamms hinaufführte, eine Art Bachbett in den Ausläufern des Bergs Suribachi, der sich in ihrem Rücken erhob und die Sicht aufs Meer versperrte. Die Aufgabe der 2nd, 28th bestand darin, den Vulkan zu umrunden und den Berg von Nachschublieferungen abzuschneiden. Im Anschluss würden sie sich langsam hinaufbewegen, die Mörser ausschalten, die Geschützstände und die Aufklärer der Artillerie zerstören sowie die Schützengräben und auf der zerklüfteten Oberfläche verstreute Bunker in die Luft jagen. Nach und nach, ein Kampf nach dem anderen. Ein langer Tag des Sterbens.
Die Landschaft um die Senke wirkte öd und leer. Wie eine zufällig in den schwarzen Sand geschnittene Rille, gespickt mit Horstgras und Bohnenranken. Hier und da ragte ein vereinzelter Eukalyptusbusch aus dem kargen Nichts hervor.
Früher hätte er die Männer dort hinaufgeführt und sie wären alle gestorben. Aber wie seine Kameraden hatte er mittlerweile das Handwerk des Kriegs erlernt.
Er hielt nach Anhäufungen knorriger Wurzeln zwischen Gras und Eukalyptus Ausschau, nach Büscheln von Zitronengras und verkümmerten Eichenstämmen. Die Japaner waren Meister darin, diese als kleine Ein-Mann-Festungen zu benutzen. Darin wurden sie vor Artilleriefeuer geschützt, saßen aber gleichzeitig fest. So etwas wie eine Hintertür existierte nicht. Um zu töten, mussten sie sterben. Begriffe wie ›Rückzug‹ oder ›Kapitulation‹ existierten in ihrem Wortschatz nicht.
»Bist du bereit, MacReedy?«
»Ja, Earl.«
»Auf mein Zeichen.«
Earl markierte das 30 Meter entfernte Ziel, ein Grasbüschel auf einem schwarzen Sandhügel, das für seinen Geschmack zu geordnet wirkte. Er wusste, dass hinter den Halmen ein Mann in einem Versteck lauerte, und er schoss vier Leuchtspurkugeln in diese Richtung ab. Das Neonlicht flackerte über die Distanz hinweg und schlug ins Grüne ein, ließ dunkle Staubwolken aufsteigen. Kräftig und geübt, wie er war, verzog die Waffe bei ihm nicht nach oben; nie kam es dazu, dass er 45er-Kugeln wild ins Leere spuckte. Er konnte mit der Waffe Tontauben schießen, wie er es den Marineoffizieren einmal bei einer legendären Demonstration an Bord eines Schiffs bewiesen hatte.
Neben ihm feuerte MacReedy eine Salve der schwereren Kaliber-30-Kugeln in die feindliche Stellung. Diese Kugeln erzeugten beim Einschlag kleine Explosionen. Geysire aus wütender Kraft.
»Gut gemacht. Der Kerl ist jetzt bei seinen Ahnen.«
Earl nahm sich den Berghang etappenweise vor. Seine Augen erfassten Einzelheiten, die nur wenige andere bemerkt hätten. Er bestrich sie mit Leuchtspurmunition und die Jungs mit dem BAR feuerten mit den schweren Vollmantelgeschossen im Kaliber 30 nach. Nach wenigen Minuten schien die Senke sicher zu sein.
»Jetzt kommt der schwierige Teil. Wisst ihr, die Japsen haben auch welche auf dieser Seite. Ich meine, in Richtung ihrer eigenen Linien. Kerle, die wir nicht sehen. So funktionieren die Gehirne von diesen schlauen kleinen Affen. Die machen das hier schon ’ne Weile und haben verdammt noch mal das eine oder andere gelernt dabei.«
»Was tun wir jetzt, Sergeant Earl?«
»Wir werden Granaten diesen Abhang runterrollen. Ich werd das BAR nehmen. Nachdem die Granaten hochgegangen sind, spring ich runter. Ich kann die Affenlöcher erkennen und unter Beschuss nehmen. Ihr kommt über den Kamm nach und gebt mir mit der Tommy Deckung. Kapiert?«
»Dabei gehst du bestimmt drauf, Earl.«
»Nee. Kein Gelber ist schnell genug, um den alten Earl zu erwischen. Okay, ich will, dass das Gewehr geladen und gespannt ist. MacReedy, nimm auch das Zweibein ab. Du, hol deine Granaten raus. Bereit?«
»Ja, Mr. Earl.«
»Okay, auf mein Zeichen zieht ihr den Splint, lasst den Bügel los und werft die Granaten dann einfach über die Kammlinie. Klar?«
Die Schlacht tobte wie ein Unwetter. Er rannte durch Dunstschwaden, Staub und Schwefel. Die Sonne war verschwunden. Seine Stiefel suchten Halt im schwarzen Untergrund. Es donnerte – nur dass es Schüsse waren. Überall am Abhang schlugen Kugeln ein und kleine Tiere schienen verstohlen die Köpfe hervorzustrecken. Unten erfasste er nichts als Schemen, die durch den Staub hasteten – die haarigen Tiere, die sich mühsam weiter vorkämpften, um in Granatenwurfweite zu kommen, ständig gejagt von den weiß aufleuchtenden Geschossen, die seine Leute benutzten.
Er rannte von Schützengraben zu Schützengraben.
»Feuert weiter. Wir schlagen sie zurück. Habt ihr Munition, Wasser? Jemand verwundet?«
Die Männer waren wunderbar. Alle glaubten an die 100 Millionen, die sich opfern mussten, um den Kampfwillen des Feindes zu zerstören, an ihre Pflicht gegenüber dem Kaiser. Alle hatten bereits ihren Frieden mit dem Tod und der Selbstaufopferung geschlossen, glaubten an ihre Notwendigkeit und verzichteten auf eine Flucht. Sie waren die besten Männer der Welt. Samurai!
»Dort, auf der linken Seite!«
Er deutete hin, und das Nambu-Maschinengewehr schwenkte herum und feuerte eine Salve ins Gebüsch. Die Belohnung war der seltene Anblick eines getroffenen Feindes, der schlaff aus der Deckung rollte.
»Sucht nach Zielen, schießt weiter. Bald werden sie genug haben vom Sterben und ziehen sich zurück.«
Jetzt gelangte Captain Yano zu einer letzten Erhebung. Aufgrund einer geografischen Besonderheit fand sich hier ein nur wenige Meter langer Hügelkamm; dort, wo das Gefälle zu steil war und man keine Gräben ausgehoben hatte. An dieser Stelle bot das Gelände keinerlei Deckung. Trotzdem musste es überquert werden.
»Captain, seien Sie vorsichtig!«
»Lang lebe der Kaiser«, brüllte Yano, als rufe er eine höhere Macht an.
Glaubte er daran? Ein Teil von ihm tat es. Man gab sich der Sache hin, man akzeptierte den eigenen Tod, auch den mit Schmerz und Feuer. Man empfing das Leid mit offenen Armen, man sehnte sich nach der Leere. Man ging durchs Feuer, um seine Pflicht und sein Schicksal zu erfüllen.
Aber ein anderer Teil von ihm fragte: Warum?
Was für eine Verschwendung!
Diese guten Männer, die so viel zum Erfolg der Gesellschaft beitragen konnten, starben auf einem Berg aus schwarzem Sand, auf einer Schwefelinsel, die keine erkennbare Bedeutung besaß. Für den Kaiser? Wie viele von seinen Männern wussten schon, dass der gottgleiche, allwissende, absolute Treue fordernde Kaiser eine relativ neue Erfindung war? In Edo hatte man ihn als Marionette verspottet, während in Kyoto mächtigere und diskretere Männer regierten, die einen Kaiser nur als nützliche Fiktion duldeten, als eine Gestalt, die Anlass zu ablenkenden – und damit für sie nützlichen – Zeremonien bot.
Yano wusste auch: Der Krieg war verloren. All unsere Armeen sind zerschmettert. Keine der Inseln wurde erfolgreich verteidigt. Wir sterben hier für nichts. Wenn es nicht so dumm wäre, könnte man darüber lachen. Für die sieben Männer, die Japan regieren, ist es ein Spektakel; ein Spiel, über das sie sich beim Sake amüsieren.
Aber er stürmte trotzdem weiter.
Er war nur sieben Sekunden lang sichtbar. Die Amerikaner schossen schnell und er spürte das heiße Flüstern der Kugeln, die rechts und links von ihm vorbeisausten. Um ihn herum explodierte der Boden und füllte die Luft mit Sandkörnern, die ihm in Kehle und Nasenhöhlen brannten.
Aber die tödliche Kugel fand ihn nicht.
Hinter einem kleinen Hügel warf er sich zu Boden und schnappte nach Luft. Eine Reihe von Detonationen aus der tiefer gelegenen Senke drang an seine Ohren.
Er kroch zur Spitze der Erhebung und beobachtete aus knapp 100 Metern Entfernung, wie ein Amerikaner mit einem großen Automatikgewehr den Hügel hinunterrannte – sie hatten so viele verschiedene Waffen! Der Mann feuerte schnell, versenkte Kaskaden von Kugeln in Schützenlöcher, von deren Existenz nur der Captain wusste, weil er sie selbst entworfen hatte.
Nach wenigen Sekunden war es vorbei.
Das große haarige Tier rief etwas und gestikulierte. Zwei Männer kamen den Hang herab, ein paar andere hinter der Kuppe hervor. Sie sammelten sich in der Mitte der Senke. Der Amerikaner ließ sie hastig in einer Reihe antreten und führte sie dann weiter vorwärts.
Da sah es der Captain: Flammenwerfer.
Die letzten beiden Amerikaner in der Reihe. Einer trug ihn in einem Gestell mit Tragegurten, auf dem Rücken ein Bündel von Tanks. Er war so schwer beladen mit Napalm, dass er unter dem Gewicht in die Knie ging. In der Hand hielt er ein Strahlrohr mit einem Pistolengriff, in dem sich ein Zünder verbarg; praktisch ein Streichholz, das bei Betätigung den herausspritzenden Brennstoff in Brand steckte. Sie würden durch die Senke kommen, sich nach links wenden und unter Deckungsfeuer die Schützengräben ausräuchern. Dann planten die Amerikaner vermutlich, die Stahltür des Bunkers aufzusprengen und auch diesen auszubrennen.
Der Captain tastete nach seinen Granaten. Es waren absurde Konstruktionen – Typ 97, unberechenbar und unzuverlässig. Zylindrisch geformt und mit Rillen versehen, welche die Splitterwirkung verstärken sollten. Die vorgesehene Verzögerungszeit der Zünder betrug viereinhalb Sekunden, aber in der Praxis lief es auf entweder eine oder sechs Sekunden heraus, wenn sie denn überhaupt explodierten. Man machte sie scharf – und das war wirklich mehr als lächerlich! –, indem man zuerst den Splint zog und dann das Gehäuse fest gegen den Helm schlug, wobei ein Kolben sich in den Zünder bohrte und das Pulver entzündete.
Fast hätte er darüber gelacht.
Wir sind das Yamato-Volk, aber wir können ums Verrecken keine Handgranaten bauen. Die Männer rissen schon Witze darüber: Die Amerikaner können wir überleben … aber unsere eigenen Granaten? Doch der Buddha war ihm gnädig. Yano zog den Splint aus dem ersten Zylinder, schlug das Gehäuse gegen einen Stein, der Kolben löste den Zünder aus und die nunmehr scharfe Granate knisterte. Er hielt sie eine Sekunde lang in der Hand (so gefährlich!) und schleuderte sie über die Kammlinie. Er wiederholte den Vorgang und hörte dabei, wie die erste Granate detonierte. Wenn jemand geschrien hatte, war das Geräusch im Knall untergegangen. Bei der zweiten Granate wartete er nicht – dem soliden Grundsatz folgend, dass keine zwei nacheinander richtig funktionierten. Er schleuderte sie einfach sofort in Richtung Feind, und das war die richtige Entscheidung, denn nur einen Augenblick später ging sie los.
Der Captain zog sich über den Kamm zurück, hinter dem die Senke lag.
Alle Amerikaner lagen am Boden. Einer der Jungen mit den automatischen Gewehren kreischte hysterisch. An seinem linken Arm klebte überall Blut. Zwei andere lagen still. Der Träger des Flammenwerfers versuchte auf die Beine zu kommen.
Ihn erschoss der Captain zuerst. Er wurde von fünf 8-Millimeter-Nambu-Kugeln getroffen. Eine weitere Salve traf seinen Assistenten, obwohl dieser Gegner sich bereits nicht mehr rührte. Yano zielte jetzt auf den Kerl mit dem automatischen Gewehr, der mit seinem blutigen Arm versuchte, die Waffe zu heben. Der Ladeschütze hinter ihm angelte nach einem Karabiner, den jemand fallen gelassen hatte. Der Captain tötete beide mit einer ausgedehnten Salve. Dann schwenkte er auf den liegenden Anführer herum und erledigte auch diesen. Er spurtete in die Senke hinab zu dem Mann mit dem Flammenwerfer, der unglaublicherweise nach wie vor atmete. Während er ihm in den Kopf schoss, bemühte er sich, nicht zu genau hinzusehen. Da ihm das nicht gelang, konzentrierte er sich darauf, zumindest keine Scham zu empfinden, als die Kugeln dieses junge Gesicht trafen. Dann griff er zum Bajonett, kappte den Schlauch und warf das pistolenähnliche Griffstück mit dem Zünder weg.
Heute setzt niemand meine Männer in Brand!
Er wandte sich ab und rannte zurück in Richtung Bunker.
Irgendwie gelangte Earl wieder zu Bewusstsein. Er war nicht tot. Was mochte passiert sein? Er ging davon aus, dass sie entweder ein fehlgeleiteter Mörserschuss oder Granaten erwischt hatten. Er schüttelte den Kopf, versuchte die Schmerzen zu vertreiben, aber sie blieben. An der Hüfte spürte er ein Pochen. Als er an sich hinabblickte, bemerkte er Blut. Seine Feldflasche hatte zwei Löcher, an der Messingschnalle des Militärgürtels war eine Kugel abgeprallt und hatte eine Kerbe hinterlassen. Eine weitere Kugel hatte eine Furche in seine Seite geschnitten. Rote Feuchte begann sich unter dem dicken USMC-Twillhemd zu sammeln. Er blickte sich um.
Tot, alle tot.
Scheiße!, dachte er. Begegne ich also doch noch einem Japsen, der so schlau ist wie ich. Sogar noch schlauer, dieses verfluchte Äffchen. Zur Hölle mit ihm!
In der Senke selbst blieb es still, obwohl aus einiger Entfernung noch der Lärm der Schüsse aufbrandete. Die Japaner hielten ihren Bunker; sein Angriffstrupp an der Flanke war besiegt worden. Durch seine Schuld hatten vier Männer der Able-Kompanie ihr Leben gelassen. Um ein Haar auch er selbst. Jetzt, wo er darüber nachdachte, wurde ihm klar, dass er wohl nur wegen des aufgeschnappten Tschink! überlebt hatte, das ertönte, wenn ein Japaner eine Handgranate scharf machte. Er hatte sich vor dem ersten Knall auf den Boden geworfen. Aber es mussten zwei Explosionen gewesen sein.
Er blickte sich um. Seine Thompson lag nur wenige Meter entfernt. Er hob sie auf, blies den Sand aus dem Gehäuse und schob den Sicherungshebel nach unten. Er schaute nicht in die Kammer, da er die Waffe im Kampf immer mit einer Patrone in der Kammer und zurückgezogenem Spannhebel trug. Er trabte die Senke hinauf.
Nachdem er den Hügel erklommen hatte, drehte er sich um, konnte aber nichts erkennen. Vor ihm breitete sich eine Kammlinie aus. Ein Hügel aus schwarzem Sand, eingebettet in ein Geflecht struppiger Pflanzen.
Er stürmte los, geriet einmal kurz ins Stolpern, umrundete schließlich den Hügel und befand sich jetzt noch etwa 100 Meter vom Bunker entfernt. Drei Schützengräben, Schutzwälle aus Sandsäcken, verstärkt mit Palmenholz. In den Gräben hockten Gruppen von Gewehrschützen, die aus allen Rohren feuerten. Das Hämmern der Gewehre erinnerte an Industriemaschinen.
Earl zögerte keine Sekunde. Zögern lag nicht in seiner Natur. Er hatte den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Bevor die Männer ihn bemerken konnten, sprang er schon in die erste Grube. Mit einer langen Salve, bei der ihm die Waffe in den Händen qualmte und hüpfte, mähte er sie einfach nieder.
In der zweiten Grube, 30 Meter weiter, sprang ein Mann auf und schoss auf Earl. Die Kugel prallte am Helm ab, der ihm dabei vom Kopf gerissen wurde. Earl feuerte aus der Hüfte, erwischte den Gegner und spurtete feuernd weiter. Sobald er die Vertiefung erreichte, ging ihm die Munition aus, also sprang er hinein und setzte den Gewehrkolben ein. Er stieß mit dem schweren Teil zu, rammte es einem Japsen ins Gesicht, drehte sich zur Seite und schlug noch einen anderen. Als Nächstes ging er wieder auf den ersten los und versetzte ihm mehrere brutale Kolbenstöße, erbarmungslos.
Um ihn herum brach die Hölle los. Nambu-Feuer aus der dritten Grube. Earl duckte sich, griff nach einer Granate, zog den Splint und warf sie. Während er auf die Detonation wartete, wechselte er hastig das Magazin. Als die Granate explodiert war, stand er auf. Drei Männer mit einem leichten Maschinengewehr kamen in seine Richtung. Mit einer ausladenden Serie mähte Earl sie nieder. Er erhob sich, spurtete unter Beschuss zur dritten Grube – warum er dabei nicht getötet wurde, war ein Rätsel, über das er für den Rest seines Lebens nachdenken sollte – und leerte den Rest des Magazins auf die verletzten Männer, die sich darin quälten. Als er nicht mehr schießen konnte, tötete er zwei Verwundete mit dem Gewehrkolben. Nichts, wovon man seinem Enkel stolz erzählte, aber notwendig.
Nun lehnte er sich erschöpft zurück, schnappte nach Luft und atmete den Chemikaliengestank dieser beschissenen Insel ein. Der Bunker war nur ein paar Meter entfernt. Er wusste, dass er ihn in die Luft jagen musste. Ja, aber womit? Er hatte keine Granaten mehr, keine Rucksackladung, keine Sprengröhre, keinen Flammenwerfer. Dann drehte er einen Japsen um – der Körper war so leicht! – und fand einen Beutel mit Granaten. Er wusste, dass die japanischen Versionen nichts taugten, aber vielleicht reichte eine ganze Tasche voll für sein Vorhaben aus. Er griff nach seiner Thompson und sah jetzt, warum sie nicht länger feuerte. Ein Brocken Sand sorgte dafür, dass der Spannhebel auf halber Strecke festklemmte. Er hätte einen Monat kratzen müssen, um die Blockade zu beseitigen.
Okay.
Er atmete tief durch und hastete zum Bunker, schlich an der Rückseite entlang und scheuerte dabei mit dem Hemd über den Beton. Er konnte hören, dass die Gewehre im Inneren weiterhin den Hang beschossen. Beim Hineinspähen in eine der Kammern bemerkte er eine schwarze Stahltür.
Earl drückte sich mit dem Rücken an die Wand und griff nach einer der Japsengranaten. Mit den Zähnen zog er den Splint heraus, schlug das Ding an die Wand, hörte, wie es zu zischen begann, und beobachtete den trockenen, dünnen Rauch brennenden Pulvers, der daraus hervorquoll.
Mann, diese Teile machten ihm eine Scheißangst.
Er ließ sie in den Beutel fallen, knallte den Beutel an die Stahltür und rannte über den Sand zur Schützengrube zurück.
Er brauchte eine anständige Waffe.
Der Captain schaffte es, ins Haus zurückzukehren. Hier, in der Feuchtigkeit und Dunkelheit, fand er für einen Augenblick Ruhe vor dem Getöse der Schlacht. Der Lärm verringerte sich erheblich, das Licht blendete ihn nicht länger und der Schwefelgestank wurde von anderen Arten unangenehmer Gerüche verdrängt.
Jemand klopfte ihm auf die Schulter, umarmte ihn und stieß einen Freudenschrei aus.
»Ich habe ihr Flammenwerferteam aufgehalten. Jetzt haben wir sie. Die werden heute Morgen nicht mehr hier raufkommen. Samurai!«
Yano reichte die Typ 100 seinem Unteroffizier und zog sich in seine kleine Ecke zurück, wo er zu seinem Schwert griff – einem nüchternen, zweckmäßigen Mordinstrument, das höchstwahrscheinlich in der Schwertfabrik der Marine maschinell hergestellt, poliert und von einem Arbeiter zusammengesetzt worden war. Trotzdem erwies sich die Klinge als äußerst scharf. Schon zweimal hatte jemand versucht, es ihm abzukaufen. Es hatte irgendetwas Besonderes an sich, das er nicht näher definieren konnte.
Er befestigte das Schwert am Gürtel, zog es aus der Scheide und legte es vor sich hin.
Er hatte das Gefühl, seine Pflicht getan zu haben. Niemand ging heute in Flammen auf. Ihnen stand ein würdevoller Tod bevor.
Yano tauchte den Kalligrafiepinsel in ein Tintenfass und fühlte sich dabei ins Jahr 1702 zurückversetzt. Er musste an Fürst Asano denken, Sekunden bevor dieser sich das Leben genommen hatte, überwältigt von einem so massiven Druck, dass man ihn sich kaum vorstellen konnte.
Asano hatte geschrieben:
Ich wünschte, ich hätte
das Ende des Frühlings gesehen,
aber mir fehlt nicht
das Fallen der Kirschblüten
Asano wusste damals, worauf es ankam: das Ende des Frühlings, seine Pflicht; das Fallen der Kirschblüten, die Bedeutungslosigkeit von Zeremonien. Dann hatte er sich die Klinge in den Bauch gestoßen und einen sauberen Schnitt mitten durch den Leib vollzogen, der Eingeweide und Organe aufschlitzte und das Blut spritzen ließ, bis das gnadenvolle Schwert des Sekundanten ihm das Genick durchtrennte und allem ein Ende bereitete.
Jetzt wurde Yano klar, was er zu tun hatte. Er musste aufschreiben, was hier passiert war, um was für einen Ort es sich hier handelte, wie hart diese Männer gekämpft hatten und wie brutal ihr Tod gewesen war. Plötzlich überkam ihn die Inspiration zusammen mit Erleuchtung. Mit wenigen geschickten Pinselstrichen füllte er das Reispapier vertikal mit Kanji-Schriftzeichen. Sie schienen wie von allein aus seinem Pinsel zu gleiten – federleicht, fast zerbrechlich, ein Zeugnis von künstlerischem Genie inmitten des Gemetzels. Überaus menschlich.
Er schrieb ein Gedicht über den eigenen Tod.
Yano legte das Schwert vor sich auf den niedrigen Schreibtisch. Mit dem Stiel des Pinsels schob er den Bambusstift heraus, der zur Sicherung des Griffs am Schaft diente. Der Griff ließ sich leicht nach oben schieben, aber anstatt ihn abzunehmen, wickelte er das Todesgedicht um den Schaft und befestigte ihn erneut. Danach stieß er den Bambusstift durch die Öffnung. Aber er dachte: zu locker. Mit dem noch feuchten Kalligrafiepinsel schmierte er schnell einen Tropfen Tinte auf den Stift, damit diese ins Loch floss, sich lackartig verdichtete und schließlich aushärtete wie Zement. Auf diese Weise hielt sie das Schwert dauerhaft fest zusammen.
Aus irgendeinem Grund bereitete ihm diese kleine Tat im Angesicht des Todes eine immense Befriedigung. Es bedeutete, dass seine letzte bewusste Handlung dem Erschaffen von Poesie gegolten hatte.
Unmittelbar danach explodierte die Welt.
2 — Die Sense
Crazy Horse, Idaho, Gegenwart
Es gab eigentlich keinen richtigen Grund dafür.
Man konnte so etwas nicht in Worte fassen. Seine Tochter hätte gesagt: Du hast einfach zu viel Zeit. Seine Frau hätte gesagt: Dieser Mann lässt einfach nicht mit sich reden. Und wer wusste schon, was die Leute in der Stadt sagten – oder die Mexikaner; die Peruaner, die die Schafe hüteten und die Zäune flickten. Aber zumindest die Letztgenannten hätten mit ziemlicher Sicherheit die Worte muy loco benutzt.
Bob Lee Swagger, der auf die 60 zuging, stand allein an einem Abhang im amerikanischen Westen. Das Grundstück gehörte ihm. Er hatte es gekauft, nachdem dieser neue Abschnitt seines Lebens ihm unerwarteten Wohlstand beschert hatte. Die zwei Mietställe in Pima County, Arizona, die er besaß, liefen gut. Sie wurden mit Scharfsinn von einer High-School-Freundin seiner Tochter geführt, einer jungen Frau, die Pferde liebte und praktisch veranlagt war. Also traf jeden Monat ein Scheck aus Arizona ein.
Es gab noch zwei weitere Mietställe hier in Idaho, einen östlich und einen westlich von Boise, die Bob mehr oder weniger selbst verwaltete, wobei das quasi von allein ging und Julie sich um die Buchhaltung kümmerte. Auch das brachte Geld ein. Dann schickte ihm noch das United States Marine Corps jeden Monat einen Scheck für all das Blut, das er an fernen Orten vergossen hatte, an die sich niemand mehr erinnerte. Das Kriegsveteranenministerium zahlte ihm eine Invalidenrente wegen der Probleme mit seiner Hüfte – das Stahlgelenk im Körper war immer ein paar Grad kälter als die Lufttemperatur.
Also hatte er sich dieses schöne Stück Land am Piebald River gekauft. Es lag ein ganzes Stück von Crazy Horse entfernt und noch weiter von Boise. Man konnte von hier aus die Sawtooths bewundern – eine blaue Narbe inmitten des grünen Meeres, als das sich dieses Tal aus der Luft präsentierte. Die Landschaft wirkte friedlich. Keine menschlichen Bauten weit und breit. Wenn man es betrachtete, unter dem weiten, mit Cumuluswolken bedeckten Himmel Idahos, mit den Falken, die in den Aufwinden kreisten, und dem verschwommenen Weiß der Gabelbockherden, konnte man ein bisschen Frieden finden.
Ein Mann, der in seinem Leben einige schwere Taten vollbracht hatte und endlich in ein Land gekommen war, in dem er mit Frau und Tochter ein ruhiges Leben führen konnte, musste diesen Ort lieben – auch wenn die Tochter eine Graduate School in New York City besuchte und er und seine Frau nicht mehr so viel miteinander redeten wie früher. Aber die Vorstellung war herrlich: ein schönes Haus bauen, mit Blick auf die Sawtooth Mountains und einer großen Veranda. Den ganzen Sommer über blieb alles grün, im Herbst hielt das Rotgold Einzug, im Winter das Weiß.
»Du hast es dir schwer erkämpfen müssen, Bob«, hatte Julie einmal zu ihm gesagt.
»Tja, vermutlich hab ich das. Jedenfalls werd ich’s einfach nur genießen, am Morgen mit einer Decke dazusitzen und es mir anzuschauen.«
»Darauf würd ich nicht wetten, aber wenn du es sagst.«
Aber eine Sache gab es da noch: Bevor man ein Haus bauen konnte, musste das Land von Unkraut befreit und bewässert werden. Bob wollte nicht, dass ein Fremder diese Arbeit mit einer Maschine und einer Gruppe von Helfern erledigte. Er wollte es selbst tun.
Mit einer Sense. Einer uralten, geschwungenen Klinge, rostig und voller Kerben, aber immer noch teuflisch scharf, die an einem Griff befestigt war, der biegsam und griffig genug war, dass man sein komplettes Gewicht und volle Kraft in die Schwünge legen konnte. Alles, was er damit traf, wurde durchtrennt. Man fand seinen Rhythmus, die Klinge verrichtete ihr Werk, man streckte die Muskeln, die Ausdauer wuchs. Wie im 19. Jahrhundert, und deshalb gefiel es ihm – womöglich sogar wie im 18., 17. oder 16. Jahrhundert.
Es dauerte eine gewisse Zeit, damit ein größeres Stück Land zu bearbeiten, und je länger es dauerte, desto mehr Freude bereitete es ihm. Er musste rund eine Stunde von seinem Zuhause in Boise hierherfahren. Der Großteil der Strecke bestand aus Feldwegen. Um etwas Zeit zu sparen, hatte er sich ein Geländemotorrad gekauft, eine Kawasaki 450, und gelernt, damit umzugehen. So konnte er ohne Umwege durch die Wüste rasen und musste nicht auf die abenteuerlichen Serpentinenstraßen ausweichen, auf die ihn sein Pick-up-Truck gezwungen hätte.
Am Ziel machte er sich sofort an die Arbeit. In Jeans, Stiefeln und einem alten Unterhemd. Er war jetzt seit einem Monat dabei – 197 Schritte in die eine Richtung, dann 197 in die andere, sechs, sieben, manchmal acht oder sogar zehn Stunden am Tag. Er verspürte keine Schmerzen mehr, das Pochen im Rücken war verschwunden. Sein Körper hatte sich schließlich an die Arbeit gewöhnt, sogar angefangen, sie zu brauchen. Hin und zurück – die Schwielen an den Händen schützten ihn, die Klinge schnitt durch die struppigen Sträucher und mit jedem Schwung flogen Halme und Blätter weg, bis er eine vielleicht 60 Zentimeter breite Schneise geschlagen hatte. Mittlerweile war etwa die Hälfte geschafft. Das halbe Feld wurde nur noch von Stoppeln bedeckt; nun konnte es gepflügt und neu bepflanzt werden. Es blieb noch das steilere Stück. Ein Streifen mit Präriegras, Steppenläufern, Kakteen und anderen dürren Wüstengewächsen. Aber irgendwie gefiel es ihm. Es besaß grundsätzlich keine Bedeutung, und doch bedeutete es ihm etwas, hier und heute.
Es war ein Tag wie jeder andere. Warum hätte er auch anders sein sollen: Es gab die Sonne, den Himmel, Dornensträucher, die es zu stutzen galt, eine Sense, die er schwingen musste, ein Ziel, das er vor Augen hatte. In der einen Spur hinauf, in der anderen hinunter, das stete Schwingen der Klinge, die 60 Zentimeter breite Schneise, der ausbrechende Schweiß, das Gefühl, sich ganz zu verlieren in …
Dann entdeckte er das Auto.
Wer zum Teufel mochte das sein?
Er glaubte nicht, dass jemand wusste, dass er allein hier draußen in der Wildnis war, oder überhaupt jemand die seltsame Verknüpfung von Feldwegen kannte, über die man an diese Stelle gelangte. Nur Julie wusste davon. Also ging er davon aus, dass sie demjenigen, dem das Auto gehörte, davon erzählt haben musste. Bestimmt gab es einen guten Grund dafür.
Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen S-Klasse-Mercedes, ein schickes Auto, das einen Staubwirbel hinter sich herzog.
Bob sah zu, wie der Wagen ganz langsam zum Stehen kam. Zwei Männer stiegen kurz hintereinander aus.
Den einen erkannte er sofort: Thomas M. Jenks, ein Marine Colonel im Ruhestand und ein alter Freund von Bob. Er galt in Boise als relativ große Nummer, besaß ein Buick-Autohaus, einen Radiosender und das eine oder andere Einkaufszentrum. Ein äußerst netter Kerl, aktiv in der Marine Corps League, ein Mann, dem Bob vertraute. Der zweite war ein Asiate. Bob fand, dass er etwas an sich hatte, das ihn sofort als Japaner erkennbar machte, ohne dass er den Finger darauf legen konnte. Jetzt erinnerte er sich an einen Brief, der vor etwa einer Woche bei ihm eingetroffen war. Einen Brief, der eine Vielzahl verwirrender Fragen aufwarf.
Gny. Sgt. (a. D.) Bob Lee Swagger
RR 504
Crazy Horse, ID
Sehr geehrter Sergeant Swagger,
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie genießen Ihren wohlverdienten Ruhestand. Ich hoffe auch, Sie verzeihen mir diese Störung, denn ich weiß, dass Sie ein Mann sind, der großen Wert auf Privatsphäre legt.
Ich bin ein Colonel a. D. des USMC und leite die Historische Abteilung des Marine Corps in Henderson Hall, Arlington, VA – dem Hauptquartier des Marine Corps.
Seit einigen Monaten arbeite ich mit Philip Yano aus Tokio zusammen. Mr. Yano ist ein ausgezeichneter Mann. Ein früheres Mitglied des japanischen Heers, in dem er als Oberst und Bataillonskommandant gedient hat. Durch seine besonderen Aufgaben gelangte er in Kontakt mit einer Reihe amerikanischer und britischer Rekrutenschulen, darunter Einrichtungen der Ranger, der Luftstreitkräfte, der Special Forces und des britischen SAS, sowie mit dem Command and Staff College in Fort Leavenworth in Kansas. Außerdem besitzt er einen Master in Betriebswirtschaftslehre von der Stanford University.
Mr. Yano hat diesen Sommer im Rahmen eines Forschungsprojekts über die Militärkampagne von Iwojima von Februar bis März 1945 Recherchen auf Grundlage der Archive des Marine Corps angestellt. Da Ihr Vater in dieser Schlacht eine herausragende Rolle einnahm und zu den 23 Marines gehörte, denen für ihren Einsatz die Medal of Honor verliehen wurde, hofft er, mit Ihnen darüber sprechen zu können. Meines Wissens will er ein Buch über Iwo schreiben, aus japanischer Perspektive. Er ist ein höflicher, respektvoller und liebenswerter Mann und ein erstklassiger Berufssoldat. Ich hoffe, dass Sie Mr. Yano unterstützen werden.
Ich bitte Sie daher um uneingeschränkte Kooperation mit ihm. Vielleicht werden Sie nicht abgeneigt sein, mit ihm die Erinnerungen an Ihren Vater zu teilen. Wie ich schon sagte, er ist ein bewundernswerter Mann, der Respekt und Unterstützung verdient.
Ich werde den Kontakt zu Ihnen vermitteln und gehe davon aus, dass er sich im Laufe der nächsten Wochen bei Ihnen meldet. Vielen Dank und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen,
Robert Bridges
Leiter der Historischen Abteilung
Hauptquartier Marine Corps
Henderson Hall, VA
Bob hatte sich dieser Angelegenheit nicht gewachsen gefühlt. Beim Lesen des Briefes schoss ihm durch den Kopf: Ach du meine Güte. Was weiß ich denn schon darüber? Sein alter Herr hatte nie über solche Themen gesprochen. Auch er selbst hatte viele Jahre später nie von den Zeiten erzählt, als die Luft voll Blei gewesen war. Irgendwie gehörte das zum Leben eines Mannes an der Front. Man redete nicht über seine Erlebnisse.
Aber er wusste, dass sein Vater, der die Japaner drei Jahre lang auf schrecklichste Weise bekämpft, gehasst, getötet, in die Luft gesprengt und verbrannt hatte, ihr Volk auf merkwürdige Weise auch respektierte; auf eine Art, wie nur Todfeinde sich gegenseitig respektieren konnten. Es wäre eine Übertreibung gewesen, von Liebe zu sprechen; wahrscheinlich schossen auch Begriffe wie Vergebung und Wiedergutmachung über das Ziel hinaus. Aber von einer Heilung zu sprechen, hätte den Kern der Sache ungefähr getroffen.
Ihm hing noch das Bild vor Augen, wie der alte Herr in einem Drugstore gestanden hatte, es musste etwa ’52 oder ’53 gewesen sein, ein paar Jahre vor seinem Tod. Jemand hatte ihn gefragt: »Sag mal, Earl, diese Japsen, das sind ’n paar teuflische, kleine Äffchen, hm? Die hast du doch damals gleich haufenweise gegrillt, oder?« Und sein Vater war schlagartig ernst geworden, als hätte ihn jemand beleidigt. Er erwiderte: »Du kannst über die reden, wie du willst, Charlie, aber eins sag ich dir. Die waren verdammt gute Soldaten und haben standgehalten bis zum letzten Blutstropfen. Die haben sogar noch gekämpft, wenn sie in Flammen standen. Keiner hat je einem japanischen Infanteristen vorwerfen können, dass er nicht seine Pflicht getan hätte.« Dann hatte sein so redegewandter und dominanter Vater die Unterhaltung geschickt auf andere Themen gelenkt. Es gab bestimmte Sachen, über die er kein Wort verlor, vor allem gegenüber Leuten, die nicht selbst da draußen gewesen waren, an den Stränden dieser winzigen Inseln.
Bob widmete sich dem anderen Gentleman.
Er sah sich einen Mann in seinem Alter gegenüber, mit eckigem Kopf und kurzem, adrett geschnittenem Haar. Sein Blick wirkte beharrlich und er war stämmig, wo Bob schlaksig war. Selbst in dieser Hitze und auf diesem zerklüfteten Gelände trug der Mann einen dunklen Anzug mit Krawatte. Mit jeder Faser strahlte er militärische Würde aus.
»Bob«, begann Tom Jenks, »das ist …«
»Oh, ich weiß schon. Mr. Yano, der sich vor Kurzem …« Er hielt unwillkürlich inne, als er bemerkte, dass Mr. Yanos linkes Auge nur fast dieselbe Farbe hatte wie das rechte und sich nicht auf ihn fokussierte, obwohl es sich in Koordination mit dem anderen bewegte. Das ließ darauf schließen, dass es aus Glas bestand. In diesem Moment bemerkte er auch eine Linie oberhalb und unterhalb des Auges. Obwohl man ihn offenbar mit allem Geschick und Mitteln modernster Chirurgie behandelt hatte, dokumentierte diese Narbe, dass Yano eine hässliche Verletzung erlitten hatte. »… aus dem Militärdienst für sein Land zurückgezogen hat. Sir, es freut mich, Sie zu sehen. Ich bin Bob Lee Swagger.«
Mr. Yano lächelte, offenbarte eine kerzengerade Reihe weißer Zähne und verbeugte sich auf eine Art, wie Bob es bisher nur aus Filmen kannte: Die Verbeugung fiel tief und gleichzeitig herzlich aus, als ob sie dem Mann wirklich Freude bereitete.
»Ich möchte Sie wirklich nicht stören, Sergeant Swagger.«
Bob erinnerte sich, irgendwann einmal davon gehört zu haben, dass die Japaner sehr bescheiden waren und sich davor scheuten, jemandem etwas schuldig zu bleiben oder ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Aus diesem Blickwinkel konnte er verstehen, warum es dem Mann sinnvoller erschienen war, eine Stunde lang über Landstraßen zu fahren, anstatt ihn zu Hause aufzusuchen.
»Was kann ich denn für Sie tun, Sir?«, fragte Bob. »Es geht um ein Forschungsprojekt über Iwo, ja?«
»Zunächst, Sergeant Swagger, wenn Sie erlauben …«
Damit zog Yano eine kleine Geschenkschachtel aus der Tasche, verbeugte sich erneut und überreichte sie Swagger.
»Zum Dank dafür, dass Sie mir Ihre Zeit und Ihr Wissen zur Verfügung stellen.«
Bob war etwas verblüfft. Er legte keinen großen Wert auf Geschenke, Verbeugungen und andere Formalitäten, schon gar nicht, wenn er völlig verschwitzt bei 32 Grad auf seinem eigenen Grundstück im Wüstenhochland der Weststaaten stand.
»Tja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Sir. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen.«
»Die Japaner machen immer Geschenke«, erklärte Tom Jenks. »Das ist einfach ihre Art, Hallo und Danke zu sagen.«
»Bitte sehr«, schien der Japaner die Worte bestätigen zu wollen.
Die Box war so sorgfältig in Geschenkpapier verpackt, dass es ihm wie Blasphemie vorkam, sie zu öffnen. Aber er spürte die Erwartung, die auf ihm ruhte, also packte er das Geschenk aus. Er staunte über die raffinierte Faltung des Papiers. Als er es schließlich entfernt hatte, fand er einen kleinen Schmuckkasten vor und öffnete auch diesen.
»Oh, das ist aber toll.«
Ein kunstvoll gearbeitetes Miniaturschwert. Die winzige Klinge funkelte und der Künstler hatte den Griff mit verschiedenen Garnen umwickelt.
»Das Schwert ist die Seele eines Samurai, Sergeant Swagger. Da ich weiß, dass Sie ein großer Samurai sind, erbringe ich Ihnen dies zum Gruß.«
Bob fühlte sich auf merkwürdige Art gerührt über dieses Geschenk. Es kam so unerwartet, und in Anbetracht der erlesenen handwerklichen Qualität nahm er an, dass es ziemlich teuer gewesen sein musste.
»Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wirklich beeindruckend. Glauben Sie mir, den Samurai habe ich schon lange hinter mir. Ich kümmere mich jetzt nur noch um ein paar Ställe. Aber jetzt haben Sie meine Hilfsbereitschaft angestachelt. Also, was immer Sie interessiert, fragen Sie nur, und dann werd ich sehen, was ich dazu beitragen kann. Mein alter Herr hat nicht viel über den Krieg gesprochen.«
»Ich verstehe. Das tun nur wenige. Jedenfalls, wie sicherlich schon in Colonel Bridges’ Brief stand, habe ich die letzten paar Monate in Henderson Hall verbracht und dort die Originaldokumente über Iwojima studiert. Davor hielt ich mich fast ein Jahr lang in den Archiven des japanischen Verteidigungsministeriums auf und habe dort zum selben Thema geforscht. Aber Sie können sich vorstellen, dass die japanischen Aufzeichnungen eher lückenhaft sind.«
»Ja, Sir.«
»Ich habe mich am Ende hauptsächlich auf etwas konzentriert, das sich am 21. Februar ereignete, an einem Ort, der auf den japanischen Karten als Punkt I-Fünf bezeichnet wurde. Es handelte sich dabei um einen Bunker am Nordwesthang des Suribachi.«
»Ich weiß, was sich am 21. Februar am Nordwesthang des Suribachi abgespielt hat. Sir, eins möchte ich Ihnen noch sagen. Manchmal ist es nicht gut, zu genau hinzusehen und zu viel darüber zu erfahren, was im Krieg passiert ist. Im Krieg tun die Menschen Sachen, die sie zu jeder anderen Zeit, an jedem anderen Ort nicht einmal im Traum täten. Ich spreche da aus Erfahrung, Sir.«
»Das weiß ich.«
»Sie könnten dabei vielleicht etwas über unsere oder Ihre Leute erfahren, das Sie tief erschüttert.«
»Auch das ist mir bewusst. Aber es geht mir nicht um Gräueltaten oder um nationale Politik, nicht einmal um die Truppenbewegungen, also zum Beispiel, wie das 28. Marineregiment die Südspitze der Insel umrundet hat, um den Suribachi zu isolieren und dann anzugreifen. Es geht um etwas viel Persönlicheres. Ihr Vater hat den Bunker an Punkt I-Fünf zerstört und die meisten der Soldaten dort getötet. Ein bemerkenswerter, mutiger und heroischer Akt. Dafür empfinde ich nichts als Respekt. Diese Schlacht interessiert mich, weil mein Vater, Captain Hideki Yano, ein Infanterieoffizier der Kaiserlichen Armee gewesen ist. Er kämpfte im Zweiten Bataillon, 145. Regiment, und hatte das Kommando an Punkt I-Fünf, im Bunker am Nordwesthang des Suribachi. Mit anderen Worten: Ich glaube, dass Ihr Vater im Verlauf der Schlacht meinen Vater getötet hat.«
3 — Der Bunker
Earl versuchte gerade, ein leichtes Maschinengewehr vom Typ 96 in der nächstgelegenen Schützengrube auszugraben, als die Granaten explodierten. Obwohl er sich zwölf Meter entfernt aufhielt und sie in einer Vertiefung vor der Stahltür des Blockhauses gelegen hatten, traf ihn die Druckwelle und stieß ihn zu Boden. Er prallte auf einen toten Soldaten, dem er mit dem Kolben seiner Thompson das Gesicht zertrümmert hatte. Earls Blick streifte die scheußlich entstellten Gesichtszüge, die Schwellungen, die zerschmetterten Feinheiten des Gesichts und der Zähne, die aufgeblähten Lippen – rasch wandte er den Blick ab. Man musste sich darauf trainieren, solche Details auszublenden. Er wusste, dass er sich konzentrieren musste. Das Gewehr, das Gewehr!
Das 96 war zwar kein BAR, aber genug Feinde hatten damit genug Kugeln auf ihn verschossen, dass er gelernt hatte, es zu respektieren. Er musterte es und begriff sofort, wie es funktionierte; in den meisten Aspekten wiesen Maschinengewehre ziemliche Ähnlichkeiten auf. Er wühlte herum, suchte nach einer Munitionstasche, fand sie, nahm ein frisches Magazin zur Hand, schob es in den passenden Schacht, ließ es einrasten, tastete nach dem Spannhebel, entdeckte ihn, zog ihn zurück. Jetzt hob er das Gewehr, spürte, wie das am Ende des gerippten Laufs hängende Zweibein sich störend herumdrehte, und raste zur Rückseite des Bunkers. Falls jemand auf ihn schoss, bekam er es nicht mit.
Er ließ sich hinabgleiten. Die Tür war in Stücke gerissen und schwarzer Rauch quoll aus der Öffnung. Es glich einem Tor zur Hölle. Für so etwas brauchte man Flammenwerfer – ein einziger, reinigender Feuerstrahl von außen konnte in alle Winkel, Ecken und Ritzen vordringen und die Angelegenheit erledigen, sodass man nicht selbst hineinkriechen und schießend von Raum zu Raum wandern musste.
Er atmete noch einmal tief ein und betrat dieses unterirdische Reich, kämpfte sich durch den beißenden Rauch, den Gestank nach Latrinen, Blut und Nahrungsmitteln, die plötzliche, klamme Kälte der unterirdischen Kammern. Es kam ihm vor, als habe er ein Insektennest betreten.
Von links hörte er ein spechtartiges Pochen. Er drehte sich um und trat über eine Leiche hinweg. Bapp, bapp, bapp, bapp, bapp – das Hämmern des langsam feuernden, schweren Maschinengewehrs. Ein Durchgang führte in ein weiteres Verlies. Und da waren sie: drei Männer, die das große Nambu-Gewehr Typ 92 im Kaliber 7,7 Millimeter bedienten. Sie konzentrierten sich auf Ziele am Hang. Einer lokalisierte sie, einer feuerte und einer bestückte die mächtige Waffe mit Patronenstreifen. Sie kämpften bis zum Ende. Die Sprengung der Tür hatten sie nicht einmal bemerkt.
Es war glatter Mord. Normalerweise sah man nicht so deutlich, wie es passierte; man sah nur Gestalten, die sich bewegten, aufhörten, sich zu bewegen, oder verschwanden. Jetzt drückte Earl den Abzug, das Gewehr spuckte heißes Blei und die Leuchtspurgeschosse fegten die Männer in weniger als einer Sekunde von den Beinen. Es ging so elend leicht. Es fühlte sich falsch an, dass es kaum mehr Mühe bereitete, als Blumen mit einem Wasserschlauch zu gießen.
Die Waffe in seiner Hand entleerte sich zuckend. Die Soldaten begriffen nicht, wie ihnen geschah, sie fielen einfach um, wurden hierhin und dorthin geschleudert. Einer kämpfte noch dagegen an, ein anderer ging schlagartig zu Boden, ein weiterer sackte in sich zusammen, festgehalten und angestrahlt von den weiß-blauen, heißen Leuchtspurgeschossen, die auf ihn einprasselten. Nach einer Sekunde war alles vorbei.
Earl schwenkte zur linken Seite herum, geriet kurz ins Stolpern, schabte sich an der niedrigen Decke ein Stück Haut von der Stirn und machte sich auf den Weg zur nächsten Kammer.
Der Captain schüttelte sich Spinnweben, Glassplitter, tote Insekten und Staub vom Kopf. Ihm tat alles weh. Beim Atmen drang heiße, stinkende Luft in die Lunge und kratzte in der Kehle. Er hatte das Gefühl, in Rauch und Dunst zu ertrinken. Er griff sich an den Schädel, wollte den Schmerz herausquetschen, aber es half nicht. Wo befand er sich, was war geschehen?
Seine Kammer war am schwersten von der Explosion getroffen worden, die die Stahltür aufgesprengt hatte. Das große Nambu-Gewehr schoss nicht länger. Es hing schräg nach rechts und der Ladeschütze war entweder tot oder lag im Sterben. Jedenfalls ruhte er auf dem Rücken, Gesicht und Brust ein blutiges Etwas. Die Augen des jungen Mannes starrten ins Leere. Ein Splitter ins Gehirn oder in die Wirbelsäule hatte sein Bewusstsein innerhalb einer Mikrosekunde ausgelöscht, ein gnädiger Tod.
Es war Sudo aus Kyushu.
Du hast dich nicht im Feuer opfern müssen, dachte Yano. Ich habe Wort gehalten.
Aber ein anderer Gefreiter war zum Maschinengewehr gelaufen. Er mühte sich ab, es wieder richtig auszurichten. Ein dritter Mann half ihm, schien aber stark geschwächt zu sein, ebenfalls schwer getroffen.
Da hörte der Captain Schüsse in der Nähe und wusste, dass eins der haarigen Tiere eingedrungen war. Schnell griff er zur Pistole und stellte fest, dass die Explosion ihm den Gürtel weggerissen hatte. Er fühlte sich wehrlos, blickte sich um. Das Schwert lag rechts von ihm.
Er bückte sich und hob es auf. Es war natürlich lächerlich, dass japanische Offiziere und Unteroffiziere in dieser modernen Zeit immer noch mit diesen Zahnstochern in die Schlacht zogen. Mit solchen Schwertern konnte man höchstens chinesische Partisanen exekutieren oder damit auf Gruppenfotos und patriotischen Veranstaltungen posieren, aber nicht viel mehr. Trotzdem erfreuten sie sich bei der gesamten Armee großer Beliebtheit, was mit der tausendjährigen Tradition des Bushido-Kriegerkodex zusammenhing.