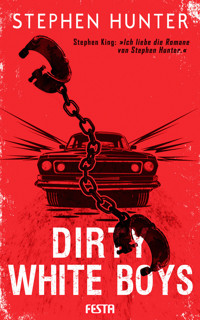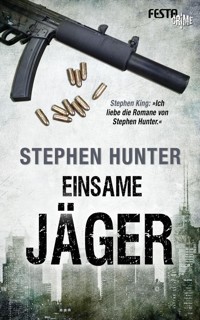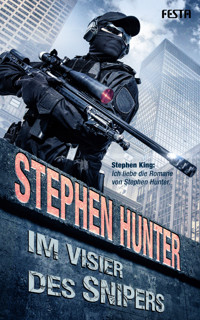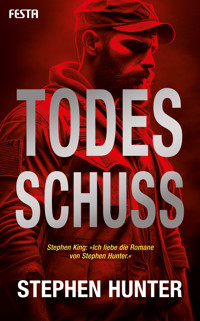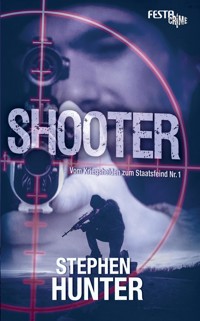4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bob Lee Swagger auf der Jagd nach den Mördern seines Vaters. Vietnam-Veteran Bob Lee Swagger ist mittlerweile 50 und sehnt sich nach einem ruhigen Leben mit seiner Frau und der gemeinsamen kleinen Tochter. Doch dann taucht ein junger Journalist auf und wühlt in der Vergangenheit: Warum kam Bobs Vater Earl als Staatspolizist vor 40 Jahren bei einer Schießerei wirklich ums Leben? Widersprüche zwischen der offiziellen Schilderung der Ereignisse und dem Tagebuch seines Vaters lassen Bob keine Ruhe. Er reist zurück in seine Heimat Arkansas, um die Vorfälle von damals zu rekonstruieren. Und die Operation Schwarzlicht nimmt ihren Lauf. Die Fortsetzung zum Hollywood-Blockbuster Shooter mit Mark Wahlberg. Chicago Tribune: 'Schnallen Sie sich gut an. Nachtsicht ist ein wilder Ritt, den man so schnell nicht vergisst.' New York Daily News: 'Nur wenige moderne Autoren können Hunter in Sachen Vorstellungskraft das Wasser reichen und dem Leser einen derartigen Adrenalinkick verpassen.' Publishers Weekly: 'Einer der talentiertesten im Thrillergeschäft. Die Story ist rasant, sorgfältig durchdacht und gipfelt in einem atemberaubenden nächtlichen Angriff.'
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Patrick Baumann
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Black Light erschien 1996 im Verlag Island Books.
Copyright © 1996 by Stephen Hunter
1. Auflage November 2014
Copyright © dieser Ausgabe 2014 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Clinton Lofthouse
Lektorat: Alexander Rösch
Alle Rechte vorbehalten
eBook 978-3-86552-338-9
www.Festa-Verlag.de
FÜR MEINEN SOHN JAKE.
»And it’s old and old it’s sad and old and weary I go back to you, my cold father, my cold mad father ...«
– James Joyce, Finnegans Wake
Kapitel 1
Heutzutage braucht man etwa eine Stunde, um von Fort Smith über den Harry Etheridge Memorial Parkway in südlicher Richtung nach Blue Eye in Polk County zu fahren. Dieser Parkway zählt zu den schönsten Straßen in ganz Amerika. Leider erzielte er nicht ganz die erwünschte Wirkung, Polk County in das Branson von West Arkansas zu verwandeln, zumal manche Zyniker aus der Gegend ihn statt als Parkway lieber als Porkway bezeichnen, weil auf ihm ständig Laster mit Schweinefleisch entlangrollen. An seinen Abfahrten reihen sich dicht an dicht Fast-Food-Restaurants und Großtankstellen mit im Wind flatternden Wimpeln. Die riesigen Schilder nationaler Motel-Ketten – Days Inn, Holiday Inn, Ramada Inn – kann man schon von Weitem sehen, obwohl die Motels nie mehr als halb ausgebucht sind und der erhoffte Aufschwung für Polk County nie so recht in Gang gekommen ist. Sobald man sich Blue Eye nähert, der Hauptstadt des Landkreises, verwandelt der Gebirgskamm der Ouachita Mountains die Landschaft auf eindrucksvolle Weise. Die Ouachitas sind die einzige von Osten nach Westen verlaufende Bergkette in Amerika, ein wogendes Meer aus mit Kiefernnadeln übersäter Erde und Felsen.
Die Schnellstraße wurde 1995 fertiggestellt, finanziert von Boss Harrys Sohn Hollis Etheridge, zu dieser Zeit Mitglied des US-Senats und später Präsidentschaftskandidat. Der Sohn wollte durch den Bau der Straße seinem Vater eine Art Denkmal setzen. Dieser war bettelarm in Polk County zur Welt gekommen und hatte sein Glück zuerst in der erbittert ausgefochtenen Bezirkspolitik von Fort Smith, danach im wahren Zentrum der Macht in Washington gesucht, wo er sich 15 Amtszeiten lang als Kongressabgeordneter und schließlich als Vorsitzender des Haushaltsausschusses für das Verteidigungsministerium abmühte. Es schien nur passend, dass Polk County und Fort Smith einen Mann ehrten, dem sie so viel Ruhm – und so großzügige finanzielle Unterstützung – verdankten.
Im Jahr 1955 gab es noch keinen Parkway, man konnte ihn sich zu dieser Zeit noch nicht einmal vorstellen. Man gelangte auf dem gleichen Weg von Blue Eye in die große Stadt, den schon Harry genommen hatte, als er nach dem Ersten Weltkrieg hierhergezogen war: über die gewundene, langsame Route 71, den beschissen armseligsten Witz von einer Schotterpiste, den man sich vorstellen konnte. Zwei Spuren schäbiger Asphalt, die sich durch Berge und Ackerland schlängelten. Alle zehn Meilen verbreiterte sie sich kurzfristig für kleine Kuhkäffer wie Huntington, Mansfield, Needmore, Boles oder das ärmlichste und erbärmlichste von allen: Y City. Insgesamt typisch für die ertragsarme Landschaft eines der elendsten Bundesstaaten der USA: Hügel, zu schroff, um sie zu bewirtschaften, Täler, in denen verzweifelte Männer sich am Rande des Existenzminimums durchschlugen und hier und da etwas Kulturland – doch in der Regel gab es nur die trostlosen Hütten von Farmpächtern zu entdecken.
An einem heißen Samstagmorgen im Juli dieses Jahres hielt ein schwarz-weißer Ford der Landespolizei am Straßenrand, nahe der Grenze zwischen den Landkreisen Polk und Scott auf der US 71, etwa zwölf Meilen nördlich von Blue Eye. Ein hochgewachsener Polizeibeamter stieg aus, nahm seinen Stetson ab und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Er trug die drei gelben Streifen eines Sergeants auf der Schulter und unter seinem grauen Bürstenschnitt besaß er den unbeirrten Blick und das unbeeindruckbare Gesicht eines Unteroffiziers, der in jeder Armee oder Polizei der letzten 4000 Jahre gedient haben könnte. Eine ganze Phalanx von Falten breitete sich in seinem wettergegerbten Gesicht aus, dessen Haut so viele Jahre in der Sonne gebraten hatte, dass sie einem Stück uraltem Leder ähnelte. Seine Augen hatte er zu Schlitzen zusammengekniffen. Scharfe Augen, denen nichts entging und die nichts verrieten. Seine Stimme klang so tief und rau, als ob jemand eine 300 Jahre alte Kiefer mit einer 300 Jahre alten Säge fällte. Sein Name lautete Earl Swagger, und er war 45 Jahre alt.
Earl sah sich um. Die Straße verlief hier an einem Hang entlang, sodass auf der einen Seite eine hohe Böschung aufragte, während das Land zur anderen Seite hin steil abfiel. Viel gab es nicht zu sehen, außer einer gottverdammten Reklametafel für Texaco-Benzin: nur ein dicht gewachsener Wald am Südhang, schwer zu durchqueren, ein dorniger Irrgarten aus Fichtenkiefern, Schwarzeichen, schwarzen Hickorybäumen und einem wirren Unterholz mit Dornbüschen und Arkansas-Yuccas. Staub schien in der Luft zu hängen; es gab keinen Wind, nicht den geringsten Hauch klarer Bergluft. Wenn man zurück in Richtung Blue Eye blickte, wurde einem die Sicht vom Buckel des Fourche Mountain versperrt, der wie eine riesige, grüne Wand wirkte. Auf der Straße war ein Gürteltier vom Sattelschlepper eines Holzfällers zu einer Mischung aus Fleisch, Blut und abgebrochenen Schuppen zerquetscht worden. Zikaden sangen in der stillen Hitze und klangen wie ein Quartett betrunkener Maultrommelspieler. Es hatte seit Wochen nicht geregnet: Waldbrandwetter. Das erinnerte Earl an andere heiße, staubige Orte, an denen er sich schon aufgehalten hatte: Tarawa, Saipan und Iwojima.
Er spähte auf seine Bulova. Er war früh dran, doch das traf auf den Großteil seines Lebens zu. 9:45 Uhr. Die anderen trafen erst in einer Viertelstunde ein. Earl setzte seinen Stetson wieder auf. Ein Colt Trooper Kaliber 357 steckte unter einer Lasche in einem Holster an der rechten Hüfte; er zog ihn hoch, weil das Gewicht der großen Pistole seinen Gürtel ständig nach unten rutschen ließ. Er empfand es als ständigen Kampf, die Waffe dort zu behalten, wo sie hingehörte. 30 glänzende Hochgeschwindigkeits-Teilmantelgeschosse steckten in den Gürtelschlaufen. Sie glänzten, weil er sie im Gegensatz zu anderen Cops jeden Abend aus den Schlaufen zog und abwischte, um zu vermeiden, dass die vom Leder angezogene Feuchtigkeit sie zum Rosten brachte. In seinen 15 Jahren beim Marine Corps hatte Earl zahlreiche Lektionen gelernt, die wichtigste: Halte deine Ausrüstung immer in Schuss.
Es wurde ein melancholischer Tag, obwohl er am Vorabend noch so viel Freude versprochen hatte: der 23. Juli 1955. Nach 90 Tagen entließ man Jimmy Pye aus dem Sebastian-County-Gefängnis bei Fort Smith. Jimmys Cousin Bub wollte sich mit ihm am Gefängnistor treffen, um mit ihm gemeinsam den Bus nach Polk County zu nehmen. Earl hatte angekündigt, sie dort um 16:30 Uhr abzuholen und Jimmy zu Mike Logans Sägewerk in Nunley zu bringen. Mike wollte Jimmy dort einen Job besorgen. Das war wichtig: Jimmy musste sich die Chance auf einen guten Neuanfang sichern, wenn er es schaffen wollte, und bei Gott, Earl hatte Jimmys Frau Edie versprochen, dafür zu sorgen, dass Jimmy diesmal auf der richtigen Seite des Gesetzes blieb.
1950, Jimmy feierte damals gerade seinen 16. Geburtstag, hatte Earl ihn zum ersten Mal widerwillig festgenommen, wegen eines gewöhnlichen Einbruchs. Das nächste Mal hatte er ihn 1952 erwischt, dann noch zweimal im Jahr 1953. Jedes Mal hatte Jimmy sich aus der Sache rausreden können, denn das zählte zu seinen Talenten: Er war nicht nur gut aussehend und der beste High-School-Sportler, den Polk County je gesehen hatte, sondern er verfügte auch über jede Menge Charme. Er brachte die Leute dazu, dass man ihn mochte. Hinter ihm lag eine wilde Jugend: Sein Vater war in Iwojima ums Leben gekommen und Earl hatte dem Sterbenden geschworen, sich um Jimmy zu kümmern. Auf einem Schlachtfeld geleistete Schwüre gewannen nach der Rückkehr in die Normalität zunehmend an Bedeutung. Earls Frau June hatte sogar einmal gesagt: »Earl, ich möchte wetten, dass du dich um diesen wilden Proletenjungen besser kümmerst als um deinen eigenen Sohn.« Earl wusste, dass das nicht stimmte, aber er wusste auch, dass es den Leuten wohl so vorkommen musste.
Wenn man Jimmy so ansah, wusste man einfach, dass er alles werden konnte, wovon sein Vater geträumt hatte: Er war klug genug, um aufs College zu gehen, und mit der richtigen Führung konnte er danach ein wunderbares Leben beginnen. Gerade vor vier Monaten hatte er mit 21 Jahren das hübscheste Mädchen in ganz Polk County geheiratet. Doch es war, als trage er irgendeine verdorbene Ader in sich: Immer wenn er etwas bekam, das für andere – Edie White zum Beispiel – unerreichbar schien, warf er es einfach weg.
Es versprach also ein feierlicher Tag zu werden, denn schließlich konnte man getrost annehmen, dass 90 lange Tage im Knast einfach jeden wieder zur Vernunft brachten: Jimmy und Edie konnten ein neues Leben anfangen, Earl kam all seinen Verpflichtungen gegenüber Jimmys Dad nach und sie alle konnten endlich wieder optimistisch nach vorne schauen.
Dann bemerkte Earl, wie ein anderes Fahrzeug in Sichtweite geriet: ein schwarzer Streifenwagen, der aus Blue Eye kommend die 71 entlangfuhr. Er hielt am Straßenrand. Ein Hilfssheriff aus Blue Eye, ein hagerer Mann namens Lem Tolliver, stieg aus und Earl erinnerte sich wieder, weshalb er hier war.
»Howdy, Earl«, rief der Deputy. »Sind wir zu spät oder bist du zu früh?«
»Ich bin zu früh. Außerdem sind die verdammten Hunde noch nicht hier. Ich hoffe, dass dieser gottverdammte alte Mann es nicht vergisst.«
»Wird er nicht«, entgegnete Tolliver. Dann wandte er sich um und öffnete die Hintertür. »Okay, Jungs, raus mit euch. Sind da.«
Zwei sonnenverbrannte Kerle in Häftlingskleidung kletterten heraus. Earl kannte sie: Lum und Jed Posey hatten mehr Zeit im Knast von Blue Eye verbracht als in Freiheit. Sie gerieten andauernd wegen irgendwelchem läppischen Kram mit dem Gesetz in Konflikt, für jede dumme Kleinigkeit, die man sich vorstellen konnte – meistens Whiskey-Schmuggel, für den die Jungs von der Bundespolizei zuständig waren, aber auch Bagatellgaunereien: Autodiebstahl, Ladendiebstahl – alles, womit sie sich etwas zu beißen verschaffen konnten. Doch Earl hatte sie bislang im Großen und Ganzen für harmlos gehalten.
»Sicher, dass ihr euch all den Aufwand für ein Niggermädchen machen wollt?«, fragte Jed Posey. »Was macht’s denn für ’n Unterschied? Sollen sich doch die Nigger selbst drum kümmern.«
»Halt die Klappe, Jed«, sagte Earl. »Verpass ihm eins, Lem, wenn er dir noch mal dumm kommt. Er ist zum Arbeiten hier, nicht zum Reden.«
»Ihr geht mit den Niggern immer lascher um«, moserte Jed. »Jeder weiß das. Überall werden die Nigger aufmüpfig. Man sagt, dass aus dem Norden Kommunistennigger hier runterkommen, um unsere eigenen aufzustacheln. Ist so ’ne Judensache. Diese Hebräer ham ’nen großen Plan, sich alles unter ’n Nagel zu reißen, werdet schon sehn, und den großen Niggern geben sie dann unsere Mädchen. Werdet schon sehn.«
»Jetzt halt aber den Rand, Jed«, sagte Earl. »Ich hab dich gewarnt. Normalerweise warne ich einen Mann nur einmal. Du bist’s, mit dem ich zu lasch umgehe.«
Earl war für seinen Mut und seine Zähigkeit bekannt; in einem fairen Kampf, selbst in einem unfairen, hätte er Jed Posey sämtliche Knochen gebrochen und sich mit dem Rest von ihm die Schuhe abgeputzt. Als Jed die Wut in Earls Augen aufflackern sah, wusste er, dass er sich besser zurückhalten sollte. Niemand legte sich mit Earl Swagger an.
»Ich quatsch doch bloß so daher, Earl. Hör gar nicht hin.«
Lem benutzte sein Taschenmesser, um ein Stück von einem Riegel Brown Mule abzusäbeln. Er steckte es sich auf der linken Seite in den Mund, wo es seine Wange ausbeulte wie ein Sack voller Goldstücke, und bot den Priem auch Earl an.
»Nein, danke«, sagte Earl, »das ist wenigstens mal eine gottverdammte schlechte Angewohnheit, die ich mir noch nicht zugelegt hab.«
»Du weißt nicht, was du verpasst, Earl«, grinste Lem mit aufgeblasener Backe und spuckte einen Spritzer von dem süßen braunen Saft aus, der am Straßenrand in einer Staubwolke landete.
In diesem Moment kam in einiger Entfernung das dritte und letzte Fahrzeug in Sicht. Eine Spur aus blauem Qualm hinter sich herziehend und mit seinem uralten Getriebe kämpfend, tuckerte ein 20 Jahre alter Nash den Hang hinauf, schien ein- oder zweimal schlappzumachen, bog aber schließlich von der Straße ab und kam neben den ersten beiden Wagen zum Stehen. Der Großteil des Dachs war mit einem Schneidbrenner entfernt worden, was dem Fahrzeug das Aussehen eines Pick-ups verlieh. Heraus sprang ein lebhafter, alter Kerl, dessen genaues Alter sich schwer einschätzen ließ. Sein Gesicht wurde von einem buschigen Bart und einer alten Lokführermütze halb verdeckt, dazu trug er einen schmutzigen Overall. Man konnte Pop Dwyer meilenweit gegen den Wind riechen, sagten die Leute, und an diesem Tag gab es keinen Wind, sodass Pops Körpergeruch Earl mit der Wucht eines Vorschlaghammers traf. Aber es waren nicht nur die Ausdünstungen eines ungewaschenen Mannes, sondern auch die von Hunden.
»Haltet mir diesen Alten vom Leib«, sagte Jed Posey. »Er stinkt wie ein elender Schweinestall.«
»Du riechst aber auch nicht mehr besonders gut seit der Sache letzte Nacht«, murmelte Lem Tolliver an seinem Priem vorbei. »Howdy, Pop.«
»Howdy, Leute«, sagte Pop und ließ sein verrücktes Grinsen durch den Bart blitzen. »Hab meine besten Jungs mitgebracht, Mr. Earl, genau wie Sie gesagt haben.«
»Gut«, meinte Earl und beobachtete, wie Pop zur Hinterseite des Trucks ging, sich dort an den Zwingern zu schaffen machte und drei sabbernde, zappelnde Hunde an die Leine nahm. Bei zwei davon handelte es sich um Bluetick Coonhounds, glatt, geschmeidig und muskulös unter ihrem hell schimmernden Fell, mit dunklem Zahnfleisch und voller Jagdeifer. Der dritte schien eine Art Beagle zu sein, die Schnauze war in schlabbrige Fleischfalten gehüllt.
»Mr. Mollie ist der Beste«, sagte Pop. »Wenn sich etwas finden lässt, wird der alte Mollie es finden. Diese anderen Welpen sind bloß dabei, um das verdammte Handwerk zu lernen. Mr. Mollie wird langsam alt.«
Die beiden Coons kläfften, zeigten ihre weißen Zähne und rosa Zungen und brachten dichten, schaumigen Speichel zum Vorschein. Sie konnten die Posey-Jungs auf Anhieb nicht leiden, weil sie Jeds Verachtung für Pop spüren konnten. Jed Posey wich zurück.
»Bleib mir bloß mit diesem verfluchten Luder vom Hals.«
»Ist gar kein Luder. Der hat ’n Schwengel so groß wie ’n Maiskolben, du Bauerntölpel«, erwiderte Pop. »Und ich selbst lass mich auch nicht an die Kette nehmen. Ich bin ’n freier Mann im Auftrag der Polizei.«
Die Hunde bellten in die träge, heiße Luft, wirbelten ihre Energie gegen die quälende Hitze und die Trockenheit des Holzes. Tatsächlich beunruhigten sie Earl ein wenig, obwohl er sonst dazu neigte, böse Vorahnungen einfach zu ignorieren. Doch während der Säuberungsaktionen auf Tarawa hatten Hundeteams aus dem zweiten Marine Corps die bombardierten Bunker und Unterstände durchkämmt und Jagd auf die wenigen noch lebenden Japsen zwischen all den toten gemacht. Um sie zu retten? Oh nein. Wenn die Hunde heulten und hastig aus einem Bunker herauskamen, hieß das, dass drinnen noch ein Japse atmete oder stöhnte. Dann wurden zwei oder drei Handgranaten hineingeworfen, gefolgt von dem Ruf »Volle Deckung!«. Nach den Explosionen sprühte ein Marine mit einem Flammenwerfer zehn Sekunden lang brennendes Benzin in den kleinen Raum, um ihn auszuräuchern. Das alles lag zwölf Jahre zurück, doch Earl würde es nie vergessen: das Gekläff der Hunde, den dumpfen Nachhall der Granaten, den Gestank von Benzin und Fleisch, das Summen der Fliegen.
»Haben Sie was, womit Mr. Mollie arbeiten kann?«, fragte Pop und schielte zu ihm hinauf. »Es klappt nicht, wenn er nichts hat, mit dem er anfangen kann!«
Earl nickte; nun verspürte er einen Anflug von Traurigkeit. Er griff auf den Rücksitz seines Streifenwagens und brachte den rosa Wollpullover zum Vorschein.
»Schauen wir mal, ob sie damit Witterung aufnehmen können«, meinte er und sah zu, wie Pop das zierliche rosa Kleidungsstück in seine riesige, schmutzige Pranke nahm und es den Hunden hinhielt, die es beschnüffelten und damit herumtobten. Einer der Coons bekam es zu fassen und verscheuchte die anderen beiden Hunde, doch beide zitterten und drängten sich erneut heran, bearbeiteten den Stoff mit Nasen und Zähnen, schienen ihn förmlich zu absorbieren oder aufzusaugen. Dann war es genauso schnell vorbei, wie es angefangen hatte: Die Hunde hatten den Duft irgendwie in ihr scharfes, aber beschränktes Hundebewusstsein eingebrannt. Das Objekt selbst interessierte sie nicht länger. Feucht und zerfleddert fiel es zu Boden.
»Sie wollten es doch nicht zurückhaben, oder, Mr. Earl?«, fragte Pop.
»Nein, nein, ist schon in Ordnung. Legen wir los.«
»Sicher, dass es die richtige Stelle ist?«
»Ich bin mir sicher«, bestätigte Earl. Er blickte über die Schulter: Dort, fast fünf Meter über der Erde, prangte der Slogan ›Texaco mit Anti-Klopf-Kraft und der Sky-Chief-Geheimzutat Petro X‹ über einem farbenfrohen Gemälde mit fünf tanzenden Tankstellenbediensteten. Momentan das ganz große Ding bei irgend so einer Show im verdammten Fernsehen, von der Earl zwar eigentlich nie gehört hatte und die ihn auch nicht juckte, von der er aber irgendwie doch wusste.
Auf die seltsame Art, wie der Verstand eines Polizisten manchmal funktioniert, war ihm ein Eintrag im Ereignisprotokoll des Polk County Sheriff Department aufgefallen, in das er aus Gewohnheit ein- bis zweimal die Woche einen Blick warf, obwohl er eigentlich nicht dafür zuständig war. Der schlichte Wortlaut: »Weiße Dame rief an, um zu sagen, dass sie gestern spätnachts in Richtung County-Grenze gefahren ist, als sie im Scheinwerferlicht einen sich seltsam benehmenden schwarzen Jungen direkt am Texaco-Schild bemerkt hat. Sie dachte sich, dass sie das besser meldet, weil sie viel über gefährliches und aufmüpfiges Verhalten von Schwarzen weiter im Süden gehört hat.«
Das war hängengeblieben, hatte sich in seinem Gedächtnis breitgemacht, auch wenn es an sich bedeutungslos zu sein schien. Doch dann war er in der vorigen Nacht spät nach Hause gekommen und hatte zu seiner Überraschung seinen Sohn Bob Lee allein im Mondlicht vor dem Farmhaus stehen sehen, mit der Davy-Crockett-Waschbärkappe auf dem Kopf, die er ständig trug. Bob Lee zählte zu den stillen, kopflastigen Jungen, ließ sich aber in der Regel nicht so schnell in Panik versetzen oder Angst einjagen.
»Was ist los, Sohn?«, hatte er gefragt.
»Da sind ’n paar Leute, die dich sehen wollen, Daddy«, erwiderte der Neunjährige. »Die woll’n aber nicht ins Haus gehen, obwohl Mommy sie drum gebeten hat.«
Etwas in der Stimme des Jungen verriet ihm sofort, dass etwas Merkwürdiges vor sich ging, und so war es auch: Ein schwarzer Mann und eine schwarze Frau standen stocksteif auf der Veranda und hatten offenbar Angst, Junes Gastfreundschaft anzunehmen.
Earl ging zu ihnen hinüber.
»Kann ich was für Sie tun?«
Es war für Schwarze extrem ungewöhnlich, Weiße zu Hause aufzusuchen – besonders, wenn es Fremde waren, besonders nach Einbruch der Dunkelheit. Daher wusste Earl in Sekundenschnelle, dass etwas nicht stimmte. Obwohl es ihm lächerlich vorkam, strich er beim Näherkommen mit der rechten Hand über die Holsterlasche, unter der sein Colt Trooper steckte, um für den Fall, dass er seine Waffe ziehen musste, schnellen Zugriff zu haben.
Doch schon im nächsten Moment wurde ihm klar, dass er überreagiert hatte.
»Mr. Earl, ich bin Reverend Percy Hairston von der Aurora-Baptistenkirche. Es ist mir wirklich unangenehm, Sie zu Hause zu belästigen, Sir, aber diese arme Dame hier ist so aufgewühlt und bei der Stadtpolizei hat man sie gar nicht richtig beachtet.«
»Ist schon in Ordnung, Percy. Schwester, wollen Sie sich nicht setzen und Ihre Sachen abstellen?« Er rief durch die Fliegengittertür: »June, kannst du diesen Leuten etwas Limonade bringen?« Dann wandte er sich erneut dem Paar zu. »Erzählen Sie mir einfach, worum es geht. Ich kann zwar nichts versprechen, aber ich werde mich damit befassen.«
Doch ein Teil von ihm schreckte davor zurück: Die Probleme der Schwarzen waren nicht gerade sein Spezialgebiet. Er hatte keine Ahnung, wie Neger lebten oder dachten; sie schienen sich damit zu begnügen, in einer Parallelwelt zu leben. Außerdem wusste er, dass sie dazu neigten, in heikle Schwierigkeiten von der Sorte zu geraten, in die sonst nur die absolute Unterschicht der Weißen geriet. Scheinbar stachen bei ihnen ständig Leute aufeinander ein, oder der Bruder des einen rannte mit der Frau des anderen in die nächstgrößere Stadt und ließ zu Hause zehn dürre Kinder und einen arbeitslosen Daddy zurück. Nichts davon ergab je einen Sinn, jedenfalls nicht für einen Weißen. Wenn man zuließ, da hineingezogen zu werden, kam man vielleicht nie mehr heraus. Eine Lebensweisheit des Polizisten lautete: Lass die Nigger ihre eigenen Wege gehen, solange sie uns nicht in die Quere kommen.
»Mr. Earl«, setzte die Frau an, die etwa 40 zu sein schien und einen großen Hut und ihre beste Sonntagskleidung trug, um bei ihrem Besuch bei einem weißen Polizeibeamten einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. »Mr. Earl, es geht um mein Mädchen Shirelle. Sie ist am Dienstagabend ausgegangen und nie zurückgekommen. Oh, Mr. Earl, ich hab so eine Angst, dass Shirelle was passiert ist.«
»Wie alt ist Shirelle?«, wollte Earl wissen.
»Sie ist 15«, antwortete die Mutter. »Das hübscheste kleine Ding in der ganzen Stadt. Meine süße, kleine Tochter.«
Earl nickte. Es klang nach einer typischen Niggertown-Sache: Das Mädchen wurde von einem adretten Kerl in einem schicken Anzug aufgegabelt, und er rauschte mit ihr davon zu dem, was sie ihre ›Buden‹ nannten, an der Westseite der Stadt, wo Musik und Tanz nie endeten und der Alkohol und Gott weiß was noch kostenlos die Runde machten, trotz der Tatsache, dass Polk County ein trockener Landkreis war. Dann machte sich der Kerl über das Mädchen her und setzte sie hinterher am Straßenrand aus. Vielleicht packte das Mädchen die Scham, nachdem sie aufwachte, und sie verließ die Stadt oder lebte fortan mit dem Kerl zusammen. Das konnte man nie so genau wissen; jedes Mal lief es ein bisschen anders ab und war doch immer dasselbe.
»Nun, meine Liebe«, sagte Earl, »möglicherweise hat sie einen jungen Mann getroffen und ist auf eine Party gegangen. Sie wissen doch, wie die jungen Leute heutzutage sind.«
»Mr. Earl«, meldete sich der Reverend zu Wort, »ich kenne Schwester Parker und ihre Familie jetzt schon seit fast zwei Jahrzehnten. Ich kenne Shirelle, seit ich sie getauft habe. Sie ist ein Kind des Herrn.«
»Halleluja und Amen, Jesus«, stimmte Shirelles Mama ein. »Meine kleine Tochter ist eine brave kleine Tochter.«
»Ja, Ma’am«, sagte Earl. Jetzt, wo sie ihm mit diesem ganzen Kirchenzeug kamen, begann er allmählich die Geduld zu verlieren.
»Wissen Sie, diese weißen Polizisten in der Stadt, diesen Jungs ist völlig gleichgültig, was einem Negermädchen passiert, selbst einem so kultivierten Negermädchen wie Shirelle«, meinte der Pfarrer erbittert.
Earl war überrascht, dass Percy es wagte, sich so deutlich auszudrücken; doch er wusste, dass es stimmte. Das Sheriff’s Department rührte keinen Finger, um die Probleme von Negern zu lösen oder ein Verbrechen unter Negern aufzuklären.
Und dann stellte Earl die Verbindung her: dieser merkwürdige schwarze Junge dort am Straßenrand, an einem Ort, an dem er nichts verloren hatte, spät in der Nacht, zu einer Zeit, zu der er dort ebenfalls nichts verloren hatte. Das Mädchen, das in derselben Nacht verschwunden war. Wer weiß?
»Ihr trinkt jetzt alle erst mal einen Schluck Limonade«, verkündete June, als sie mit einem Krug und zwei Gläsern auf einem Tablett aus dem Haus kam.
»Also gut«, sagte Earl. »Wie schon gesagt, ich werd mir die Sache mal ansehen. Ich kenne ein paar Jungs, die mir sicher das ein oder andere erzählen können. Und – nun ja, das ist alles, was ich momentan für Sie tun kann. Aber ich werde ihr eine faire Chance geben.«
»Oh, Mr. Earl, das ist so nett von Ihnen. Oh danke, danke, danke Jesus, du hast meine Gebete erhört«, stammelte die Dame, während Reverend Hairston versuchte, sie zu beruhigen.
Earl begleitete die beiden zurück zum alten Auto des Pfarrers, einem DeSoto aus der Vorkriegszeit, der schon unzählige Meilen auf dem Buckel hatte. Nachdem die Dame eingestiegen war, folgte er dem alten Mann und zog ihn beiseite.
»Percy, ich werde vielleicht etwas von Shirelle brauchen, falls es so weit kommt«, sagte er und spielte seine letzte Karte aus. »Sie wissen schon, ein Kleidungsstück, etwas, das sie dicht am Körper getragen hat. Können Sie sich darum kümmern, wenn Sie Mrs. Parker nach Hause fahren? Ich werde heute Nacht ein paar Anrufe machen, um ein paar Sachen zu klären und ein paar Leute zusammentrommeln, die ich kenne. Ich komme dann morgen früh bei der Kirche vorbei, sagen wir, gegen neun.«
»Ja, Sir. Wozu brauchen Sie denn die Sachen –«
Doch dann hielt der Alte inne und sah ihn an.
»Ich will damit nichts Bestimmtes sagen«, erwiderte Earl, »aber ja, wir müssen eventuell die Hunde einsetzen. Fahren Sie jetzt nach Hause und beten Sie, dass die Hunde morgen früh nichts finden.«
Earl gehörte zu den Menschen, die immer systematisch vorgingen. Bevor sie sich ans Werk machten, notierte er zuerst sorgfältig die Namen aller anwesenden Männer in großen, klobigen Buchstaben auf den Innenumschlag seines Notizblocks.
›Jed Posey‹, schrieb er. ›Lem Tolliver. Lum Posey. Pop Dwyer‹, und darunter: ›Suchteam 7-23-55.‹
»Earl?«
»Schon gut, schon gut«, sagte er, als er die Ungeduld in Lems Stimme hörte. »Okay, dann legen wir mal los.«
Der alte Mann hatte eine wunderbare Art, mit den Hunden zu arbeiten. Es hörte sich an, als ob er in einer geheimen Sprache mit ihnen redete, in einem leisen, sanften Vokabular aus Gemurmel, Flüstern, Schnalz- und Krächzlauten und dem prägnantesten Geräusch, einer Art Knutschlaut. Der kleine, dicke Beagle schien zu begreifen, dass er etwas Besonderes war; er gebärdete sich wie ein Filmstar, arbeitete nicht viel und beschnupperte den Boden mit affektierter Gleichgültigkeit, von allem unbeeindruckt. Die jüngeren, größeren Hunde tobten wilder und überschwänglicher herum; sie schäumten vor Ungeduld und Unreife. Pop lief mit ihnen die Straße etwa 800 Meter in jede Richtung ab. Keiner von ihnen reagierte auf irgendetwas; bloß einmal verstieß einer der Blueticks gegen die Jagddisziplin und hielt auf einen Waschbär zu, der in Panik über den Asphalt davonhuschte. Pop verpasste ihm einen heftigen Schlag und er reihte sich wieder hinter dem lässigen Oberspürhund ein.
Zur gleichen Zeit beäugten Earl, Deputy Tolliver und die Posey-Brüder das Buschwerk und suchten nach – nun, wer wusste schon so genau, wonach sie suchten? Anzeichen von Beschädigung? Spuren? Kleidungsstücke, Schuhe, Socken, Haarbänder? Aber sie entdecken nichts, abgesehen von einer Colaflasche, auf die Lum Posey stieß. Er säuberte sie sorgfältig und verstaute sie wegen des Pennys, die sie ihm einbrachte, in der Tasche seines Overalls.
Die Sonne stieg den Himmel hinauf und brannte noch unbarmherziger herab. Jed Posey murmelte etwas über Niggermädchen und darüber, für wie sinnlos er dies alles hielt, laut genug, dass man es hörte, jedoch nicht laut genug, um Earl damit zu provozieren. Earl spürte, wie der Schweiß sein Baumwollhemd durchtränkte und bemerkte, dass die anderen ebenfalls ihre Hemden durchschwitzten. Es herrschte eine fürchterliche Hitze.
»Tja, Earl«, erkundigte sich Lem, als sie jede Richtung abgeschritten hatten, »was willst du jetzt tun? Willst du in den Wald und den verdammten Hügel rauf? Deine Entscheidung.«
»Gottverdammt«, sagte Earl. Er schaute auf die Uhr. Bald Mittag. Jimmy Pye war jetzt frei. Er wartete sicher mit Bub an der Fort-Smith-Haltestelle. Earl kannte den Fahrplan auswendig. Der Bus nach Blue Eye fuhr erst um halb zwei ab.
»Äh, vielleicht geben wir der Sache noch ’ne Stunde oder so. Dann kann zumindest keiner behaupten, dass ich’s nicht versucht hätte.«
»Mr. Earl?«
»Was ist denn, Pop?«
»Meinen Hunden wird heiß. Die können bei diesem Wetter nicht mehr viel länger arbeiten.«
»Pop, du wirst schon deine verfluchten 75 Cent die Stunde vom Staat kriegen, aber du bist erst dann fertig, wenn ich sage, dass du’s bist.«
Scheiße! Earl wollte auch nicht länger bleiben. Er musste noch ein paar Nachforschungen anstellen. Ihm kam die Idee, mit einem Nigger zu reden, den er kannte und dem eine Billardhalle im Westen Blue Eyes gehörte. Das könnte vielleicht einen Versuch wert sein. Ihm blieb immer noch genug Zeit, bis Jimmys Bus eintraf.
»Lasst uns noch ungefähr 100 Meter durch diese verfluchten Bäume laufen und diesen elenden Wald durchkämmen«, rief er. »Haltet die Augen offen, Jungs.«
Jed Posey rotzte als Kommentar zu dieser Entscheidung einen dicken, gelben Klumpen in den Dreck, wagte es aber nicht, Earls stechendem Blick zu begegnen. Der alte Mann zerrte hart an den Leinen der drei Tiere und der kleine Trupp machte sich zu den Bäumen auf.
Als sie in den Wald eindrangen, schien sich das Land gegen sie zu wehren. Der Hang wurde steiler und das Gehen mühselig; kein klarer Weg führte zwischen den dicht stehenden Kiefern hindurch und die Dornensträucher zerkratzten ihnen die Beine. Das Sonnenlicht fiel in schrägen Garben durch die Dunkelheit, doch es war kein kühles Dunkel, sondern ein heißes, beengtes. Schweiß brannte Earl in den Augen.
»Gottverdammt!«, fluchte Jed Posey, als er zum zehnten Mal in ein Dornengestrüpp stolperte und seine Frustration wuchs. »Das ist hier kein verdammtes Picknick, Earl. Das ist keine Arbeit für Weiße. Hol dir ein paar Nigger, wenn du dich durch diese Scheiße hier kämpfen willst.«
Earl konnte nicht anders, als ihm zuzustimmen. Es hatte keinen Zweck. Man konnte kaum drei Meter weit sehen. Überall wirbelte Staub auf.
»In Ordnung«, gab sich Earl geschlagen. »Hauen wir hier ab.«
»Mr. Earl?« Pops Stimme.
»Wir gehen, Pop. Hier draußen ist nichts.«
»Mr. Earl, Mollie hat was gewittert.«
Earl sah genauer hin. Die zwei dümmeren, jungen Hunde waren zusammengebrochen, hatten die Köpfe auf den Boden gelegt und ließen ihre nassen rosa Zungen aus halb geöffneten Mäulern hängen. Ihre Körper bebten vor Anstrengung und Enttäuschung. Aber Mollie hockte still da, den Kopf geneigt, sein Blick fragend und sehr ruhig. Dann fing das Tier an zu jaulen. Der Klang schien aus irgendeiner anderen Öffnung als der Kehle zu kommen: durch und durch animalisch, ein einzelnes, kehliges Aufheulen unterschiedlicher Klangfarben und Bedeutungen. Dann sprang er auf, drehte sich im Kreis, wedelte aufgeweckt mit dem Schwanz und reckte die Nase vor.
»Er hat sie, Mr. Earl«, sagte Pop. »Sie ist hier.«
»Verflucht«, rief Jimmy Pye. »Gott im Himmel, Junge, dreh an diesem verflixten Rädchen! Ich brauch was auf die Ohren!«
Jimmys Haar war blond, ziemlich lang und mit Pomade geglättet, die es in der Sonne glänzen ließ wie eine Platte aus Blattgold über seinem schönen, fein geschnittenen Gesicht.
Bubs dicke Finger drehten am Regler, aber die Musik, von der Jimmy behauptete, sie gehört zu haben, während Bub die Sender durchging, schien verschwunden zu sein.
»J-j-Jimmy, ich kann ihn nicht f-f-f…«
»Spuck’s aus, Junge. Mach schon, spuck’s aus.«
Aber Bub konnte nicht. Das Wort blieb irgendwo zwischen Hirn und Zunge hängen, klebte in einem Sirup aus Frustration und Schmerz fest. Herrgott noch mal, wann lernte er endlich zu sprechen wie ein normaler Mensch?
Bub war 20 Jahre alt, ein dicklicher, schwerfälliger Kerl, der als Schreinergeselle bei Wilton’s Construction in Blue Eye gearbeitet hatte – bis zu seiner vorzeitigen Entlassung, weil er den Dreh bei der Sache nie so ganz herausbekam. Er war mit einer absoluten Bewunderung für seinen älteren Cousin aufgewachsen, dem besten Runningback, den Polk County je hervorgebracht hatte, mit einem Batting Average von .368 in seinem letzten Schuljahr an der Polk High. Jimmy hätte entweder in die Minor Leagues oder an die University of Arkansas gehen können. Dummerweise landete er stattdessen im Gefängnis.
In diesem Moment empfand Bub mehr als Bewunderung, vielleicht sogar Liebe. Denn Jimmys goldene Macht schien in der Luft zu hängen und die magische Versprechung ungeahnter Möglichkeiten mit sich zu bringen.
»Na los, Junge«, johlte Jimmy mit fröhlich leuchtendem Gesicht. »Such mir ein bisschen Musik. Nichts von diesem Nigger-Scheiß. Auch keinen Hillbilly-Scheiß. Nein, Sir, ich will Rock-and-Roll hören, ich will Rock around the Clock von Mr. Bill Haley und seinen gottverdammten Comets hören.«
Bub jagte den Sendern hinterher, ging die Frequenzskala nach links und rechts auf der Suche nach einem starken Signal von einer Station in Memphis oder St. Louis durch, doch aus unerfindlichen Gründen spielten die Götter nicht mit und genau der ›Scheiß‹, den Jimmy nicht wollte, ertönte laut und deutlich, sei es KWIN aus Little Rock oder dieser Schwarzensender KGOD aus Texarkana. Aber Jimmy wurde nicht wütend. Er fand Gefallen an Bubs Bemühungen und verpasste ihm einen kleinen Klaps auf die Schulter.
Jimmy saß am Steuer. Wo zur Hölle hatte er ein Auto herbekommen? Tja, verflucht noch mal, Bub war derart von Liebe überwältigt gewesen, als er beim Gefängnis im westlichen Fort Smith ankam, dass er einfach nicht danach gefragt hatte, und Jimmy hatte es ihm nicht erklärt. Das Auto war eine gottverdammte Schönheit, ein schnittiger, weißer Fairlane mit Fordomatic-Schaltung, ein Cabrio obendrein. Es wirkte funkelnagelneu, als sei es gerade eben aus einem Autosalon gefahren worden. Jimmy fuhr den Wagen wie ein Gott. Er sauste über die Rogers Avenue, scherte aus und fädelte sich wieder ein, donnerte an den langsameren Fahrzeugen vorbei, hupte fröhlich und winkte mit dem sexy Selbstbewusstsein eines Filmstars, wann immer weibliche Teenager in Sicht kamen.
Jedes Mal winkten die Mädchen zurück, und das gehörte zu den Sachen, die Bub ein wenig verwirrten. Jimmy war verheiratet. Mit Edie White, der Tochter der Witwe von Jeff White. Eine legendäre Schönheit. Warum winkte Jimmy trotzdem fremden Mädchen zu? Bei ihm war doch alles in trockenen Tüchern, geradezu perfekt. Mr. Earl hatte Jimmy eine Arbeit im Sägewerk in Nunley besorgt und er konnte gemeinsam mit Edie in einem Häuschen am Rand von Nunley leben, auf der Rinderfarm des verstorbenen Rance Longacre. Connie Longacre, Rances Witwe, hatte gesagt, sie könnten es umsonst haben, wenn Jimmy beim Viehtrieb mit anpackte. Währenddessen konnte er im Sägewerk ein Handwerk lernen. Vielleicht schaffte er es sogar, später einen leitenden Posten zu übernehmen. Alle wünschten sich, dass es klappte.
»Schau dir die Mädels an«, sagte Jimmy, als das Auto an einem Pontiac-Kombi vorbeiraste. Vier hübsche blonde Mädchen, die aussahen wie Cheerleader, lächelten, als Jimmy rief: »Hey, ihr Hübschen, wollt ihr mit uns ein Eis essen?«
Die Mädchen prusteten los, denn Jimmy sah so gut aus und flirtete so unverschämt, dass sie wussten, dass er es nicht ernst meinen konnte. Doch Bub war derjenige, der bemerkte, dass sie die Mittellinie überquert hatten und ein Lastwagen genau auf sie zukam.
»J-j-j-j...«
»Oder wie wär’s mit Autokino, wir könnten zum Sky-Vue fahren und uns Jail Bait anschauen«, brüllte Jimmy.
Der Lastwagen war –
Der Lastwagen hupte.
Die Mädchen schrien.
Jimmy lachte.
»J-j-j-j...«
Mit einer schnellen Bewegung aus dem Handgelenk riss Jimmy das Steuer herum, trat aufs Gas und ließ den Wagen mit athletischem Geschick in den winzigen Zwischenraum zwischen dem Kombi auf der rechten Seite und dem auf sie zurasenden, quietschend bremsenden, hupenden Lastwagen schießen. Er kam wieder in die Spur und preschte weiter.
»Wuuuuuuui!«, machte Jimmy. »Ich bin endlich ein freier Mann!«
Er nahm die nächste Abfahrt links, schlitterte über den aufgewirbelten Schotter und fuhr in Richtung Innenstadt zurück.
»Jetzt such mir schon ein bisschen Musik, Bub Pye, du alter Hund, du.«
Bub fand etwas, das ihm bekannt vorkam und zumindest den hämmernden Rhythmus besaß, den sein Cousin jetzt brauchte.
»Das is ’n Nigger«, sagte Jimmy.
»N-n-n-n-nein«, brachte Bub hervor. »Der Kerl ist weiß. Er klingt aber wie ein Nigger.«
Jimmy hörte zu. Es war ein Weißer. Ein Weißer mit Rhythmusgefühl. Ein Weißer, der einen Nigger in sich trug, voller Pisse und Wichse, heiß und gefährlich.
»Wie heißt dieser weiße Junge?«, wollte er wissen.
Bub konnte sich nicht erinnern. Es war etwas Neues, irgendein Name, den er sich nicht merken konnte.
»Weiß nich mehr.«
»Tja, du bist eben zu nichts zu gebrauchen«, entgegnete Jimmy mit einem dicken, fetten Grinsen und gab ihm damit indirekt zu verstehen, dass es ihn nicht störte.
Jimmy schielte auf seine Armbanduhr. Er schien genau zu wissen, wo er hinfuhr. Bub war vorher nur ein paarmal in Fort Smith gewesen. Er hatte keine Ahnung.
Nach kurzer Zeit hielt Jimmy an.
»Ist fast Mittag«, sagte er. Sie befanden sich auf einer viel befahrenen Straße, dem Midland Boulevard, gegenüber von einem großen Lebensmittelladen. ›IGA Food Line‹ stand auf dem Schild. Es musste das größte Lebensmittelgeschäft sein, das Bub je gesehen hatte.
»Meine Fresse«, sagte Jimmy. »Siehste das, Bub? Guck dir an, wie viele Leute bei so einem Laden rein- und rausgehen. Und die haben alle gerade ihr Geld für Essen ausgegeben. Zur Hölle noch mal, Junge, da drin müssen 50 ... na, eher 60.000 Dollar liegen.«
Bub fragte sich, wovon zum Teufel Jimmy redete. Irgendetwas daran gefiel ihm nicht.
»J-j-j-j-j...«
Aber verdammt, was hatte Jimmy für ein Glück!
One, two, three o’clock, four o’clock ROCK,
five, six, seven o’clock, eight o’clock ROCK,
nine, ten, eleven o’clock, twelve o’clock ROCK,
We’re gonna ROCK around the clock tonight!
We’re gonna ROCK ROCK ROCK till broad daylight!
Die freigelassenen Hunde fanden sie. Earl hörte ihr wildes Gebell, ihre sich vor Aufregung überschlagenden Stimmen.
»Die Hunde werden doch nicht ...«
»Die werden nichts anrühren«, versicherte Pop.
»Hier drüben, hier drüben«, rief Jed Posey. »Himmel, Arsch und Zwirn, hier drüben!«
Earl kämpfte sich schwer atmend den Hügel hinauf, durch die Bäume und Dornensträucher, und brach auf eine Art Lichtung durch. Hier gab es keinen Schatten mehr, weshalb die Hitze ihn mit ihrer vollen, mörderischen Wucht traf.
Er sah Jed keuchend vor einem Bachbett mit Schiefergestein stehen. Die Erde war steinig und zerklüftet, die Sonne brannte unerbittlich. Die Hunde saßen gehorsam auf der anderen Seite des Bachbetts und bellten, als wollten sie den Teufel vertreiben. Aber der Teufel war bereits hier gewesen und hatte sein Werk verrichtet.
Shirelle lag auf der Seite. Ihr rosafarbenes Gingham-Kleid war über ihre Hüften hochgestreift, ihr Slip fehlte und man hatte ihr die Bluse vom Leib gerissen. Aber sie konnte sich nicht mehr für ihren Aufzug schämen. Ihre Augen waren weit aufgerissen und erloschen. Ihre Haut wirkte grau, fast farblos, mit Staub überzogen. Ihr Körper war stark aufgedunsen, aufgebläht wie ein Ballon. Die linke Seite ihres Gesichts hatte sich zu einem gewaltigen, gelblichen Wulst verformt, mit einem blutverkrusteten Riss bedeckt, dort, wo jemand sie mit einem Stein erwischt hatte. Einen Meter von ihr entfernt lag dieser Stein. Etwas Schwarzes klebte daran.
»Man kann ihre Möse sehen«, sagte Jed. »Kommt her, schaut euch das an, man kann ihre Möse sehen.«
Das konnte man natürlich. Earl sah etwas, das er für eine schwarze Blutspur hielt, sowie Prellungen und Schürfwunden am Geschlecht der Kleinen. Das Summen von Fliegen. Verwesungsgestank.
Bei drei großen Inselinvasionen hatte Earl den Tod in all seinen Formen zu Gesicht bekommen. Mehr als nur einmal hatte er ihn auch selbst gebracht. Doch das Mädchen sah so zerstört und weggeworfen aus, so entstellt von den Gasen, die sich in ihr gesammelt hatten, zurückgelassen am Hang eines rauen Berges. Es brach ihm das Herz, obwohl er geglaubt hatte, nichts könne es ihm mehr brechen nach dem langen Marsch durch das seichte Meerwasser vor Tarawa, den Flammenwerfer-Angriffen auf Saipan und dem Töten aus nächster Nähe mit der Tommy Gun auf Iwo – es waren viele, so viele gewesen. Kein Japse und kein toter amerikanischer Junge hatte je so sinn- und nutzlos dahingeschlachtet ausgesehen.
Lem Tolliver spuckte geräuschvoll seinen Priem aus.
»Diese Nigger«, fluchte er. »Was die mit ihren eigenen Leuten anstellen! Wir hätten sie nie hier rüberbringen sollen. Die gehören zurück in den afrikanischen Dschungel.«
»Lem«, sagte Earl, »du bringst diese Jungs hier weg und gehst dann zu meinem Auto. Ich will, dass du ...«
»Hey, Earl«, unterbrach Jed Posey. Jeds Bruder lachte.
»Hey, Earl, was dagegen, wenn ich noch schnell meinen Spaß mit ihr habe? Ich meine, ich könnte ja noch kurz drübersteigen, bevor du sie einpacken lässt. Ihr wird’s nichts mehr ausmachen. Und ’ne Jungfrau ist sie ja sicher auch nicht mehr.«
Earl traf Jed mit der geballten Faust kurz unter dem Ohr, am Kieferansatz; ein kurzer, brutaler, vollkommen befriedigender Schlag. Er traf den Kerl so hart, dass er nach hinten geschleudert wurde und sich auf die Zunge biss, was eine furchtbare Wunde verursachte. Blut begann aus Jeds Mund zu strömen und dunkle Flecken auf seinem Overall zu hinterlassen. Eine Staubwolke stieg auf, als er noch etwas zappelte und dann still liegen blieb. Er hatte eine Hand zu einer Geste des Aufgebens erhoben. Earl trat auf ihn zu, als ob er ihn noch weiter in die Mangel nehmen wollte. Jed wich auf allen vieren hastig zurück. In seinem Gesicht zeichnete sich die Angst eines Mannes ab, der weiß, dass er klar unterlegen ist.
»Hör auf, ihn zu schlagen, Earl«, flehte Lum Posey.
»Schaff dieses Stück Scheiße hier weg«, sagte Earl zu Lem. »Ich will, dass er verschwindet. Du gehst zu meinem Auto, rufst über das verdammte Funkgerät die Polizeikaserne in Greenwood und sagst ihnen, dass es ein sehr schlimmer Zehn-39 ist. Ich will, dass das Ermittlungsteam so schnell wie möglich herkommt. Und die Spurensicherung, nur für den Fall, dass unser Mann Fingerabdrücke oder so was hinterlassen hat. Lass sie Sam Vincent benachrichtigen. Ich will ihn als Repräsentanten der Staatsanwaltschaft hier haben. Er wird derjenige sein, der mir hilft, diesen Drecksack auf den Stuhl zu bringen. Ruf deinen Sheriff und sag ihm, dass ich seine Leute hier draußen haben will, um den Tatort abzusperren und nach Beweismaterial zu suchen. Ruf den Gerichtsmediziner, die Leiche muss gründlich untersucht werden. Hast du verstanden, Lem?«
»Hab ich, Earl.«
»Pop, du lässt deine Hunde jetzt ausruhen und fressen. Bring sie in den Schatten. Wir brauchen sie vielleicht noch mal, um die Witterung von dem Kerl aufzunehmen, der das getan hat. Verstanden, Pop?«
»Ja, Sir.«
»Dann los, auf geht’s.«
Die Männer liefen den Hügel hinab. Lum Posey half seinem blutenden Bruder.
Dann war Earl mit der Leiche allein.
Okay, kleines Mädchen, dachte er. Wird Zeit, dass du mir etwas verrätst, damit ich den finden kann, der dir das angetan hat. Ich schwör dir: Ich werd ihn erwischen, und ich werd zusehen, wie er auf dem Stuhl schmort.
Earl war weder Sherlock Holmes, noch einer von diesen Großstadtcops von der Mordkommission. Er hatte bislang noch nie einen Mordfall bearbeitet, bloß Tötungsdelikte, bei denen die Identität des Täters anhand von Zeugenaussagen oder bekannten Motiven bereits feststand. Dies war anders: eine Leiche, die seit fast einer Woche hier gelegen hatte. Ein echtes Rätsel. Es ging über alles hinaus, womit Earl sich bisher auseinandergesetzt hatte. Doch Earl Swagger war ein ernsthafter, professioneller Polizeibeamter. Er hatte sich den Prinzipien von Pflicht und Gerechtigkeit verschrieben, war regelrecht besessen von ihnen. Sein konsequenter Verstand sah nur eine einzige Möglichkeit, wie diese Sache ausgehen konnte: mit der Hinrichtung des Mörders. Bis dahin würde er das Gefühl haben, dass ein großes Loch im Mauerwerk des Universums klaffte. Und es lag an ihm, dieses Loch zu stopfen.
Er ging methodisch vor, achtete weder auf den Geruch des Todes, der in der Luft hing, noch auf die summenden Fliegen, noch auf die Obszönität der Tat selbst. Als Erstes: eine Zeichnung des Tatorts. Später rückten die Polizeifotografen an, um zu tun, was sie zu tun hatten, aber er wollte den allgemeinen Zustand des Körpers und die genaue Position zur Umgebung für seine eigenen Ermittlungen festhalten. Er benutzte die Methode der Triangulation, die sich bei Tatorten unter freiem Himmel stets als hilfreich erwies, wenn keine Grundlinie wie etwa eine Straße existierte, an der man sich orientieren konnte. Als drei Punkte wählte er den am nächsten stehenden Baum, etwa siebeneinhalb Meter oberhalb vom Kopf des Mädchens, den Rand des unbewachsenen Bachbetts, in dem sie lag, und einen Stein, der ein Stück weiter rechts aus dem Erdboden ragte. In groben Zügen skizzierte er eine Strichmännchenversion ihres geschändeten Körpers und verortete ihn zwischen diesen Orientierungspunkten.
Anschließend suchte er die unmittelbare Umgebung nach Fußabdrücken oder anderen Spuren am Boden ab, außerdem nach Beweisstücken, die Rückschlüsse auf den oder die Täter zuließen, die das Mädchen hergebracht oder hier liegen gelassen hatten. Doch der Boden erwies sich an dieser Stelle als so hart und trocken, dass er keine Abdrücke fand. Stattdessen wehte eine Brise, die Shirelles Kleid lüftete und Staubwolken aufsteigen ließ. Dann verschwand sie ebenso schnell, wie sie gekommen war.
Earl trat an den Leichnam heran. Später würde das Ermittlungsteam, die Profis, eine gründlichere Untersuchung auf mikroskopische Informationen vornehmen: Stofffasern, Körperflüssigkeiten, möglicherweise Fingerabdrücke, Blutflecken – solche Sachen. Aber vorher wollte er von dem armen Kind so viel in Erfahrung bringen, wie er konnte.
Sprich mit mir, Kleine, dachte er und spürte, wie ihn eine Welle so schmerzhafter Zärtlichkeit überkam, dass er es kaum aushielt. Etwas in ihm sehnte sich danach, sie aufzuheben und in seinen Armen zu wiegen, um ihren Schmerz zu vertreiben. Doch es gab keinen Schmerz, es gab nicht einmal mehr sie, nur ihre aufgeblähten Überreste. Ihre Seele befand sich bei Gott. Er schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu verscheuchen, und sprach noch einmal im Geiste mit ihr: Komm jetzt, verrat dem alten Earl, wer dir das angetan hat.
Er sah in ihre leeren, ausdruckslosen Augen, wie sie dort auf so brutale Weise hingestreckt lag, registrierte die Blutflecken an ihrem Körper, die Prellungen und Hautabschürfungen und etwas Heißes, hoffnungslos Unprofessionelles schlich sich in seinen Verstand ein: Er sah sein eigenes Kind, diesen ernsten, düsteren, fleißigen kleinen Jungen, der fast nie zu lachen schien, sah Bob Lee, auf die gleiche Weise entführt und zugerichtet und liegen gelassen, bis die Verwesung ihn dermaßen anschwellen ließ, dass seine Gesichtszüge in die Breite gezerrt wurden. Für eine Sekunde hörte Earl auf, ein Polizist zu sein, und war nur noch ein Rache suchender Vater. Wie durch einen roten Nebel nahm er wahr, wie er demjenigen, der diese Tat begangen hatte, im Namen aller Väter der Welt eine Ladung Schrot ins Herz verpasste.
Doch dann kam er wieder zu sich und beruhigte sich, stellte sich trockene, professionelle Fragen, konzentrierte sich auf Details, die man leicht messen, schnell in Erfahrung bringen konnte. Ihr Körper war ziemlich staubig. Etwa deshalb, weil sie hier schon so viele Tage lag? Möglich, aber wahrscheinlicher erschien es ihm, dass sie an einem anderen Ort ermordet und dann hier abgelegt worden war. Wenn es sich bei diesem Stein wirklich um die Mordwaffe handelte, hätte es viel mehr Blut geben müssen.
Er bückte sich und betrachtete das geronnene Blut unter ihrem Kopf. Das Fließmuster verlief regelmäßig und es gab keinerlei Spritzer, nur eine Lache. Das wies darauf hin, dass das Blut geronnen und nur langsam aus der Wunde ausgetreten war. Hätte das Mädchen bei ihrer Ermordung gezappelt, wäre es viel weiter verteilt worden. Also ging er davon aus, wer immer dies getan hatte, musste ihr nach dem Tod den Schädel mit einem Stein eingeschlagen haben, um es so hinzustellen, als habe er sie hier getötet. Aber warum? Welchen Unterschied machte das? Er beugte sich dicht an ihre Kehle heran: Ja, unter der grauen, gedunsenen Haut waren Quetschungen sichtbar. Hatte man sie etwa erwürgt und nicht erschlagen? Er hielt diese Vermutung in seinem Notizbuch fest.
Dann sah er, wo ihre verrutschte Bluse ein Stück ihrer Schulter freigab, eine rote Schliere, die nicht von etwas Feuchtem herrührte, sondern von etwas Trockenem. Er berührte ihn. Staub, roter Staub. Hmmm? Er betrachtete ihre Hand und öffnete sie vorsichtig. Er beugte sich hinunter, um ihre Nägel zu untersuchen: Unter allen vier Fingern fand sich eine halbmondförmige Ansammlung von etwas, das Blut hätte sein können, aber eher wie der gleiche rote Staub aussah, den er an ihrer Schulter gefunden hatte. Die Leute von der Spurensicherung konnten das sicherlich genauer bestimmen.
Roter Staub? Roter Lehm vielleicht? Es ging ihm nicht aus dem Kopf, erinnerte ihn an etwas. Dann fiel es ihm ein: Etwa zehn Minuten außerhalb von Blue Eye gab es in der Nähe eines Örtchens namens Ink einen verlassenen Steinbruch, der für seine Vorkommen von rotem Lehm bekannt war. Er wurde zwar auf keiner Karte so bezeichnet, doch aufgrund übereinstimmender mündlicher Überlieferung hatten die Leute ihn Little Georgia getauft – eine Hommage an den ›Red Clay State‹ Georgia.
Er notierte sich ›Little Georgia‹, widmete sich dann der anderen Hand, die verdreht unter dem Körper des Mädchens lag, im Todeskampf zur Faust geballt. Er glaubte, etwas darin zu erkennen, einen Papierschnipsel vielleicht. Er wusste, dass er ihn besser an Ort und Stelle lassen sollte, doch die Versuchung, mehr zu erfahren, gewann die Oberhand. Er benutzte seinen Bleistift als eine Art Tastinstrument und bog sanft ihre Finger nach oben, wobei er versuchte, möglichst nichts zu verändern.
Ein Schatz fiel heraus. Shirelle hatte ein Stoffknäuel in der linken Hand, zerknittert und erbärmlich, etwas, das sie ihrem Mörder entrissen haben musste, während er sie umbrachte. Earl schob das Knäuel mit seinem Stift auseinander. Es schien eine Tasche aus einem Baumwollhemd zu sein. Und sie war mit einem Monogramm versehen!
Drei Buchstaben, klar und deutlich lesbar: RGF.
Ist es wirklich so einfach?, fragte sich Earl. Mein Gott, konnte das schon alles sein? Musste er jetzt bloß noch einen Herrn RGF finden, an dessen Hemd eine Tasche fehlte?
»Lawdie, lawdie, lawdie«, sang jemand vor sich hin.
Earl sah auf. Lem Tolliver stapfte mit seiner beachtlichen Körpermasse durch den Wald, offenbar von großer Aufregung getrieben.
»Earl, Earl, Earl!«
»Was ist denn, Lem?«, fragte Earl, während er aufstand.
»Ich hab sie gerufen, Earl, und sie werden kommen, sobald sie können.«
»Wieso, was ist ...«
»Earl, Jimmy Pye und sein Cousin Bubba haben einen Lebensmittelladen in Fort Smith zusammengeschossen. Oh Earl, die haben vier Leute umgebracht, sogar einen Cop! Earl, der ganze Bundesstaat ist jetzt hinter dem Jungen her!«
Kapitel 2
Jimmy griff über die Rückenlehne nach hinten und zog eine Einkaufstüte aus Papier hervor, deren schwerer Inhalt sie ausbeulte, als er sie auf seinen Schoß hob. Sie riss nicht, aber als er sie auf seinen Oberschenkeln absetzte, hörte Bub das dumpfe Klappern schwerer Metallgegenstände, die aneinanderschlugen.
»Bitte schön.« Jimmy zog einen großen Revolver mit langem Lauf aus der Tüte und reichte ihn Bub. »Das ist ein .44 Smith & Wesson Special. Ein ganz schön dicker Brocken von einer Pistole.«
Bub betrachtete das Ding. Es fühlte sich unglaublich schwer in seinen Händen an, ölig, dicht, auf seltsame Weise energiegeladen. Eine Waffe. Eine Pistole. Er hatte noch nie eine Pistole besessen. Nur Polizisten trugen sie mit sich herum, das war alles. Er sah zu Jimmy hinüber und spürte, wie sein Unterkiefer absackte und sein Gesicht einen Ausdruck glotzäugiger Dummheit annahm, weil ihm die Worte fehlten.
Währenddessen hatte Jimmy eine automatische Waffe mit rauem Horngriff hervorgezogen und fing an, klappernd mit ihr zu hantieren, etwas in den Griff zu schieben, an einem kleinen Hebel herumzufummeln.
»’ne .38 Super«, meinte er zufrieden. »Von Colt. Und die Knarre tritt ordentlich Arsch. Hat jede Menge Wucht, obwohl sie so klein daherkommt. Eine Waffe für Profis.«
Doch dann bemerkte er den Ausdruck äußerster Verwirrung im Gesicht seines jungen Cousins.
»Na, was macht dir denn so zu schaffen, Bub? Wo drückt der Schuh?«
Bub fiel beim besten Willen nicht ein, was er sagen sollte. Dann platzte er heraus: »I-i-i-ich hab … Angst.«
»Ach, jetzt komm aber, Bub. Da ist doch überhaupt nichts dabei. Wir gehen rein, präsentieren ihnen unsere Waffen, die geben uns das Geld und wir machen uns vom Acker. So einfach ist das. Ein Typ im Knast hat mir erklärt, wie man sich ’nen großen Lebensmittelladen vornimmt. Schau, die legen jede gottverdammte Stunde ihre Kohle in den Safe. Also ist um diese Zeit, nachdem die Leute alle ihre Morgeneinkäufe erledigt haben, alles im Bürosafe, gleich da vorne. Bei jedem verdammten IGA-Supermarkt ist das so. Er hat’s mir gesagt: Da ist nix dabei. Der einfachste Coup, den es gibt.«
Bub bekam einen trockenen Hals und hatte Schwierigkeiten zu atmen. Er hätte am liebsten losgeheult. Er liebte Jimmy so sehr, aber … er glaubte nicht, dass er den Mut hatte, so eine Sache durchzuziehen. Er wollte bloß seinen alten Job zurück. Er wollte einfach nur Nägel klopfen für Mr. Wilton, jeden Tag aufs Neue, egal ob es regnete, kalt war, schneite oder ob es Frost gab. Einfach nur Nägel klopfen. Das reichte ihm.
»Hör mal, Bubba«, sagte Jimmy, beugte sich zu Bub und zog ihn verschwörerisch zu sich heran. »Ich weiß ja nicht, wie’s dir geht, aber ich fang nicht einen gottverdammten Job in einem Sägewerk an, bloß um den gottverdammten Mr. Earl Gottverdammter Swagger zu einem glücklichen Mann zu machen. Ich arbeite da nicht. Früher oder später verlierst du da ’nen Finger, ’nen Arm, ’n Bein. Man sieht die doch ständig rumlaufen, gottverflucht, haben keine Arme mehr, und die Leute sagen: ›Oh, der hat früher unten im Sägewerk gearbeitet.‹ Oh nein, ohne mich.«
Er lehnte sich zurück, atmete schwer und sah auf die Uhr.
»Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir gehen da rüber, rein und wieder raus. Keiner rechnet damit. Dann haben wir was in der Hand, unseren Einsatz. Ja, ganz genau. Dann können wir aus diesem verarmten West Arkansas abhauen und uns auf den Weg nach Kalifornien machen. Schaust du mich an? Bub, schau mich an!«
Bub sah auf und starrte seinen Cousin an.
»Also, seh ich etwa wie ein gottverdammter Sägewerkarbeiter aus, der 1000 Dollar im Jahr verdient und in einer Hütte von der Mildtätigkeit irgendeiner alten Schachtel lebt? Oh nein, ich seh wie dieser gottverdammte Kerl James Dean aus, ich weiß das. Ich seh so gut aus wie er. Ich geh nach Kalifornien, und ich hab vor, dort ein großer Filmschauspieler zu werden. Du kannst auch mitkommen, Bubba. Ein Star, weißt du, ein Star hat immer eine rechte Hand, du weißt schon, einen, der für ihn Anrufe und Reservierungen macht und die Flugtickets abholt. Dafür hab ich dich eingeplant. Du sollst meine rechte Hand sein.«
»A-aber Edie liebt dich.« Wie so viele andere hatte sich Bub selbst halb verliebt in Jimmys junge Frau.
»Für Edie gibt’s dort eine ganze Menge. Wirst sehen, da gibt’s ’ne Menge für das Mädchen. Wir nehmen sie auch mit. Sie kommt mit nach Kalifornien! Ich hab dort Freunde, die auf mich aufpassen. Oh, wir werden eine tolle Zeit haben, du, ich, Edie, in L.A. Wir werden Stars sein!«
Er sprach mit einer solchen Inbrunst, dass Bub die Augen schloss und es für einen kurzen Moment wirklich vor Augen hatte: Seine Vorstellung vom Leben eines Filmstars umfasste Swimmingpools, schicke Klamotten, kleine Schnurrbärte und schnittige Autos, alles unter der Sonne Kaliforniens. Bis gerade eben hätte er von alldem nicht einmal zu träumen gewagt.
»Ich schwör dir, es wird keiner verletzt. Halt mir dort im Büro einfach den Rücken frei. Du zeigst ihnen die Waffe, ich zeig ihnen die Waffe. Niemand wird sich für ein bisschen gottverdammtes Geld, das einer Lebensmittelfirma gehört, auf einen Kampf mit uns einlassen. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. Wir legen noch einen Zwischenstopp ein, um Edie einzusammeln, und weg sind wir. Keiner wird verletzt. Jetzt komm schon, Bub, ich brauch dich. Wir müssen los.«
Jimmy stieg aus dem Wagen und stopfte die Automatik in den Bund seiner Chinohose. Er rückte die Sonnenbrille in seinem hübschen Gesicht zurecht, dann griff er in seine Tasche und zog eine Packung Luckys hervor. Mit einem Schwung aus dem Handgelenk ließ er eine Zigarette hervorschnellen, zog sie mit den Lippen aus der Schachtel und zündete sie mit einem Zippo-Feuerzeug an, das wie durch Zauberkraft in seiner Hand aufgetaucht war. Er drehte sich um und zwinkerte dem armen Bub zu, der ihn bloß angaffte. In seinem Verstand bildete sich ohne das geringste Stottern der Gedanke: Wir sind jetzt schon in einem Film.
Jimmy geht vor. Jimmy läuft selbstbewusst, ein Bebop-Rhythmus schwingt in seinem Gang mit, er hat ein Lächeln im Gesicht. Bub ist hinter ihm. Bub ist verängstigt und verwirrt. Auch er hat sich die Pistole in den Hosenbund gesteckt, aber sie ist schwer und sitzt schlecht, und ihr Lauf ist so lang, dass er sich in seinen Schenkel bohrt. Deshalb geht er steifbeinig wie ein Krüppel, tollpatschig hüpfend, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Sollten wir nicht Masken tragen?
Was, wenn uns jemand erkennt?
Meine Mama wird sooooo wütend sein.
Warum tue ich das?
Warum passiert das hier?
Jimmy … Jimmy …Hilf mir!
Jimmy stolziert einfach drauflos; sein aufgewecktes Gesicht leuchtet vor Freude. Er unterbricht seinen Vormarsch kurz für eine höfliche Geste in Richtung einer Frau, die sich gerade mit dem Beladen ihres Kofferraums abmüht. Er bückt sich schnell und reicht ihr die letzte Tüte, damit sie diese verstauen kann.
»Oh, Danke schön«, sagt sie.
»Bitte sehr, Ma’am«, trällert er so charmant, dass sie die Pistole, die in seinem Hosenbund steckt, gar nicht bemerkt. Das nimmt etwa eine Sekunde in Anspruch. Bub schließt zu ihm auf und sie betreten den Laden als Duo. Das Geschäft ist merkwürdig dunkel und weitläufig; Bub fühlt sich an eine Kirche erinnert. An sechs Theken machen sich sechs Frauen mit großem Klackerdiklack an Registrierkassen zu schaffen und reichen die Einkäufe Stück für Stück an Einpacker weiter, während sie die Kasse die Beträge aufaddieren lassen.
Es ist der größte Lebensmittelladen, den Bub je gesehen hat! Die Flächen kommen ihm riesig vor, er sieht Gänge, die zu weiteren Gängen führen, stapelweise Güter und Nahrungsmittel. Es ist ein Amerika, wie er es noch nie gesehen hat. Etwas an der Ordnung, die an diesem Ort herrscht, an der Größe und der sorgfältigen Planung, mit der er angelegt wurde, macht ihm Angst. Er hat das Gefühl, dass er kurz davor steht, ein Heiligtum zu entweihen. Eine leise Stimme beginnt zu wimmern. In seinen Knien pocht es. Er wünschte, er hätte den Mut, zu schreien: Nein! Nein! Jimmy, nein! Doch Jimmy ist da vorne so selbstsicher, dass Bub weder die Chance noch die Nerven hat, sich ihm in den Weg zu stellen. Außerdem geht es bereits los, so schnell.
Jimmy ist an einer Art Büro hinter der letzten Kasse angekommen, einer hohen, von einer Mauer umgebenen Konstruktion mit einer Tür inmitten all der weiten Flächen. Davor befindet sich eine Theke, hinter der eine freundliche, rothaarige Frau steht und sich mit einer schwarzen Dame unterhält. ›Virginia‹ steht auf ihrer Bluse, ›Assistentin der Geschäftsleitung‹.
Sie sieht Jimmy an, reagiert, wie alle es tun, auf seinen Charme und sein gutes Aussehen und schenkt ihm ein strahlendes Lächeln, bis sie erkennt, dass das, was er ihr vors Gesicht hält, eine Waffe ist. Ihr Strahlen weicht einem ängstlichen Ausdruck. Jimmy stößt die farbige Lady zu Boden, hält Virginia die Pistole mitten ins Gesicht und schreit: »Geh ins Büro und mach den Safe auf!«
Nach Luft schnappend wie ein Fisch, der sterbend auf einem Pier liegt, drückt Virginia auf einen Summer. Die Tür zum Büro öffnet sich und ein junger Mann beugt sich heraus. Bub ist nicht sicher, was als Nächstes passiert. Er hört ein Bamm!, das er nicht zuordnen kann, das überhaupt nicht dorthin zu gehören scheint, deplatziert wirkt. Dann liegt der junge Mann auch schon auf den Knien, schließlich am Boden. Er ist nass. Irgendetwas Nasses kommt aus ihm heraus und verteilt sich überall. Bub hört Schreie, Rufe, Kreischen. Er zieht langsam die eigene Pistole. Einen Augenblick später sind sie im Büro, aber Jimmy stößt ihn zurück und schreit: »Du passt draußen auf.« Also steht Bub Wache. Er sieht und bemerkt nicht, was in dem kleinen Büro vor sich geht, nur, dass es einen furchtbaren Tumult gibt.
Bamm!
Da ist es wieder, und Bub zuckt vor Schreck zusammen. Er mag dieses Geräusch überhaupt nicht. Er weiß, dass es ein Schuss ist, und er hofft, dass Jimmy in die Luft oder in den Boden schießt, um ihnen Angst einzujagen. Doch das schiere Entsetzen, das in ihren Schreien liegt, macht ihm langsam deutlich, dass Jimmy tatsächlich auf Menschen schießt. Warum sollte er das tun? Warum sollte Jimmy auf jemanden schießen? Wenn man Jimmy gesehen hat, wie er mit einem Football rennt, Gegenspielern ausweicht, sich zur Seite bewegt, freiläuft und mit langen, anmutigen Schritten unter dem Gejubel der Menge davonsaust, kann man sich nie und nimmer vorstellen, dass so ein Junge auf Menschen schießen könnte.
Bub fängt an zu weinen. Das hier gefällt ihm nicht im Geringsten. Er ist krank vor Angst. Er sollte jetzt mit Jimmy in einem Bus zurück nach Blue Eye sitzen. Jimmy wird mit Edie zusammenleben und in Nunley in einem Sägewerk für Mike Logan arbeiten. Mr. Earl hat es doch gesagt! Mr. Earl hat gesagt, dass es so passiert! Warum kommt alles ganz anders? Warum sitzt er nicht in dem Bus?
Jemand kommt auf Bub zu, so ein großer Neger, und drückt Bub gegen den Verkaufstresen, hält seine Arme fest. Er verpasst Bub einen harten Schlag auf den Mund und die Welt verschwimmt vor seinen Augen. Warum? Warum hat er Bub geschlagen? Bub wirft sich mit der Schulter voran nach vorne und der Mann rutscht zu Boden. Bub richtet die Pistole auf ihn.
»Warum?«, will er wissen.
Jimmy steht neben ihm.
»Tu es«, befiehlt er. »Tu es!«
Ich kann nicht, denkt Bub. Bitte zwing mich nicht dazu.
Aber der Neger rappelt sich auf, kommt auf ihn zu und die Waffe geht los. Er hat nicht gewollt, dass sie losgeht. Das hat er nicht gewollt! Es ist nicht seine Idee gewesen! Es ist nicht seine Schuld! Der Nigger hat Schuld!