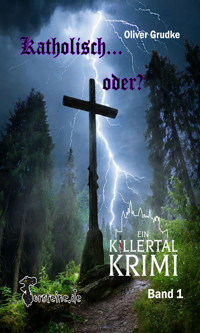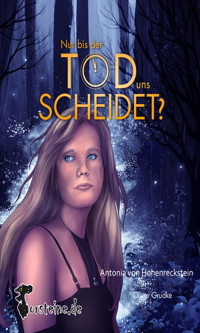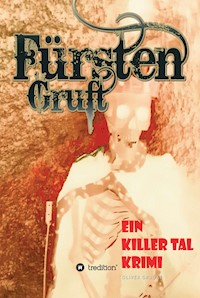Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Torsteine.de
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach schweren Schicksalsschlägen kehrt der erfolgreiche Neurochirurg Doktor Steimer zurück in sein Heimatdorf am Rande der Schwäbischen Alb.Dort führt noch immer sein Vater eine Landarzt Praxis, welche er nie übernehmen wollte.Doch bevor es zu einer Aussprache kommt, stirbt sein Vater unerwartet und ein Praxis sucht einen Nachfolger. Doktor Steimer nimmt sich der Aufgabe an. Dabei lernt er Schicksale, Geschichten und die Menschen der Schwäbischen Alb neu kennen und stellt fest wie dringend ein Arzt gebraucht wird. Seinen eigenen privaten Schatten und schrecklichen Erlebnissen kann er dabei nicht entfliehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Grudke
© 2024 Oliver Grudke
Coverdesign von: Sascha Riehl (www.sascha-riehl.de)Lektorat: Nadine Senger
Website: www.torsteine.de
Lektorat von: Nadine Senger Solingen
Verlagslabel: torsteine.de, www.torsteine.deISBN Taschenbuch 9783989954748
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Oliver Grudke, Ebingerstraße 52, 72393 Burladingen, Germany.
Prolog
Ich fahre. Fast lautlos.
Und doch strengt es mich an.
„Mit der neuen Mobilität sind wir führend in ganz Deutschland!“, hatte die junge schlanke und recht hübsche Frau hinter dem Tresen der Autovermietung mir erklärt. Ich habe sie auf Anfang zwanzig geschätzt. Und ich bin davon überzeugt, dass sie Veganerin ist. Anzeichen dafür waren ihre zu blasse Haut und die brüchigen Fingernägel. Fleisch kann nicht durch veganes Essen ersetzt werden. Dafür ist der Mensch nicht konstruiert worden. Wer vegan lebt, muss darauf achten, ausgewogen und vor allem nährstoffreich zu essen. Wichtige Stoffe, die in Eiern, Milch und Fleisch enthalten sind, können nicht durch Körner und Pflanzen ersetzt werden. Achtet man nicht darauf, kommt es zu Mangelerscheinungen, welche schlimme gesundheitliche Schäden erzeugen können.
Ich erschrecke, denn das Fahrzeug hinter mir hupt. Zuerst drehe ich mich um, dann schaue ich wieder nach vorne. Die Ampel ist grün und ich gebe Gas. Das E-Auto rollt weiter lautlos. Schweißperlen bilden sich auf meiner Stirn, überall fahren Autos und es gibt doppelte und dreifache Straßen.
Alles verändert.
Alles neu.
Fast ist es, als komme ich in ein fremdes Land. Doch das ist nicht so.
Ich komme heim.
Nach Hause!
Auch wenn mir der Begriff nicht richtig erscheint.
Ich blicke nach oben zu einem großen Straßenschild. Geradeaus geht es nach Stuttgart, rechts nach Tübingen und links auf die A8 in Richtung München. Ich bin im Zentrum, in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Dem „Ländle“, wie es seine Bewohner liebevoll nennen. Ich setze den Blinker und biege nach Tübingen ab. Dabei fällt mein Blick wieder auf den Flughafen. Alles ist anders, größer, geschäftiger, neuer. Als ich vor fünfundzwanzig Jahren in ein Flugzeug stieg, gab es nur einen Terminal und die meisten der Bauwerke waren noch nicht einmal geplant. Dort, wo diese jetzt stehen, bauten die Filder Bauern ihr Kraut, Kartoffeln und Gemüse an.
Vergangenheit.
Vergangen sind auch fünfundzwanzig Jahre, in denen ich fort war. Niemand hat mich gezwungen, nein ich war es, weil ich es wollte.
Weg!
Weg aus der Enge, der Nähe, der Spießigkeit der Menschen.
Ich steuere den kleinen roten Wagen auf die Einfädelspur zur B27 in Richtung Tübingen. Eine unglaubliche Menge an Fahrzeugen bewegt sich mit mir und meinem Fahrzeug in dieselbe Richtung.
Veränderungen.
So viele! Ist es das, was die Menschen wollen? Mehr Hektik, Stress, Lärm? Ich denke, das würde keiner bejahen, und doch lassen sie sich vorantreiben. Schlimmer als ein Schäfer auf der Alb seine Schafe, der diese vor einem Unwetter in Sicherheit bringen möchte.
Die Alb!
Die Schwäbische Alb!
Mein Blick schweift über die Fildereben hinüber zum Horizont, wo ich in der Ferne schon den Albtrauf erkennen kann. Dahinter liegt meine Heimat.
Heimat!
Nun benutze ich dieses Wort schon ein zweites Mal. Es sollte mir falsch vorkommen und doch ist es nicht so. Fünfundzwanzig Jahre war Nigeria und die ganze Welt meine Heimat. Oder war es das nie? War ich dort nur Gast? Sind wir nur dort zu Hause, wo wir geboren wurden? Viele Fragen und viele Gedanken dringen durch meinen Kopf.
Erinnerungen.
An damals, an die Zeit, bevor ich wegging.
An die Zeit, wo ich ein unbeschwerter Junge war. War und sein konnte. Durch die Bäche und Wälder des so schönen Killertales streifen konnte.
An Tübingen und mein Studium.
An meinen Vater und meine Familie.
Vater!
Wir gingen im Streit auseinander und haben diesen nie beendet, nie mehr miteinander gesprochen. Vielleicht ist dies der Grund, warum ich nun zurückkehre.
Vielleicht!
Doch vielleicht ist es auch eine Flucht. Eine Flucht vor den Erinnerungen an Nigeria. Eine Flucht vor den Erinnerungen an die Schatten, welche ich dort nicht zurücklassen konnte. Eine Flucht vor mir selbst.
Genau wie damals, vor fünfundzwanzig Jahren.
Damals bin ich auch geflohen.
Vor all dem hier. Der Heimat, der Familie und besonders vor mir. Vor meinen Verfehlungen und Ängsten.
Ich blinze, denn die ersten Sonnenstrahlen tauchen alles in ein orangewarmes Rot. Der Tag erwacht und mit ihm ein neues, ein verändertes Leben.
Mit Entsetzen sehe ich, wie weit der Flächenfraß vorangetrieben wurde. Überall zwischen den Äckern ragen hässliche Industriebauten empor.
Fortschritt.
Vielleicht, doch sicher eher ein Rückschritt. Einer, der uns Menschen zu Sklaven der Moderne macht. Zu Getriebenen und zu Rastlosen, welche nur dem Streben nach mehr dienen können.
Streben!
Strebte nicht auch ich nach mehr? Nach etwas anderem.
Egal nach was, nur nicht nach dem, was ich hatte?
So war es und nun freue ich mich wie ein kleines Kind, als ein Schild nach der Eichtalbrücke mir verrät, dass ich Tübingen nur mit zehn Minuten Verspätung erreichen werde. Im Radio kommen die Staumeldungen, demnach muss ganz Baden-Württemberg heute, an einem Montag, in einem Stau stehen. Das interessiert mich nicht und ich lasse den Sendersuchlauf starten.
SWR3, der Kultsender!
Ein Lächeln huscht über mein Gesicht.
Ein Lächeln!
Wie lange ich das nicht mehr gespürt habe, weiß ich nicht.
Zu lange, zu viele Schmerzen. Zu groß meine Trauer.
Doch das Gefühl heimzukommen, nach Hause zu gehen, weckt eine Freude in mir, eine die hilft, die Trauer etwas zu verdrängen. Nur zu verdrängen, nicht zu vertreiben. Das wird nie geschehen.
„Nun ein Top-Song aus den Achtzigern!“, sagt der Moderator und schon beginnt Roxette zu singen.
„Listen to your heart …“
Ich drehe die Lautstärke höher und beginne leise mitzusingen. Mein Herz fühlt sich wieder jung. So jung wie damals in Hechingen als Abiturient.
Jung und frei.
Unbeschwert!
Die Zukunft lag vor uns.
Und nun liegt schon ein großer Teil weit zurück und wird nie wiederkommen.
Vor mir sehe ich das Blinken einer Warnblinkanlage.
Stau!
Und Tübingen.
Das war schon früher so und ist nun noch schlimmer geworden, denn ich stehe bereits kurz nach der Abfahrt nach Kirchentellinsfurt.
Das ist nun der Fortschritt. Das „Neue“, oder die Zukunft. Wirklich?
Nein!
So haben wir uns das damals nicht vorgestellt. Damals, als die Mauer fiel und es wirklich eine Zeitlang eine Chance gab für eine Zukunft. Für Tiere, das Klima und auch für die Menschen.
Damals!
Lebten zwei Milliarden Menschen weniger auf diesem Planeten. Und das waren schon viel zu viele. Bin ich zu hart? Mag sein, doch ich habe gesehen, wie die Menschen sind.
Grausam!
Und gerade ich habe geschworen, ihnen meine Kraft und mein Können uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen. So wie schon mein Vater.
Damals.
In Tübingen.
Ein Verkehrszeichen weist darauf hin, sich einzufädeln, wenn man weiter in Richtung Hechingen möchte. Doch viele fahren weiter rechts an mir vorbei und drängen sich kurz vor der Ampel vor.
Wie rücksichtsvoll.
Ich rolle im Stop and go mit meinem E-Auto weiter vorwärts.
Modern und zukunftsorientiert.
So denken die Käufer. So erzählt man es ihnen. So wollen sie es glauben.
Doch so ist es nicht!
Für die Herstellung des Akkus werden seltene Stoffe benötigt. Stoffe, die es in Deutschland kaum oder gar nicht gibt. Aber in Afrika. Und dort müssen Menschen in ärmlichsten Verhältnissen und zu Hungerlöhnen diese Stoffe abbauen.
Zukunftsorientiert.
Doch diese Menschen haben keine Zukunft. Kaum einer der Arbeiter wird über vierzig Jahre, während hier die Menschen noch mit weit über achtzig sich Gedanken über ihr neues Auto machen.
Gedanken, Gefühle, Ängste.
All das macht sich bei mir breit mit jedem Meter, dem ich meiner Heimat näherkomme.
Soll ich umkehren?
Doch da gibt es nichts, zu dem ich umkehren könnte.
Nichts und niemanden nach fünfundzwanzig Jahren.
Die Fußgängerampel schaltet auf Rot, in dem Moment, wo ich hätte darüberfahren sollen. Nun stehe ich in erster Reihe und kann die Menschen beobachten, welche über die Straße gehen.
Da ist eine viel zu dicke Frau mit geschwollenen Waden, die einen sehr kleinen Pudel an einer Leine förmlich über die Straße zieht. Dann ein junges Mädchen, welches lange Haare bis über den Po hat und auf einem klapprigen Fahrrad in zerrissenen Jeans auf die linke Seite fährt. Ein dunkelhäutiger Junge, der seine Kapuze weit über sein Gesicht gezogen hat und auf seiner linken Schulter einen roten Rucksackt trägt. Eine Mutter, die ein Fahrrad mit grünem Anhänger schiebt, an dem ein roter Wimpel angebracht ist. Ein Postbote mit einem E-Bike und daran angebrachten großen Kisten. Ein alter Mann mit schlürfendem Gang, der seinen Rollator vor sich herschiebt. Eine junge Frau mit kurzen Haaren und langen Ohrringen und verspiegelter Sonnenbrille, die Ohrstöpsel trägt und nur auf den Bildschirm ihres Smartphones starrt.
Menschen.
Und keiner nimmt Notiz vom anderen. Jeder sieht nur sich selber.
Es wird nicht gegrüßt, geplaudert oder gewunken.
Nichts!
Fortschritt nach der modernen Zeit.
Egoismus pur.
Ich schließe kurz die Augen und versuche meine negativen Gedanken zu vertreiben. Ein Hupen des Fahrzeugs hinter mir lässt dies jedoch nicht zu. Es ist grün und meine Fahrt geht weiter.
Weiter vorbei an Tübingen und weiter ins Steinlachtal.
Nach Hause.
Doch mittlerweile bezweifle ich, dass ich ein Zuhause überhaupt noch habe, oder je gehabt habe.
„Nein!“, rufe ich lauter als die nächste Verkehrsdurchsage. Denn das stimmt nicht. Ich hatte ein Zuhause. Einen friedlichen Ort. Menschen, die mich mochten und die ich enttäuscht habe. Ja sicherlich verletzt habe. Und zu jenen möchte ich nun heimkehren.
Möchte?
Oder muss ich, weil es sonst auf der Welt keinen Ort gibt, an denen ich mich verkriechen kann. An denen ich Frieden finden könnte.
Die Straße weitet sich und es gibt vier Spuren. Zwei in jede Richtung. Das ist neu! Vater hatte immer behauptet, das würde er nie erleben, wenn die B27 vierspurig bis Tübingen werden würde.
Ich schmunzle, denn er hatte auch einmal nicht recht.
Einmal.
Sonst hatte er immer recht, oder wollte, dass es so ist. Doch so ist es nicht immer in unserem Leben. Dieses besteht aus der Gemeinsamkeit. Aus Rücksicht, Nächstenliebe und Vertrauen und Hilfsbereitschaft. Ich denke an die Menschen an der Fußgängerampel zurück. Sie haben von all dem nichts. Vielleicht werde ich dies alles auch hier nicht finden und sollte nicht zurückkehren. Doch wo soll ein gebrochenes Herz hin als nach Hause.
Nach Hause zu seinen Liebsten, und diese jene, die mir geblieben sind, wohnen nun einmal am Rande der Schwäbischen Alb. Und ich habe mit keinem in den letzten fünfundzwanzig Jahren gesprochen. Nicht ein Wort, keine Karte, kein Anruf.
Vater ist alt, und Mutter ebenso. Doch noch arbeitet er. Ich weiß es, weil ich es im Internet nachgelesen habe.
Das Internet.
Ein anonymer Ort, ohne all die Dinge, die Menschen ausmachen. Und doch habe ich auch diesen Ort benutzt, den Ort der Technologie und nicht angerufen. Mit Vater gesprochen.
Mit Mutter.
Jetzt, da ich in Dußlingen voller Verwunderung durch einen Tunnel fahre, wird meine Freude durch Angst verdrängt.
Angst vor dem, was mich erwartet. Doch schlimmer als was geschehen ist, was ich sehen und erleben musste, wird es nicht sein. Mein Blick fällt durch den Rückspiegel auf eine kleine Sporttasche. Darin befindet sich alles, was ich mitbringe.
Mit nach Hause.
„Es ist schön hier! Grün und vor allem friedlich. Es würde euch gefallen“, sage ich zur Tasche und vor allem zu ihrem Inhalt. Immer habe ich es mir vorgenommen. Immer wollte ich hier einen Besuch abstatten. Einen bei meinen Eltern. Doch immer habe ich es verschoben, aufgeschoben und verdrängt. Mir selber eingeredet, einen Grund zu haben, dass es „jetzt“ nicht geht. Und nun?
Geht es!
Wie werden sie mich aufnehmen, empfangen? Freudig, mitleidig oder abstoßend? Ich weiß es nicht, bin mir jedoch sicher, dass es nicht aus Mitleid geschehen darf. Was passiert ist, wird mein Geheimnis bleiben. Dies geht niemanden etwas an. Nur mich. Mich und den Inhalt der Tasche.
Kurz vor Ofterdingen endet der Straßenausbau. Das ist Baden-Württemberg. Kompromisslos bürokratisch! Und wieder drängt sich eine Autolawine durch das kleine Örtchen, das so klein nicht mehr ist. Wie ein Geschwür breiten sich die schönen Dörfer und Gemeinden in die schöne umliegende Natur aus.
Zerstören und versiegeln.
Ein Paradies, das keiner mehr sieht.
Ich denke, keiner der Menschen, die überwiegend alleine in einem Fahrzeug sitzen, welches mehr gekostet hat als ein ganzes Dorf in Nigeria im Jahr für Nahrung ausgeben kann, je durch einer der Obstwiesen gewandert ist.
Dafür fahren sie fluchend, hupend und gestresst durch die enge Ortsdurchfahrt von Ofterdingen. Selbst ich bin froh, als ich die Anhöhe bei Bad Sebastiansweiler erreiche.
Dann sehe ich sie.
Zum ersten Mal seit über fünfundzwanzig Jahren.
Die Burg.
Die Burg Hohenzollern.
Das Wahrzeichen des Kreises und der ganzen Region.
„Seltsam!“, murmele ich und drehe das Radio leiser.
Beim Anblick der Burg fühle ich mich daheim. Mein Innerstes wird ruhiger und fast denke ich, die Zeit bleibt etwas stehen. Doch das tut sie nicht und Vergangenes werden wir nie zurückbekommen.
Nach einem kleinen Wäldchen weitet sich der Blick. Die Burg der Albtrauf und das kleine Hechingen, das im Wetteifer der anderen Gemeinde nicht nachstehen will und sich auch schon in die Landschaft ausgebreitet hat.
Ich werde ruhiger, und atme erleichtert aus.
Fragen drängen sich in meinen Kopf.
Warum?
Warum bin ich gegangen?
Geflohen?
Damals?
Ich weiß, ich werde heute keine Antwort darauf finden.
Und morgen?
Vielleicht nie.
Doch jetzt bin ich zurück und biege ab in das wunderschöne Killertal, meine Heimat. In der ich außer Schmerzen und Enttäuschungen nichts zurückgelassen habe.
Nichts, das kann ich mir auch nicht schönreden.
Dafür gibt es keine Entschuldigungen.
Nie!
Es ist Anfang Juli. Auf den Feldern liegt duftendes Heu. Einige Traktoren sind schon bei der Arbeit. Die Blätter der großen Buchen, welche den ganzen Albtrauf und fast alle Hänge des kleinen Killertales bedecken, sind schon dunkelgrün gefärbt. Der Wind spielt mit ihnen, doch heute wird es ein heißer Tag werden. Ein Schild weist auf eine Abbiegung hin.
Beuren.
Der kleinste Killertäler Ort.
Wieder beginnen meine Gedanken zurückzukehren.
Nach damals.
An rauschende Feste am Grillplatz.
An tolle Küsse mit Blick zur Burg.
An ein anderes Leben.
An die Jugend.
Als ich aus meinen Gedanken erwache, bin ich längst abgebogen und fahre durch das kleine Beuren. Vorbei an der Gaststätte zum Dreifürstenstein, die es noch immer gibt. Ich fahre weiter bis zum Wanderparkplatz, wo ich das kleine Auto abstelle. Mühevoll klettere ich aus dem Wagen. Ich strecke mich und spüre die Verspannungen. Ja, die Fünfzig werden mich bald erreichen.
Fünfzig, ein halbes Jahrhundert. Noch mal werden es keine werden.
Kaum.
Nur wenige Menschen erreichen die Hundert Lebensjahre. Natürlich werden es immer mehr, geschuldet der guten medizinischen Versorgung, der Ernährung und auch der Technik, die vieles erleichtert. Gleichzeitig nehmen der Stress und damit eingehende Wohlstandskrankheiten zu und raffen schon viele Menschen in jungen Jahren dahin.
„Guten Morgen! Sitz Arco, sitz!“ Eine Frau kommt den Waldweg entlang. Sie führt an unterschiedlichen Leinen drei Hunde mit sich. Klein, groß und mittel. Um ihren Bauch hat sie einen Beutel gebunden, aus dem sie immer wieder den Hunden kleine Stück zuwirft und ihnen dann Befehle erteilt. Die Frau und die Hunde haben mindestes zwanzig Prozent Übergewicht. Ich nicke ihr stumm zu und beginne, den steilen Weg durch die Beurener Wachholderheide hochzulaufen.
Es ist still.
Nur einzelne Vögel, deren Namen ich nicht kenne, singen ihr Lied. Nun beginnt sich mein Körper zu entspannen.
„Ein Paradies!“, sage ich laut und schaue mich dann erschrocken um, ob dies jemand gehört hat. Doch so früh ist an einem Montag im Juli fast niemand auf den Beinen. Das Gras ist noch mit leichtem Tau bedeckt. Der warme Wind streicht sanft über die Halme und lässt auch die Blätter der Bäume tanzen. Es wird ein warmer Sommertag. An genauso einem Tag bin ich damals davongelaufen. Einfach so, ohne mich zu verabschieden.
Warum nur?
Ein grüner Geländewagen kommt den Weg entlang. Ich trete auf die Seite und lasse ihn passieren. Ein stämmiger Mann sitzt darinnen, der eine dunkle Sonnenbrille trägt. Auf dem Wagen ist das Logo der Stadt Hechingen zu erkennen. Der Wagen fährt vorbei und ich drehe mich um und möchte weitergehen, als ich höre, wie der Wagen stoppt.
„Conny? Mensch Conny, Cornelius! Du bist es doch!“, ruft der Mann mir zu. Ich drehe mich um und er kommt den Weg hochgestapft. Der Mann hat einen gepflegten Vollbart, kurze graue Hosen und ein grünes Forsthemd an.
„Ja Menschenskind, du bist es!“ Er umarmt mich und klopft auf meine Schulter. Erst jetzt erkenne auch ich ihn.
„Franz Josef!“ Ich lache und freue mich auch.
„Du kennst deinen alten Spezel noch, ja?“
Ich nicke.
„Aber gleich hast du mich nicht erkannt, gibt es zu!“ Franz Josef lacht und aus seinem Wagen springt ein kleiner brauner Jagdhund.
„Ertappt!“, sage ich einsilbig. „Bist du auf der Jagd?“
„Heute nicht, war oben im Forst, einen Vollerntereinsatz vorbereiten“, sagt er sichtlich stolz.
„Echt? Dann hast du echt noch studiert?“
„Habe ich doch immer gesagt, ich werde noch Förster, und das bin ich nun jetzt. Stadtförster, zuständig für über zweitausend Hektar.“ Nun ist Franz Josef noch stolzer und irgendwie hat er auch das Recht dazu.
„Wow, klasse!“ Ich heuchle Begeisterung.
Mein Freund Franz Josef Schuler. Schon im Kindergarten waren wir die besten Freunde. Dann in der Schule. Er hat den Realschulabschluss gemacht und wurde Waldarbeiter. Aber sein Traum war immer, eines Tages Förster zu werden. Und das hat er nun auch geschafft. Mein Blick fällt auf seinen Körper. Zu dick, die Haut aufgedunsen und an der Nase kann ich feine Äderchen sehen, der kleine Weg vom Wagen hoch zu mir hat ihn fast außer Puste gebracht. Franz Josef lebt ungesund und trinkt zu viel Alkohol.
„Ja, und du? Zu Besuch oder bleibst du länger? Manche haben ja gedacht, du kommst nie mehr zurück!“ Er lacht und klopft mir wieder auf die Schulter.
„Weiß nicht!“, murmele ich und dies entspricht der Wahrheit. Sein Handy läutet.
Zu Hause ist es doch am schönsten. Du, ich muss dann auch, aber komm doch mal vorbei. Zum Essen. Carola kocht doch so gerne!“ Er trabt schwerfällig zurück zu seinem Geländewagen. Am linken Bein knickt er etwas ein.
Meniskus.
„Carola?“, frage ich und versuche mich zu erinnern.
„CK!“ Er grinst.
„Carola Klaiber, echt? Du bist mit der zusammen?“
„Klar, seit fünfzehn Jahren verheiratet. Die musste mich ja nehmen, da the most sexiest man weg war. Melde dich!“ Er klettert in seinen Wagen und winkt mir noch aus dem offenen Seitenfenster zu. Ich halte mir kurz die Hände vor mein Gesicht und atme schwer ein.
„Du bist zurück!“, sage ich zu mir selbst.
Vieles hat sich verändert, nein, das ist so nicht richtig. Richtig ist: Alles hat sich verändert! Alles und am meisten ich selbst. Dann erschrecke ich, als ein großer Rehbock hinter einer Wachholderhecke hervorspringt. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals.
„Du Angsthase!“, sage ich wieder zu mir selbst und lache. Lache laut und fest, bis mir das Zwerchfell wehtut. Nicht alles hat sich verändert. Die Natur ist hier im Killertal noch immer am schönsten.
Ein Paradies!
Eines, das von so wenigen wahrgenommen wird. Ich atme die würzige frische Waldluft ein und lasse meinen Blick über die Heide hinüber zu Burg Hohenzollern streichen.
Ob ich wohl hierbleibe?
Auf diese Frage habe ich noch keine Antwort, doch denke ich, dass es nun für mich keinen anderen Platz mehr geben wird als hier.
Als zu Hause.
Das Lachen hat meiner Seele gutgetan und ich lasse mich auf die alte Bank neben der Mehlbeere plumpsen. Von hier blickt man zur Burg, ohne dass man sonst etwas von der Bebauung sieht. Ein Blick wie aus dem Märchen oder einer Traumwelt.
Meiner Traumwelt.
„Carola!“, murmele ich und schüttele dabei den Kopf. Carola war so wunderschön, und genau hier haben wir uns geküsst. Mein erster Kuss, an meinem siebzehnten Geburtstag und einer tollen Klassenfeier unten am Grillplatz. Meine Gedanken schweifen ab. Was wäre gewesen, wenn …
Wenn Carola mich geheiratet hätte?
Ich hätte ein gutes Leben führen können, doch das habe ich. Bis an jenen unsäglichen Tag vor zwei Monaten. Ich schließe die Augen und trete in meine Traumwelt ein. Etwas, das ich immer genau hier an diesem Ort getan habe. Immer wenn es mir schlecht ging, und immer, wenn ich nachdenken musste oder etwas entscheiden sollte.
Doch das alles muss ich nicht tun, nicht jetzt.
Ich muss aufstehen und wieder zurück ins Tal fahren.
Und mich dem Leben stellen.
Meinem Leben und meiner Verantwortung, vor der ich geflohen bin: Jetzt!
Jetzt!
Mein kleines rotes Auto fährt auf die Anhöhe nach Schlatt hoch. Und schon wieder sehe ich Veränderungen.
Das Junginger Gewerbegebiet ist wie überall ausgeufert. Fortgeschritten.
Es gibt einen Car Wash, einen Nettomarkt und eine großen Gewerbekomplex einer Junginger Firma.
Fünfundzwanzig Jahre.
Kein einziges Jahr davon werde ich je wieder zurückbringen können. Alle sind für immer vergangen. Ja vielleicht für mich sogar verloren.
Ich fahre weiter und dann in der großen Kurve biege ich ab und parke an der alten Dorflinde. Hier scheint es noch so zu sein wie früher. Kurz bleibe ich sitzen, weil die Anspannung und auch die Furcht mich lähmen.
„Jetzt komm schon! Hey, der verlorene Sohn kommt heim. Ein Freudentag!“ Ich spreche laut, um mir Mut zu machen.
Doch es hilft nichts. Jetzt habe ich Schuldgefühle.
Ich steige aus. Die Luft ist schon warm, ja eher schwül. Ich denke, am Ende des Tages wird es ein Gewitter geben. Ich blicke zum kleinen roten Fachwerkhaus, der Praxis meines Vaters. Es wirkt schön. Neu, frisch! Rechts am Eck ist eine Markierung angebracht.
„Hochwasser 2008“ steht dort auf einer kleinen Messingplatte. Ich erinnere mich an den Sommer, wo das Killertal von einer schrecklichen Hochwasserkatastrophe heimgesucht wurde und auch die Praxis meines Vaters unter Wasser stand. Menschen haben ihr Leben verloren. Die Schäden waren enorm.
Doch dies scheint vorbei, ob vergessen, das wissen nur die Menschen hier im kleinen Killertäler Ort. Ich gehe mutiger als ich es bin auf die Eingangstüre zu. Erst jetzt fällt mir die lange Menschenschlange auf.
So viele!
So viele Patienten!
Ich bin erstaunt und entsetzt. Vater ist über achtzig Jahre alt. Und noch immer arbeitet er.
Hart!
Meine Schuld!
„Hallo! Heee! Ja, Sie meine ich, Sie, junger Mann!“, sagt eine Frau, die sich an der Eingangstüre und auf einem Gehstock abstützt. Sie trägt weiße bequeme Schuhe, welche in einem Orthopädiegeschäft hergestellt und angepasst wurden. Ihr linker Schuh ist um geschätzte zehn Zentimeter höher als der rechte. Vermutlich hat sie diesen Unterschied schon lange und lange nichts dagegen unternommen. Ihre Hüfte ist verschoben und all dies hat bereits Auswirkungen auf ihre Wirbelsäule. Sie kommt wegen der Schmerztabletten, denn Vater ist nur ein Allgemeinmediziner.
„Hinten anstellen!“, knurrt sie feindselig.
„Entschuldigung, aber ich möchte nicht in die Sprechstunde!“, sage ich und eigentlich lüge ich, denn ich möchte Vater schon gerne sprechen.
„A Rezept! Der will no a Rezept!“, sagt ein schlanker Mann, der in der Reihe vor der Frau steht, in tiefem schwäbischem Dialekt. Jetzt, da ich diesen endlich wieder höre, merke ich, wie er mir gefehlt hat.
„Ach so, ja dann!“ Sie versucht mir Platz zu machen und ich quetsche mich an ihr und den anderen die enge Treppe in den ersten Stock zur Praxis meines Vaters hoch. Überall stehen, sitzen und vor allem warten Menschen. Telefone klingeln ohne Ende.
Hektik, Stress.
Das sollte Vater sich in seinem Alter nicht mehr antun. Ich stelle mich am Tresen an. Vor mir ist eine junge Frau mit ihrem Sohn. Der Kleine ist ungefähr drei Monate alt. Sie trägt ihn auf ihren Armen und schafft es fast nicht. Ihre Arme sind zu schlank. Die Füße auch und am Gesicht sind die Knochen zu erkennen.
Essstörung.
Ich seufze und beschließe endlich damit aufzuhören, Arzt zu sein. Doch eigentlich kann ich dies ebenso wenig wie Vater. Es ist eine Berufung, nicht nur ein Job. Und doch ist nach dem, was geschehen ist, etwas in mir zerbrochen. Für immer.
Mag sein, dass dies der Grund ist, warum ich hier bin.
Zurück bin.
„Hallo!“, sage ich zu der sehr jungen Frau, die am Tresen in einen Bildschirm starrt.
„Was können wir für Sie tun?“ Sie blickt kaum auf.
„Ich möchte gerne Doktor Steimer sprechen, nur kurz!“, füge ich hinzu. Durch eine der geöffneten Sprechzimmertüren höre ich seine tiefe und doch charismatische Stimme.
„Sie haben einen Termin?“ Die Frau tippt etwas in den Computer ein. Das Telefon läutet und in einem Zimmer weint ein Kind.
„Nein, ich ...“
„Oje, dann muss ich Sie vertrösten. Sie wissen doch, immer erst anrufen. Ohne Termin kommen Sie heute nicht mehr dran. Und morgen ist auch schon alles voll. Ist es denn ein Notfall?“ Jetzt schaut sie mich an und ich denke, ich kenne diese Augen. Aus einer anderen Zeit. Ich schüttele den Kopf.
„Nein, es ist kein Notfall, ich bin auch kein Patient, ich bin …“
„Das tut mir jetzt wirklich leid, aber wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf, haben Sie das Schild nicht gesehen?“ Sie zeigt auf etwas und ich drehe mich um.
Und dann steht sie vor mir. Unsere Blicke treffen sich und ich sehe in ihren das blanke Entsetzen. Für eine Sekunde scheint die Zeit stillzustehen.
Dann holt sie aus und schlägt mir mit der flachen Hand in mein Gesicht.
„Du Schwein! Du mieses dreckiges Schwein!“ Sie will noch einmal zuschlagen, doch ich packe ihre Hand und halte diese fest.
„Das habe ich wohl verdient!“ Ich sehe, wie Tränen über die Wange von Karin rinnen.
„Mama! Bist du verrückt geworden?“, sagt die junge Frau hinter dem Tresen und stürmt nach vorne. Karin bricht völlig zusammen. Sie zittert und weint. Eine weitere Sprechstundenhilfe kommt aus einem Raum mit der Aufschrift „Labor“.
„Was ist denn hier los!“, sagt Agathe Kästle mit einer tiefen, eher männlichen Stimme. Agathe blickt zu Karin und dann sehr wütend zu mir. Ich nicke ihr freundlich zu. Doch spüre ich Wut, Hass und Ablehnung.
Ich bin nicht willkommen.
Habe ich das etwa erwartet?
Warum? Weil ich verzweifelt bin?
Wie verzweifelt waren die Menschen damals, vor fünfundzwanzig Jahre, als ich diese im Stich ließ?
Ich quetsche mich durch die Menge der wartenden Patienten hindurch hinunter zum Ausgang. Der Begriff „Spießrutenlauf“ bekommt eine neue Dimension für mich. Ich spüre die neugierigen und fragenden Blicke auf meinem Körper.
„Nur raus hier!“, denke ich. Endlich bin ich im Freien und merke, wie heiß es schon geworden ist. Und ich merke einen kleinen Hunger. Außer meiner Kreditkarte habe ich nur ein paar Münzten aus Nigeria dabei. Also gehe ich zur Bank, die sich gleich im Erdgeschoss der Praxis meines Vaters befindet.
Befand!
Ein Schild drückt mir das Bedauern der Volksbank mit, dass sie gezwungen war, die Filiale zu schließen. Ich gehe weiter die Straße entlang und muss feststellen, dass es auch keine Metzgerei mehr gibt, doch zum Glück noch die Killertal Apotheke. Darüber bin ich nun echt froh. Etwas weiter oben gibt es dann doch tatsächlich noch eine Bank. Klein, aber fein hält die Sparkasse noch die Stellung.
Euro!
Ich schüttele den Kopf. Meinen ersten Euro halte ich in Händen. Vorbei die Zeiten der D-Mark. Also betrete ich mit meinen Euro nun den Kusse Beck und kaufe mir eine noch warme Butterbrezel und einen Becher heißen Kaffee. Beides trage ich gleich einer Trophäe zur Bank unter der Dorflinde, wo es Schatten gibt.
„Hallo!“, sage ich zu den beiden Männern, die dort bereits sitzen. Den einen schätze ich auf über achtzig. Etwas zu dick, jedoch recht rüstig, er hat nicht einmal einen Stock bei sich. Der andere etwas jünger, schlank und drahtig. Doch hier spüre ich innere Unruhe. Ihre Unterhaltung unterbrechen sie jäh, als ich mich zu ihnen setze.
„Dag!“, sagt der eine auf Schwäbisch.
„Grüß Gott!“, der andere mit einem fremden Dialekt. Hier tippe ich auf Ostdeutsch. Doch ich bin mir nicht ganz sicher.
„Wird heiß heute!“ Ich versuche die Konversation wieder in Gang zu bringen.
„Wenn`s no koi Gwittr geiht!“, antwortet der eine auf Schwäbisch.
„Ein Gewitter ist ja egal, nur kein Hochwasser!“, ergänzt der andere und der Dickere nickt zustimmend. Ich schlürfe an meinem Kaffee, der heute nicht abkühlen will.
„Sie sind ab`r, ita vo hier?“ Der Dickere versucht es auf Hochdeutsch und vermischt dabei den Dialekt mit gekünstelten Brocken Hochdeutsch. Oder etwas, das er dafür hält. Ich schmunzele.
„Doch, natürlich!“ Ich schlürfe weiter.
„Awah! Vo Junginga?“ Er wirkt plötzlich viel munterer.
„Ja, eigentlich aus Hausen!“ Ich verbrenne mir die Zungenspitze.
„Des han i glei denkt. Weil d`Jungingr kenn i älle!“, sagt er zufrieden.
„Ich bin auch von Hausen! Wo wohnen Sie denn da?“, sagt nun der andere.
Ich beiße in meine Brezel.
„War lange im Ausland. Doch meine Eltern wohnen oben beim Friedhof in dem Bungalow.“ Ich kaue weiter.
„Hano! Do wohnt doch dr Herr Doktor!“, sagt nun der Dicke.
„Mein Vater!“ Ich lasse die Katze aus dem Sack. Nun sehen mich beide verwundert an.
„Dann sind Sie der junge Doktor Steimer“, sagt der schlanke Mann. Etwas fühle ich mich geschmeichelt. Noch in diesem Jahr werde ich fünfzig. Nicht mehr gerade jung.
„Ja genau, der bin ich!“ Ich möchte die Konversation beenden. Doch die Killertäler sind sehr neugierig. Ich werde keine Chance haben.
„Do wuat sich dr Doktr aber freia. Das sie, oder däfe du saga?“ Ich nicke. Natürlich darf er du sagen. Warum auch nicht. In Nigeria tut man nichts anderes. Doch, ob Vater sich freut, das muss ich erst noch herausfinden.
„Sie sind ja richtig berühmt. Einer der besten Neurochirurgen der Welt. Haben Sie nicht auch an der Krebszellenforschung in Sidney teilgenommen?“ Der Dünnere scheint richtig gut informiert zu sein. Doch das ist alles lange her. Dennoch nicke ich zustimmend.
In der Ferne höre ich ein Martinshorn und meine Leichtigkeit, die ich spürte, seit ich wieder zu Hause bin, beginnt zu verschwinden. Ersetzt wird diese mit einem Angstgefühl. Das mit dem Näherkommen der Martinshörner immer größer wird.
So groß wie meine Schuld, welche ich mir aufgeladen habe.
Die Idylle ist vorbei. Ein Rettungswagen der Ringinger Ersthelfer fährt vor die Praxis meines Vaters und versperrt die Straße. Zwei Rettungssanitäter springen aus dem Wagen, öffnen die Hecktüre und entnehmen mehrere Koffer. Ich erkenne den Notfallkoffer und einen Defibrillator.
Die ganze Szene wühlt mich so auf, dass ich den Rest meines Kaffees verschüttet habe. Auch die beiden Männer neben mir sind nun stumm geworden. Über allem liegt eine große Anspannung, denn jemand kämpft in diesen Minuten mit dem Tode. Ich stehe auf und werde von einer unsichtbaren Macht getrieben.
Getrieben zu helfen.
Etwas, das in einem steckt, das man nie mehr loswird, wenn man Arzt ist. Denn dies ist man aus Berufung und innerer Überzeugung. Die Hilfe am Nächsten steht über allem. Auch wenn ich damit schreckliche Erinnerungen verbinde. Ich will helfen.
Ich muss helfen.
Vater braucht Hilfe bei seinen Patienten.
Doch das nicht erst seit heute. Ich gehe zuerst langsam, dann schnell und schneller auf die Eingangstüre zu. Die ersten Patienten drehen um und kommen kopfschüttelnd aus der Praxis. Eine Frau weint. Dann kommt einer der Rettungssanitäter aus der Praxis. Er hält sich ein Smartphone an sein Ohr und wirkt hektisch.
„Kann ich helfen?“, frage ich, doch er winkt mir nur abweisend zu.
„Bitte! Bitte machen Sie Platz!“ Agathe rennt aus der Eingangstüre und drängt die Menschen zurück, auch sie hat geweint. Ich sehe, wie ihre schwarze Wimperntusche ihre Wange verschmiert hat. Dann wird der Patient aus der Praxis getragen. Einer der Rettungssanitäter an einem und ein mir unbekannter Mann am anderen Ende.
Ich spüre eine unglaubliche Beklemmung in mir aufsteigen.
Ich spüre Angst und Furcht.
Die Schatten, die mich schon so lange verfolgen, sind zurück.
„Wo bleibt der Notarzt?“, will der eine Rettungssanitäter wissen.
„Im Stau, es gab noch einen Unfall!“, sagt der andere und telefoniert weiter.
„Wo ist nur Vater?“, denke ich, und spüre den Drang, zu helfen.
Einmal Arzt immer Arzt! Das hat schon mein Professor an der Uni immer gesagt. Und so ist es einfach. Den Hippokratischen Eid schwören wir am meisten für uns selber.
„Scheiße! Abstellen! Bernd, komm her!“, ruft der Rettungssanitäter und dann stellen sie die Trage einfach auf die Straße. Einer beginnt mit Reanimationsmaßnahmen und ich erstarre zu Eis.
„Vater!“, murmele ich und dränge mich nun vor.
„Macht Platz, ich bin Arzt!“, schreie ich den jungen Mann an. Dieser schaut mich fragend an und dann Agathe.
„Er ist Arzt!“, schreit sie völlig außer sich. Der Sanitäter macht Platz. Kurz beginnt sich alles in mir zu drehen. Doch ich bin zu lange Arzt, um in solchen Situationen nicht professionell zu sein. Ich fühle den Puls.
Kein Puls, keine Atmung. Sofort beginne ich wieder mit der Reanimation.
Dreißigmal Herzdruck, zweimal beatmen.
„In den Wagen! Ich brauche den Defibrillator!“, sage ich laut und bestimmt. Zwei weitere Männer helfen mir, die Trage und Vater in den Rettungswagen zu schieben. Plötzlich nimmt Agathe meine Hand. Sie schaut mich mit wässrigen Augen an. Ihre Hand und ihr Mund zittern.
„Das wird doch wieder?“ Eine kurze Frage, in der so viele Gefühle, Ängste und Hoffnungen stecken.
„Ich tue mein Bestes!“, antworte ich und springe in den Rettungswagen.
„Nach Hechingen ins Krankenhaus!“, weise ich den Fahrer an. Der andere gibt mir die Kabel und den Defibrillator. Ich lege die Klemmen an. Laden auf zweihundert! Weg jetzt!“, schreie ich und das Gerät gibt einen Impuls. Doch die Sinuskurve zeigt keinen Ausschlag.
„Laden auf dreihundert! Weg!“
Der Körper von Vater bäumt sich auf. Endlich ein Ausschlag.
„Da ist er wieder!“ Der Rettungssanitäter, welcher bei mir steht, lacht. Ich nicke und atme erleichtert aus.
„Warum fahren wir denn nicht!“ Ich fluche und klopfe an die Scheibe zum Fahrerbereich. Dieser zuckt mit der Schulter.
„Wohin denn?“, will er wissen.
„Das habe ich doch gesagt. Nach Hechingen ins Krankenhaus!“ Ich schreie zu laut.
„Aber da gibt es doch schon lange kein Krankenhaus mehr!“, sagt nun der andere Rettungssanitäter.
„Was? Warum sollte ...“
Veränderungen!
„Nach Tübingen in die Med!“, befehle ich und messe so lange den Puls.
Vater ist schwach, alt und viel zu mager. Er hat sich zu lange aufgeopfert. All das ist meine Schuld. Nur meine! Weil ich egoistisch war.
Der Rettungswagen setzt sich in Bewegung. Das Blaulicht und die Sirene werden eingeschaltet.
Wir rasen los.
„Bis Tübingen sind es dreißig Minuten, eine lange Zeit.“ Meine Gedanken kreisen und ich injiziere Vater ein Blutverdünnungsmittel. Ich überprüfe die Werte.
„Eine verdammt lange Zeit!“, murmele ich und höre dann nur noch das Martinshorn.
Der Rettungswagen fährt rückwärts in die Notaufnahme. Dort stehen schon einige Klinikmitarbeiter, was in mir eine Erleichterung auslöst.
Doch warum nur?
Weil ich denke, dass diese gleich Engeln Wunder vollbringen können und werden? Oder weil ich froh bin, meine Verantwortung nun abgeben zu können?
Doch das kann ich nicht, nie!
Ich springe als Erstes aus dem Wagen.
„Patient, männlich, zweiundachtzig, Nichtraucher. Herzinfarkt, Einsatz Defibrillator, zweimal, Verabreichung von Blutverdünner. Pupille auffällig, Verdacht auf zusätzlichen Schlaganfall. Derzeit stabil!“, sage ich zu einem sehr jungen Arzt, der nun die weitere Behandlung übernimmt.
Übernehmen möchte.
Wir rennen neben der Liege weiter einen Flur entlang.
„Danke Kollege, ab hier übernehmen wir. In den Schockraum!“, schreit er und dann rennen die Mitarbeiter noch schneller. Doch auch ich renne mit, denn ich will nicht, dass jemand anderes die Behandlung übernimmt. Vater soll den besten Arzt bekommen. Und ohne zu übertreiben, der bin nun mal ich!
Vater wird in den Schockraum geschoben, an Kabel angeschlossen, Injektionen werden aufgezogen.
„Danke Kollege, aber wir machen das jetzt!“, sagt der junge Arzt zu mir, doch ich nehme das nicht wirklich wahr. Ich beobachte, was getan wird, um einzuschreiten oder Tipps zu geben.
„Soll ich die MRT vorbereiten?“, fragt eine kleine Krankenschwester.
„Ja, sagen Sie denen, wenn er stabil ist, dann kommen wir sofort.“ Der Arzt setzt eine Spritze in den von mir angelegten Zugang.
„Er muss sofort in eine MRT und dort mittels Katheter untersucht werden und Engstellen geöffnet werden!“, werfe ich ein.
„Ja, sicher, vielleicht! Wer sind Sie überhaupt?“, will der junge Arzt nun von mir wissen.
„Sein Sohn“, antworte ich.
„Schwester, bringen Sie diesen Mann hier raus!“, schreit er dann die kleine Krankenschwester an und nimmt von mir keine weitere Notiz.
„Bitte kommen Sie! Wir tun alles, was in unsere Macht steht!“, sagt die kleine Frau und greift nach meinem Arm. Genau in diesem Moment ertönt ein greller Pfeifton, gefolgt vom wild blinkenden Leuchten auf dem EKG-Monitor.
„Assy Linie! Defi, schnell!“ Der junge Arzt schreit und wirkt hektisch. Der Defibrillator wird erneut geladen.
„Laden auf zweihundert! Weg vom Tisch und Schuss!“
Doch es passiert nichts. Der Pfeifton ändert sich nicht. Ich spüre, wie mir eine Träne über meine Wange läuft, und dabei hatte ich gedacht, in meinem Leben alle Tränen vergossen zu haben.
„Laden auf dreihundert! Weg vom Tisch und Schuss!“ Ein kurzes klackendes Geräusch und das Aufbäumen des Körpers meines Vaters.
Doch das Geräusch bleibt.
„Noch mal!“, schreit der junge Arzt und es klackt erneut, doch dieses Mal bäumt sich der Körper meines Vaters schon nicht mehr so weit auf.
„Das war`s!“, murmelt er dann und die Schwester nickt ihm zu. Sie will die Kabel am Körper meines Vaters entfernen.
„Nein!“, schreie ich. „Noch mal!“ Doch niemand will meinem Befehl, meinem Wunsch oder meiner Hoffnung folgen.
„Noch mal, noch mal, noch mal …“ Tränen rinnen über mein Gesicht und tropfen auf den Brustkorb meines Vaters. Ich beginne mit der Herzdruckmassage und rufe stoisch immer den gleichen Satz. Was um mich herum passiert, nehme ich nicht wahr. Ich drücke und drücke, bis zwei sehr schlanke Hände sich um die meinen legen.
„Conny! Lass es gut sein, komm Conny, es ist vorbei!“ Eine sanfte Stimme flüstert mir ins Ohr. Ich möchte weitermachen, nicht aufgeben, Ärzte geben nie auf. Dann schlingen sich zwei starke und doch schlanke Arme um meinen Körper und ziehen mich weg von Vater.
„Conny, es ist vorbei. Du hast alles getan!“, sagt die Stimme.
Habe ich das? Was, wenn nicht? Wenn ich zu früh aufgebe?
Ich bin Arzt und nicht Gott.
Jemand notiert eine Uhrzeit und schlägt eine weißes Tuch über das Gesicht von Vater.
Es ist vorbei!
Ein laues Lüftchen streicht über meinen Kopf. In der Ferne sieht man die tausend Lichter der endlosen Autoschlange, die sich in das Steinlachtal hochquält. Ich bibbere, obwohl es eine der mildesten Nächte ist, die ich in Tübingen je erlebt habe. Ein Klicken, eine kleine Flamme und etwas weißer Rauch.
„Echt jetzt, du rauchst?“ Ich blicke auf. Neben mir sitzt Simone. Sie trägt einen Arztkittel und dazu rote Sneakers. Sie zuckt mit der Schulter.
„Manchmal!“ Sie nimmt einen kräftigen Zug.
„Und dann noch dieses Mentholzeugs!“ Ich höre mich an wie Vater.
Vater! Er ist tot. Gegangen so wie ich damals. Ohne ein Wort zu sagen, ohne dass wir noch ein Wort sprechen konnten. Ein grässlicher Schmerz schießt durch meine Brust.
„Dann riecht man es nicht gleich. Versuche doch, meine Patienten vom Rauchen wegzubringen.“ Simone lächelt mir zu.
„Deine Patienten!“, flüstere ich und mein Blick fällt auf das Schild, welches an ihrem Arztkittel baumelt. Dort steht: Professor Doktor Doktor Simone Kessler, Klinikleiter Uniklinikum Tübingen.
„Ja, manchmal stehe ich sogar noch im OP. Manchmal!“ Sie nimmt noch einen kräftigen Zug von ihrer Zigarette.
„Und sonst? Leitung der Klinik, das ganz große Ding?“, frage ich.
Simone zuckt mit der Schulter. „Ja, schon. Viel Geld, viel Stress, wenig für was wir gelernt haben. Und du? Wo warst du all die Jahre?“
„Hie und da!“ Ich senke meinen Blick und greife noch fester um den Pappbecher, den ich in den Händen halte.
„Hie und da!“ Simone lacht. „New York, Tokyo, Singapur, Sidney und ich glaube auch L.A. Mensch, du bist der beste Neurochirurg und Krebsspezialist auf der ganzen Welt.“
„So wie du das sagst, hört es sich nach einem Jobangebot an?“ Ich versuche auch etwas zu lachen. Doch nach all dem, was geschehen ist, fällt es mir sehr schwer.
„Unbedingt, doch ich glaube Tübingen kann sich dich nicht leisten! Aber vielleicht räumst du mir einen Rabatt ein.“ Simone streicht mir über meinen Arm. Ein Gefühl, das Erinnerungen wach werden lässt. Erinnerungen an Nigeria. Hastig und schroff ziehe ich meinen Arm weg.
Simone zippt ihre Kippe auf das Dach der Uniklinik, auf dem wir sitzen.
„Ist sicherlich nicht erlaubt!“
„Was? Ach, dass wir hier oben sind! Nein sicherlich nicht, doch hier stört dich keiner. Und glaub mir, das braucht man ab und an. Ist so was wie mein Geheimplatz.“ Sie rempelt mich an.
„Fühle mich geehrt, dass du diesen mit mir teilst!“ Ich möchte zurückrempeln, doch tue es nicht.
„Ich bin froh, dass du zurück bist!“, sagt sie.
„Da bist du vielleicht die Einzige!“, antworte ich und Simone sagt darauf nichts. Ich stehe auf, denn ich habe eine Aufgabe, eine, um die mich niemand beneidet.
„Ich muss es Mama sagen!“, murmele ich und weiß nicht, wie ich das tun könnte. Simone nickt.
„Ich fahr dich!“, sagt sie und steht auch auf.
„Schon Schichtende?“, möchte ich wissen.
„Du weißt doch, ich bin der Chef hier!“ Sie lächelt mir zu und ich werfe meinen Pappbecher in dieselbe Richtung wie Simone ihre Kippe geworfen hat. Wir gehen zurück in das Gebäude. Zurück in eine fremde Welt.
Zurück zu meinen Schatten, welche nun noch größer geworden sind.
In der Nacht kann eine Klinik etwas Friedliches besitzen. Man bildet sich ein, dass Tod, Schmerzen und Siechtum für einige Momente aus der Welt verbannt sind. Natürlich weiß ich es besser. Auch in der Nacht schläft die Klinik nie. Unfallopfer, Notfälle, plötzliche Komplikationen. Die Zeit steht niemals still, doch für Vater und mich nun schon. Es wird kein „Wir“ mehr geben. Ich warte vor dem Büro von Simone. Natürlich habe ich vor Neugierde einen Blick hineingeworfen. Es ist so groß und modern, dass man in Nigeria eine halbe Klinik daraus machen könnte.
Nigeria.
Alles beginnt sich wieder zu drehen. Ich höre die Stimmen, die Schüsse, die Schreie. Ich rieche das Blut, die Flammen, ja den Tod.
„Kommst du?“ Simone steht neben mir und schließt das Büro zu. Mein Erstaunen scheint man mir anzusehen.
„Ja was jetzt, denkst du, ich trage nur Arztkittel und Sneakers? Hey, noch bin ich eine junge Frau, der Fünfer hat noch a bisle Zeit“, sagt Simone auf Schwäbisch.
„Bei dir vielleicht!“, brumme ich und folge ihr, die in knallroten Pumps und einer engen Jeans vor mir her stöckelt. Wir steigen in den Aufzug, wo eine Krankenschwester gerade aussteigt. Sie grüßt fast überschwänglich ihre Chefin.
„Guten Abend Frau Professor!“, sagt die junge Frau und ich ziehe die Augenbrauen nach oben.
„Ich weiß schon, du bist der Chef!“
Wir lachen beide und das tut mir gut.
Etwas, denn es gibt eigentlich nichts zu lachen.
Nie mehr!
Der Aufzug stoppt und wir treten in den großen Warteraum. Beim Anblick der Wartenden macht mein Herz einen spürbaren Sprung.
„Mama!“, flüstere ich.
„Du Schwein, du!“ Meine Schwester Cindy rennt auf mich zu. Sie gibt mir eine schallende Ohrfeige und schlägt dann mit ihren Fäusten auf meinen Brustkorb ein.
„Du hast ihn umgebracht, du nur du bist schuld!“ Cindy schreit wie eine Verrückte.
„Frau Steimer! Frau Steimer, bitte beruhigen Sie sich!“ Simone geht dazwischen, kann jedoch Cindy nicht bändigen. Und mir fällt auf, dass Simone Cindy mit „Sie“ anspricht.
Veränderungen.
„Cindy, komm lass es gut sein“, sagt nun mein Bruder Max und versucht charismatisch zu klingen. Er trägt einen teuer aussehenden schwarzen Anzug, ist korrekt rasiert und seine Haare sind gegelt. Doch etwas in seinen Augen gefällt mir nicht. Doch ich habe im Moment nicht die Kraft, weiter darauf einzugehen. Max gelingt es dann, Cindy etwas zu beruhigen und sie von mir wegzuziehen.
„Mein Beileid!“, sagt Simone trocken und kühl. Ich bin sicher, sie muss diesen Satz zu oft sagen. Zu oft, als dass es das Herz eines Arztes ertragen könnte. Das alles kam in unseren Visionen vom Beruf des Arztes nicht vor.
„Können wir ihn sehen?“, will Max wissen und Simone nickt. Sie winkt eine Schwester her, die gerade den Gang entlangschlürft.
„Die Schwester bringt Sie hin!“ Simone kann autoritär und sachlich wirken. Cindy bricht völlig zusammen und muss von Max gestützt werden. Mama steht aus ihrem Sitz auf. Sie trägt bereits schwarze Kleidung. Alles sehr korrekt. Korrektheit, das war immer ihr Lebensmittelpunkt.
„Mama! Ich, ich … es tut mir leid!“, stammele ich und versuche dabei nicht zu weinen. Mama nickt mir mit einem stechenden Blick zu. Dann schlägt sie mir mit der flachen Hand ist Gesicht und geht wortlos an mir vorbei.
Das war nun die zweite Ohrfeige am heutigen Tag. Und ich denke, ich habe beide verdient. Doch die letzte von Mama hat nicht nur meine Wange getroffen, nein diese ging sehr tief in mein Herz.
Verletzungen: Ich bin wieder zu Hause.
Ich sitze in einem roten Porsche neben Simone und wir fahren durch einen Burger Drive-In. Nun gibt es so etwas auch in Hechingen. Ein Angestellter lächelt Simone an und reicht ihr die Tüten. Sie zwinkert mir zu.
„Du musst was essen, hast heute doch noch nichts zu dir genommen!“ Röhrend fahren wir los.
„Aber doch! Zwei Brezeln vom Junginger Kusse Beck!“ Ich antworte schon etwas stolz, fast wie ein kleiner Junge, der mit einer guten Note die schlechten Erwartungen der Eltern übertrumpft.
„Wow. Finde ich ja klasse, dass es den noch gibt!“ Wir fahren am Landgericht vorbei, stadtauswärts.
„Nicht alles hat sich verändert.“ Ich blicke auf das Hechinger Gymnasium.
„Nicht alles, aber das meiste!“, sagt Simone und nun fahren wir direkt auf die majestätisch wirkend und angestrahlte Burg Hohenzollern zu.
„Immer wieder schön anzusehen!“, meint Simone und sie hat recht.
„Wo fahren wir eigentlich hin?“
„Zu mir, oder wo möchtest du übernachten?“ Simone biegt ab und gibt Gas.
Eigentlich dachte ich, dass ich zu Hause, bei Mama und Vater schlafen würde. Dass sie sich freuen würden, wenn ich zurück bin. Dass Mama vielleicht einen Kuchen backt und ...
Träume.
„Das wäre klasse!“ Meine Stimme klingt belegt.
„Oh, dein Gepäck! Wo ist dein Gepäck?“
Ich höre ihre Worte und denke an die Tasche, das Einzige, was ich mit genommen habe aus Nigeria.
„Ich habe keines!“
„Kein Gepäck? Du reist ohne Gepäck?“ Die Stimme von Simone klingt sachlich. Sie ist und war immer die Einzige, die mich verstanden hat, und es wohl noch immer tut.
„Es ist kompliziert!“, murmele ich und versuche den aufkeimenden Schmerz und die Erinnerungen zu unterdrücken.
„Oh Conny, wann war es bei dir nicht kompliziert?“ Nun lacht Simone etwas und ich fühle mich zum ersten Mal etwas geborgen.
Zum ersten Mal, seit die Schüsse fielen.
Wir fahren durch den kleinen Ort Boll, dann biegen wir rechts ab und fahren einen kleinen Feldweg entlang. Dann wird mir bewusst, wo wir hinfahren.
„Du hast es getan? Den Hof deiner Großmutter? Echt, wow!“ Ich setze mich auf und wir fahren in den renovierten Bauernhof, der von großen Koppeln umgeben ist.
„War nicht einfach, hat mich ein Vermögen gekostet. Doch was soll ich sagen, ich konnte nicht anders. Gefällt er dir?“
„Ja Wahnsinn, echt. Du bist die Größte!“ Ich steige aus, die Luft ist klar, mild und riecht nach Wald und einfach der Alb. Nach zu Hause. Und auch etwas nach Pferd. Doch dann wird mir bewusst, dass ich schon wieder eindringe. In ein Leben, in etwas, was ich nicht sollte.
„Weißt du, es ist besser, wenn ich mir ein Hotel suche, ich möchte deinem Man und deiner Familie nicht lästig werden.“
Simone ist fast bei der Haustüre und dreht sich noch einmal um.
„Ein Hotel, in Hohenzollern, um diese Uhrzeit? Und ich heiße noch immer Kessler. Kein Mann, und was die Familie betrifft, also das musst du selber klären. Ich habe da Kalle, den Kater, Curry, meinen Goldie, und ein halbes Dutzend Pferde. Ich denke, die werden dich mögen!“
Simone schließt die Türe auf. „Komm schon, ein kalter Burger schmeckt nicht!“
Wo sie recht hat, hat sie recht!
Egal ob kalt oder lauwarm, ich bin einfach kein Burger-Fan.
Jetzt.
Früher war das etwas anderes. Ja, da war das etwas Besonderes. Und ein Ort, ein Rückzugsgebiet für mich und Simone. Seit der Grundschule waren wir Freunde. Und sie hatte es nie leicht. Ihre Mutter war immer kränklich. Zuerst musste ihr ein Bein amputiert werden und dann starb sie früh, da war Simone gerade erst vierzehn. Ihr Vater stürzte sich in die Arbeit und bekam dann einen Herzinfarkt. Dann wohnte sie bei ihrer Großmutter und wir verloren uns aus den Augen. Doch als ich auf das Hechinger Gymnasium kam, traf ich sie wieder. Und wir waren weiter Freunde. Erzählten uns immer alles und wenn es bei einem dann mal nicht rundging, aßen wir Fastfood. Dann war es immer, als wenn die Zeit stehen bleiben würde.
Doch das tat sie nicht, nicht ein einziges Mal. Und ich muss gestehen, dass ich mich in Simone verliebte. Doch so etwas kann auch eine Freundschaft zerstören, und so habe ich es ihr nie gesagt. Es stand auch immer etwas im Weg. Zuerst ihr Freund, dann meine Freundin. Das Studium. Auch hier hatte sie es nicht leicht. Musste alles selber finanzieren, anders als bei mir. Ich hatte ja Vater.
Vater!
Nun werden für immer die letzten Worte zwischen uns gesprochen sein. Und diese haben wir beide im Zorn gesprochen. Damals dachte ich, es läge an allen anderen. Heute denke ich, es lag nur an mir. Ich hätte nicht kommen sollen. Doch wo hätte ich sonst hingehen können. Wo hätte ich einen Platz gefunden mit Frieden und Ruhe. Ich werde auch heute Nacht im luxuriösen Gästezimmer von Simone nicht schlafen können, auch nicht, obwohl der Kater mir Gesellschaft leistet. Ich setze mich auf und blicke durch die Terrassentüre hoch zur Burg. Dann fasse ich wieder einen Entschluss. Ich werde die Beerdigung abwarten und dann für immer weggehen.
Irgendwo hin.
Weit weg, ein Arzt wird immer gebraucht.
Ich falle zurück auf das Bett und weine wie ein kleines Kind.
Das ich so gerne noch einmal wäre.
Ich renne, immer schneller. Die Hitze ist drückend. Doch ich muss es schaffen. Ich werde es schaffen. Mein Rucksack ist schwer, zu schwer. Doch ich werde es schaffen. Überall ist Morast und es regnet wie aus Kübeln. Menschen kommen mir entgegen. Viele sind verletzt, schreien und weinen. Doch ich sehe nicht nach ihnen, denn ich muss weiter.
Noch eine Viertelstunde bis zum Dorf.
Ich renne, obwohl ich völlig außer Puste bin und eigentlich meine Beine kaum noch spüre.
Doch ich werde es schaffen.
Dann fallen Schüsse.
Schreie!
Etwas hinter den Baumkronen explodiert. Ein mächtiger Feuerball steigt auf. Die Wucht der Druckwelle wirft mich um.
Schreie, Schüsse ...
Ich wache schweißgebadet auf. Kurz weiß ich nicht, wo ich mich befinde. Doch dann sehe ich den Kater in der geöffneten Terrassentüre sitzen. Er ist stolz, denn er hat schon eine Maus gefangen. Ich setze mich auf.
„Igitt, lass das bloß nicht dein Frauchen sehen, die mag keine Mäuse.“ Ich strecke meine verspannte Nackenmuskulatur. Auf dem kleinen Tisch neben dem Bett, welches als Nachttisch gedacht ist, liegt ein kleiner grüner Zettel.
„Bin joggen und habe Spätdienst. Frühstück, wenn ich zurück bin, ein „Nein“ wird nicht akzeptiert.“ Um die Nachricht hat Simone ein Herz gemalt.
Nun verspüre ich eine komplette Leere und starre auf den Zettel als wäre er aus Gold oder eine Urkunde oder etwas Besonderes. Aber genau das ist er auch, für mich. Ich habe doch noch einen Freund. Vielleicht etwas, das meinem Leben noch mal einen Sinn geben könnte. Ich stehe auf und gehe ins Bad. Dort halte ich meinen Kopf unter das eiskalte Wasser.
Es hilft nicht, meine Schatten bleiben und sind seit gestern größer geworden.
Ich gehe in den Flur und wähle die Nummer meiner Eltern. Eine kurze Nummer, die sich nie geändert hat.
Es piept, dann klackt es und eine Stimme beginnt zu sprechen.
Vater.
„Grüß Gott. Dies ist der private Anschluss von Doktor August Steimer. Gerne erreichen Sie mich morgen in der Praxis. Die Nummer ist 0747715609, den Notdienst an Wochenenden erreichen Sie unter 116117, wenn Sie eine private Nachricht für mich haben, dann sprechen Sie nach dem Signalton, auf Wiederhören.“ Ich lege auf.
Ich werde Vater nicht mehr sprechen können. Ich nicht und auch sonst niemand. Doch ich muss mit Mama sprechen, ihr erzählen, was geschehen ist, mich entschuldigen.
Es läutet und ich gehe zur Türe. Als ich diese öffne, steht Karin davor. Sie packt meinen Arm und zieht mich die Treppe hinunter.
„Komm schon!“, sagt sie. In dem Moment kommt Simone vom Joggen zurück. Sie hat ihre Haare hochgesteckt und trägt eine bunte enge Leggings und hat Kopfhörer aufgesetzt. Sie nimmt diese ab.
„Karin, gute Morgen!“ Simone ist höflich und fröhlich. Anders als Karin, doch ich kann es ihr nicht verdenken.
Karin antwortet nicht, sondern brummt etwas Unverständliches vor sich her und zerrt mich zu ihrem Wagen.
„Ich hätte da noch Frühstück!“ Simone zwinkert mir zu.
„Frühstück, pah. Ich wusste ja, wo ich ihn finden werde, das war so klar.“ Karin drückt mir frische Kleidung in die Hand.
„War es das?“, will ich erstaunt wissen.
„Meinst du, ich bin blöd? Ihr zwei, das war doch schon immer so. Ihr könnt es jetzt ruhig zugeben!“ Sie schreit.
„Das ist unfair von dir. Wir haben nie ...
„Das ist mir scheißegal!“ Karin fällt Simone vulgär ins Wort und zerrt mich in den Wagen.
„Ich hoffe, du meldest dich dieses Mal früher?“ Simone lacht und geht ins Haus. Karin fährt los, ohne mich dabei anzusehen.
Wir fahren vor die Praxis meines Vaters. Dort stehen noch mehr Menschen als gestern, und das, obwohl sich der Tod von Vater schon längst herumgesprochen hat. Auf der Schwäbischen Alb ist noch immer die Mundpropaganda schneller als das Internet. Und nun dämmert es mir auch, was Karin vorhat.
„Das tue ich bestimmt nicht!“, sage ich mit fester Stimme. Karin steigt aus. Sie dreht sich um und schaut mir sehr böse in die Augen.
„Nein? Was tust du dann? Wieder abhauen und dich vor der Verantwortung drücken. Ja? Tust du das? Ja dann hau doch ab!“ Sie schlägt die Türe zu. Ich steige auch aus und möchte hinterherlaufen.
Möchte vielleicht eine Erklärung abgeben.
Eine Entschuldigung.
„Jetzt warte doch!“, rufe ich ihr nach, doch sie hebt nur ihren rechten Arm und zeigt mir den Stinkefinger. Dann stößt etwas gegen mein Bein. Ich drehe mich um und sehe in die verweinten Augen einer kleinen alten Frau mit schlohweißem Dutt.
„Oh Entschuldigung, aber i mecht mei Beileid aussprächa. Ihr Vaddr war emmer fier aus do!“, sagt sie in tiefem Dialekt und reicht mir ein Couvert mit schwarzem Rand auf dem „Aufrichtige Anteilnahme“ steht.
„Danke, ja Vater war immer für alle da!“, antworte ich und denke: „Nur nicht für die Familie!“
„Siehscht, i han gwisst dr Jung kommt ond duat weiter!“, sagt ein Mann zu einem anderen. Doch er hat nicht recht, denn ich werde nicht weitermachen. Jemand lacht und erst jetzt merke ich, dass ich noch immer keine Hose anhabe. Dann trabe ich los, um in die Praxis zu gelangen.
Warum?
Weil ich mich schuldig fühle.
Verpflichtet?
Nur in Shorts und einer weißen Hose und grasgrünem T-Shirt in der Hand steige ich die enge Treppe in die Praxis hoch. Drinnen ist es noch schlimmer. Eigentlich ist die Praxis überfüllt. Die Menschen stehen an den Wänden und in den Gängen. Am Tresen klingelt ständig das Telefon.
„Viel los heute, Doc!“ Die junge Trau am Empfang winkt mir zu. Karin kommt mit Blutproben aus dem Labor.
„Okay, ich mache das. Heute, nur heute!“, zischt meine Stimme, doch sie würdigt mich keines Blickes. Ich zwänge mich durch den Gang und betrete Vaters Behandlungsraum.
Ich schließe die Türe.
Stille.
Erinnerungen.
Hier haben wir uns gestritten, vor fünfundzwanzig Jahren. Fast auf den Tag genau.
Eine andere Zeit.
„Es tut mir leid!“, flüstere ich, während ich die Hose und das T-Shirt anziehe, als könnte Vater es hören. Der Raum hat sich kaum verändert. Eine mit grünem Kunstleder bezogene Behandlungsliege. Dann der große aus Nussbaum gefertigte Schreibtisch. Korrekt und ordentlich aufgeräumt. Rechts ist ein Bleistiftspitzer angebaut, der eigentlich längst in ein Museum sollte. Auf dem Tisch liegt eine zerschlissene graue Schreibunterlage, Stifte und Vaters Stethoskop. Er kam immer ohne all die modernen Geräte aus und hat sich beinahe nie geirrt. Fast besser als eine MRT sah er in der Körpersprache der Patienten schon die Ursache der Beschwerden. Manchmal noch, bevor es Beschwerden gab. Das kann ich nicht, ich brauche die Technik, doch mit deren Hilfe bin auch ich gut.
Sehr gut, wie viele sagen würden.
Die Türe fliegt auf und die junge Frau vom Empfang bringt mir die erste Patientenakte. Und wieder denke ich, dass ich die Frau kennen sollte. Ihre Konturen, ihre Bewegungen und vor allem ihre Augen kommen mir sehr bekannt vor.