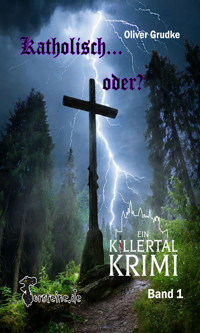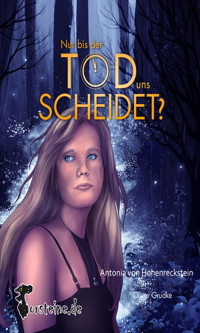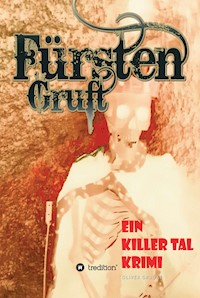Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Torsteine.de
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zurück in der alten Heimat, und zurück in der Spießigkeit einer Kleinstadt in der ländlichen Provinz. Jeder kennt jeden, und träg ein dunkles Geheimnis mit sich. War es die Richtige Entscheidung noch einmal zurück zu kehren an den Ort der Demütigungen? An den Ort der Verzweiflung? Doch er kommt nicht mehr weg, denn eine bestialische Mord Serie zwingt ihn seinem Beruf als Forensicher Psychologe nachzugehen und dem Mörder zu folgen. Dieser hat noch ein letztes Ziel: Er will Dich!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Grudke
© 2023 Oliver Grudke
Lektorat: Nadine Senger
Verlagslabel: Torsteine.de
Verlagslabel: Torsteine.de Druck und Distribution im Auftrag des Autors: www.torsteine.de Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Oliver Grudke, Ebingerstraße 52, 72393 Burladingen, Germany
Ich bin wütend! Doch das sollte nicht sein. Denn ich weiß, wie man Gefühle und Emotionen kontrolliert. Diese steuert und psychische Ausnahmesituationen umgeht.
Stecke ich in einer psychischen Ausnahmesituation?
Aus der Sicht eines Durchschnittsbürgers gesehen natürlich nicht. Doch für mich stellt sich die Situation völlig fremd dar. Geschätzt bin ich seit fünfundzwanzig Jahren nicht mehr Auto gefahren.
Warum auch?
Ich lebe, arbeite und verbringe die gesamte Zeit in Stuttgart.
Genau in der Autostadt, in der es unmöglich ist, Auto zu fahren. Selbst wenn man es schieben würde, käme man kaum voran.
Und heute?
Fahre ich Auto. Ein Teil-Auto. Klein und hässlich. Es wäre ein Hybrid, hat der Vermieter gesagt. Teil, weil es sich die Menschen teilen.
„Na und?“, war meine Antwort und dann bekam ich eine lästig lange Erklärung, dass dieses Auto sowohl mit Strom als auch mit Benzin fahren würde.
Toll!
Aber wenn beides aus ist, so fährt es nicht. Diese Tatsache ist mir auch nach fünfundzwanzig Jahren noch bekannt.
„Vollgetankt und geladen.“
Eine Lüge.
Ich mag keine Lügen.
Und ich spüre diese immer.
Bei allen, ob Patient oder nicht.
Meine Professoren an der Uni hielten dies für eine Gabe, doch ich halte es eher für etwas Lästiges. Doch letztendlich hat diese „Gabe“, wenn ich nun den Ausdruck doch noch benutzen soll, mich zu einem der besten forensischen Psychiater Deutschlands gemacht.
Ich blicke auf den Beifahrersitz. Dort liegt der Grund für meine Autofahrt.
Eine Fahrt zurück.
Viele würden vielleicht sagen: nach Hause.
Doch was ist ein Zuhause?
Wie wird dies definiert?
Schlägt man dies nach oder googelt es, so ist dies ein Ort, wo sich jemand wohlfühlt. Setzt man ein Neutrum davor, also das Zuhause, so bedeutet dies für viele die Familie, das Zusammensein und das Umgeben-Sein von Menschen, die mich lieben.
Ein Zufluchtsort.
Also ist es ein Ort.
Oder?
Nein und ja. Zu Hause kann auch nur ein Gefühl sein. Eines, das für jeden anders empfunden wird. Es ist authentisch und persönlich.
Deshalb fahre ich nicht nach Hause, weil es für mich einen solchen Ort nicht gibt. Ich habe keine Familie, keine Kinder, keine Partnerin oder Partner. Es gibt keinen Ort, an dem ich mich geborgen fühle oder nach dem ich mich sehne.
Ich fahre in die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Und in der ich sehr lange nicht war.
Denn es gab keinen Grund dazu, und eigentlich gibt es den auch heute nicht.
Weil sich nichts verändert hat.
Weil sich die Menschen nie ändern.
Sie sind egoistisch, gierig und selbstsüchtig.
Nie habe ich jemanden getroffen, der dem nicht entsprach. Zugegeben - einige gab und gibt es, da muss man noch einige schlechte Charakterzüge hinzufügen. Vor allem bei den Mördern, welche die Tat geplant haben.
Jene faszinieren mich immer am meisten.
Also warum fahre ich zurück in die Stadt, welche ich eigentlich hasse?
Wieder fällt mein Blick auf den Beifahrersitz, wo die Einladungskarte liegt. Darauf ein Bild der Abi-Abschlussklasse von 1998. Selbstverständlich ist dies auch kein Grund, in einem Auto zu sitzen und sich zu quälen.
Etwas anderes hat mich berührt. Mich neugierig gemacht. Denn die Karte wurde persönlich unterschrieben.
„Ich freu mich auf Dich. Deine Ivette.“
Ivette.
Sie war hübsch. Unglaublich hübsch und unerreichbar.
Für mich.
Groß, lange blonde Haare und einen umwerfenden Augenaufschlag.
Ivette.
Alle standen auf sie. Und das genoss Ivette.
Ich war, nein ich bin hässlich, und da gab es keine Chance.
Und nun? Schreibt sie mir persönlich?
Nach so vielen Jahren?
Das macht mich neugierig. Darauf wie sie heute aussieht, wie sie lebt, welchen Beruf sie ergriffen hat. Und ob ihr Augenaufschlag noch immer so umwerfend ist.
Ivette. Ivette Sailinger. Ihr Vater hatte eine Versicherungsagentur. Immer gut verdient und sie wohnte oben an der Sonnenhalde in einem neuen Haus. Auch glaube ich mich an einen Bruder zu erinnern, Simon. Ihre Mutter arbeitet bei der Bank und es fehlte Ivette nie an irgendetwas. Wie gerne wäre ich einmal mit ihr ausgegangen. Das taten die anderen. Vor allem Schöck und dieser dämliche Mayer, welcher heute sicherlich von Beruf Sohn ist.
Und doch interessiert es mich, wie sie heute aussieht und wer sie geheiratet hat.
Vielleicht ist sie auch ledig geblieben, so wie ich? Als Psychiater spüre ich die in mir aufkeimende Hoffnung, was natürlich völliger Blödsinn ist. Vergangenes ist vergangen und muss es auch bleiben.
Ivette. Sie organisiert unser Treffen. Fünfundzwanzig Jahre Abi-Abschluss?
Seltsam.
Denn Ivette war nicht dabei. Sie hat auf eigenen Wunsch das letzte Jahr wiederholt. Und jetzt, da ich mich erinnere, fallen mir auch die anderen Veränderungen wieder ein, welche bei Ivette kurz vor dem Abitur auftraten.
Sie lachte nicht mehr, trug schwarze Kleidung, schwarzen Lippenstift und sonderte sich mehr und mehr von uns ab.
Nein, ich habe sie nicht gefragt.
Das bereue ich jetzt.
Doch warum hätte ich fragen sollen?
War das nicht die Aufgabe der anderen? Die Aufgabe von Schöck und Mayer?
Warum also schreibt sie mir, dass sie sich ausgerechnet auf mich freuen würde? Wir haben nie mehr als ein oder zwei Sätze gesprochen.
All das macht mich neugierig. Eine schlechte Eigenschaft, welche ich nie ablegen konnte. Vielleicht ist es aber auch für meinen Beruf eine gute Eigenschaft, denn ich frage und frage, bis ich die richtige Antwort bekomme.
Und die möchte ich auch auf die Frage, warum sich Ivette auf mich freut und warum sie das Treffen organisiert.
Doch im Moment habe ich eine andere Frage, auf die ich schnellstens eine Antwort bekommen sollte.
Was tankt ein Teil-Auto?
Mein schüchterner Blick streift die Beschriftung der Zapfsäule, vor der ich nun parke.
Super, Super plus, Super Ecomotion, Diesel, Diesel Plus.
Ich steige aus und stehe schon vor dem nächsten Problem: Wie soll ich diese schmutzige Zapfpistole ohne Handschutz berühren? Genau in diesem Moment fährt ein mit bunten Klebern beklebter weißer Wagen dicht hinter meinen.
Das ärgert mich, und ich beginne zu beobachten. Denn Menschen, ihre Handlungen, Kleidung, Gesten, Gerüche und Bewegungen sind für mich ein offenes Buch. Alles kann man so über eine Person erfahren, ohne dass man diese kennt.
Im tiefergelegten Wagen mit breiten Sportreifen sitzt ein übergewichtiger Mann. Eigentlich wäre Junge besser, denn er ist kaum über zwanzig. Sein Übergewicht erkenne ich an der schwammigen Hand, die er lässig aus dem geöffneten Seitenfenster hält. Um seinen Hals baumelt eine dicke Goldkette, welche sicherlich nicht aus Gold ist. Er trägt ein schwarzes T-Shirt ohne Ärmel und das, obwohl es höchstens vierzehn Grad hat. Immer wieder lässt er den Motor aufheulen und trommelt mit der Hand ungeduldig auf die Seitentüren.
Cooler Junge!
Er blickt er durch seine Sonnenbrille in Richtung des Tankstellenshops.
Ich folge dem Blick und sehe hinter der Kasse eine junge, sehr blonde Frau.
Das Ziel seiner Begierde.
Wie einfach es ist.
Cooler Junge möchte Mädchen imponieren.
Um mein Urteil abzuschließen, sollte ich noch etwas mehr von seiner Kleidung sehen. Hier insbesondere die Schuhe. Schuhe sagen fast alles über seinen Träger aus. Und wenn ich ihm näherkommen könnte, so würde ich seinen Geruch wahrnehmen. Hier bin ich sicher, dass er trotz eines starken und übertriebenen Parfüms nach Schweiß riecht.
Weil er aufgeregt ist. Und durch sein Übergewicht schnell und fast bei jedem Wetter ins Schwitzen kommt.
Wieder heult der Motor auf.
Cooler Junge will ein Spiel spielen.
Toll, darauf habe ich Lust.
Ich steige wieder in mein Teil-Auto und fahre aus dem Tankstellengelände hinaus auf die Straße und dann wieder hinein. Mein cooler Freund ist natürlich vorgefahren und steht schon an der Zapfsäule.
Und wieder heult ein Motor auf. Nicht so stark, weil mein kleiner Wagen nicht so viel PS hat, jedoch mit gleichem Erfolg.
Cooler Typ wird nervös.
Auch wenn er noch immer seine blöde verspiegelte Brille trägt, sehe ich, als er sich zu mir umdreht, seine Unsicherheit. Nicht in den Augen, wie es mir lieber wäre, aber an anderen Dingen.
An seiner Körperhaltung. Denn sein gesamter Körper ist angespannt. Seine Brille rutscht und beim Versuch, diese wieder anzudrücken, fällt die Brille auf den Teerbelag. Er bückt sich und streift den Tankschlauch.
Ich lasse wieder den Motor aufheulen.
Er beendet den Vorgang und steckt die Zapfpistole zurück in die Halterung. Dann geht er ein paar Meter in Richtung Shop, dreht um und öffnet wieder seine Wagentüren.
Geldbeutel vergessen.
Mein Motor heult wieder auf.
Jetzt rennt er fast zum Shop und wischt sich seine feuchten und schmutzigen Hände an seiner Hose ab.
Ekelhaft.
Jetzt stelle ich meinen Motor ab und beobachte, wie der coole Junge bei 14 Grad Außentemperaturen bekleidet mit einem T-Shirt, Dreiviertelhose und weißen Turnschuhen, in denen seine Füße ohne Socken stecken, dem jungen Mädchen imponieren möchte.
Aussichtslos.
Als er den Platz freigibt, stehe ich wieder vor demselben Problem. Wie und was soll ich tanken?
Wieder blicke ich zu der jungen Frau im Shop. Diese zu fragen erscheint mir sinnlos. Sie wüsste es nicht.
Egal, ich nehme die mittlere Zapfpistole und wickle eine Bäckertüte drum, welche noch auf meinem Beifahrersitz lag.
Ist ja nicht mein Wagen.
Pech, wenn es falsch ist.
Ich spüre, wie meine Stimme zurückkommt. Die Stimmen, die wirr in meinem Kopf sprechen und immer wieder versuchen zu mir durchzudringen.
Das möchte ich nicht.
Denn ich bin stärker als die Stimmen.
Doch nun fahre ich vorbei an der Ortstafel meiner Stadt.
Stadt?
Es ist genau genommen keine Stadt. Laut der offiziellen Definition ist eine Stadt eine Gemeinde, welche eine grundzentrale Funktion und mindestens fünftausend Einwohner vorweisen kann.
Das kann meine nur bedingt. Auf die geforderte Anzahl an Einwohner kam man nur, indem man alle kleineren Gemeinden, welche angrenzend sind, mit einbezog. Also wurde man zur Stadt. Diese Tatsache änderte natürlich nichts an der Größe. Denn diese änderte sich ja nicht dadurch, dass man zur Stadt erhoben wird. Und so besitzt die sogenannte Stadt nichts, was eine Stadt ausmacht. Keine Fußgängerzone, Markplatz und Ähnliches. Hier gibt es drei Discounter, zwei Tankstellen und die Mayer Werke. Letzteres überragt mit den aufdringlichen giftgrünen Farben fast alle Gebäude.
Ich spüre, wie mein Körper sich verkrampft. Ich wollte nie mehr hierherkommen.
Nie mehr in diese Stadt fahren, oder dort Zeit verbringen.
Und doch tue ich es selbst mit der Gefahr, dass meine Stimmen wieder lauter werden. Das letzte Mal, als ich hier war, hier in dieser ekligen Stadt, hier in der Straße, wo das Haus steht, in dem ich aufgewachsen bin, waren die Stimmen viel zu laut.
So laut, dass ich zuletzt auf diese hören musste.
Und dann?
Verstummten diese, fast zehn Jahre lang.
Ich wende den Wagen auf der Wendeplatte am Ende der Sackgasse, wo unser Haus steht.
Ich wundere mich: Wo ist es?
Ich muss vorbeigefahren sein, denn es ist das letzte auf der rechten Seite. Also fahre ich langsam in die andere Richtung.
Und schon kommt Haus Nummer 18. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, hat Nummer 20.
Ist es abgerissen?
Das kann nicht sein.
Nicht ohne meine Zustimmung. Denn es gehört mir. Mir, Mama und meinem Bruder. Volker.
Volker, mein jüngerer und dümmerer Bruder. Warum hat man Brüder? Oder Geschwister? Dies ist eine besondere Frage, und ich weiß, jeder wird diese individuell beantworten. Viele Eltern denken es ist gut, wenn Kinder zusammen aufwachsen. Ist das so?
Tun sie das, wenn fünf Jahre dazwischenliegen?
Nein. Denn der Ältere wird dadurch nur gegängelt. Er muss Rücksicht nehmen. Zurückstecken. Verständnis aufbringen. Der Jüngere hingegen wird belohnt.
Mit Großmut, Verständnis und Nachsichtigkeit.
Volker wollte zuerst nicht länger zur Schule gehen. Klar, ein Handwerk. Doch dort arbeite man. Viel zu viel Stress und Anstrengung, der er nicht gewachsen war. Also doch noch schnell die Fachhochschulreife nachgeholt mit mäßig schlechtem Abschluss und dann Studium.
Studium auf Lehramt. Klar, allein die Ferien und halben Tage. Das kam ihm entgegen. Und das Studium zu bestehen, da hatte Vater schon nachgeholfen.
Vater!
Beim Gedanken an ihn beginnt meine Stimme lauter zu werden.
Das ist wirklich nicht gut.
Ich steige aus und blicke mich um, dabei bemerke ich ein kleines Wäldchen.
Ein Wäldchen bis an die Bordsteinkante?
Langsam gehe ich darauf zu.
Das Laub ist gelb, braun und vieles schon abgefallen. Erst als ich dicht davorstehe, sehe ich dahinter ein Haus.
Das Haus.
In dem ich aufgewachsen bin.
Wie lange ist es her?
Kurz kneife ich die Augen zusammen, weil die Stimmen nun fast schreien. Und diese Stimmen wissen genau, wann ich das letzte Mal hier war.
Vor zehn Jahren. Ja ich denke, es könnte fast genau derselbe Tag sein.
November, grau und kalt.
Nach meinem Besuch wurde es auch noch still. Totenstill.
Ich versuche mir einen Weg hoch zur an der Nordseite gelegenen Haustüre zu suchen. Mühevoll zwänge ich mich durch das Gestrüpp, welches noch von den Tentakeln einer Brombeere zusätzlich zusammengehalten wird.
„Aua!“ Irgendwelche Dornen reißen meine Wange auf. Warmes Blut rinnt darüber und tropft auf meine Zunge. Ich lecke danach, als hätte ich mich lange danach gesehnt.
Es könnte schon so sein, doch das wäre nicht gut.
Hier ist nichts gut.
War es nie und wird es nie sein. Warum also bin ich hier?
Neugierde?
Während ich versuche meine Stimmen zum Schweigen zu bringen, bleibt unten an der Straße ein Mann stehen, welcher mit einem Hund Gassi geht. Der Hund ist ein kleiner weißer mit struppigem Fell und schlecht erzogen, da er wie ein Ackergaul in seiner Hundeleine hängt und kläfft. Ein helles durchdringendes Kläffen, dass wieder meine Stimmen verstärkt. Der Mann hat einen vorstehenden Bauch, über dem er einen roten Pullover mit Aufschrift trägt. Seine Füße stecken in weißen Turnschuhen und man kann erkennen, dass er keine Socken trägt. In seinem Halsausschnitt steckt eine Sonnenbrille. Seine kurzen Naturlocken haben graue Schläfen. Ich denke, er ist Mitte fünfzig.
Ein Beach-Typ mit Übergewicht und das im November.
Er starrt mich an.
Ich grüße und bekomme keine Antwort, dafür lässt er sich von seinem Köter weiterziehen.
Derweil habe ich es geschafft und stehe vor der Haustüre, zu der ich keine Schlüssel besitze. Heute ist mir diese Tatsache zum ersten Mal unangenehm, weil ich nun wieder ein Stück zurück durch das Gestrüpp muss, um über die nie verschlossene Garage ins Haus zu gelangen. Wieder streife ich Dornen und Äste schlagen nach mir, doch ich schaffe es und wie immer ist die Garage offen. Doch das Tor lässt sich nur etwas nach oben drücken, weil ein dicker Stamm irgendeines Baumes dagegenhält.
Ich seufze und suche etwas, mit dem ich das Tor abstützen kann, um anschließend unten durchzuschlüpfen.
Ich finde einen alten Backstein und versuche es.
Gerade als ich durch bin, schlägt das Tor wieder zu.
Nun ist es dunkel und still. Es riecht muffig und nach altem Öl. Kein Wunder, niemand lüftet. Niemand kommt her.
Vielleicht Volker. Einmal im Jahr oder so. Doch das weiß ich nicht. Es interessiert mich auch nicht. So wenig, wie es ihn interessiert, was ich mache.
Ja er schreibt mir. Einmal oder zweimal im Jahr.
Eine E-Mail.
Um mir zu sagen, wie es Mutter geht.
Im Heim.
Doch auch das ist mir egal.
Dann möchte er das Haus verkaufen, weil das Geld knapp wird.
Angeblich.
Nur das geht nicht. Nicht, solange ich noch lebe. Danach ist es egal. Ja er könnte eine Versteigerung der Gemeinschaft beantragen, doch dazu ist er zu feige. Viel zu feige. Wie alle in meiner Familie immer feige waren.
Doch ich habe diese Tradition gebrochen. Ich war einmal nicht feige.
„Ich bin wieder da!“, rufe ich durch die dunklen und stinkenden Gänge des Kellers.
Doch es ist niemand da, der mich hören könnte.
Ich klopfe mir den Staub von der Hose und gehe weiter den Gang entlang. Schwarze alte Spinnweben hängen von den Decken, als wären es abgestorbene Pilzmyzele.
So abgestorben wie das Leben in diesem Haus.
Etwas, das es hier nie gegeben hat.
Und nie mehr geben wird.
Mama ist im Heim.
Wahnsinnig geworden. Sagen die einen, welche es nicht verstehen.
Dement die anderen, welche vorgeben, etwas von Medizin zu verstehen. Ich weiß es natürlich besser. Ich bin der Fachmann. Der forensische Psychiater. Bei Mama treffen verschiedenen Faktoren zusammen. Natürlich leidet sie primär unter Demenz. Diese hat sich schon Jahre zuvor angekündigt und wurde vor allem durch das herrische Auftreten meines Vaters ausgelöst und verstärkt. Dazu kommt ein psychisches Erlebnis, welches akut eine Psychose auslöste und durch das eigene Verdrängen oder Leugnen eines Erlebnisses einer vorhandenen oder beginnenden Demenz starken Vorschub leistet.
Sie wird nie wieder zurückkommen.
Und Vater auch nicht.
Nie.
Ich gehe nach oben in den Wohnbereich.
Auch hier stinkt es nach abgestandener Luft, alten Teppichen und Holzausdünstungen, welche sicherlich auf ein ungesundes Imprägniermittel hindeuten.
Aber das ist egal, ich bleibe nur zwei Tage.
Und dann komme ich auch nie mehr zurück.
Ich werde durch die Sonnenstrahlen, die durch die vergilbten Vorhänge des Wohnzimmers fallen, abgelenkt und öffne gedankenverloren die Haustüre, um meinen Rucksack hereinzuziehen.
„Ah, das ist doch jemand. Was machen Sie hier?“, sagt eine Baritonstimme. Ich blicke auf und erkenne erst langsam zwei Gestalten hinter der Eibe, die fast die ganze Haustüre zugewuchert hat.
„Sind das Polizisten?“
Und da ich nicht gleich antworte, winkt die rechte Gestalt mir zu.
„Kommen Sie doch mal zu uns herüber.“
Die Gestalten stehen auf der Pferdekoppel neben meinem Elternhaus hinter dem Gestrüpp. Also zwänge ich mich erneut hindurch und befürchte wieder, mir weitere Verletzungen zuzuziehen.
Doch es gelingt mir ohne ein weiteres Blutvergießen.
Es sind zwei Polizisten.
Ein Mann und eine Frau mit langen blonden Haaren. Mir fällt auf, dass viele Polizistinnen lange blonde Haare haben.
Der Mann hat einen respektablen Bierbauch, Halbglatze und trägt eine verspiegelte Sonnenbrille. Beide tragen praktische schwarze feste Schuhe und Uniform. Das macht es für meine Analyse schwerer.
„Was machen Sie hier?“ Er stemmt seine Hände in die Hüfte und drückt seine linke Hüfte etwas nach vorne, damit ich seine Pistole im Halfter besser wahrnehme. Die Frau steht etwas hinter ihm in fast demütiger Haltung und weicht meinem Blick immer wieder aus.
„Wohnen!“, ist meine kurze und knappe Antwort.
„Hier!“, schreit er fast. „Ausweis!“, befiehlt er. Mein Blick geht an ihm vorbei hinunter zur Straße, wo der Mann im roten Pullover ohne Socken mit seinem Hund neugierig zu uns hochschaut. Wieder einer dieser Gutmenschen, der für Recht und Ordnung einsteht. Natürlich, ich könnte hier auch etwas Verbotenes tun. In meinem eigenen Haus.
Ich bücke mich und versuche den Reißverschluss meines alten Rucksackes zu öffnen, um meinen Pass herauszuholen.
„Vorsichtig, schön langsam!“ Der Polizist hat das Holster geöffnet. Er möchte mich einschüchtern.
Ein lächerliches Spiel.
Eines, das der jungen Polizistin gefällt. Diese steht nun auch eindeutig in einer Abwehrposition. Linkes Bein etwas nach vorne, Muskeln angespannt und die Hand an ihrem Holster, welches sie rechts trägt. Durch diese Haltung werden ihre Brüste nach vorne gedrückt und es entsteht der Eindruck, dass diese üppig sind.
Doch das sind sie nicht.
Ich reiche dem Polizisten meinen Ausweis.
„So Saskia, hier haben wir …“, er stutzt. Schaut mich an, dann wieder den Ausweis. Dann nimmt er seine Brille ab und hängt diese in den Kragen seines Hemdes.
„Mike? Mensch Mike, das bist ja du.“ Er umarmt mich, was ich absolut nicht leiden mag, und drückt mich an seinen Körper. Ich rieche Schweiß ummantelt von einem rauchigen Aftershave. Im Schweißgeruch ist ein süßlicher Geruch recht dominant enthalten. Der Gute hat etwas Alkoholprobleme.
„Hätte dich fast nicht wiedererkannt, Mike. Saskia, das ist mein Kumpel Mike. Wir haben das Abitur zusammen gemacht.“ Er tritt einen Schritt zurück und die Polizistin, Saskia, gibt mir die Hand und wirft mir dabei einen entschuldigenden Blick zu. Ihr Händedruck ist weich und angenehm. Ihre Hand ist sehr klein und ihre Haut zart. Ich ziehe etwas Luft über meine Nase ein, um ihre Gerüche wahrzunehmen.
Auch hier ist es etwas Schweiß, aber ein angenehmer weiblicher Schweißgeruch. Ihr Deo ist unauffällig und riecht leicht nach Mandel. Es könnte auch sein, dass sie Körperlotion oder Pflegemilch benutzt.
Ich blicke nun den Polizisten an, meinen vermeintlichen Freund. Es dauert, bis ich ihn erkenne. Und wir waren nie Freunde, und werden es nie. Ich blicke in die Augen von Schöck. Dietmar Schöck. Der Frauenheld. Und jetzt mit Halbglatze und Bierbauch. Einer, der mich gehänselt, geschlagen und verspottet hat. Und dem ich mehrfach gesagt habe, dass ich nie Mike genannt werden möchte.
„Dietmar, hätte dich ja fast nicht wiedererkannt.“
„Ja, wir werden ja alle nicht jünger. Nicht wahr, Mike. Aber im Schritt ist noch alles fit.“ Er wirf der jungen Polizisten einen Blick zu, dem sie nicht standhalten kann. Mit leicht geröteten Wangen schaut sie hinunter zur Straße.
„Es ist alles in Ordnung hier!“, ruft sie dem Mann im roten Pullover zu, welcher dann schulterzuckend sich wieder von seinem Hund die Straße entlangziehen lässt. Ich bekomme meinen Pass zurück.
„Mensch, wie lange ist es her? Zehn Jahre?“
Fünfundzwanzig wäre die richtige Antwort.
„Könnte hinkommen.“
„Was machst du hier? Das Haus endlich verkaufen?“
„Nein!“
„Das müsst ihr tun. Wirklich, schau dich um. Alles verkommt. Ich habe schon einige Beschwerden bekommen.“
„Schick diese zu Volker!“
„Ja mach ich ja andauernd. Übrigens, er war erst letzten Monat hier und hat mir gesagt, er will verkaufen. Hey Mike, da könnte ich euch unterstützen.“
„Betrügen würdest du uns.“ Denke ich.
„Das wäre gut. Aber wir verkaufen nicht!“
Er zieht eine Grimasse. „Das würde ich mir echt noch einmal überlegen. Die Preise sind gut im Moment. Aber echt, was machst du hier? Oh, jetzt klar, du kommst zum Treffen. Hat Ivette dich erreicht?“
„Hat sie!“
Das Funkgerät von Saskia knistert. Sie spricht etwas Unverständliches hinein.
„Einsatz!“, sagt sie und nickt mir zum Abschied zu.
„Tja, ich muss dann. Hey Mike, komm doch mal zum Essen bei mir vorbei. Dann schmettern wir ein paar Biere und reden über alte Zeiten.“
Es gibt keine alten Zeiten.
„Ich bin nur zwei Tage hier.“
„Ja dann, bis morgen Abend!“ Er dreht sich um und legt dann seine Hand auf den Po seiner Kollergin, welche versucht, dem durch einen schnelleren Gang zu entfliehen.
Also macht er es wieder. Er fickt seine Kollegin, und dies, obwohl er ja offensichtlich verheiratet ist. Wofür der Ehering spricht.
Dietmar Schöck bleibt ein sehr lästiger Zeitgenosse.
Ich schließe die Augen und bin zurück.
In den Achtzigern und in meiner Grundschule. Schöck war schon damals ein riesengroßes Schwein.
Und ich?
Schüchtern, schlank und unauffällig.
Ein Opfer.
Und so kam es eines Tages auf dem Heimweg. Schöck und Mayer passten mich ab. Zu zweit, denn alleine ist Schöck zu nichts fähig. Auch ich war nicht allein. Harald, mein bester Freund, der vier Jahre neben mir saß, ging mit mir zusammen nach Hause.
In einer kleinen Gasse hatten sich Schöck und Mayer an eine Hauswand gepresst und mich abgepasst. Schöck packte mich und begann sofort auf mich einzuschlagen.
Immer und immer wieder.
Dabei wurde er von Mayer angefeuert.
Mein Freund ging mit gesenktem Kopf einfach weiter. Er hörte meine Schreie wohl nicht.
Ich lag eine Woche im Krankenhaus. Natürlich habe ich die beiden beschuldigt, doch Vater wollte davon nichts wissen, denn die Väter von Schöck und Mayer waren angesehen.
Hoch angesehene Schweine.
Ich nehme meinen Rucksack und zwänge mich durch das Gestrüpp zurück ins Haus. Hier beschließe ich, eine Gartenschere zu suchen, um wenigstens etwas besseren Zugang zu bekommen.
Doch vorher schaue ich in die Küche. Der Kühlschrank brummt. Ob Volker etwas reingetan hat. Ich öffne diesen …
„Oh mein Gott!“ Der Inhalt ist so lebendig wie die Leber einer drei Tage alten Leiche, wo sich die Maden bereits austoben.
„Da wird einer wohl einkaufen gehen müssen“, rufe ich durch das leere Haus.
Ich hasse einkaufen in völlig überfüllten Discountern. Das Einzige, was man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bekommt, sind Infektionen.
Gleich nach dem Eingang liegt Obst und Gemüse offen herum. Das ist so eklig, jeder hustet oder spuckt darauf.
Pfui!
In Stuttgart muss man nicht einkaufen. Es gibt Lieferdienste, welche einem exakt das zusammenstellen, was man für einmal an einem Tag benötigt. Oder man bestellt gleich fertige Gerichte.
Doch hier in dieser provinziellen Stadt habe ich mir gleich die Mühe, nach solchen Lieferdiensten zu suchen, gespart. Heute ist Freitag, morgen das Treffen und am Sonntag fahre ich zurück. Also muss ich nur heute Abend etwas zu essen haben, morgen früh meine Milch und diese am Sonntag früh. Dazu etwas Wasser, weil ich glaube, das Wasser aus den alten Leitungen im Haus ist abgestanden. Kurz vor der Kasse falle ich auf den alten Trick der Discounter herein und greife nach einem Sixpack Cola, welches mitten im Weg steht.
So bezahle ich zwei Schokomilch, einen Pack Wasser, Cola und eine Fertigpizza von der Billigmarke.
Als ich meine Waren wieder in den Einkaufwagen lege, blicke ich mich noch einmal um. Ich bin ja froh, nicht erkannt zu werden, doch auch ich erkenne niemanden. Die Zeit geht mit allen recht unsanft um. Heute sind wir die Erwachsenen und die Erwachsenen von gestern tot oder im Heim.
Tot, so wie Vater.
Ich höre wieder die Stimmen flüstern.
Also beeile ich mich und schiebe den Wagen hinaus auf den Parkplatz. Natürlich überprüfe ich derweil noch den Kassenbeleg. Es sollte schon alles korrekt sein.
Korrekt so wie Vater, und die Väter von Schöck und Mayer waren.
Alle sind tot.
Ich blicke wieder auf und vor mir steht eine recht korpulente Nonne und lächelt mich an.
Widerlich.
Ich versuche ihr auszuweichen, doch sie stellt sich mir immer wieder in den Weg.
Natürlich werde ich gleich angebettelt.
Die christlichen Gutmenschen auf ihrem immer so selbstlosen Weg. Natürlich wurde auch ich christlich erzogen. Christlich korrekt.
Doch habe ich längst festgestellt, wie unkorrekt die Christen sind. Dies ist natürlich eine höfliche Umschreibung.
Uwe, Uwe Löhns, war der Enkel des Messmers in unserer Kirche.
Korrekt und christlich.
Männlich. Mädchen durften ja nicht Messdiener werden und wir Jungs mussten alle. Darauf hat Vater, ja eigentlich alle Väter und Mütter wert gelegt. Doch irgendwann musste ich nicht wieder hingehen. Uwe hat mir in einem unbeobachteten Moment an die Eier gegriffen. Daraufhin habe ich ihn mit einem der Standkruzifixe niedergeschlagen.
Christlich!
Vater hat alles geregelt, wie immer.
„Michael?“ Die Stimme der Nonne kommt mir bekannt vor.
„Ja?“ Ich schaue mich um, ob diese nicht doch jemand anderen meint. Denn ich kenne keine Nonnen. Nicht in der lebendigen Form. Eine hatte sich erhängt in einem Kloster, doch diese konnte mich nicht mehr anlächeln und es war alles beruflich.
Heute bin ich nicht beruflich unterwegs und um den Hals dieser Nonne ist kein billiges gelbes Abschleppseil geflochten.
„Du erkennst mich nicht? Oder?“ Sie schaut mich nun mit einem Blick an, der mir wie ihre Stimme bekannt vorkommt. Nonnen sind schwer einzuschätzen. Sie tragen einheitliche Kleidung, bequeme Schuhe, fast immer Röcke oder Kleider und Hauben.
Schwierig.
Und riechen kann ich außer den leichten Hauch von Mottenkugel nichts.
„So geht es den meisten. Ich bin es, Ivette. Ivette Sailinger. Ja, jetzt bin ich Schwester Felicitas.“
Ich trete einen halben Schritt zurück. Ivette ist in ein Kloster eingetreten?
Warum?
Sie war alles andere als eine Heilige.
„Ivette, ja jetzt erkenn ich dich. Mensch, du als Nonne.“
„Ich diene dem Herrn, und du? Was wurde denn aus dir?“ Sie wirkt neugierig. Früher kannte sie kaum meinen Namen. Dafür den von Schöck und Mayer umso besser.
„Arbeite für den Staat“, ist meine Antwort, denn mehr hat niemanden zu interessieren.
„Das freut mich für dich“, heuchelt sie und ich spüre die Lüge sofort.
„Danke! Wo ist denn dein Kloster?“ Meine Neugierde beginnt zu arbeiten.
„Untermarchtal. Bist du nur wegen dem Treffen hier oder besuchst du deine Eltern? Deine Mutter war immer so nett.“
Ich glaube nicht, dass sie Mutter kannte.
„Nur wegen dem Treffen. Vater ist tot und Mutter im Heim.“
„Ojee. Ich werde für beide beten.“
Wie schön, doch das hilft beiden auch nicht.
„Das wird Mama freuen. Vielleich sage ich es ihr.“
„Das musst du. Sie war doch so engagiert in der Gemeinde. Besonders gut erinnere ich mich an den Firmunterricht bei euch zu Hause.“
Jetzt erinnere auch ich mich, wie engagiert Mama in der katholischen Gemeinde war. Sogar Lektorin und Kommunionhelferin war sie. Und ich glaube, Ivette auch.
„Das stimmt. Mama mochte die Kirche und konnte gut mit dem Vikar, wie hieß dieser gleich noch mal? Rose … nein Ross irgendwas.“
„Rosskopf. Ja denk dir nur, der ist jetzt hier Stadtpfarrer.“
„Tatsächlich?“
„Die Wege des Herrn sind unergründlich!“ Sie blickt zum Himmel empor.
Wie die Wege des Herrn sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Seelen der Menschen unergründlich sind. Selbst für mich als Profi nach so vielen Berufsjahren blicke ich immer wieder in Abgründe. Und diese werden immer tiefer.
Warum wurde eine so hübsche lebensfrohe Frau Nonne?
„Wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf dich. Sieben Uhr in der Turnhalle. Gott sei mit dir.“ Ivette geht an mir vorbei in den Discounter.
Ich blicke ihr nach und frage mich, ob sie unter dieser Haube noch immer ihre schönen langen Haare hat.
Die Entscheidung, eine Fertigpizza zu kaufen, bereue ich. Denn der alte Backofen von Mama sieht so speckig aus, dass man sich nur eine Vergiftung holen kann. Doch noch einmal einkaufen möchte ich auch nicht.
Ich blicke durch die verschmierten Fenster hinaus. Noch ist es hell.
In Stuttgart besuche ich regelmäßig ein Fitnessstudio. Krafttraining, Rückenschule und Ausdauer. Das ist wichtig, will man nicht eine morgens aufwachen und mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben.
Früher gab es das nicht. Niemand wäre auf die Idee gekommen, in ein Fitnessstudio zu gehen. Es gab Aerobic in den Achtzigern und natürlich Fußball.
Was waren Volker und ich in dieser Angelegenheit für eine Enttäuschung für Vater. Volker hat es wenigstens versucht. Mit mäßigem Erfolg. Ich hingegen habe diesen Sport boykottiert. Und so konnte Vater nicht wie all die anderen Väter stolz am Platzrand stehen und hirnlose Rufe über das Feld jagen. Mayer spielte sogar in der Landesliga. Das wurde andauernd hervorgehoben und ich weiß bis heute nicht, was eine Landesliga ist.
Doch auch ich wurde zum Sport gezwungen. Als ich vierzehn war, bekam ich Migräne. Sogar eine mit Aura. Hört sich spannend an. Doch das Gegenteil ist der Fall. Zuerst beginnt es vor deinen Augen zu flimmern. Immer mehr, bis du fast blind bist. Dann vergeht dieser Spuk und es kommen die Kopfschmerzen. So heftig, dass ich erbrechen musste. Zu Spitzenzeiten hatte ich vier- bis fünfmal in der Woche Migräne. Die Lösung, welche unser Landarzt Dr. Rückert, der Vater von Albert mir präsentierte, war: „Mach Sport, mein Junge!“
Und das sagte er zu mir.
Gut, wer so starke Schmerzen mehrfach in der Woche ertragen musste, der griff nach jedem Strohhalm.
Also fuhr ich Rad. Die steilen Berge bei uns hoch. Zuerst musste ich alle fünf Minuten pausieren. Doch mit der Zeit ging es. Und die Migräne verflog.
Doch heute geht es nicht. Denn alle beiden Reifen meines alten grünen Fahrrades sind platt und rissig und doch habe ich Lust, mich zu bewegen.
Vielleicht kann ich so die Stimme auch vertreiben, wie damals die Migräne.
Vielleicht.
Es dämmert bereits und darüber bin ich froh. Denn auch wenn ich lange nicht hier war, so möchte ich, dass mich niemand in meinem gegenwärtigen Outfit sieht. Ich sehe aus wie eine bunte Vogelscheuche. Aber meine alten Sportklamotten, eine schwarze Hipster-Hose, dazu lange schwarze Kniestrümpfe und ein viel zu weites hellblaues T-Shirt mit zwei Streifen auf dem Ärmel. Dazu trage ich die alten Turnschuhe. Schwarz mit auch nur zwei Streifen. Mama fand das Kaufen von Markenartikeln gleiche einer Sünde. Und meine Mitschüler hielten mich für einen Idioten.
Mitschüler?
Ich höre wieder die Stimmen.
Alle haben mich gemoppt. Und jene, die es nicht taten, ignorierten mich. Am meisten Ivette. Und nun freut sie sich, dass ich gekommen bin?
Ich beginne mit Dehnübungen.
Welche Veränderungen das Leben, mit seinen Schicksalen und Herausforderungen mit uns Menschen anstellt, würde ein Buch füllen. Nein mehrere Bücher. Und nun könnte es sein, dass der Eintritt in einen Orden sich auf das Gewissen von Ivette ausgewirkt hatte. Dass sie zurückblickt.
Reue zeigt.
Doch in den wenigsten Fällen ist es Reue. Sondern es ist die Angst. Angst vor ihrem guten Gott. Dass er sie für ihre unkorrekten Taten zur Rechenschaft zieht.
Sie betraft.
Ob es so bei Ivette auch ist?
Ich laufe los. Langsam und doch zielstrebig über die Sumpfwiesen hoch in den Wald, der unweit unseres Hauses beginnt.
Hier war ich oft.
Hier fand er mich nicht, oder suchte nicht nach mir.
Es war mein Wald, meine Burg, ja mein Versteck.
Weiter geht es und ich spüre, wie mein Blut in Wallung gerät. Mein Herz pocht, Schweiß bildet sich. Ich erreiche den Forstweg und beschließe, hoch zum Aussichtspunk zu laufen, dann eine Runde hinüber zum Sportplatz und wieder zurück.
Spätestens dann werde ich so hungrig sein, dass der Schmutz im Backofen mir nichts mehr ausmachen sollte.
Keuchend erreiche ich den Aussichtspunkt. Erst hier fällt mir auf, wie dunkel es schon geworden ist. Offensichtlich habe ich mich doch in der Zeit vertan, oder mehr Zeit als früher benötigt. Und wenn ich nicht in die Dunkelheit geraten möchte, so werde ich jetzt abkürzen. Also biege ich rechts ab, nutze den Trampelpfad vorbei am Sportplatz hinüber zur Grillhütte des Wandervereins.
Und dann habe ich plötzlich diesen Geruch in der Nase.
Zuerst kann ich diesen nicht einordnen. Ich erkenne nur, dass er nicht hierhergehört. Er ist fremd und wie ein Störfaktor.
Hier sollte es nach frischem Laub, Moos und feuchter Erde riechen. Doch je mehr ich dem Weg zur Grillhütte folge, umso mehr verdrängt der fremde Geruch die Waldgerüche. Und je besser beginne ich, diesen zu erkennen. Es riecht verbrannt.
Ob heute jemand an der Grillstelle ist? Um diese Zeit? Im November?
Ich werde langsamer und beschließe, vorsichtig zu sein. Es könnte eine Horde betrunkener Jugendlicher sein. Party am Freitag. Oder wie die es nennen: Komasaufen. Und mit solchen Halbstarken wollte ich früher und schon gar nicht heute zusammentreffen.
Kurz vor der Hütte bleibe ich stehen. Der Brandgeruch ist nun beißend und stechend, als ob jemand Müll verbrennen würde. Ja das wird es sein: jemand verbrennt illegal seinen Abfall hier bei der Grillstelle.
Doch da ist niemand.
Die Grillstelle ist kalt und feucht.
Aber es brennt, hier in der Nähe, denn ich kann in der nun ausgehenden Dämmerung weiße Rauchschwaden erkennen. Eindeutig ziehen diese vom Parkplatz herüber.
Ich beginne zu laufen und dann stehe ich vor einem Polizeiwagen. Aus dem leicht geöffneten hinteren Seitenfenster steigt der Rauch auf.
Wo sind die Polizisten?
„Hallo? Niemand da?“ Ich rufe noch lauter: „Hallo!“
Dann beginnt der Wagen zu wackeln.
Ich nähere mich und sehe vorne eine Gestalt sitzen. Der gesamte Innenraum ist schon voller Qualm.
„Raus! Kommen Sie raus hier!“, schreie ich und versuche die Türe zu öffnen, doch diese ist verriegelt.
„Die Türe! Sie müssen die Türe öffnen, schnell!“, schreie ich und zerre mit aller Kraft daran. Doch die Türe lässt sich nicht öffnen. Ich versuche es hinten, auf der anderen Seite. Ich habe keine Chance. Als ich es an der rechten hinteren Türe noch einmal versuche, sehe ich eine Flasche auf dem Rücksitz, in der ein brennender Lappen steckt.
Ein nicht richtig funktionierender Molotowcocktail.
Dann wird es mir bewusst. Hier handelt es sich um einen Anschlag.
Ich versuche es noch einmal an der Fahrertüre und nun blicke ich in die verängstigten Augen von Dietmar Schöck. Jemand hat ihn mit Handschellen an das Lenkrad seines eigenen Fahrzeuges gekettet. Um seinen Mund und Hinterkopf ist ein dickes graues Klebeband gewickelt, sodass er kaum Luft bekommen kann. Dennoch zerrt er wie wild an den Handschellen. Seine Knöchel und Handgelenke sind bereits blutig. Immer wieder versucht er mir etwas zu sagen.
Doch ich kann nichts verstehen.
„Wo sind die Schlüssel?“, rufe ich und Schöck zerrt wie wild weiter an den Handschellen.
„Die Wagenschlüssel!“, präzisiere ich.
Selbst wenn ich die Türe aufbringe, so stehe ich noch immer vor dem Problem mit den Handschellen.
Ich muss es versuchen und suche nach einem Stein.
Und finde nur einen Ast.
Der Qualm hat nun Schöck völlig eingenebelt.
Mir bleiben nur noch Sekunden. Also schlage ich mit voller Wucht auf die Scheibe an der Fahrertüre. Und diese zerbricht in tausend kleine Stücke, dann folgt ein Knall und ich werde von einer Druckwelle erfasst und mehre Meter weggeschleudert.
Schöck brennt nun heller als das Maifeuer, das unser Sportverein früher immer zum Tanz in den Mai entfacht hat.
Ja es könnte sein, dass er nun auch tanzt.
Tanzt mit dem Teufel.
Ich reibe meine geprellte Schulter und wähle den Notruf.
Ich sitze in einem Rettungswagen und wurde mit einer dieser goldglänzenden Rettungsdecken eingehüllt. Die Seitentüre ist offen und vor dem Fahrzeug spielt sich eine Szene ab, welche eigentlich besser in einen der Vorabendkrimis gepasst hätte.
Mehre Feuerwehrfahrzeuge sind vor Ort und das Blau ihrer Lichter erzeugt mit den dunklen, jetzt fast kahlen Baumwipfeln eine gespenstische Wirklichkeit.
Schöcks Polizeiwagen ist gelöscht. Übrig ist nur eine vergilbte geschrumpfte Karosserie. Seine Kollegen sperren recht hilflos den Tatort ab. Hinter dem blauweißen Absperrband kann ich einige Gesichter meiner ehemaligen Mitmenschen erkennen.
Gaffer!
Ein kleiner Trupp von Feuerwehrleuten steht noch löschend an einem großen brennenden Wachholder und versucht ein weiteres Übergreifen zu verhindern.
Endlich steigt ein Mann mit Glatze zu und streckt mir seine Hand entgegen. Wo war dieser die letzten drei Jahre? Das Virus ist nicht weg, möchte ich ihm zurufen, lasse es aber dann doch. Allerdings erwidere ich seinen Gruß nur durch ein Kopfnicken.
„So, ich bin Doktor Rückert. Haben Sie Schmerzen?“ Er greift nach dem Handschuhspender und zieht sich sterile blaue Einmalhandschuhe über. Hinter ihm steht die kleine nette junge Rettungsassistentin mit der stupsigen Nase und den fast blauschwarzen Haaren, die mich erstversorgt hatte. Hier bin ich mir sicher, dass diese, oder zumindest ihre Eltern aus Syrien stammen. Doktor Rückert trägt eine Sanitätsjacke mit den vorgeschriebenen Warn- und Reflektionsaufdrucken, dazu Sicherheitsschuhe und eine weiße Baumwollhose, welche nicht zur Jacke passt. Also wurde er überraschend zum Notdienst gerufen, denn sonst würde er auch eine Outdoorhose tragen.
„Sind zu ertragen. Schauen Sie mal auf das Articulatio glenohumeralis rechts.“
„Oh, habe ich hier einen Kollegen?“
„In etwa. Auaaaa!“
„Sie haben recht. Geprellt, zum Glück nicht ausgekugelt. Aber das tut nicht minder weh!“
„Ich merke es.“
„Wird wieder, Herr Kollege. Das wird wieder. Ich fixiere die Schulter mit einem Verband. Zur Sicherheit röntgen wir es später in der Klinik.“
„Komme schon klar. Sie erinnern sich: Kollege.“
„Aha, und Sie haben eine MRT und ein Röntgen zu Hause?“
Ich grinse abschätzig und werde mich wohl fügen müssen.
„Meinetwegen.“
Er nickt und zieht seine Handschuhe aus, die er in einen kleinen gelben Eimer wirf.
„Fahrt ihn in die Kreisstadt Selima, ist ja nicht so schlimm. Ich mache Feierabend, muss ja wegen der Prellung nicht mitfahren, oder?“
„Nein, nein!“, sagt die gutaussehende Rettungsassistentin und schlüpft an Doktor Rückert vorbei, um mich anzuschnallen. Jemand klopft an die Karosserie.
„Kann ich kurz mit ihm reden?“, fragt eine sehr schlanke Frau mit hohen Wangenknochen, einer viel zu blassen Haut und halblangen dünnen blonden Haaren. Sie trägt eine dicke lederne Bikerjacke, schwarze Jeans und schwarze Bikerstiefel.
„Natürlich. Aber bitte kurz. Die Kollegen wollen auch Feierabend.“ Dr. Rückert hüpft auf eine kindische Art aus dem Rettungswagen.
„Ranzow, LKA. Können Sie mir sagen, was geschehen ist?“
Ich überlege, wie ich das Geschehene sinnvoll zusammenfassen könnte. Doch die Ereignisse haben sich zu schnell überschlagen.
„Es war Mord!“
Frau Ranzow zieht beide Augenbrauen nach oben und schaut mich fast angriffslustig an. Ich versuche, ihren Geruch einzuatmen. Und es gelingt mir. Sie benutzt ein blumiges Parfüm mit einer herben Note. Daneben rieche ich kalten Zigarettenrauch und etwas von ihrem Schweiß, welcher sehr dezent ist und ich bin mir sicher, Frau Ranzow lässt sich nicht schnell aus der Fassung bringen.
„Meinen Sie? Sind Sie sich da sicher? Oder es könnte auch sein, Obermeister Schöck hat sich selber ans Lenkrad gefesselt und dann den Dienstwagen in Brand gesetzt.“