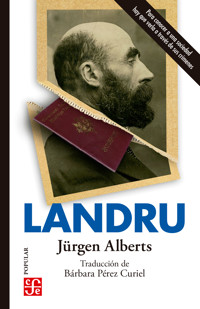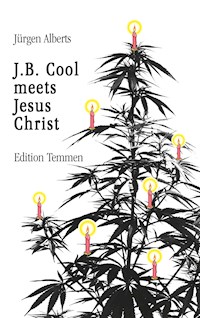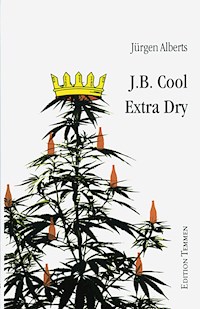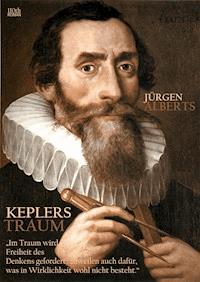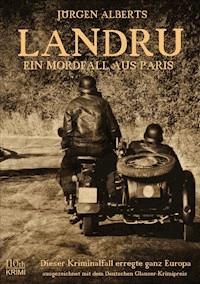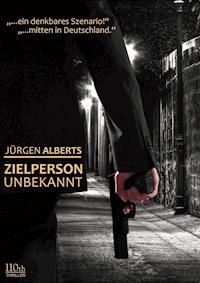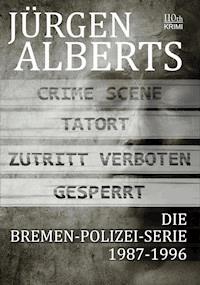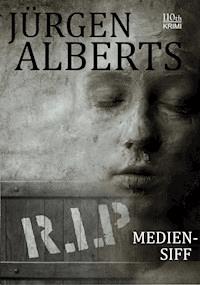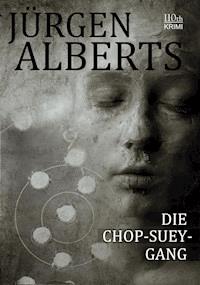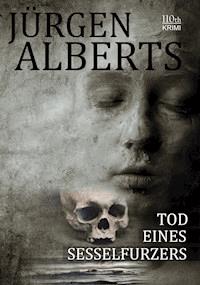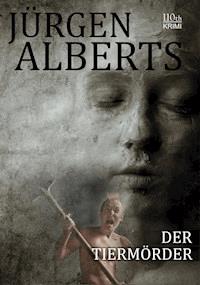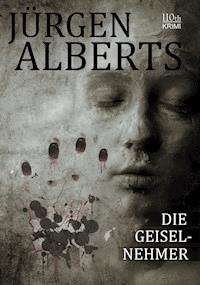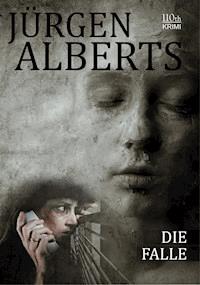Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wer am 4. Mai 1886 die Bombe auf dem Haymarket von Chicago warf, ist nie geklärt worden. Sie detonierte gegen Ende einer friedlichen Demonstration für den Achtstundentag. Acht führende Anarchisten wurden verhaftet, vier von ihnen zum Tode verurteilt. Schon einige Jahre später war klar, dass es sich um einen Justizirrtum handelte. Soweit die historischen Ereignisse, vor deren Hintergrund Jürgen Alberts die Geschichte des Attentäters entwickelt. Die Wege des Idealisten und Schustergesellen Karl Schasler aus Regensburg führen in die anarchistischen Zirkel Europas; er trifft Bakunin, landet in der Pariser Commune. Dann wandert er nach Amerika aus, schlägt sich durch und beginnt schließlich im Hinterstübchen seines Devotionalienladens, Bomben zu basteln. Als die Polizei wieder einmal gewaltsam gegen Arbeitgeber vorgeht, wirft er die Bombe, taucht unter - und erkennt bald, dass er einen verhängnisvollen Fehler begangen hat. Jürgen Alberts verbindet Fakten und Fiktion zu einer spannenden Geschichte. In seinem Roman fängt er die Atmosphäre der anarchistischen Bewegung gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein: ein bewegtes Fest von Boheme, Romantikern, utopistischen Handwerkern und Gewaltbesessenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÜRGEN ALBERTS
Der Anarchist von Chicago
Roman
Impressum:
Cover: Karsten Sturm-Chichili Agency
Foto: fotolia
© 110th / Chichili Agency 2015
EPUB ISBN 978-3-95865-708-3
MOBI ISBN 978-3-95865-709-0
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur Chichili Agency reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Kurzinhalt
Wer am 4. Mai 1886 die Bombe auf dem Haymarket von Chicago warf, ist nie geklärt worden. Sie detonierte gegen Ende einer friedlichen Demonstration für den Achtstundentag. Acht führende Anarchisten wurden verhaftet, vier von ihnen zum Tode verurteilt. Schon einige Jahre später war klar, dass es sich um einen Justizirrtum handelte.
Soweit die historischen Ereignisse, vor deren Hintergrund Jürgen Alberts die Geschichte des Attentäters entwickelt. Die Wege des Idealisten und Schustergesellen Karl Schasler aus Regensburg führen in die anarchistischen Zirkel Europas; er trifft Bakunin, landet in der Pariser Commune. Dann wandert er nach Amerika aus, schlägt sich durch und beginnt schließlich im Hinterstübchen seines Devotionalienladens, Bomben zu basteln. Als die Polizei wieder einmal gewaltsam gegen Arbeitgeber vorgeht, wirft er die Bombe, taucht unter – und erkennt bald, dass er einen verhängnisvollen Fehler begangen hat.
Jürgen Alberts verbindet Fakten und Fiktion zu einer spannenden Geschichte. In seinem Roman fängt er die Atmosphäre der anarchistischen Bewegung gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein: ein bewegtes Fest von Boheme, Romantikern, utopistischen Handwerkern und Gewaltbesessenen.
Der Autor
Jürgen Alberts studierte nach dem Abitur (1966) in Tübingen und Bremen Germanistik, Politik und Geschichte und promovierte 1973 am Fachbereich Kommunikation und Ästhetik der Bremer Universität zum Thema "Massenpresse als Ideologiefabrik am Beispiel BILD".
Er arbeitete als freier Mitarbeiter für den WDR und das ZDF und lebt heute als Schriftsteller in Bremen. Er schrieb Drehbücher, Hörspiele und 1969 den Roman NOKASCH U.A. sowie 1980 DIE ZWEI LEBEN DER MARIA BEHRENS, bevor er sich auch mit Kriminalgeschichten zu beschäftigen begann.
Gemeinsam mit Fritz Nutzke (Pseudonym für Sven Kuntze) veröffentlichte er 1984 den mit Science-Fiction Elementen durchsetzten Kriminalthriller DIE GEHIRNSTATION und ein Jahr darauf als Alleinautor die Fortsetzung DIE ENTDECKUNG DER GEHIRNSTATION.
Nach dem Roman TOD IN DER ALGARVE (gemeinsam mit Marita Kipping) schrieb Alberts den Polizeiroman DAS KAMERADENSCHWEIN, in dem es um den Fall eines Bremer Kommissars geht, der sich gegen die Weisungen seiner Kollegen als Nestbeschmutzer betätigt, weil er hartnäckig in einem Fall von Polizeigewalt gegen einen Verdächtigen ermittelt.
In seinen weiteren Romanen DER SPITZEL, DIE CHOP-SUEY-GANG und DIE FALLE befasste sich Alberts in den darauffolgenden Jahren immer eingehender mit dem Innenleben der Bremer Polizei und ihrer Führung, bis schließlich mit KRIMINELLE VEREINIGUNG 1996 der zehnte Roman der später so bezeichneten Serie "Bremen Polizei" vorlag.
1987 veröffentlichte Alberts den semi-dokumentarischen Roman LANDRU, in dem es um mögliche politische Hintergründe zum Fall des französischen Frauenmörders Henri Desire Landru (1869 - 1922) geht, der zu Beginn dieses Jahrhunderts wegen Mordes an zehn Frauen verurteilt und hingerichtet wurde.
1988 erschien Jürgen Alberts' Kriminalroman ENTFÜHRT IN DER TOSKANA, den er gemeinsam mit Marita Alberts schrieb, ebenfalls mit seiner Frau schrieb er den Griechenland-Krimi GESTRANDET AUF PATROS.
Von 1990 bis 1991 und von 2001 bis 2005 war Jürgen Alberts einer der Sprecher der "Autorengruppe deutsche Kriminalliteratur DAS SYNDIKAT"
Preise:
1988 Glauser - Autorenpreis deutsche Kriminalliteratur für "Landru"
1990 CIVIS-Preis des WDR und der Freudenbergstiftung für "Eingemauert"
1994 Deutscher Krimi Preis für "Tod eines Sesselfurzers"
1997 Marlowe Preis der Deutschen Raymond Chandler-Gesellschaft für "Der große Schlaf des J.B. Cool"
«Regiert werden heißt, bei jedem Werk, bei jedem Handeln, bei jeder Bewegung festgestellt, registriert, zensiert, tarifiert, abgestempelt, geschätzt, mit Abgaben belegt, lizenziert, autorisiert, befürwortet, behindert, reformiert, korrigiert werden; es heißt, unter dem Vorwand des öffentlichen Nutzens und im Namen des allgemeinen Interesses besteuert, dressiert, gerupft, ausgenutzt, monopolisiert, bevollmächtigt, gedrängt, mystifiziert, bestohlen und beim ersten Wort der Klage unterdrückt, bestraft, verunglimpft, schikaniert, verfolgt, gezaust, verurteilt, gerichtet, deportiert, geopfert, verkauft und verraten, dabei noch gefoppt, genarrt, gekränkt und entehrt werden. Das heißt Regierung, das ist ihre Gerechtigkeit, das ist ihre Moral.»
Pierre Joseph PROUDHON, 1841
Anarchismus: Die Philosophie einer neuen sozialen Ordnung, die auf einer Freiheit gründet, die nicht durch ein von Menschen geschaffenes Gesetz eingeschränkt wird; die Theorie, die besagt, dass alle Formen von Regierung auf Gewalt beruhen, und deshalb falsch, schädlich und nicht notwendig sind.
Emma GOLDMAN, 1917
Nach der Revolution wird es keine Gefängnisse mehr geben, keine Gerichte und keine Polizei. Die Welt wird eine einzige große Kommune sein, in der Lebensmittel und Unterkunft frei sind, in der wir alles miteinander teilen.
Alle Uhren werden zerstört. Friseure werden in Umerziehungslager gehen und sich die Haare lang wachsen lassen. Das Pentagon wird durch eine Farm ersetzt, auf der man mit LSD experimentiert. Es wird keine Schulen oder Kirchen mehr geben, denn die ganze Welt wird eine einzige Kirche und eine einzige Schule sein. Die Leute werden am Morgen das Land bebauen, am Nach-mittag Musik machen und ficken, wann immer sie Lust dazu haben.
Jerry RUBIN, 1968
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: Chicago, Mai 1886
2. Kapitel: Berlin, Mai 1856
3. Kapitel: Ischia, Frühjahr 1866
4. Kapitel: Paris, April 1871
5. Kapitel: Bern, Frühjahr 1876
6. Kapitel: Bremerhaven—New York, Herbst 1877
7. Kapitel: Amerika, Herbst 1877
8. Kapitel: Chicago, Frühjahr 1885
9. Kapitel: Chicago, Mai 1885
10. Kapitel: Chicago, 1. Mai 1886
11. Kapitel: Chicago, 4. Mai 1886
12. Kapitel: 5. Mai 1886: «Hängt sie auf und stellt sie dann vor Gericht!»
13. Kapitel: 6. Mai 1886: «Wir hätten dir Strychnin in die Wunde reiben sollen!»
14. Kapitel: 7. Mai 1886: «Es gibt keinen, der nicht verdächtig wäre!»
15. Kapitel: 10. Mai 1886: «Endlich! Der Bombenbauer ist hinter Gittern!»
16. Kapitel: 21. Juni 1886: «Zwölf gute Männer, nur der Wahrheit zugetan!»
17. Kapitel: 15. Juli 1886: «Wir hatten zuviel Vertrauen in die Freiheit!»
18. Kapitel: 2. August 1886: «Niemand in der Menge trug eine Waffe!»
19. Kapitel: 20. August 1886: «Wenn Polizisten das Gesetz in die Hand nehmen, dann ist das Anarchie!»
20. Kapitel: 7. Oktober 1886: Die Angeklagten klagen an
21. Kapitel: 2. November 1887: «Die bewaffnete Anarchie ist tot in dieser Stadt!»
22. Kapitel: 11. November 1887: «Lassen Sie mich reden, Sheriff Matson!»
Kleines Glossar für Pennsylvania-Deitsch
Nachwort
Danksagung
1.Kapitel: Chicago, Mai 1886
Er suchte einen Ort, von dem aus er seinen Laden im Auge behalten konnte, ohne selbst entdeckt zu werden. Mit dem dreibeinigen Holzschemel in der Hand ging er um die Werkbank, auf der kein einziges Werkzeug lag.
Die beiden Gesellen hatte er an diesem Mittwochmorgen nach Hause geschickt. Sie waren losgestürmt, ohne sich für den freien Tag zu bedanken. Von der kurzen Seite des eingekerbten Holztisches her konnte er den Türspalt gut einsehen, aber ein unerwünschter Beobachter würde ihn durch die rückwärtigen Fenster ausmachen können. Die Scheiben waren von den Dämpfen der Chemikalien beschlagen, und doch ließen sie zu viel Sicht frei. Er wuchtete den Blechschrank vor das dreiteilige Fenster und fühlte sich sicher.
In der Werkstatt hingen Rahmen an den Wänden, verschnörkelte goldene, glatte silberne, schwarze, die mit Schnitzereien verziert waren. Geordnet nach Formaten, rechteckige und quadratische. An der Wand die Rahmenspanner, über-einander gehängt glichen sie den neuesten Hochhäusern der Stadt.
Aus der untersten Schublade des Blechschrankes holte er eine Kiste hervor. Die Gäste des letzten Abendmahles lächelten ihm zu. Maria Magdalena hatte Bedenken. Hildegard von Bingen gab ihre Zustimmung. Jesus nickte am Kreuz.
Er entzündete die Spiritusflamme und wartete eine Weile, bis sich das bläuliche Licht ruhig verbreitete, ohne zu flackern. Sorgsam stellte er das Gefäß mit der Schwefelsäure auf den Tisch und nahm das gläserne Haarröhrchen aus der Kiste. Er hielt es so lange in die Flüssigkeit, bis die Schwefelsäure einen Zoll breit eingedrungen war. Mit einem sauberen Lappen wischte er das Röhrchen ab und hielt es über die Flamme. Nach kurzer Zeit schmolz das Glas und verschloss die Öffnung. Als das Haarröhrchen etwas erkaltet war, rieb er das Ende zwischen den Fingern. Dann wiederholte er den Vorgang auf der anderen Seite.
Schon vor Tagen hatte er sich die Materialien besorgt. In verschiedenen Pharmazien. Als er ein Pfund chlorsaures Kali kaufte, es kostete 35 Cent, war der Apotheker nachsichtig mit ihm «Lassen Sie äußerste Vorsicht walten, Mister, das Zeug ist nicht ganz ungefährlich.» Er spitzte dabei die Lippen.
Das will ich meinen, dachte er.
Die Türschelle ging. Kundschaft.
Er legte ein Leinentuch über die Kiste, dann erhob er sich. Der Kunde, der, ganz ungewöhnlich für diese Uhrzeit, einen Frack trug, betrachtete eingehend die Bilder.
«Womit kann ich dienen?», fragte er höflich und setzte hinzu: «Wir führen auch größere Formate.» Der Mann sah nach ausreichendem Vermögen aus, das steigerte den Preis immer. «Soll es eine biblische Szene sein? Ein Engelreigen für das Schlafzimmer und das nächtliche Wohlbefinden?» Der Kunde trug einen hohen Zylinder.
«Mr. Weissenbach, Sie haben mir voriges Jahr so eine wunderschöne Madonna geliefert, sehr schlank, sehr brünett, ihr Aussehen war ...»
«Ein wenig spitzbübisch», ergänzte er, seine eigenen Worte erinnernd.
«Die Madonna von Weilersheim im Rosengarten, ihr Blick hat etwas Himmlisches, diese Verzückung, der selige Gruß. Ich muss im Lager nachschauen, ob ich noch ein Exemplar davon besitze.»
Er wusste, dass sich in seinem Schuppen keine Madonna von Weilersheim mehr befand. In ihrem hellen, fast durchsichtigen Gewand gefiel sie den prüden Kirchgängern nicht. Ein Katholik hatte sich ob dieser unzüchtigen Darstellung sogar beschwert.
«Und überhaupt, was soll denn diese Madonna von Weilersheim bewirken?», hatte er erbost gefragt. So bestellte er bei seiner Dresdner Malerei kein weiteres Exemplar.
Der Schuppen war geräumig und versammelte alle Heiligen der Alten Welt, die in der Neuen reißenden Absatz fanden: Franziskus von Assisi, Amandus von Straßburg, Edmund von Abbington, Margareta von Schottland, den heiligen Florinus und die Mystikerin Gertrud von Helfta, die als Fünfundzwanzigjährige ihre erste Christus-Vision hatte und bis zu ihrem Tode immer wieder innige Vereinigungen mit dem Herrn be-schrieb. Ihr Lächeln glich jenem der Madonna von Weilers-heim, mit dem Zeigefinger der rechten Hand zeigte sie auf das Herz Jesu, von dem ein Lichtstrahl auf die Heilige Schrift ausging.
Er holte das große Gemälde hervor.
«Ich muss mich entschuldigen, das gewünschte Bild ist leider ausgegangen. Ich kann es nachbestellen, das wird aber einige Monate dauern. Doch ich habe einen würdigen Ersatz. Dieses polnische Meisterwerk erzählt die Geschichte einer Frau, die schweben konnte. Eine Heilige, die von Ort zu Ort glitt und der Liebling aller armen Kinder war.» Er wartete auf die Reaktion des vornehmen Kunden. Wollte er noch mehr von diesem Wunder hören oder erst das Bild sehen?
«Mr. Weissenbach, Sie kennen meinen Geschmack. Sie werden bestimmt das richtige Bild herausgesucht haben. Bill ist plötzlich verstorben, seine Frau trägt es mit Fassung, aber sie braucht eine moralische Stärkung. Zeigen Sie schon!»
Erst jetzt drehte er das Porträt um, überraschte seinen Kunden mit dem Anblick und sagte: «Sieben Dollar.» Er hatte zwei Dollar aufgeschlagen. Die Ausgaben für Schwefelsäure und Kali waren damit beglichen. Der Kunde zögerte. Langsam ließ er das Heiligenbild sinken. Mit Bedacht entfernte er es aus dem Blick des Kunden.
«Ich nehme es, Mr. Weissenbach, ich nehme es. Das ist ein enormes Geschenk, allerdings auch ein enormer Preis.» Er schwieg. Sah an dem Kunden vorbei auf die Straße. Eine Droschke wartete auf den Kunden. Das würde die Verhandlungen beschleunigen.
«Ist diese Madonna ein Original?», fragte der Kunde, sein Zylinder saß tief in der Stirn.
«Ich führe nur Originale. Meine Dresdner Malerei hat ausgezeichnete Künstler unter Vertrag.»
«Aber im Schaufenster sah ich ein paar billige Öldrucke: die Hochzeit von Kanaan, der brennende Busch... Ich erinnere mich ganz genau.» Nun wusste er, dass er mit dem Preis zu hoch gegangen war. Der Kunde begann seine Dollars zusammenzusuchen.
«Das war vor meiner Zeit, ist Jahre her. Als ich den Laden von Mr. Goldworths übernahm, habe ich alle Drucke billig abgegeben. So etwas verdirbt das Geschäft.» Dies entsprach nicht ganz der Wahrheit, diente aber dem Renommee des Ladens: Verkauf von Heiligenbildern in Originalen. Das einzige Geschäft in Chicago, das diese Ware führte. Die Öldrucke versandte er, wenn Gemeinden größere Posten bestellten. Im Überland-Verkauf fiel es nicht auf, wenn er ein paar mitschickte. Schließlich bürgten die Gemeindepfarrer für die Qualität.
«Ich habe fünf Dollar zur Hand», sagte der Kunde, «würden Sie den Rest anschreiben?»
«Sie können Namen und Betrag in diesem Schuldbuch notieren. Ich wäre froh, wenn Sie dann in der nächsten Woche die ausstehende Summe begleichen würden.»
Während der Kunde der Aufforderung nachkam, begann er, das Bild einzupacken. Unter der Ladentheke befanden sich allerlei Geschenkpapiere. Mit großer Sorgfalt wählte er ein weißes Seidenpapier mit goldenen Kreuzchen aus. Ein Posten dieses exquisiten Papiers aus Italien war ihm zugefallen. Der Besitzer des Schreibwarenhandels hatte Bankrott gemacht, weil ihn ein Konkurrent denunzierte.
Nachdem der Trauergast den Laden verlassen hatte, legte er die fünf Dollar in die gusseiserne Kasse und schloss sie zweimal ab. Dann löschte er das Licht, weil genügend Helligkeit durch die großen Glasscheiben hereindrang.
In der Werkstatt fügte er das Glasröhrchen mit der eingeschweißten Schwefelsäure in ein gleich langes aus Blech, das an einer Seite mit einer Kapsel verschlossen war. Danach füllte er mit Hilfe eines Trichters die vorbereitete Mischung aus chlorsaurem Kali und mehlfein pulverisiertem Zucker, zu gleichen Teilen, in das Blechröhrchen, bis kein Zwischenraum mehr blieb. Mit einer zweiten Kapsel verschloss er das andere Ende. Behutsam legte er das Blechröhrchen auf die Werkbank. Zwischen den der Größe nach geordneten Werkzeugen fiel es nicht auf.
«Franz, Franz, bist du da?» Er erkannte Florines Stimme. Sie kam zur ungünstigen, Zeit. Er sprang auf, ging mit raschen Schritten zur Tür, die er fest hinter sich zuzog. Florine trug eines von ihren extravaganten Kleidern, einer römischen Tunika nachempfunden, hellviolett, mit weiß-goldenen Schnüren verziert. Ihr schwarzer Pagenschnitt war akkurat geschnitten, die Augen stark geschminkt. Wenn sie derart festlich gekleidet war, glich sie der heiligen Barbara. Sie reichte ihm ein handgedrucktes Zirkular. Den Inhalt kannte er schon.
Rache! Rache!
Arbeiter zu den Waffen!
Arbeitendes Volk, heute Nachmittag mordeten die Bluthunde Eurer Ausbeuter 6 Eurer Brüder bei McCormick’s. Volk zu den Waffen! Vernichtung der menschlichen Bestien, die sich Deine Herrscher nennen.
Eure Brüder
Während er las, dachte er darüber nach, wie er sich am geschicktesten verhalten solle. Wieviel durfte er Florine sagen? Konnte er sie einweihen? Es war zu ungewiss und sicherlich viel zu gefährlich, wenn sie von seinem Vorhaben erfuhr. Er nahm die goldene Halbbrille von der Nase. Das Flugblatt war ihm am Abend zuvor in den Laden gebracht worden. Es hatte ihn die ganze Nacht nicht schlafen lassen.
«Was wirst du unternehmen, Franz?», fragte Florine ungeduldig, «du kannst nicht zusehen, wie deine Landsleute niedergemäht werden. Du wirst nicht stillsitzen und die Augen verschließen.» Er wusste nicht, was er sagen sollte. Vor ihm stand die Frau, die er vor einem Jahr kennengelernt, die ihn aus seiner langandauernden Junggesellenschaft geholt hatte. Die er begehrte.
«Ich weiß, dass du dieses Abschlachten nicht gutheißt. Sag etwas, Franz, bitte!»
«Ich verkaufe Heiligenbilder, Florine. Ich muss in meinem Laden bleiben und der Kundschaft zur Verfügung stehen. Gerade vorhin hat jemand eine polnische Madonna gekauft, ein Trauerfall, die Heilige soll trösten...» Er unterbrach sich, weil er sah, dass Florine wütend wurde. Seine gestammelten Entschuldigungen würde sie nicht akzeptieren.
«Red nicht so einen Unsinn. Schlimm genug, dass Menschen für diesen Kitsch auch noch Geld ausgeben. Aber, dass du die tröstende Wirkung beschwörst! Du bist ein Samariter für wunde Seelen, Franz, kein handfester Bürger.» Mit Mühe verbarg er seine innere Unruhe. Es waren die Vorfälle der letzten Wochen, die ihn aus dem Gleichgewicht brachten. Und dabei hatte er sich in der Neuen Welt nach einem ruhigen Leben gesehnt.
«Ich bin zu Beverlys Hochzeit eingeladen. Ich geh jetzt dorthin und sammle Unterschriften für eine Petition, damit die Polizei in die Schranken gewiesen wird. Das, was bei McCormicks geschehen ist, muss gestoppt werden. Wenn sich nicht alle Bürger der Polizei entgegenstellen ...»
«Du gehst dorthin?»
«Milton hat mich eingeladen. Warum nicht? Du verkriechst dich hier in deinem Laden, während in Chicago Blut fließt. Was bist du für ein Feigling, Franz!»
Sie drehte sich um.
Die Tür fiel ins Schloss.
Er sah ihr nach, lächelte milde. Florine war imstande, an der Hochzeitstafel einen Aufruhr zu organisieren. Das würde dem Schoko-König gar nicht gefallen. Sie würde eine wundervolle Rede halten, gewandt, pathetisch, voller Rührung, dabei den Gastgeber nicht aus den Augen lassen. Seinen Widersacher in der Gunst der Malerin. Das gefiel ihm besonders an ihrem Vorhaben. Florine würde nicht ruhen, bis alle ihre Petition unterschrieben hätten. Die ganze feine Gesellschaft würde sie durcheinanderwirbeln. Wahrscheinlich war auch Bürgermeister Harrison zugegen. Milton hatte ihn gewiss auf seiner Einladungsliste. Er dachte an den Ausspruch, als er dem Zuckerbäcker zum ersten Mal begegnete: «Wu Schmook iss, iss aa Feier.»
Florine riss die Tür auf, stapfte zum Verkaufstisch und nahm das Zirkular wieder an sich.
«Hier würde es nur ganz unnütz sein, Franz. Überleg dir, was du jetzt sagst!» Sie funkelte ihn an. Er schwieg. «Dann gehe ich», zischte sie.
Er mochte es, wenn Florine wütend war. Ihr strenges Gesicht bebte dann und ihre Lippen wurden schmal. Sie hatten sich oft gestritten. Sosehr sie ihn anzog. Ein heftiges Jucken am Ohrläppchen setzte ein, ein Gefühl der Vorfreude, das sich in den letzten Jahren nicht mehr eingestellt hatte. Seit er in die Neue Welt gekommen war, wollte er sich von Gefühlen nicht mehr leiten lassen. Eine neue Haut war gewachsen.
Schon vor Tagen hatte er das Dynamit hergestellt. In einem Steinguttopf, der in einem kalten Wasserbad stand, mischte er achtzehn Pfund Schwefelsäure und neun Pfund Salpetersäure. Da sich scheußliche Dämpfe bei der Mischung entwickelten, schützte er sich mit feuchten Tüchern über Mund und Nase. Nach einer Viertelstunde, in der die Mischung erkaltete, fügte er unter ständigem Rühren drei Pfund Glycerin hinzu. Vorsichtig kippte er das gelbliche Öl in das vorbereitete Eiswasser und erhielt Nitroglycerin. Mit Sodalauge reinigte er es. In ein Gemisch aus Zuckerstaub, Salpeter und gemahlenem Holz ließ er das Nitroglycerin behutsam einlaufen, bis er einen zähen Teig erhielt. Er wickelte das fertige Dynamit in Ölpapier und lagerte es in Blechbüchsen. Ein Geselle hatte am Morgen, nach der Herstellung des gefährlichen Stoffes, die Nase gerümpft und gefragt, wonach es in der Werkstatt so streng rieche. Er gab dem Gesellen keine Antwort.
«Wenn ihr dieses Wunderzeug damals gehabt hättet, wären die Römer schnell außer Landes gewesen!» Er blickte hinauf zum Gekreuzigten. «Unter dem Hintern der Großmäuligen vermag Dynamit manchen Tanz aufzuführen.»
Er holte die gehämmerte Bleikugel hervor, nicht größer als eine saftige Orange, legte den Zünder hinein und füllte die ganze Kugel mit Dynamit. Das Blechröhrchen war so eingefügt, dass es beim Aufprall zerbrach, die Schwefelsäure sich in die Zucker-Kali-Mischung ergoss und die Sprengkapseln zündete. Damit wurde das Dynamit zur Explosion gebracht. Er pfiff ein Liedchen aus dem alten Europa. «Wir sind des Geyers schwarzer Haufen, he ja, hoho ...»
Es war die Gelassenheit, diese Ruhe der Uhrmacher, die ihn schon in der Schweiz so beeindruckt hatte. Handwerker, die mit größter Präzision arbeiteten, Tausende von Teilchen zusammenfügten und nicht einen krausen Gedanken im Kopf haben durften. Im Jura waren gerade sie die fanatischsten Anarchisten gewesen.
Es gab einige von ihnen, die versucht hatten, Dynamit herzustellen. Manche waren dabei in die Luft geflogen, andere der Polizeischurkerei aufgefallen, weil die Fabrikation einen solchen Gestank erzeugte, dass sie schwerlich zu verbergen war. Außerdem musste man genügend Dynamit herstellen, um einen wirkungsvollen Effekt zu erzielen. Wie hatte Johann in seiner Broschüre geschrieben: «Neunundneunzig Mal an die Wand geworfen, geht vielleicht ein Pfund Dynamit nicht los, und das hundertste Mal fällt es etwa durch Zufall von einem Tisch auf den Boden und explodiert.»
Er war Johann Most begegnet, dem Schiefmäuligen mit der gewaltigen Stimme, der es fertigbrachte, noch im Gefängnis eine Zeitung herauszugeben. Er schrieb Artikel mit Haferbrei und umwickelten Streichhölzern, bestach Gefängniswärter, die seine Papiere aus dem Kerker schmuggelten. Was würde es für einen Effekt haben, wenn er seine Bombe unter die Hochzeitsgesellschaft warf? Der Schoko-König würde als erster durch die Luft wirbeln.
Auf dem Pappschild, das er mit einem kleinen Nagel über der Tür anbrachte, stand: «Closed for mourning.» In deutscher Sprache fügte er den Hinweis an: «Wegen Trauerfall vorübergehend geschlossen.»
Er zog das graue Rollo herunter und drehte den Schlüssel bis zum Anschlag.
Die Bombe ließ er unter dem Leinentuch auf der Werkbank liegen.
Über eine Wendeltreppe erreichte er den zweiten Stock. Im Ankleidezimmer wechselte er seine Handwerkerschürze gegen ein dunkles Jackett, das er vom Bügel nahm, richtete sich die Krawatte, die er stets mit einem Windsorknoten band, kämmte sich im Bad die kräuseligen, rötlichen Haare, die erste silberne Fäden aufwiesen. Über die Vordertreppe verließ er sein Haus.
Die Heiligen sahen ihm nach. St. Georg hielt im Kampf mit dem Drachen inne.
Es war elf Uhr elf, als er den Saloon betrat.
«Das ist nicht Ihre Zeit, Mr. Weissenbach», schnarrte der Barkeeper, der hinter dem Tresen Gläser spülte. Er deutete auf die große Uhr, deren Zeiger wie dünne Finger aussahen.
«Stimmt», erwiderte er, «nie vor fünf! Aber ich habe meinen Laden geschlossen, weil ich zu einer Trauerfeier muss. Und da ich Trauerfeiern nicht mag...»
«Wer ist denn gestorben?», fragte der Barkeeper linkisch.
Er antwortete nicht gleich. Sah auf die Whiskyflaschen, die im hölzernen Regal wie Soldaten standen. «Pay today —trust tomorrow», so lautete die Aufforderung an die Gäste. Im Saloon gab es nichts auf Pump.
«Ein Cousin», sagte er beiläufig.
«Ach.» Der Barkeeper trocknete die Unterarme und Hände mit einem schmutzigen Tuch. «Ich wusste gar nicht, dass Sie Verwandte in Chicago haben. Ich dachte, Sie seien ein Einzelgänger. Ihr Cousin hätte sich auch einen anderen Tag für die Beerdigung aussuchen können!»
«Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er gar nicht gestorben!»
«Was war er denn von Beruf?»
«Gib mir einen Whisky!», unterbrach er die Konversation. Er wusste, dass der Barkeeper erst das Fragen einstellte, wenn er alles in Erfahrung gebracht hatte. Gerade deswegen hatte er sich den Saloon ausgesucht, der nur zwei Blocks von seinem Haus entfernt lag. Joe würde bestätigen können, dass er vor der Beerdigung ein paar Drinks zu sich genommen hatte.
«Das wird ein gehöriges Durcheinander werden, Mr. Weissenbach!» Der Barkeeper schob das volle Glas über den Tresen.
Er setzte den Whisky an und kippte ihn hinunter.
«Haben Sie nicht gehört, die wollen heute Abend in der Randolph Street einen Riesentumult veranstalten, wegen dieser Schießerei bei McCormicks. Die haben aufgerufen, dass die Arbeiter sich bewaffnen sollen.»
«So? Nichts gehört. Ich muss mich um mein Geschäft kümmern», erwiderte er und ließ das leere Glas zurückgleiten.
«Ich werde meinen Saloon zusperren, damit die nicht hier reinstürmen und wieder alles kurz und klein schlagen.»
«Besser so.» Er machte ein Zeichen, dass der Barkeeper nachschenken solle.
In den neighborhood saloons, die meistens Arbeiterclubs waren, wurden die wildesten Pläne ausgeheckt. Die Brutalität der Polizei war ständiges Gesprächsthema. Seit der Kampagne für den Achtstundentag gingen die Pinkertons mit großer Härte gegen die Streikenden vor.
Das zweite Glas trank er langsamer.
«Man sagt, dass sie heute Abend losschlagen wollen. Spies und Parsons stacheln die Leute auf. Die Arbeiter-Zeitung macht mobil. Glauben Sie, dass es zum Bürgerkrieg kommt?»
«Was weiß ich», sagte er. Im Spiegel gegenüber konnte er neben der gläsernen Karaffe und den vier Kerzenständern sein glattrasiertes Gesicht erkennen, obwohl der Spiegel fast blind war. «Nachschenken», befahl er.
Der Barkeeper füllte das Wasserglas bis zum Rand.
«Sie werden den Kürzeren ziehen.»
«Wer?»
«Die Streikenden.»
Er stürzte den Whisky hinunter und legte die Münzen auf den Tisch.
«Muss los, nichts für ungut.»
Der Barkeeper wünschte eine schöne Beerdigung.
Er ging die Straße lang. Er wusste, dass der Barkeeper ihn beobachtete. Dann bog er ab und beeilte sich, wieder nach Hause zu kommen. In der Zeitung hatte er gelesen, dass gegen fünf Uhr nachmittags auf dem Waldfriedhof ein gewisser Mr. Mueller beerdigt wurde. Den wollte er als Cousin angeben. In der Neuen Welt konnte das niemand nachprüfen.
Wegen seines rötlichen Haares war er lange für einen Iren gehalten worden, was in Chicago keine schlechte Herkunft war. Die deutschen Einwanderer stellten mit einer dreiviertel Million zwar die größte Gruppe dar, aber viele betrachteten sie als Störenfriede, fremd und roh.
Als er 1877 nach Amerika gekommen war, stellte er fest, dass niemand sich für die Vergangenheit der anderen interessierte. Die Deutschen bildeten Vereine für Turnen und Singen, blieben für sich. Ebenso beargwöhnt wurden die Polen.
Er kehrte in sein Haus zurück, betrachtete lange die Bombe auf der Werkbank, bevor er sich im zweiten Stock zum Schlafen legte. Vielleicht hatte der Barkeeper Recht, vielleicht kam es zum Bürgerkrieg. Dann schlief er ein. Die Heiligen beschützten ihn.
Der Laden war ein Glücksfall, ein Ringeltäubchen, ein wunderbares Auskommen. Als katholischer Geistlicher, der lieber Heiligenbilder verkaufte, als auf der Kanzel zu predigen. Nur manchmal sehnte er sich nach seinem früheren Beruf. Am liebsten verkaufte er das unschuldige Jesuskind, das manche ältliche Kundin wie ihren eigenen Enkel ansah.
Gegen halb sechs erwachte er. Nach ausführlicher Dusche wählte er im Ankleidezimmer den schwarzen Anzug. Der Hemdeinsatz mit dem weißen Priesterkragen war frisch gestärkt. In der Küche bereitete er sich ein Abendbrot. Zwei Scheiben Wurst waren noch vorhanden. Der Käse war etwas angeschimmelt.
Er ging hinunter in die Werkstatt, nahm die gefährliche Orange vom Tisch und band sie mit zwei dünnen Schnüren an seinem rechten Bein fest. Er schritt im Laden auf und ab, konnte aber keine Behinderung beim Gehen bemerken. Im Spiegel prüfte er, ob eine Ausbeulung des Hosenbeines festzustellen war. Er nahm den grauen Hut vom Ständer. Aus Marshall Field's Department Store für zweieinhalb Dollar. Wie stets führte er ein kleines Holzstöckchen mit sich. Gelegentlich schlug er damit an einen Laternenpfahl oder einen Eisenzaun. Er verließ sein Haus durch den Hinterausgang.
Seit Mitte Februar wurde die Landmaschinenfabrik McCormick bestreikt. Die Presse wütete. Täglich auf den ersten Seiten Angriffe gegen die Demonstranten, die roten Ausländer und Anarchisten. Die Chicago Tribune riet ihren Lesern: «Der einfachste Plan ist, den Arbeitern statt Butter Arsenik aufs Brot zu streuen. Das bewirkt in kürzester Frist den Tod und ist allen anderen eine Warnung.» Und die Chicago Times schrieb: «Die beste Mahlzeit für einen Tramp ist Blei. Man sollte ausreichende Portionen geben, um ihren Appetit und ihre Gefräßigkeit zu stillen.»
William Pinkertons Geschäfte blühten. Er hatte eine geheime Armee von Schlägern aufgestellt, die auch als Streikbrecher eingesetzt wurden. Bei McCormicks Fabrik nahmen sie die Demonstranten unter Beschuss. Die Pinks zielten von Pferdewagen aus in die Menge. Eine Portion Blei. Die Lunte war gelegt.
Er ging nicht auf direktem Wege zum Haymarket, wo die Protestversammlung stattfinden sollte, sondern wanderte zickzack zwischen der Dearborn und der Clark Street, wo sich Saloons, Puffs und Pfandhäuser aneinanderreihten. Manchmal mischte er sich sonntags unter die Herumtreiber und ließ sich in einer Droschke zurück ins deutsche Viertel bringen. Für diese Ausflüge gab es eine besondere Garderobe: Schlägermütze, Knickerbocker und derbe Schuhe.
Er dachte an Florine. Sie tanzte jetzt zwischen den Hochzeitsgästen, hielt Reden und sammelte Unterschriften. Erregt, wütend. Wie gerne hätte er gesehen, was sein Gegenspieler für ein Gesicht machte, dass ihm die schöne Feier verdorben war. Florine stieg auf einen Stuhl, damit alle sie sehen konnten. Kakaotassen gingen zu Bruch, und auf den weißen Kleidchen gab es ein paar braune Flecken.
«Passen Sie doch auf, Sie Flegel», sagte er zu einem betrunkenen Matrosen, der ihn anrempelte.
«'tschuldigung, Mister», erwiderte der junge Mann. Er brach zusammen. Zwei Kumpane kamen aus dem Saloon und halfen ihm zurück an die Theke.
Die Puffs hatte er nur zweimal besucht. Nicht, weil er die paar Dollars sparen wollte, für eine heilige Maria im Dornbusch bekam er zwei Marys und zwei Dorothys, sondern weil er die Frauen abstoßend fand. Sie ließen sich volllaufen, um ihren Job zu ertragen. Ungeschickt stülpten sie den Männern das Gummi über. Auf dem Präservativ stand gedruckt, dass es für die Benutzung nur gestattet sei, um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten zu verhindern. Die Marys und Dorothys waren fast bewusstlos, wenn die Männer auf ihnen lagen.
Er spürte, dass die gefährliche Orange ein wenig verrutschte. Aber die Schnüre hielten, waren straff gespannt. Als er den Haymarket erreichte, sah er die Grüppchen, die sich auf dem langgezogenen, rechteckigen Platz verloren. Es war kurz vor acht. Eigentlich hätte die Versammlung schon beginnen müssen. Dann entdeckte er Bürgermeister Harrison, der also nicht bei der Hochzeit der Milton-Tochter war. Harrison rauchte eine Zigarre.
Seit vier Wahlperioden war er im Amt. Er wog zwei Zentner, ein grauer Vollbart zierte ein Gesicht, das Respekt verlangte und Zuneigung. Sein aufrechter Gang und die Art, wie er seine Zigarre in Brand setzte, ließen jeden Bürger aufmerksam werden. Ein Mann, der neben ihm stand, sagte, er solle besser gehen, sonst würden die Anarchisten sich ihn als ersten greifen. «Ich will, dass die Leute wissen, hier steht ihr Bürgermeister!» wies Carter Harrison den Mann ab.
Jetzt erschien August Spies, der Polsterer, der ein eigenes Geschäft besaß und Möbel schreinerte. Ein schmales, blasses Gesicht, tiefliegende Augen, Geheimratsecken im vollen Haar, obwohl er erst Anfang Dreißig war. Spies fragte nach seinem Freund Parsons, der als englischer Redner die Versammlung eröffnen sollte, erst danach kamen gewöhnlich die Sprecher für die deutschen und tschechischen Demonstranten. Spies stellte sich auf einen Pferdewagen und rief die Anwesenden zusammen. Offensichtlich enttäuscht, wie wenig dem Aufruf gefolgt waren. Als sie den Haymarket ausgewählt hatten, rechneten sie mindestens mit zehntausend Menschen. Der Platz fasste die doppelte Menge. Er kam näher an den Pferdewagen heran, der voll beladen war. Ölfässer, Säcke, Holzscheite. Spies schickte jemanden los, um Parsons zu holen.
«Lass uns den Wagen auf die Randolph schieben, August, dann machen wir unsere Versammlung gleich da.» Spies lehnte ab, dort halte man nur den Verkehr auf. Sie entschieden sich, einen anderen Wagen als Plattform zu benutzen. Vor der Metallfabrik der Gebrüder Crane. Der Truck war leer.
Er ließ Bürgermeister Harrison nicht aus den Augen. Wenn der das Zeichen gab ... Er konnte keinen von den Pinkertons entdecken, aber sie unterschieden sich in Zivil nicht von den anderen auf dem Platz. Alle trugen schwarze Hüte, hatten ihre langen Jacken an, die über einer Weste getragen wurden. Fast alle waren bärtig. Es gab kaum Transparente. Nur eine Fahne konnte er erkennen. Aus der Entfernung war nicht zu entziffern, was darauf stand. Spies begann seine Rede mit dem Hinweis, dass Parsons bald erscheinen würde. Er sprach mit heftigen Gebärden.
«Es gibt bei manchen Authoritäten die Meinung, dass diese Versammlung einberufen wurde, um einen Aufstand zu beginnen. Das ist nicht unsere Absicht. Wir haben euch zusammengerufen, um einige Fakten darzustellen, von denen ihr vielleicht nichts wisst. Gestern Nachmittag sprach ich bei McCormick zu sechstausend Lohnsklaven. Die meisten waren brave Kirchgänger. Ich sagte ihnen, dass sie sich stark fühlen müssten gegenüber dem Häuflein Unternehmer. Da marschierte die Polizei auf und richtete ein Blutbad an. Nun wird behauptet, ich hätte die Attacke bei McCormick provoziert. Das ist eine Lüge.»
Er hörte, wie einzelne aus der Menge riefen: «Erschießt ihn! Hängt ihn auf, diesen McCormick!» Harrisons Zigarre war ausgegangen. Er kaute aufgeregt auf ihr herum. Spies hob beide Hände, während er sprach.
«Jetzt haben wir die Chance, für eine lebenswerte Existenz zu streiken. Die Ausbeuter wollen uns mit Gewalt zufriedenstellen. Sie wollen uns umbringen lassen. Doch der Tag ist nicht fern, an dem wir Männer wie McCormick zur Verantwortung ziehen - als Mörder an unseren Brüdern. Und denen, die hier rufen: Hängt ihn auf, sei gesagt, macht keine leeren Versprechungen. Sie helfen nicht weiter. Wann immer ihr bereit seid, etwas zu tun, tut es, aber kündigt es nicht an. Eure Existenz hängt von ein paar Schweinehunden ab, die in Müßiggang und Luxus von eurer Arbeit leben. Wie lange wollt ihr das ertragen?»
Nach zwanzig Minuten erschien Albert R. Parsons, der Drucker und Herausgeber der Zeitung Alarm, der auf vielen Versammlungen als Agitator auftrat. Sein Haar war gestriegelt, der gerade Schnurrbart frisch gewachst, der Anzug hochgeknöpft. Spies schloss seine Rede und kündigte seinen Freund Parsons an. Die Menge beruhigte sich schon wieder.
Der Bürgermeister steckte seine Zigarre in Brand. Er kannte diesen glänzenden Redner, der sicherlich zu keiner Gewalttat aufrufen würde. Er hatte einen leichten Südstaaten-Akzent. Meist argumentierte er mit Zahlen und Statistiken, die Arbeiter bekämen von einem Dollar nur fünfzehn Cents, während der Rest an die Kapitalisten ginge.
Er ging in Richtung Desplaines Street. In die Nähe der Polizeistation. Nun spürte er die Schnüre, mit denen die Bombe befestigt war. Er bewunderte den Mut des Bürgermeisters, der mitten unter den Demonstranten stand. Harrison trat für den Achtstundentag ein, suchte den Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit. Er würde auf keinen Fall die Sozialisten und Anarchisten daran hindern, ihre Versammlungen abzuhalten. Aber es bestand auch kein Zweifel, dass Harrison die Polizei einsetzen würde, falls einer der Redner zum Aufruhr anstachelte. Parsons hielt sich an die Spielregeln.
«Es ist an der Zeit, eine Warnung ernst zu nehmen. Wisst ihr, dass das Militär unter Waffen steht? Und dass die Gatling-Kanone be-reit ist, uns niederzumähen. Sind wir denn in Deutschland oder Russland oder Spanien? Wann immer ihr mehr Lohn fordert, wird das Militär eingesetzt, die Sheriffs und die Pinkertons werden losgelassen. Ihr werdet erschossen, geprügelt und in den Straßen ermordet. Ich bin nicht hierhergekommen, um euch aufzustacheln, sondern um die Fakten auszusprechen, die auf dem Tisch liegen, auch dann, wenn das mich vor dem Morgengrauen das Leben kostet.»
Fast eine Stunde sprach Albert Parsons. Die ersten Demonstranten verließen den Platz. Er ging zurück, um zu sehen, was der Bürgermeister vorhatte. Mit verschränkten Armen stand Harrison und plauderte mit einem Nebenmann. Alles blieb ruhig. Harrison klopfte seinem Gesprächspartner auf die Schulter und ging zur Polizeistation.
Inzwischen hatte Samuel Fielden, der Fuhrmann, das provisorische Podium erklommen. Sein langer Vollbart war ungestutzt, er trug ein derbes kariertes Hemd, darüber eine dicke Wolljacke. Schwarze Wolken zogen auf. Ein starker Wind brauste vom Michigansee herüber. Die ersten Tropfen fielen. Die meisten Zuhörer suchten einen Unterstand. Nur ein paar hundert Zuhörer blieben vor dem Pferdekarren stehen. Fielden war irritiert, dass ihm die Leute wegliefen.
«Es gibt für euch keine Sicherheit in diesem System. Ich weiß nicht, ob ihr Demokraten oder Republikaner seid, aber was auch immer, ihr betet vor dem himmlischen Schrein. Die Gesetze sind jedoch eure Feinde. Und wir rebellieren gegen sie. Die Gesetze sind nur gemacht, um euch in Schach zu halten, sie sind die Gesetze der Ausbeuter. Ihr habt mit diesen Gesetzen nichts anderes zu tun, als sie in eure beiden Hände zu nehmen und sie zu erwürgen, bis sie keinen Laut mehr von sich geben. Sie sind es, die eure Brüder aus der Bahn werfen und die euch zu bloßen Tieren erniedrigen. Haltet eure Augen offen!»
Er sah, wie Bürgermeister Harrison, ohne der Versammlung weitere Beachtung zu schenken, die Desplaines-Polizeistation verließ, sein weißes Pferd bestieg und nach Hause ritt. Der Regen wurde stärker.
2. Kapitel: Berlin, Mai 1856
Nach monatelanger Tippelei war Karl Schasler endlich ans Ziel gelangt. Auf der anderen Straßenseite lag jene Berliner Weinstube, in der er Stirner anzutreffen hoffte. Friedrichstraße 94, so hatte man ihm gesagt. Er musste nur noch durch den Torbogen gehen, dann würde er dem Lehrmeister gegen-übertreten. Er kannte ganze Passagen seines Buches auswendig, hatte immer wieder anderen daraus deklamiert, gab manchmal an, es seien seine eigenen Gedanken, die er vor-trage. Aber kaum einer seiner Zuhörer glaubte ihm. Mit seinen achtzehn Jahren war er noch zu grün hinter den Ohren. Kein Schustergeselle kann solche Sätze sagen.
Karl war das sechste Kind einer Buchbinderfamilie, die in der Nähe von Regensburg lebte. Sein Vater leimte tagsüber Bücher zusammen und prügelte nach Feierabend seine Kinder. Die Mutter hatte auf einer Liste die Vergehen zusammen-gestellt, die jedes einzelne sich zuschulden kommen ließ, und der Vater wählte aus seiner Sammlung von Schlagwerkzeugen jenes aus, das er für die Bestrafung angemessen hielt. Es gab Ruten, Ochsenziemer, Rohrstöcke, Kleiderbügel mit Eisen-haken, zusammengeflochtene Bassgeigen Saiten. Wenn Karl Glück hatte, kam er mit ein paar Watschen davon. Er sah, welche Freude es seinem Vater bereitete, Hiebe auszuteilen. Nicht selten sang er bei der Prügelei. Oder er grinste ganz vergnügt. «Die Bosheit steckt tief im Herzen des Knaben, aber die Zuchtrute treibt sie heraus, so spricht der weise Salomon», diesen Spruch zitierte er häufig bei den Züchtigungen. Die Mutter stand dabei und rief die Kinder herein. Wenn einer seine Tracht bekommen hatte, strich sie den Namen auf der Liste durch.
Kaum hatte Karl das dreizehnte Lebensjahr erreicht, äußerte er den Wunsch, die Gewerbeschule zu verlassen und sich als Schusterlehrling zu verdingen. Seinen Eltern war dies recht, weil ein Esser weniger am Tisch saß. Schuhmacher König war einer jener Krauter, die keinen Lohn zahlten, um aus den Lehrlingen das meiste herauszuschinden. Karl musste gegen vier in der Früh das Haus verlassen und kam erst nach Sonnenuntergang zurück. Er hörte die Schreie seiner Geschwister, während er erschöpft in der Schlafstube lag.
Durch einen angezettelten Streit gelang es ihm, schon vor der Zeit seinen Lehrbrief zu erhalten. Er hatte dem Meister zwei Paar Schuhe derart versohlt, dass dieser in Regress genommen wurde.
«Aus dir wird nie ein guter Schuster», brüllte ihn der Meister an.
«Aber ein wilder Bursche», erwiderte Karl. Er erbat das Arbeitsbuch, ohne das er sich nicht von Ort zu Ort bewegen durfte. Der Abschied von zu Hause war sein glücklichster Tag. Die Mutter weinte, während Karl nicht mal versuchte, ein trauriges Gesicht zu machen. Als er weit genug von seinem Elternhaus entfernt war, drehte er sich um und rief seinem Vater zwei Worte zu, die er nie bereute: «Mastbürger, damischer!»
Karl Schasler war kräftig gewachsen und während seiner Tippelei keinem Gefecht aus dem Weg gegangen. In jeder großen Stadt, die er erreichte, gab es Herbergen seiner Zunft. Am schwarzen Brett konnte er lesen, wer Arbeit für einen Schuster hatte. Dann musste er sich vorstellen. Er wurde wie ein Sklave gemustert, die Feilscherei um Arbeitszeit und Lohn begann: 14 Stunden für einen Gulden pro Woche nebst Kost und Logis. Mit seinem Arbeitsbuch musste er sich beim Bürgermeister melden, wurde vom Stadtchirurgen untersucht, ob er hautrein sei, dann ging's zur Polizei, wo er lange anstehen musste, und endlich gab es den ersehnten Stempel: Kann in Arbeit treten. Die Polizei prüfte zuvorderst, ob ein Steckbrief gegen den betreffenden Gesellen vorlag.
Es war in Bremen, wo ihm ein Exemplar des Buches «Der Einzige und sein Eigentum» in die Hände fiel. Zunächst verstand er kaum etwas, mühsam entzifferte er Zeile um Zeile. Las manche Stellen zehn- und zwanzigmal, unterstrich hier und da, machte sich Kreuzchen an den weißen Rand. Was für ein Buch, was für Gedanken, was für ein Name! Endlich einer, der keinen Gott und keinen Vater über sich gelten ließ. Das Buch hatte mehr gekostet, als er in drei Wochen verdiente. Es wurde seine Bibel.
Die Tippelei führte Karl Schasler bis Dänemark, nach Jütland, wo er lange am Meer saß und in seinem Buch las, und auch nach Italien, wo er als Deutscher oft verjagt wurde. «Maledetto Tedesco!», schrie man hinter ihm her. Wenn er kein Geld verdiente, verlegte er sich aufs Fechten: Er bettelte in reichen Häusern, trug Gedichte vor, die er in seiner Schulzeit hatte lernen müssen. Ein einziges Mal musste er sitzen, weil er wegen Landstreicherei aufgegriffen wurde. Er ließ die Stadt Hagen danach bei seiner Tippelei links liegen. Dann kam ihm der Gedanke, dass er den Autor seiner Bibel kennenlernen wollte, den Verfasser der hochverehrten Zeilen. Er dachte sich den Mann als wilden Burschen, als wüsten Ketzer, als ungezügelten Helden des Geistes. Ein Meister antistaatlicher Gedanken. «Der Staat beruht auf der Sklaverei der Arbeit. Wird die Arbeit frei, so ist der Staat verloren.»
Ein Gerücht erzürnte Karl Schasler sehr. Ein Lehrbursche in Hamburg behauptete frech, er wisse ganz genau, dass Stirner sich nicht an den Barrikadenkämpfen im Jahre 1848 beteiligt habe. Dem Lehrburschen hatte Karl eins aufs Maul gegeben. Dennoch wollte er den Verfasser danach fragen.
Karl Schasler war gewohnt zu hungern, denn von dem Schusterlohn blieb selten etwas übrig. In Düsseldorf erhielt er einen preußischen Taler pro Woche, Arbeitszeit zwölf Stunden täglich. Die Meisterin hatte sich in ihn verguckt, gab ihm, wenn der Alte liefern war, gelegentlich mal einen Schnaps zum Pumpernickel mit fettem Speck. Die Tippelei war weniger anstrengend, wenn er etwas Alkoholisches bei sich trug.
Er ging durch den Torbogen und wandte sich nach rechts, woher die lautstarken Reden kamen. Die Weinstube Hippel war ein geräumiges Zimmer, ganz schmucklos, in der Mitte ein langer Tisch. Dort tagten allabendlich die Freien. In einer Ecke spielten Herren Karten, Eichel-Mariage. Die Gäste qualmten Pfeifen, dicke Rauchschwaden hingen unter der niedrigen Decke. Verstohlen setzte sich Karl auf einen freien Stuhl.
«Die Kirche, wenn ich das Wort nur hör, wird mir speiübel. Was sind das für Laffen, die sich im Himmel wähnen und doch wie andere Menschen scheißen gehn? Die Mutter Kirche, mein Lieber, wenn ich so eine böse Mutter hätt, wär ich lieber tot.»
«Die Kirche sorgt für die Armen.»
«Dreck!»
«Die Kirche sorgt zuerst mal für sich selbst. Damit die Fettwänste was zum Fressen haben, zum Saufen, damit sie sich in goldenen Gewändern zeigen können. Und ab und zu ein kleines Almosen. Das nennen sie dann Samaritertum.»
Karl Schasler wusste nicht, wohin er zuerst hören sollte. Am langen Tisch, auf dem die Weinschoppen standen, unzählige leere in der Mitte und vor den Gästen volle oder halbgefüllte, erregten sich die Gemüter. So frei hatte er noch nie eine Gesellschaft reden hören.
«Und wieder mal die hohe Zensurbehörde. Was gibt es heute zu zensieren? Was ist nicht geeignet fürs geschätzte Publikum? Da wird geschnitten, dort gekürzt. Meinen Sie denn, wir wüssten nicht, dass uns die Wahrheit nur in kleinen Scheibchen verabreicht wird.»
«Die Zensur ist eine Himmelsmacht.»
«Dreck!»
«Die Herrschenden brauchen die Zensur, sonst wären sie gänzlich verloren. Glauben Sie, wenn das Publikum erführe, wie die Herren sich die Taschen füllen, dass einer von diesen Gaunern noch am Leben wär?»
Karl Schasler bestellte beim Wirt einen Schoppen und musste Vorauskasse leisten, da sein Gesicht hier nicht bekannt sei. Der Wein schmeckte derart sauer, dass er beschloss, keinen weiteren zu ordern. Eine einzige Frau saß mit am langen Tisch, ganz elegant, in Männerkleidern. Die silberne Fliege war akkurat gebunden. Sie sprach von der freien Universität, die zu gründen sei.
«Wir müssen eine eigene Universität haben, nicht diese hochgelehrten Duckmäuseranstalten, nicht diese lächerlichen Geistesdressuren und auch nicht diese kriecherischen Professoren. Wir brauchen frische Geister, die sich den Wind um die Nase haben blasen lassen, freie Denker und Redner, die unsere Jugend erziehen sollen, damit sie endlich emanzipiert wird.»
«Ganz richtig, Frau Aston, ganz richtig. Wir sollten gleich damit beginnen, ein Komitee zu gründen für eine solche Lehranstalt.»
«Dreck. Lehranstalten sind Dreck! Das muss unter freiem Himmel geschehen, mitten in der Natur. Heraus aus allen muffigen Gebäuden, die den preußischen Drill geatmet haben. Nur die freie Wildbahn kann unsere Schule sein.»
«Ein Komitee, wozu schon wieder ein Komitee? Da wird geredet und nichts kommt dabei heraus.» Mit einem Mal war Stille in der Weinstube.
Karl Schasler wusste nicht, wieso. Dann hörte er von seinem Nebenmann, der Wirt pumpe nicht mehr, es gebe keinen weiteren Kredit.
Ein Herr im steifen Gehrock, der die ganze Zeig geschwiegen hatte, sagte hinein in diese Stille: «Ihr wollt frei sein und merkt nicht, dass ihr bis über beide Ohren in einem stinkenden Schlamm steckt! Reinigt euch zuerst selbst, bevor ihr anderen Freiheit beibringen wollt.»
Sofort erhob sich wütender Protest. Die meisten Teilnehmer der langen Tafel verließen die Weinstube, ohne ihren Mantel oder Überzieher mitzunehmen. Der Schuster folgte ihnen. Frau Aston kam an seine Seite.
«Wo bist du her? Du siehst so neu aus, gar nicht wie ein Berliner?» Ihre Stimme leise, fast zärtlich. Sie hakte sich bei Karl ein.
«Ich bin ein freier Handwerksbursche! Ich kann hingehen, wohin ich will.»
«Gut gebrüllt, Löwe», sagte sie und lachte mit ihrer tiefen Altstimme. Sie roch nach Tabaksqualm und süßlichen Veilchen.
«Wo gehn wir hin?»
«Wart's ab», sagte sie.
Die Freien zogen «Unter die Linden», stellten sich auf beide Seiten der Prachtstraße.
Karl Schasler hörte, wie einer, nachdem er tief den Hut gezogen hatte, einen Bürger ansprach: «Ich wollte bitten um eine Kleinigkeit, und wenn's bloß ein Taler wär. Hippel pumpt nicht mehr, und ich möchte noch gerne eine Bowle trinken...» Die meisten der Bürger gingen nicht auf diesen Jux ein, aber manche zahlten doch. Andere zogen mit. Und als genügend Taler erbettelt waren, kehrten alle singend in die Weinstube zurück.
Der Wirt nahm das Geld, rechnete die Schulden ab und schenkte wieder großzügig aus.
Schasler kam neben Frau Aston zu sitzen.
«Ich möchte zu Stirner!», sagte er leise.
«Stirner», antwortete sein Gegenüber, «zu dem Mucker? Dem Schwächling?»
«Gymnasiallehrer ist er. Hauslehrer. So ein Spießer!» Karl Schasler brauste auf. Frau Aston hatte Mühe, ihn zu beruhigen. Dann fragte er, ob Stirner denn nicht anwesend sei. Man habe ihm gesagt, er könne ihn jeden Abend hier antreffen.
«Den würden wir nicht dulden!», rief ein anderer barsch, «den Stirner nicht.»
«Ich kann dir sagen, wo er logiert», sagte ihm Frau Aston, «wenn du ihn unbedingt besuchen möchtest.» Sie gab ihm die Adresse und legte ihre Hand auf seinen Arm. Schasler dankte, trank den sauren Wein. Er war froh, dass niemand weiter über seinen Lehrmeister herzog. Er hätte es nicht zugelassen, wenn Stirner weiter beleidigt worden wäre.
Jetzt ging es um Judenhass, der sich auch in Berlin breitmachte, dann wieder um die Kirche, ein anderer Kreis stritt über den Sozialismus und sein Aufflammen in verschiedenen Ländern. Alle führten kecke Reden, legten Axt an Begriffe, die bis dahin noch unerschütterlich festgestanden hatten, ließen kein gutes Haar an Autoritäten.
«Gibt es keine Polizeispitzel hier?», fragte Schasler seine Nachbarin. Sie nahm die Pfeife aus dem Mund und lachte tief: «Hier wird palavert, Karl!»
In dieser Nacht streifte er durch die dunkle Stadt, die mit ihren hohen Häusern aussah wie ein versteinerter Garten. Die Luft war würzig und frei. Es gab kaum Bäume. Gegen sieben erreichte er das Haus im Nordwesten Berlins, Philippstraße 19. Ein vierstöckiger Bau, schmucke Fassade. Manche Fenster waren mit Brettern zugenagelt. Sein Herz pochte so laut, dass er sich an die Brust fasste. Er wusste nicht, was er nun sagen sollte. Würde ihn der hohe Herr überhaupt einlassen? Ein Schuster und ein wilder Philosoph? Vorsichtig schob er das Eingangsportal auf und stand in einem dunklen Treppenhaus. Er beugte sich, um die Namen an den Türen zu entziffern. Dann fiel ihm ein Satz ein, mit dem er Stirner begrüßen wollte.
«Wen suchen Sie denn?», fragte eine helle Stimme hinter der Wohnungstür.
«Ich möchte zu Herrn Stirner!», gab Karl von sich.
«Eine Treppe weiter oben», kam die Antwort.
Schasler sprang mit schnellen Schritten die beiden Treppenabsätze hinauf. Jetzt war ihm der Satz wieder entfallen, den er zur Begrüßung sagen wollte. An der linken Wohnungstür stand in großen Buchstaben Weiss, an der rechten in Sütterlinschrift Schmidt. Die Frau hatte ihn in die Irre geführt. Gerade, als er noch ein Stockwerk hinaufgehen wollte, kam eine Dame aus der linken Wohnung.
«Bettler und Hausierer sind in diesem Haus nicht zugelassen! Haben Sie die Warnung am Tor nicht gelesen?»
«Ich möchte zu Herrn Stirner», sagte Schasler, dem die Wut ins Gesicht stieg. Wenn ihn jemand anging, musste er sich stets beherrschen.
«Sie stehen vor seiner Tür!», gab die Dame von sich und zeigte auf die gegenüberliegende Wohnung.
«Stirner», wiederholte Schasler.
«Wohnt dort.» Die Dame schubste ihn.
«Da steht Schmidt!»
«Nun gehen Sie schon. Er ist wach.»
Zögernd setzte Schasler dazu an, die Klinke herunterzudrücken.
Er stand in einem schmalen Flur. Nur wenig Morgenlicht kam von der Seite herein.
Er räusperte sich ein paarmal.
Am anderen Ende wurde eine Tür geöffnet. In der Silhouette erkannte Schasler einen Mann, der Zigarre rauchte. Er winkte ihn heran.
«Haben Sie Geld bei sich?», fragte Stirner, «ich bin mit der Mietzahlung im Rückstand.»
Schasler nickte eifrig, beglückt, dass er keinen ersten Satz sagen musste.
Er nahm sein Portemonnaie heraus, schüttete die Taler auf den Tisch.
«Bitte, nehmen Sie.»
Schon zur Morgenzeit trug Stirner einen Anzug, der sehr eng saß und die hagere Erscheinung noch verstärkte. Die dünne Stahlbrille mit den kleinen Gläsern ließ ihn wie einen Pedanten aussehen, einen Steueramtmann. Helle, blaue Augen, ein schmallippiger Mund, blonder Backen- und Schnurrbart, das Kinn glattrasiert. Schasler studierte die ernste Miene lange.
«Was führt Sie zu mir?», fragte Stirner, der die Geldmünzen auf dem Tisch zählte. Beim Sprechen nahm er die Zigarre nicht aus dem Mund.
«Ich bin gekommen», begann Schasler mit fester Stimme, «weil ich ein großer Verehrer Ihres Buches <Der Einzige und sein Eigentum> bin ...» Nun stockte er wieder.
«Ach, das ist lange her. Wann kam es heraus? Ich habe es schon vergessen.» Schasler sah auf die Hände. Weiße, sehr gepflegte schlanke Hände, die konnten sicher keiner Fliege etwas zuleide tun. «Soll ich das Buch signieren?» Der Schuster zog es aus der Innentasche und reichte es Stirner. Der Schweiß trat ihm auf die Stirn. Gab es einen Satz, mit dem er sich verabschieden konnte? Bedächtig schrieb der Autor Johann Caspar Schmidt auf die Titelseite, fügte das Datum hinzu: Berlin, den 29. Mai 1856.
«Bitte sehr», er reichte Schasler die zerfledderte Ausgabe. «Wussten Sie, dass man es nicht einmal richtig verboten hat? Anfangs sah es ja so aus, als würde die Kreisdirektion in Leipzig die ganze Auflage beschlagnahmen. Aber dann hoben sie ihren Beschluss wieder auf, das Ministerium des Innern befand, es sei zu absurd, um gefährlich zu sein. Nur die Preußen und Kurhessen haben ein Verbot ausgesprochen, aber das hielt niemand, der es lesen wollte, davon ab, es sich zu beschaffen. Ich wollte den Staat betrügen ...» Max Stirner unterbrach sich, blickte aus dem kleinen Fenster auf den freiliegenden, mit Bäumen umstandenen Platz der Anatomie.
«Es war ganz einfach, sich das Buch zu beschaffen», sagte Karl Schasler, der es jetzt genoss, dem Philosophen zuzuhören. Wieso sollte er sich Sätze für den Eingang oder den Abschied ausdenken?
«Von den großen Zeitungen hat es nicht eine rezensiert. Man hat mich totgeschwiegen. Immer noch die beste Weise, einen vor der Zeit zu beerdigen. Sie hatten Wichtigeres zu tun! Es gab großartige Klatschgeschichten zu vermelden, Unterhaltung jeder Art, ein wenig Seichtes für die Leser, Tagesinteresse, wohlbekannt. Was finden Sie denn nun an meinem Buch?»
«Ich?», fragte Schasler, völlig überrascht. «Ich habe es wieder und wieder gelesen und werde es auch immer wieder tun, ganz bestimmt.» Wie ein eifriger Schüler, der er in der Schulzeit niemals war, beeilte er sich mit diesem Geständnis.
«Und was hat Ihnen besonders gefallen?» Stirner drückte die Zigarre in dem übervollen Tongefäß aus, entnahm einem Lederetui eine neue und setzte sie ohne Umschweife in Brand.
«Die Respektlosigkeit, die Verachtung für Obrigkeiten. Und wie Sie mit der Religion ins Gericht gehen!» Schasler sprudelte die Worte hervor, wollte seinem Lehrmeister beweisen, dass er seine Hausaufgaben erledigt hatte.
«Sind Sie denn ein respektloser Mensch?»
Schasler glühte jetzt: «Ich leg mich an mit diesen Herren, die glauben, dass sie mich beherrschen könnten. Wir hatten einen Meister in Hannover, der wollte partout keine Uhrzeit gelten lassen. Da hab ich mir das Horn der Feuerwehr besorgt und abends einmal kräftig hineingestoßen und dann geschrien: <Feuer, Feuer! Alle zum Bürgermeister kommen!> Da war Feierabend für den Tag.»
«So», erwiderte Stirner. Mehr nicht. Inzwischen war es heller in der Stube geworden. Schasler konnte die Regale sehen, in denen sich die Bücher stapelten, übereinander geschoben, gänzlich ohne Ordnung.
«Die haben Sie alle gelesen, Herr Stirner?»
«Nicht alle, die meisten lohnen nicht», erwiderte der elegant gekleidete Herr, «die Bücher geben oft mehr vor, als sie wirklich sind.»
«Aber Ihr Buch gewiss nicht.»
Wieder trat ein Schweigen ein. Diesmal war es dem Schuster nicht mehr unangenehm.
«Haben Sie Zigarren?», fragte Stirner nach einer Weile.
«Ich rauche nicht», antwortete Schasler, «aber ich kann Ihnen welche besorgen.»
«Nein, lassen Sie nur.»
Karl Schasler dachte an die Frage, die er dem hohen Herrn stellen wollte, aber er wusste nicht, ob es der rechte Zeitpunkt war. Es handelte sich ja bloß um ein dummes Gerücht.
«Ich glaube, mein Buch hat nichts bewirkt, gar nichts. Als ich es geschrieben habe - meinen Freunden ist es gar nicht aufgefallen, sie waren alle überrascht, als sie davon erfuhren - da dachte ich, es wird alles revolutionieren, über den Haufen werfen. Ein Neubeginn im Denken, ein frischer Wind bei all dem preußischen Mief. Und was geschah? Nichts! Oder kaum etwas. Es lohnte sich ja nicht, auf die paar Rezensionen einzugehen. Ich hab es nur getan, weil ich der Sache noch nicht überdrüssig war.»
«Ich verstehe nicht», sagte Schasler, der vor lauter Ehrfurcht die ganze Zeit gestanden hatte.
«Da schreibe ich ein radikales Buch, ein gefährliches Buch, in dem Staat und Obrigkeit attackiert werden ... und dann war alles harmloses Geschreibsel. Was für ein Hohn!»
«Aber ich ...» Schasler versuchte, Stirner zu unterbrechen. Es gelang nicht, ihm zu widersprechen. Was wollte sein Lehrmeister sagen? Warum dieses nachdenkliche Getue?
«Die meisten haben mich ridikulisiert. Die Liberalen riefen, es könne doch niemand die Notwendigkeit des Staates negieren, die Sozialisten schimpften, weil ich den wahren Egoismus in uns darstellte, die Humanisten hatten sich den Menschen so schön, neu und herrlich vorgestellt... Sehen Sie, ich habe niemand gewinnen können mit meinem Werk, niemand.» Karl Schasler schluckte.
«Mich. Mich haben Sie gewonnen.»
«Na schön», sagte Stirner. Und es klang so, als komme es auf diesen Schuster nicht an.
Ein Klopfen an der Wohnungstür.
«Mein Frühstück. Mademoiselle Weiss ist so überaus freundlich zu mir ...»
Max Stirner erhob sich. Mit einer leichten Drehung stand er auf. Karl Schasler konnte den dicken Wulst sehen, den Stirner am Nacken trug, ein Karbunkel, das gefährlich rot war. Hastig schlang Stirner die beiden Schrippen in sich hinein, trank den dünnen Kaffee in großen Schlucken. Schasler dachte an seine Barschaft, die auf dem Tisch lag. Ob er sich nicht wenigstens einen Taler zurücknehmen sollte?
«Nur die Franzosen mochten mein Buch», sagte Stirner, nachdem er sich den Mund abgewischt hatte, «die haben mich verstanden. Einer schrieb: <Welche Schärfe, welche unzerstörbare Sicherheit. Ihn erschüttert in der gewaltigen Ideenverbindung nichts. Er hat keine Gewissenszweifel, keine Unruhe, keinen Schmerz. Seine Feder zittert nicht. Man muss das Buch gelesen haben, um überzeugt zu sein, dass es existiert>. Nur Taillandier hat mich recht verstanden.» Stirner hielt die Augen geschlossen, als er das Zitat wiedergab.
Karl Schasler fasste sich ein Herz.
«Herr Stirner, haben Sie an den Barrikadenkämpfen im Mai '48 teilgenommen? Das waren Ihre Gedanken...»
«Was soll die Frage, mein Herr?»
«Sie haben auf der Barrikade gestanden!»
«Wie komme ich dazu? Sehe ich aus wie ein Kämpfer, ein Helot? Ich saß bei Hippel damals, habe mit den anderen die Lage besprochen. Alles jubelte und schrie. Die wildesten Hoffnungen, die leidenschaftlichsten Debatten — und dann der Absturz in die trostloseste Reaktion, in der alles zerstört wurde ...»
«Aber Sie selbst?» Schasler sah den Philosophen an. «Sie haben keinen Finger gerührt?»
«Das ist nicht mein Fach», erwiderte Stirner barsch.
«Nicht Ihr Fach», wiederholte Schasler, plötzlich übellaunig. «Ich dachte, es sei ein Gerücht gewesen», beendete er das Gespräch. «Aber ich sollte Sie jetzt wieder Ihren Studien überlassen.» Stirner erhob sich und gab seinem Gast die Hand. Ein weicher, kühler Händedruck.
Als der Schuster auf der Straße stand, geriet er ins Rennen, er wollte die Avenuen und protzigen Gebäude hinter sich lassen, das aufgeblasene Berlin. Jeder ein Wichtigtuer und Großredner, aber feige Hansel, wenn's zur Tat ging. Gefährlich, dachte Schasler, gefährlich wie eine tote Mücke war dieser Lehrmeister.
Johann Caspar Schmidt, wie akkurat die Sütterlin-Buchstaben nun das geliebte Werk zierten, noch vor der Widmung für Marie Dähnhardt. Versteckt hinter einem fremden Namen. Dann fiel ihm auf, dass Stirner ihn nicht einmal nach seinem Namen gefragt hatte. Als sei er gänzlich ohne Bedeutung. Ein Herr im gesetzten Alter, mit gesetzten Worten, der nur von Niederlagen sprach, niemals vom Aufstand, vom Erheben gegen die Autoritäten. Was war sein Buch jetzt, wo er den Autor kannte? Eins stand für ihn fest: Wie dieser gelackte Herr wollte er niemals werden!
«Was machen Sie hier? Sind Sie ohne Arbeit?» Ein Schutzmann griff Schasler an der Jacke.
«Ich hab mir den Tag freigenommen. Außerdem will ich Berlin schon bald verlassen.»
«Mitkommen», sagte der Schutzmann. Er drehte Schasler den Arm auf den Rücken und pfiff Verstärkung heran. «Führen wir doch mal eine Leibesvisitation durch. Auf die Wache mit dir.» Schasler bekam den Knüppel zu spüren, direkt hinter dem Ohr. Sie legten ihn in Handschellen. Auf der Wache in der Dessauerstraße musste er sich ausziehen, splitternackt. Die Kleider wurden durchsucht. Die Börse leer, im Arbeitsbuch fehlte der Eintrag.
«Ich hab mich vergeblich um eine Anstellung bemüht», versuchte der Schuster sich herauszureden.
«Aber Bücher lesen, das kann er!» Der Revierbeamte hielt das zerfledderte Exemplar mit spitzen Fingern in die Luft. «Schuster lesen keine Bücher.» Nach einer Weile kam der Reviervorsteher.
«Wieder so ein Herumtreiber! Wir werden dich an den Ohren vor die Stadt schleifen.»
Der Untergebene, der sofort aufgesprungen war, reichte ihm das Buch.
«Auch das noch. Stirner, dieser Nichtsnutz. Den haben wir zweimal in den Schuldturm gesteckt, weil er die Gläubiger nicht zufriedenstellen konnte. Wollen Sie seine Schulden abtragen?» Mit einem gezielten Wurf landete das Buch in einem Blecheimer. Der Reviervorsteher befahl, er solle sich anziehen und dann so schnell wie möglich verschwinden.
«Wir können solches Gesindel in Berlin nicht gebrauchen. Und wenn wir dich noch mal erwischen, dann lernst du unseren Alfred kennen. Der kann mit einem Schlag drei Verletzungen zufügen. Da hast du noch kein Vaterunser zu Ende gesagt!» Der Schuster bat, das Buch zurückerstattet zu bekommen. Der Reviervorsteher lachte.
«Ein Buch will er. Prügel kann er beziehen, die gibt's gratis!»
Karl Schasler atmete tief durch, als er vor dem Revier stand. Hinter ihm hatte sich der Schutzmann aufgebaut, der ihn in Gewahrsam genommen hatte.
«Dort rüber», er zeigte nach Osten. «Dort geht's lang, ein bisschen Beeilung. Ich möchte nicht lange bitten.» Ohne Buch und Barschaft machte sich der Schuster auf den Weg, immer wieder den Gedanken verfluchend, nach Berlin getippelt zu sein. Selbst die Erinnerungen an die wilden Reden bei Hippel konnten ihn nicht überzeugen, noch länger hier zu bleiben.
Er würde Berlin meiden.
Genauso wie Hagen.
3. Kapitel: Ischia, Frühjahr 1866
Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Dunkelarrest. Wann stellte ihm der weißhaarige Wärter den Krug mit Wasser in die Zelle? Wann hörte er die Zikaden zirpen? Wann war die Ratte zwischen seinen Beinen herumgekrochen?
Er machte keinen Versuch, sich auszumalen, was die Soldaten mit ihm vorhatten. Er wusste, dass auf seine Taten die Todesstrafe stand. Die Italiener machten kurzen Prozess. Ohne Verhandlung. Von anderen Mitgliedern der Brüderschaft hatte er gehört, dass die Militärs die Aufrührer gleich am Ort erschossen. Die Leichen mussten die Bauern unter die Erde bringen. Bei seiner Festnahme wurden ihm die Augen verbunden. Er rechnete jeden Moment mit einem Genickschuss. Erst als der Friseur sein rötliches Haar von der Kopfhaut schabte, begann er wieder zu hoffen. Er konnte sich nicht vorstellen, wie er mit Glatze aussah.