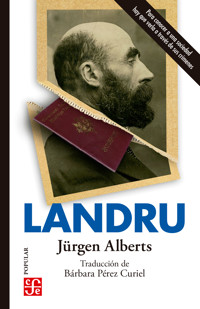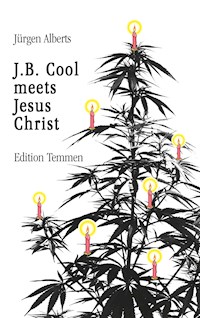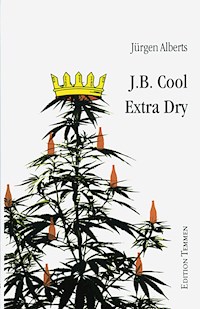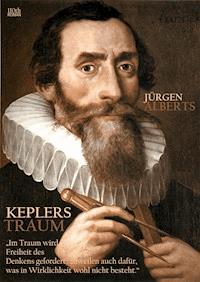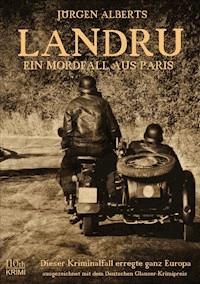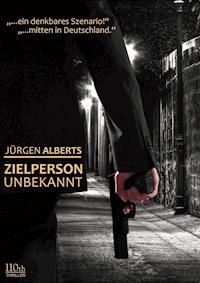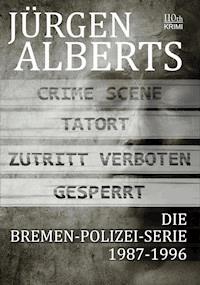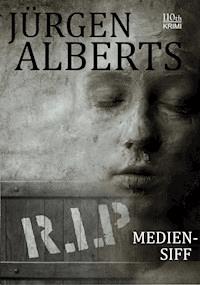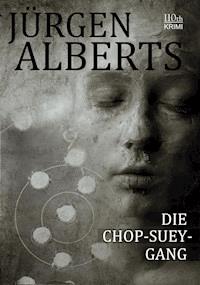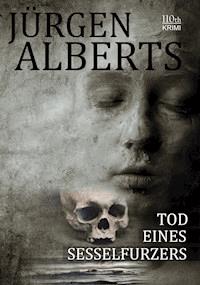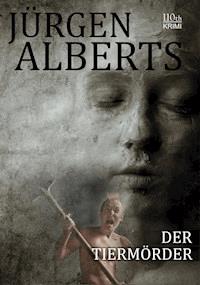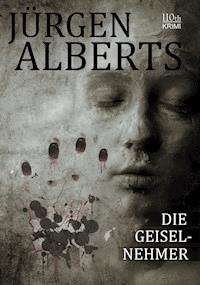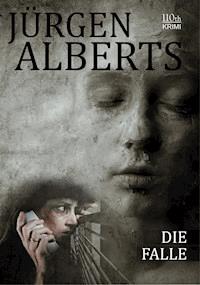Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1852 startet der norwegische Geiger Ole Bull einen utopischen Versuch: Er möchte in Pennsylvania ein neues Norwegen gründen, um seinen Landsleuten, die in schwierigen politischen und ökonomischen Bedingungen leben, eine freie Heimat zu geben. Ole Bull war, nach Niccolo Paganini, zu seiner Zeit der bekannteste Geigenvirtuose. Er trat in allen europäischen Ländern auf, improvisierte auf seinem Instrument zu klassischen und folkloristischen Melodien, hatte stets ausverkaufte Häuser. Er war so berühmt, dass das Wasser von seinem Sonntagsbad auf Fläschchen gezogen und an Verehrerinnen verkauft wurde. Zusammen mit Ibsen versuchte er, in Bergen ein Nationaltheater zu gründen, um norwegischen Künstlern und norwegischer Musiktradition zum Durchbruch zu helfen. Noch immer stand Norwegen im Schatten der übermächtigen Schweden und Dänen. (Ibsen hat später in seinem Peer Gynt einiges von der realen Figur Ole Bulls übernommen.) Dieses Projekt ließ sich im ersten Jahr gut an, wurde dann aber vom Staat nicht finanziell unterstützt. Zu dieser Zeit überlegte Bull, ob nicht die Vereinigten Staaten eine viel bessere Ausgangsbasis für seine Unternehmungen sein könne. Eine erste Tournee, zehn Jahre zuvor, war ein überwältigender Erfolg gewesen. Also ließ er ein sehr großes Areal aufkaufen, annoncierte sein "Oleana" in norwegischen Zeitungen und die ersten Siedler trafen ein, um aus dem "Urwald" eine norwegische Siedlung zu machen. Es sollten insgesamt vier Städte entstehen mit Gemeinschaftszentrum, Kirche, Gemeindewiese und Blockhäusern, wie es sie in Norwegen gab. Der Versuch scheitert kläglich. Schon anderthalb Jahre später bricht das ganze Unternehmen zusammen. Die Fahnen werden eingerollt, die Siedler ziehen enttäuscht weiter, einige haben noch genügend Geld, um nach Norwegen zurückzukehren
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÜRGEN ALBERTS
Der Violinkönig
Aus dem Leben eines Abenteurers
Roman
Impressum:
Cover: Karsten Sturm-Chichili Agency
Foto: fotolia
© 110th / Chichili Agency 2015
EPUB ISBN 978-3-95865-712-0
MOBI ISBN 978-3-95865-713-7
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur Chichili Agency reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Kurzinhalt
Im Jahre 1852 startet der norwegische Geiger Ole Bull einen utopischen Versuch: Er möchte in Pennsylvania ein neues Norwegen gründen, um seinen Landsleuten, die in schwierigen politischen und ökonomischen Bedingungen leben, eine freie Heimat zu geben.
Ole Bull war, nach Niccolo Paganini, zu seiner Zeit der bekannteste Geigenvirtuose. Er trat in allen europäischen Ländern auf, improvisierte auf seinem Instrument zu klassischen und folkloristischen Melodien, hatte stets ausverkaufte Häuser. Er war so berühmt, dass das Wasser von seinem Sonntagsbad auf Fläschchen gezogen und an Verehrerinnen verkauft wurde. Zusammen mit Ibsen versuchte er, in Bergen ein Nationaltheater zu gründen, um norwegischen Künstlern und norwegischer Musiktradition zum Durchbruch zu helfen. Noch immer stand Norwegen im Schatten der übermächtigen Schweden und Dänen. (Ibsen hat später in seinem Peer Gynt einiges von der realen Figur Ole Bulls übernommen.) Dieses Projekt ließ sich im ersten Jahr gut an, wurde dann aber vom Staat nicht finanziell unterstützt. Zu dieser Zeit überlegte Bull, ob nicht die Vereinigten Staaten eine viel bessere Ausgangsbasis für seine Unternehmungen sein könne. Eine erste Tournee, zehn Jahre zuvor, war ein überwältigender Erfolg gewesen. Also ließ er ein sehr großes Areal aufkaufen, annoncierte sein “Oleana” in norwegischen Zeitungen und die ersten Siedler trafen ein, um aus dem “Urwald” eine norwegische Siedlung zu machen. Es sollten insgesamt vier Städte entstehen mit Gemeinschaftszentrum, Kirche, Gemeindewiese und Blockhäusern, wie es sie in Norwegen gab.
Der Versuch scheitert kläglich. Schon anderthalb Jahre später bricht das ganze Unternehmen zusammen. Die Fahnen werden eingerollt, die Siedler ziehen enttäuscht weiter, einige haben noch genügend Geld, um nach Norwegen zurückzukehren
Der Autor
Jürgen Alberts studierte nach dem Abitur (1966) in Tübingen und Bremen Germanistik, Politik und Geschichte und promovierte 1973 am Fachbereich Kommunikation und Ästhetik der Bremer Universität zum Thema "Massenpresse als Ideologiefabrik am Beispiel BILD".
Er arbeitete als freier Mitarbeiter für den WDR und das ZDF und lebt heute als Schriftsteller in Bremen. Er schrieb Drehbücher, Hörspiele und 1969 den Roman NOKASCH U.A. sowie 1980 DIE ZWEI LEBEN DER MARIA BEHRENS, bevor er sich auch mit Kriminalgeschichten zu beschäftigen begann.
Gemeinsam mit Fritz Nutzke (Pseudonym für Sven Kuntze) veröffentlichte er 1984 den mit Science-Fiction Elementen durchsetzten Kriminalthriller DIE GEHIRNSTATION und ein Jahr darauf als Alleinautor die Fortsetzung DIE ENTDECKUNG DER GEHIRNSTATION.
Nach dem Roman TOD IN DER ALGARVE (gemeinsam mit Marita Kipping) schrieb Alberts den Polizeiroman DAS KAMERADENSCHWEIN, in dem es um den Fall eines Bremer Kommissars geht, der sich gegen die Weisungen seiner Kollegen als Nestbeschmutzer betätigt, weil er hartnäckig in einem Fall von Polizeigewalt gegen einen Verdächtigen ermittelt.
In seinen weiteren Romanen DER SPITZEL, DIE CHOP-SUEY-GANG und DIE FALLE befasste sich Alberts in den darauffolgenden Jahren immer eingehender mit dem Innenleben der Bremer Polizei und ihrer Führung, bis schließlich mit KRIMINELLE VEREINIGUNG 1996 der zehnte Roman der später so bezeichneten Serie "Bremen Polizei" vorlag.
1987 veröffentlichte Alberts den semi-dokumentarischen Roman LANDRU, in dem es um mögliche politische Hintergründe zum Fall des französischen Frauenmörders Henri Desire Landru (1869 - 1922) geht, der zu Beginn dieses Jahrhunderts wegen Mordes an zehn Frauen verurteilt und hingerichtet wurde.
1988 erschien Jürgen Alberts' Kriminalroman ENTFÜHRT IN DER TOSKANA, den er gemeinsam mit Marita Alberts schrieb, ebenfalls mit seiner Frau schrieb er den Griechenland-Krimi GESTRANDET AUF PATROS.
Von 1990 bis 1991 und von 2001 bis 2005 war Jürgen Alberts einer der Sprecher der "Autorengruppe deutsche Kriminalliteratur DAS SYNDIKAT"
Preise:
1988 Glauser - Autorenpreis deutsche Kriminalliteratur für "Landru"
1990 CIVIS-Preis des WDR und der Freudenbergstiftung für "Eingemauert"
1994 Deutscher Krimi Preis für "Tod eines Sesselfurzers"
1997 Marlowe Preis der Deutschen Raymond Chandler-Gesellschaft für "Der große Schlaf des J.B. Cool"
I had a very pleasant little party-kin last night
at Cambridge at Longfellow's, where there
was a mad-cap fiddler, Ole Bull, who
played most wonderfully on his instrument,
and charmed me still more by his oddities and
character. Quite a figure for a book.
William Makepeace Thackeray
Weil du zum Ruhm für unser Land wurdest - so wie kein anderer,
weil du unser Volk mit dir zu den Höhen der Kunst erhobst,
weil du ein Vorkämpfer für unsere nationale Musik wurdest;
treu, warmherzig, herzerobernd - so wie kein anderer,
weil du eine Saat gesät hast, die in Zukunft keimen wird,
und wofür kommende Geschlechter dich segnen werden.
Mit tausend und aber tausend Dank für alles dies
lege ich im Namen der norwegischen Tonkunst
diesen Lorbeerkranz auf deinen Sarg nieder.
Friede sei mit dir!
Eduard Grieg
Inhaltsverzeichnis
Präludium
1. Molto presto
2. Allegro con fuoco
3. Andante vivace
4. Allegretto
5. Furioso
6. C-Dur
7. Andantino
8. Allegro giusto
9. Adagio passionato
10. Burlando
11. Scherzo magnifico
12. G-Dur
13. Avvivando
14. Erstes Intermezzo
15. Accelerando
16. Squillando
17. Frettando
18. D-Dur
19. Rivoltato
20. Ritmico
21. Raccontando
22. Saldo ma scordato
23. Festivo
24 .d-Moll
25. Sognand
26. Allegro maestoso
27. Zweites Intermezzo
28. Inquieto
29. Fiasco sforzato
3o. a-Moll
31. Fiacco
32. Ritorno al primo tempo
33. e-Moll/E-Dur
34. Postludium / Da capo al fine
Glossar
Lebensdaten von Ole Bull
Danksagung
Präludium
Casamicciola, Sommer 1867. Mit leichtem Kopf verließ Henrik Ibsen die Villa Pisani, in der er sich und seine Familie einquartiert hatte. Er pfiff ein Liedchen, einem neapolitanischen Gassenhauer ganz verwandt. Was für ein Fund, welche Kraft! Die nächtliche Lektüre der Norske Eventyr og Folkesagn, vom Teufelsritt auf einem Rentierschädel, fulminant. Hoch über den Fjorden der Jäger Gudbrand Glesne, der glaubt, den enormen Bock mit einem einzigen Schuss erlegt zu haben. Und gerade als er sein Messer zieht, den Halswirbel zu durchtrennen, richtet das Tier sich auf und springt davon - seinen Widersacher zwischen den Hörnern. Ein wilder Ritt hinauf im Sturmgebraus, über Gletscher und Moränen, hinab in grüne Schluchten. Gudbrand glaubt, Sonne und Mond niemals mehr erblicken zu dürfen. Wüste Flüche, Stoßgebete. Da stürzt sich das Rentier ins Wasser, reißende Fluten, und trägt den Jäger hinüber. Als sie am Ufer angekommen, packt Gudbrand beherzt das Messer und heftet es dem Tier in den Nacken.
Ibsen stoppte vor dem Eingang des Hotels Bristol Palace.
Erstarrte.
Das war doch Vilhelm Bergsøe.
Was verschlug den auf Ischia?
»Sind Sie das, Ibsen?«
»Hab' Ihren neuen Roman gelesen, Bergsøe, handelt von Gegenwärtigem. So etwas müssen wir jetzt schreiben. Schluss mit dem romantischen Gefasel!«
»Ach, Sie kennen den Verriss schon?«, fragte Bergsøe, »der wird meinem Buch Schaden zufügen, ganz gewiss. Clemens Petersen hat meinen Roman in Grund und Boden verdammt.«
»Unsinn, niemals«, Ibsen wurde heftig, »wenn einem so ein langer und bösartiger Verriss ins Haus kommt, wird das Widersacher aufbringen und Aufmerksamkeit erheischen. In welchem Lokal verkehren Sie für gewöhnlich?«
»Ich bin ziemlich mickrig im Moment und bleibe lieber im Hotel und trinke Tee.«
»So werden Sie nie gesund, Bergsøe. Auf diese Weise wird man nur ein ganz gewöhnlicher Misanthrop. Lassen Sie uns zum Buffalo gehen, ein paar Gläser rosso darauf trinken, dass wir eines Tages diese Petersens bei weitem überflügeln werden.«
So gingen die beiden Dichter, Seite an Seite.
Der kleine, etwas staksige Henrik Ibsen, mit schwarzem Haar und schwarzem Backenbart, funkelndem Blick, angetan mit einer Seemannsjoppe und einem gestickten römischen Schal. Und der hoch aufgeschossene Vilhelm Bergsøe in feinem englischen Cut, mit weiß-silbrigem Plastron, Spazierstock und graufarbenem Zylinder.
»Wann kehren Sie zurück, Herr Ibsen, wenn Sie mir diese Frage gestatten?«
»Nach Christiana? So bald nicht. Ich finde in Italien, was ich zum Schreiben brauche. Widerständiges, starke Gerüche, aufmüpfige Gedanken.«
Das Buffalo war um diese Uhrzeit noch nicht sehr frequentiert. Sie bestellten ein foglietto vino rosso. Zwei müde Kellner wuschen Gläser, ein Hund räkelte sich in der ersten Sonne.
»Sind wir auf Ischia vor Erdbeben sicher?«, fragte Bergsøe und hüstelte ein wenig.
»Ich bräuchte ein Erdbeben, damit ich endlich zu schreiben beginne. Die ganze Nacht hab' ich in Asbjørnsens Abenteuersagen gelesen. Stoffe voller Kraft. Schon vom Jäger Gudbrand Glesne gehört, den ein Rentier aufs Horn nahm? Oder von diesem Peer Gynt aus Kvam, der dem großen Krummen widersteht, die Trolle austreibt und eigenhändig den Bären fällt? Prosit!«
»Kein Heimweh in den Norden, Herr Ibsen. Selbst nicht nach solcher Lektüre?«
Ibsen leerte sein Glas in einem Zug, bevor er antwortete. Rotwein hatte auch am Morgen schon belebende Wirkung.
»Diese unbeschreibliche Langeweile dort, das sorgsam Bescheidene, die wütige Tüchtigkeit der Spießer. Nein, Bergsee, das lass' ich hinter mir. Es ist das Verdammte an unseren kleinen Verhältnissen, dass sie die Seelen so klein machen. So verzagt, in sich gekehrt, frömmelnd.« Er blinzelte zu seinem Kollegen hinüber, dem diese Worte nicht zu behagen schienen.
»Die Hohlheit hinter all den selbstfabrizierten Lügen, unser sogenanntes öffentliches Leben, die jämmerliche Phrasendrescherei, selbstzufrieden, Lauheit des Blutes, musterhafte Einförmigkeit und dazu noch einen Korporal als König...« Neuerlich hielt Ibsen inne, wartete auf eine heftige Replik. Bergsøe blieb aufgeregt, stumm.
»Um Worte sind die unseren nie verlegen, reden gerne über große Sachen, aber wenn's ans Handeln geht, nichts. Nur Schlaffheiten, Brei, als flösse Sirup in ihren Adern. Unserem Norwegen fehlt ein Aufstand, es fehlt die große Unruhe ob all der Lügen und Ungerechtigkeiten... Ich dagegen fühle mich wie ein junger Hengst. Wenn ich bloß mit dem Schreiben beginnen könnte.«
Dann kam die Rede auf Freunde und Feinde, Pastoren und Pack, Gönner und Neider. Der Sogne-Fjord im Abendlicht. Bergen, die Stadt im Zauber. Der Blick vom Fløyen über Hafen und Markt. Ibsen erzählte von Arne, den sein Dichterfreund Bjørnsjerne Bjørnson als naiv romantischen Helden herausgeputzt hatte.
»Einmal geht Arne zum Pfarrer und sagt, er wolle heiraten. Und zwar die Witwe Elly. Aber die ist doch schon siebzig, ruft der Pfarrer entsetzt. Gleichwohl, erwidert Arne gelassen, sie besitzt eine Kuh!« Bergsøe kannte die Geschichte, aber ließ sich nichts anmerken. Er hatte schon davon gehört, dass Ibsen spätestens nach dem dritten Glas Wein diese »wahre Geschichte« zum Besten gab. Mit jedem Schluck kam Norwegen näher.
Ibsens Lehrjahre am Bergener Theater, er war zu arm, um zu heiraten, seine häufigen Anfragen an das Storting nach einem Stipendium für Schriftsteller, die Rückschlage bei seinen jährlichen Stücken, das erste Ensemble, mit dem er bei seinen Inszenierungen arbeiten mußte.
Ibsen sagte hochvergnügt: »Jeder, der eine Note singen konnte, trat an die Rampe. Ein Stotterer wollte ein Gedicht aufsagen, ein Greis den klassischen Liebhaber geben und eine Scharteke unbedingt die strahlende Geliebte spielen. Wir kamen aus dem Gelächter nicht mehr heraus. Auch die alte Tante von Lorentz Dietrichson bewarb sich und wurde prompt akzeptiert, obwohl ihr ein Vorderzahn fehlte und sie nur Zischlaute hervorbringen konnte. Die Direktion war jedoch großzügig und spendierte ihr einen künstlichen Zahn. Doch als ihr Engagement zu Ende war, musste sie ihn wieder hergeben.«
»Da war Ole eisern«, lallte Bergsøe, der bereits erheblich über sein Maß getrunken hatte. »Er warf stets mit dem Geld um sich, aber wenn etwas einzusparen war...«
In diesem Augenblick tauchte ein Bild vor Ibsen auf: Ole, sein Gönner, Ole Bull, der Aufschneider, Lügenbaron, der Geiger, der Violinkönig Ole Bull. War der nicht dem sagenhaften Peer Gynt verwandt? Dem Fabelhans und Lügenschmied, von dem er letzte Nacht gelesen hatte. Der eine braucht Branntwein, der andere braucht Lügen.
Vilhelm Bergsøe ließ seinen Kopf auf die Brust fallen und schlief unversehens ein. Ein leichtes Schnarchen war zu vernehmen. Henrik Ibsen erhob sich, nur wenig schwankend. Bull und Gynt, Modell und Fabel, Geschichtenerzähler und Garnspinner, Peer und Ole.
Beginnen müsste es damit, dass Peer seiner Mutter erzählt, wie er auf dem mächtigen Rentierbock geritten ist, hinauf und hinab, in wildem Ritt über Gletscher und durch die Fluten des reißenden Bergbaches...
»Sie müssen zahlen, Signore Ibsen. Er kann es nicht.«
Abwesend klaubte Ibsen ein paar Münzen aus der Hosentasche und gab sie dem Kellner, der sich mit einem tiefen Bückling verabschiedete.
»Bis morgen, Signore Ibsen!«
Er warf dem schnurgelnden Bergsøe einen letzten Blick zu, dann eilte er davon.
Noch bevor er die Villa Pisani erreicht hatte, fiel ihm der erste Satz für die erste Szene ein: »Peer, du lügst!«
1. Molto presto
Fru Grevle stemmte sich von innen gegen die Haustür, presste ihren schmächtigen Körper mit aller Kraft gegen das Holz, zog mit der rechten Hand einen Stuhl herbei und klemmte die Lehne unter die Türklinke. Sie hasste diese nächtlichen Belästigungen, immerhin war es bereits zwei Uhr in der Früh und vor ihrem Haus standen ein paar tausend Bergener Bürger, die keine Anstalten machten abzuziehen.
Verrückte, tullingene, Holzköpfe, treskallene.
Sie schimpfte, fluchte vor sich hin, stieß bittere Verwünschungen aus, übertönt von den wilden Schreien, die von draußen hereinschallten. Fru Grevle richtete ihren Blick nach oben, hinauf zum ersten Stock.
Eine Fensterscheibe klirrte. Hoffentlich im Nebenhaus, dachte sie.
Es gab nur einen Menschen in ihrer Heimatstadt, der eine derartige Anziehungskraft besaß, und der musste ausgerechnet bei ihr zur Untermiete wohnen. Hätte sie das alles zuvor gewusst, als er ihr seine Aufwartung machte und für ein paar Wochen um Logis nachsuchte. Ihm ging ein gewisser Ruf voraus, das schon, aber dieses Durcheinander. Nacht für Nacht. Diese wilde Toberei. Und dann auch noch das Gerede am nächsten Morgen. Die spöttelnden Nachbarn, die ihre Zunge nicht im Zaum halten konnten. Die bösen Blicke, die gierigen Schandmäuler. Waren doch bloß neidisch auf sie und ihren illustren Gast. Jeder von denen hätte ihn gerne bei sich aufgenommen, jeder, da war sie sich ganz sicher, und auch ohne je eine Bezahlung dafür anzunehmen.
Zugleich liebte Fru Grevle diesen Untermieter über alle Maßen. Wie man im Leben nur einmal einen einzigen Menschen lieben konnte. Sie war seinem Anblick verfallen. Hoch aufgeschossen, breitschultrig, feingliedrige Hände. Das Blau seiner Augen hatte sie zu immer neuen Vergleichen herausgefordert: saphirblau, eisvogelblau, sphärenblau. Sie konnte sich nicht entscheiden. Als sei er einem Gemälde von Tidemand oder Gude entsprungen. Nach wenigen Stunden Schlaf stand er auf, nahm hastig im Stehen sein Frühstück und machte ihr einige schamlose Komplimente. Fru Grevle zählte bereits über 6o Jahre. Wenn sie ihm die Haare wusch, bevor er zu seinem abendlichen Auftritt eilte, drückte er ihr jedes Mal als Dank einen zaghaften Kuss auf den Mund. Immerhin war es ihr in den letzten Wochen gelungen, die kreischenden Frauen abzuweisen, die an der Türe forderten, sein Badewasser geschenkt zu bekommen. Manche von ihnen hatten Flaschen, Vasen und Kochtöpfe für diesen Zweck mit-gebracht. Er erzählte ihr von seinen Reisen in Länder, deren Namen sie noch nie gehört hatte, berichtete von seinen überaus glänzenden Auftritten und ließ sie an märchenhaften Erlebnissen teilhaben, die alles in den Schatten stellten, was sie bislang vernommen hatte, die norwegischen Sagen- und Abenteuersammlungen eingeschlossen. Und wenn er sich dann plötzlich in der Küche von ihr verabschiedete, ohne jemals zu vergessen, ihr einen letzten Kuss über den Handrücken zuzuhauchen, war sie stets aufs Neue in ihn verliebt. Nicht mal 4o Jahre war dieser Mann, den ihr eine wundersame Fee ins Haus geführt haben musste.
Draußen wurden die Rufe wieder lauter. Sie skandierten seinen Namen, wie jede Nacht. Unaufhörlich, begleitet von rhythmischem Klatschen. Fru Grevle wusste, dass es nur ein Mittel gab, die aufgebrachte Menge zu beruhigen, aber sie wollte dies von ihrem geliebten Untermieter nicht einfordern. Sie wusste, dass er im abgedunkelten Zimmer im Obergeschoß saß und weinte. Vor Glück. Vor Erschöpfung. Vor Freude. Vor Angst.
An diesem Abend hatte er ein Konzert unter freiem Himmel gegeben, vor über 10 000 Zuhörern bei freiem Eintritt. Er spielte seine neuen Kompositionen, die er in Amerika und Frankreich, Italien und Russland schon so oft erprobt hatte, spielte norwegische Volkslieder, einfache, eindringliche, einsame Weisen in Moll, spielte, bis er keine Kraft mehr in den Armen hatte. Tosender Applaus. Beifallsstürme. Er verbeugte sich wieder und wieder, rang vornübergebeugt nach Luft, um wieder aufrecht vor seinem Publikum stehen zu können, winkte mit Geige und Bogen seinen Zuhörern zu, um einen erneuten Applaussturm zu ernten. Es wollte einfach kein Ende nehmen. Manchmal waren es zehn Zugaben, manchmal zwanzig. Er war so erschöpft, dass er oftmals hinter der Bühne zu Boden stürzte und nach Luft schnappte. Sein Herz raste im Eiltempo eines wirbelnden Tanzes. In seinem Kopf Nachbilder aus hundert vergangenen Konzerten zugleich. Bis irgendjemand kam und sagte, die ersten Zuhörer würden abziehen, das Konzert sei wohl vorbei. Wenn er wieder auf den Beinen stehen konnte und manchmal noch gestützt von einem Freund hinaustrat, sah er die
Menge, die umgehend in einen neuen Jubelsturm ausbrach. Wieder und wieder riefen sie seinen Namen. Als sei er ein Gott, ihr Gott, als würden sie den Heiland in ihm sehen, den Erlöser, den Wundermann, der all ihre Sorgen kannte und all ihre Wunden heilen konnte, der sie tröstete und hoffen ließ, dem sie alles zu opfern bereit waren, nur damit er sie ihre Leiden und Alltagsnöte für ein paar Stunden vergessen ließ.
Jeden Abend nach dem Konzert führten sie ihn im Triumphzug durch die dunkle Stadt Bergen, durch Straßen. und Gassen, hügelan bis zu dem Haus von Fru Grevle, die ihn stets wie ihren Sohn an der Haustür in Empfang nahm Mit staksigen Schritten erklomm er die Treppe, nicht ohne seiner Vermieterin einen kurzen, liebevollen Blick zugeworfen zu haben, mit beiden Händen zog er sich mühsam am Holzgeländer nach oben. Manches Mal stöhnte er leise dabei. Sein desolater Zustand gab Fru Grevle stets einen Stich ins Herz.
Kaum war die Menge vor dem Haus angeschwollen, ging das Spektakel los. Wenn doch wenigstens die Polizei kommen würde und die Verrückten auseinandertriebe, dachte Fru Grevle, die Polizisten sollten alle inhaftieren und ein paar Stunden in die Zellen sperren, damit sie wie-der zur Vernunft kämen. Sosehr sich auch alles in ihr da-gegen sträubte, sie musste ihn bitten, doch noch mal ans Fenster zu treten. Nur wenn er sich der Menge zeigte, würden sie in dieser Nacht ein wenig Ruhe finden können. Es gab keine andere Möglichkeit. Fru Grevle versicherte sich, dass der Lehnstuhl fest unter der Türklinke eingeklemmt war, den Schlüssel hatte sie vor Jahren schon verloren, und trat den Weg ins obere Geschoß an. Die Holztreppe knarrte bei jedem Schritt.
Ihr geliebter Künstler lag hingestreckt auf dem Fußboden. Sein langes, blondes Haar verwirbelt, in feuchten Strähnen, die weißsilbrige Fliege verrutscht, der Kummerbund abgeknöpft, die schwarzlackierten Schuhe weit von sich geschleudert. Nur die Geigenkästen waren ordentlich nebeneinander gestapelt.
»Ole, Ole«, sagte sie leise, »es hört nicht auf.« Keine Regung.
Nichts. Er lag da, ohne sich im Mindesten zu rühren. Als habe ihm jemand den ganzen Lebenssaft herausgesogen. Draußen schwollen die Rufe weiter an. Wie Wellen, die ans Gestein schlugen. Hohe, furchterregende Wellen, die irgendwann den Fels besiegten. Am liebsten wäre Fru Grevle ans Fenster gegangen und hätte die Verrückten an-gebrüllt, hätte ihnen zugerufen, dass sie ihren Ole in den Wahnsinn treiben würden, dass sie ihn umbringen... aber was hätte es genützt?
»Ole«, sie kam ganz dicht an sein Ohr, »Ole, du musst noch einmal aufstehen, sonst...«
Sie hörte, wie ungleichmäßig sein Atem ging. Stoßweise. Ruckend.
Ohne jeden Rhythmus.
Mal ganz flach und kurz.
Dann wieder lang und aufstöhnend.
Fru Grevle sah die Spur der Tränen, die über seine Wangen geflossen waren.
»Ole, ich helfe dir auf. Es wird bestimmt nicht lange dauern, aber einmal musst du dich noch zeigen.«
»Ich komme, warten Sie nur ein bisschen, bitte«, seine Stimme war so rau, dass Fru Grevle heftig erschrak. »Lassen Sie mich einen Augenblick ruhen.« Mit festem Schritt ging Fru Grevle ans Fenster. Öffnete es. Für einen kurzen Augenblick wurde es vor ihrem Haus ein wenig stiller.
»Ole wird gleich erscheinen. Er macht sich etwas frisch und trinkt ein Glas Bier.«
Ihr Blick ging hinüber zu den Häusern am Park. In den meisten war ein Lichtschein zu entdecken. Manche Bewohner standen in ihren Türeingängen. Fru Grevle wusste, was sie am nächsten Morgen auszustehen hatte.
Kurz darauf ging ein zweites Fenster auf.
Ole Bull.
Die Haare gebürstet, seine hellen Locken fielen wellig auf die Schulter, die Fliege frisch gebunden, der Frack glatt gestrichen. Seine hohe Gestalt ohne jegliche Verkrümmung. Aufrecht wie ein Baumstamm
Unter sich sah er tausende Gesichter, Rosen auf einem See, Kiesel an einem Strand, Augen aus Stein und auf hölzernen Stämmen. Wie sie ihn anstarrten. Wie sie ihn stärkten. Er nahm die Geige hoch, blieb eine kurze Weile ohne jede Regung stehen. Die Menge war augenblicklich ganz still geworden, angespannt, erwartend. Kein Mucks mehr, keine Rufe. Nur noch Stille in den Gassen. Fru Grevle liebte diesen Moment, diesen unwiederbringlichen Moment der Ruhe, bevor Ole seine Violine zum Klingen brachte. Ein ausgesprochen prickelnder Augenblick, kurz vor dem Ausbruch, dem überwältigenden Spiel seiner wunderbaren Violine. Er strich so sanft über seine Guarneri, als führe seine Hand mit weit gespreizten Fingern durch ihr Haar.
In dieser frühen Morgenstunde intonierte Ole sein »Sæterjentens Søndag«, eine Komposition, die er vor ein paar Monaten in Christiana zum ersten Mal vorgetragen hatte. Sie war auch in Bergen schon so populär, dass viele seiner Zuhörer mitsummten. Das Lied erzählt die Geschichte einer Schafhirtin, die auf der hochgelegenen Weide die Glocken im Tal vernimmt. Jetzt weiß sie, dass ihr Geliebter bald zur Kirche eilen wird. Sie wird einsam bei ihrer Schafherde in den Bergen bleiben. Fremd, traurig, verloren.
Der Applaus, der einsetzte, war so laut, dass auch in den letzten Wohnungen die Öllampen angingen. Wütende Proteste kamen aus einigen Häusern, man wolle endlich seine Ruhe haben, aber die Menge zischte die Protestierenden aus.
Ole Bull hob plötzlich seine Hand, als wolle er noch eine Zugabe spielen.
»Liebe Bergener!« rief er mit fester Stimme.
Fru Grevle war erstaunt, mit welcher Kraft er nun wieder sprechen konnte. Wie anders hatte seine Stimme vor wenigen Minuten geklungen. Ole Bull sprach von seinem geliebten Norwegen, der Heimat seiner Seele, sprach davon, dass er an fremdländischen Zollstationen auf die Frage, wer er sei, sage, er heiße Ole Olsen, ein norwegischer Norweger aus Norwegen.
Großes Gelächter erhob sich.
Ole Bull sprach davon, dass er in Paris während der Februarrevolution den Premierminister Alphonse Lamartine mit der norwegischen Fahne aufgesucht habe, um in den Gesang der Freiheit einzustimmen. Wohlgemerkt mit der norwegischen Fahne, der einzigen, rot und weiß und blau gekreuzten, ohne das verhasste Blaugelb der Schweden, das die seit 1814 gemeinsame Fahne verunziere.
Ole Bull sprach von Bergen, der schönsten Stadt der Welt. Ungeheuerlicher Applaus. Er habe schon viele Kontinente bereist, Städte gesehen, viel größere Städte, viel reichere Städte, aber nichts ähnele Bergen, der Stadt auf den sieben Hügeln. Ole Bull sprach davon, dass er mit dem festen Willen nach Bergen gekommen sei, ein norwegisches Nationaltheater zu gründen. Schluss mit der dänischen Vorherrschaft auf dem Theater. Die 400jährige Nacht der dänischen Bevormundung müsse endlich zu Ende gehen.
Langanhaltendes Pfeifkonzert.
Ole Bull hob wieder die Hand, um sich Gehör zu verschaffen Bergen sei die richtige Stadt für dieses Theater, nur in Bergen könne sein Plan gelingen. Die Hauptstadt Christiana habe ja sogar schon ihren eigenen Namen Oslo der fremden Herrschaft geopfert. Neuerliches Gelächter, vereinzelte Rufe. Ole Bull endete mit den Worten: »Wer genug Liebe zu seinem eigenen Land verspürt, dem gelingt alles, was er zu dessen Fortkommen beginnt.«
Seine Stimme war wie das Spiel seiner Geige über die Köpfe seiner Zuhörer weit hinweggeglitten. Nach einem kurzen Augenblick der Stille erschollen Rufe.
»Lang lebe Ole Bull!«
»Lang lebe das alte Bergen!«
»Lang lebe unser geliebtes Norwegen!«
Langsam ging die Menge auseinander, verlief sich in den dunklen Gassen der Stadt. Von überall Echos der Begeisterung, zustimmende Gesänge. Am nächsten Morgen erschien in den Bergener Zeitungen folgende Mitteilung:
Norwegisches Theater in Bergen
Diejenigen Männer und Frauen, die Singen, Musizieren, Schauspielern oder Aufführen unserer nationalen Tänze zu ihrem Beruf erwählt haben, können ein Engagement erhalten. Originäre dramatische und musikalische Werke werden angenommen und den Sätzen entsprechend honoriert. Richten Sie Ihre Bewerbung umgehend an das Norwegische Theater in Bergen.
25. Juli 1849 - Ole Bull
2. Allegro con fuoco
Jacob war ein Träumer, ein leichtlebiger Tänzer. Wann immer er auf einem Fest in Bergen erschien, ganz gleich, ob er eingeladen war oder nicht, meistens war er nicht geladen, brachte er umgehend die Gäste dazu, ein Tänzchen zu wagen. In Windeseile ließ er die Sessel beiseiteschieben, den Teppich, sofern vorhanden, aufrollen und forderte zumeist die Frau des Gastgebers auf, mit ihm zu tanzen. Häufig hatte er einen Musiker an seiner Seite, der gegen ein geringes Entgelt aufspielte. Ab und zu fielen auch für ihn ein paar Specietaler ab.
Die Tage verschlief Jacob gerne. Er träumte von Männern, mit denen er gelegentlich verstohlen tanzte, er träumte von den wasserhellen Seen, in denen sie heimlich nackt badeten.
Am späten Nachmittag wachte er auf, trank gierig Wasser aus einem großen Regenfass und rieb sich die Augen. Gegen Abend hatte Jacob sein Äußeres wieder so hergestellt, dass er ausgehen konnte. Ein stolzer Herr mit einem hohen Hut. Seine beste Kledage, einen Berliner Frack mit allem Zick und Zack, hielt er sorgsam in Ordnung. Ohne diese überaus kostbare Ausstattung hätte er sein Gewerbe nicht betreiben können. Er wäre nirgends eingelassen worden.
Seine Behausung in der Vaskerelvsgaten war derart bescheiden, dass er keinen seiner männlichen Freunde zu sich nach Hause bat. Zwischen zwei schmalen Holzhäusern stand sein überdachtes Zimmerchen. Wenn Jacob jedoch auf die steinige Straße trat, musste jeder den Eindruck gewinnen, es handele sich um einen hochgestellten und vermögenden Herrn.
Das meiste Geld verdiente er am Wochenende auf den ländlichen Volksfesten, wenn er in seiner traditionellen Tracht elegant den Tanz anführte, die Mädchen herumschwang und die ältlichen Frauen becircte, die kecken Bäuerinnen an sich drückte und den staksigen Arztwitwen ins Hinterteil kniff. Die meisten steckten ihm etwas zu, manche flüsterten ihm Ungenierliches ins Ohr, wieder andere griffen ihm ohne Zögern zwischen die Beine. Er hielt sie alle an einer langen Leine. Seine eigentliche Leidenschaft galt Genüssen, von denen niemand jemals auch nur das Geringste erfahren durfte. Es hätte Gefängnis für ihn bedeutet.
Als Jacob von Ole Bull den Auftrag erhielt, den Møllerguten aus Haukelid zu holen, weil er mit ihm zusammen im Theater aufspiele wolle, war der Tänzer hocherfreut.
Ganz gleich in welches Städtchen, welches Dorf oder zu welchem Weiler Jacob auf seinem langen Weg durch schneeverwehte Berglandschaften kam, überall erzählte er, dass der wilde Geiger, dessen richtiger Name Thorgeir Augundson war, zusammen mit Ole Bull in Bergen auftreten werde. Das Gerücht von diesem außerordentlichen Zusammentreffen zweier Könige lief schneller über die Berge, als Jacob, der manchmal gerne eine Rast auf einer Hütte einlegte, vorankam. So geschah es auch, dass Thor-geirs Frau bereits von Ole Bulls Wunsch erfahren hatte. Als Jacob ihr Haus in Haukelid betrat, stand das Reisebündel fertig gepackt neben der Tür.
»Und wo ist der Møllerguten?«, fragte Jacob erschöpft von der überaus anstrengenden Reise. Die kleingewachsene Frau verdrehte bei seinem Anblick die Augen.
»Er kommt«, antwortete sie, »er kommt, wenn er es für richtig hält!« Ihr Stimmchen war kläglich und sehr leise. Sie bewirtete Jacob mit getrocknetem Fleisch, heißen Kartoffeln und selbstgebranntem Waldbeerenschnaps. Unablässig schaute sie den Fremden aus der großen Stadt an. Sobald er einnickte, berührte sie ihn an der Hand.
»Hier bin ich«, sagte Thorgeir mit polternder Stimme, als er in die Wohnstube trat, »ich geh jetzt schlafen. Wir starten morgen ganz früh. Sei bereit, mein Freund!« Er verschwand in der Schlafkammer, ohne sich einmal umzudrehen. Jacob vergewisserte sich wiederholt, dass es sich bei dem Männlein tatsächlich um den wilden Geiger handelte.
In dieser Nacht bekam Jacob kein Auge zu. Er durfte den Aufbruch des Geigers nicht verpassen. Møllerguten hatte einen legendären Ruf. Wenn er aufspielte, gab es kein Halten mehr, alle Dämme brachen, Fluten stürzten talabwärts, Eisschollen sprengten auf, ein ungeheuerliches Sturmgebraus. Die Wildheit der Natur-gewalten zu überbieten, war Møllergutens erklärte Absicht. Ole Bull hatte schon vor etlichen Jahren Thorgeir Augundson kennengelernt, mit ihm gemeinsam musiziert und viel von seinem Spiel abgeschaut. Die Hardanger-Fiedel, auf der Thorgeir spielte, war das Vorbild für Bulls eigene Konstruktionen geworden. Er ließ den Steg all seiner Violinen wesentlich flacher legen, so dass er bis zu vier Töne gleichzeitig spielen konnte. »Quartett für eine Violine« war eines seiner Bravourstückchen, die in aller Welt immer wieder Applausstürme hervorriefen. Bull benutzte sehr dünne Saiten. Auch die Verlängerung des Geigenbogens auf mehr als einen Meter ging auf die Hardanger-Fiedel zurück. Lange vor Sonnenaufgang verließen Jacob und Thorgeir das tiefverschneite Haukelid. Wo sie auch hinkamen, sie wurden schon erwartet. Hochrufe. Beifall für die eiligen Künstler.
Einige Tage später erreichten sie Bergen, gerade noch rechtzeitig, um am Abend das erste Konzert zu geben. Bull und Møllerguten umarmten sich lange. Der wilde Geiger musste sich auf die Zehenspitzen stellen, während der Violinkönig sich tief zu ihm hinunterbeugte.
»Wir sollten ein wenig zusammen probieren«, sagte Bull.
»Was denn?«, wollte Thorgeir wissen.
»Wenn wir zusammen spielen, sollten wir uns doch wenigstens miteinander abstimmen.«
»Nicht nötig«, erwiderte Thorgeir, »wenn du spielst, höre ich schon, wie die Melodie geht - und wenn ich spiele, dann wirst du es ebenso können. Ich geh' jetzt schlafen. Bleibt ja nicht mehr viel Zeit bis zum Auftritt. Und sag dem Jacob, er soll ein paar Tänzer organisieren. Die werden wir heute durch die Hölle schicken.« Møllerguten lachte so laut, dass Ole Bull erschrak.
Am Abend war das Theater bis auf den letzten Platz gefüllt.
Ole Bull hatte eine Heizung installieren lassen, denn die Zuhörer kamen in der kalten Jahreszeit in dicken Wollmänteln, die absonderliche Gerüche ausströmten. Nach den Vorstellungen musste häufig die ganze Nacht gelüftet werden. Ole wies den Theaterheizer an, die Öfen zum Glühen zu bringen. »Wir müssen unser Publikum rösten, damit sie endlich ihre Mäntel an der Garderobe ablegen.«
Als Thorgeir und Bull Seite an Seite die Bühne betraten, David neben Goliath, war die Stimmung außerordentlich gespannt. Zuschauer sprangen von den Sitzen, klatschten mit hocherhobenen Händen. Die Tanzgruppe, angeführt von Jacob, nahm in der Mitte des groben Holzbodens Aufstellung.
Sie begannen mit dem langsamen Hallingtanz.
Thorgeir ließ es so gemächlich angehen, dass Ole Mühe hatte, dem verschleppten Takt zu folgen. Majestätisches Ausschreiten. Gedehnt anhaltender Ton. Wie ein sonntäglicher Trauerzug, der über die Bühne zog. Ab und zu schaute Jacob zu den beiden Geigern, ein wenig verzweifelt ob dieses überaus gedehnten Beginns. Die Geigenkünstler ließen sich nicht aus dem Blick, verfolgten das Fingerspiel des anderen, wiegten ihre Körper sanft im dahingleitenden Takt. Kein Lächeln, kein Mienenspiel. Strich für Strich, sorgsam ausgespielt.
Immer wieder blinzelten sie ins Publikum.
Nach und nach zogen die beiden das Tempo an. Ein vor sich hinplätschernder Bach jetzt.
Der Springtanz, springar, ungerader Takt, artistische Bewegungen im Zeitmaß presto.
Die Tanzschritte wurden schneller.
Drehungen. Kreise.
Erste Sprünge.
Im Publikum entstand Aufruhr. Zuschauer stürmten auf die Bühne, mischten sich unter die Tänzer. Sie hatten die Mäntel längst von sich geworfen, einige bereits die Joppen abgelegt. Einer riss sich das Leinenhemd vom Leib. Schweißglänzend sein Körper.
Und wieder schneller.
Und noch schneller.
Rasend.
Die älteren Tänzer verließen das Rund und überließen den jungen das Finale des nun überbordenden Springtanzes.
Oh sprich mir niemals mehr von spanischen Weibern und südlichen Tanzgöttern. So paraphrasierte Ole Bull das Gedicht eines Poeten, der die wilden Tänzer seiner Heimat beschrieb, die Leidenschaft, das Aufbrausen, schäumender Wasserfall, heulender Sturm über den gezackten Bergkämmen.
Die Sprünge wurden immer höher, ausgelassener, kreiselnde Drehungen, leicht in der Luft. Wenn Bull einen Springtanz bei seinen Konzerten intonierte, entstanden in seinem Kopf die Bilder norwegischer Naturschauspiele und trieben sein eigenes Spiel mit höllischer Energie voran. Jemand warf einen vollen Bierkrug auf die Bühne, dann sprang er selbst hinauf und schrie ins Publikum: »Haltet euch die Ohren zu! Hier spielen die Teufel ihre Melodei!«
Erst bei Sonnenaufgang verließen die letzten Zuschauer das Theater. Die beiden Musiker saßen auf der Bühne nebeneinander. Immer wieder hatten sie ihre Instrumente angesetzt und zusammen musiziert, zu ihrem eigenen Pläsier, auch wenn ihnen noch viele zugehört hatten. Sie waren hoch glücklich und hoch trunken.
»Hättest du noch einen Wunsch, Møllerguten?«, lallte Ole Bull, während er seine Guarneri im Geigenkasten verstaute.
»Ja, schon«, stammelte Thorgeir. Er zupfte an den Resonanzsaiten seiner hardangfele. »Ich möchte eines Tages mal genügend Geld haben, um mir ein paar Schuhe zu kaufen und meiner Frau ein seidenes Taschentuch.« Dann lachte er heftig auf und schielte ein wenig zu seinem Kollegen hinüber.
Als Thorgeir Augundson einige Tage später Bergen verließ, war er ein wohlhabender Mann. Nach seinen Konzerten mit Ole Bull besaß er 2000 Specietaler. Nur drei Wochen später soll von diesem Geld nichts mehr übrig gewesen sein.
3. Andante vivace
Richter Holm schob die Goldrandbrille auf den Nasen-höcker. Warum diese Zeitungen ihre Berichte immer so klein drucken mussten! Speziell die lächerlichen zehn Zeilen, die über den gestrigen Gerichtstag eingerückt worden waren. Außerdem war sein Name erneut falsch geschrieben. Wie oft hatte er sich schon beschwert? Er hieß weder Helm noch Halm, weder Hjalm noch Hume. Aber was wussten denn diese Zeitungsleute! Jedes Mal, wenn er sich beschwert hatte, bekam er absonderliche Ausreden zu hören. Ein Setzer habe in der Eile die Buchstaben verwechselt, ein Volontär habe seinen Namen falsch notiert, ein Korrektor sei über der Arbeit eingeschlafen. Richter Holm hoffte, in der nächsten Ausgabe einen fulminanten Artikel lesen zu können. Mindestens einen Zweispalter.
Der Tee war kalt geworden und draußen regnete es. Bergen zeigte sein trauriges Gesicht. Richter Holm überlegte, welchen Schlips er für diesen besonderen Tag anlegen sollte. Den weißen mit den silbernen Streifen oder den silbernen mit den weißen Punkten. Die Auswahl fiel ihm nicht leicht. Er hielt beide Schlipse nebeneinander, mal den einen, dann wieder den anderen bevorzugend.
Seine Frau war schon vor zehn Jahren gestorben. Es war ihre Aufgabe gewesen, ihm diese morgendliche Entscheidung abzunehmen. Mit der Haushälterin war kein vernünftiges Wort zu wechseln. Sie kam aus dem Norden, nördlicher als Trondheim, und war nicht in der Lage, einen Schlips von einer Fliege zu unterscheiden.
Richter Holm freute sich auf den Angeklagten des an-stehenden Prozesstages. Immer für einen Scherz gut, immer zu Späßen aufgelegt, immer den Spießbürgern um drei Nasenlängen voraus. Oh ja, diesen Spießbürgern, denen würde er es heute mal zeigen. Auch wenn es allesamt hochgestellte Obrigkeiten waren. Sie sollten ihn kennen-lernen. Richter Holm würde ihnen demonstrieren, was Recht und was Rechthaberei war. Wie sie in den letzten Wochen mit dem Angeklagten umgegangen waren. Einfach niederträchtig. Provinzler eben. Kleingeister, Vertreter in Sachen Engstirnigkeit, stupide Kontoristen.
Richter Holm schaute auf die Wanduhr. Er würde sich beeilen müssen. Pünktlichkeit gehörte zu seinen wichtigsten Tugenden. Er hatte bei Gericht eingeführt, dass der Prozesstag exakt mit dem letzten Achtuhrglockenschlag der Marienkirche begann. Es hatte einige Zeit gedauert, bis sich das Gerichtspersonal, Beisitzer und Protokollanten, Wach- und Schutzleute, Staatsanwälte und Verteidiger, aber auch Angeklagte und Zeugen an sein striktes Regularium gewöhnt hatten. Richter Holm entschied sich für den silbrigen Schlips mit den weißen Punkten. Den schiefen Knoten, er konnte keinen anderen, band er sich beim Hinausgehen.
Dieser Angeklagte hatte ihm schon einmal im Gerichts-saal gegenübergestanden. Damals bekam er von ihm eine Zigarre geschenkt, wie er jedem im Saal eine Zigarre schenkte und dazu sagte, er sei kein Frühaufsteher, zu dieser Morgenstunde habe er noch keine Gelegenheit gehabt, seine erste Zigarre zu entzünden. Bis auf den Richter hatten alle abgelehnt, die gar nicht billigen Zigarren anzunehmen. Der Angeklagte stand damals vor Gericht, weil er es gewagt hatte, in der Nähe der Tyskebryggen zu rauchen. Ein altes hanseatisches Gesetz bestimmte, dass dort nur bedeckte Pfeifen geraucht werden durften. Es bestand Brandgefahr, alle Gebäude an diesem Hafenkai der deutschen Hanse waren aus Holz. Richter Holm hatte schnell einen Ausweg aus diesem Dilemma gefunden. Er entschied, dass der Angeklagte keineswegs in der Straße, wo es verboten war, sondern auf dem Markt geraucht habe. Er sprach den Beschuldigten frei. Damals hatten alle Bergener Zeitungen berichtet. Die Artikel waren durchaus akzeptabel und ausführlich gewesen.
Zwei Minuten vor acht betrat Richter Holm das Gerichtsgebäude. Er erkundigte sich, ob der Angeklagte schon erschienen sei. Dies wurde ihm bestätigt. Ole Bull saß zu diesem Zeitpunkt auf der hölzernen Bank vor dem Gerichtssaal und las einen Brief, den ihm ein Bote überreicht hatte. Es war ein Brief seiner Frau Fé1icie, die er aus Frankreich hatte nachkommen lassen. Mit den Kindern lebte sie in dem gerade erworbenen Haus auf der Insel Andøen an der Südküste Norwegens, in der Nähe der Stadt Christiansand. Nur zwei Wochen waren sie dort zusammen gewesen, dann hatte es ihn wieder fortgetrieben.
»Ich verstehe nicht, was Du an diesem Andøen findest. Wäre es nicht besser gewesen, Du hättest das Haus besichtigt, bevor Du es kauftest? Das Wetter ist entsetzlich. Es stürmt ohne Unterlass. Nachts kriegen wir kein Auge zu, weil der Wind so fürchterlich heult. Das hier ist ein Sommerhaus, aber nichts für den Winter. Du schreibst, dass Du Dir Sorgen um Mutter machst, die ständig den Tränen nahe sei. Auch ich weine, aber hier ist niemand, der mich weinen hört und mich tröstet!« Ein Gerichtsdiener trat zu Ole Bull.
»Entschuldigen Sie, die Sitzung ist aufgerufen worden. Sie müssen eintreten. Bitte folgen Sie mir!«
»Einen Augenblick«, bat Ole Bull, »bitte geben Sie mir einen Augenblick. Ich stehe dem Gericht gleich zur Verfügung.«
Er zog an seiner Zigarre, legte sie behutsam auf die Holzbank, das brennende Ende ragte über den Sitz hinaus. Asche rieselte zu Boden. Dann zog er ein Stück Papier aus der Innentasche und begann, einen Brief zu schreiben. Er musste Félicie sofort antworten.
»Ich wünsche Dir Glück, Gesundheit, Friede, GEDULD. Seitdem das Theater eröffnet ist, gibt es nur Probleme. Wir mussten die Eröffnung um sieben Tage verschieben. Was für ein herber Verlust! Die Premiere war allerdings überaus gelungen. Ich habe extra ein Stück für den Prolog komponiert, danach sang der Chor norwegische Weisen, dann spielten wir Beethovens Egmont-Ouvertüre, zum ersten Mal in Bergen, und zum Schluss Ludvig Holbergs Drama Der Wetterhahn. Der erste Abend war ein wunderbarer Erfolg.«
»Aufgerufen wird Herr Ole Bornemann Bull«, schallte es durch den Flur, »Ihre Sache steht zur Verhandlung an. Bitte treten Sie unverzüglich in den Gerichtssaal ein.« Ole Bull erkannte die Stimme sofort. Richter Holm, den konnte er getrost noch ein wenig warten lassen.