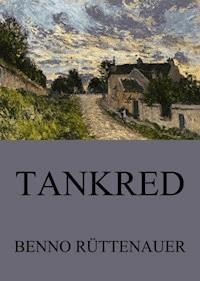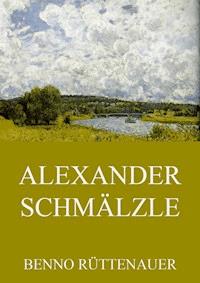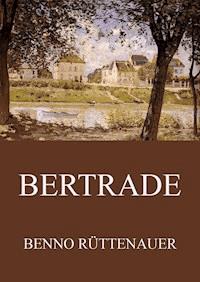Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Frauenspiegel aus dem Rokoko. Diese Ich-Erzählung aus dem 18. Jahrhundert ist eine Emanzipationsgeschichte, die unter anderem in Paris und der Normandie angesiedelt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Blaustrumpf am Hofe
Ein Frauenspiegel aus dem Rokoko
Benno Rüttenauer
Inhalt:
Der Blaustrumpf am Hofe
Vorwort
Sie wird erzogen wie eine kleine Prinzessin
Erste Männerbekanntschaft
Ein anderer Fall
Ein recht häßliches Abenteuer
In Not und Verlegenheit
Die Schwester als rettender Engel
Glänzende Aussichten
Die Herzogin von La Ferté
Die Zofe
Der Schöngeist kommt aufs neue zur Geltung
Ihre Königliche Hoheit
Die Liebschaften der Zofe und die beginnende Staatsverschwörung der Herzogin
Die Fürstin konspiriert, die Zofe revoltiert
Die kuriose Verwandlung eines Schweines in einen roten Krebs
Die Bastille
Der Chevalier von Le Mesnil
Ein vorläufiger Sieg der Tugend und Klugheit
Die Liebe im Gefängnis
Kühnheit und Verzweiflung der Liebe
Ihr Gefängnis wird immer lichtvoller
Anzeichen der Enttäuschung
Bleierne Freiheit
Der berühmte Mann
Tragische Episode
Mißlungene Weltflucht
Neue Versorgungsaussichten
Wie billig Hochzeit gehalten wird
Der Blaustrumpf am Hofe, B. Rüttenauer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849644857
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Der Blaustrumpf am Hofe
Vorwort
Es ist gewiß eine übertreibende Verleumdung, wenn gesagt wird, daß die schönen Frauen nebst sich selbst – ihren Putz mit einbegriffen – nichts so sehr lieben als den Spiegel. Aber sie lieben ihn. Eine Art vielleicht ausgenommen.
Ein Tugendspiegel ist jedoch diese Geschichte nicht, sie ist ein weiblicher Schicksalsspiegel und das deutet freilich auch auf nichts Schmeichlerisches und Spielerisches, denn was man Schicksal nennt, hat immer ein ernstes und manchmal erschreckendes Gesicht. Er ist also kein Spiegel, der schmeichelt. Nur die einfache verdammte Wahrheit, ob sie nun angenehm sei oder nicht, spiegelt er. Wer herkömmliche beliebte Hirngespinste sehen will, weil die Wahrheit hart ist, der lasse ihn beiseite, er würde kaum von ihm befriedigt werden. Zwar einige Bedenklichkeiten und Selbstgefälligkeiten, die mit Vorsicht genommen werden müssen, spiegelt dieser Spiegel, aber ein heller und klarer Spiegel ist er trotzdem und lange nicht so nebelig und schwummrig wie die meisten, die sich dennoch großer Beliebtheit erfreuen. Und ganz merkwürdig zeitgemäß muten seine Spiegelungen an, darum hat ihn ein Liebhaber solcher Dinge, als er ihn unter altem Schutt vergraben fand, bedachtsam aufgehoben, als ein handlich und zierlich Gerätlein, hat ihn sauber geputzt von Staub und Spinnweben und auch dem verschnörkelten Rokokorahmen ein wenig mit neuer Versilberung nachgeholfen, das ist aber alles, was er daran getan hat.
Erstes Kapitel
Sie wird erzogen wie eine kleine Prinzessin
Wenn ein Frauenzimmer sich bis zur Schmerzhaftigkeit geschnürt fühlt, bildet sie sich unfehlbar ein, eine tadellose Taille zu besitzen. So ging es mir mit der Vernünftigkeit. Ich fühlte mich wie durch sie beengt, darum tat ich mir allzeit nicht wenig zugut auf meine Vernunft.
Dabei habe ich es dennoch nie so weit gebracht, meine Launen zu zähmen oder auch nur äußerlich jene Ausgeglichenheit des Gemüts zu erreichen, die zum Glück des Menschen so notwendig ist. Dergestalt wurde ich meinen Vorgesetzten oft unangenehm, in Gesellschuft lästig, und ganz unerträglich für diejenigen, die von mir abhingen.
Aber nicht daraus entsprang das Unglück meines Lebens, sondern aus einem Zug meines Charakters, der zwar an sich sehr ehrenvoll sein mag, mir aber zum Verhängnis wurde.
Die Hauptleidenschaft meines Lebens war nämlich eine ungebändigte Liebe zur Freiheit, ein bös Ding für jemanden (insbesondere meines Geschlechts), der den größten Teil seines Daseins, wie ich, in der Dienstbarkeit zubringen mußte. Auch empfand ich meinen Zustand immerdar fast unerträglich, trotz der vielen ganz unverhofften Annehmlichkeiten darin.
Nichtsdestoweniger habe ich, begünstigt durch die Verhältnisse, bereits als armes Mädchen eine gewisse Berühmtheit erlangt. Männer von glanzvollem Namen wurden früh auf meinen Geist oder was sie so nannten, aufmerksam, und darüber sah ich mich eines Tages in Ereignisse verwickelt, von denen lange Zeit ganz Europa sprach. Man hat mir nie das Zeugnis verweigert, bei Gelegenheit einer furchtbaren Katastrophe mit Klugheit und Festigkeit gehandelt (oder geduldet) zu haben. Die weltgeschichtliche Bedeutung der gedachten Hofkabale hat darum auch auf meine arme Person abgefärbt und mich zeitweilig mit einem Nimbus umgeben, der zu meinem geringen Stand oder zu dem mein geringer Stand schlecht paßte. Ich war nie eitel darauf: oder ist dies, mit Genugtuung von mir auszusagen, gar die größte Eitelkeit?
In gewissem Sinn ist mein Leben ein Roman, aber ein umgekehrter. In dergleichen Büchern pflegt die Heldin als arme Schäferin aufzuwachsen, um sich zuletzt als reiche Königstochter zu entpuppen, ich aber wurde in meiner Kindheit wie eine Prinzessin behandelt und entdeckte erst viel später, daß ich nur eine arme Waise war, die nichts in der Welt ihr eigen nennen konnte, und wenn man mich heute eine Frau Baronin von Staal nennt, so ... doch ich will den Dingen nicht vorgreifen.
Mein Vater, ein nicht unberühmter Maler seiner Zeit, sah sich wegen einer Angelegenheit, die ich nie erfahren habe (er hatte einen Vornehmen im Zweikampf getötet), genötigt, Frankreich zu verlassen und sich in England eine neue Heimat zu suchen. Meiner Mutter, damals jung und schön, erweckte ihr Beichtvater Gewissensbisse darüber, daß sie von ihrem Gatten getrennt lebe, und so folgte sie diesem nach England nach, aber von den fremden Verhältnissen und dem düsteren Klima abgestoßen, kehrte sie nach Frankreich zurück, mich selber mit sich tragend unter ihrem Herzen, und also in Bitternis empfangen, wurde ich bald darauf zu Paris geboren.
Ganz von Mitteln entblößt, suchte und fand meine Mutter eine Zuflucht in der Abtei von St. Salvator zu Evreux in der Normandie, deren Aebtissin, eine Frau von La Rochefoucault, sie ohne Pension in ihrem Kloster aufnahm. Sie willigte sogar ein, daß man mich, eben von der Amme entwöhnt, holen ließ, um bei meiner Mutter im Kloster zu bleiben.
Damals hatten sich die Damen von Grieu, zwei Schwestern, aus der Abtei von Jouarre nach St. Salvator zurückgezogen, und es entspann sich dort eine große Freundschaft zwischen ihnen und meiner Mutter. Auch zu mir faßten die beiden Damen sofort eine große Leidenschaft, denn ihre Untätigkeit in dem fremden Hause hatte sie in einen Zustand der Langeweile versetzt, in welchem sie gern den ersten Gegenstand, der ihnen begegnete, mit Heftigkeit ergriffen, und sie liebten mich mit dem Ungestüm, das die Einsamkeit und der Müßiggang jeder Art von Gefühlen zu geben pflegt.
Noch war ich wenig mehr als zwei Jahre, als ich schon kleine Reden hielt, die man in Anbetracht meines Alters für sehr geistreich erklärte. Die Gunst der Aebtissin gewann ich mir durch ein Erlebnis, das vielleicht des Erzählens nicht wert ist. Sie war die Schwester des durch seinen Geist und seine Maximen so bekannten Herzogs von La Rochefoucault, auch hatte sie selbst viel Verstand, der sie aber nicht an großen Narrheiten verhinderte, sondern dieselben nur um so hervorstechender erscheinen ließ.
So hatte sie sich eine Art Hundeasyl errichtet. Sie versammelte um sich her alle Lahmen, alle Krüppel, alle Unheilbaren. Die einen hatten die fallende Sucht, andere waren von Krätze bedeckt. Einzig um die Gesunden und Hübschen kümmerte sie sich nicht, in der Ueberzeugung, daß diese anderswo Unterkommen fänden.
So geschah es mir eines Tages, als man sich gerade zu Tische setzen wollte, daß mir das Unglück zustieß, einem dieser Unglücklichen auf die Pfote zu treten, der alsbald in ein jämmerliches Gewinsel ausbrach. Die Aebtissin verzog ihr Gesicht und schien so empört, daß man mir leise zuflüsterte, ich solle um Verzeihung bitten. Da ich nicht unterschied, wer der Beleidigte sein mochte, verließ ich meinen Platz, kniete in der Mitte des Saales vor dem verletzten Hunde nieder und bat diesen mit beweglichen Worten um Entschuldigung. Diese Handlung hatte Erfolg und brachte mich bei der Aebtissin in Gunst. Auch die Marquise von Sillery, ihre Schwester, und die Damen von Saint-Poix und von Boisfévrier, ihre Nichten, alles sehr geistreiche Frauen, machten sich ein Vergnügen daraus, sich mit mir zu beschäftigen. Wirklich hatte ich zu jener Zeit mehr Intelligenz und Vernunft, als man es sonst in diesem Alter findet, und ich kann das ohne Eitelkeit sagen, da man genug Kinder trifft, die einmal für ein Wunder von Geist gegolten haben und nachher Wunder von Dummheit geworden sind.
Meine glücklichen Anlagen wurden aber auch durch jede Art Unterweisung aufs sorgfältigste gepflegt, und da ich überdies nur mit erwachsenen Personen umging, erhielt mein Geist eine erstaunliche Reife und einen ausschließlichen Hang zum Ernsten.
Anstatt mich mit Kindermärchen einzuschläfern, füllte man meinen Kopf mit den ersten Anfängen der heiligen und profanen Geschichte; und ich behielt all das so gut, daß ich, wenn es gerade paßte, oder gelegentlich auch nicht paßte, alles mögliche daraus zitierte. Ein solcher Erfolg ihrer Erziehung machte, daß die Personen, die sich damit beschäftigten, mich nur noch leidenschaftlicher in ihr Herz schlossen, und sie gingen deshalb meine Mutter darum an, mich ganz ihren Händen zu überlassen.
Nun hatte die Frau Herzogin von Ventadour den Wunsch geäußert, meine Mutter als Erzieherin ihrer einzigen Tochter zu sich zu nehmen und meine Mutter nahm die Stelle unter vorteilhaften und ehrenvollen Bedingungen an. Aber ihre außerordentliche Frömmigkeit, unvereinbar mit dieser Art der Lebensführung, und noch mehr mit den Neigungen ihrer Schülerin, veranlaßte sie, ihre Stellung noch vor der Verheiratung des Fräuleins von Ventadour mit dem Fürsten von Turenne wieder aufzugeben.
Nach Verlauf eines Jahres kam meine Mutter also wieder in das Kloster zurück, wo sie mich unter der Obhut jener Damen zurückgelassen hatte, die so sehr an mir hingen, daß sie mich auch jetzt nicht wieder von sich lassen wollten. Sie betrachteten mich als ihr Kind und beschäftigten sich ausschließlich mit meiner Erziehung.
Die lebhafte Neigung zu mir machte es den Damen von Grieu wünschenswert, in der Lage zu sein, mir mehr Gutes tun zu können, und sie benützten die Verbindungen, die sie mit dem Hofe unterhielten, um eine Abtei zu bekommen. Es war lange davon die Rede, ehe die Sache gelang, und ich machte die Prophezeiung, daß es nicht vor meinem siebenten Jahre eintreten würde. Narren und Kinder sagen ja manchmal die Wahrheit richtig voraus, indem sie einfach in den Tag hineinreden.
Für ein Kloster ist es aber ein großes Ereignis, wenn eine Nonne Aebtissin wird, und die Schritte, die eine Prätendentin zu diesem Zwecke tut, werden aufmerksam belauert. So hatte man auch Vermutungen über die Wünsche der Damen von Grieu, und da man annahm, daß dieselben mir nichts verheimlichten, wurde ich von allen Seiten ausgefragt. Ich antwortete verkehrtes Zeug, sprach von meiner Puppe, und man wurde endlich davon überzeugt, daß ich noch zu kindisch sei, als daß man mir etwas hätte anvertrauen mögen. So bewahrte ich das Geheimnis, ohne mich doch gegen die Wahrheit zu vergehen. Lügen hatte ich nicht gelernt. Gewohnt, mit dem Geständnis meiner Fehler auch deren Verzeihung zu finden, bewog mich nichts dazu, Ausflüchte zu machen.
Bloß die Strenge und der Zwang, den man auf Kinder ausübt, sind die Ursache davon, daß die meisten Lügner und Betrüger werden.
Endlich wurde die Frau von Grieu, die ältere der beiden Schwestern, zur Aebtissin von St. Ludwig in Rouen ernannt. Sie begab sich mit ihrer Schwester bald dorthin, und mit der Einwilligung meiner Mutter, die sich glücklich schätzte, nicht auch noch für mich sorgen zu müssen, führte sie mich mit sich an ihren neuen Bestimmungsort.
Ich fühlte mich überglücklich zu reisen und neues sehen zu können, die Welt wuchs vor meinen Augen. Noch glücklicher war ich, als wir in St. Ludwig ankamen, wo der große parkartige Klostergarten mit seinen hohen Ulmen und Hainbuchen mich besonders entzückte.
Bald danach erfuhr ich den Tod meines Vaters in England. Ich hatte ihn niemals gesehen, ich weiß kaum, ob ich mir bewußt war, einen Vater zu haben. Trotzdem weinte ich um ihn, und ich kann mich nicht erinnern, woher mir diese Tränen kamen.
Das Kloster von St. Ludwig bildete einen kleinen Staat, in welchem ich unumschränkt herrschte. Die hochwürdige Aebtissin und ihre Schwester dachten nur daran, wie sie meinen Wünschen zuvorkommen und meine Launen befriedigen könnten. Ich wohnte in ihren Gemächern, die an Bequemlichkeiten, ja aller Art Luxus nichts zu wünschen übrigließen.
Besonders die reichen Tapeten oder Teppiche an den Wänden mit ihren bunten Darstellungen aus der Biblischen Geschichte und der heiligen Legende erfreuten mich über alles und dienten mir zugleich zum Unterricht. Vor dem Bilde der Hagar, wo sie mit ihrem kleinen Ismael von Abraham aus dem Zelt hinweg in die Wüste hinaus verstoßen wird, habe ich oft kindliche Tränen vergossen. Einen tiefen Eindruck machte mir auch das Bild, wo der Abgesandte Isaaks, des Sohnes Abrahams, mit seinen langhalsigen Kamelen vor dem Brunnen hielt. Er stand vor der lieblichen Rebekka, die schon den Krug in der Hand hielt, um seinen Tieren Wasser zu schöpfen. Vor diesem Bild stand gerade eine der schwärzlichen, reich skulptierten Truhen, ich glaube aus der Zeit des Königs Franz, wie deren mehrere abwechselnd mit anderen Möbeln im gleichen Stil an den Wänden herum verteilt standen. Auf die genannte Truhe bin ich oft hinaufgeklettert und konnte mich dann nicht enthalten, die liebliche Rebekka verstohlen auf die roten Lippen zu küssen. Ich glaube, ich küßte sogar einmal die langen, schmalen Nüstern von einem der Kamele, das mich aus großen grünlichen Augen so märchenhaft ansah.
Wenn ich mich recht erinnere, waren es rings im Saal fünfzehn solcher Bilder, alle mit farbiger und einzelne mit glänzender Seide sehr kunstreich eingewebt in diese Tapeten, wie man sie vor etlichen hundert Jahren in der Stadt Arras zu verfertigen pflegte. Ohne diese lebendigen Bilder würde ich die alten Geschichten längst aus dem Gedächtnis verloren haben, die doch eines hohen poetischen Reizes nicht entbehren und fast denen des Homer gleichkommen, was auch Herr und Frau Dacier dazu sagen mögen.
Seltsam, daß mir hier der Name dieser berühmten Uebersetzer des Homer in die Feder fließen mußte, es hätte mir ja damals niemand prophezeit, daß die beiden eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen würden.
Und also derart üppige Gemächer mit fast königlicher Ausstattung umrahmten die Tage meiner ersten Jugend.
Vier Personen, teils Nonnen, teils Laienschwestern, zu meiner Bedienung bestimmt, hatten genug zu tun, um meinen zahlreichen und verschiedenartigen Wünschen nachzukommen. Man hat viele Wünsche, wenn diese durch keinerlei Zwang begrenzt werden.
Zwei Nichten der Aebtissin, die diese zu sich genommen hatte, willfahrten mir ebenfalls, wenn auch mit Mißvergnügen, und das ganze Haus fand sich in die Notwendigkeit versetzt, mir sozusagen den Hof zu machen.
Da ich alles um mich her zu meinen Füßen sah, dachte ich nicht daran, daß ich selbst die geringste Rücksicht zu zeigen nötig hätte. Auch dies tat ich keineswegs, nicht einmal gegen die Damen, deren blinde Zärtlichkeit mir dieses kleine Königreich aufgerichtet hatte.
Ein Jahreseinkommen, das die Damen von Grieu von ihrer Familie bezogen, wurde dazu benützt, meine Lehrer zu bezahlen und mir alles zu verschaffen, was notwendig oder erwünscht für mich sein konnte. Lieber ließen sie es selbst an allem fehlen, als daß es mir an etwas hätte mangeln sollen. In Wahrheit liebte ich sie zärtlich, aber ich hatte keinen Begriff davon, wie sehr ich mich ihnen verpflichtet fühlen mußte. Was man für mich tat, schlug ich so wenig an, daß ich es für ganz selbstverständlich fand. Nur unsere Anstrengung, etwas zu erreichen, lehrt uns den Wert einer Sache kennen.
So klein ich war, hatte ich doch schon alle Fehler der Großen angenommen, und sogar die vielen religiösen Uebungen taten dem leider keinen Eintrag, wie eifrig ich mich ihnen auch hingab.
Wie schon erwähnt, war ich in der Religion sehr unterrichtet, und mein Geist so frühreif, daß man mich an den heiligsten Mysterien teilnehmen ließ, ehe ich noch das Alter von acht Jahren erreicht hatte.
Diese frühzeitige Gunst erhöhte meine fromme Inbrunst. Ich las gern, und da es in der Bibliothek des Klosters nur fromme Bücher gab, las ich beständig darin. Die übrige Zeit des Tages brachte ich in Gebeten oder Betrachtungen zu. Man fürchtete aber, diese Lebensweise könne meiner ohnehin zarten Gesundheit schaden und versuchte meinen Eifer einzuschränken. Jedoch der Zwang, der mir bis jetzt eine unbekannte Sache gewesen, machte mich nur um so hartnäckiger, mein Feuereifer wurde noch glühender, und ich brachte die Stunden, die meiner Erholung und Unterhaltung zugedacht waren, heimlich in frommen Uebungen zu.
Mehrere Jahre lang lebte ich auf diese Weise und zwar mit solchem Ernst, daß ich jeden Augenblick beklagte, der mit anderen Dingen als religiösen Uebungen ausgefüllt werden sollte; ich ließ mir sogar meine außergewöhnlich langen Haare abschneiden, nur um früher als Nonne eingekleidet zu werden. Aber wir Frauen hängen noch mehr an unseren körperlichen Vorzügen als an unseren Leidenschaften. Meine Leidenschaft für die frommen Bücher hinderte mich nicht, die Größe des Opfers, das ich gebracht hatte, plötzlich zu ermessen, und damals lernte ich die Reue kennen.
Diese Erkenntnis hemmte meine Ungeduld, Nonne zu werden. Bisher hatte ich den Augenblick mit Leidenschaft herbeigesehnt; nun fing ich an, die Folgen eines unverbrüchlichen Gelübdes zu bedenken. Und von diesem Zeitpunkt an bis zu dem Alter, wo ich den Schleier hätte nehmen können, wurde das Gefühl meiner innerlichen Berufung immer schwächer, so daß ich schließlich fast nicht mehr daran dachte.
Im Kloster fanden sich einige Pensionärinnen, viel älter als ich; ihnen schloß ich mich näher an, und dieser Verkehr gereichte mir zu einiger Abwechslung zwischen meinen ernsthaften Beschäftigungen. Sie liehen mir verschiedene Romane, und die Erlebnisse der erdichteten Personen machten mir einen so starken Eindruck, wie ich ihn kaum später von meinen eigenen Erlebnissen bekommen habe.
Die große Freiheit, die man mir ließ, hinderte nicht, daß man meine Handlungen streng überwachte, und da ich nichts verbarg, so fiel es leicht, meine Geheimnisse zu kennen. Man bemerkte also, daß ich gefährliche Lektüre trieb und sagte mir, daß ich darauf verzichten müsse, was ich so pünktlich befolgte, daß ich inmitten eines höchst aufregenden Ereignisses in meiner Lesung abbrach. Meinen innerlichen Einflüsterungen, heimlich den Roman zu Ende zu lesen, widerstand ich fest, und wahrlich, wenig Dinge im Leben sind mir so schwer gefallen wie dieser Verzicht.
Zweites Kapitel
Erste Männerbekanntschaft
Damals kam Fräulein von Sillery als Pensionärin nach St. Ludwig, die ich während meiner Kindheit in St. Salvator öfter gesehen hatte und ich schloß mich mit aller Lebhaftigkeit der ersten Freundschaft an sie an, ich dachte nur noch daran, ihr zu gefallen, und was ihr gefiel, gefiel auch mir. Sie liebte die sogenannte wissenschaftliche Lektüre und steckte auch mich damit an.
Bis jetzt hatte ich noch keine Bücher ernsterer Art gefunden, die meine Neugier erregt oder gar befriedigt hätten, und ich habe seitdem oft den Verlust von fünf oder sechs Jahren bedauert, wo der Geist am willigsten ist, sich zu bilden, und die ich zugebracht hatte, ohne, außer den Sachen der Religion, mehr zu lernen, als was man gewöhnlich die jungen Mädchen lehrt: wie Musik, Tanz, Klavierspiel, alles Dinge, für die ich weder Sinn noch Begabung besaß und in denen ich keinerlei Fortschritte machte, bis endlich das Fräulein von Sillery mir neue Wege eröffnete.
Sie machte aus der Philosophie von Descartes eine Art von Studium und ich gab mich selber mit außerordentlichem Vergnügen diesem Unternehmen hin. Ich las mit ihr sein Werk Ueber die Erforschung der Wahrheit und begeisterte mich für das System des Verfassers so sehr, daß ich es nicht leiden konnte, wenn mich irgend etwas von diesem Studium ablenken wollte. Die gewöhnlichen Vergnügungen und gesellschaftlichen Vereinigungen mißfielen mir mehr als je, wie überhaupt alles, was sich nicht auf meine Studien bezog.
Indessen wurde ich vermittels dieses Nachdenkens von Gedanken ergriffen, die mich beunruhigten. Ich fürchtete, daß die Philosophie den Glauben beeinträchtigen könne, daß diese metaphysischen Ideen eine zu starke Nahrung für meinen Geist sein möchten, der sich noch nicht fähig erwies, diese Ideen zu verdauen, und im Augenblick, als meine Leidenschaft für diese Philosophie den höchsten Punkt erreicht hatte, faßte ich den Entschluß, mich so lange von dem Gegenstand loszusagen, bis ich mich ihm ohne Gefahr hingeben könnte.
Dieses Opfer kostete mich unendlich viel, aber ich hatte mich früh daran gewöhnt, mir Gewalt anzutun und in zweifelhaften Dingen gegen meine Neigung zu entscheiden.
Fräulein von Sillery, die ich zu Rate zog, billigte meine Zurückhaltung; es gab keinen Gedanken, den ich nicht mit ihr geteilt hätte, ich liebte sie wie man sich selbst liebt, ja noch mehr, so schien es mir; ich hätte die Leiden erdulden mögen, die ihr bestimmt waren, und ich ging so weit, daß ich eine Abneigung gegen die Leute faßte, die mir selber mehr Zuneigung und Verständnis schenkten als ihr.
Diese von mir unzertrennliche Freundin mußte eine Reise nach Paris machen, und ihre, wenn schon kurze Abwesenheit verursachte mir einen Schmerz, wie ich ihn größer bis dahin nie empfunden hatte. Ich nahm unterdessen meine Zuflucht zu einer neuen Beschäftigung, um mich aus der gänzlichen Niedergeschlagenheit, in die mich die Abwesenheit der Freundin versetzte, herauszuziehen. Bei meinen philosophischen Studien hatte ich bei mir den Mangel an Kenntnissen in der Geometrie bemerkt und mir vorgenommen, mir wenigstens einen Schimmer davon anzueignen. Nun entschloß ich mich dazu und fand eine nützliche Ablenkung durch dieses Studium. Das beste Mittel, die Verwirrungen der Seele zu beruhigen, ist nicht, dagegen anzukämpfen, sondern dem Geiste neue Anregungen zuzuführen, die ihn unmerklich von dem, was uns quält, ablenken.
So gingen wieder einige Jahre ruhig genug vorüber, dann aber erlebte ich den großen Kummer, mich von Fräulein von Sillery trennen zu müssen, die zu ihren Eltern auf deren Schloß in der Normandie zurückkehrte.
Bald nach der Abreise meiner Freundin bekam ich die Blattern und war so übel daran, als man es nur sein kann, wenn man nicht daran stirbt. Mein Leben kümmerte mich wenig mehr, ebenso mein Gesicht, das mir ohnehin nicht der Beachtung wert schien, ich fühlte nur noch das Uebel der Krankheit. Doch dachte ich daran, mich absondern zu lassen, um niemand in Gefahr zu bringen. Wie in der Geometrie, so hatte ich auch in der Morallehre bereits verstanden, daß das Ganze größer ist als sein Teil. Gern bereitete ich mich zum Sterben vor; als ich indessen wieder genas, wagte ich es nicht, mein Gesicht anzusehen, so wenig Aufhebens ich sonst davon gemacht hatte, und erst nach drei oder vier Monaten sah ich es mit Erstaunen wieder, so sehr hatte ich jeden Begriff davon verloren.
Die Frauen, die ihre äußeren Vorzüge gering einschätzen und gar nicht daran zu hängen scheinen, halten doch viel mehr darauf als sie sich selbst bewußt werden.
Ein unerwartetes Ereignis brachte mich wieder mit Fräulein von Sillery zusammen. Ihre Mutter mußte eines Prozesses wegen nach Rouen und führte ihre Tochter mit sich. Ich war überglücklich, sie wiederzusehen und wurde es noch mehr, als man mir den Vorschlag machte, mich auf einige Zeit nach Sillery mitzunehmen. Frau von Sillery zeigte mir ihre Zustimmung und sogar ihren lebhaften Wunsch und so willigten die Aebtissin und ihre Schwester ohne den geringsten Widerstand in meine Abreise, trotzdem es ihnen unendlich schwer fiel, sich von mir zu trennen. Sie fühlten sich glücklich, mir eine Freude auf Kosten der ihrigen zu machen.
Mit dem größten Enthusiasmus von der Welt reiste ich in der Gesellschaft meiner immer zärtlich geliebten Freundin ab. Ihre Mutter erwies sich kühl aber höflich gegen mich und ich gewöhnte mich bald an sie. Wir kamen in einem recht schönen Schlosse an, das zwar etwas traurig und altertümlich, aber ebenso vornehm wirkte wie sein Besitzer, der sich äußerst trocken gegen mich benahm. Mit der Zeit aber gewann ich seine Gunst, sowie die seiner Gemahlin, die sich sonst kaum weniger zugänglich zeigte, und sie baten mich zu bleiben, solange es mir gefiele. Diese Leute waren durchaus menschenfreundlich, aber kaum liebenswürdig. Daran hinderte sie ein gewisses kühlsteifes Wesen, das aus übertriebenem Stolz entsprang, den nur ihr wirkliches Wohlwollen etwas dämpfte. Ihr Sohn, von dem noch viel die Rede sein wird, erwies sich mir später als von gleichem Schrot und Korn, nur daß bei ihm eine hohe geistige Bildung und der vollendete Weltmann den Junker übertünchte. Er stand gegenwärtig im Feld und seine Abwesenheit wirkte fühlbar auf alle Gemüter.
Es kam fast niemand in dieses Haus. Der alte Marquis von Sillery liebte die Ausgaben nicht und die Marquise war sehr fromm und machte sich nichts aus Gesellschaft. Außer einigen benachbarten Edelleuten, die meine Aufmerksamkeit keineswegs auf sich zogen, hatte ich noch niemanden gesehen.
Da machte eines Tages der Chevalier von Le Mesnil Besuch, ein jüngerer Bruder des Grafen von Le Mesnil-Monmart, auf dessen benachbartem Schloß er sich gerade aufhielt. Man forderte ihn zu einer Partie Hombre auf, wonach er sich verabschiedete, mit dem Versprechen, wiederzukommen und einige Zeit bei uns zu bleiben. Bei dieser Gelegenheit entdeckte ich den Wunsch bei mir, daß er doch recht bald wiederkehren möchte, und ich versuchte, mir über den Grund meiner heftigen Wünsche klar zu werden.
Ich sagte mir, daß es ein Mann von Geist und ein guter Gesellschafter sei, der selbstverständlich an einem so einsamen Orte willkommen sein müsse. Als ich mich aber daraufhin prüfte, worauf ich die Meinung von seinem Geist gründete, fiel es mir ein, daß ich ihn nur die beim Spiel gebräuchlichen Worte wiegagné »trois matadors«undsans prendrehatte aussprechen hören, und ich mußte mich fragen, ob etwa gar nur die schlanke Gestalt, das flaumige Blondbärtchen über den Lippen und die munteren blauen Augen es waren, die mir seine Gegenwart so wünschenswert erscheinen ließen! Seine Familie gehörte zu dem ältesten Adel von Anjou, er selbst stand als Fahnenjunker bei dem Regiment des Herzogs von Burgund zu Angers.
Als er wiederkam und ich ihn mehr sprechen hörte, verschwand der Geist, den ich ihm so gern zugeschrieben hätte, und es blieb nur ein angenehmer Tonfall der Stimme übrig, ein wenig mehr weltmännische Umgangsformen als bei den Leuten, die ich zu sehen gewohnt war, und außerdem freilich auch die munteren blauen Augen, das flaumige Blondbärtchen über den frischen Lippen und eine schlanke und äußerst graziöse Gestalt.
Er kam nun oft, ohne eingeladen zu werden und blieb lang, ohne daß man sich Mühe gab, ihn zurückzuhalten, woraus wir beide, Fräulein von Sillery und ich, schlossen, daß eine von uns auf ihn Eindruck gemacht haben müsse. Auf wen aber seine Wahl gefallen sei, wagten wir nicht zu entscheiden. Ich behauptete auf sie, sie behauptete auf mich, und es wurde eine wichtige Sache für uns, herauszubringen, wem diese Eroberung galt.
Dieser Wettstreit zwischen uns schien nur ein Scherz, und die Beobachtungen, die wir uns pünktlich einander mitteilten, wurden uns eben in unserem Müßiggang zur willkommenen Beschäftigung. Wenigstens glaubte ich es nicht anders. Als ich aber erfuhr, daß er sich erklärt hatte und nicht für mich, empfand ich einen mir bis dahin unbekannten Groll. Eine heftige Gemütsbewegung verursachte mir eine Art von Angstgefühl, wie man es empfindet, wenn man in einen bodenlosen Abgrund zu versinken glaubt. Es war die Eifersucht mit allen ihren Begleiterscheinungen; und doch konnte ich damals nicht ahnen, welche schmerzliche Bedeutung der junge Mann in meinem Leben noch gewinnen sollte. Einstweilen aber fand der blonde Chevalier nur allzubald einen gefährlichen Rivalen.
Drittes Kapitel
Ein anderer Fall
Nachdem ich fünf oder sechs Monate auf Schloß Sillery zugebracht hatte, mußte ich in mein Kloster zurückkehren. Man nahm mir das Versprechen ab, im nächsten Jahre wiederzukommen, und die Marquise von Sillery drängte mich um so mehr dazu, als sie für den folgenden Sommer ihren Sohn erwartete und durch eine geeignete Gesellschaft hoffte, ihm den Aufenthalt auf dem Lande erträglicher zu machen.
Der junge Herr von Sillery war unter der Zahl der Gefangenen von Hochstädt gewesen und nach England überführt worden. Von der dortigen feuchten Luft hatte er sich eine Brustkrankheit zugezogen und die Erlaubnis erhalten, auf sein Ehrenwort hin in sein Vaterland zurückkehren zu dürfen.
Herr von Sillery hatte sein Leben in der großen Welt und in den angenehmsten Verhältnissen zugebracht. Man hatte mir so viel von ihm gesprochen, daß ich sehr neugierig war, ihn kennenzulernen.
Mit Ungeduld erwartete ich darum die Zeit, um nach Schloß Sillery zurückkehren zu können, obgleich meine heftige Hinneigung zu meiner alten Freundin seit dem peinlichen Ereignis vom vorigen Jahre etwas weniger lebhaft geworden war.
Endlich erschien der Zeitpunkt meiner Reise. Als ich auf Schloß Sillery ankam, erwartete man gerade den Sohn des Hauses, alles fühlte sich schon erfüllt von ihm.
Er kam an. Jedermann eilte zu seinem Empfang an den Wagen, auch ich ging wie die anderen hin, aber ein wenig langsamer, und als ich die übrige Gesellschaft erreichte, stieg er schon in der weiß-roten Uniform seines Regiments die Stufen der breiten Vortreppe hinauf, um sich in sein Zimmer zu begeben. Als er sich umwendete, um zu danken, wurde ich von seiner Stimme angenehm berührt, wie auch von seiner edlen Haltung, die sich von allem, was ich bis jetzt kennengelernt, durchaus unterschied. Nur eine gewisse Steifheit in seiner hohen Gestalt, die er vom Vater ererbt haben mochte, beeinträchtigte ein wenig den sonst überaus günstigen Eindruck.
Er empfing niemanden bei sich und zeigte sich zuerst wenig mitteilsam. Die Bücher, die er mitgebracht hatte, bildeten seine einzige Gesellschaft. Meist blieb er auf seinem Zimmer oder ging allein spazieren, und außer den Mahlzeiten sah man ihn nie. Aber trotzdem er sich kaum die Mühe nahm zu sprechen, so sprach er doch so gut und mit soviel Anmut, daß sein Geist sich bemerkbar machte, ohne daß er daran dachte, ihn zu zeigen.
Seine Anziehungskraft und seine Verachtung reizten mich gleicherweise. Auch seine Schwester, die ihn schon umgänglicher gekannt hatte, fühlte sich gekränkt. Unsere Unterhaltungen drehten sich meist um ihn.
Eines Tages, als wir innerhalb des weiten Schloßparkes in einem Wäldchen spazierengingen, wo wir allein zu sein glaubten, machten wir unserem Unwillen gegen ihn Luft. Er befand sich aber ganz in unserer Nähe, ohne daß wir ihn bemerkt hatten, und als er hörte, daß von ihm die Rede war, blieb er stehen, um uns zuzuhören. Wir hatten uns gesetzt und er verbarg sich hinter einigen Bäumen, wo ihm nichts von unserem Gespräch entging, das er trotz allem seiner Aufmerksamkeit für würdig hielt; auch fühlte er, daß wir recht hatten, uns über eine Nichtachtung zu beklagen, die wir nicht verdienten. Er zeigte sich nicht, aber als wir in das Schloß zurückgekehrt waren, sagte er uns: er habe über sich reden hören, und zwar viel Schlechtes und sehr im Ernst.
»Man ist nicht zum Lachen aufgelegt,« antwortete ich, »wenn man sich über Euch beklagt.«
Diese naive Antwort gefiel ihm.
»Ich erwartete nicht,« versetzte er darauf, indem er mich betrachtete, »in dem Tale von Auge das zu finden, was ich gefunden habe.«
Und dann gestand er uns, daß er unsere für ihn wenig schmeichelhafte Unterhaltung doch mit großem Vergnügen angehört habe.
Von diesem Augenblick an hielt er uns seiner würdig und wir blieben nun unzertrennlich. Die Spaziergänge, die Lektüre, alles vollzog sich gemeinschaftlich.
So brachte ich denn ganze Tage mit einem jungen Kavalier hin, der mir ungemein gefiel, und dem ich doch nicht dachte gefallen zu wollen. Denn es schien mir unmöglich, daß ein Mann, der an den Umgang mit den liebenswürdigsten Frauen an dem glänzenden Hof von Versailles gewöhnt und von ihnen geliebt worden war, die geringste Aufmerksamkeit für ein Geschöpf haben könnte, das weder Schönheit noch die sonstigen angenehmen Eigenschaften besaß, die nur der Verkehr in der großen Welt zu geben vermag. Ich machte Verse, die ich niemandem zeigte, die aber meine Gemütsverfassung deutlich ausdrückten; sie schlossen: Ach, ich würde ihn lieben, wenn ich selber liebenswürdiger wäre.
Indessen genoß ich das Glück, den Menschen, dessen bloße Gegenwart mich schon selig machte, täglich zu sehen. Ich gewann seine Teilnahme, ja sogar seinen Beifall, und dieser äußerte sich auf eine so zartfühlende Weise, daß er der Eitelkeit schmeichelte, ohne die Bescheidenheit zu verletzen. Diese Kunst habe ich später, als ich die Welt kennenlernte, bei keinem Menschen sonst wieder in dem Maße gefunden.
Es gehörte zum guten Ton des Hauses, daß jedermann sich mit ihm beschäftigte, und so konnte auch ich mich dieser Neigung hingeben, ohne daß es besonders auffiel. Trotzdem geschah es mir manchmal, daß ich mich hinreißen und meine Gefühle nur allzu deutlich merken ließ, so daß niemand darüber im unklaren sein konnte.
Unter anderem hatte ich mir einmal eine gestickte Geldbörse aus dem Kloster schicken lassen, und als ich sie ihm gab, warf er die seinige einer Kammerfrau seiner Mutter zu, aber ehe die Börse in die Hände der Kammerfrau fiel, fing ich sie in der Luft auf, um sie selber zu behalten und dies in Gegenwart der Marquise von Sillery, einer der strengsten und ernstesten Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe.
Natürlich wollte ich ihm nichts von meinen Gefühlen in Worten aussprechen, suchte aber dennoch mit Leidenschaft ein Zusammentreffen unter vier Augen, das er mit Sorgfalt zu vermeiden schien. Als ich den Grund seiner Vorsicht glaubte erraten zu haben, wünschte ich noch heftiger eine besondere Unterredung mit ihm, die ihm zeigen sollte, wie weit ich davon entfernt sei zu vergessen, was ich mir selbst schuldig war.
Endlich sollte ich diese Befriedigung haben. Wir wollten eines Tages unseren gewöhnlichen Spaziergang machen. Fräulein von Sillery fühlte sich aber nicht wohl und ließ sich entschuldigen. Die Mutter, die nur an die Unterhaltung ihres Sohnes dachte, hieß mich allein mit ihm gehen. Es gab keine Möglichkeit, dies auszuschlagen, und wir wandelten zusammen erst durch den alten Park und dann weit hinaus über die Wiesen an dem weidenbestandenen Bach entlang, den man die Auge nennt. Er ging, ohne ein Wort zu sprechen, neben mir her, mehr in Verlegenheit als ich selber.