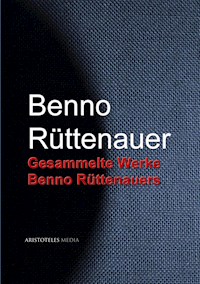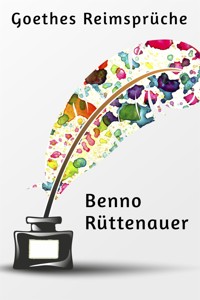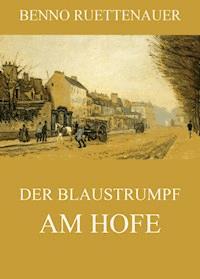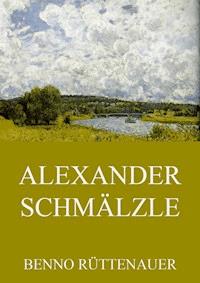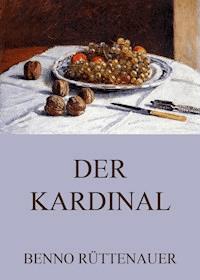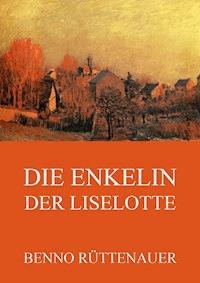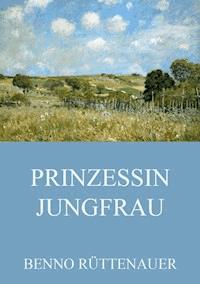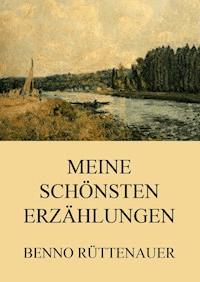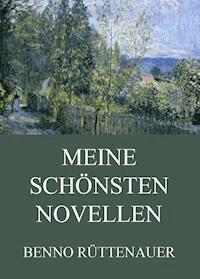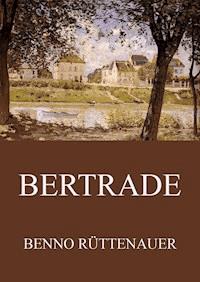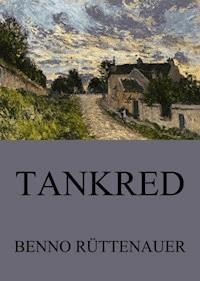
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 1940 in München verstorbene Rüttenauer brillierte immer wieder mit seiner Erzählkunst, mit der er auch schwierige historische Themen exzellent darstellen konnte. In "Tankred" geht es um eine höchst pikante Affäre im französischen Hochadel Mitte des 17. Jahrhunderts. Dem Hause Rohan wird ein Kind untergeschoben, das schon bald für sehr viele Verwicklungen sorgen wird ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tankred
Benno Rüttenauer
Inhalt:
Tankred
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapital
Siebzehntes Kapitel
Tankred, B. Rüttenauer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849643522
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Tankred
Erstes Kapitel
Handelt von dem, der Tankreds Vater sein sollte
Herr Roger von Rabutin, Graf von Bussy, der auch in diesen verwirrten Tagen auf Seite des Königs kämpfte gegen das frondistische Parlament und die Stadt Paris, wofür er später schlecht genug belohnt wurde; er schrieb unterm 2. Februar des Jahres 1649 an seine Base, die Marquise von Sévigné auf Schloß Livry in der Normandie, unter anderem folgendes:
In dem verschneiten Wiesental von Fécan, nahe bei Schloß Vincennes, heißt es in dem Briefe, war ich vor drei Tagen Augenzeuge, wie ein feindlicher Angreifer von einem meiner Leute tödlich verwundet niedergestreckt wurde. Der junge Mann, von fast noch knabenhafter Gestalt, das bläßliche Gesicht von einem üppigen Schmuck braungoldiger Locken umgeben, stürzte nur wenige Schritte von mir entfernt jählings von seinem Rappen, offenbar von einer Musketenkugel getroffen, und ich sehe ihn noch, wie er mit der Rechten krampfhaft in den zerstampften Schnee greift, den das helle Blut färbte, das ihm unter der Schulter durch die Kleider sickerte.
An seiner Schärpe erkannte ich ihn als einen Freiwilligen der Parlamentsarmee von Paris.
Wer in Wahrheit dieser Jüngling war ... aber das wäre falsch ausgedrückt, denn niemals wird die Welt das wissen; was er vielmehr vorstellte oder vorstellen sollte, das erfuhr ich und erfuhr die Hauptstadt gleichzeitig mit der Nachricht von seinem erfolgten Tod am andern Morgen.
Das Parlament aber, heute eine souveräne kriegführende Macht gegenüber seinem Herrn und König – was für kuriose Dinge man nicht erlebt! – dieses Parlament in seinem gotisch-finsteren Inselpalast erhielt die verblüffende Botschaft, als gerade seine drei obersten Kammern zu einer außerordentlichen feierlichen Sitzung zusammengetreten waren.
»So hat denn der Tod gesprochen und unseren Spruch unnötig gemacht;« mit diesen Worten löste der erste Präsident die kaum begonnene Gerichtssitzung auf, und all die würdigen und machtgewaltigen Männer in den scharlachfarbenen und violetten Talaren und den hohen Hermelinmützen gingen auseinander mit Gesichtern, wie Leute, die vom Kirchhof kommen. Ihr werdet sie Euch vorstellen, verehrte Base. Schon oft hatte das Machtwort eines Königs oder Ministers diese Trotzigen und Stolzen des Gerichtspalastes unwürdig auseinander getrieben, wenn sie sich weigern wollten, eine neue Steuerforderung oder sonst ein Willkürgesetz zu sanktionieren; etwas wie gestern aber war der illustren Gesellschaft noch nicht widerfahren. Denn da ist ihre Versammlung gesprengt worden von der allerhöchst eigenen Person Seiner grausigen Majestät des Todes selber, dessen Spruch ihnen sozusagen mit eiskaltem Stahl das Wort vom Munde abgeschnitten, also daß ihnen eine geraume Weile die Mäuler davon offen standen.
Ihr müßt nämlich wissen, meine liebe Freundin, wenn Ihr es nicht sonst etwa schon erfahren habt, daß die Hermelinmützen sich an dem genannten Tag versammelt und sich konstituiert hatten als außerordentlicher oberster Gerichtshof, zu dem Zweck und in dem Vorhaben: den »zugelaufenen Vagabunden« – wie die Königin Anna von Österreich und der Hof den jungen Mann vom Tal zu Fécan nannten – auf Begehren seiner Mutter, der Herzoginwitwe von Rohan, feierlich in seine Rechte einzusetzen: d. h. ihn als einzigen und rechtmäßigen Sohn des verstorbenen Herzogs Heinrich von Rohan, Fürsten von Leon und Pair von Frankreich, anzuerkennen, ihm alle hierausfließenden Ansprüche auf Namen, Rang und Besitztümer des genannten Herzogs Heinrich zuzusichern, für seine Person ebenso wie für alle seine Nachkommen, und jeden Widerspruch, der sich dagegen erheben sollte, zum voraus und auf alle Zeit und Ewigkeit für null und nichtig zu erklären.
Dieses löbliche Vorhaben der in diesen Tagen der »Fronde« mächtigsten Körperschaft des Königreichs hat der Tod vereitelt.
Und wie diese heilige Majestät (des Todes nämlich) – wenigstens kann einen das Leben dahin bringen, dies zu glauben – öfter eine Wohltat bedeutet, wo sie erscheint, als ein Übel und im ganzen dieser Welt mehr Trost und Linderung spendet als Schmerz zufügt, so hat der Allgewaltige und Unerbittliche (aber Wohltäter der Menschheit trotz allem), so hat der Tod auch in diesem Fall, wo er als der plumpste und roheste Zufall zu walten schien, aller Wahrscheinlichkeit nach Schlimmes verhindert, viel Zank und Streit und tausendfältiges Blutvergießen.
Aber, was schreib ich Euch da ein langes breites, denn gewiß ist auch zu Euch längst die Kunde gedrungen und von diesem »zugelaufenen Vagabunden«, diesem Tankred Ohnenamen, den die Herzoginwitwe von Rohan plötzlich für ihren Sohn anzuerkennen beliebte, und für den sie das Erbe des verstorbenen Herzogs Heinrich, das längst von dessen Tochter angetreten worden ist, nachträglich in Anspruch nehmen wollte. Die wunderliche alte Dame ist nun ihrer Sorge und freilich auch ihrer phantastischen Hoffnungen ledig.
Und jubilieren wird die Tochter.
Und die Hände reiben wird sich Heinrich von Chabot, genannt von Rohan, dem nun niemand mehr seinen neuen Namen und sein anerheiratetes Herzogtum streitig machen wird.
Der Mann hat bei Gott Glück. Wie wird er nun erst tanzen, der ewige Tänzer, der geniale Erfinder der »Chabotte«. Ja, denen, die der Herr lieb hat, gibt er's im Tanz. Und erinnert Ihr Euch noch, wie damals eine Tanzwut über die Jugend kam und die ruppigsten Bärbeißer sich im Menuettschritt übten, als zum erstenmal die Rede ging von der famosen Heirat der Prinzessin Margot mit diesem Herrn von Habenichts?
Aber nicht jeder ist ein Liebling des Herrn. Euer gehorsamster Diener zum Beispiel scheint nicht dazu gehört zu haben. Denn ich war doch wahrlich auch kein schlechter Tänzer; aber Ihr, schöne Base, wäret eben keine Margaret von Rohan. Verzeiht den Scherz einem alten Hofmacher. Es muß aber wahr sein, daß ... genug. Sie rostet aber wirklich nicht. Seid nicht bös.
###
Das eine darf kaum bezweifelt werden, nämlich: daß jener vielberühmte Herzog Heinrich von Rohan, Fürst von Leon und Pair und Marschall von Frankreich, wenn auch nicht dem Blute, so doch dem Gesetze nach, der Vater war des »zugelaufenen Vagabunden.«
Von ihm, dem Herzog, wird also einiges zu sagen sein.
Wie jedermann weiß, war Herzog Heinrich der erste dieses Titels innerhalb seines Geschlechts. Ja, seine stolze Mutter aus dem uralten Hause von Luzignan-Parthenay, hat sich aufs tiefste empört, als sie hörte, daß ihr Sohn von König Heinrich den Herzogs- und Pairstitel bekommen solle. Das heiße, meinte die alte Dame im weißen Haar, den alten stolzen Wappenspruch derer von Rohan»Roy ne puys, Duc ne dagne, Rohan suys«in schimpflicher Weise Lügen strafen.
Denn die von Rohan waren bis dahin außer auf ihren fast königlichen Besitz in der Bretagne auf nichts so stolz gewesen als ihre Abstammung, die sie in gut verbrieften Ansprüchen auf die alten bretonischen Könige zurückführten, mit denen ihre Vorfahren zum mindesten öfter verschwägert waren, wie denn schon in den alten Liedern und Sagen von des Königs Arthus Tafelrunde ein Rohan als Onkel und Vormund des vielbeschrienen Herrn Tristan genannt wird, also daß sich die Überlieferungen dieses Geschlechts bis in die regenbogenfarbigen Dämmerungen der ältesten Fabeln und Poesien hinein verlieren.
Mit den meisten souveränen Häusern von Europa war das Geschlecht zu aller Zeit verschwägert und auch die Lusignanerin, die Mutter unseres Rohan, konnte sich rühmen, von Königen abzustammen und noch dazu von Königen mit einer Aureole absonderer Art. Denn einer ihrer Vorfahren, ein Guido von Lusignan, war einmal nichts Geringeres als ein König von Jerusalem und Cypern, was darum bemerkt sein mag, weil die Insel Cypern eine Rolle in dieser Geschichte spielt.
Heinrich von Rohan jedoch, so scheint es, fühlte weniger Stolz in sich als der allzu stolze Wappenspruch seines Hauses ausdrückte. Und darum wurde er außer einem Rohan und Fürst von Leon, der er schon war, ein Herzog und Pair von Frankreich, vielleicht sogar nur aus reinem Gehorsam gegen seinen Oberherrn, König Heinrich VI., mit dem er nicht allein den Namen, sondern auch die neue Religion teilte.
Aber während der königliche Heinrich diese Religion, wenigstens äußerlich, abschwur, weil er meinte, daß Paris wohl eine Messe wert sei, blieb Rohan ihr treu bis in den Tod. Ja, er wurde nach der Ermordung des großen Königs durch Franz Ravaillac erst recht das anerkannte Haupt der hugenottischen Partei, die sich durch ihn gegen König Ludwig XIII. und seinen Minister Richelieu zu jenen wiederholten verheerenden Kriegen aufreizen ließ, die den ganzen Süden unsers schönen Frankreichs verwüsteten, und in deren Verlauf der Herzog Rohan, das kann niemand leugnen, sich einen großen und wohlbegründeten kriegerischen Ruhm über ganz Europa hin erwarb, aber doch seine Sache zuletzt verlor, wenn auch weniger durch seine als der anderen Schuld.
Aber diese auf dem großen Schauplatz der Weltgeschichte trotz aller Mißerfolge glanzvolle Persönlichkeit war der bedauerlichste Schwächling auf dem Boden der eigenen Familie.
Man erriet dies, indem man ihn nur ansah. Sein Haupt war schon früh kahl über der hohen schmalen Stirne, seine großen Augen blickten müd und waren eher die eines Apostels oder Predigers, als die eines Feldherrn. Seine Mundwinkel über dem verkürzten Kinn zogen sich wie erschlafft nach unten. Der ganze Ausdruck seines Gesichtes hatte wenig Kriegerisches trotz des steifgewichsten dreispitzigen Bartes, den er trug in Nachahmung des großen Schwedenkönigs Gustav Adolf.
Zu allem Unglück mußte dieser Mann an eine Frau geraten, die sich seiner wenig würdig zeigte. Sie hieß Margarete von Bethune und ihr Vater war der vielgenannte Minister Herzog von Sully – Sully-Bethune – ein großer Finanzmann in seiner Art, aber sonst, wie sich das oft bei Leuten dieser Berufsart findet, ein unfeiner und fast roher Mensch.
Man erzählt sich von ihm, daß er einmal die zehnjährige Margaret, seine Tochter, wegen einer Unart vor mehreren anwesenden Personen gezüchtigt habe mit Entblößung des hierzu besonders geeigneten Körperteils. Und dann, indem er mit Kennerblicken den zuckenden zarten Körper seinen Gästen zeigte: Da sieht man schon, scherzte er unter Behagen – – – aber nein, seine Worte waren zu canaillenhaft, als daß man sie einem Leser, den man achtet, oder gar einer ehrbaren Leserin schwarz auf weiß bringen dürfte.
Mit kaum sechzehn Jahren wurde die kleine Margaret dem Herzog Heinrich vermählt. Die Trauung vollzog sich unter großem soldatischen Gepränge in dem protestantischen Tempel zu Charenton, damals noch eine Hochburg des Kalvinismus im Angesicht von Paris, ein Art Zion und neues Jerusalem für alle Rechtgläubigen (wie sie sich nannten) des ganzen Königreichs. Man mußte die Braut, gekleidet in weißen Taft, auf einen Schemel stellen, so klein war sie noch, und der Prediger Dumoulin, ein Spaßvogel trotz seinem Predigertum, fragte lachend, ob das Kind getauft werden wolle.
Aber unmittelbar nach dem Trauakt wurde dieses Kind zur Herzogin gekrönt und angetan mit dem dukalen Mantel von Hermelin und blauer Seide. Und als sie darauf, zur Rechten der Herzoginmutter, jener alten Dame im weißen Haar aus dem Hause Luzignan-Parthenay, ihren feierlichen Einzug in Paris hielt, durch die Vorstadt von Sankt Anton, da sah sie nicht anders aus als eine kleine Königin.
Ohne ihren Gemahl hielt sie diesen Einzug in den herzoglichen Palast von Rohan in dem Stadtteil, genannt das Marais, nahe bei Unserer Lieben Frau zu den blauen Mänteln. Der Herzog selber stieg vom Traualtar hinweg in den Sattel, und an der Spitze seiner zahlreichen Krieger, die mit ihm zur Hochzeit gekommen waren, alles mächtige Herzöge und Grafen aus der Languedoc, zog er gen Grenoble in das Heerlager des Königs Heinrich, der damals gegen Savoyen im Felde stand.
Das eheliche Beilager mit seiner allzu jungen Frau mußte verschoben werden. Es wurde erst zwei Jahre später während eines Waffenstillstandes vollzogen und blieb lange unfruchtbar. Erst im neunten Jahre schenkte Margarete von Bethune dem Herzog eine Tochter.
Ich sagte im neunten Jahr, nicht im neunten Monat. Denn wenn man auch bei einem so freudigen Ereignis die Arithmetik mit Fug und Recht aus dem Spiel lassen sollte, gibt es doch immer Leute genug, die es gerade bei solchen Gelegenheiten nicht unterlassen können, peinliche Berechnungen anzustellen. Und da Herzog Heinrich, immer von kriegerischen Unternehmungen in Anspruch genommen, nur selten und stets nur auf kurze Zeit, auf einen Sprung sozusagen, seine Gemahlin besuchte, wollten jene Rechner herausgefunden haben, daß die kleine Prinzessin, sie hieß Margaret wie ihre Mutter, trotz der neun Ehejahre noch immer um einige Monate zu früh auf die Welt gekommen sei.
Doch wie es sich nun auch mit ihr verhalten mag, sicher ist so viel, daß bald nachher der Herzog von Candale ganz allgemein als der Geliebte der Fürstin oder Herzogin von Rohan – sie ließ sich gern als Hoheit anreden – bezeichnet wurde.
Dieser Candale war der ältere Bruder des durch seinen Feldherrnruhm allgemein bekannten Kardinals von La Ballette. Er selber wurde durch nichts berühmt als, wie gesagt, durch seine allzu öffentlichen und allzu skandalösen Beziehungen zu der genannten Fürstin, deren Gemahl gerade jetzt in der Languedoc alle Hände voll zu tun hatte, um mit seinen Verbündeten den Truppen des Kardinals Richelieu standzuhalten.
Zweites Kapitel
Erzählt mehr von Herzog Heinrich und seiner schönen Gemahlin
Der Herzog selber war mit seiner Frau sehr zufrieden. Das kleine lebhafte Persönchen – sie muß nach dem, wie man sie im Alter gesehen hat, sehr hübsch gewesen sein – liebte ihren Mann auf ihre Weise. Sie kam oft zu ihm ins Lager oder in seine Standquartiere zu La Rochelle und Montauban, zu Castre und Aigues-Mortes, zu Montpelliers und Pisme, und wie sonst die festen Plätze der Hugenotten in der Languedoc heißen mochten, und führte wiederholt für ihn und nicht ohne Glück die Verhandlungen mit Richelieu und der Königin Anna von Österreich, mit der sie in einer Art freundschaftlichem Verhältnis stand. Man sprach einmal von ihr bei der Marquise von Rambouillet. »Oh, rief Tallemand des Réaux, in einem Land, wo der Ehebruch erlaubt wäre, würde sie nicht nur für eine tüchtige, sondern auch für eine höchst ehrbare Frau gelten.« »Als ob bei uns, antwortete boshaft der Marschall von Bassompières, der Ehebruch etwa nicht erlaubt sei.«
Selbst in ihren Liebeshändeln verlor sie die Politik ihres Gemahls nicht ganz aus dem Auge und brachte wirklich den Candale dahin, sich von seiner Frau zu scheiden und zu Charenton feierlich den katholischen Glauben abzuschwören, was ihr vom Hof in höherem Grad übel genommen wurde als alles andere.
Von ihrem lebhaften und brüsken Temperament erzählte man eine Menge drolliger Geschichten. Als sie einmal von einem Ball im Louvre in ihrer Sänfte nach Hause kehrte, wurde sie hinter den Markthallen nahe bei dem schönen Brunnen der Unschuldigen Kinder von Räubern überfallen, die es auf ihr kostbares Perlenhalsband abgesehen hatten. Die Dienerschaft war im Nu überwältigt, die Herzogin aber wehrte sich heldenhaft, indem sie das Kleinod an ihrem Hals krampfhaft mit ihren Händen umschlossen hielt. Da griff einer der Männer nach einem andern Kleinod, das sich sonst die Damen am wenigsten gern von fremden Händen berühren lassen. Die Herzoginhoheit aber lachte. Das werdet ihr mir schon lassen müssen, sagte sie verächtlich; meine Perlen haben es nötiger verteidigt, zu werden. Und sie hat wirklich ihre Perlen gerettet.
Sie war eine Frau von praktischem Verstand. Dennoch konnte sie, und all ihrer intriganten Rührigkeit zum Trotz, nicht hindern, daß das politische Schiff ihres Eheherrn immer mehr mit vollen Segeln dem Untergang zusteuerte.
Der gute Herzog hatte kein Glück mehr. Die Wahrheit zu sagen, war er eine Art personifizierter Anachronismus geworden. Er fand sich nicht in die Veränderung der Zeit. Während seine Verbündeten längst die Religion nur noch als Vorwand benützten zur Verwirklichung eigennütziger und sonderbündlerischer Absichten, um die es ihnen allein noch zu tun war, meinte er immer noch in aller Aufrichtigkeit, einzig für seinen Glauben zu kämpfen. Er mißkannte gründlich seine Genossen, die bereits anfingen, sich über ihn lustig zu machen. Seit dem Edikt von Nantes erfreuten sie sich mehr als hinlänglicher Duldung in Religionssachen, und so mußten die Verständigen unter ihnen immer deutlicher fühlen, daß es ihnen schlecht anstand, für eine Sache zu kämpfen, die ihnen in Wahrheit niemand streitig machte. Daß der Rohan und sein Bruder, der Fürst von Soubise, damals von Spanien, dem Todfeinde Frankreichs, Subsidien bezogen und zuletzt Englands Hilfe gegen den König anriefen, setzte ihren Patriotismus in ein verdächtiges Licht und mißfiel den meisten in der eigenen Partei. Die mächtigsten ihrer Häupter folgten jetzt sogar dem Beispiel der Bourbonen und traten öffentlich in die Kirche zurück.
Besonders verstand es Herzog Heinrich nicht, gewisse unzeitgemäße Äußerlichkeiten rechtzeitig abzulegen. Er trug über seinem schwarzen Küraß den berüchtigten hugenottischen Kragen noch immer um keinen Finger weniger breit als zur Zeit des dritten Heinrich, und sein dreigespitzter Bart war in Frankreich auch längst außer Mode.
Und nie hielt er seinen Einzug in eine eroberte Stadt, ohne daß drei Prediger mit brennenden Kerzen und einer riesigen aufgeschlagenen Bibel vor ihm her schritten. Vielleicht glaubte er auch hierin seinen Patron, den heiligen Gustav Adolf von Schweden, würdig nachzuahmen.
Herzog Heinrich selber war mindestens ein ebensoguter Prediger wie Feldherr. Auf der vielbeschrienen Kirchenversammlung zu Saumur hielt er an den reformierten hohen Adel eine Allocution, die folgendergestalt schloß: »So laßt uns, meine Brüder in Christo, abtun alle weltlichen Gedanken, abtun von uns alle sündige Ehrsucht und feige Rücksicht auf irdisches Gut und persönlichen Vorteil, um einzig und mit allen unsern Kräften zu arbeiten am Ruhme unsers Erlösers und seiner heiligen Kirche. Dann wird die Hand des Herrn mit uns sein in all unserem Beginnen. Und wahrlich, kein frommerer Ehrgeiz könnte uns beseelen, als der ist, die verfolgte Kirche Gottes zu erretten und mächtig zu machen gegen ihre Feinde. Dazu wirke jeglicher nach den Kräften, die ihm Gott verliehen hat. Alle irdischen Güter sind eitel Kot und Staub vor dem Herrn und unser ganzes Leben hienieden hat keinen andern Sinn, als damit das ewige im Jenseits zu verdienen. Darum laßt uns ebenso all unsere Kraft aufwenden zur Verherrlichung Gottes, wie unsere Gegner zum Gewinn des Teufels. Laßt uns sie nachahmen in ihrem unermüdlichen Eifer, aber zur Vermehrung des Reiches Christi, nicht Satans, wie sie tun in ihrer Verruchtheit.«
Leider hatte die schöne Predigt nicht den gewünschten Erfolg bei seinen vornehmen Standesgenossen. Die einen lachten, die andern schüttelten unwillig den Kopf. Sie meinten, die Zeiten der Apostel und Albigenser seien doch wohl vorüber.
Um diese Zeit war es auch, daß Heinrich von Bourbon, Fürst von Condé, ihm einen harten Brief schrieb wegen seines geheimen Einverständnisses mit den Todfeinden Frankreichs, den Spaniern und Engländern. Heinrich von Rohan antwortete darauf als Christ, ohne auch nur mit einem Wort auf des Bourbonen ungeheuerliche Beschuldigung der Felonie einzugehen, einzig besorgt um das Seelenheil des Fürsten.
»Zuletzt bleibt mir nur übrig,« so schloß seine fromme Epistel, »als Gott zu bitten, daß er Euch nicht behandle nach Eueren Werken, vielmehr Euch die Gnade angedeihen lasse, zur wahren Religion zurückzukehren und darin zu verharren. Ja, möchte doch Gott in seiner Barmherzigkeit Euch würdigen, wie er Euren Herrn Vater und Großvater gewürdigt hat, aufs neue der Verteidiger unserer heiligen Kirche zu werden: dann könnte ich freudigen Herzens mich bekennen, auch in Hinsicht auf Eure Person, wie jetzt nur in Anbetracht Eures Ranges, als
Euern Diener H. v. R.«
Herzog Heinrich, in seiner Nachahmung des großen Schwedenkönigs, vergaß eines: daß wir Franzosen eine andere Rasse Menschen sind als die fischblütigen Nordländer und daß in unserem schönen Frankreich kein Fluch tödlicher wirkt, als der der Lächerlichkeit. Er begriff auch nicht, daß die Franzosen, und die im Süden mehr noch als wir andern, zwar einen Glauben mit einem an Raserei grenzenden Fanatismus zu ergreifen vermögen, der aber, einmal lau geworden, leicht in Frivolität umschlägt und, dem bewegten Geist gallischer Rasse entsprechend, einer Spottlust Raum gibt, die manchmal an Gottlosigkeit grenzen mag.
Man verbreitete damals die erste Übersetzung jenes spanischen Buches von einem gewissen Miguel de Cervantes, und bald mußte Heinrich von Rohan es erleben, daß alle Welt ihn mit dem lächerlichen Helden des närrischen Romans verglich. Seine eigenen Anhänger aus der hohen Aristokratie – nur das gemeine Volk hatte seine ehrliche Gläubigkeit bewahrt – nannten ihn schon nicht mehr anders als den Don Quichotte des Evangeliums. Heinrich von Bourbon soll zuerst das Wort auf ihn gemünzt haben.
Kurz, es stand schlecht um seine Sache und noch schlechter um ihn selber; seine ungeheuren Besitzungen waren längst von Richelieu konfisziert.
Dabei verlor er eine Schlacht nach der andern, eine feste Stadt um die andere fiel in die Hände der Königlichen. Nur La Rochelle hielt sich noch. Dieser Platz, der von außen eher einer meerumrauschten und vielgetürmten barbarisch gotischen Burg glich als einer Stadtfestung, wurde durch den hartnäckigen Glaubenseifer seiner frommen Bürger – der Gewerbsmann brachte seiner Religion noch Opfer – wie durch die nicht weniger hartnäckige Brandung des Ozeans zu gut verteidigt. Dennoch mußte auch diese letzte Festung des Kalvinismus sich endlich nach dreizehnjähriger Belagerung übergeben; denn wenn die Hugenotten den Ozean und hundert feste Türme für sich hatten, so kämpften dafür auf Seite Richelieus zwei noch schrecklichere Gewalten, denen keine menschliche Macht je auf die Dauer widerstanden ist: der Würgeengel Hunger und sein entsetzliches Geschwister, die Seuche.
Und als dann La Rochelle, drei Tage vor Allerheiligen des Jahres 1628, sich seinem furchtbaren Belagerer, dem bourbonischen Prinzen Ludwig, Grafen von Soisson, auf Gnade und Ungnade ausgeliefert hatte, da schien es, daß der Herzog Heinrich von Rohan seine Rolle auf dem irdischen Welttheater für immer ausgespielt habe.
Er wurde zwar, wie auch seine Glaubensgenossen, von Richelieu gnädig behandelt. Denn dieser Priester war in erster Linie Politiker und in zweiter Linie noch einmal Politiker. Er kannte in seinem Herzen nur eine Religion, die Religion der Macht. Ihr allein widmete er einen ehrlichen Kultus. Der Glaube der Untertanen galt ihm gleich, wenn sie nur seine schrankenlose Herrschaft duldeten, welcher selbst König Ludwig sich nicht zu entziehen gewagt hätte.
Herzog Heinrich erhielt alle seine konfiszierten Besitztümer, Städte, Burgen, Dörfer und Ländereien zurückerstattet, nur eben mit dem königlichen Befehl, Frankreich unverzüglich zu verlassen und in Venedig Wohnung zu nehmen, bis es Seine Majestät gefallen sollte, ihn zurückzurufen. In dem neutralen Venedig glaubte man den unruhigen Herzog am unschädlichsten aufgehoben.
Das mürrische und verdrossene Gesicht Heinrichs von Rohan, in dem die großen Augen mit dem umflorten Blick und die herabgezogenen Mundwinkel so schlecht zusammen gingen mit dem steifgewichsten dreispitzigen Kriegerbart, dieses melancholische Antlitz war damals jedermann bekannt.
Auch wo er als Sieger in Burgen und feste Städte eingezogen – immer, wie schon erwähnt, mit den drei Predigern, die brennende Kerzen und die Bibel vor ihm hertrugen – hat er nie ein anderes als dieses Gesicht gezeigt, das an das eines armen Sünders erinnerte, der zum hochnotpeinlichen Gericht geführt wird. Wie aber mag er erst dreingeschaut haben, als er nun, nicht mehr als ein Sieger oder Krieger, sondern als ein Unterlegener, als ein Verbannter und Ausgestoßener, mit seinem Gefolge in die stolze Lagunenstadt einzog, um deren Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen.
Die schwarzen Gondeln in der sonst so hellfarbigen Stadt können, schlank und schmal wie sie gebaut sind, selbst einen Frohen an Särge erinnern, und als diejenige, die den besiegten Rohan trug, auf dem großen Kanal unter den prunkvollen Palästen dahinglitt, da mochten die Insassen anderer Gondeln manchmal erschrocken zusammengefahren sein, weil sie einen Augenblick geglaubt hatten, einem Gespenst ins Angesicht gesehen zu haben. Auch mag sich seine Leichenbittermiene kaum erheitert haben, als die Gondel nach kurzer Fahrt an der Portaltreppe des von ihm gemieteten Palastes anstieß und seine Gemahlin und Tochter ihm vom Balkon herunter freudig zuwinkten.
Denn die immer rührige, immer sorgliche und immer reisefertige Frau Fürstin – da sie doch einmal diesen Titel am liebsten hatte – war ihm mit ihrer Tochter, der Prinzessin Margaret, zusammen vorausgeeilt, um dem düsteren Gemahl in dem farbigen Venedig das Haus zu bestellen und die harten Tage des Exils so leicht und sanft als möglich zu machen.
Und wie die ewigen Götter ein Wohlgefallen haben an der liebenden Besorgtheit ehelicher Gatten für einander, das zeigt sich deutlich bei dieser Gelegenheit, indem der Gott Zufall es gütig fügte, daß zur selben Zeit der Herzog von Candale nach Mantua reiste, um an dem dortigen Hof einen Auftrag auszurichten, den er sich von der Königin verschafft hatte. So schien es nur natürlich, das die Fürstin in seiner Gesellschaft reiste.
Wer sich aber in Rohan geirrt hatte, wenn er ihn zu Venedig kaltgestellt glaubte, das war der Kardinal Richelieu. Denn in dieser Lagunenstadt kam der Herzog auf den Gedanken, eine wie herrliche Sache es wäre, ein Bündnis zu stiften zwischen der Republik des heiligen Markus und dem König von Schweden, womit er dem Kardinal sehr unbequem werden mußte. Er begann also zu handeln und zu korrespondieren, und wenn man gewissen Historiographen glauben darf, waren wirklich seine Bemühungen nicht aussichtslos, hat es nur an einem Haar gefehlt, daß ihm sein kühner Plan gelungen wäre.