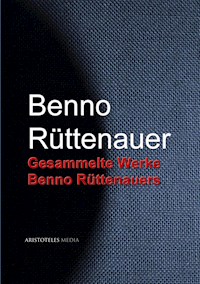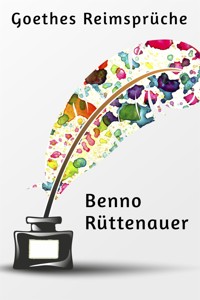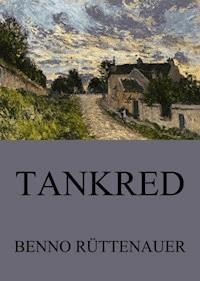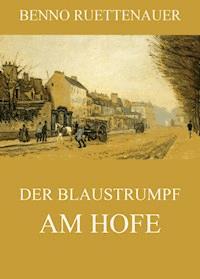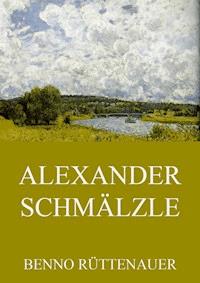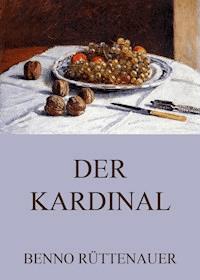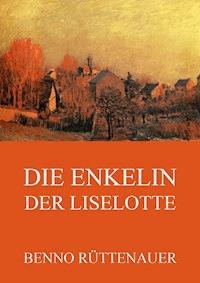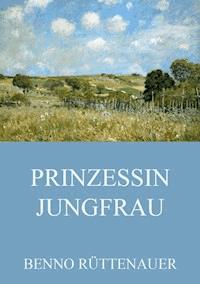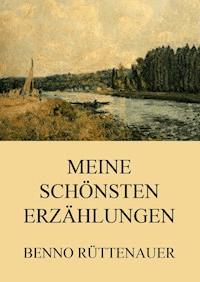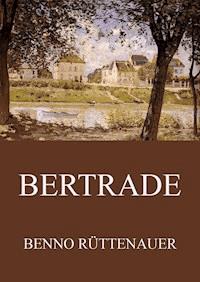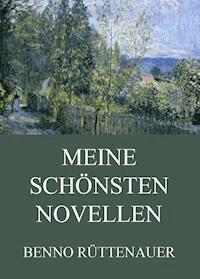
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Sammelband bietet die schönsten Novellen des 1940 in München verstorbenen Schriftstellers. Inhalt: Pandolfino Der geschundene Marsyas Unter dem Feigenbaum Napolitanische Sittlichkeit Der Heilige und der Papst Der nackte Kaiser und der heilige Jovinian Gerechtigkeit muß sein Der feurige Wagen Wie ein toter Bräutigam zu einem lebendigen wurde Die Frau mit den zwei Geköpften Von einem, der sich für den Ritter Blaubart hielt Das Hündchen Kors und Napoleon der Große Die Dose des Herzogs von Savoyen Der Beichtvater als Finanzberater Die gerettete Ehe Der gute Erzbischof Der Feldmarschall als Polizeisergeant Die beiden Minister Vorteil der Nullen Unterirdische Mächte Der Schutzengel des Königs Das Wunder des Abbé Cochin Die kostbare Cafetière Von einem, der es krumm nahm Aristokraten »Eine feine Art« Der Graf von Hoorn Wie der Engländer den Franzosen überführte Die Novize Der Fuchs und die Wölfe Der Papst und der Abt Gerechtigkeit Der Botschafter Das Duell des Prinzen Der Ritter, das Weib und die Schlange
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine schönsten Novellen
Benno Rüttenauer
Inhalt:
Pandolfino
I.
II.
III.
Der geschundene Marsyas
Unter dem Feigenbaum
Napolitanische Sittlichkeit
Der Heilige und der Papst
Der nackte Kaiser und der heilige Jovinian
Gerechtigkeit muß sein
Der feurige Wagen
Wie ein toter Bräutigam zu einem lebendigen wurde
Die Frau mit den zwei Geköpften
Von einem, der sich für den Ritter Blaubart hielt
Das Hündchen Kors und Napoleon der Große
Die Dose des Herzogs von Savoyen
Der Beichtvater als Finanzberater
Die gerettete Ehe
Der gute Erzbischof
Der Feldmarschall als Polizeisergeant
Die beiden Minister
Vorteil der Nullen
Unterirdische Mächte
Der Schutzengel des Königs
Das Wunder des Abbé Cochin
Die kostbare Cafetière
Von einem, der es krumm nahm
Aristokraten
»Eine feine Art«
Der Graf von Hoorn
Wie der Engländer den Franzosen überführte
Die Novize
Der Fuchs und die Wölfe
Der Papst und der Abt
Gerechtigkeit
Der Botschafter
Das Duell des Prinzen
Der Ritter, das Weib und die Schlange
Meine schönsten Novellen, B. Rüttenauer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849644833
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Pandolfino
I.
Die weltgeschichtlichen großen Sünderinnen, wie zuletzt alle übergroßen und blendenden Gestalten der Vorzeit, haben freilich ihre Wurzeln im Boden der gemeinen Wirklichkeit, aber ihr letztes Ausmaß, den letzten Höhenwuchs ihrer Gestalt, womit sie ins Übermenschliche und Unmenschliche hineinragen, verdanken sie doch einer Macht außer ihnen; sie verdanken sie jener mythenbildenden Kraft der Volksphantasie, aus der auch alle Kunst und Dichtung aufsprießt, deren tiefstes Wesen ist zu lügen, wenn man es gemein ausdrücken will, nämlich nicht eigentlich zu verschönern im schwächlichen Sinn des Wortes, sondern zu vergrößern, zu bereichern, zu steigern, emporzutreiben aus dem Gemeinen ins Ungemeine, aus dem Gewöhnlichen ins Außergewöhnliche, aus dem Vernunftbaren ins Wunderbare, aus dem Natürlichen ins Übernatürliche und Widernatürliche, aus dem Menschlichen ins Göttliche oder Teuflische, mit einem Wort über den Menschen hinaus in den Übermenschen.
Und wehe, wenn dann ein Dichter, der nicht Größe genug hat, verführt von der dämonischen Schönheit solcher mythischen Volksschöpfungen, sich ihrer zu seinen Zwecken bemächtigt, dann entstehen notwendig, ästhetisch, nicht moralisch gesprochen, nur widerliche Ungeheuer und Scheusale.
Man weiß, was auf diesem Weg aus jener zaubervollen Lukretia Borgia und aus jener so unglücklichen Johanna geworden ist, jener letzten angiovinischen Königin von Neapel, von der sogar die nüchterne Geschichtsschreibung, freilich ohne sie zu verstehen, eine schöne und große Liebe erzählt, aber natürlich, ihres Nichtbegreifens wegen, schlecht und unverständlich erzählt.
Diese Königstochter war mit sechzehn Jahren an den kränklichen Erzherzog Wilhelm von Österreich vermählt worden, der, eben seiner kranken Lunge wegen, in dem windgeschützten Meran, der Landeshauptstadt seiner neuerworbenen Grafschaft Tirol, seinen Aufenthalt genommen hatte.
Und in diesen hochummauerten, horizontlosen Gebirgskessel sah sich nun die Tochter des lichtweiten parthenopeischen Golfs, sah sich die sozusagen königliche Palme vom Fuß des meerumblauten Posilipo verpflanzt und in einem weltverlorenen dorfartigen Winkelstädtchen einem siechen Manne, den bereits der Tod gezeichnet hatte, zur Genossin bestellt, die von dem glanzvollsten und üppigsten Hofleben kam, das die Welt damals kannte. Die rohen Kriegsmänner in der Umgebung ihres Gemahls, denen Kampf und Trunk das Leben bedeutete, schmeichelten weder ihren zarten Sinnen noch ihrem feinen Geist, also daß es nicht zu verwundern ist, wenn das blutjunge Königskind fast kränker wurde als ihr lungensüchtiger, käsegesichtiger Ehegespons – krank im Herzen vor nagendem Heimweh; und krank zu krank gesellt, gibt eine traurige Musik.
Jene andere Musik aber, die das Königskind aus dem Sonnenland als Erinnerung in tiefverschlossener Seele trug, war nicht nur das Gegenteil davon, sondern von so heißem Klang, daß sie nicht daran denken durfte, wenn ihr nicht unter den langen schwarzseidenen Wimpern auch die Blicke heiß werden sollten wie lodernde Flammen. Aber von so südlichem oder sündlichem Klang sollte dennoch eines Tages auch ihr äußeres Ohr einen wenn auch noch so unvollkommenen Widerhall vernehmen, und dieses scheinbar geringfügige musikalische Erleben wurde nicht nur ihr, sondern noch mehr drei Männern dergestalt verhängnisvoll, daß es zweien davon um den Kopf und dem andern um die Krone ging.
An einem Sonntagnachmittag im April war's, und die junge Erzherzogin befand sich mit zahlreichem Gefolge auf dem Weg zur Hauptkirche der Stadt, um die Vesper zu hören. An ihrer Linken schritt die spitznasige, blonde Gräfin von Trachenstein aus der Steiermark, die gestrenge Frau Oberhofmeisterin; zwei buntscheckige, knirpsige Pagen trugen, wohl in fünf Schritten Abstand, das schwere Schleppkleid der Fürstin; die übrigen Herren und Damen folgten hinterdrein. Aus den dunklen Feueraugen der Angiovinerin blickte es wie zorniger Mißmut. Die bäuerisch plumpen Pfeiler der Gewerbelauben, unter denen sie herschritt, spotteten ihrer schlanken grazilen Gestalt, und wie einen Druck empfand sie die dunklen, allzu niederen Gewölbe, die eine hohe, stolze Aufgerichtetheit unmöglich zu machen schienen. Wirklich war, zwar nicht für ihre Gestalt an sich, aber für ihre ellenhohe zuckerhutförmige Haube, von langen Schleiern leicht umflattert, die geringe Höhe der Gewölbkappen kaum genügend. Vielleicht waren es aber auch andere, mehr innerliche Dinge, die sie mißgelaunt stimmten, daß ihre dunklen Augen fast zornig böse Blicke warfen, die sich aber dann plötzlich sonnenhaft erhellten.
Das wurde bewirkt durch eine Musik, die plötzlich in einiger Entfernung anhub, wie die verstoßene Tochter der parthenopeischen Nymphe in diesem Land der Hyperboräer nie gehört hatte, woran sie aber die Erinnerung aus frühester Kindheit in sich trug. Die hohen quirlenden Töne eines Dudelsacks waren es, und die sich überhastenden, sich übersteigenden und manchmal sich frech überschreienden Triller konnten, so schien es ihr, nur die Begleitung sein zu jenem wilden napolitanischen Volkstanz, dem die königliche Prinzessin als Kind einige Male zugeschaut hatte. Bei dieser Erinnerung verschwanden die stumpfen, klotzigen Pfeiler zu ihrer Seite und die schwarzen, schmutzigen Mauern und niederen Gewölbdecken, und vor ihr weitete sich unter unendlicher Lichtbläue der gelbe Strand von Santa Lucia, der den perlmutterschimmernden Spiegel des unabsehbaren Golfs wie ein goldener Rahmen umschmiegte. Aber das war natürlich nur ein augenblickliches Traumgesicht. In Wahrheit stieß der Zug der fürstlichen Kirchgänger auf einen gedrängten bäuerlichen Volkshaufen, der mit aufgesperrten Mäulern dieser unerhörten, wilden Tanzmusik lauschte. Den Tanz selber mußte man sich dazudenken, es sei denn, daß man die grimassenhaften Sprünge und Pantomimen eines grasgrün bekleideten Äffchens auf der Schulter des Dudelsackpfeifers dafür nehmen wollte.
»Platz, Platz! ihr Leute«, riefen jetzt die Hoftrabanten die Menge an, die sofort ehrfurchtsvoll auseinander wich, daß der fremde Spielmann der Fürstin frei vor Augen stand, ein hagerer, brauner Junge mit roter Schlappmütze auf dem schwarzen Hinterkopf und schwarzem Faltenmantel über rotem Hemd, kurz, ein unverkennbarer allerliebster Neapolitanerbengel, der beim Anblick der jungen Erzherzogin sich die Mütze herunterriß und in beide Knie niedersank, während er, die feurigen Blicke auf die Fürstin geheftet, die schrillen und hastenden und sich überstürzenden Triller seiner wilden Tanzweise sehr wirksam in ein sanftes Adagio überleitete in langgezogenen, fast klagenden Tönen, womit auf dem Golf von Neapel in hellen Mondnächten die Fischer auf unendliche Entfernungen hin im Zwiegesang Strophe und Gegenstrophe einander zusenden.
Die Erzherzogin Johanna stand eine kleine Weile wie im Bann. Und deutlich war ihr anzusehen, wie sehr sie Lust hatte, den tönegewaltigen Sendboten der Heimat zu sich heranzurufen, um auch in seinen Worten den süßen Gruß der Heimat zu hören; aber das spitznasige, schmale Gesicht der hageren, blonden Frau Oberhofmeisterin nahm einen solchen Ausdruck von Strenge und Härte an, daß der jungen Erzherzogin gänzlich der Mut entfiel. Sie griff nur noch rasch in ihre Gürteltasche und warf ihrem kleinen Landsmann ein Geldstück zu, der es geschickt auffing und inbrünstig küßte, was auch das grasgrün bekleidete Äffchen pantomimisch nachahmte, und bei welchem Anblick die Nase der Frau Gräfin von Trachenstein noch spitziger wurde. Denn diese Dame war offenbar die Großmutter oder Urgroßmutter jener Spottgeburt von höfischem Ungeheuer, das später unter dem Namen der spanisch-habsburgischen Hofetikette über zwei Jahrhunderte lang die Fama von ganz Europa in Atem hielt; was nun freilich, wenngleich in anderm Sinn, auch dem Königskind Johanna widerfuhr, infolgedessen ein schwaches menschliches Wesen zur eingefleischten Teufelin werden mußte – im Munde eben jener Frau Fama. Und so kann man sagen, daß die beiden Frauen, wie sie jetzt, den beglückten Dudelsackpfeifer hinter sich lassend, dem spitzbogigen Kirchenportal zuschritten, recht eigentlich die Symbole zweier feindlicher Mächte darstellten, die besonders in den höheren und höchsten Regionen der menschlichen Gesellschaft seit ewig um den Sieg miteinander kämpfen, der doch, wenn er, auf der einen oder andern Seite, ein letztgültig vollständiger je werden sollte, das Menschentum in diesen Regionen so oder so mit gleicher Sicherheit vernichten müßte.
Für diesmal aber hatte das eine Prinzip, das der Gouvernante, einstweilen gesiegt, und es siegte auch noch einmal am darauffolgenden Sonntag, wo sich der gleiche musikalische Auftritt wiederholte, ohne zu etwas Weiterem zu führen.
Eine andere Gestalt aber bekam dann die Sache am Montag danach bei dem vormittägigen Messegang der Herzogin. Wieder staute sich eine Volksmenge vor der Kirche, aber was sie umstanden und umgafften, war jetzt, wenn schon dieselbe Person, kein lustiger Pfeifer mehr und Spielmann, sondern ein ertappter Dieb, ganz ohne seinen geliebten Dudelsack und ohne das grasgrün bekleidete Äffchen. Der junge Neapolitaner hatte nämlich unter den Lauben am offenen Bäckerladen ein Weizenbrötchen stibitzt, dabei war er ertappt worden und sollte nun dafür öffentlich ausgepeitscht werden. Die Stockknechte hatten ihm bereits die Kleider vom Leib gerissen; wie sie ihn aber nun ergreifen wollten, in seiner wundervollen braunen Nacktheit, um ihn auf die Schranne niederzuzerren, da stieß er einen Schrei des Entsetzens aus. Hatte er das Herannahen der Erzherzogin bemerkt?
Sie jedenfalls wurde von seinem Schrei getroffen, und diesmal tat sie, alle äußeren Rücksichten vergessend und nur dem inneren Antrieb folgend, nicht beachtend auch die dünnen verkniffenen Lippen und spitze Nase der hagerblonden Frau Oberhofmeisterin, tat sie so rasche Schritte gegen den gaffenden Volkshaufen – trotz der unbequemen langen Schnabelschuhe –, daß sogar der eine der kleinen Pagen, der zugleich ihr Stundenbuch trug, sich ihre Schleppe aus der Hand entfahren ließ. Doch das hatte nichts zu bedeuten, auch die bäuerliche Menge wartete nicht erst auf einen Heroldsruf, sondern wich von selber zu einer breiten Gasse auseinander. Ein Leuchten wie von einem Blitz unter den langen, schwarzseidenen Wimpern der Fürstin hervor, begleitet von einer heftig abwehrenden Bewegung des Armes – daß ihr langer, spitzer Hängeärmel dabei wie ein gnadenverkündendes Fähnlein flatterte –, scheuchte die betroffenen Henkersknechte weit hinweg von dem Körper des nackten Adonis, der jetzt nicht ohne Grazie in die Knie sank und zu seiner Retterin seine Arme ausgebreitet emporhob. Die erregte Königstochter sprach kein Wort, aber mit ihren Fingerspitzen, wie sie rosig aus den gehäkelten Halbhandschuhen hervorschauten, berührte sie die Schulter des Knaben; damit weihte sie ihn zu ihrem Eigentum und machte ihn unberührbar und unnahbar für die schmutzige Bratze eines kommunalen Schergen.
Mit einem Semmeldiebstahl also machte diesmal ein Mann seinen Eintritt in die Weltgeschichte; denn daß Ser Pandolfo Graf von Alopo dieser für alle Zeiten angehört, wird niemand bestreiten. Für seinen Semmeldiebstahl wurde ihm die Strafe trotzdem nicht geschenkt, er erhielt sie sogar ins Ungeheure vergrößert und in demselben Ausmaß, wie sein seltsames Schicksal sich seither ausgewachsen hat, aber bis dahin waren noch weite Wege.
Pandolfino oder auch kurz Dolfino nannte ihn mit schmeichlerischem Diminutivum das Königskind aus Neapel, das seltsamerweise, und wer weiß von was für Mächten, dazu bestellt worden, auf der landesfürstlichen Burg zu Meran eine Zeitlang die Rolle einer Erzherzogin von Österreich zu spielen, was doch nicht so recht ihr Fach war.
Pandolfino nannte sie ihn, und er war ihr Page geworden, trotz der Oberhofmeisterin Gräfin von Trachenstein; denn der kranke Wilhelm von Österreich hatte keinen Grund oder auch vielleicht nur nicht den Mut gefunden, seiner Gattin, die ihn so selten mit einer Bitte beehrte, in einer so geringfügigen Sache wider Willen zu sein, also daß jetzt, zur Abwechslung, das Prinzip der Gouvernante dem andern, dem Entgegengesetzten, das Feld räumen mußte.
Pandolfino nannte ihn das Königskind Johanna, wenn er das Knie vor ihr beugte und sie ihm die Wange streichelte, der aber auch ein gar so hübscher und gar so aufmerksamer Page war und mit dem sie – es bedeutete dies kein Kleines – in den süßen Lauten ihrer Kinderheimat plaudern konnte und ganz anders als mit ihrer zahnlosen alten Amme, die in dem nordischen Klima von Tag zu Tag schwerhöriger würde, und ganz anders auch als mit dem sehr dienstwilligen, doch leider etwas säbelbeinigen Ser Martino Petruccini, der ihr als ihr Oberstallmeister nach Meran gefolgt war, aber immer nur von Dingen redete (und geredet haben wollte), die nun einmal dem Königskind kein Vergnügen machten.
Aber konnte sie denn ein Gefallen finden an dem, was in knabenhafter Ruhmredigkeit Pandolfino an sie daher plauderte und mit fast komisch leidenschaftlichen Versicherungen und Schwüren untermischte?
Nämlich ganz und gar nicht aus Zufall sei er nach Meran gekommen, sondern als elfjähriger Knabe habe er die Prinzessin Johanna bei ihrer Abreise von Neapel zum erstenmal erblickt, draußen am Hafen, als sie aus ihrer Sänfte trat und, geführt von der Hand ihres königlichen Bruders, die steil ansteigende Brücke zu dem weißleuchtenden hohen Meerschiff, einer venetianischen Gallione, hinaufstieg. Da war es wie ein Zauber über ihn gekommen, und er hatte sich geschworen, wenn er größer geworden, ihr zu folgen, sie aufzusuchen, wo es auch sei, und in ihrem Dienst, wenn sie ihn genehmigen wollte, das höchste Glück seines Lebens zu finden.
Und auch das leckere goldene Weizenbrötchen hatte er nur entwendet, um die Aufmerksamkeit der Erzherzogin mit Gewalt auf sich zu lenken.
In all dem steckte nicht das geringste Körnchen Wahrheit, es war reine Lüge; aber wie er die Lüge vortrug, wurde sie zum Gedicht und wurde er zum Dichter; ja, berauscht von der feurigen Kühnheit der eigenen Rede und dreimal schön in solchen Momenten, wurde er leicht glaubend an sich selber; kein Wunder, wenn er Glauben weckte.
Natürlich sorgte die junge Erzherzogin für seine Erziehung. Sie hatte sich von dem gelehrten Kardinal-Erzbischof von Brixen, der ihr manchmal den Hof machte, einen gewandten Kleriker ausgebeten, von Geburt Toskaner, der mit dem Knaben aus Neapel die Fiametta des Boccaccio und die Sonette des Petrarca las und seinen Zögling in allen sieben Künsten unterrichtete. An diesem Unterricht durften auch die vier übrigen Pagen teilnehmen; aber diese blieben neben dem Napolitaner, dessen Geist sich wie eine prachtvolle exotische Blüte entfaltete, nur arme bescheidene Schattenblümchen, daß man sie mehr für die untertänigen Diener als für die Kameraden des Pandolfino gehalten hätte.
Drei Jahre dauerte dies. Dann eines Tages erlag der Erzherzog Wilhelm seiner Lungenkrankheit und machte seine kinderlose junge Witwe zur eigenen Herrin ihres Schicksals. Sie trug ein Vierteljahr lang in großer Zurückgezogenheit und frommer Herkömmlichkeit Trauer um den Verstorbenen, dann holte sie von neuem ihre goldschimmernden Gewänder von farbiger Seide, von schwerem Brokat hervor, und bald entwickelte sich auf der landesherrlichen Burg zu Meran ein ungewohntes reges Treiben. Das Königskind rüstete sich, unterstützt von Ser Martino Petruccini, ihrem Oberstallmeister, zur Rückreise nach Neapel.
Die kurze Strecke nach Venedig wurde in glanzvollem Zug über das Gebirge zurückgelegt, und dabei tat nun das Königskind etwas, womit sie dem heiligen Prinzip der Gouvernante, um diesen symbolischen Ausdruck beizubehalten, in geradezu unerhörter Weise ins Gesicht schlug. Daß die blondhagere und spitznäsige Gräfin von Trachenstein aus der Steiermark von der Fahrt ausgeschlossen wurde, war wohl selbstverständlich; aber daß die junge Johanna außer ihrer Kammerfrau (soviel Zugeständnis machte sie dem genannten Prinzip) noch jemanden in ihre prunkvolle königliche Sänfte nahm, die von vier Maultieren getragen wurde, und daß dieser Jemand kein anderer war als ihr Pandolfino, den sie zu ihrem Mundschenken erhoben hatte, das verdarb dem allzeit dienstbereiten, aber leider ein wenig säbelbeinigen Ser Martino bedenklich die Laune, so sehr er sich auf diese Reise gefreut hatte wie seine junge glänzende Herrin selber.
Zu Venedig bestieg die Gesellschaft das Schiff, eine weißleuchtende hohe Galeere, fast der Gallione ähnlich, worauf das Königskind von Neapel her ihrem kränkelnden Gemahl zugeführt worden war.
Möge aber niemand hier falschen Vermutungen Raum geben. Die schöne Johanna hat, solange Herr Wilhelm von Österreich die reine Luft von Meran mit seinem verpesteten Atem verunreinigte, dem Elenden pünktlich die Treue gehalten – wenn auch nur wegen der strengen Wachsamkeit der mehrgenannten Gräfin von Trachenstein; denn das heilige Prinzip der Gouvernante ist nicht immer eine verächtliche Spottgeburt und lächerliches Ungeheuer, sondern ebenso oft auch eine wirkliche moralische Person hohen Ranges, die nur leider nicht immer ihren Zweck erreicht, weil eben das andere, das ihr entgegenstehende Prinzip, zwar vielleicht weniger moralisch ist, aber seine Quellen aus einer Macht herschreibt, als welche von den Herren Theologen und Moralpredigern anders genannt wird als von den Philosophen, sofern diese etwa, wie dies wohl zuzeiten kommen mag, nicht selber Moralprediger und Theologen sind. Der Novellist aber, als die dritte Art Richter und souveränste von allen, möchte von den beiden Mächten, die in der menschlichen Gesellschaft, besonders in deren hohen und höchsten Regionen, seit ewig um den Sieg miteinander kämpfen, der Novellist möchte beileibe keiner von beiden zu nahe treten, weil, wie gesagt, der letztgültig vollständige Sieg einer der beiden das Menschentum in diesen Regionen, so oder so, in gleicher Weise vernichten müßte. Aber freilich, ohne den ewigen Kampf beider würde es weder Novellisten noch Novellen geben.
Auf der Burg zu Meran hätte also, ich sagte es schon, auch das schärfste Späherauge nichts entdecken können, was nicht zu dem Verhältnis von Herrin und Diener gepaßt hätte. Aber wie sie jetzt auf dem Deck der hohen weißleuchtenden Galeere von Sankt Markus über die stillen Fluten der blauen Adria dahinglitten, die ehemalige Erzherzogin (wenigstens hatte sie diese Rolle gespielt) in einen hochlehnigen, reich skulptierten Sessel geschmiegt, ihre mit spitzen Schnabelschuhen bekleideten Füße auf einem reich gestickten Kissen, während Dolfino neben diesen Füßen und Kissen, wie ein gezähmter Panther graziös hingestreckt, aus seinen napolitanischen Glutaugen schmachtende Blicke zu ihr emporrichtete: da konnte selbst ein wenig scharfsichtiges Auge unzweifelhaft erkennen, daß das Verhältnis der beiden zueinander ein anderes geworden war, als wie es auf der Burg zu Meran bestanden hatte. Denn es gibt nun einmal menschliche Beziehungen, die ein Königskind einem Bauernkind seltsam ähnlich machen, bis aufs Kleid, das nun gerade in den genannten Beziehungen am wenigsten mitzureden hat. Und wenn die menschlichen Gesetze es der Frau Politik erlauben, die blühende Schönheit und Fülle der Jugend an Siechheit und Unvermögen zu verkuppeln, so ist doch noch nicht ausgemacht, daß auch die höheren göttlichen Gesetze ihre Sanktion dazu geben, da ja auch das mehrfach genannte Prinzip der Gouvernante doch mehr menschlichen als göttlichen Ursprungs ist.
»Schau' nur, Dolfino,« sagte das Königskind, »wie die geschmeidigen Delphine so lustig unsern Kiel umtanzen, als ob sie mit uns im Einverständnis wären und uns einen Hochzeitsreigen aufführen wollten; soll ich dich in Zukunft Delfino nennen?«
Dazu lächelte sie geheimnisvoll, und ein tiefer vielsagender Blick des Pandolfino dankte ihr. Und beide schwiegen wieder, und nur mit stummen Blicken fuhren sie fort, sich heimlich in der Seele miteinander zu unterhalten.
II.
Zu Neapel erwartete die junge Königstochter ein jubelnder Empfang. Denn alles, wonach sein Sinnen stand, versprach sich dies Volk, hoch und niedrig, von der künftigen Herrschaft der schönen jungen Fürstin, überreiche Gnaden und Geschenke und prunkvoll glänzende Feste.
Nur König Ladislas, ihr Bruder – wie er zu dem befremdenden Namen kam, gehört nicht zur Sache –, war nicht dabei vertreten. Er lag, anders wie einst Wilhelm von Österreich, aber in ebenso rettungsloser Siechheit danieder, und zwar an einer Krankheit – warum sollte das nicht gesagt werden –, die man damals in Europa, wo sie noch neu war, die napolitanische nannte. Er war vergiftet worden auf Anstiften der Florentiner, als welche sich von dem ebenso ehrgeizig tatkräftigen wie ausschweifenden König alles versehen mußten, der mit seinem Wahlsprach»Aut Caesar aut nihil«nichts Geringeres als die Herrschaft über ganz Italien anstrebte. Mittels einer ungeheuren Summe hatten sie den Peruginer Arzt Uccellaccio bestochen, der durch das Medium seiner eigenen Tochter dem König das Gift beibrachte, das ihn vernichten sollte. Wahrlich, die Welt, in welche die jungverwitwete Erzherzogin hier in Neapel eintrat, war eine andere als jene, welche sie zu Meran im heiligen Land Tirol verlassen hatte.
Der König also konnte sich bei dem triumphalen Empfang seiner Schwester, die schon jetzt vom ganzen Volke als seine zukünftige Königin umjubelt wurde in ihrer jugendlich strahlenden Schönheit, nicht persönlich einstellen; aber er ließ ihr, da zwei Hofhaltungen in demselben Palast nicht königlich gewesen wären, im Nordosten der Stadt, in dem gewaltigen Capuaner Kastell, ihre Residenz anweisen, wo ein glänzender Hofstaat sie erwartete. Von diesem jedoch schloß sich ihr mürrischer Reisemarschall, der Oberstallmeister Martino Petruccini, freiwillig aus, weil er die Rolle, die dem Mundschenken Pandolfino, dem kleinen Semmeldieb aus Meran, hier zugeteilt wurde, nicht mit ansehen mochte. Denn es blieb bis in die weitesten Volkskreise hinein nicht unsichtbar, daß der genannte Pandolfino, den viele als den Sohn des armen Dudelsackpfeifers Peppo noch gut in Erinnerung haften, bei ihrer zukünftigen Königin noch einen andern Posten einnahm als den des Mundschenken. Wenn das Volk auch nicht wissen konnte, daß es hinter den massigen Rundtürmen des Capuaner Kastells eine geheime Wendeltreppe gab, die auf verborgenen Umwegen zu dem Schlafgemach der jungen Fürstin führte, denn außer der verwitweten jungen Erzherzogin wußte das allein der süße Dolfino, so wurde doch vieles von dem Treiben in jenem Schlafgemach bald allgemeines Gerede.
Wenn da zur Stunde des Morgengebetes der Kaplan in psalmodierendem Ton die Horen las, was der schönen Johanna sichtbar nur ein geringes Vergnügen machte, wahrscheinlich, weil sie die lateinischen Psalmverse und Antiphonen eben doch nur halb verstand, da suchte wie oft ihr gelangweilter Blick in verstohlener Sehnsucht nach dem des Pandolfino, der in erheuchelter Andacht neben der Frau Oberhofmeisterin – aber es war nicht mehr die Gräfin von Trachenstein – hinter dem Priester kniete. Und ihre Haltung vor dem gar nicht unbequemen schmalen Betstuhl aus zierlich durchbrochenem schwarzen Holz und roten Kissen wurde sichtlich immer ungeduldiger, wie die eines kleinen Mädchens in einer langweiligen Unterrichtsstunde, und ihr Herz freute sich schon jetzt auf den leckeren geistigen Nachtisch.
Da war dann die Szene verwandelt, der schwarze Kaplan verschwunden, das Königskind saß behaglich hingeschmiegt in seinem hohen thronartigen Sessel, wie der Betstuhl von braunem durchbrochenen Holz und roten Kissen, und auf zierlichem Schemel zu ihren Füßen saß Pandolfino und las ihr mit seiner einschmeichelnden Stimme und im reinsten toskanischen Klang die wunderbar rhythmischen Perioden, in die Meister Boccaccio seine graziösen Novellen zu kleiden gewußt hat, an denen sich damals, da sie noch neu waren, mehr als je die ganze Welt entzückte.
Und wenn sie dann ihre königliche Sänfte bestieg, weil sie den dicken, dumpfen Mauern entfliehen und des goldenen Lichtes und der seidenweichen Lüfte des napolitanischen Himmels froh werden wollte und des Anblicks von Meer und Inseln und palmentragender Vorgebirge – ihre Sänfte bestieg, um sich nach dem gelben Strand von Santa Lucia tragen zu lassen, die volksbunte Hauptstraße hinunter, die später der Corso von Toledo hieß und heute wieder einen andern Namen trägt: da saß ihr Oberstallmeister – und es war nicht mehr der säbelbeinige Ser Martino – und saß ihre Frau Oberhofmeisterin (aber auch nicht mehr die Gräfin von Trachenstein) bescheiden auf dem schmalen Vorderbänkchen, und ihr bequem zur Seite und herablassend lächelnd saß ihr Ganymed, ihr göttlicher Mundschenk, ahnungslos, daß einst in derselben Straße die Hunde sein Fleisch fressen würden. Denn die Liebe einer Königin, die zum süßesten heimlichen Entzücken noch den höchsten Rausch menschlichen Daseins, den Rausch der öffentlichen Macht verleiht, vermag auch zu Ausgängen von so furchtbarer Tragik zu führen, daß ... doch bis dahin hat es noch weite Wege.
Pandolfino also saß glückdurchschauert an der Seite der stolzen Königstochter, leutselig herablächelnd auf das Volk, unter dem er einst als kleiner verlumpter Bettelmusikant seine Laufbahn begonnen hatte. Dieses Volk aber machte ehrfurchtsvoll Platz und riß die Mützen vom Haupt und begrüßte jubelnd, zusammen mit seiner schönen zukünftigen Königin, auch ihren lockigen Mundschenken, denn das war wirklich noch ein gutes Volk, das nichts Arges darin fand, wenn sich eine junge Witwe zu trösten suchte, wie sie eben konnte.
Waren sie wirklich ein gutes Volk, diese wildleidenschaftlichen, lärmigen Halbafrikaner des neapolitanischen Golfs, denen doch das, was wir Treue nennen, nie eigentlich so recht im Blute lag? Jedenfalls war es noch eine gute Zeit – für Könige; eine Zeit, wo den Völkern das Blut derer, die es einmal als seine Herren anerkannte von Geschlecht zu Geschlecht, eine unverletzliche heilige Sache bedeutete, die nach dem allgemeinen Gefühl selbst von Schuld und Sünde der Person nicht leicht besudelt und verunehrt werden konnte. Und man weiß ja, was dieses Volk sich erwartete von seiner Fürstin. Wie hätte es also ernstlich verstimmt werben können beim Anblick einer leichtfertigen Unbekümmertheit, die seinen Hoffnungen nur um so reichere Nahrung bot?
Wo aber hatte sich das Prinzip der Gouvernante jetzt verkauert?
Ach, es war gar nicht so sehr verkauert und versteckt, es stand sogar in leibhaftiger Gestalt und als gewaltige Macht, dem Pandolfino zum Trotz, zur Seite der jungen Fürstin. Es gehörten dazu die Ersten unter den Großen des Reiches, in vorderster Linie Julius Cäsar, Graf von Durazzo und Herr von Capua, ihr leiblicher Vetter, ferner dessen Schwager, der Graf von Gerace, und endlich der besonders trotzige und stolze Graf von Troja, der oberste Seneschall des Reiches, ebenfalls ein Vetter der jungen Fürstin. Diese hatten ein ganz besonderes Interesse an der Thronfolge der Prinzessin Johanna; denn sie war ja mir von ihrer Mutter her eine Angiovinerin, durch ihren Vater aber, Karl III., war sie eine Durazzo. Wenn sie den Thron bestieg, bestieg ihn mit ihr zum drittenmal das Haus Durazzo, welches durch König Karl III. dem Hause Anjou gleichsam aufgepfropft war. Diese starke sogenannte Partei der Durazzi übte, wie sie die mächtigste Stütze der jungen Fürstin und Thronprätendentin bildete, eben deswegen eine Art Recht der Vormundschaft über sie aus, und wenn darin das Prinzip der Gouvernante auch nicht wie der Zipfel eines Taschentuches zwischen biedermeierlichen Rockschößen hervorguckte, so steckte es doch darin.
Die Durazzi hatten zugleich den nach dem König mächtigsten Mann des Reiches auf ihrer Seite, den Condottiere und Großkonnetabel Sforza. Was für den Pandolfino die Göttin der Liebe, das hatte für den Sforza, den Begründer des späteren Mailänder Herrscherhauses, die Bellona, die gewaltige Kriegsgöttin vollbracht. Öfter als irgendwo hat man es in Italien erlebt, daß sich Söhne selbst der alleruntersten Volksschichten zu machtvollen Ämtern, ja zu fürstlich souveränen Würden erhoben haben, denn Italien ist das Land, wo sogar der Sohn eines Schweinezüchters den höchsten Thron der Welt besteigen und ihm Ehre machen konnte, was nur möglich ist in einer Rasse und in einem Volk, wo Vorurteile wenig, die verwegene Kühnheit aber, wenn ihr Kraft und Begabung zur Seite stehen, alles gelten.
Öfter als irgendwo sind in Italien Spitznamen zu weltgeschichtlichen Namen geworden. Der Konnetabel Sforza hieß eigentlich Mutius Attendoli. Schon seine äußere Erscheinung verriet ihn als Ausländer, wenigstens für Neapel. Seine hohe Gestalt, die die kleinen fettlichen Napolitaner um drei Kopflängen überragte, sowie sein dicker und lang herabhängender ganz blonder Schnurrbart ließen an die ehemaligen Normannen denken, die einst die sizilianischen und napolitanischen Lande beherrscht hatten. Aber noch von anderem Blute her wachsen solche Gestalten auf dem Boden Italiens, nämlich unter den Romagnolen von Dalmatiner Abstammung. In der Tat war Mutius Attendoli, genannt Sforza, ein Bauernsohn aus einem Dorf der Romagna, bei der Stadt Faenza. Als er einmal, ein sechzehnjähriger Knabe, im Garten seines Vaters hart arbeiten mußte, überkam ihn der Unmut über die knechtische Mühseligkeit, und mit einem Schwur warf er seine Hacke hinauf zu dem Feigenbaum über ihm. Geschworen hatte er innerlich: fällt sie wieder herunter, so ist es der Wille Gottes, daß ich weiterarbeite, bleibt sie aber hängen, usw. Die Hacke verfing sich leicht in dem schlangenartigen Geäste des Feigenbaumes, Mutius aber stahl in der Nacht darauf ein Pferd aus dem Stalle seines Vaters, ritt damit heimlich davon, nahm Kriegsdienste, und wenn er in Ausübung dieses Handwerks bei der Beuteverteilung meist sehr gewalttätig war, so hat ihm dies zwar seinen Spitznamen eingetragen, den späteren Namen einer mächtigen Dynastie, aber ihn nicht daran gehindert, ein gewaltiger Feldhauptmann und zuletzt der Großkonnetabel des Königreichs Neapel zu werden. Oder ist er dazu gar noch der Nebenbuhler des Semmeldiebes aus Meran, des göttlichen Mundschenken Dolfino geworden?
Das wird die Geschichte zeigen.
Wenn also wirklich das Prinzip der Gouvernante von der Partei der Durazzi vertreten wurde, so lag es wahrlich in starken Händen. Einstweilen jedoch, wie bereits angedeutet, merkte man nicht viel davon. Diese Großen des Reiches dachten zwar anders als das gemeine Volk über das Verhältnis ihrer Fürstin zu ihrem Ganymed, doch sie machten, nach dem bekannten Sprichwort, dieselbe Miene dazu. Sie dachten: Gönnen wir dem verzogenen Königskind einstweilen seine Possen (als ob die Liebe eine Posse wäre); wird sie einmal erst den königlichen Thron bestiegen haben, wird sie auch begreifen, was sie diesem, was sie uns und sich selber schuldig ist, und der kleine Adonis von Mundschenk wird von ihr absinken wie ein vernutzter Kleiderlappen und wird wieder ein Lump und Bettler sein, wie er immer gewesen war. So dachten sie. Aber das Prinzip der Gouvernante hat sich, wie die Weltgeschichte lehrt, öfter gröblich verrechnet.
Und ein weltgeschichtlicher Tag war es, da König Ladislas von Neapel endlich seinem innerlichen Gift erlag. Wie schon erwähnt, hatte ihn Florenz vergiftet, weil es in ihm seine größte Gefahr erblickt hatte. Damit war zugleich einem näheren und darum noch dringlicher bedrohten Herrscher ein großer Dienst erwiesen worden; denn wer weiß, was aus dem ohnedies arg zerrütteten Patrimonium Petri geworden wäre ohne die Erkrankung des ehrgeizigen Königs? Es stand dort schlimm, und an dem Tag, da das genannte Gift im Castello Nuovo zu Neapel seine letzte endgültige Wirkung tat, mußte zu Rom der alte napolitanische Seeräuber Baltasar Cossa, der als Johann XXII. den Statthalter Christi auf Erden darstellte, in der Nacht heimlich die Flucht ergreifen, um seinen seltsam umgekehrten Gang nach Kanossa anzutreten. Denn nicht der Kaiser war diesmal der Bußgänger, sondern der Papst, und nicht dem Süden entgegen ging die Reise, sondern dem Norden. Konstanz hieß sein Kanossa, und es harrte dort seiner auf dem Konzil ein beträchtlich schlimmerer Empfang, als ihn jener vierte Heinrich einst auf dem finsteren Bergschloß der schönen Markgräfin Mathilde erfahren hat. Seltsamerweise war es die vereinsamte und verödete Burg zu Meran – das Königskind vom Parthenopeischen Golf war ja längst ausgeflogen –, die dem obersten König der Christenheit ein letztes Nachtquartier jenseits der Alpen darbot. Auf einem schwarzen Maulesel, aber anders wie einst der Göttliche, dessen Statthalter er sich nannte, begann er in der Frühdämmerung des andern Morgens, nur von zwei Getreuen begleitet, seinen mühseligen und gefahrvollen Ritt über die Reschen-Scheideck und Finstere Minz auf die Landseck zu. Es war ein lamentabler Zug für den Inhaber einer Würde, die über allen Würden stand auf dieser Welt.
Einen andern Aufzug sah zu derselben Zeit die Stadt Neapel. Durch die volksbunte Hauptstraße, die später der Korso von Toledo genannt wurde und heute wieder einen andern Namen trägt, bewegte sich ein wundersamer goldener Wagen. Er war von sechs weißen Rossen gezogen, geführt an den goldenen Zügeln von den höchsten Würdenträgern des Reiches, das vorderste Paar von dem Grafen von Troja, dem obersten Seneschall, das zweite von Julius Cäsar von Capua, dem Großgonfaloniere, und das dritte von dem Grafen von Gerace, an Stelle des Exkämmerers, welches Amt für das vornehmste galt von allen, aber augenblicklich unbesetzt war. In dem bekränzten Wagen aber, in königlicher Einsamkeit – denn diesmal fehlte Pandolfino – saß die junge Königin Johanna und hielt ihren Triumphzug von dem Capuaner Kastell nach dem Königsschloß, das noch heute, so schwarz und finster es auch aussieht vor Alter, das Neue Kastell heißt. Damals aber war es wirklich noch neu und stieg mit seinen gewaltigen runden Türmen weißleuchtend wie ein Märchenbild aus den blauen Fluten des Golfs empor an derselben Stelle, wo einst griechische Fischer – sie trugen auf ihren schwarzen Haarschöpfen schon dieselben roten und nach vorn oder nach der Seite lappenartig umhängenden Tuchmützen – einen seltsamen Fisch in ihren Netzen gefangen haben, der nichts anderes war als der schlohweiße Leichnam der homerischen Nymphe Parthenope, die manche auch eine Sirene nennen.
Ein wirklicher Triumphzug war's, und an jeder Seggia der Stadt, nämlich den offenen antiktheaterartigen Gerichtsplätzen hielt der Wagen, und der Sprecher des Adels aus der jeweiligen Region hielt eine wohlgesetzte Begrüßungsrede. Und ein ungeheurer Jubel des Volkes umtoste jedesmal die neue erbberechtigte Herrscherin von Neapel.
Und sein Jubelrausch erlitt keine Enttäuschung, noch vor Abend öffneten sich alle Gefängnisse und gaben ihre Gefangenen frei, und in allen Regionen der Stadt wurde unter das gemeine Volk Geld ausgeteilt und leckere Speisen und Wein. Auch die Großen des Reiches, besonders die Partei der Durazzi, waren zufrieden. Die Königin war ja gewissermaßen ihr Werk, und wenn dieses mit so außerordentlichem Pomp in Szene gesetzte Werk mit Jubel begrüßt wurde von der Welt, so konnten sie darin nur ihre eigene Genugtuung finden.
Sie dauerte leider nicht lange. Am dritten Tage nach dem Regierungsantritt der Königin Johanna, d. h. in der Nacht nach diesem Tag, befand sich im Stadtpalast des Grafen Julius Cäsar von Capua eine vierköpfige Versammlung von Männern beieinander, auf deren Gesichtern, auch ohne daß man erst ihre Reden hörte, Arger und Empörung deutlich genug zu lesen standen. Außer dem noch jugendlichen Julius Cäsar waren da die Grafen von Troja und Gerace, zwei schon greisenhafte Gestalten, und der hochstämmige Sforza, der allseitig gefürchtete Condottiere. Die Angelegenheit, die besprochen wurde, betraf am nächsten und persönlichsten den Grafen Gerace. Dieser hatte bei dem prunkhaften Einzug der Fürstin in das Königsschloß den Platz des Großkämmerers eingenommen und darum auf die Verleihung dieses Amtes mit Sicherheit gerechnet. Aber die Königin hatte nun einen andern mit dieser höchsten Wurde bekleidet, nämlich, zum Unrecht das schreiende Ärgernis fügend, den neugebackenen Grafen von Alopo, den Ser Pandolfo, genannt Pandolfino, Semmeldieb und Schleppenträger meranischen Angedenkens. Dieses Allerschlimmsten hatten sich die Grafen wahrlich nicht versehen. Sie waren wie vor den Kopf geschlagen. So furchtbar war ihre Entrüstung, daß sie kaum Worte fanden. Nur ihre verstörten Gesichter zeigten an, daß sie vor dem Unerhörten sich wie rettungslos Verlorene fühlten, wie Leute, die in einen plötzlich aufgähnenden Abgrund starren, der sie zu verschlingen droht.
Aber noch tödlicher als diese Ernüchterung traf sie die Enttäuschung, die der schnauzbärtige Kriegshäuptling, der hochstämmige Sforza und Großkonnetabel ihnen bereitete. Sie hatten nicht anders gemeint, als daß er ihre Ausfassung vollauf teilen werde. Aber er zeigte sich anderer Meinung, wenigstens nahm er das für sie Ungeheuerliche ganz und gar auf die leichte Achsel, die er dabei ein wenig verächtlich zuckte.
Von ausgesprochen königlichem Sinn, will sagen königlicher Klugheit, so meinte Sforza, zeuge allerdings das Gehaben der Königin Johanna nicht. Nein, eigentlich königlich könne man ihr Handeln nicht nennen. »Aber«, so fuhr er fort, mit einem fast verächtlichen Lächeln unter dem herabhängenden, bereits leicht ergrauenden Lippenbart, »warum will man auch aus einem Weib eine Königin machen? Ist das nicht gegen die Natur? Man kennt die Namen berühmter Königinnen. Semiramis hieß die eine, Tamyris die andere, Kleopatra die dritte. Waren das aber Frauen nach der Natur des Weibes oder nicht vielmehr ihr entgegen? Unsere schöne Königin Johanna aber, hat sie nicht, wenn auch vielleicht wenig königlich, so gerade darum echt weiblich gehandelt? Ist es nicht echt weiblich, daß die Frau, was sie liebt, gern groß und herrlich sehen möchte vor der Welt, die das Knie beugen soll vor dem, dem sie selber untertan ist?«
»Ja«, schrie hier der noch jugendliche Julius Cäsar von Capua heraus; »aber es müßte ein Würdiger sein. Ist es jedoch erlaubt, daß eine Königin einen Knecht liebe?«
»Ich gebe dir deine Frage zurück, Julius Cäsar,« rief der Sforza, »ich frage: darfst du den einen Knecht nennen, den deine Königin liebt? Ich habe nicht die Ehre, dem Ser Pandolfo, Grafen von Alopo, näherzustehen, aber man sagt: ihn habe die Muse geküßt, ehe es unsere Königin getan hat. Das ist vielleicht kein allzu großes Verdienst, aber Ihr, Graf von Troja, müßt doch wissen, daß Ihr sogar Euren Namen letzten Endes einem Manne verdankt, den man, wenn er heute lebte, sehr wegwerfend einen Bänkelsänger nennen würde.«
Der alte Graf von Troja hob unwirsch den Kopf, während seine auf dem Tisch liegende knöcherne Hand sich unwillkürlich zur Faust ballte.
»Herr Konnetabel, Ihr sprecht in Rätseln, ich verstehe Euch nicht,« sprach er mit verhaltenem Ingrimm, »ich höre aber: Ihr geht weit in Euren Reden.«
Der lange Sforza zuckte wieder verächtlich mit der Achsel. Er sagte: »Ich bin eines Bauern Sohn.« Und dabei warf er den dreien einen Blick hin, den sie nicht mißverstehen konnten; daß er aber seine Laufbahn mit einem Pferdediebstahl begonnen, fügte er nicht hinzu.
Kurz, die geheime Zusammenkunft der vier Männer nahm für drei unter ihnen einen höchst unbefriedigenden Verlauf. Sie hatten den Großkonnetabel für ihren Verbündeten gehalten, und als er nun weggegangen war, zweifelten sie nicht, daß er ihnen entgegenstand, daß sie zum mindesten auf ihn nicht rechnen durften. Er aber erhielt dafür, daß er so freimütig und allerdings vielleicht nur aus einer augenblicklichen Laune heraus den Anwalt der Königin und ihres Günstlings gemacht hatte, schon nach wenigen Tagen seinen Lohn, freilich so, wie er ihn kaum mochte erwartet haben. Er wurde am Morgen darauf von der Königin in Audienz empfangen, die von der geheimen nächtlichen Zusammenkunft nichts wußte. Sie behandelte ihren Feldhauptmann mit großer Huld, der sich nicht genug wundern konnte über die Wohlunterrichtetheit der jungen Monarchin in allen Fragen der Politik und Regierung, also daß auch er, wie er überhaupt als Kriegsmann mit Potentaten pflegte, frei von der Leber redete und sogar bald eine recht heikle Frage berührte.
»Ihr werdet auf einen Gemahl denken müssen, hohe Frau«, sagte er; »wie Euer eigener Sinn steht, weiß ich nicht, aber das Volk erwartet von Euch einen Erben des Reiches, und Eure Großen werden es sich nicht nehmen lassen, Euch die Möglichkeit dazu recht bald zu verschaffen.«
Die Königin, zurückgesunken in die goldgestickten schwarzen Kissen ihres steillehnigen hohen Stuhles, zeigte dem Sprecher ein unmutiges Gesicht, ja unter den langen, schwarzseidenen Wimpern hervor traf ein fast feindseliger, böser Blick den Sprecher, der deswegen aber seine Rede nicht bereute.
»Ihr habt recht,« antwortete Johanna endlich, »man wird mir deshalb bald genug und lästig genug in den Ohren liegen. Aber gerade du, mein Sforza, sollst mir nicht davon reden. Oder soll ich den Stil umdrehen? Hättest du nicht zu allererst die Pflicht in deiner Stellung, dich nach einer neuen Hausfrau umzusehen? Du bist jetzt schon im dritten Jahr Witwer, ein großes Haus wie das deine bedarf einer Herrin.«
»Ihr spottet meines grauen Bartes, schöne Königin«, versetzte der Konnetabel in überzeugtem Ton.
»Was du redest, mein Mutio,« rief Johanna in heiterer Vertraulichkeit, wie sie ihr eigen war, indem sie sich gegen den vor ihr stehenden Kriegsmann weit vorneigte, »was du redest! Willst du deine Königin zu Komplimenten herausfordern? Nimm dich in acht! Stelle mich nicht auf die Probe!«
Es war mit Scherz gesprochen. Es konnte aber auch als Ernst gehört werden. Und vielleicht haben es zwei Ohren so gehört – die Ohren des Ser Pandolfo, Grafen von Alopo. Als Großkämmerer des Reiches hatte er jederzeit Zutritt zu der Person der Königin. Und so stand er jetzt im langen brokatenen Gewand unter dem erhobenen Vorhang des Eingangs, die Lippen aufeinander beißend, lauernd. Mutio Sforza schien ihm offenbar kein ungefährlicher Nebenbuhler. Er räusperte sich jetzt, sei es unwillkürlich oder willkürlich, und der Sforza begrüßte den Großkämmerer mit stummer Verbeugung. »Ich habe Euch schon zu lange belästigt, hohe Frau«, wandte er sich an die Königin, beugte das Knie, und mit einem leichten Kuß auf die dargereichte lilienweiße Hand verabschiedete er sich.
Aber das lockenumwallte apollohafte Gesicht des Herrn Pandolfo, Grafen von Alopo, erheiterte sich auch jetzt nicht. Seine dunklen, leicht verschleierten Augen ruhten wie mit tiefem Kummer auf der Gestalt der jungen Königin. Sie hatte sich wieder behaglich, fast katzenartig in die goldgestickten schwarzen Kissen ihres steillehnigen Stuhles zurückgeschmiegt. Die von feinen Silberfäden durchwobene amethystfarbene Seide ihres Kleides hob sich wundervoll davon ab, ihr Hängeärmel war zurückgestreift, ihr schimmernder Arm lag lässig auf der hohen Armlehne ihres braunen Holzgestühls. Sie schien auf eine Anrede zu warten.
III.
»Was ist dir, Pandolfino?« fragte die Königin endlich, befremdet von dem düsteren Schweigen ihres Lieblings.
»Königin,« antwortete dieser, »Ihr nährt eine Natter an Eurem Busen.«
»Pfui, Pandolfino, du sprichst ja wie ein schlechter Poet,« versetzte sie lachend, »ich bin doch keine Kleopatra von Ägypten.«
Aber Herr Pandolfo blieb ernst. Und ernst wurde bald auch das zarte Nymphengesicht der Königin, während der Kämmerer, aufrecht vor ihr stehend, die Linke im Gürtel seines lichtgrün-goldblumigen Gewandes, seinen gar nicht harmlosen Bericht erstattete. Dieser betraf die geheime nächtliche Zusammenkunft der drei Häupter der Durazzischen Partei im Stadtpalast des Grafen Julius Cäsar von Capua. Herr Pandolfo war durch seine zahlreichen Späher genau davon unterrichtet. Zwar den Inhalt der Verhandlungen kannte er nicht. Aber nach den Gesichtern, die die Herren geschnitten hatten bei der letzten Audienz, ließ sich nur Schlimmes vermuten. Auch der lange Sforza war beobachtet worden, wie er, ohne alle Begleitung, durch die dunkelsten Treppengäßchen sich nach jenem Palast geschlichen und durch ein Hinterpförtchen in ihn eingetreten war.
Und Herr Pandolfo zweifelte nicht, daß es sich dabei um eine gefährliche Verschwörung handelte, bei welcher der Konnetabel wahrscheinlich die aktivste Rolle übernommen habe.
Wirklich, die Königin war ernst geworden, und auf ihren samtenen Pfirsichwangen lag jetzt fast die Blässe der Angst. Der Herr Pandolfo sprach zuletzt nicht mehr wie ein schlechter Dichter, sondern wie ein guter, der, weil selber ergriffen, ergreifende und überzeugende Worte findet. Das Leben ihres Lieblings stand offenbar in ernster Gefahr. Und diese Angst bestimmte ihre Haltung. Ohne viel Besinnen gab sie dem Großkämmerer jede gewünschte Vollmacht mit der Versicherung, alle Schritte zu billigen, die er zu seiner Sicherheit unternehmen werde.
Und als der Großkonnetabel nach drei Tagen sich aufs neue zu einer Audienz meldete, wurde ihm bedeutet, daß sich die Königin auf den Turm Beverella verfügt habe, um einem Flottenmanöver zuzuschauen, das ihr aus dem Golf zu Füßen des Kastells vorgeführt werde – was denn freilich mit den hochgebauten weißen Gallionen und Galeeren und Karavellen mit ihren langbewehrten Ruderern ein wunderbares Schaustück gewesen sein mag – wenn es nicht eine bloße Lüge war wie überhaupt die Anwesenheit der Königin in dem genannten Turm an der Seeseite des Kastells. Denn kaum war Mutio Sforza, nachdem er an der Schloßkirche von St. Barbara vorüber den ungeheuern Hof des Kastells überschritten hafte, in die nichts weniger als zur Lust erbaute Beverella eingetreten, so wurde er schon von vier Schergen ergriffen, gefesselt und in die unterirdischen, eigentlich unterseeischen Verliefe dieser runden Quaderfeste hinuntergeschleppt.
So hatte es Pandolfino gedichtet, so wurde es ausgeführt.
Pandolfino hoffte dadurch die Mitverschworenen in Furcht und Schrecken zu erhalten. Daß er sie damit sogar versöhnen wurde, konnte er nicht ahnen. Er hatte dabei mehr Glück, als er wußte. Sein Gewaltstreich gegen einen der mächtigsten Männer des Königsreichs konnte ihm übel bekommen, wenn die Durazzi nicht Grund gehabt hätten, jetzt sogar aus seinen Gegnern, die sie waren, wenigstens für den Augenblick seine Mitverschworenen zu werden. Denn da sie seit jener Nacht den Sforza als einen Verräter an ihrer Sache betrachteten, fanden sie keine kleine Genugtuung darin, daß der Großkonnetabel wie ein rechter Gimpel dem Mann in die Schlinge gegangen und zum Opfer geworden war, dem er so großmütig das Wort geredet hatte, und sie konnten darum dem Großkämmerer gar nicht so recht böse sein.
Nicht, daß sie ihren Plan, ihn zu entfernen, aufgegeben hatten, aber dieses Geschäft sollte nun ein anderer besorgen. Sogar einer, der in gewissem Sinn einstweilen noch gar nicht existierte, nämlich der Gemahl der Königin. Mit diesem rechnete nun das Prinzip der Gouvernante, und diesmal machte es für lange Zeit keine Falschrechnung, obwohl der gedachte Gemahl erst gesucht und gefunden werden mußte.
Diese Bemühung übernahmen jetzt die Durazzi, die damit keine Verschworenen mehr waren, sondern die ehrlichen Förderer des Staatsinteresses und ergebene Diener ihrer Monarchin, als welche, wie die Dinge nun einmal lagen, zu dem bösen Spiel eine gute Miene machen, ja überdies gegen ihre Vettern von königlichen Dankesworten überfließen mußte für ihre Sorge um das Heil der Monarchie und der Monarchin.
Nichtsdestoweniger lehnte die Königin eine Reihe von Vorschlagen und Anträgen sehr energisch ab, vielleicht nur, um Zeit zu gewinnen und ihre aufgedrungenen Vormünder zu ermüden. Auch mußte man öfter ihre Gründe gutheißen, da sie politisch nicht ohne Sinn und Vernunft waren. Nur einmal wurde ihre Weigerung als allgemeines Ärgernis empfunden. Da erschien eines Tages – der alte Graf von Troja hatte es so eingefädelt – eine glänzende Gesellschaft, Ritter und Prälaten, von seiten des Königs Ferdinand von Aragonien, um feierlich um die Hand der Königin zu werben für den Prinzen Don Juan, den zweiten Sohn des Königs. Diesmal gab es keine vernünftigen Gründe zur Ablehnung. Vielmehr sprach die Politik, wenn für irgendeine, so für diese Verbindung. Die Aragonesen waren bereits die Herren von Sizilien. Eine Wiedervereinigung der beiden Königreiche Sizilien stand durch diese Heirat in sicherer Aussicht. Sie lag sogar bereits im Plan der weltgeschichtlichen Vorsehung und fand tatsächlich, wie jedermann weiß, und dem Widerstand der Königin Johanna zum Trotz, nicht viel später ihre Verwirklichung. Einstweilen aber schien sie endgültig zu scheitern an dem kinderhaften Trotz Johannas. Und was konnte sie diesmal für Gründe anführen? Der aragonesische Prinz war erst achtzehn Jahre. Sie erklärte, daß sie sich schämen müßte, einen Knaben zu heiraten.
Fast mit sittlicher Entrüstung sprach sie dieses Wort, indem sie sich in ihrem Stuhl stolz emporrichtete, und über ihr nymphenhaftes Gesicht legte sich ein kalter Trotz. Der Graf von Troja, der diese Unterhandlungen mit ihr führte, senkte, vor ihr stehend, bekümmert sein greises Haupt. Es stieg ihm wohl eine Antwort auf die Lippen, eine bitterböse, und man kann sich leicht denken, auf welche Persönlichkeit sich diese Antwort bezog. Aber wie hätte er so gröblich den Respekt gegen die Monarchin verletzen dürfen? Dieser Respekt zwang ihn, seine Antwort in sich hineinzuwürgen, und wenn er es noch nicht gewußt hatte, jetzt blieb ihm kein Zweifel mehr daran: daß wohl er und seine Freunde in dem schwierigen Fadengewirr der Politik gelegentlich ihre Hand und ihre Finger haben durften, daß aber allein der Graf von Alopo, Großkämmerer des Reiches, mehr oder weniger König war von Neapel, wenn auch sozusagen auf heimliche Weise. Und also mußte, denn so war esle bon plaisirdes Herrn Pandolfo, die glänzende Gesandtschaft des Königs Ferdinand von Aragonien, Ritter und Prälaten, mit einem höchst ärgerlichen Korb und nicht wenig gekränkt in ihrem spanischen Stolz, auf ihrer weißbesegelten Karavelle nach Barcelona zurückkehren.
Aber nicht nur die spanischen Gesandten waren gekränkt, noch mehr waren es die Magnaten von Neapel, ja selbst das harmlose Volk murrte, und Johanna fühlte wohl, daß sie einen Streich wie diesen nicht wiederholen dürfe, weil selbst Ser Pandolfo dabei seine Rechnung nicht finden würde. Auch sehr mächtige Monarchen sind nicht allmächtig. Und als darum der alte Graf von Troja und Julius Cäsar von Capua mit einem neuen Heiratsplan vor ihr erschienen, da war es, wie wenn ihre trotzige Königin sich in ein schüchternes Pensionsmädel verwandelt hätte.
»Meine lieben Vettern,« sagte sie mit einem etwas müden Lächeln auf den sonst so trotzigen Lippen, »ihr wißt, daß ich euch in allem gern zu Willen bin, insofern damit nicht meinen königlichen Rechten und meiner Frauenehre zu nahe getreten wird.«
Über die »Frauenehre« hatte hier wieder der alte Troja gern eine Bemerkung gemacht, jedoch wie früher unterdrückte er auch jetzt seine Meinung.
»Eines will ich euch nicht verhehlen,« fuhr die Königin fort, »ihr steht hier vor eurer rechtmäßigen Herrin, eurem angestammten, anererbten König, vertreten durch meine arme, schwache Person. Bedenkt dies wohl! Meine ererbten Königsrechte zu schützen gegen jedermann, das ist eure Pflicht als meine Untertanen und Verwandte, die ihr seid. Schickt nun immerhin eure Abgesandten an den Grafen von La Marche. Er ist ja wohl ein Bourbone und also vom Blut der Könige von Frankreich, aber seine Residenz Gueret – wer hätte auch mir je den Namen gehört? – ist doch nicht viel mehr als ein Dorf in den Auvergner Bergen, wo er jetzt, wie ich höre, damit beschäftigt ist, sich ein prunkvolles Schloß zu bauen, weil er sonst nichts zu tun hat. Denn mit seinem Vetter von Frankreich soll er nicht zum Besten stehen. Er wird sich also bewußt sein, wie weit er in seinen Ansprüchen gehen darf. Ich will ihn als meinen Gemahl freundlich empfangen, und wenn er es zufrieden ist, heiße er der Generalvikar des Königreichs von Neapel; das ist gewiß ein schöner Titel.«
Von den Lippen der Königin war das müde Lächeln verschwunden, und ein strenger, herrischer Zug war an seine Stelle getreten. Sie selbst hatte sich hoheitsvoll emporgerichtet auf ihrem Stuhl. Ihre Herren Vettern beugten sich tief vor ihr. Sie fühlten etwas wie Drohung in dem Blick ihrer wundersamen Augen. Und das hätte sie eigentlich nicht gedemütigt, es hätte sie eher mit Stolz erfüllt, denn sie fühlten gern in Johanna ihren Herrn und König. Mit Genugtuung hätten sie sich als ihre Untertanen empfunden, wenn sie selber frei gewesen wäre. Aber statt dessen war sie, wie es die Vettern nahmen, die Sklavin eines andern, eines Niedriggeborenen. Dieser Gedanke drückte sie unerträglich, und so setzten sie auf den Grafen von La Marche heimliche Hoffnungen, von denen aber die Königin einstweilen nichts zu ahnen brauchte. Sie waren wirklich im Herzen entschlossen, ihre Königin, mehr: ihren König zu verraten. Sie waren Hochverräter in ihrem Herzen, während Johanna sie für ehrliche Untertanen hielt. Ihre Motive mochten ihren Verrat entschuldigen, ja rechtfertigen, aber die kommenden Dinge haben gezeigt, daß sie sich in ihrem Mittel vergriffen hatten.
Und dann war's einige Monate nach dieser Audienz, da trat einmal gegen Abend der Graf von Alopo in großer Aufregung in das Gemach der Königin, die, harmlos mit ihren Frauen plaudernd, am Stickrahmen saß, von dem ihre Augen sich von Zeit zu Zeit erhoben, um durch das offene Fenster mit den zierlichen Doppelsäulchen aus rotem Porphyr in die lichte Ferne hinauszuschweifen, hinweg über den opalfarbenen Golf zum Posilip, der mit seinem weißen Gefels aus den Wogen emporwuchs und auf dessen Absturz einige schlanke Palmen schwarz gegen die lichtseidene Bläue des Himmels standen.
Das Erscheinen des Großkämmerers und seine verstörte Miene riß sie aus ihrer kindlichen Harmlosigkeit.
»Was ist dir, Pandolfino?« fragte sie besorgt.
»Ich bringe schlimme Nachricht, Königin,« antwortete er mit einer Stimme, in der seine innere Erregung zitterte, »der neue Herr naht.«
»Herr?« wiederholte Johanna. »Ich kenne keinen Herrn über mir an. Keinen,« fügte sie schelmisch lächelnd hinzu, »als den ich mir selber gesetzt habe.«
Das war stolz königlich gesprochen. War es auch weiblich gesprochen? Und darf der Mann sein Herrentum haben aus der Gnade der Frau?
Doch dem Großkämmerer von Neapel lagen im Augenblick solche Spitzfindigkeiten fern, er hegte andere Sorgen.
»Ihr steht im Begriff, ihn zum Herrn zu machen«, versetzte er fast barsch. »Und einstweilen spielt er ihn, ohne Euch gefragt zu haben.«
»Von wem redest du, Pandolfino?« fragte die Königin mit der unschuldigsten Miene von der Welt.
»Von wem anders,« versetzte Herr Pandolfo, »als von dem Bauerngrafen Jakob von Bourbon! Er ist in Venedig eingetroffen und hat es sich nicht versagt, in seiner französischen Eitelkeit sich dort einen königlichen Empfang zu bestellen. Er ist ja sehr reich. Der Doge der Republik des Heiligen Markus ist ihm sogar auf dem hochgebauten goldenen Bucentauro in großem Pomp entgegengefahren, und ganz Venedig hat ihn als den König von Neapel begrüßt.«
»Er ist ein Narr,« versetzte die Königin im wegwerfendsten Ton, der ihr zur Verfügung stand, »ein echter französischer, eitler Narr; aber lassen wir das Männlein nur kommen!«
Hier entstand eine Pause. Herr Pandolfo schien nachzudenken. Und was er dann sagte, überraschte die Königin nicht wenig. War auch ihr Pandolfino unter die Politiker gegangen?
»Wir haben eine Unüberlegtheit begangen«, sprach er. »Ich denke an den Sforza.«
»Wie?« versetzte etwas boshaft Johanna.
»Ihr habt meiner rasenden Eifersucht allzu willig Gehör geliehen.«
»Da kannst du recht haben, mein Dolfino«, meinte das liebe Hannchen und machte ein verzweifelt altkluges Gesicht dazu; »wenn ein Mann eifersüchtig ist, ist er immer ein Tor, und man sollte überhaupt nicht auf ihn achten.«
»Laß uns nicht streiten, schöne Herrin,« bat der Großkämmerer, »wir leben in einem zu gefährlichen Augenblick. Leider kommen zu den heimischen Sorgen auch noch bedrohliche Aussichten der äußeren Politik. Die Konzilherren zu Kostnitz haben unter Mitwirkung des Kaisers Sigismund unsern guten Landsmann, den Papst Johann, zur Abdankung gezwungen und den Otto Colonna als Papst Martin den Fünften auf den Stuhl Petri erhoben. Dieser gewalttätige und herrschsüchtige Römer wird uns ein weniger bequemer Nachbar sein als sein Vorgänger (diese Voraussagung hat sich seither auffallend bewahrheitet), und Eure Majestät, Königin, wird wahrscheinlich nur allzubald eines mächtigen Feldhauptmanns bedürfen. Ihr seht, schöne Herrin, daß es also naheliegt, an den Großkonnetabel zu denken, dessen in Tricarico müßig liegende Heerhaufen sich immer mehr aufführen wie der böse Feind, ohne daß eine starke Hand da wäre, ihnen zu wehren. Bis vor die Tore von Neapel verheeren und verwüsten sie das Land.«
Die Königin seufzte.
»Meine Vettern haben leider anderes zu tun, als ihre Königin vor ihren Bedrängern zu schützen.«
»Sie sind selber Eure ärgsten Bedränger«, ergänzte der Großkämmerer. »Über den Konnetabel aber ist mir erstaunliche Kundschaft geworden, und daraus ist mir ein Plan erwachsen. Der Sforza war gar nicht, wie ich gemeint hatte, von der Partei der Durazzi. Er hat sich sogar in der Nacht jener heimlichen Zusammenkunft offen mit ihnen überworfen und ist als Feind von ihnen geschieden, weshalb sie denn auch seine Einkerkerung so ruhig hingenommen haben. Er kann noch unser Verbündeter werden. Gebt ihm die Freiheit, Königin, und ...«
»Wir haben ihn schwer gekränkt«, fiel ihm Johanna ins Wort; »wird er sich so leicht versöhnen lassen?«
»Haltet Ihr es für möglich, daß er, Euer Untertan und Dienstmann, Eure königliche Huld von sich weist?«
»Er ist stolz und hochfahrend.«
»Mehr noch ist er etwas anderes,« beeilte sich der Großkämmerer hinzuzufügen, »nämlich habsüchtig. Er ist nicht umsonst ein geborener Bauer; seine Reichtümer zu vermehren, war ihm noch immer jede Gelegenheit willkommen. Und diese Gelegenheit hat diesmal ein allerliebstes Gesicht. Eure Freigebigkeit, Königin, hat meine Schwester Katarina Alopo, heute außer Euch das schönste Weib in Neapel, zur reichsten Partie des Königreichs gemacht, ich werde dem Sforza ihre Hand anbieten.«
»Ei, mein Pandolfino,« antwortete die Königin mit einem klugen Augenaufschlag, »du hast wirklich manchmal einen verflucht gescheiten Gedanken, wie man ihn einem Musensohn, der du bist, gar nicht zutrauen sollte.«
Der Großkämmerer beugte das Knie und küßte der Königin die Hand. »Ich eile, den Mann in seinem Kerker aufzusuchen.«
Unterwegs aber hatte er noch ein kleines Zwischenspiel zu bestehen, nämlich bei Überquerung des langgestreckten weiträumigen Burghofs, so weiträumig, daß er einem ganzen Heerlager Platz gegeben hätte und daß die gar nicht kleine Kirche von Sankt Barbara sich inmitten des ungeheuren und auch ungeheuer hohen Schachtes wie ein kleines zierliches Kapellchen ausnahm. Zwischen den Strebepfeilern dieser Kirche aber waren jetzt gelbe Zelttücher aufgespannt, grob zugehauene Marmorblöcke von bald schmal länglicher, bald kubischer Gestalt lagen übereinandergehäuft, an einzelnen von ihnen meißelten rüstige Gesellen, und hier und da war bereits zu erkennen, wie pflanzliche und tierische Formen oder auch der Ansatz zu einer menschlichen Figur, nach vorliegenden Rötelzeichnungen auf glatten Holztafeln, sich aus dem harten Gestein heraushoben. Vor einem mächtigen Reißbrett aber stand in anliegend gestrickten braunroten Beinkleidern und dunkelgrünem, gegürtetem Tuchkamisol der Meister Andreas aus Florenz und zog in sinnendem Schauen seine Rötelstriche. Mit seinem kurzen, weißen Bart und dem gleichfarbigen dreigeteilten Haargelock, unbedeckt von dem zurückgeschobenen gelben Lederkäppchen, glich sein mächtiger Kopf fast dem des heiligen Petrus, wenigstens so wie man ihn oft abgebildet sieht. Der Großkämmerer wollte grußlos an ihm vorüber, der Meister aber vertrat ihm den Weg.
»Ein Wort, wenn Eure Gnaden erlauben möchten!«
»Scher' dich zum Teufel, Maurer,« herrschte der Graf von Alopo ihn an, »ich habe Wichtigeres im Kopf.«
Die Hand des berühmten Bildners machte eine Bewegung nach seinem Dolchgürtel. Doch er beherrschte sich, und stolz erhobenen Kopfes trat er an sein Reißbrett zurück. Es ist so, wie man mir in Florenz sagte, dachte er, diese Neapolitaner sind keine Christenmenschen; Afrikaner sind es, Heiden, Barbaren, mit einem Wort Bestien. Und dann hantierte bereits wieder sein Rötelstift in bald zögernden, bald hastig zufahrenden Strichen über das weißgeglättete Pappelholz vor ihm.
Die Schritte des Großkämmerers aber hatten sich verlangsamt. Diese verdammten Florentiner, dachte er, zuerst haben sie uns gezwungen, ihre Sprache zu sprechen und zu schreiben, und nun sollen wir auch einzig beten vor ihren Götterbildern, womit sie ganz Italien überschwemmen, und doch sind wir, wir Napolitaner, die Söhne Griechenlands. Aber diese Toskaner haben böse Zungen, die überall gehört werden, und wer sich ihnen nicht beugt zwischen Verona und Palermo, den bringen sie in ein übles Geschrei. Die Königin wird mein barsches Betragen zu entgelten haben und wird es mir übel anrechnen. Sapristi, ich liebe ihre Gardinenpredigten nicht. Und an dem Alten hat sie gar ihren Narren gefressen.
Er hatte einen Augenblick im Gehen angehalten, und jetzt kehrte er um. Mit liebenswürdigster Freundlichkeit näherte er sich von neuem dem Meister Andreas. »Verzeiht, Meister,« sprach er, »ich habe schwere Dinge im Kopf und war ungeduldig gegen Euch; aber wollet nicht glauben, daß ich den größten Meister in der Kunst, dessen Italien sich heute rühmt, nicht zu schätzen wüßte! Habt Ihr ein Anliegen an mich, Meister Andreas?«
Solchen Schmeichelreden konnte der Bildner nicht widerstehen.
»Hoher Herr,« sprach er, »Eure schöne Königin, Gott erhalte sie glücklich, hat mir eine Ehre angetan, wie noch keinem Künstler der Christenheit widerfahren ist. Das Grabmal des Königs Ladislas, das sie zu schaffen mich berufen hat, soll an Größe und Reichtum und Schönheit alles übertreffen, daß es seinesgleichen nicht haben wird in der ganzen Christenheit. Ihr dient der größten und großmütigsten Königin der Welt, hoher Herr. Aber die Großen übersehen gern das Kleine. Ein Großes ist das Werk des Künstlers, ein Kleines ist das Geld. Aber Eure schöne Königin sollte doch daran auch denken, denn meine Gehilfen laufen mir weg, wenn ich sie nicht bezahlen kann. Unsere herrschenden Geschlechter von Florenz sind keine Könige, sind nur einfache Bürger, aber für die Künstler haben sie einen stets offenen und bei Gott auch vollen Beutel, besonders der junge Kosimo aus dem Haus der Medici.«
Ei, du bettelhafter florentinischer Großsprecher, dachte der Pandolfo, aber seine schönen Adonisaugen heuchelten staunende Bewunderung.
»Es ist mir eine große Ehre, dir zu dienen, Meister Andreas«, sagte er; »ich werde noch diesen Abend mit der Königin reden; mein Freund, du sollst mit mir zufrieden sein.« Und mit einem verbindlichen Kopfnicken verabschiedete er sich.
Wenn es mir nur auch gelingt, den schnauzbärtigen Romagnolen so leicht zu begütigen wie diesen Florentiner Handwerker! dachte er. Wenigstens soll es mir ein gutes Vorzeichen bedeuten, wenn ich auch bei dem Sforza ganz andere Schulden aus dem Kerbholz habe.
Und wirklich muß ihm sein Besuch in der Beverella, deren unterirdische oder vielmehr unterseeische Verliese gewiß nicht auf Heiterkeit zu stimmen angetan waren, ganz nach Erwarten geglückt sein. Denn als er am Abend zu Santa Lucia, als napolitanischer Fischer verkleidet, in dem Hause eines engen Winkelgäßchens mit einem hübschen Liebchen bei einer Flasche Falerner zusammensaß – denn er war der Königin Johanna keineswegs treu –, da mußte ihm die schlangengeschmeidige Assunta gestehen, daß sie ihn seit Wochen nicht in solcher Aufgeräumtheit gekannt habe. »Du würdest dich nicht wundern,« sagte er lachend, »wenn du wüßtest, was für ein Mordsfisch mir heute in die Angel gebissen hat, ein Fisch, sage ich dir, mein Schätzchen, den der stolze Cäsar von Capua mit seiner halben Grafschaft nicht zu teuer bezahlen würde. Freilich war auch mein Köder danach. Ich habe ihn der Königin gebracht, und so glücklich wie über seinen Anblick haben ihre strahlenden Augen schon lange nicht geleuchtet.«
»Hat sie ihn denn aber auch gut bezahlt?« fragte die schlangengeschmeidige Assunta mit begehrlichem Blick. »Mit einem Kuß von ihren stolzen Lippen«, antwortete trocken der geheimnisvolle Menschenfischer. Die Assunta schien enttäuscht: »Du bist einmal ein lumpiger Ausschneider«, versetzte sie schnippisch, indem sie mit ihrem Glas, in dem der Wein vor der flackernden Öllampe funkelte wie flüssiger Bernstein, an das seinige stieß.