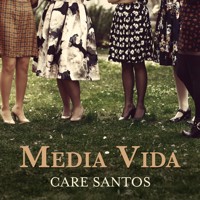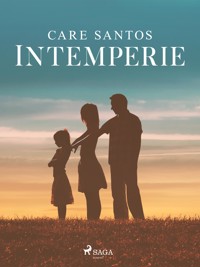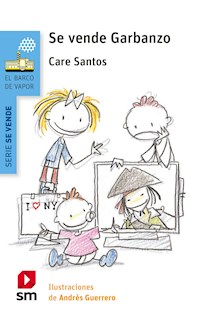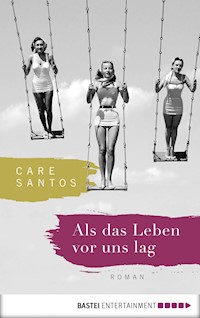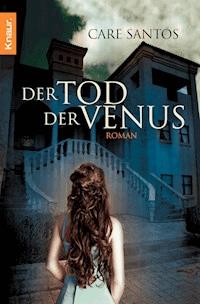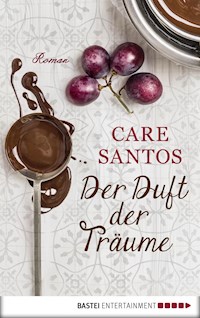
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei starke Frauen, drei Jahrhunderte - verbunden durch eine große Leidenschaft.
Sara, Inhaberin einer Confiserie mit langer Familientradition, ist in ganz Barcelona bekannt für ihre süßen Kreationen. Für Aurora, Dienstmädchen im 19. Jahrhundert, ist Schokolade ein unbezahlbarer Luxus. Und Mariana versucht im 18. Jahrhundert die Schokoladenproduktion ihres verstorbenen Mannes fortzuführen. Was die drei Frauen verbindet? Ihr Wohnort Barcelona. Ihre Liebe zur Schokolade. Und ein Krug aus feinstem weißen Porzellan, der über die Jahrhunderte von Hand zu Hand gewandert ist.
Verführerisch, sinnlich, zartschmelzend - ein Roman über die süßeste Sünde der Welt. Für alle Fans des Films CHOCOLAT.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
VORSPIEL Auferstehung
ERSTER AKT Chili, Ingwer und Lavendel
Polymorphes Verhalten
A la santé de Madame Adélaïde de France
Die mannigfachen Talente des Oriol Pairot
Die 709
ERSTES ZWISCHENSPIEL Deckel
ZWEITER AKT Kakao, Zucker und Zimt
Tristan und Isolde
Die Puritaner
Don Giovanni
Norma
Der Troubadour
La Traviata
Don Pasquale
Rigoletto
ZWEITES ZWISCHENSPIEL Bruchstellen
DRITTER AKT Pfeffer, Nelke, Annatto
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
FINALE Madame Adélaïde
Personenverzeichnis
Anmerkung der Autorin
Danksagung
CARE SANTOS
Der Duft der Träume
ROMAN
Aus dem Spanischen von Stefanie Karg
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe: Copyright © 2014 by Care Santos Titel der katalanischen Originalausgabe: »Desig de xocolata« Originalverlag: Editorial Planeta, S.A. Translation rights arranged by Sandra Bruna Agencia Literaria, S.L. through SvH Literarische Agentur
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln Titelillustration: © getty-images/DeAgostini Umschlaggestaltung: Favoritbüro, München E-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf ISBN 978-3-7325-1407-6
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für Deni Olmedo für all das, was sich kaum in Worte fassen lässt
VORSPIELAuferstehung
Sechzehn Scherben und eine Tube Alleskleber. Max widmet sich dem zweifelhaften Vergnügen, die Stücke zusammenzusetzen, als handle es sich um ein Puzzle. Es ist spätnachts, und eigentlich sollte er längst schlafen – immerhin muss er in wenigen Stunden wieder aufstehen –, doch er hat es Sara zugesagt und will dieses Versprechen auch halten.
Er greift eine Scherbe nach der anderen und sucht ein passendes Gegenstück. Je weniger Scherben auf dem Tisch zurückbleiben, umso schneller geht ihm die Arbeit von der Hand. Er bestreicht die Ränder mit ausreichend Klebstoff und presst sie zusammen. Zufrieden betrachtet er dann das Ergebnis. In einigen Fällen gelingt es ihm, die Narben nahezu unsichtbar zu machen, aber meist ist es schwierig, vor allem wenn die Bruchstellen zersplittert sind. Nach und nach stellt Max das wieder her, was für immer verloren schien. Es hat sich gelohnt, nach dieser langen Nacht vor Müdigkeit schier umzufallen. Sara wird glücklich sein, wenn sie am Morgen in die Küche kommt und sieht, wie viel Mühe er sich gegeben hat.
Es war ein gelungener Abend gewesen. Zuerst das Gespräch zwischen zwei alten Freunden, die sich nach so langer Zeit vieles zu erzählen hatten. Dann Sara, so bezaubernd, so schön, so entschieden. Was geschieht nur mit den Frauen, wenn sie die vierzig überschreiten? Ihre Qualitäten scheinen sich zu bündeln, so dass sie intensiver, intelligenter, ausgeglichener und attraktiver wirken als noch vor zwanzig Jahren. So hatte Max gestern Abend seine Frau wahrgenommen, und er war stolz auf sie gewesen. Stolz darauf, dass sie seine Frau ist. Das ist ein primitives, ein falsches Gefühl, das eigentlich gar nicht zu ihm passt, sagt er sich jetzt, doch er muss zugeben, dass der Abend aus genau diesem Grund für ihn so erfreulich verlaufen ist.
Sobald Oriol die Wohnung verlassen hatte, hatten Sara und er begonnen, alles aufzuräumen, das Geschirr zu spülen und die Reste wegzustellen, in der perfekten, oft erprobten Arbeitsteilung. Selbstverständlich sprachen sie dabei über die Neuigkeiten. Gut, dass der Freund endlich vernünftig geworden war, aber hätte er sich nicht auch eine Frau aus der näheren Umgebung suchen können?
»Wer zum Heiraten in die Ferne geht, wird betrogen oder will betrügen«, flüsterte Sara im Tonfall ihrer Mutter, während sie die Salatreste in eine kleine transparente Plastikdose umfüllte.
»Was meinst du, wie er als Vater sein wird?«, fragte Max.
»Katastrophal«, sagte sie, »wie in allem anderen.«
»Nicht in allem, sei nicht ungerecht.« Max war ganz der treue Freund, der die Verteidigung übernimmt. »Er hat wirklich etwas Großartiges auf die Beine gestellt!«
Doch Sara antwortete nicht. Ihre Augen sahen müde aus und sie wirkte ein wenig niedergeschlagen. Es tat ihr offensichtlich weh, das zerbrochene Porzellan zu sehen. Resigniert betrachtete sie die Scherben.
»Mach dir keine Sorgen, wir können sie kleben«, sagte Max aufmunternd.
»Auch wenn du sie klebst, werde ich immer wissen, dass sie mal zerbrochen war«, antwortete Sara und verstaute die Plastikdosen in perfekter Anordnung im Kühlschrank. »Macht es dir etwas aus, wenn ich im Bett auf dich warte?«
Max macht es nichts aus. Ganz im Gegenteil. Er weiß, dass Sara allein sein muss und Zeit benötigt, um alles zu verarbeiten. Diese Nacht ist erst der Anfang eines langen Weges. Womöglich werden die Narben niemals ganz verschwinden, so wie die auf dem Porzellan, das in seiner Hand wieder Form annimmt, und sie werden lernen müssen, ihnen einen Sinn zu geben.
Das, was sich nun wieder formt, ist von erlesener Schönheit. Die blaue Inschrift unten ist leider in der Mitte auseinandergebrochen. Je suis à Madame Adé…, hält Max in der rechten Hand, …laïde de France in der linken. Zum Glück ist nicht ein Millimeter des Porzellans verloren gegangen, und die beiden Hälften passen perfekt zusammen. Madame Adélaïde von Frankreich – wer auch immer sie sein mag – kann aufatmen.
»Jeder Gegenstand hat seine Geschichten, die zum Leben erwachen können«, hatte Sara vor Jahren gesagt, als sie die Schokoladenkanne aus Porzellan zum ersten Mal in den Händen hielt. »Manchmal, wenn ich etwas berühre, habe ich das Gefühl, dass ich diese Geschichten hören kann.«
»Und, sind es viele?«, hatte Max fasziniert gefragt.
»Ja, einige. Siehst du denn nicht, dass dies ein sehr altes Stück ist, das schon durch viele Hände gegangen ist?«
Und Max vertiefte mit seinem üblichen wissenschaftlichen Interesse das Thema.
»Du behauptest also, dass die Dinge voller Geister sind, so wie die Häuser in den Horrorfilmen?«
Sie nickte zustimmend.
»Ganz genau, Max. Die Leute glauben an verwunschene Häuser, aber die Geister leben im Allgemeinen lieber in kleinen, alltäglichen Gegenständen, dort, wo sie niemand vermutet.«
»Ein guter Grund, niemals Staub zu wischen!«, meinte Max amüsiert.
Als er die Tülle zusammensetzt, die in drei Teile zerbrochen ist, und sie dann an den birnenförmigen Korpus klebt, nimmt die Kanne beinah wieder ihre alte Gestalt an. Nun liegen auf dem Tisch nur noch zwei Scherben vom Henkel. Wenn Max sie erneut in die graziöse Form einer Schleife gebracht hat, wird das Puzzle fertig sein. »Hier habt Ihr Eure Schokoladenkanne, Madame. Möge sie Euch noch viele Jahre begleiten. In Kürze werdet Ihr sie wieder einweihen können«, scheint eine ihm unbekannte Stimme in seinem Kopf zu sagen, und eine Sekunde lang lächelt er vor sich hin. Mit der Hingabe eines Chirurgen, der eine heikle Operation zu Ende bringt, klebt er die Bruchstücke zusammen. Danach entfernt er mit Alkohol und etwas Watte die Kleberreste von den Bruchstellen.
Die Schokoladenkanne erinnert ihn an einen Kriegsinvaliden. Als Sara sie kaufte, spät in jener Nacht, war die Tülle am Rand schon angeschlagen, und obwohl der Deckel und der Quirl fehlten, wirkte sie doch sehr edel und elegant. Seine Frau hat ihm niemals erzählt, ob der Antiquitätenhändler ihr etwas über die Herkunft verraten hatte. Max weiß nur, dass dieser merkwürdige alte Mann den Preis herabsetzte, weil Sara so jung und so interessiert war. Damals beeinträchtigte der angeschlagene Rand den harmonischen Gesamteindruck. Jetzt hingegen wirkt er keineswegs störend. Max streicht mit der Fingerkuppe über die alte Verletzung. Er spürt die Unebenheit des Materials. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Spuren, die man von außen nicht sieht. Obwohl die Kanne von oben bis unten geklebt ist, könnte man sie noch benutzen. Sie fasst genau drei kleine Tassen Schokolade. Wie schade, dass jetzt, da Oriol nicht mehr da ist, eine Tasse übrig bleibt. Tatsächlich wird nun immer eine Tasse übrig bleiben.
Als Max fertig ist, räumt er alles auf. Er stellt die soeben aus Trümmern auferstandene Schokoladenkanne genau in die Mitte des Tischs, reißt ein Blatt vom Einkaufsblock ab, schreibt Voilà darauf und legt es vor sein Werk. Dann schaltet er das Licht aus.
Er befürchtet, dass Sara noch wach ist und all die Ereignisse des Abends Revue passieren lässt. Aber nein. Sara schlummert wie ein kleines Kind. Als er unter die Laken schlüpft, bemerkt er, dass seine Frau vollkommen nackt ist. Er weiß, dass dies eine Einladung ist, die er nicht ablehnen sollte, aber er weiß auch, dass es nicht der passende Moment ist. Sobald er Ursachen und mögliche Konsequenzen analysiert hat, stellt er den Wecker eine halbe Stunde später als sonst und macht die Augen zu. Sein Herz pocht mit rasender Geschwindigkeit.
ERSTER AKT Chili, Ingwer und Lavendel
Die unheilbaren Verletzungen des Herzens sind der Preis, den wir für unsere Unabhängigkeit zahlen.
HARUKI MURAKAMI
Polymorphes Verhalten
Wir Menschen werden allem überdrüssig, das liegt in unserer Natur: dem Besitz, den Vergnügungen, der Familie, sogar uns selbst. Es ist egal, dass wir uns all das gewünscht haben, dass wir so leben, wie wir es wollten, und dass wir die Tage mit dem wunderbarsten Menschen der Welt verbringen, früher oder später langweilt uns alles.
Es ist immer das Gleiche. Eines Abends wenden wir den Blick vom Fernsehschirm ab und betrachten einen Moment lang unseren Ehemann, der auf der anderen Seite des Wohnzimmers sitzt, wie immer nach dem Abendessen. Nichts, was wir erblicken, überrascht uns. Auf dem kleinen Tisch in der Ecke liegt das obligatorische Dutzend Bücher, zum Teil mit Buchzeichen oder bereits ausgelesen, zum Teil noch ungelesen. Seit dem Tag, an dem die Renovierung der Maisonettewohnung abgeschlossen war, bietet sich das immer gleiche Bild: Max lehnt entspannt in seinem Lesesessel (das einzige Möbelstück, das er ausgesucht hat), die Beine auf dem Hocker, die Brille auf der Spitze der knochigen schmalen Nase, in den Händen ein Buch, das ihn von allem restlos ablenkt, was in seiner Umgebung geschehen mag, und hinter ihm die Stehlampe, die das Buch wie einen Varietéstar ins Rampenlicht rückt.
Max gehört zu den Leuten, die zum Lesen weder Ruhe noch irgendetwas anderes benötigen als die genannten Requisiten: Sessel, Fußhocker, Lampe und Brille. Und natürlich das Buch. Max’ ständige Gegenwart in seiner Leseecke gleicht der eines gutmütigen Haustieres. Er verursacht keinen Lärm, er nervt niemanden, er gibt nur dann und wann einen Seufzer von sich, er verändert manchmal seine Position oder blättert die Seiten um. So weiß man, dass er noch anwesend und am Leben ist. Wenn er nicht da wäre, würde sie ihn vermissen, denkt Sara genau in dem Moment, als ihr Blick vom Fernseher abschweift und sie ihren Ehemann am üblichen Platz bei der üblichen Beschäftigung sieht. Sie würde ihn tatsächlich vermissen, denn sie hat sich genauso an seine stille Anwesenheit gewöhnt, wie andere Leute sich daran gewöhnen, dass Möbelstücke stets an der gleichen Stelle stehen. Es ist eine Frage der Sicherheit, des Gleichgewichts. Max ist alles, was Sara auf dieser Welt hat. Doch in dem Moment kommt sie nicht umhin, sich zu fragen: Warum bin ich mit diesem Mann verheiratet?
Das ist eine dieser Fragen, die das Gewissen aufwirft, wenn man eine Sekunde nicht aufpasst, und für die man sich – selbstverständlich – sofort schämt. Eine dieser Fragen, die Sara niemals laut aussprechen würde, weil sie irgendwie das angreift, was sie in ihrem Leben für am wenigsten verwundbar hielt. Vielleicht fährt deswegen ihr Gewissen bereits eine Batterie von Antworten auf: Woher kommt das denn auf einmal? Du hast doch alles, was man sich nur wünschen kann! Es geht doch nicht um materielle Dinge, sondern um das, was wirklich schwer zu bekommen ist. Du hast dich in völliger Freiheit entschieden, mit wem du zusammen sein willst, oder? Hast du jemals auf irgendetwas verzichtet? Hast du dich nicht unzählige Male dazu beglückwünscht, die beste Wahl getroffen zu haben? Bist du dir denn nicht absolut sicher, dass Max nicht nur ein großartiger Mensch ist, sondern bestens zu dir passt? Wie für dich gemacht? Habt ihr nicht zwei wundervolle, intelligente Kinder, die dich anbeten und die von beiden das Beste mitbekommen haben? Verspürst du keinen heimlichen Stolz darüber, wie sich deine Eigenschaften und die von Max in den – selbstverständlich – nahezu perfekten Charakteren eurer Kinder vereinen?
In dem Moment hebt Max den Blick von seinem Buch, setzt die Brille ab und sagt:
»Ach, Mamá, beinahe hätte ich es vergessen! Weißt du, wer mich angerufen hat? Du wirst es nicht glauben! Oriol! Er ist gerade in Barcelona und hat übermorgen Abend Zeit. Ich habe ihn zum Essen eingeladen, das ist hoffentlich in Ordnung? Du freust dich doch sicher auch darauf, ihn nach so langer Zeit einmal wiederzusehen?«
Max nimmt seine Lesebrille nur ab, wenn das, was er zu sagen hat, wirklich wichtig ist. Er wartet einen Moment, doch Sara zeigt keine Reaktion. Er setzt die Brille wieder auf und widmet sich seinem Buch – Frequent Risks in Polymorphic Transformations of Cocoa Butter –, so als hätte er nichts Außergewöhnliches gesagt.
»Hat er dir erzählt, warum er sich so lange nicht gemeldet hat?«, fragt sie.
»Er ist ein viel beschäftigter Mann. Wir hätten ihn ja auch mal anrufen können, das ist doch egal. Wann war das letzte Mal? Kannst du dich noch daran erinnern? War das vielleicht an dem Abend im Hotel Arts, als er den Preis bekommen hat?«
»Ja, genau, an dem Abend.«
»Wie lange ist das jetzt her? Bestimmt schon sechs oder sieben Jahre, oder?«
»Neun«, berichtigt ihn Sara.
»Neun? Unglaublich! Bist du sicher? Wie die Zeit vergeht. Dann sollten wir ihn erst recht sehen. Das passt dir doch sicher, oder? Du hast Oriol doch immer gern getroffen.«
Max widmet sich wieder seinem englischen Buch.
Sara fragt sich, wie ihr Mann es schafft, eine Abhandlung über die physischen Eigenschaften der Kakaobutter mit dem gleichen Eifer zu lesen wie einen Sherlock-Holmes-Roman, aber dann sagt sie sich, dass sie inzwischen eigentlich nicht mehr überrascht sein sollte. Viel mehr überrascht sie das, was sie gerade gehört hat, und zwar aus mehreren Gründen: Oriol hält sich in Barcelona auf – und nicht in Canberra, Katar, Shanghai, Litauen oder an irgendeinem anderen fernen Ort. Zudem scheint er sich daran zu erinnern, dass in dieser kleinen Stadt am Mittelmeer zwei Menschen leben, mit denen er etwas Wichtiges teilte. Damals, als er noch nicht der Oriol Pairot war, der durch die Welt jettet und Luxusgeschäfte mit seinem Namen eröffnet und auf den seine Mitbürger mit Stolz blicken, wenn im Fernsehen einmal mehr über ihn berichtet wird. Sara ist auch deswegen überrascht, weil Oriol sich mit ihrem Ehemann verabredet hat, denn früher hat er immer zuerst sie angerufen. Doch vor allem verschlägt es ihr die Sprache, dass Max nicht auffällt, wie wichtig seine Ankündigung ist, und es ihr quasi nebenbei mitteilt, zwischen zwei Absätzen über die Probleme der polymorphen Transformation. Sofort folgt er wieder dem allabendlichen Ritual, mit dessen Hilfe sie beide das Abendessen – oder vielleicht auch ihr Leben – in den letzten Stunden des Tages verdauen.
Sara überlegt, was sie jetzt sagen soll. Sie könnte wie die Hauptdarstellerin einer der Soaps antworten, die sie nicht mehr einschaltet, weil sie süchtig machen: Mein Gott, Max! Ich habe schon immer gewusst, dass er früher oder später wieder auftauchen würde. Oder sie könnte ihm eine absurde Szene machen: Und Max, wieso sagst du mir das jetzt erst? Doch sie verwirft die Ideen. Max ist nicht gut im Streiten und gibt ihr meistens beim ersten Gegenargument recht. Solche Auseinandersetzungen machen keinen Spaß. Außerdem ist sie heute viel zu müde, um sich an irgendeinem Thema festzubeißen. Sie beschließt, es sich leicht zu machen, indem sie die einfachste Lösung wählt, die zugleich die egoistischste ist, aber auch, wie sie zugeben muss, die feigste. Flüchten.
»Sind wir da nicht im Liceu?«
»Nein, das habe ich schon überprüft. Das ist erst nächste Woche, am Dienstag, und das ist mir heilig: Aida.«
»Ich kann übermorgen trotzdem nicht. Ich habe ein Arbeitsessen«, bringt sie hervor und verzieht wie bedauernd den Mund. »Kann er denn an keinem anderen Tag?«
Max nimmt die Brille wieder ab. Die Kakaobutter wartet, ohne sich zu verändern, wie es ihrer Natur entspräche.
»Ich habe ihn nicht danach gefragt, aber du weißt ja, wie rastlos er ist. Bestimmt ist sein Terminkalender übervoll.«
»So wie bei uns allen. Wir haben alle viel zu tun.«
»Das stimmt natürlich, aber bei ihm ist es etwas anderes. Er ist nur noch unterwegs, er hetzt von Flughafen zu Flughafen und reist in die merkwürdigsten Länder. Anscheinend ist dieses Jahr Japan an der Reihe. Er will uns unbedingt davon erzählen. Er machte einen sehr zufriedenen Eindruck. Was für ein Typ! Lebt wie ein Nomade. Und wir sind diejenigen, die auf ihn warten und ihn mit gedecktem Tisch empfangen. Es muss ja auch Leute geben, die ein ruhiges Leben in geordneten Bahnen vorziehen. Wir sind im Grunde genommen immer so gewesen, findest du nicht auch?«
Ruhig, geordnet, wir und im Grunde genommen. Vier Begriffe, die bleischwer auf Sara lasten.
»Es tut mir wirklich leid, aber ich kann übermorgen nicht. Das Arbeitsessen ist schon seit Wochen terminiert.«
Terminiert. Ein klares Signal. Auch Sara ist eine viel beschäftigte, wichtige, moderne Frau mit dringenden Terminen, die fürchterliche Begriffe verwendet, erfunden für Leute wie sie, die keine Zeit für längere Erklärungen haben.
»Kannst du es denn nicht verschieben?«, fragt Max.
Warum muss sie diejenige sein, die etwas verschiebt? Kann sich der große Oriol Pairot nicht dazu herablassen, seine Pläne um einen Millimeter zu ändern?
»Unmöglich. Es ist ein Abendessen mit dem Herausgeber der Zeitschrift«, erwidert sie kurz angebunden.
»So ein Pech.« Seine sonst stets freundlichen Züge zeigen plötzlich echtes Bedauern. »Ich kann ihn anrufen und fragen, bis wann er hier bleibt.«
Sara setzt eine unbekümmerte Miene auf, die sehr natürlich wirkt (genau wie von ihr beabsichtigt).
»Kein Problem, Liebling. Ich komme zum Kaffee nach. Bestimmt redet ihr bis tief in die Nacht.«
Liebling ist eine sehr gute Strategie zur Schwächung des Gegners. Liebling impliziert in dem Fall eine ganze Menge. Es bedeutet: Alles in Ordnung. Es bedeutet: Mach dir keine Gedanken. Es bedeutet: Ich bin ganz ruhig und mache, was ich will.
»Gut, einverstanden. Dann machen wir es so«, sagt Max mit seinem Akzent, der nach mehr als zwanzig Jahren in Barcelona fast so makellos ist wie ein rund geschliffener Kieselstein. Und auf den er ausgesprochen stolz ist. Bevor er die Brille wieder auf der Nase platziert und die Angelegenheit für abgeschlossen erachtet, stellt er noch eine praktische Frage: »Decken wir den Tisch auf der Dachterrasse oder besser drinnen? Kannst du etwas für das Abendessen vorbereiten?«
»Aber natürlich, Papá. Wie immer.«
Endlich kann Max die Brille wieder aufsetzen und ungestört zu seiner Kakaobutter zurückkehren, die verschiedene Formen annehmen kann, ohne ihre chemischen Eigenschaften zu verändern. »Alles ist Chemie«, sagt Max gern, »wir bestehen nur aus Chemie. Alles, was mit uns geschieht, alles Gute und alles Schlechte, alles sind nur chemische Reaktionen.«
Nun, da ihr Mann wieder – wie fast immer – abgelenkt ist, kann Sara im Kopf den morgigen Tag planen. Zwei Termine stehen an: Sie muss mit ihrer Assistentin die Turrón-Herstellung für dieses Jahr besprechen, und am Nachmittag ist sie mit einem Journalisten eines renommierten Gourmetmagazins verabredet, der an einer Reportage über die besten Schokoladengeschäfte in Barcelona arbeitet. Selbstredend nimmt Casa Rovira auf seiner Liste einen privilegierten Platz ein. Aber jetzt kommt noch ein neuer Termin hinzu, den Sara nicht geplant hatte und der auf einmal viel wichtiger ist als alles andere. Sie wird der leer stehenden Wohnung ihrer Nachbarin einen Besuch abstatten. Sie hätte das schon vor Tagen tun sollen, aber aus reiner Trägheit hat sie es immer wieder aufgeschoben. Sie will sicher sein, dass dies der geeignete Ort ist, gleich morgen früh wird sie dorthin gehen. Sie muss sich einen guten Aussichtsposten suchen, um sich auf die Lauer legen zu können.
Sara kann sich nicht mehr genau daran erinnern, wann Max sie zum ersten Mal mit Mamá angesprochen hat statt mit ihrem Vornamen oder einem der Koseworte wie zu Beginn ihrer Beziehung – Sweetheart, Honey, Dear. Diese neue Anrede war offenkundig eine Folge der Geburt der Kinder, aber vor allem verdankte sie diese einer Nachlässigkeit ihrerseits. Sara hat sich in dieser Angelegenheit stets selbst die Schuld gegeben. Niemals hätte sie zulassen dürfen, dass die Frau, die sie war, das Terrain an die Mutter verlor, zu der sie wurde. Nicht einmal in der Öffentlichkeit ist sie noch Sara, oder äußerst selten und auch nur, wenn die Anwesenden nicht zum engeren Kreis gehören. Das schmerzt Sara, aber sie hat längst aufgegeben, dagegen zu protestieren wie am Anfang, als sie noch sehr jung waren.
»Nenn mich nicht Mamá! Ich bin nicht deine Mutter, ich bin ihre Mutter!«, hatte sie ihn gerügt und auf die lachende Aina gezeigt, die die Situation lustig fand, weil Sprache anscheinend auch für Erwachsene eine schwierige Sache war.
Dann pflegte Max sich zu rechtfertigen:
»Aber du bist in unserem Haushalt die Mutter! Du bist die wichtigste Person hier! Das muss man doch anerkennen.«
Damals hatte Sara mit Schrecken erfasst, dass Max sie seit der Geburt attraktiver fand. Die einzigen Phasen, in denen Max ihr seinen Lesesessel überließ und so merkwürdige Dinge wie Milchpumpe, Lätzchen und Brustwarzencreme auf dem ansonsten sakrosankten Büchertisch lagen, waren die Stillzeiten der beiden Kinder. Jedes Mal, wenn sie ihre Tochter mit der heiligen Geduld stillte, die ihr sonst eigentlich fehlte, bemerkte sie, wie Max sie verzückt betrachtete, als stünde er vor einem ungewöhnlichen Phänomen. Zuweilen kam ihr dieser Blick zärtlich vor, doch oft flößte er ihr auch ein wenig Angst ein, denn sie hatte das Gefühl, als hätte eine fremde Frau ihren Platz eingenommen.
Sara muss zugeben, dass ihr mütterlicher Instinkt in Sachen Stillen nahezu inexistent war. Sie fühlte sich dabei niemals bestätigt, ebenso wenig empfand sie diese kostbare Innigkeit mit ihrem Baby, die die militanten Verfechterinnen des Stillens propagieren, die ihren Kindern jahrelang die Brust geben. Sara hegt für diese Frauen große Bewunderung, sie selbst hingegen brachte diesen Abschnitt schnellstmöglich hinter sich, auch wenn Max die Hände über dem Kopf zusammenschlug und ihr nicht im Geringsten half, ihre Schuldgefühle zu bekämpfen. Sie kaufte ein halbes Dutzend Fläschchen und ebenso viele Großpackungen der teuersten Sorte Milchpulver und legte das Kapitel Stillen bereits vier Monate nach Ainas Ankunft auf dieser Welt ad acta. Von nun an dienten die Bücher in der Leseecke den Fläschchen und Saugern als Stütze, während Max die Szene nach wie vor mit einem verzückten Gesichtsausdruck betrachtete. In der Frage ihrer Anrede hatte Sara für immer den Kürzeren gezogen.
Fünfzehn Jahre später kommt es ihr ein wenig lächerlich vor, ihrem Mann zu sagen, dass sie nicht mit Mamá angesprochen werden möchte. Genau wie die Sache mit Oriol ist auch diese verjährt. Mit ihren vierundvierzig Jahren hat sie immerhin begriffen, dass es sich nicht lohnt, Energie für Dinge zu vergeuden, die bereits verloren sind.
Am nächsten Morgen bereitet sich Sara wie jeden Tag in der Küche das Frühstück zu, während sie die Nachrichten guckt. Vor allem interessiert sie der Wetterbericht für den Folgetag: Abends soll der Himmel wolkenlos sein und eine angenehme Temperatur herrschen, die etwas über dem üblichen Durchschnitt für Ende Mai liegt, mit Tendenz zu abnehmender Luftfeuchtigkeit.
Für Sara beginnt der Tag nicht gut, obwohl die Wettervorhersage perfekt ist. Max ist schon vor einer Weile zur Universität gegangen, nach seinem ersten Kaffee – den stets sie zubereitet –, dem Kuss, den er ihr jeden Morgen auf die Stirn drückt, und seinem üblichen Abschiedsgruß: »Ich wünsche dir einen schönen Tag, Mamá.«
Sobald sie hört, dass die Tür zufällt, greift Sara nach ihrem Smartphone. Seit dem frühen Morgen schon will sie ihre Nachrichten checken. Sie geht systematisch alle Einträge der letzten drei Tage durch: SMS, Messenger, Mails, Facebook, Twitter und schließlich die Mailbox – ohne Ergebnis. Es kommt ihr seltsam vor, keine Nachricht von Oriol vorzufinden. Warum hat er sich nicht gemeldet? Dann muss sie wohl selbst ans Werk.
Wann bist du angekommen? Wo bist du?
Nein, nein. Das ist zu direkt. Sie löscht es. Und versucht es noch mal.
Geht es dir gut?
Das kommt ihr jetzt zu harmlos vor. Wieder löscht sie den Text. Sie legt das Smartphone beiseite, nimmt eine Scheibe Brot aus dem Gefrierfach und steckt sie in den Toaster. Sie stellt Butter und die Limettenmarmelade auf den Tisch, die sie extra von einem englischen Lieferanten bezieht (anscheinend ist sie die Einzige in ganz Barcelona, der diese Sorte schmeckt), greift wieder zum Telefon und unternimmt einen dritten Versuch.
Ich habe große Lust, dich zu sehen.
Gerade als sie die Nachricht abschicken will, lässt irgendetwas sie innehalten. Die Nachricht kommt ihr sehr förmlich vor, etwas unnatürlich, so wie die Scheibe Brot, die sie gerade aus dem Gefrierfach genommen hat. Wieder lässt sie die Zeile verschwinden. Allmählich überfallen sie Zweifel. Wäre es besser, ihm keine Nachricht zu senden? Vielleicht ist sein Schweigen ja beabsichtigt.
Die Toastscheibe springt hoch, das Gerät schaltet sich aus, und alles ist nun in Warteposition: ein Teller, das Tablett, das Buttermesser, das Smartphone, eine Stoffserviette mit ihrem Namen sowie die Fernbedienung. Sara stellt den Fernseher ein wenig lauter und guckt weiter die Nachrichten, während sie das Brot mit Butter bestreicht, wie jeden Tag.
Ein Schwarzer, mit blutverschmierter Hand und mit zwei gigantischen Messern bewaffnet, brüllt wutentbrannt in die Kamera. Sara versteht seine Worte auch ohne Untertitel, obwohl ihr Englisch ziemlich miserabel ist: »Ihr werdet niemals sicher sein. Ihr müsst eure politischen Führer stürzen, die sich einen Scheißdreck für euch interessieren!«
Der Mann, so erklärt der Moderator, habe soeben am helllichten Tag in einer Straße im Süden von London einen ehemaligen Militärangehörigen enthauptet. Sara ist entsetzt. Uns bleibt aber auch nichts erspart, denkt sie und schaltet den Fernseher aus.
Als sie mit dem Frühstück fertig ist, beschäftigt sie sich wieder mit ihrem Problem. Sie benötigt weitere drei Anläufe, bis sie endlich einen Text entworfen hat.
Hallo!
Sie tippt auf Senden und setzt, kein bisschen erleichtert, den geplanten Tagesablauf fort. Doch sie muss von ihrem Plan abweichen, als es um halb neun an der Wohnungstür klingelt: ein zerstreuter Lieferant, der vor Ladenöffnung aufgetaucht ist. Ihre Assistentin ist noch nicht eingetroffen, und Sara will nicht riskieren, dass er unverrichteter Dinge wieder abfährt. Sie ist sich sicher, dass er die Schokolade nachliefert, die gestern fehlte, um die Bestellungen auszuführen. Über die Sprechanlage vernimmt sie eine heisere Stimme:
»Ich bringe die dreißig Pakete der Firma Callebaut.«
»Ich komme runter.«
Hastig läuft Sara los, greift nach den Schlüsseln – ihren eigenen und denen der Nachbarin – und eilt zum Treppenabsatz. Während sie auf den Aufzug wartet, wirft sie einen Blick auf ihr Smartphone. Vor der spiegelnden Metalltür richtet sie ihre Frisur. Wenn sie nervös ist, muss sie sich andauernd an die Haare fassen. Dabei gibt es keinen Grund zur Nervosität, es ist nichts passiert, alles ist unter Kontrolle. Die fehlende Schokolade ist gerade eingetroffen, der Besuch der Nachbarwohnung ist nichts weiter als eine Erkundung des Terrains, sie hat noch keine Entscheidung getroffen, und früher oder später wird Oriol antworten müssen, vielleicht kämpft er ja noch mit dem Jetlag und schläft. Sobald die Aufzugtüren sich schließen, drückt sie auf den Knopf für das Erdgeschoss, und es geht abwärts, auch mit ihrer Stimmung. Sara kann nicht vergessen, dass die Dinge keineswegs unter Kontrolle sind, sosehr sie auch versucht, sich das einzureden. Wie früher, wenn Oriol auftauchte, herrscht auch jetzt absolutes Chaos. Außerdem würde sie gern wissen, warum sie so verärgert ist. Es hat ihr doch keiner etwas getan.
Sara kümmert sich um die Formalitäten mit dem Lieferanten. Sie öffnet die Tür des Geschäfts und bittet ihn, die Ware nicht mitten in den Weg zu stellen. Noch bevor er mit dem Ausladen fertig ist, kommt die Assistentin und übernimmt das Kommando. Sara sagt ihr, dass sie zur Bank müsse, und verschwindet. In den letzten zwei Minuten hat sie das Smartphone noch mehrfach gecheckt, aber die Antwort lässt auf sich warten.
Raquels Wohnung befindet sich im Nachbarhaus. Sie könnte ein Zwilling ihrer eigenen sein, wenn sie nicht so alt und beengt wäre und man sie einer ebenso sündhaft teuren Komplettsanierung unterzogen hätte, die sie bei sich hat vornehmen lassen. Im Haus gibt es keinen Lift, zwangsläufig muss sie die vier Stockwerke zu Fuß gehen. Das macht ihr nichts aus. Sara tut viel für ihre Fitness, sie ist Mitglied in einem exklusiven Studio nur für Frauen in der Zona Alta. Wenn sie dorthin geht, schwimmt sie ein paar Bahnen in dem hell erleuchteten Hallenbad, spielt eine Partie Squash mit der Direktorin eines Luxushotels in der Avinguda Diagonal – ihre Bekanntschaft reicht über das Spielfeld nicht hinaus –, und danach geht sie noch in die Sauna. Tatsächlich gefallen ihr die Sauna und der Whirlpool am besten, denn an den Geräten fühlt sie sich nicht wohl.
Wie auch immer, dank des Fitnessstudios – zumindest glaubt Sara das – schafft sie den Aufstieg zu Raquels Wohnung, ohne aus der Puste zu kommen. Das Treppenhaus ist nicht gerade einladend, es hat etwas mehr als nur einen frischen Anstrich nötig. Sie steckt den Schlüssel ins Schloss, spürt beim Umdrehen einen kleinen Widerstand, dann betritt sie die Wohnung. Kaum hat sie die Türschwelle überschritten, nimmt sie den Geruch der abwesenden Nachbarin so deutlich wahr, als würde diese sie gleich persönlich begrüßen.
Sara ist erst einmal hier gewesen, an dem Tag, an dem Raquel in der Confiserie auftauchte und sie fragte, ob sie ihr einen riesigen Gefallen tun könne, sie würde es ihr gleich unter vier Augen erklären. Sara besuchte sie am selben Nachmittag, zur Kaffeezeit, in ihrer Wohnung. Bis dahin kannte sie Raquel nur aus ihrem Geschäft, wo sie ihr Croissants, Brötchen, zuweilen eine Ensaimada und recht oft die Tafeln für die Zubereitung von Trinkschokolade verkaufte. Raquel ist eine schmächtige Frau, eher sechzig als fünfzig, sie ist seit fünf Jahren Witwe und hat eine Tochter, die allerdings im Ausland lebt. Raquel erklärte, dass die Tochter ihre Hilfe benötige und sie beschlossen habe, für eine Weile zu ihr zu ziehen. Sie wisse nicht, wie lange sie weg sein würde, und habe deshalb überlegt, die Wohnungsschlüssel einer vertrauenswürdigen Person zu überlassen, damit diese im Notfall in die Wohnung käme. »Und falls Sie mitbekommen, dass hier im Viertel jemand eine Wohnung zur Miete sucht, würden Sie dann netterweise von meiner erzählen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Señora Sara. Sie sehen doch jeden Tag viele Leute. Ich möchte Ihnen wirklich keine Umstände machen, aber in diesen schwierigen Zeiten käme mir das Geld sehr gelegen.«
Das war vor mehr als einem Monat gewesen, und Sara schüttelt das Schuldgefühl ab, die Wohnung seitdem nicht ein einziges Mal betreten zu haben, obwohl sie jeden Tag daran gedacht hat. Sie ist überrascht, wie gut alles in Schuss ist. Raquel hat vor ihrer Abreise die Fenster geschlossen und einige Möbelstücke mit Laken bedeckt. Nachdem sie sich umgeschaut hat, steuert Sara direkt den Ort an, der sie interessiert. Sie geht die Wendeltreppe zu Raquels Schlafzimmer hinauf, tastet sich im Dunkeln voran – die Jalousien vor dem Fenster lassen keinen Lichtstrahl herein – und betritt die Dachterrasse.
Zufrieden stellt sie fest, dass dies der ideale Ort für ihren Plan ist. Die Pflanzen in den Kübeln wachsen dicht an der Mauer und ragen ein wenig darüber hinaus, so dass eine Person von ihrer Statur sich bestens dahinter verstecken kann. In der Hecke ist eine schmale Lücke, durch die Sara alles beobachten kann, ohne selbst gesehen zu werden. Der Boden ist ein wenig abschüssig, sie wird aufpassen müssen, dass sie nicht stolpert. Ansonsten wird sie nur wenige Maßnahmen ergreifen müssen, damit alles funktioniert: schwarze Kleidung tragen – zur Tarnung –, einen bequemen Stuhl auftreiben, der nicht knarrt oder wackelt, und vielleicht eine Jacke und ein Halstuch anziehen. Die Nächte sind noch frisch, vor allem bei dieser Luftfeuchtigkeit. Und das Smartphone muss sie stumm stellen, das hat absolute Priorität.
Sara hat nach wie vor keine Nachricht erhalten, dabei schaut sie andauernd auf das Display. Sie verharrt einen Moment auf ihrem Aussichtsposten und betrachtet ihre eigene Dachterrasse, die von hier aus eine gewisse aristokratische Aura ausstrahlt: die Holzpaneele am Boden, der geflieste Bereich mit dem Teakholztisch, der Kunstrasen – kleiner als Max ihn haben wollte, doch größer als ihr eigentlich lieb ist –, die Hollywoodschaukel für drei Personen, die exklusiven verstellbaren Liegestühle, die dank des automatischen Bewässerungssystems bestens gepflegten Pflanzen, die Markise mit Windautomatik, die von selbst weiß, wann sie einfahren muss …
Sie hatten das große Glück, die beiden oberen Wohnungen in dem Haus kaufen zu können, in dem ihre Eltern zeit ihres Lebens gewohnt hatten, und zwar kurz bevor die Immobilienpreise in die Höhe schossen. Zudem fanden sie einen guten Architekten, der den Umbau zu einem annehmbaren Preis vornahm (was sie Max und dessen kaltblütigem Verhandlungsgeschick verdankten, das Sara normalerweise wahnsinnig macht). Und zu guter Letzt konnten sie alles in Ruhe in Angriff nehmen, es kam weder zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten, noch gab es unerwartete Zusatzkosten. Damals hatten ihre Eltern beschlossen, sich zur Ruhe zu setzen und eine Zeit lang auf Menorca zu leben. So konnten Sara, Max und Aina, die damals nicht einmal ein Jahr alt war, in die Wohnung von Saras Eltern ziehen, solange ihr zukünftiges Paradies eine Baustelle war. Von den Umbaumaßnahmen bekamen sie so gut wie nichts mit.
Das Haus war schon immer etwas Besonderes gewesen. Es lag mitten im Carrer de l’Argenteria, stand unter Denkmalschutz, war saniert und sogar mit einem Lift ausgestattet, eine Rarität in dem Viertel. Aber zum Schmuckstück wurde es erst, als die Eigentümergemeinschaft sich in den Achtzigerjahren von dem Sanierungsboom anstecken ließ, der vor den Olympischen Spielen von Amts wegen in ganz Barcelona herrschte, und die Fassade erneuern ließ. Daraufhin stieg natürlich sofort der Wert der Wohnungen, um nach den Spielen wieder ein wenig zu sinken. Als Max und Sara zum ersten Mal das obere Stockwerk ihrer zukünftigen Maisonettewohnung besichtigten und die Dachterrasse betraten, die den Blick auf die Basilika Santa Maria del Mar freigab, sagte Max: »Hier will ich zu Abend essen, und zwar jeden Abend, solange ich lebe.«
Ursprünglich machte die Dachterrasse nicht viel her, sie war eigentlich nur ein Flachdach, auf dem die Wäsche aufgehängt wurde, aber Max und Sara gingen davon aus, dass ein guter Architekt bestimmt ein paar zündende Ideen hätte.
Auf die Wohnung im vierten Stock mussten sie noch weitere drei Jahre warten, bis die alte Frau starb, die dort seit Jahrzehnten ganz allein wohnte. Sie hätten diese Wohnung auf jeden Fall gekauft, sogar ohne sie vorher anzusehen, doch beim Besichtigungstermin spielten sie perfekt ihre Rollen. Max verhandelte unnachgiebig, Sara schien kurz vor dem Nervenzusammenbruch zu stehen, und der Immobilienmakler mimte den Beleidigten. Doch am nächsten Tag rief er sie gleich morgens an und akzeptierte das Angebot.
Ihre Maisonettewohnung wurde so schön und so geräumig, dass Señora Rovira, Saras Mutter, bei der ersten Besichtigung Tränen in die Augen schossen und sie rief: »Das ist die Wohnung, die ihr verdient habt, mein Kind!« Weitere drei Jahre später konnten sie auch noch die Wohnung in der zweiten Etage kaufen. Diese Wohnung benutzten sie als Lager, Büro und Umkleideraum für die Mitarbeiter der Confiserie, aber Saras eigentlicher Plan war, dass Aina einmal die Wohnung im ersten Stock und Pol die im zweiten Stock bekommen sollte. Dass sie für die Zukunft ihrer Kinder bereits Vorsorge getroffen hatte, noch ehe eines von beiden die Grundschule abgeschlossen hatte, belegte recht deutlich ihren Wohlstand.
Sara blickt ein letztes Mal auf das Display, ihr entfährt ein Seufzer, und sie tippt eine neue Nachricht.
Hallo?
Senden, Nachricht wird gesendet, Nachricht erfolgreich gesendet.
Sara steckt das Smartphone in die Handtasche. Sie betritt Raquels Schlafzimmer und hinterlässt es so, wie sie es vorgefunden hat. Sie geht die Wendeltreppe hinunter, schließt die Wohnungstür hinter sich und denkt im Treppenhaus darüber nach, dass ein frischer Anstrich wirklich nicht verkehrt wäre, um dem Haus ein anderes Ambiente zu verleihen. Das alles lenkt sie nicht davon ab, dass sie sich wegen Oriol hin- und hergerissen fühlt. Eigentlich will sie nichts von ihm wissen, aber warum verzweifelt sie dann daran, dass er nicht auf ihre Nachrichten reagiert? Zum Glück kann sie auf die Wohnung ihrer Nachbarin zurückgreifen, die perfekte Lösung. Denn aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat sie ihrem Mann noch nicht erzählt, dass Raquel für längere Zeit verreist ist und ihr den Wohnungsschlüssel überlassen hat.
Würde man Sara fragen, warum ihr Mann ihr gefällt, so erhielte man eine ausführliche Antwort mit vielen aufrichtigen Gründen. Max ist ein großartiger Mann, da würden ihr alle zustimmen. Das beginnt mit seinem Aussehen: Mit seinen auffällig blauen Augen und der widerspenstigen Haarsträhne, die seine Mutter früher verrückt gemacht hat, wirkt er wie ein ewiger Jugendlicher. Sein Aussehen erwies sich kurz nach der Promotion als großes Problem, denn als Max zu unterrichten begann, musste er feststellen, dass die meisten seiner Studenten größer, kräftiger und auch durchsetzungsfähiger wirkten als er. Was er dann unternahm, um sich bei den Studierenden Respekt zu verschaffen, folgte nicht wirklich einer Strategie. Er musste nur seine ohnehin vorhandenen Charakterzüge ein wenig übertreiben: Distanz, Strenge, Ernsthaftigkeit sowie hoher akademischer Anspruch. Zumindest am Anfang konnte er damit auftrumpfen. Überrascht stellte er fest, dass er von den weiblichen wie von den männlichen Studierenden gleichermaßen ernst genommen wurde, auch wenn Erstere die besorgniserregende Tendenz entwickelten, sich in ihn zu verlieben und ihn während der Sprechstunden oder bei der Diskussion um Prüfungsergebnisse mit peinlichen Äußerungen zu überfallen. Max hingegen fühlte sich nie zu Studentinnen hingezogen, nicht einmal physisch. Für ihn waren sie alle nur oberflächlich, verrückt und vor allem ungebildet. Mit Mädchen, die nicht einmal wussten, wer Mendelejew war, konnte er sich keine intime oder sonst wie transzendente Situation vorstellen.
Max verfügt über alle Charakterzüge, die eine Mutter für das Idealbild des perfekten Schwiegersohnes zeichnen würde. Beim Sprechen zeigt er so viel Respekt, dass er sich zuweilen in einem Labyrinth liebenswürdiger Worte verliert; er schläft nie länger als bis sieben Uhr morgens; an zeitliche Vorgaben hält er sich so eisern wie ein Glöckner; er wird niemals laut; ihm gehen nie die Nerven durch (schon gar nicht im Beisein seiner Ehefrau); er hat keine großen, mittleren oder kleinen Laster (nicht einmal etwas Bewundernswertes wie eine Sammelleidenschaft oder ein Hobby wie die Bibliophilie); ihm fällt kein Zacken aus der Krone, wenn es um Hausarbeiten geht (als die Kinder noch klein waren, rühmte er sich, den Weltrekord im Windelwechseln zu halten); er kennt die Waschmaschine sehr viel besser als Sara; er kümmert sich um sämtliche Flick- und Näharbeiten. Und als wäre das alles nicht genug: Max setzt keinen Fuß in die Küche, denn das mag Sara gar nicht, es sei denn, sie erlaubt es ihm ausdrücklich.
Natürlich, wenn eine innere Stimme Sara nach den Gründen fragen würde, warum sie in Max zuweilen nicht den Typ Mann sieht, an dessen Seite sie alt werden möchte, hätte sie auch darauf eine Reihe Antworten parat. Aber diese Antworten würde sie nur sich selbst geben, und auch nur dann, wenn ihr Schuldgefühl es zuließe, was selten vorkommt. Dann würde sie beispielsweise sagen, dass Max ein vorzeitig gealterter Mann ist. Nicht dass er mit seinen zweiundvierzig Jahren tatsächlich alt wäre, nein, er ist schon seit zwanzig Jahren alt, und das wiegt noch schwerer. Man kann nicht ohne größere Vorausplanung abends mit ihm ausgehen, denn die frühen Morgenstunden sind ihm heilig, und wenn er nicht mindestens acht Stunden Schlaf bekommt, ist er nicht leistungsfähig genug. Wenn sie ihn früher, als sie noch nicht gelernt hatte, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, manchmal spontan ins Theater oder zu irgendeinem Konzert schleifen konnte, dann musste sie auch die Konsequenzen ertragen: Max schlief während der Veranstaltung einfach ein. Zudem leidet ihr Ehemann an dieser Krankheit, die gesellschaftlich hoch angesehen ist und sehr oft mit dem Wesen eines Genies verwechselt wird, aber absolut nervig ist, wenn man sie täglich ertragen muss: Zerstreutheit. Tatsächlich ist er so oft geistig abwesend, dass es zuweilen äußerst schwerfällt, ihn wieder in die Realität zurückzuholen. Für das Abendessen beispielsweise legt Max eine Pause ein und steigt in die Niederungen der Wirklichkeit hinab, aber sobald er damit fertig ist, kehrt er in seine Parallelwelt zurück, in der er – selbstverständlich – Unterricht erteilt, Vorträge hält und in seinem Sessel sitzt und liest.
Und zu guter Letzt gibt es noch den Sex. Natürlich steht Sex immer an irgendeiner Stelle. Aber an welcher genau, ob an erster oder an vierzehnter Stelle, das hängt von jedem Einzelnen ab. Man kann nicht sagen, dass Max in dieser Hinsicht eine Enttäuschung darstellt. Sara kann im Großen und Ganzen nicht klagen. Aber allmählich ändert sich etwas, das zeigt sich an kleinen Details. In letzter Zeit besteht Max zum Beispiel darauf, beim Sex die Socken anzubehalten. Er behauptet, dass sonst seine Füße kalt werden. Am Wochenende vernachlässigt er die Pflicht, sich zu rasieren, und trotz allem startet er sonntagnachmittags einen sexuellen Angriff auf Sara. Wenn sie ihm dann zu verstehen gibt, dass er sich entweder rasiert oder nichts daraus wird, entscheidet er sich für das Nichts, womit er ihr wiederum zu verstehen gibt, dass er lieber in diesem abgewrackten Zustand herumläuft, als mit ihr ins Bett zu gehen. Die Liste ließe sich beliebig verlängern, wenn es nicht so lästig wäre, über solche Dinge zu sprechen.
Jedes Mal, wenn sie Inventur macht – für eine Bilanz ist sie noch zu jung –, erkennt Sara, dass sie keine schwerwiegenden Gründe hat, ihres Ehemannes überdrüssig zu sein. Vielleicht ist es ja purer Snobismus, so wie dieser aktuelle Trend, Pralinen aus solchen Absonderlichkeiten wie Zwiebeln oder Würsten herzustellen, einfach eine Laune. Aber wer im Glashaus sitzt …
In ihrem Geschäft hat sie ein Schaufenster eigens für die Marke Oriol Pairot reserviert (mit einem Porträt des Freundes und allem Drum und Dran), und selbstverständlich ist das mit Abstand erfolgreichste Produkt die berühmte Pralinenschachtel Trio der ungleichen Freunde: Ingwer, Chili und Lavendel. Solche Zutaten konnten nur Oriol einfallen, schließlich ist er ein Genie.
Was Max angeht, ist Sara sich völlig im Klaren darüber, dass die Schuld bei ihr liegt, und zwar nur bei ihr. Schließlich weiß sie seit dem Tag, an dem sie sich kennenlernten, dass er ein argloser Mensch ist, unfähig, irgendetwas zu unternehmen, was sie stören oder gar beleidigen könnte, und dass er sich schon gar nicht vorstellen kann, welche Verirrungen oder Gemeinheiten sich seine Ehefrau zuweilen erlaubt. Wenn er das wüsste, würde er die Welt nicht mehr verstehen, der Ärmste.
Dass Max Sara verzückt betrachtet, ist nichts Neues. Er verschlingt sie mit Blicken, und das seit jenem ersten Abend im April, den man für den Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte halten kann. Oder sogar schon länger, denn dieser Blick machte Sara schon während des Kurses über Chocolatier-Techniken nervös, in dem sie sich kennenlernten.
»Ich heiße Sie alle herzlich willkommen!«, begrüßte der Kursleiter die Teilnehmer feierlich am ersten Tag. »Mein Name ist Jesús Ortega, ich bin Chocolatier, und in den nächsten drei Wochen werde ich dafür sorgen, dass Sie dies auch werden. Lassen Sie uns damit beginnen, uns bewusst zu machen, was das in einer Stadt bedeutet, in der die Tradition der Schokoladenherstellung so tief verwurzelt ist wie in Barcelona. Vielleicht wissen viele von Ihnen nicht, dass Sie in einer in dieser Hinsicht herausragenden Stadt leben. Hier wurde die Schokolade zu einer Delikatesse für die Aristokratie, hier stand die Wiege des ersten Schokoladenmachers – sein Name war Fernández –, der eine Maschine zur Verarbeitung von Kakaobohnen konstruierte, hier befindet sich der Hafen, von dem aus im neunzehnten Jahrhundert die Schiffe mit den Produkten der großen Schokoladenmanufakturen aufbrachen. Ich nenne Ihnen jetzt nur die Namen der Häuser Sampons, Amatller, Juncosa, Coll … Sie alle begründeten eine große Tradition und brachten es nebenbei auch noch zu beeindruckendem Wohlstand. Barcelona ist die Stadt, in der die ersten Skulpturen aus Schokolade kreiert wurden, die Monas. Joan Giner, ein Meister seines Fachs, hat daraus eine Kunst gemacht, die in den Schaufenstern der Confiserie Mora präsentiert wurde, zum großen Vergnügen für viele Menschen meiner Generation. Beim Thema Schaufenster dürfen wir natürlich auch seinen großen Freund Antoni Escribà nicht vergessen, den man auch den Mozart der Schokolade nennt, weil er seine Kunstwerke mit einer so überwältigenden Fantasie gestaltete. Mit anderen Worten, die Stadt Barcelona nimmt aufgrund ganz eigener Verdienste einen prominenten Platz auf der Weltkarte der Schokolade ein, und das sollten Sie wissen, wenn auch Sie sich in dieser Stadt einen Namen machen möchten. Lassen Sie uns mit einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen, damit wir uns ein wenig kennenlernen. Danach machen wir uns ans Werk!«
Das alles war sehr aufregend, und jedes Mal, wenn Sara von ihrer Arbeit aufblickte, sah sie in die blauen Augen von Max, die sie fixierten. Wenn ihre Blicke sich begegneten, erschrak er kaum wahrnehmbar wie ein kleiner Vogel und versuchte, schnell woanders hinzuschauen, um seine Verlegenheit zu überspielen. Doch die Röte, die ihm ins Gesicht stieg und an eine reife Frucht erinnerte, war verräterisch. Er war einfach süß, ein so ungeschickter und guter Mensch. Es war nicht zu übersehen, dass er sich auf den ersten Blick in Sara verliebt hatte. Manchmal war er so zerstreut, dass Jesús Ortega ihn tadeln musste. »Wir müssen uns ein bisschen besser konzentrieren, Señor Frey, denn das hier sieht weniger nach einem Trüffel aus als nach Brei.« Dann senkte der Schüler den Kopf, pustete die Haarsträhne zur Seite, die stets aus der Kochmütze heraushing, und traute sich einige Minuten lang nicht mehr, von seiner Trüffelsuppe aufzublicken, die einfach nicht legieren wollte.
Sara fühlte sich durch Max’ Verehrung geschmeichelt. Jeder seiner Blicke weckte in ihr den unerträglichen Stolz einer Pubertierenden. Sie war damals noch zu jung, um zu begreifen, dass die eigene Befindlichkeit ein Verdienst der anderen ist. Zudem wurde sie von allen bewundert, denn in dem Kurs war sie bei Weitem die Schülerin mit der besten Technik. Beim Anblick dessen, was sie mit ihren Händen zustande brachte, verschlug es den anderen Teilnehmern die Sprache. Sara spielte ihr Können hinunter. Sie führte an, dies sei nur das Erbe ihrer Familie, schließlich sei sie unter Chocolatiers aufgewachsen und habe schon zugesehen, wie diese Wunderwerke zubereitet werden, als sie noch nicht einmal über die Tresenkante schauen konnte: Turrones, Torten, Schokoladenskulpturen und alles andere, was der Fantasie entspringen konnte. Ihre Worte klangen, als sei Sara davon überzeugt, das Kreieren der süßen Kunstwerke in den Genen zu haben. Ihre Kollegen widersprachen ihr nicht.
Max ließ Sara den ganzen Kurs lang kaum einen Moment aus den Augen, und sie wurde es allmählich überdrüssig, ihn stets mit diesem verzückten Gesichtsausdruck zu sehen. Es waren eher strategische Gründe, die den jungen Mann vor ihrer Zurückweisung bewahrten und Sara dazu veranlassten, ab und an mit ihm zu sprechen und zu ihm hinüberzusehen.
Während des Kurses gewann Sara viele Einblicke: Sie lernte, wie man einen einfachen Kuchen mit weißer Schokolade zubereitet und welche Temperaturen ein erfolgreiches Conchieren gefährden, ihr wurde klar, warum sie persönlich die traditionellen Rezepte den neuen Trends vorzog, und sie fasste den Beschluss, schleunigst, möglichst noch vor Ende des Kurses, Oriol Pairot aufzureißen, den besten Freund von Max und den exzentrischsten Kursteilnehmer.
Der letzte, eher weniger sachgerechte Aspekt verursachte ihr am meisten Kopfzerbrechen. Sara hätte auf der Stelle zehn oder mehr Gründe benennen können, warum sie der klassischen Confiserie den Vorzug gab. Aber sie fand keine Erklärung dafür, warum sie mit aller Macht diesen Angeber begehrte, während ihr doch der bezaubernde Max Frey zu Füßen lag. Vielleicht war es die unwiderstehliche Anziehungskraft des Unerreichbaren. Während Jesús Ortega prüfend um die Arbeitstische herumschlenderte und sich über die halb verarbeitete Schokolade beugte, schielte sie verstohlen zu Oriol Pairot und beobachtete sein ungewöhnliches Auftreten, so als wäre er das hässliche Entlein inmitten einer Schar Hühnerküken.
Der junge Oriol Pairot, der vielleicht authentischer war als der jetzige, trug den Stolz und die Gleichgültigkeit der Menschen zur Schau, die sich nicht darum scheren, wie die Welt funktioniert. Er war von zu Hause weggegangen und schlug sich mit Kneipenjobs und Kurierdiensten durch. Irgendwie hatte er die Gebühren für den Kurs aufbringen können, doch es war abzusehen, dass er in der Welt der Confiserie mangels finanzieller Mittel den Weg eines Autodidakten würde einschlagen müssen. Er wohnte in der Nähe vom Bahnhof Sants, wohl bei Verwandten oder Bekannten, auf die er aber nie zu sprechen kam. Wenn er Glück hatte, kam er nachts auf vier oder fünf Stunden Schlaf, weshalb er morgens stets mit derart tiefen Ringen unter den Augen auftauchte, dass er einem nur leidtun konnte. Die Art, wie Oriol sich am ersten Kurstag vorstellte, hätte nicht lakonischer ausfallen können. Sara hat seine Worte nie vergessen:
»Hallo, mein Name ist Oriol Pairot, ich komme aus Reus, aber ich wohne seit zwei Monaten in Barcelona. Ich möchte Chocolatier werden, aber eine andere Art von Chocolatier.«
Alle warteten auf eine Fortsetzung, während Oriol nur auf den Boden guckte.
»Können Sie uns vielleicht erklären, was Sie unter einer anderen Art verstehen?«, fragte Jesús Ortega nach.
»Genau das. Anders als die Übrigen.«
»In welcher Hinsicht?«
»In jeder Hinsicht.«
»Hat das Interesse für Schokolade bei Ihnen irgendeinen Hintergrund?«
»Die Familie.«
»Aha.« Der Dozent hatte endlich einen Anhaltspunkt, zumindest dachte er das. »Haben Ihre Eltern eine Konditorei? Vielleicht könnten Sie uns ein wenig darüber erzählen?«
Oriol rutschte unbehaglich auf dem Stuhl hin und her. »Also … Ich dachte, ich sollte etwas über mich erzählen.«
Jesús Ortega besaß eine hervorragende Menschenkenntnis und war darüber hinaus auch ein guter Mensch. Er nahm den nächsten Teilnehmer dran: Max.
»Mein Name ist Max Frey, und ich bin neunzehn Jahre alt. Eigentlich komme ich aus Illinois, USA, aber als ich noch klein war, sind meine Eltern nach New York gezogen. Das ist für mich meine Heimatstadt. Ich lebe seit zwei Jahren in Barcelona und studiere Chemie. Außerdem bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer internationalen Gruppe, die über Molekularverbindungen forscht, eine Kooperation zwischen der hiesigen Universität und einer japanischen Universität, aber deren Name ist so kompliziert, damit will ich euch nicht langweilen. Ihr fragt euch bestimmt, was ich in einem Kurs für Chocolatiers verloren habe. Ich muss zugeben, dass ich mich das selbst frage. Ich habe zwei linke Hände, ich bin feinmotorisch eine Niete und außerdem glaube ich nicht ans Lernen. Das Ganze hat mit meiner Abschlussarbeit zu tun. Darin geht es um das Verhalten von gewissen Lipiden unter bestimmten Umständen, insbesondere von Kakaobutter, und wie man dafür sorgen kann, dass sie, sagen wir es mal so, ein beispielhaftes Verhalten zeigen. Auf unseren Kurs übertragen entspricht das der Frage, wie man eine perfekte Schokolade herstellen kann. Ich bin sozusagen der verrückte Wissenschaftler, der sich in diesen Kurs geschmuggelt hat. Entschuldigt bitte die lange Rede, aber da ich eure Sprache nicht so flüssig beherrsche, habe ich mir gestern alles aufgeschrieben und auswendig gelernt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Danke für eure Geduld.«
Als Max fertig war, wurde spontan geklatscht, was ihn erröten ließ.
»Sie haben gerade gesagt, dass Sie neunzehn Jahre alt sind?«, hakte Jesús Ortega nach.
»Ja.«
»Ihnen ist klar, dass Sie hier der jüngste Teilnehmer sind?«
»Ja, das bin ich gewohnt.« Max sah zu Boden. »Ich habe zwei Jahre übersprungen.«
Max antwortete, als wäre ihm das peinlich. Und das war es auch. Jedes Mal, wenn er seinen Ausbildungsweg erklären sollte, ging es früher oder später um seine großen intellektuellen Fähigkeiten und um das Gutachten, das ein bedeutender Psychologe erstellt hatte, der auf Hochbegabung und besondere Talente spezialisiert war. Denn das war der wahre Grund für den Umzug der gesamten Familie nach New York gewesen. Dort begann für Max ein neues Leben und der furchtbarste Albtraum, den ein neunjähriger Junge erleben kann, wenn man ihn plötzlich in eine Klasse mit elfjährigen Hochbegabten steckt.
An diesem Tag musste Max keine weiteren Erklärungen abgeben, denn glücklicherweise konnte Jesús Ortega mit seinem sechsten Sinn alles mehr oder weniger erahnen und hakte nicht weiter nach.
Dann war Sara an der Reihe.
»Ich heiße Sara Rovira, bin einundzwanzig Jahre alt und beende demnächst mein Geschichtsstudium. Ich habe mich für das Fach entschieden, weil ich den Dingen gern auf den Grund gehe und weil ich denke, dass wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen müssen, denn sonst werden wir niemals wissen, wer wir selbst sind. Mit anderen Worten, sonst wäre die Vergangenheit nur ein Berg von bedeutungslosen Ereignissen. Aber ich fürchte, ich schweife vom Thema ab. Also, ich studiere Geschichte, aber seit meiner Kindheit weiß ich, dass ich einmal in der Confiserie meiner Eltern hinter der Theke stehen werde. Mein Vater hat das Geschäft bereits 1960 gegründet, es läuft immer noch sehr gut und hat viele Stammkunden. Er möchte sich in zwei Jahren zur Ruhe setzen, und ich bin Einzelkind. Ich weiß genau, was auf mich zukommt, und ich freue mich darauf! Mir gefällt der Gedanke, das Geschäft zu übernehmen und eine Tradition weiterzuführen, die mir viel bedeutet. Ich bin hier, um neue Techniken zu lernen, die mir jetzt und in der Zukunft weiterhelfen können. Außerdem …« Sie lächelte frech und sah zu Oriol. »Außerdem interessiert mich, was die Konkurrenz so treibt.«
»Das ist die richtige Einstellung!«, rief der Dozent, dem die hintersinnige Absicht des letzten Satzes entgangen war und der gar nicht auf die Idee kam, die Teilnehmer könnten in seinem Kurs miteinander flirten. »Das mit dem Jetzt und der Zukunft haben Sie sehr schön formuliert, Sara. Wirklich sehr schön!«
Max und Oriol bildeten ein unbegreifliches Gespann, denn ganz offensichtlich hatten sie nichts gemein. Aber vielleicht ist das die beste Freundschaft, die nicht auf Gemeinsamkeiten gründet und diese auch nicht anstrebt, sondern die Unterschiede pflegt. Man musste die beiden nur zusammen sehen, dann spürte man, dass sie absolut nichts verband. Oriol hatte seinen ganz eigenen Stil, ein bisschen Hippie, ein bisschen Rocker, stets in strenges Schwarz gekleidet, doch mit einem gewissen eleganten Touch, mit dem er sich von allen Szenen oder Trends absetzte. Oriol Pairot war einfach Oriol Pairot, nicht mehr und nicht weniger. Mit seiner Körpergröße von über ein Meter neunzig überragte er alle anderen, er hatte breite, wenn auch herabhängende Schultern, wie fast alle, die sich ihr Leben lang zu ihren kleiner gewachsenen Gesprächspartnern hinunterbeugen müssen. Seine schmale Taille und die kräftigen Oberschenkel erinnerten an eine klassische Statue. Seine Hände waren so dürr, als wollten sich die Knochen durch die Haut bohren, und am Hals zeichnete sich überdeutlich sein Adamsapfel ab, den Sara fasziniert, wenn auch diskret, bewunderte. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund war dies für sie der attraktivste Teil der männlichen Anatomie, und jedes Mal, wenn sie darauf blickte und Oriol gerade schluckte, hätte Sara am liebsten seinen Hals abgeschleckt wie ein Eis am Stiel.
Für Sara waren Männerfreundschaften seit jeher etwas Beneidenswertes. Männerrunden schienen ihr wunderbar simpel. Ein bisschen Alkohol, ein Zusammenhalt fast wie bei einer Stammesgesellschaft, eine gewisse Lässigkeit − keine Selbstanalysen oder tiefschürfende Diskussionen über den Sinn des Lebens, wie sie unter Frauen üblich sind −, eine gewisse Selbstverherrlichung sowie, vor allem, diese Exklusivität: Wenn Männer sich verabreden, sind Frauen nicht eingeladen. So einfach ist das.
Am Ende der ersten Kurswoche, nachdem die anderen Teilnehmer den Saal fluchtartig verlassen hatten, saß das merkwürdige Trio immer noch beisammen.
»Wollen Sie nicht nach Hause gehen?«, fragte Ortega.
Oriol, Sara und Max schienen nicht gerade begeistert von dieser Idee. Auch den Kursleiter trieb nichts nach Hause. Er stand kurz vor dem Ruhestand, und der Beruf war sein Ein und Alles. Also machte er einen Vorschlag, den er sonst keinem der Teilnehmer unterbreitet hätte.
»Soll ich Ihnen noch ein paar nützliche Tricks für die Verzierungen zeigen?«
Die drei begrüßten den Vorschlag unisono und suchten sofort ihre Schürzen, Handschuhe und all das andere Zubehör zusammen. Sie wussten, dass sie sich privilegiert fühlen konnten. Ortega schloss den Raum von innen ab und sorgte für ein privates Ambiente, das die zusätzliche Lehrstunde sehr beflügelte. Was nun folgte, war der pure Luxus. Ein Luxus, der eine Stunde und fünfundvierzig Minuten währte, in denen der Experte ihnen einige seiner Berufsgeheimnisse offenbarte.
»Menschen zu unterrichten, die tatsächlich etwas lernen wollen, ist ein Geschenk«, sagte der Chocolatier mit glänzenden Augen am Ende der Extrastunde, die er mit diesen so frischen und vielversprechenden Talenten verbracht hatte.
Seine drei Schüler waren danach zu aufgeregt, um einfach nach Hause zu gehen.
»Wie sieht’s aus, Max? Wie wär’s mit einem Bierchen?«, schlug Oriol vor, wobei er ausschließlich zu Max sah.
»Of course!«, antwortete der Amerikaner, bevor er in Richtung Toilette verschwand.
Nun waren Oriol und Sara allein.
»Nur dass du’s weißt, ich trinke auch gern Bier!«, sagte sie ein wenig eingeschnappt.
»Ach, Entschuldigung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du mitkommen willst.«
»Spricht was dagegen?«
»Ich weiß nicht. Max ist ziemlich fertig und muss sich mal aussprechen.«
»Aha. Du bist also sein Beichtvater.«
»Mehr oder weniger. Er braucht männlichen Rat.«
»Hat er Probleme, die wir Frauen nicht begreifen können?«, fragte Sara provokativ.
»Nein. Er hat Probleme mit Frauen.«
»Ach so, ein Gespräch unter Männern.«
»Genau.«
Sara hatte selten zuvor eine Antwort gehört, die so falsch klang. Aber da Oriol nun schon einmal das gefährliche Spiel der Lügen begonnen hatte, beschloss sie, ihren Beitrag zu leisten.
»Mach dir deswegen keinen Kopf. Bei dem Thema bin ich wie ein Typ.«
Oriol riss die Augen auf. Es gelang nicht alle Tage, einen schrägen Vogel wie ihn zu beeindrucken, und Sara kostete den Moment aus wie ein köstliches Petit Four frisch aus ihrer Confiserie.
»Was willst du damit sagen?«
»Ich steh auf Frauen.«
Sara sagte das einfach so dahin, ohne an die Konsequenzen zu denken.
»Wow, ich habe noch nie mit einer Frau über Titten geredet!«, sagte Oriol begierig.
»Tja, dann würde ich mir an deiner Stelle eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen.«
Als Max von der Toilette zurückkam, war das geplante Männergespräch unter vier Augen um einen überaus interessanten lesbischen Aspekt erweitert worden.
Das war der Abend, an dem ihre Freundschaft offiziell zu einer Dreiecksbeziehung wurde, auch wenn schwer zu sagen ist, ob es ein gleichseitiges Dreieck war. Die Basis aber, das ist sicher, bildeten zwei Lügen.
Am Tag der Verabredung mit Oriol behält Max seinen üblichen morgendlichen Ablauf bei. Sara hingegen ist nicht nach Routinen zumute. Sie wälzt sich bis um halb neun im Bett herum, und sobald sie aufgestanden ist, nimmt sie zwei Kopfschmerztabletten. Sie ruft ihre Assistentin an und bittet sie, sich um alles zu kümmern, weil sie noch einen Artikel schreiben müsse und den ganzen Morgen nicht ins Geschäft kommen könne. Es ist die glaubwürdigste Ausrede, die ihr einfällt. (Wäre sie nicht so durcheinander, wäre es keine Ausrede). Die Leute von der Zeitschrift bringen viel Geduld für sie auf, fragen so gut wie nie nach, veröffentlichen ihre Beiträge sofort und bezahlen pünktlich. Das ist sehr viel mehr, als man in diesen für den Zeitschriftenmarkt so schwierigen Zeiten erwarten kann.
Sara bleibt dem Geschäft ungern einen ganzen Tag fern. Sie hat den Eindruck − ob aus reinem Verantwortungsbewusstsein oder einem Hauch Arroganz −, dass nicht alles so rund läuft, wenn sie nicht da ist. Die Mitarbeiter von Casa Rovira beherrschen selbstverständlich ihr Metier, sie arbeiten nun schon seit Jahren an Saras Seite und kennen deren Stil und auch deren Marotten zur Genüge, aber aus irgendeinem für Sara unerfindlichen Grund fehlt ihnen das Quäntchen Esprit, das gewisse Etwas, das Sara besitzt und das man leider nicht lehren kann. In den knapp zwanzig Jahren, die sie nun schon die Confiserie leitet, gab es nur wenige Tage, an denen Sara nicht im Geschäft gewesen ist. Wenn sie tatsächlich einmal fehlte, war stets höhere Gewalt im Spiel, etwa die Geburten ihrer Kinder.
Auch die heutige Ausnahme fällt unter höhere Gewalt.
Während der nächsten Stunden verschwendet Sara die Zeit mit tausenderlei Dingen. Sie lackiert sich die Zehennägel in dunkellila, mit einem Nagellack mit dem schönen Namen Dominatrix, den sie bei ihrer letzten Reise nach Andorra erstanden und den sie bisher noch nie verwendet hat. Sie räumt die Besteckschublade auf. Sie trinkt drei Tassen Kaffee und nimmt eine weitere Tablette, weil die Kopfschmerzen immer noch nicht weg sind, und fragt sich, ob sie sich auf dem besten Weg zur Kodeinabhängigkeit befindet.