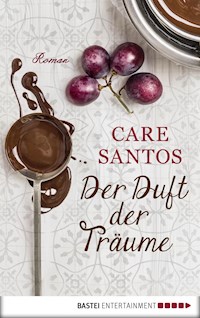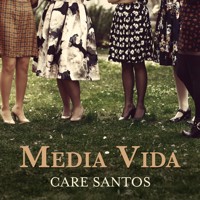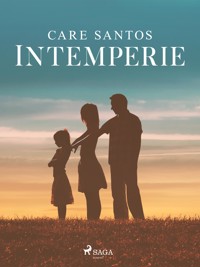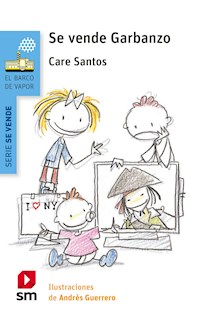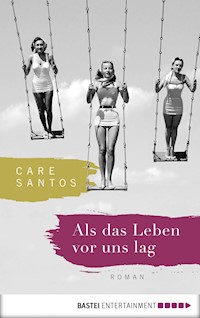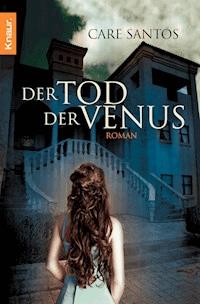
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Haus mit einem unheimlichen Geheimnis Als Mónica ein uraltes Haus in Barcelona erbt, häufen sich dort bald merkwürdige Ereignisse, unerklärliche Dinge geschehen und jemand scheint Kontakt mit ihr aufnehmen zu wollen. Doch nur der beste Freund ihres Mannes glaubt ihr. Mónica verliert plötzlich das Bewusstsein, erwacht mitten in der römischen Antike und wird Zeugin eines grausamen Verbrechens. Zurück in der Gegenwart setzt sie alles daran, die Tat aufzuklären – und bringt damit nicht nur ihre Ehe in Gefahr… Vielschichtig, unterhaltsam, mysteriös – ein faszinierender Roman der spanischen Bestsellerautorin Care Santos. Der Tod der Venus von Care Santos: auch als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Care Santos
Der Tod der Venus
Roman
Aus dem Spanischen von Jutta Ressel
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für Francesc Miralles,
zur Erinnerung an unsere Wette bei Regen
Also: Ich möchte gar zu gerne wissen, ob du glaubst, dass es Gespenster gibt und dass sie eine eigene Gestalt und irgendeine Wirksamkeit haben oder ob sie leere, eitle Gebilde sind und nur in unserer Furcht Gestalt gewinnen.
Plinius der Jüngere, Briefe, VII, 27
Vor ihrem Tod hörte die Greisin die Rufe aus dem Jenseits. Es war ein Chor vertrauter Stimmen; sie flüsterten, als befürchteten sie, die alte Frau zu wecken, während sie immer näher kamen. Die Greisin konnte sie nicht sehen, sie spürte jedoch sehr wohl ihre Anwesenheit gleichsam körperlich. Sie fühlte sich getröstet und spannte ihre Gesichtsmuskeln zu einem letzten Lächeln an. Dann schien es ihr, als würde eine unsichtbare Hand die ihre berühren und ihre Finger – einen nach dem anderen – aus den warmen Händen der jungen Frau lösen, an die sie sich noch klammerten, um sie dann mit einer anderen Kraft fest zu packen.
»Komm, Lola, wir werden erwartet«, vernahm sie, als spräche die Luft mit lieblicher Stimme zu ihr.
In genau diesem Moment erkannte sie sich selbst auf ihrem Totenbett, eine blasse und dürre Gestalt, wie ein in ein Leichentuch gehülltes Skelett. Mónica, ihre Großnichte, saß bei ihr, wie so oft in den vier langen Monaten ihrer Krankheit. Mónicas Augen waren geschlossen, denn die Müdigkeit hatte sie schließlich besiegt, doch ihre Hände hielt sie noch mit denen der sterblichen Hülle verschränkt, die nun in dem Krankenbett der Klinik ruhte.
Lola begriff, dass in diesem Augenblick etwas zu Ende gegangen war. Doch zu ihrer großen Überraschung begann nun etwas anderes. Und sie ließ sich sanft zu einem Licht geleiten, das so nah und fern zugleich erschien und das mit einer übernatürlichen Intensität wunderschön leuchtete.
ERSTER TEIL
KALTE ZONEN
»Meine Güte«, sagte der schweizerische Reiseleiter auf Französisch, »also wenn du von Gespenstern redest …«
»Ich rede nicht von Gespenstern«, erwiderte der Deutsche.
»Wovon denn dann?«
»Wenn ich das wüsste, so würde das bedeuten, dass ich mehr weiß, als dies wirklich der Fall ist.«
Charles Dickens, Bei Dämmerlicht zu lesen
Ihr, die ihr die Existenz der Geister leugnet,
füllt doch das Nichts, das sie einnehmen:
Und ihr, die ihr über sie lacht,
wagt über die Werke Gottes zu lachen und über seine Allmacht.
Allan Kardec, Das Buch der Geister
1
Als sich der Schlüssel im Schloss drehte, gab er ein stechend metallisches Geräusch von sich – als wollte sich die Tür nach all den langen Jahren nicht öffnen lassen. Javier schob mit dem Fuß einen Papierhaufen mit Werbung beiseite, der den Eingang blockierte. Dann ließ er seinen beiden Begleiterinnen den Vortritt.
»Wie lange ist das Haus schon nicht mehr bewohnt?«, fragte Elvira Pagés, als sie über die Schwelle trat. Die Immobiliensachverständige sollte den Wert des Hauses schätzen.
Ihr helles Kostüm war tadellos; die Aktentasche aus Leder wirkte, als hätte man sie gerade poliert.
»An die fünfzehn Jahre«, antwortete Mónica, »seit die Tante ins Altenheim gezogen ist. Jetzt verstehe ich, warum sie das getan hat. Wer kommt schon auf die Idee, allein in einem so großen Haus zu wohnen?«
Sie befanden sich in einem herrschaftlichen Entree, das mit Mosaiken dekoriert war, deren Motive alle möglichen Früchte zeigten. Die Bodenfliesen hatten ein geometrisches Muster; die dicke Staubschicht machte es allerdings unmöglich, sie auch gebührend zu bewundern. Und prätentiöse Pflanzenornamente in der Stuckdecke komplettierten das herrschaftliche Ambiente.
»Es war alles total überstürzt … Es ist das erste Mal, dass wir hier sind. Wir hätten ja nie vermutet, dass Tante Lola Mónica als Erbin einsetzen könnte. Wir dachten, sie würde das Haus den Nonnen vermachen, die sie gepflegt haben.«
»Sonst gibt es keine Verwandten mehr?«
»Eigentlich nicht. Lola war ja nicht einmal Mónicas Tante, sondern die Tante ihres Vaters.«
Javier gelang es nach einer weiteren kurzen Kraftanstrengung, die mit einem schmiedeeisernen Gitter versehene Haustür wieder zu schließen. Durch eine Flügeltür mit Glasausschnitten war schon das geräumige Wohnzimmer zu sehen, in das vom Patio hell das Licht einfiel.
»Das Holz hat sich verzogen«, sagte Javier und drückte nun kräftig gegen die Tür zum Wohnzimmer.
Die Gutachterin der Sparkasse hatte einen Fotoapparat hervorgeholt und machte sich an die Arbeit. Verstohlen hatte sie sich nach einer Stelle umgesehen, um ihre Aktentasche absetzen zu können. Doch dann hatte sie sich dafür entschieden, sie sich wieder über die Schulter zu hängen.
Nach einem weiteren gewaltsamen Versuch gab die Tür schließlich nach. Als Erste ging Elvira Pagés hinein. Sie scherzte: »Wie mir scheint, haben Sie ein recht widerspenstiges Haus geerbt.«
Doch kaum hatte sie einen Schritt in den großzügigen Raum gesetzt, wich sie mit angeekeltem Gesichtsausdruck zurück.
»Meine Güte, da drinnen stinkt es aber!«
Und tatsächlich, auch die anderen rochen sogleich diesen durchdringend säuerlichen Gestank, der sich nicht genauer definieren ließ und von vergammeltem Müll stammen konnte oder auch von der intensiven Feuchtigkeit in dem Gebäude. Er war so stark, dass die drei ein paar Sekunden lang fassungslos waren.
Javier musste zuerst seine Übelkeit überwinden, bevor er das Wohnzimmer durchqueren konnte, um die geschlossenen Fenster aufzureißen. Er stellte sich seelisch schon auf ein weiteres heftiges Gefecht ein, doch dann bemerkte er, dass die Fenster sich widerstandslos öffnen ließen. Das Gleiche galt für die Glastür zum Esszimmer. Javier drängte sich der Gedanke auf, dass der Garten der einzige Ort war, der für ihn etwas Einladendes hatte.
»Das Haus ist wirklich großartig«, murmelte Pagés, während sie anfing, Fotos zu machen, »aber Sie werden gewaltig investieren müssen.«
Javier und Mónica suchten einander mit den Augen.
»Genau dafür brauchen wir ja die Hypothek«, erklärte Javier. Er legte Mónica einen Arm um die Schultern und zog sie an sich. Sanft streichelte er ihren Bauch.
»Wie fühlst du dich?«
»Besser. Mir war nur ein bisschen übel.«
Das geflieste Esszimmer, über dem sich der Balkon im ersten Stock befand, war Teil von einer Art Portikus, der in den Garten führte. Mónica fiel ein, welchen Spaß es ihr als Kind bereitet hatte, dort die kleinen Fische im Wasser des Springbrunnens zu betrachten. Zwischen dem Springbrunnen und der Mauer, die das Grundstück begrenzte, wucherte Gestrüpp. Auf der einen Seite, neben der Mauer, erfreuten sich die Bäume, an die Mónica sich noch gut erinnern konnte, bester Gesundheit. Vor allem der Feigenbaum hatte sich in einen wahren Riesen verwandelt. Seine Zweige beugten sich unter dem Gewicht und hingen schwer über den Garten. Etwas weiter entfernt standen noch zwei Zitronenbäume, ein Maulbeerbaum und eine Kastanie.
Javier drehte sich um, er wollte sich vergewissern, dass die Sachverständige außer Hörweite war. Dann fragte er mit zärtlicher Stimme: »Hast du dir schon überlegt, wo unser Zwerg mal schlafen soll?«
Mónica war in der sechzehnten Woche schwanger. Vermutlich war die Gewissheit ihrer Schwangerschaft, die einer langen Zeit der Unsicherheiten ein Ende bereitete, die erste einer ganzen Reihe von Veränderungen, die eine entscheidende Wende für ihr gesamtes Leben bedeuten sollten. Dann kam der Tod von Tante Lola, gefolgt von den Zeremonien, die mit dem Ende eines Lebens immer einhergehen: Sie mussten bei der Trauerfeier der Rolle als einzige Verwandte der Verstorbenen gerecht werden, die Beileidsbezeugungen von Dutzenden von Leuten entgegennehmen, die sie gar nicht kannten, um später dann allein den Leichenwagen zum Friedhof zu begleiten – eine einsame Verrichtung, an der niemand gern teilnehmen möchte. Dort wurde der Leichnam der alten Frau unter eisigem Schweigen beigesetzt.
Formalitäten mussten sie jedoch keine erledigen. Tante Lola hatte ihre Beerdigung bis in alle Einzelheiten mit aller Sorgfalt geplant. Vom Kleid, das sie im Sarg tragen wollte, bis zu den Räumlichkeiten, wo sie für die Totenwache aufgebahrt werden sollte, hatte sie alles akribisch bestimmt. Auf diese Weise ersparte sie es Mónica und Javier, irgendwelche Entscheidungen treffen zu müssen. Und Ausgaben fielen auch keine an: Eine Sterbeversicherung, die vor über zwanzig Jahren abgeschlossen worden war, deckte alles großzügig ab. Sogar die beeindruckenden Trauerkränze waren schon im Voraus bezahlt. Den schönsten Grabschmuck schickte das Altenheim, in dem die alte Dame die letzten fünfzehn Jahre ihres Lebens in der Obhut dienstbarer Nonnen verbracht hatte. Die Leiterin wirkte im Übrigen während der Trauerfeier schier untröstlich.
Nur ein paar Tage später läutete das Telefon bei Mónica und Javier. Eine weibliche Stimme stellte sich – etwas unbeholfen, wie Mónica fand – als Schwester Asunción vor, die Leiterin des Altenheims, in dem Mónicas Tante bis zu ihrer Erkrankung gelebt hatte. »Gott hab sie selig«, fügte sie noch hinzu, bevor sie erklärte, dass sie momentan damit beschäftigt sei, die wenigen persönlichen Dinge, die die Verblichene hinterlassen hatte, »aufzuräumen«. Unter den Habseligkeiten habe sie einen Umschlag gefunden, den sie ihr nun möglichst schnell zukommen lassen wolle.
Mónica fragte erstaunt nach, ob der Umschlag denn auch tatsächlich für sie bestimmt sei.
»Aber Sie sind doch Mónica Salvà Clau, oder nicht?«
Gleich am nächsten Tag holte Mónica den Umschlag ab und riss ihn ungeduldig noch auf der Straße auf. Er enthielt mehrere rostige Schlüssel und eine Visitenkarte:
Alfonso Rodríguez Díez
Notar
Mónica vereinbarte sofort mit dem Notar einen Termin. Und so erfuhr sie, dass die Tante kurz vor ihrem Tod ihr Testament gemacht und sie als Alleinerbin des Vermögens eingesetzt hatte, das aus dem alten Haus – dem Familiensitz – samt Inventar bestand.
Mónica und Javier mussten sehr bald entscheiden, was sie mit dem Haus anstellen wollten. Ihre beiden Gehälter reichten kaum aus, um die astronomisch hohe Miete für ihre winzige Wohnung zu bezahlen und auch noch für den Unterhalt der beiden Söhne von Javier aufzukommen; sie waren das Produkt seiner Ehe mit Eva, die er nach nur wenigen Ehejahren wegen Mónica verlassen hatte. Seit der Trennung hatte Eva beschlossen, sich ihre Verbitterung mit horrenden monatlichen Zuwendungen bezahlen zu lassen. Sie hatte wie eine Furie gekämpft, bis sie schließlich zudem für ihren eigenen Unterhalt mehr als üppige Zahlungen erstritt, die ihrem Ex-Mann kaum mehr Luft zum Atmen ließen.
Hätte nicht ausgerechnet dieser Tage auch noch die Wohnungseigentümerin angerufen, um ihnen mitzuteilen, dass sie den Mietvertrag nicht verlängern wolle und sie drei Monate Zeit hätten, um sich eine neue Bleibe zu suchen, hätten sie noch jahrelang über die Erbschaft nachsinnen können.
Es war schon immer Mónicas Traum gewesen, in einem alten Haus zu wohnen, und so schien ihnen diese Möglichkeit nun eine gute Alternative zu bieten – trotz der vielen zusätzlichen Ausgaben und der Hypothek, die sie aufnehmen mussten, wenn auch zu niedrigen Zinsen, da Javier bei einer Sparkasse arbeitete. Zunächst wollten sie nur einen Teil des Hauses in Ordnung bringen und sich dort häuslich einrichten. Es war ihnen nicht so wichtig, wie viel Zeit verstreichen würde – irgendwann würden schon sämtliche Stockwerke renoviert sein. Sobald sie dort erst einmal eingezogen waren, bestand jedenfalls keine Eile mehr.
Javier begleitete nun die Gutachterin bis in die oberen Stockwerke hinauf. Das große Schlafzimmer, das auf den Patio hinausging, weckte eine Weile ihre Aufmerksamkeit. Im zweiten Stock lagen die ehemaligen Bedienstetenräume, der Speicher und eine kleine Terrasse, auf der sich irgendwann einmal der Hühnerstall befunden hatte, sowie eine Toilette. Allein dieser Bereich, so ging es Javier durch den Kopf, war schon viel größer als die Wohnung, in der sie jetzt lebten.
»Wem gehören all diese Sachen?«, fragte Pagés, als sie in den Speicher spähte, in dem auch alles unter einer dicken Staubschicht lag.
»Keine Ahnung«, antwortete er.
Als sie wieder im Erdgeschoss waren, setzte die Frau ihre Arbeit fort. Wie es schien, verewigte sie jedes kleinste Detail und machte sogar noch Aufnahmen von dem Feigenbaum.
»Also, ich für meinen Teil bin jetzt so weit«, verkündete sie plötzlich, steckte ihren Fotoapparat in die Aktentasche und ließ ihren Blick ein letztes Mal über die Räumlichkeiten schweifen. »Haben Sie das auch bemerkt? Irgendwie ist es in diesen alten Häusern drinnen einfach kälter als draußen.«
Nachdem sie einander an der Haustür die Hand geschüttelt hatten, beruhigte die Sachverständige das Paar mit dem Satz: »Ich glaube nicht, dass die Hypothek Probleme bereiten wird – das klappt schon. Dieses Haus ist einfach fantastisch. Viel Glück mit allem anderen!«
Sie waren kaum in der Wohnung angekommen und hatten mit den Vorbereitungen für das Essen begonnen, da erhielt Javier auch schon einen Anruf von Pagés auf dem Handy.
»Tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, mich noch einmal in das Haus zu lassen. Ich muss meine Arbeit wohl wiederholen.«
»Kein Problem. Was ist denn passiert?«
»Also, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so recht. Die Speicherkarte hat wohl einen Fehler. Von allen Fotos, die ich gemacht habe, ist bloß eines vorhanden. Das von dem großen Baum im Garten. Das ist doch seltsam, oder?«
2
Aus unerfindlichen Gründen führte auch die zweite Fotosession zu keinerlei Ergebnissen. Doch obwohl das Gutachten, das die Sachverständige der Sparkasse präsentierte, als Illustration nur das Foto eines robusten Feigenbaums enthielt, der im Garten des Anwesens wuchs, bewilligte die Kreditabteilung einstimmig die von ihrem Mitarbeiter Javier Fanconi Marfá beantragte Hypothek.
Noch bevor das Geld sein Girokonto überflutete, waren sich Javier und Mónica im Klaren, wofür sie es ausgeben wollten. Als Erstes mussten einige dringende Reparaturen vorgenommen werden: die Modernisierung der elektrischen Installationen und der Ersatz der alten Rohrleitungen aus Blei.
Um die Arbeiten beaufsichtigen zu können, wechselte Mónica im Kosmetikstudio die Schicht. So war sie jeden Tag am Vormittag da, und Javier wollte das an seinen freien Nachmittagen ebenso halten – viele waren es allerdings leider nicht. Abends, in ihrer Mietwohnung, die sie längst nicht mehr als ihr Zuhause empfanden, diskutierten und besprachen sie alles, was es zu beschließen galt, und amüsierten sich über die am Tage gesammelten Anekdoten.
Besonders ergiebig war in dieser Hinsicht ein Klempner, der bald in Rente gehen wollte, und sein Lehrling, deren Arbeit zehn gut genutzte Tage dauerte. In diesen zwei Wochen hatte Mónica eine Menge Stoff, um für Javier jeden Abend eine interessante Chronik zu erstellen.
»Der Klempner hat eine Theorie, was das Wachstum des Feigenbaums im Garten angeht«, erklärte Mónica. »Anscheinend war es früher absolut üblich, dass so alte Häuser im Patio eine Klärgrube hatten. Wenn sie nicht mehr benutzt wurde, hat man sie einfach, so wie sie war, zugeschüttet. Es kam nämlich billiger, sie mit Erde aufzufüllen, anstatt sie zu reinigen. Der gute Mann meint, dass unsere Klärgrube in etwa an einer Stelle war, bis zu der die Wurzeln des Feigenbaums reichten. Kein Wunder also, dass unser lieber Baum so zufrieden ist.«
Weil der leutselige Klempner im Lauf der Tage unbedingt Vertrauen gewinnen und mit der Hausbesitzerin ins Gespräch kommen wollte, nannte das Paar ihn bei ihren abendlichen Gesprächen beim Vornamen.
»José glaubt, dass der Gestank am ersten Tag von den Abwasserleitungen gekommen sein könnte«, berichtete Mónica Javier. »Er meint, dass die Rohre bestimmt noch ein paar Überraschungen für uns bereithalten werden; das ist ganz normal in so alten Häusern, in denen jahrhundertelang irgendwelches Zeug in den Abfluss gefallen ist.«
Der Gestank war jedenfalls nicht noch einmal aufgetreten. José hatte natürlich auch dafür eine Theorie auf Lager: »Wenn es zum Regnen kommt, fängt alles, was unterirdisch ist, an zu stinken«, hatte er gesagt. Mónica wollte allerdings lieber glauben, dass der Gestank am ersten Tag auf einen bestimmten Umstand zurückzuführen war, dem sie früher oder später schon auf die Schliche kommen würden, sollte er aus irgendeinem Grund erneut auftreten.
Als sie sich daranmachte, den Boden aufzuwischen, entdeckte Mónica im Wohnzimmer unter der Schmutzschicht ein Mosaik in herrlichen Farben.
»Ich bin ja keine Expertin, Señora, aber ich glaube, dieses Mosaik ist ein Vermögen wert«, stellte José fest, als er innehielt, um das Ergebnis von Mónicas Arbeit zu bewundern. »Ich nehme an, Sie werden es nicht entfernen lassen wollen.«
Ganz im Gegenteil sogar: Sie hatte die Absicht, auch diesen Motiven – so wie dem ganzen Haus – wieder zu seiner alten Pracht zu verhelfen. Auch wenn sie damit vielleicht noch eine Weile warten mussten.
»Für den Fall, dass es Sie interessiert«, fügte José hinzu, »also, ich kenne da einen Restaurator, der Ihnen mit Freuden seine Einschätzung mitteilen wird. Aber er ist ein Künstler. Ein richtig toller, wirklich … ein bekannter Künstler, nicht so ein Typ mit zwei linken Händen wie ich.«
Mónica wollte weder bis zum Abend abwarten noch Javiers Meinung dazu hören: Sie nahm das Angebot an. José erklärte seinem Freund am Telefon, worum es ging, und vereinbarte, dass dieser in den nächsten Tagen sich das Kunstwerk ansehen würde.
Der Fachmann für Mosaike, der erheblich kompetenter war, als Mónica es sich je vorgestellt hätte, ließ nicht lange auf sich warten. Aber die Überraschung im Abfluss, die José angekündigt hatte, tauchte noch schneller auf.
»Es ist immer wieder das Gleiche«, sagte der Klempner, während er in den tausend Sachen herumsuchte, die er in seinem Blaumann stecken hatte. »Da ist das Ding ja.« Er legte Mónica etwas auf die Handfläche. »Vielleicht wissen Sie ja, wem das einmal gehört hat. Bestimmt hat die Besitzerin dieses Teil ihr ganzes Leben lang gesucht.«
Es war ein Ohrring, eine im isabellinischen Stil gehaltene, kunstvolle Arbeit mit einigen Dutzend kleinen Diamanten, die einen Rubin einrahmten. Er schillerte, als wäre er neu. Mónica hatte das Schmuckstück noch nie im Leben gesehen, erkannte es jedoch auf Anhieb. Es hatte ihrer Großmutter Flora gehört, der Mutter ihres Vaters und der älteren Schwester ihrer Tante Lola. Seine Geschichte gehörte mit zu den Familienanekdoten, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden.
Was sie wusste, war in etwa Folgendes: Zu ihrer bevorstehenden Hochzeit hatte Florián, ihr Urgroßvater, ein vornehmer, wohlhabender Mann, seiner Tochter Flora wertvolle Ohrringe mit Rubinen und Diamanten geschenkt, die seit langen Jahren in Familienbesitz waren. Großmutter Flora trug sie am Tag ihrer Hochzeit. Doch das Schicksal wollte es, dass ihr in jener Nacht ein Ohrring abhanden kam – und nie wiedergefunden wurde.
Leider starb Urgroßvater Florián ein paar Monate später. Manche versicherten, dies sei nur Zufall gewesen, der Mann habe das entsprechende Alter und diverse Unpässlichkeiten gehabt, doch es wurden auch Stimmen laut, die meinten, sein Tod sei durch die unschöne Erkenntnis verursacht worden, dass seine Tochter die Familientradition in Form dieses Kleinods, das einst ihrer Mutter, ihrer Großmutter und vielen anderen vor ihr gehört hatte, nicht zu schätzen gewusst habe.
Auch wenn es sich nur um ein Schmuckstück handelte, so ließ die Bedeutung, die ihr Vater dem Missgeschick beimaß, bei Flora ein schreckliches Schuldgefühl entstehen, das zu überwinden ihr nie gelang und das in ihren kurzen Jugendjahren ihr Glück trübte. Die Suche nach dem verlorenen Ohrschmuck artete in eine solche Obsession aus, dass die junge Frau schließlich den Verstand verlor. Sie gebar einen einzigen Sohn, einen Jungen von schwächlicher Gesundheit, der dann später Mónicas Vater werden sollte; doch Flora kümmerte sich nur wenig um den Jungen, so dass dieser kaum Erinnerungen an seine Mutter hatte.
Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Flora in einem psychiatrischen Pflegeheim, wo sie kurz nach ihrem Sturz – oder vielleicht auch Sprung – vom Sims im dritten Stock verstarb. Es heißt, dass sie noch mit ihrem letzten Atemzug, während sie sich in furchtbaren Schmerzen wand, zwischen den Falten ihres Bettzeugs danach gesucht habe.
»Arme Flora«, sagte sich Mónica, als sie das Schmuckstück betrachtete. »Das ganze Leben war sie wie besessen wegen diesem Ding hier, das direkt zu ihren Füßen in den Eingeweiden ihres eigenen Hauses geschlummert hat.«
3
Der Mosaikrestaurator war ein untersetzter, kräftiger Mann mit muskulösen Armen und kurzem, dicken Hals. Er hieß Rufino. Der Experte betrat das Haus mit der Distinguiertheit eines Arztes, der einen Krankenbesuch abstattet.
Sobald er im Wohnzimmer war, umrundete er das Mosaik, ohne es zu betreten. Er hielt inne und öffnete seine überdimensionierte Ledertasche, um eine Nickelbrille herauszuholen, die er sich auf die Nasenspitze setzte. Einige Minuten lang betrachtete er sehr konzentriert den Boden, während er sich mit der Hand über den nicht existenten Bart strich. Er veränderte ein paar Mal den Blickwinkel, beugte sich hinunter, um mit dem Zeigefinger an verschiedenen Stellen über den Boden zu reiben, er trat wieder zurück, klopfte mit den Fingerknöcheln auf die Mosaikfliesen und beendete nach einer Weile seine Untersuchung mit der abschließenden Diagnose: »Kein Zweifel. Es ist echt. Ein Nolla. Und noch dazu in einem sehr gutem Zustand. Es wurde sicherlich so zwischen 1880 und 1890 verlegt. Es weist kaum Mängel auf. Nur fünfzehn Fliesen sind defekt, aber die müssten sich ersetzen lassen. Anschließend wird noch poliert, und dann ist das Mosaik wieder so schön, dass Sie für die Besichtigung Eintritt verlangen können.«
Mónica war beeindruckt.
»Was ist ein Nolla?«, fragte sie.
»Miguel Nolla. Ein Fabrikant aus Valencia im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert, der sich auf diese Art Bodenmosaik mit geometrischen Mustern spezialisiert hat. Beim Herstellungsprozess verwendete er Ton, der bei niedriger Temperatur zu Keramik gebrannt wird. Seine Böden sind sehr hart, was es uns erleichtert, sie zu polieren. Sie werden perfekt, wie neu. Ich schätze, der von Ihnen wird wirklich strahlend schön, aber genau wissen wir das natürlich erst, wenn wir damit angefangen haben.«
»Das ist bestimmt schon damals nicht billig gewesen, oder?«, bemerkte Mónica, überrascht über die Information.
»Aber natürlich nicht! Ein Mosaik wie dieses hatte nicht jeder. Wissen Sie, wer damals hier gelebt hat?«
»Ich weiß nur, dass es Verwandte von mir waren. Vermutlich meine Urgroßeltern oder deren Eltern. Ich glaube, mein Vater hat einmal etwas von einer Textilfabrik erzählt.«
»Das würde mich nicht wundern«, pflichtete Rufino ihr bei. »Die meisten dieser Bodenmosaike haben Unternehmer in Katalonien anfertigen lassen – das Großbürgertum also. Diese Leute waren reich. Und sehr neidisch.«
Mónica war sich sicher, dass sie sich Rufinos Dienste nicht leisten konnten. Dennoch bat sie ihn um einen Kostenvoranschlag. »Damit ich die Sache heute Abend mit meinem Mann besprechen kann.«
»Kein Problem«, erwiderte der Restaurator und griff wieder in seine Tasche, um sich mit einem Block und einem Taschenrechner zu bewaffnen.
Während er sich auf seine Berechnungen und Aufzeichnungen konzentrierte, dachte Mónica an die vielen Geheimnisse, die sich oft hinter den alltäglichsten Gegenständen und Orten verbergen, an die unendlich vielen Ereignisse, die ständig ohne uns passieren.
»Hier, bitte«, sagte Rufino und reichte ihr ein Blatt Papier.
Oben war zu lesen: »Baetulo Mosaike. Staatl. geprüfter Kunsthandwerksmeister Nr. 61 107. Komplettrestaurierung von Bodenmosaiken.« In der letzten Zeile stand ein exorbitanter Betrag. Als Mónica ihn sah, war sie sich sicher, dass Rufino ihnen keinen zweiten Besuch abstatten würde. Der Mann – weit von solchen Gedanken entfernt – fuhr mit seinen Erläuterungen fort: »Für die defekten Fliesen haben wir Ersatzkacheln. Das sind Originale oder originalgetreue Reproduktionen, die den gleichen Anteil an Kalkstein und Feldspat enthalten, wie Nolla ihn in seinen Arbeiten verwendet hat. Das merkt man nicht einmal in fünfzig Jahren!«
Eine seltsame Traurigkeit überkam Mónica an diesem Abend. Javier bemerkte ihre Niedergeschlagenheit, als er sie anrief. Sie informierte ihn über den Besuch von Rufino und den wahnwitzig hohen Kostenvoranschlag. Javier hatte den Eindruck, als würde seine Lebensgefährtin gleich losheulen.
»Mónica, um Himmels willen, beruhige dich. Ist denn dieses Mosaik die ganze Aufregung wert?«, fragte er.
»Es tut mir wirklich sehr leid, mein Schatz, ich wollte dir keine Sorgen machen. Das sind die Hormone, meine Nerven liegen einfach blank. Und dieser üble Geruch, der macht mich völlig fertig. Er hat plötzlich wieder angefangen. Er ist wirklich unerträglich.«
4
Als der Umbau des Hauses endlich in Angriff genommen wurde, füllte sich alles mit Zementsäcken, Fliesenpaketen und Körben voller schmutziger Werkzeuge. Mónicas Leben war plötzlich einem neuen Zeitplan unterworfen – einem Stundenplan, den die Handwerker vorgaben, außerdem musste sie viele kleine und große Entscheidungen treffen. Inmitten des geschäftigen Treibens war sie besonders stolz auf eines ihrer Vorhaben: Sie hatte die Sanierung des ganzen Hauses einer Spezialfirma übertragen, die in Rekordzeit und ein für alle Mal diesem Alptraum von Schmutz ein Ende bereiten würde. Die Leute von der Sanierungsfirma brauchten einen Tag Bedenkzeit, hielten aber mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg.
»Die Tapete im Wohnzimmer muss mit einem Fettlösungsmittel behandelt werden. Aber das müssen Sie schriftlich in Auftrag geben. Wenn es Ihnen lieber ist, können wir sie auch abreißen.«
Mónica wollte die Tapete erst einmal so lassen, wie sie war. Sie war zwar nicht gerade ein Meisterwerk, hatte aber diesen nostalgischen Touch, den Mónica so faszinierend fand.
Fortan machte ein höllischer Lärm jeden Aufenthalt im Haus zu einer absoluten Folter. Von morgens in der Früh bis zum Mittagessen – von der Frühstückspause einmal abgesehen – ertönte aus den Räumlichkeiten, wo die Handwerker gerade zugange waren, eine wahre Orgie aus Hacken, Hämmern, dem Bersten von Keramik und sonstigen Geräuschen, die von der Katastrophe zeugten. Und dann war da noch dieser üble Geruch im Wohnzimmer, der Mónica nach nur wenigen Minuten wieder in die Flucht schlug. Doch am ärgerlichsten war, dass niemand außer ihr ihn wahrzunehmen schien.
»Das ist die Schwangerschaft«, behauptete der Klempner im Brustton der Überzeugung. »Schwangere Frauen haben einfach einen feineren Riecher.«
Bald fing Mónica an, in all dem Krimskrams im Speicher herumzustöbern. Der Speicher war eine der wenigen ruhigen Ecken im Haus – eine Art Zufluchtsort, den Lärm und Gestank kaum erreichten. Dort verbrachte sie viel Zeit damit, zu retten, was andere Epochen überdauert hatte: eine ovale Wanduhr mit schwarzem Gehäuse, deren Zeiger auf Punkt ein Uhr stehengeblieben waren, ein komplettes Silberbesteck, einige Betttücher, ein halbes Dutzend Bücher mit edlem Einband, ein wenig Blechspielzeug sowie ein Koffer voller Briefe.
In einer Truhe, die sie mir kindlicher Rührung unter einem Stapel Gerümpel hervorzog, fand sie den schönsten Schatz: zahlreiche Damenkleider, die aus einem alten Kostümfilm zu stammen schienen. Es gab wirklich alles: Abendkleider aus feinem Samt, die mit Schmucksteinen eingefasst waren, reich bestickte Dessous, Hüte, Capes aus Atlas, Blusen, Röcke … Sie entdeckte sogar ein fadenscheiniges Brautkleid. Mónica erging sich in schönen Träumereien, zu welchen Gelegenheiten diese Prachtstücke wohl zur Schau gestellt worden waren. Sie fühlte sich versucht, das eine oder andere Kleidungsstück anzuprobieren, und wenn sie es letztendlich doch nicht tat, dann nur, weil aus dem unteren Stockwerk die Geräusche der Maurer zu ihr hochdrangen.
Das musste sie unbedingt Javier erzählen – also rief sie ihn in der Sparkasse an. Man sagte ihr, dass er gerade gegangen sei. Ein Blick auf das Display ihres Handys zeigte ihr, dass es schon nach drei war. Sie erschrak: Ihr Dienst begann um halb vier. Sie war so aufgewühlt, dass sie die Zeit vergessen hatte. Trotzdem schickte sie Javier eine SMS: »Der Speicher ist wie der Schatz von Captain Flint. Das musst du dir unbedingt anschauen!«
Es kam ihr seltsam vor, dass die Handwerker zur Essenszeit noch arbeiteten. Da fiel ihr auf, dass der Lärm gar nicht aus dem Bad kam, sondern aus dem Schlafzimmer. Auf der Stelle machte sie sich auf den Weg, entschlossen herauszufinden, was dort vor sich ging. Aber als sie die Schlafzimmertür erreichte, hörte der Lärm auf. Plötzlich war alles still. Das Zimmer war in makellosem Zustand, alles roch nach dem starken Desinfektionsmittel, das der Sanierungstrupp verwendet hatte. Mit einem Mal – als würde das alles mit zur Orchestrierung gehören – löste sich in einer Ecke die Tapete von der Wand. Die haben zu viel Desinfektionsmittel verwendet und alles ruiniert, ging es Mónica durch den Kopf, während sie beobachtete, wie sich die Tapetenbahn mit dem Blumenmuster gleichsam in Zeitlupe von der Wand rollte.
Mónica wurde von einem so starken Schwindel gepackt, dass sich ihr Blick trübte. Das Stück Tapete hatte sich nicht gänzlich abgelöst. Es hing knapp einen Meter über dem Boden. Darunter war ein Stück schmutzige Wand zum Vorschein gekommen – eigentlich nicht weiter bemerkenswert, wären da nicht diese Buchstaben gewesen, die aussahen, als hätte sie jemand mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt. Allein schon ihr Anblick ließ Mónicas Herz schneller schlagen. Sie wirkten, als wären sie im Zorn, womöglich in Eile hingeschrieben worden. Die Worte ließen sich allerdings nicht so leicht enträtseln. Mónica las mit äußerster Konzentration:
ME IUVA[1]
Sie riss das herabhängende Stück Tapete ganz ab. Vor ihren Augen erschienen auf der nackten Wand die rätselhaften Worte in hundert verschiedenen Größen. Einige hatten kaum die Oberfläche des Putzes angekratzt. Andere waren tief eingefurcht. Doch wirklich beunruhigend war ihre Botschaft:
ME IUVA ME IUVA ME IUVA ME IUVA ME IUVA
5
Es darf doch nicht wahr sein, dass du noch immer auf dieses Mosaik fixiert bist«, sagte Javier. »Wir haben so viele andere dringende Ausgaben …«
Die Restaurierung des Mosaiks war bei Mónica zur Obsession ausgeartet. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass sie Javiers Widerstand als Ablehnung des einzigen spleenigen Wunsches deutete, um den sie ihn in all den Jahren ihres Zusammenseins gebeten hatte.
»Mónica, bitte, ich möchte dich deswegen doch nicht weinen sehen«, tröstete Javier sie eines Abends, als die Kluft zwischen ihnen immer tiefer zu werden drohte. »Ich möchte nicht, dass du meinst, dass ich übertreibe, mein Herz. Aber noch sind diese ganzen rechtlichen Angelegenheiten nicht beigelegt. Allein die Steuern werden uns ein Vermögen kosten. Ganz zu schweigen von den Ausgaben für den Notar, den Gebühren, dem Unterhalt … Kannst du dir vorstellen, was Eva mit mir macht, wenn ich bloß einen Monat in Verzug gerate? Du weißt doch, welches Vergnügen es ihr bereitet, wenn ich einen falschen Schritt tue, oder? Dann verbietet sie mir sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, den Umgang mit meinen Kindern.«
Mónica weigerte sich, ihrem Partner recht zu geben; vielleicht weil sie durch diese simple Geste ihre Träume hätte aufgeben müssen. Sie hörte ihm in der Stille der Nacht zu, die nur durch ein metallisches Klirren gestört wurde, das aus der Küche kam, wo die Waschmaschine wie fast jeden Freitagabend ihren Dienst tat. Als sie dieses ständige Geräusch schließlich leid waren, beschlossen sie, die mit Wasser gefüllte Trommel zu öffnen, um darin nach der Ursache für den Radau zu suchen.
Es war ein an die vier Zentimeter langer, rostiger Schlüssel, den weder Mónica noch Javier je im Leben gesehen hatten. Der einzige logische Schluss war, dass er aus einem der Wäschestücke, die gerade gewaschen wurden, gerutscht sein musste. Von Javier waren im Übrigen nur zwei taschenlose Hemden darunter. Alles andere gehörte Mónica: die gesamte Kleidung dieser Woche, einschließlich der verschmutzten Klamotten, die sie ausgezogen hatte, nachdem sie von der Baustelle zurückgekehrt war. Ohne das Rätsel zu lösen, gingen sie schlafen – der soeben aufgetauchte Schlüssel lag auf dem Nachttisch.
Die Einweihung des Badezimmers ging mit einer Überraschung einher: Das WC verwandelte sich in einen Springbrunnen, sobald man an der Kette der Toilettenspülung zog. Die Maurer waren die personifizierte Resignation, als sie das Schwimmbecken auf dem Boden betrachteten. Zuallererst lehnten sie jegliche Verantwortung ab: Das konnte nur die Schuld von José sein, dem Klempner, der die Rohre ausgetauscht hatte. Aus irgendeinem seltsamen Grund hatte er etwas übersehen, was den WC-Abfluss verstopfte.
»Das ist ganz normal. In der Eile bleiben eben manchmal Lappen, Werkzeuge und sonst was da drinnen. Ich habe sogar einmal eine Brotzeitdose mit einer Tortilla gefunden«, bekräftigte der Gehilfe der Handwerker, ein Bursche von sechzehn Jahren, der bislang kaum den Mund aufgemacht hatte; dieser Vorfall schien seine Zunge gelöst zu haben.
Nach oberflächlicher Inspektion und einigen mehr oder weniger simplen Handgriffen sprach der Chef der Truppe dann das Urteil: »Der Boden muss aufgerissen werden.«
Während die Handwerker der Anordnung Folge leisteten, beschloss Mónica, zu Ikea zu fahren, um dort wie geplant Module für den Schlafzimmerschrank zu kaufen. Javier tat zwar so, als wäre ihm das gar nicht so recht, doch insgeheim freute er sich, Mónica nicht in diesen Höllenschlund begleiten zu müssen, der bei seiner Frau die seltsamsten Instinkte weckte – beispielsweise Optimierung der Lagerhaltung und der Raumnutzung.
»Ich habe mir gedacht, dass ein sehr großer Schrank, der die ganze Breite der Wand einnimmt, für uns am besten wäre. Auf diese Weise sparen wir uns eine neue Tapete. Was meinst du?«
»Sehr praktisch«, erwiderte er nur.
Bevor sie auflegte, weckte Mónica Javiers Aufmerksamkeit mit noch einem letzten Detail: »Sehr wichtig, mein Schatz: Wenn du heute Abend ins Schlafzimmer gehen willst, dann nimm dir etwas Warmes zum Anziehen mit. Irgendwie wird es dort plötzlich eiskalt.«
6
Das Kosmetikstudio, in dem Mónica arbeitete, hatte eine breit gefächerte Kundschaft; zu den besten Kundinnen zählte eine Edelsteinexpertin. Mónica bat die Gemmologin, aus Gefälligkeit einen Blick auf das Schmuckstück zu werfen, das in den Rohrleitungen aufgetaucht war. Sie war neugierig, welchen Wert der Ohrring hatte.
»Es ist wirklich schade, dass Sie den zweiten nicht haben, das Stück ist nämlich wirklich außergewöhnlich. Schauen Sie mal: Der Rubin hat eine ovale Form, ist sehr groß und weist einen herrlichen Glanz auf. Diese Diamantfassungen sind recht selten. Es sind hundertacht Steine – und nicht ein einziger fehlt. Sie sind an einem Platinrahmen befestigt. Die beiden größten weisen ein Maß auf, wie es früher in Europa üblich war, und sie wiegen schätzungsweise zweihundertvierzig Zentigramm.« Sie blickte auf, sah Mónica an und wirkte plötzlich um zehn Jahre jünger, als sie mit einem Lächeln sagte: »Ich glaube, ich langweile Sie.«
Mónica schüttelte den Kopf.
»Damit wir uns recht verstehen«, fuhr die Schmuckexpertin fort, »der Ohrring ist wirklich in einem sehr guten Zustand, beinahe unglaublich, dass er im Abfluss gefunden wurde. Weiß Gott, wie er es geschafft hat, Kratzern und Rost zu entgehen. Bei einer Antiquitätenauktion würden sich für das Paar – aber nur für das Paar – an die fünftausend Euro erzielen lassen. Vielleicht sogar mehr, wenn der Interessent ein guter Sammler ist.«
Mónica gingen die Augen über.
»Im Ernst? Und wie viel würde ich nur für das Einzelstück bekommen?«
»Viel weniger, sechshundert, siebenhundert im Höchstfall, aber es wird nicht einfach, dafür einen Käufer zu finden.«
Aufgewühlt, wie Mónica war, hätte sie um ein Haar ihren Termin beim Gynäkologen vergessen. Sie traf sich mit Javier in der Arztpraxis, erpicht, ihm alles zu erzählen, was die Expertin ihr gesagt hatte.
Als die Arzthelferin feststellte, dass Mónica ein Kilo abgenommen hatte, schimpfte sie mit ihr wie mit einem kleinen Mädchen.
»Ich habe nur abgenommen, weil ich momentan nicht eine Sekunde stillsitze«, verteidigte sie sich.
»Dann müssen Sie das Leben eben ruhiger angehen, gute Frau«, beendete die Helferin den Disput autoritär.
Der Arzt erschien in seinem Sprechzimmer mit der Selbstgewissheit, mit der ein Magier die Bühne betritt. Er ließ ständig sein perfektes Gebiss sehen, das sich von seinem gebräunten Teint abhob, während er sich einen Latexhandschuh überzog, um mit der Untersuchung zu beginnen.
Die Arzthelferin strich reichlich Gel auf den Unterleib von Mónica, die dabei leicht erschauderte, während der Arzt den Ultraschall vorbereitete. Sowohl Mónica als auch Javier hatten nur noch Augen für den Monitor, wenngleich noch gar nichts zu sehen war. Sobald die ersten Bilder erschienen, fing der Gynäkologe mit seinen Erklärungen an.
»Das hier ist der Oberschenkelknochen, sehen Sie? Diese weiße, durchscheinende Linie. Der Kopf … ein Arm … der andere Arm … Sehen Sie, jetzt hat es sich umgedreht. Das Runde hier ist der Bauch. Und das da …« Er wandte sich um, um das Paar anzusehen, »möchten Sie wissen, welches Geschlecht Ihr Kind hat?«
Beide nickten gleichzeitig. Auf dem Monitor erschien etwas, das sie nicht zu enträtseln vermochten.
»Das da« – der Arzt deutete auf einen winzigen schwarzen Kreis – »ist die Blase von Ihrem Baby. Und wenn ich mich nicht arg täusche, dann würde ich schwören, dass es ein Mädchen ist.«
Die beiden verließen den Arzt wie betäubt vor Glück. Sie beschlossen, die Nachricht bei einem Japaner gebührend zu feiern.
Über der Stadt ragte ein Gebirge aus riesigen düsteren Wolken auf.
»Da wird ganz schön was runterkommen«, meinte Javier, die Augen auf die dicken schwarzen Wolken geheftet.
Als sie aus dem Restaurant kamen, regnete es bereits. Auf dem Heimweg wurde der Regen noch schlimmer. Doch das eigentliche Unwetter fing nach Mitternacht an. Mónica konnte sich kaum entspannen, solche Angst hatte sie vor dem wilden Donner und den grell zuckenden Blitzen. Sie musste ständig an das Haus denken, daran, ob die Handwerker auch die Fenster und die Tür zum Garten geschlossen hatten, bevor sie gegangen waren, ob diese Sintflut die Bauarbeiten beeinträchtigen würde. Und ihre Pläne.
Mónicas Ängste, die ihr die Nachtruhe geraubt hatten, waren durchaus begründet: Am Vortag hatten die Maurer die Tür zum Garten offen gelassen. Am frühen Morgen hatte der Wolkenbruch auch das geometrische Mosaik im Wohnzimmer in Mitleidenschaft gezogen und es mit allen möglichen Resten von Grünzeug bedeckt. Doch nichts, was sich mit Besen und Mopp nicht hätte beheben lassen.
Auch die Bäume hatten das Unwetter nicht unbeschadet überstanden. Vor allem der Feigenbaum hatte gelitten: Viele Zweige waren abgebrochen, und zwei Meter des Stammes hingen abgeknickt über der Erde.
»Der muss wohl abgesägt werden«, lautete das Urteil des Maurers, der in Richtung Feigenbaum schaute, ohne durch die Glastür hinauszutreten.
Es war ein weiterer hektischer Tag. Am Vormittag kamen die Monteure mit den Teilen für den neuen Schlafzimmerschrank. Kurz vor der Frühstückspause schickte der Chef den Lehrling mit einer Säge zur Hausherrin, um ihr seine Hilfe bei dem abgeknickten Baum anzubieten. Der Bursche konnte seinen Mangel an Erfahrung bei der Handhabung der Säge nicht verbergen. Dennoch fügte sich der Stamm dem Wunsch der beiden.
Im großen Schlafzimmer war eine Sinfonie aus Hammerschlägen zu hören, die sich hin und wieder dem Takt der Geräusche im Badezimmer anpasste. Mónicas Stimmung war gedämpft, sie fühlte sich nicht sonderlich danach, sich in Aktivitäten zu stürzen. So strich sie eine gute Weile im Haus herum und stieg dann in den Speicher hinauf, um sich die Nachmittagsstunden zu vertreiben, die so zäh schienen wie das Wachs, mit dem sie ihre Kundinnen epilierte. Sie betrachtete zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen den Koffer voller Briefe, doch diesmal weckte er ihr Interesse. Es mussten mindestens hundert sein. Die Namen ihrer Urgroßeltern waren mit fast schon künstlerischer Schrift auf die Vorderseite geschrieben – mit dicker schwarzer Tinte, alle von der gleichen Hand: María Gomis war die Empfängerin von mindestens einem halben Dutzend der Briefe. Die übrigen waren an Florián Imbert gerichtet. Die Adresse, an die sie geschickt worden waren, war die des Hauses – Calle de la Paz 26. Als Absender war bei allen nur eine rätselhafte Initiale angegeben: »M«.
Mónica wollte gerade die Geheimnisse dieser Episteln ergründen, als ihr etwas Seltsames auffiel. Jemand hatte die Briefe zwar sorgfältig dem Datum des Poststempels nach geordnet und mit einem Band zusammengebunden, doch sie hatten noch nie einem Menschen ihren Inhalt verraten. Mónica nahm jeden einzelnen noch einmal in Augenschein: Sämtliche Briefumschläge waren ungeöffnet – ausnahmslos.
Mónica konnte der Versuchung nicht widerstehen, einen Brief zur Hand zu nehmen, den Umschlag vorsichtig aufzureißen und den Bogen herauszuziehen. Das Papier war durch die Jahrzehnte der Vergessenheit vergilbt. Die Handschrift war gerundet, druckvoll und stilsicher. Mónica las mit vor Rührung pochendem Herzen:
18. Januar 1934
Liebe Mutter,
dies ist mein letzter Versuch, Euch zu erreichen.
Ich hatte schon befürchtet, dass sich Vater von den vielen Briefen, die ich Ihnen beiden geschickt habe, nicht würde erweichen lassen. Es sind inzwischen ein paar Dutzend, und es fanden sich darin zärtliche, verzweifelte und auch reuevolle Worte.
Wie ich ihn kenne, würde es mich dennoch nicht verwundern, wenn er sie überhaupt nicht hat lesen wollen.
Sie hingegen hat er immer als seine Verbündete betrachtet, die ich in diesen schweren Zeiten gern gehabt hätte. Jemand, der in der Lage ist, Akzeptanz aufzubringen, wenn schon nicht Verständnis. Und wenn ich von Akzeptanz spreche, dann meine ich damit eigentlich Liebe. Ich dachte in aller Bescheidenheit immer, dass die Liebe zur eigenen Tochter über kleinen oder auch großen Differenzen stehen würde, sogar über Peinlichkeit und Skandal.
Ich möchte damit nicht sagen, dass Sie ein Verhalten billigen sollen, das – wie Sie mir unmissverständlich zu verstehen gegeben haben – bei Ihnen eine Krankheit ausgelöst hat, die Sie dem Tode näher gebracht hat. Doch hatte ich durchaus gehofft, dass Ihre Liebe zu mir diese Prüfung überstehen würde.
Doch wie ich sehe, ist dies nicht der Fall.
Sie können sich nicht vorstellen, wie sich mir seine letzten Worte ins Herz eingegraben haben, während seine eiskalten Augen auf meine geheftet waren, als ich für immer von zu Hause verstoßen wurde. Erinnern Sie sich noch? »Ich reiße dich aus wie Unkraut!« Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht hundertmal daran denke.
Im Laufe dieser einseitigen Korrespondenz, die aufrechtzuerhalten ich mich verpflichtet gefühlt habe, glaube ich, mit ausreichender Klarheit vermittelt zu haben, dass dieses Gefühl nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ich werde von meiner Seite Ihnen beiden gegenüber nie etwas anderes als Respekt und vor allem Liebe empfinden.
Dennoch bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mit meinen Versuchen nicht fortfahren möchte, Ihnen wie auch meinem Vater ein einziges Wort, eine einzige Geste zu entlocken.
Ich für meinen Teil – selbst wenn Sie an dieser Mitteilung kein Interesse zeigen werden – habe zu einer Sicherheit zurückgefunden, die mich über diesen anderen Verlust und über die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, hinwegtröstet. Und das Einzige, was ich von diesem Augenblick an erstrebe, ist, die Meinen glücklich zu machen und weiterhin, trotz aller traurigen Erinnerungen, ein ruhiges Dasein neben meiner Tochter und deren Vater zu pflegen.
Dies ist nun also mein Abschiedsbrief. Falls Sie einmal etwas von mir benötigen, wird Ihnen niemand bei mir zu Hause je etwas abschlagen. Wobei ich allerdings annehme, dass Sie fähig wären, lieber unter einer Brücke zu sterben als bei jemandem an die Tür zu klopfen, den Sie für den Schandfleck der Familie halten.
Glauben Sie mir, Mutter, wenn ich Ihnen sage, wie sehr ich dies bedauere.
Ihre Tochter, die Sie beide liebt,
M.
Mónica war über den Inhalt des Briefes so verblüfft, dass sie nicht auf die Rufe des Maurers geachtet hatte, der im Treppenhaus ihre Aufmerksamkeit forderte.
»Señooora! Señooora!«
Sie stand schleunigst auf, um sich um ihn zu kümmern. Auf dem Schädel des Mannes schillerte hartnäckig der Schweiß zwischen den spärlichen Haaren, die ihm verblieben waren. Er wirkte zufrieden.
»Wir haben die Verstopfung der Rohre behoben«, berichtete er. »Sie werden erstaunt sein, was wir da drin gefunden haben!«
7
Eine Silberschatulle hatte den Abfluss blockiert; sie war rechteckig, mit Basreliefs versehen, ein bisschen verbogen und hatte an allen vier Ecken winzige, spitze Füßchen. Sie wirkte wie ein Miniatur-Sarkophag. Und sie war verschlossen.
»Wenn Sie wollen, verpasse ich ihr einen Schlag mit der Hacke, dann kriegen wir sie im Handumdrehen auf«, bot der Gehilfe des Maurers freundlich an – eine Vorgehensweise, die ihm in seinem Beruf ansonsten bestimmt überaus nützlich war. Mónica lehnte das Angebot ab und fragte den Meister, ob er dafür eine plausible Erklärung wisse.
»Das liegt doch auf der Hand: Der Klempner hat das Ding dort vergessen. Eine andere Erklärung gibt es nicht.«
»José? Und aus welchem Grund?«
Der Handwerker zuckte mit den Schultern.
»Die Leute sind seltsam, Señora. Um Sie anzuschmieren, vermutlich. Oder damit Sie ihn noch einmal rufen müssen.«
»Nein, nein. José ist ein anständiger Mensch.«
Der Mann machte eine zweideutige Geste, mit der er kundtat, dass er zu der Spezies Mensch an sich wenig Vertrauen hatte, dann fuhr er mit seinen empirischen Darlegungen fort: »Versuchen Sie einmal, dieses Ding dort hineinzuschieben«, sagte er und griff sich ein Stück Rohr, das mit dem soeben überprüften identisch war.
Mónica stellte fest, dass die Schatulle etwa die gleiche Breite hatte wie das Rohr. Die Vorstellung, dass jemand die Schatulle dort absichtlich hineingeschoben haben sollte, erschien ihr völlig absurd. Ihr erster Impuls war, José anzurufen, doch als sie in den Taschen ihres Trenchcoats nach dem Zettel mit seiner Telefonnummer wühlte, stieß sie auf den Schlüssel, der vor ein paar Tagen in der Waschmaschine aufgetaucht war. Mit einem Mal bekam alles einen ganz anderen Sinn.
Mónica überfiel plötzlich das starke Bedürfnis, die Schatulle zu öffnen. Sie stieg mit dem soeben aufgetauchten Schatz, dem Schlüssel und ihrem Handy zum Speicher hinauf. Dort wollte sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um in aller Ruhe vorzugehen. Sie wog die Schatulle in der Hand, schüttelte sie ein wenig. Darin befand sich etwas Schweres, Kompaktes – aber nichts, das einen eindeutigen Hinweis gegeben hätte. Während sie den Schlüssel ins Schloss steckte, wunderte sie sich noch über ihre absurde Annahme, dass dies so leicht gehen könnte.
Doch der Schlüssel passte perfekt, und Mónica drehte ihn mühelos um, wobei ein metallisches Klacken zu hören war. Bevor sie den Deckel anhob, seufzte sie ergeben: »Um Himmels willen, da kann sonst etwas drinstecken.«
Als sie den Deckel schließlich anhob, ganz langsam und zunächst ohne einen Blick zu wagen, entdeckte sie in der Schatulle ein Stofftaschentuch, das über einen Schatz gebreitet war. Sie sah es ein paar Sekunden lang an, bevor sie den notwendigen Mut aufbrachte, es wegzuziehen. Ihr Puls war wie ein Trommelfeuer, dessen Rhythmus mit dem Ausmaß ihrer Angst, ihrer Unruhe und Neugier immer schneller wurde.
Sie legte das Taschentuch beiseite und warf einen Blick ins Innere der Schatulle. Sie war wie versteinert. Tausende Gedanken flogen ihr wie Gespenster durch den Kopf, ausgelöst durch die jüngste Vergangenheit, aber auch durch die nahe Zukunft. Sie griff zum Telefon, um Javier anzurufen, doch als sie anfing, seine Nummer zu wählen, hatte sie plötzlich das Gefühl, doch lieber noch ein bisschen abwarten zu wollen. Sie brauchte einen Moment für sich, um sich zu sammeln, um sich abzureagieren oder vielleicht auch, um ihre Gedanken zu sortieren.
Sie legte das Telefon beiseite und brach wie ein kleines Mädchen in Tränen aus.
8
Die Expertin für Edelsteine und antiken Schmuck empfing Mónica und Javier zur Mittagszeit in dem Juweliergeschäft, dessen Miteigentümerin sie war. Die Jalousien waren heruntergelassen, und innen herrschte eine Stille und Dunkelheit, die dem Treffen – einschließlich der Präsentation – einen gewissen Anflug von Heimlichtuerei verlieh.
Sie nahmen an der Tischvitrine Platz, während ihnen gegenüber die Eigentümerin einen Punktstrahler einschaltete, der ein schwarzes Samttuch darauf erhellte.
Mit der Bedachtsamkeit einer Seiltänzerin legte Mónica den Inhalt der Schatulle auf den dunklen Untergrund: drei Halsketten, sechs Paar Ohrringe, acht Anhänger, zwei Broschen und elf Armbänder, die einander an Pracht und Schönheit zu übertreffen versuchten. Für den Schluss hatte sie das Stück aufgehoben, das mit absoluter Sicherheit am beeindruckendsten war: den Ohrschmuck mit Diamanten und Rubinen im isabellinischen Stil – das Stück also, das den Fund komplettierte, den die Expertin bereits geschätzt hatte.
Die Juwelierin stieß einen Seufzer aus, so überwältigt war auch sie. Ihre Finger glitten von einem Schmuckstück zum nächsten mit der Anmut einer Biene, die von Blume zu Blume fliegt, ohne so recht zu wissen, auf welcher sie sich niederlassen soll.
»Die Sachen sind wunderschön, da gibt es keinen Zweifel. Einige sind ein bisschen angeschmutzt, aber sie sind ebenso gut erhalten wie das Ohrgehänge, das Sie mir bereits gezeigt haben.«
»Wir würden gern wissen, welchen Wert das alles hat«, sagte Mónica.
Die Frau blickte von dem Schatz auf, mit abwesender Miene. »Der Preis für Schmuckstücke wie diese hier hängt nicht nur von ihrem Zustand ab, sondern auch vom Interesse des potenziellen Käufers. Wie wäre es, wenn ich mich ein bisschen umhöre und Sie bis zum Wochenende anrufe? Wenn ich Ihnen jetzt einfach so eine bestimmte Summe nenne, wäre das bestimmt nicht sinnvoll. Aber ich kann Ihnen mit absoluter Sicherheit sagen, dass der Schmuck sehr wertvoll ist, das sieht man auf den ersten Blick. Wenn Sie vorhaben, ihn zu verkaufen, dann empfehle ich Ihnen, ihn nicht dem Nächstbesten zu überlassen.«
Sie seufzten beide, als hätten die Worte der Expertin sie gebremst.
Diese sprach weiter, während sie die Schmuckstücke wieder an ihren Platz legte: »Es ist gut möglich, dass ich Ihren idealen Käufer kenne. Einen alten Juwelier aus dem Baskenland, mit dem ich seit Jahren auch befreundet bin. Wenn er diese Kollektion sähe, würde ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er hatte schon immer eine Schwäche für Exquisites.«
Sie war schon fast fertig, als sie innehielt, um die Schatulle zu betrachten.
»Sie ist zwar ein bisschen ramponiert«, sagte sie, wobei sie auf einige Dellen und dunkle Flecken deutete, »aber sie ist großartig. Ganz im Stil des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts. Haben Sie sich schon mal die mythologischen Szenen genauer angesehen? Hier haben Sie die Geburt der Venus, die römische Göttin der Liebe und der Schönheit. Die Darstellung folgt ganz Botticelli: Sie wird von den Göttern des Windes begleitet, hier« – ihre knochigen Finger lenkten den Blick auf die Stellen, die sie gerade erläuterte –, »sie sind eng umschlungen. Diese Figur hier, die wartet, um sie mit einem Cape zu umhüllen, ist der Frühling. Man erkennt sie an ihrer geblümten Tunika und dem Rosengürtel.«
Javier und Mónica waren überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Frau ihnen eine Kostprobe ihres Wissens gab.
»Und auf der anderen Seite« – sie drehte die Schatulle um – »haben wir die Liebschaft von Königin Dido mit Aeneas, dem bedeutendsten römischen Helden, der aber auch der Sohn des Kriegers Anchises und der Göttin Venus war. Es bleibt sozusagen alles in der Familie.«
9
Am Samstagmorgen warteten Mónica und Javier immer noch auf den Anruf der Schmuckexpertin; ihre Nerven lagen schon blank, als endlich das Telefon läutete.
»Sie haben vielleicht ein Glück! Señor Uralde-Alloa ist mit seiner Tochter gerade in Barcelona; doch nur am Wochenende, während sie an einer Regatta teilnimmt. Er verlässt Bilbao sehr selten, und überdies führt er nicht gern mit potenziellen Geschäftspartnern Privatgespräche, aber ich habe ihm von Ihrem Schatz erzählt, und er ist sehr daran interessiert, Sie kennenzulernen. Er lädt Sie heute Mittag zum Essen ein, um halb drei. Ich würde Ihnen empfehlen, die Einladung anzunehmen und den Schmuck mitzubringen. Ich werde auch mit dabei sein.«
Javier war an der Reihe, den Tag mit seinen Kindern zu verbringen, aber Mónica folgte der Einladung mit Vergnügen. Das Treffen fand im Restaurant Arola statt, im obersten Stockwerk des Luxushotels Arts; von hier bot sich ein umwerfender Blick über den Port Olímpic von Barcelona.
Mónica kam ein paar Minuten vor dem vereinbarten Termin. Kaum hatte sie den Namen von Don Mikel Uralde-Alloa ausgesprochen, begleitete sie auch schon ein emsiger Ober zum reservierten Tisch, bat sie um Erlaubnis, ihr die Jacke abnehmen zu dürfen, und wartete ab, bis das Vorstellungsritual und die Begrüßung vorüber waren, um ihr den Stuhl zurechtzurücken. Die Schmuckexpertin – sie hatte sich aufwendiger zurechtgemacht als sonst – lächelte zufrieden, als sie die Szenerie beobachtete.
Don Mikel Uralde-Alloa war ein eleganter Mann über achtzig. Er trug einen grauen Maßanzug, der etwas aus der Mode war, dazu ein schwarzes Hemd mit glänzenden Manschettenknöpfen, die mit Einlegearbeiten aus Edelsteinen versehen waren. Er hatte schlohweißes Haar, selbst sein Spitzbart und sein schmaler Schnauzer waren weiß, seine extrem knochigen Hände wiesen Altersflecken auf, waren aber perfekt manikürt, und seine Augen waren von einem so hellen Blau, dass sie wie Wasser wirkten. Wenn er lächelte, was nicht so häufig vorkam, traten seine Wangenknochen hervor wie zwei kleine Hügel, und um seine Augen herum zeichneten sich unendlich viele kleine Fältchen ab. Er sprach mit Bedacht und in einem melodischen Tonfall, der seine Umgebung zu bezaubern pflegte. Mónica machte in dieser Hinsicht keine Ausnahme – von dem Augenblick an, als Uralde-Alloa sich verbeugte, um sie mit einem Handkuss zu begrüßen.
»Mein Mann lässt sich entschuldigen, er konnte nicht kommen. Er hätte Sie sehr gern kennengelernt«, sagte Mónica, um das Eis zu brechen. Der Juwelier nahm Javiers Abwesenheit mit einer gleichgültigen Geste hin.
»Möchten Sie den Schmuck sehen?«, fragte Mónica entschlossen, seine Erwartung nicht zu enttäuschen.
»Noch nicht, junge Frau … Ich würde diese Sache momentan gern vergessen und diese Gesellschaft genießen, um die mich viele beneiden werden. Was möchten Sie trinken?«
Der emsige Ober nahm die Bestellung der Getränke auf.
»Sie erwarten also ein Baby. Welch gute Nachricht«, bemerkte der Juwelier und deutete in Richtung Mónicas Bauch. »Kinder sind das schönste Geschenk, das uns das Leben geben kann.«
»Daraus schließe ich, dass Sie selbst Kinder haben, Señor Uralde-Alloa.«
»Aber bitte! Sprechen Sie mich nicht so hochtrabend an. Ich bin Mikel, das reicht. Und warum duzen wir uns nicht, was meinst du? Ein Vertrauensverhältnis mit schönen Frauen ist gut fürs Ego. Vor allem, wenn diese Frauen die eigenen Töchter sein könnten, wie meine liebe Freundin Ava.«
Die Schmuckexpertin nickte.
»Doch zurück zu deiner Frage, Mónica. Ja, ich habe eine Tochter. Sie ist etwas älter als ihr beide. Und ich bin eigentlich auch nur ihretwegen hier. Sie segelt mit Begeisterung, und es bereitet ihr Freude, wenn ihr Vater nervös wird, während er mit festem Boden unter den Füßen auf sie wartet.«
Sobald die Getränke kamen, brachte Uralde-Alloa einen Trinkspruch aus. »Auf die ewige Schönheit!«, sagte er.
Das Mittagessen in dem luxuriösen Ambiente verlief in entspannter Geselligkeit. Uralde-Alloa bestellte für seine Gäste eine Auswahl der Tapas-Spezialitäten des Hauses, die er selbst aber nicht probierte, denn er meinte, in der Kochkunst sei »zu viel Fantasie wie Essig, der schließlich alles ruiniert«.
Für die Wahl des Hauptgerichts wurde der Küchenchef höchstpersönlich am Tisch vorstellig – mit makellos weißer Schürze und Kochmütze. Uralde-Alloa erhob sich, um ihn mit einer Umarmung zu begrüßen.
»Aitor, du alter Schlawiner, wie schön, dich zu sehen!«
»Ja, ja«, scherzte der Koch, nachdem er die beiden Frauen begrüßt hatte, »du freust dich doch bloß, weil ich dir immer deine Launen durchgehen lasse. Was darf es denn heute sein?«
Sie lachten. Die Frauen ließen sich bei der Auswahl der Gerichte beraten, und ihr Treffen gestaltete sich so ungezwungen, wie die Zeit vergeht. Die Empfehlungen des Küchenchefs erwiesen sich als köstlich. Ebenso der Wein, ein 1978er Tokajer Oremus, den Uralde-Alloa in Gedenken an Mónicas Geburtsjahr eigens aus einer Bodega im Paseo del Borne kommen ließ und der wie ein Staatschef willkommen geheißen wurde. Der Wein hatte die Farbe von dunklem Gold, er war schwer und extrem süß.
»Meine Lieben«, begann der alte Herr, »lasst uns auf diese glücklichen Umstände anstoßen, die uns zusammengeführt haben. Mónica, ich weiß, dass du keinen Alkohol trinken sollst, aber in diesem Fall bitte ich dich, eine kleine Ausnahme zu machen. Trink einen Schluck von dieser Köstlichkeit. So etwas hast du noch nie probiert, das schwöre ich dir.«
Viel später erfuhr Mónica, dass dieser ursprünglich ungarische Wein, der in einer bergigen Region von Tokaj gekeltert wurde, eine Rarität war, die nur auf den Tischen von Königen, Regierungschefs und den bedeutendsten Geschäftsleuten der Welt zu finden ist. Eine einzige Flasche kostete mehr als die übrigen Speisen zusammen.
Während ihrer angeregten Unterhaltung bei dem vorzüglichen Essen wurden die Schmuckstücke kein einziges Mal erwähnt. Doch sobald der Ober die leeren Dessertteller abgetragen hatte – nur die Frauen hatten eine Nachspeise bestellt –, sprach der Gastgeber das Thema mit absoluter Professionalität direkt und unumwunden an.
»Also, wenn ich recht verstanden habe, meine Liebe, dann möchtest du meine Meinung über gewisse Preziosen wissen.«
»So ist es. Möchtest du sie sehen?«
Uralde-Alloa lehnte das Angebot erneut mit einer abweisenden Handbewegung ab.
»Hier nicht. Außerdem sind meine Augen keine solchen Präzisionswaffen mehr wie früher. Ich verlasse mich dabei lieber auf den Sachverstand meiner Freundin Ava; sie hat ihn bereits bei unzähligen Gelegenheiten unter Beweis gestellt.«
Er machte eine Pause, die er nutzte, um den letzten Schluck Wein zu trinken, ehe er weitersprach: »Die Sammlung interessiert mich, allerdings mit Ausnahme der Ohrgehänge mit Diamanten und Rubinen. Wenn du willens bist, mir alles andere zu verkaufen, werde ich dir dafür ein gutes Angebot unterbreiten.«
Mónica antwortete mit einem Schweigen, das der Juwelier als Zustimmung deutete: »Für alles andere kann ich dir – selbstverständlich – einen Freundschaftspreis bezahlen. Aber vergiss nicht, dass ich dabei im Hinblick auf meinen Lebensunterhalt und vor allem den meiner Tochter als Geschäftsmann agieren muss. Das heißt, ich muss dir ein Angebot machen, das mir bei einer Auktion einen gewissen Gewinn beschert. Ich sage: fünfzigtausend Euro. Feilschen ist mir verhasst, und somit ist dies mein einziges Angebot. Alles, mit Ausnahme der Ohrgehänge, wie gesagt. Besprich dich mit deinem Mann und gib mir innerhalb von vierundzwanzig Stunden Bescheid.«
Mónicas Herz machte einen Satz. Sie musste sich mit niemandem absprechen. Doch sie ließ sich nichts anmerken.
»Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich die Schatulle behielte?«, fiel ihr gerade noch ein.
Als Antwort fing Uralde-Alloa an zu lachen, zum ersten Mal während der ganzen Einladung.
10
Igitt, was stinkt denn hier so?«, war das Erste, was Rufino fragte, als er die Tasche voller Werkzeug von der Schulter hievte.
Er war in Begleitung von zwei Handwerkern, die wie Packesel beladen waren. Bei einem wiederholte sich der angeekelte Gesichtsausdruck, den schon sein Chef hatte sehen lassen. Der andere merkte erstaunt an: »Also, ich rieche nichts.«
Rufino meisterte geistesgegenwärtig die Situation: »Jungs, ihr habt wohl eine verstopfte Nase. Macht schon, bringt das restliche Material herein! Wir müssen jetzt sofort loslegen!«
Doch bevor es losging, erklärte der Meister Mónica, worin ihre »Verrichtung« – so seine Worte – hinsichtlich des Mosaiks bestehen würde. Er entfaltete vor ihr ein Blatt Papier, das schon in die Jahre gekommen schien; darauf waren die geometrischen Muster ihres Bodens samt einigen technischen Hinweisen zu sehen.
»Das ist die Originalzeichnung des Herstellers«, erklärte der Restaurator, bevor er sich vorsichtig ans Werk machte.
Mónica brachte inzwischen den Speicher weiter in Ordnung, bis zum ersten Mal nach ihr gerufen wurde. Es war Rufino, der ihr einen dunklen Fleck zeigen wollte; er war aufgetaucht, als sie die erste Reihe der defekten Fliesen entfernen wollten. Der Fleck hatte eine braungraue Farbe und erstreckte sich unter den Bereich des Mosaiks, der nicht restauriert werden musste.
»Was sollen wir jetzt tun?«, wollte er wissen.
Mónica sah ihn mit einem fragenden Blick an – sie suchte Rat.
»Wir können versuchen, den Fleck zu entfernen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten: von der Chemiekeule bis hin zu einer Komplettsanierung. Das würde allerdings bedeuten, dass wir das gesamte Mosaik abtragen und die schadhaften Schichten entfernen müssten. Die zweite Alternative bedeutet natürlich erheblich mehr Arbeitsaufwand und würde den gesamten Ablauf verzögern.«
Sie entschieden sich für den Einsatz von Chemikalien, doch am nächsten Tag waren die Flecken wieder da: noch größer, dunkler und zudem anders geformt als am Morgen zuvor.
»So etwas habe ich noch nie erlebt«, jammerte Rufino. »Ich verstehe das nicht. Sie haben doch mit eigenen Augen gesehen, wie wir gestern die Flecken entfernt haben.«
Die ganze Prozedur wurde wiederholt, und diesmal, wie es schien, mit Erfolg. Die Arbeiten wurden von der ständigen Kritik des Meisters an seinen Leuten begleitet.
»Was habt ihr heute eigentlich gefrühstückt? Seht ihr denn nicht, dass das schief ist?«, sagte er zu den Burschen, wobei er auf die Fugen der bereits verlegten Fliesen deutete. Die Handwerker nahmen Korrekturen vor, aber nichts vermochte ihren Meister zufriedenzustellen.
»Weiter nach oben. Ein Stück nach links. Ja, aber merkst du das denn nicht? Jetzt ist sie verdreht. Ein bisschen nach rechts. Weiter hoch, Mann! Nein, nein, so nun wirklich nicht! Was zum Teufel ist denn los mit dir? Hast du zwei linke Hände? Mach Platz, Mann, jetzt mach ich das selbst!«
Als er beiseite trat, murmelte der Mosaikrestaurator einen Kommentar, den Mónica hören konnte: »Keine Chance, dass diese Dinger in der Linie bleiben, das muss am Untergrund liegen.«
Er hatte recht. Auch Rufino selbst sah sich mit dieser seltsamen Schwierigkeit konfrontiert. Es war, als ob eine unsichtbare Hand anfangen würde, die soeben verlegten Fliesen wieder aus dem Lot zu bringen. Eine subtile, aber starke Kraft wie ein Magnet war am Werk, um ihre Arbeit zu vereiteln.
»Also was ist denn hier los, verdammt noch mal?« Der Meister war wütend. »Das werden wir doch sehen! Du, hilf mir!«