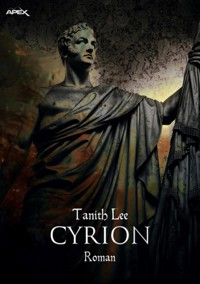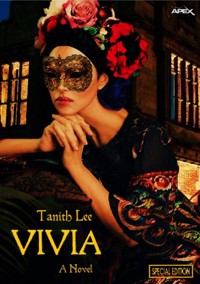7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als Kind wurde Mechail von einer schwarzen Motte hochgehoben und fallengelassen. Seitdem ist er ein Krüppel und scheint für immer den dunklen Mächten zu gehören. Vom Halbbruder in einen Hinterhalt gelockt, stirbt er, um in Gestalt eines Wolfs von den Toten aufzuerstehen und furchtbare Rache zu üben...
»Tanith Lee versteht sich auf Menschen wie auf Magie, und das ist selten. Ihre Ideen bersten vor Erotik, Humor – und Komik.«
- THE GOOD READING GUIDE TO SF AND FANTASY
Der dunkle Engel ist der erste Teil des zweiteiligen Roman-Werks Das Blut der Rosen und erscheint als 13. Band der Tanith-Lee-Werkausgabe im Apex-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
TANITH LEE
Der dunkle Engel
Das Blut der Rosen - I
Tanith Lee-Werkausgabe, Band 13
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Das Buch
DER DUNKLE ENGEL
Erstes Buch: MECHAIL
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Zweites Buch: ANILLIA
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Die Autorin
Tanith Lee.
(* 19. September 1947, + 24. Mai 2015).
Tanith Lee war eine britische Horror-, Science Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin und Verfasserin von Drehbüchern. Sie wurde viermal mit dem World Fantasy-Award ausgezeichnet (2013 für ihr Lebenswerk) und darüber hinaus mehrfach für den Nebula- und British Fantasy-Award nominiert.
Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie über 90 Romane und etwa 300 Kurzgeschichten. Sie debütierte 1971 mit dem Kinderbuch The Dragonhoard; 1975 folgte mit The Birthgrave (dt. Im Herzen des Vulkans) ihr erster Roman für Erwachsene, der zugleich auch ihren literarischen Durchbruch markierte.
Tanith Lees Oevre ist gekennzeichnet von unangepassten Interpretationen von Märchen, Vampir-Geschichten und Mythen sowie den Themen Feminismus, Psychosen, Isolation und Sexualität; als wichtigsten literarischen Einfluss nannte sie Virginia Woolf und C.S. Lewis.
Zu ihren herausragendsten Werken zählen die Romane Trinkt den Saphirwein (1978), Sabella oder: Der letzte Vampir (1980), Die Kinder der Wölfe (1981), Die Herrin des Deliriums (1986), Romeo und Julia in der Anderswelt (1986), die Scarabae-Trilogie (1992 bis 1994), Eva Fairdeath (1994), Vivia (1995), Faces Under Water (1998) und White As Snow (2000).
1988 gelang ihr mit Eine Madonna aus der Maschine (OT: A Madonna Of The Machine) ein herausragender Beitrag zum literarischen Cyberpunk; eine Neu-Übersetzung der Erzählung wird in der von Christian Dörge zusammengestellten Anthologie Cortexx Avenue enthalten sein.
Ihre wichtigsten Sammlungen von Kurzgeschichten und Erzählungen sind: Red As Blood/Tales From The Sisters Grimme (1983), The Gorgon And Other Beastly Tales (1985) und Nightshades: Thirteen Journeys Into Shadow.
Tanith Lee war seit 1992 mit dem Künstler John Kaiine verheiratet und lebte und arbeitete in Brighton/England.
Sie verstarb im Jahre 2015 im Alter von 67 Jahren.
Der Apex-Verlag widmet Tanith Lee eine umfangreiche Werkausgabe.
Das Buch
Als Kind wurde Mechail von einer schwarzen Motte hochgehoben und fallengelassen. Seitdem ist er ein Krüppel und scheint für immer den dunklen Mächten zu gehören. Vom Halbbruder in einen Hinterhalt gelockt, stirbt er, um in Gestalt eines Wolfs von den Toten aufzuerstehen und furchtbare Rache zu üben...
»Tanith Lee versteht sich auf Menschen wie auf Magie, und das ist selten. Ihre Ideen bersten vor Erotik, Humor – und Komik.«
- THE GOOD READING GUIDE TO SF AND FANTASY
Der dunkle Engel ist der erste Teil des zweiteiligen Roman-Werks Das Blut der Rosen und erscheint als 13. Band der Tanith-Lee-Werkausgabe im Apex-Verlag.
DER DUNKLE ENGEL
Für John Kaiine,
dessen moralische und praktische Unterstützung
die Grundlagen dieses Buches
sichern half und dessen zahlreiche
großzügig gewährten Bilder in seinen
bunten Fenstern aufscheinen.
Erstes Buch: MECHAIL
Pater omnipotens,
Mittere digneris sanctum
Angelum tuum de paradis
Erstes Kapitel
Am Anfang war stille Winternacht, und der große Mond brannte auf dem Schnee. Der gefrorene Boden war so hart wie eine Glaskugel. Zeitlos. Erstarrt lag die Erde da, nicht ein Zweig regte sich im Wald.
Dann ertönte ein Geräusch. Ein dumpfes, fernes Trommeln. Ein wenig Schnee erbebte und geriet ins Rutschen. Das Trommeln wurde drängender, schwoll an und wurde zu einem Donnern. Ein Strom von Reitern ergoss sich aus dem Wald, am weißen Rand der Welt entlang, abgehoben von der Schwärze des Himmels, die Pferde in gestrecktem Galopp, die roten Fackeln ein Riss durch die Nacht.
Die Jagd war eröffnet. Eine wilde Jagd.
Die Gesichter der Männer waren verzerrt und bleich. Einige schrien im Reiten, dann verstummten sie wieder. Die Pferde schnaubten. Die Soldaten gaben ihnen die Sporen, Flammen wogten, hier und da blitzte ein blankes Schwert auf, das inmitten der Fackeln hochgereckt wurde, den Mond zu spalten.
Doch wo war das Wild?
Der vorderste Reiter, ein Hauptmann von neunundzwanzig Jahren, war Carg Vrost. Er schien nicht ganz bei sich zu sein, aber schließlich war es noch keine volle Stunde her, dass er im Gasthof ausgiebig gezecht hatte, und oben im Zimmer wartete ein Mädchen auf ihn... Jetzt hatte er es gewiss vergessen. Er sah aus wie die anderen, rasend, blutdürstig und verängstigt. Und plötzlich stieß er wie die anderen einen Schrei aus und zeigte irgendwohin, mit erschreckten Augen, als erblickte er ein Wesen aus einem Alptraum. Aber was?
Die Fackeln flackerten, und die Schatten der Soldaten und Pferde malten Muster in den Schnee, und als sie wieder auf den Wald zustürmten, stand der Mond vor ihnen im Westen. Und dort... dort... einen Moment lang als Silhouette gegen die Scheibe des Mondes abgehoben...
Der Fackelschein fiel darauf, fügte der Schwärze der im Flug begriffenen Flügel einen Flammensaum hinzu und gab dem langgestreckten Körper das Aussehen einer Spindel. Darüber war deutlich der Kopf mit den Fühlern zu erkennen. Und obwohl das Wesen für seine Art riesig war, erschien es in der Dunkelheit, im Mondschein, doch unglaublich zart im Vergleich zu seinen zahlreichen Verfolgern. Die Fühler am Kopf endeten jedoch in einem glitzernden Funkeln, röter als Feuer. Die Soldaten jagten nichts anderes als eine Motte.
Der Wald wich auseinander. Die Reiter drängten hinein, finsteren, tückischen Pfaden folgend, als wollten sie mit dem untergehenden Mond Zusammenstößen. Sie wurden von Dunkelheit verschluckt. Sie waren verschwunden.
Die alte Sklavin hatte geschlafen. Dies war ihr Verbrechen, für das sie noch vor dem Morgengrauen sterben würde. Das Kind hatte ebenfalls geschlafen, aber das sollte es auch bei Nacht. Es lag in einem kleinen Holzbettchen mit grünen, purpurfarbenen und rostbraunen Vorhängen, in dessen Pfosten in Miniatur der Rabe der Korhlen eingeschnitzt war. Der Sohn des Burgherrn Vre Korhlen, drei Jahre alt, das jüngste mit einer kränkelnden Frau gezeugte Kind und darum vielleicht sein letztes Kind überhaupt, wenn die Kirchenväter dem Burgherrn keine weitere Heirat gestatteten.
Der Junge war brav, er machte keinen Ärger. Er lag da und schlummerte. Und das Feuer im Kamin brannte vor sich hin, der Winter mit seinem nächtlichen Schnee und den Wölfen blieb vor dem Fenster ausgesperrt. Das Fenster war geschlossen, doch der Laden hatte sich ein wenig verzogen. Durch eine Lücke drang die Kälte herein, darum hatte die Frau den Spalt wie gewöhnlich mit einem Wolllappen verstopft.
Als sie erwachte, fiel ihr als erstes auf, dass der Lappen unter dem Fenster lag, am Fußende des Betts. Vielleicht hatte sie der kalte Luftzug geweckt. Sie erhob sich schläfrig, nahm den Schürhaken und stocherte im Kamin. Dann wollte sie den Lappen aufheben und ihn wieder in den Spalt stecken.
Als sie am Bett anlangte, schaute die alte Frau durch die Vorhänge zu Vre Korhlens Kind hinein.
Sie erblickte etwas so Schreckliches, dass es über ihren Verstand ging. Ihr erster Gedanke war, der Junge sei enthauptet worden. Sein Kopf lag verdreht auf dem Kissen, und über den Hals zog sich eine hervorstechende Linie aus hellrotem Blut. Noch starr vor Entsetzen bemerkte sie, dass eine Winterblume mit zwei schwarzen Blütenblättern in das Blut hineingefallen war. Die plötzlich erzitterte.
Die blanke Furcht löste ihre Schreie. Sie strömten aus ihr hervor wie ein Schwall Erbrochenes.
Schreiend wich sie zurück, mit ihren mageren, verwelkten Händen wieder und wieder das Zeichen des Kreuzes und noch ein anderes Zeichen der Abwehr schlagend. Doch keins von beiden zeigte Wirkung, nicht einmal das Schreien. Als sie die Schreie aus sich herausgepresst und die Tür beinahe erreicht hatte, kamen Fußgetrappel und das Klirren und Scharren von Metall die Treppe hoch. Männliche Stärke und die Kraft des Schwertes. Und dennoch.
Und dennoch, was vermochten sie gegen dieses Wesen auszurichten?
Die schwarze Blume der Motte am Hals des bewusstlosen Kindes erbebte erneut.
Die Frau glaubte, sie werde auffliegen, sich womöglich auf sie stürzen, und ein letztes Wimmern entwich ihrer Kehle.
Es geschah jedoch etwas viel Unglaublicheres. Die Motte erhob sich tatsächlich vom Bett, schaffte es aber irgendwie, im Aufsteigen den Körper des Kindes mit anzuheben.
Das Bild überstieg die Grenzen des Möglichen und Begreifbaren. Wäre die Frau am Leben geblieben, hätte es sich ihr fürs Leben ins Gedächtnis eingebrannt.
Die Motte hielt das Kind fest. Wie eine schwere Puppe hing es an ihrem zarten, atmenden, blütenblattbesetzten Leib. Gleich nachdem sie es gepackt hatte, stieg sie hoch, weg vom Bett, bis an die Dachsparren. Und von dort ließ sie es in dem Augenblick fallen, als die Tür aufgerissen wurde.
Der Junge plumpste auf den gefliesten Boden. Er schlug hart auf, durch die Wucht des Aufpralls brachen mehrere Knochen. Dies weckte ihn jedoch nicht auf. Er blieb reglos vor den beiden Soldaten des Burgherrn und der alten Frau mit dem Wolllappen in der Hand liegen.
Die Motte flüchtete durch den Spalt, in dem der Lappen gesteckt hatte. Und die Soldaten sahen wie versteinert zu und fluchten, und die Frau plapperte sinnlos vor sich hin.
Überrascht waren sie nicht. Entsetzt, angewidert und wütend, das ja, aber nicht ungläubig. So etwas kam vor. Diese Dinge kehrten wieder wie die Jahreszeiten oder die Nacht.
Einer der Soldaten fiel wie außer sich betend auf die Knie. Der andere rannte Befehle brüllend hinaus.
Die alte Frau beugte sich über das Kind, das sie geliebt hatte, wagte jedoch nicht, es zu berühren. Sie empfand eine neue und ganz persönliche Angst, denn in ihrem Inneren wusste sie bereits, was ihr bevorstand.
Vor ihnen war der Mond in den Tälern aus Dunkelheit versunken. Überall war Wald, die Säulen der Bäume zogen vorbei, die Kiefern inmitten der Schneewehen, Felsen, Hohlwege, die Flussbetten, die sich in Höllengruben verwandelt hatten. Drei Männer waren gestürzt, einer mit einem Schrei, ein Pferd war ausgerutscht und in den Brunnen der Nacht hinabgerollt und verschwunden.
Zweige peitschten ihnen ins Gesicht. Jemand hatte ein Auge verloren, stürmte jedoch weiter mit den anderen voran, die eine Gesichtshälfte eine tintenschwarze Maske.
Carg Vrost hatte den Kopf auf den Widerrist seines Pferdes gesenkt.
Er schmeckte Galle; ohne in der wilden Jagd innezuhalten, hatte er sich vor einer halben Stunde aus dem Sattel gebeugt und das genossene Bier ausgewürgt.
Darum wusste er auch nicht, war er immer noch betrunken oder bloß außer sich. Er jagte den Teufel, und der Gegner lockte ihn weiter.
Hinter ihm ein Aufprall, Schreie, und wieder ertönte schrilles Gewieher, und ein Pferd ging zu Boden.
Bei Gott, die Männer, die sie verloren, die verletzt, lahm und ohne Pferd liegenblieben, würden ein gefundenes Fressen für umherstreifende Wölfe sein.
Carg Vrost duckte sich fluchend unter einen Ast, der wie eine Schlange nach ihm schnappte, ihm über den Schädel strich.
Vor ihm ein flirrendes Bild, schwarze Asche und zwei mit glühenden Augen besetzte Fühler. Er sah es ständig vor sich. Es war da. Aber diese Jagd war eine Tollheit.
Vrost blickte sich über die Schulter um. Zu seiner Verwunderung bemerkte er hinter sich nur zwei Männer. Sie schienen sich im Wald verheddert zu haben, als hätte etwas sie eingefangen und zöge sie von ihm weg, und er gestikulierte heftig und versuchte, sie mit Beschimpfungen anzuspornen. Und als er sich wieder umdrehte, sah er zwischen den Ohren seines Pferdes hindurch, dass der Wald zehn Schritte vor ihm am Rande eines Abgrunds endete.
»Jesus Christus!«
Carg Vrost zog die Zügel des dahinstürmenden Pferdes an, das sich daraufhin aufbäumte, strampelnd und rutschend, das Ebenbild einer wahnsinnigen Schachfigur. Und diese barbarische Erscheinung, Pferd und Reiter, tänzelte auf den Rand des Abgrunds zu und rutschte darüber hinweg, dem Mond entgegen.
Als er ins Zimmer trat, stand sie am Fenster, Vre Korhlens Frau, die Herrin Nilya. Sie stand dort, seit man es ihr vor zwei Standen gesagt hatte. Wenn sich an ihr etwas bewegt hatte, eine Hand oder die Augen, so fiel es ihm nicht auf. Sie sah noch genauso aus wie bei seinem Weggang, ein Geschöpf der Schneenacht in ihrem weißen Umhang, das schwarze Haar von dreißig Jahren Frost grau gesträhnt. Das erste Grau hatte er am Hochzeitstag bemerkt, obwohl ihre Dienstmagd es unter dem mit Bändern geschmückten Schleier verborgen hatte. Bis dahin musste sie irgendein Färbemittel benutzt haben.
»Setz dich hin«, sagte er brutal und laut, »oder geh zu Bett. Was nützt es, wenn du steif wie in der Kirche dastehst? Hast du ihn dir überhaupt angesehen? Antworte mir, Nilya.«
»Nein«, sagte sie. »Ich kann ihm nicht helfen.«
Vre Korhlen starrte auf ihr verhülltes Rückgrat, dann wandte er sich der Karaffe auf dem Tisch zu. Diese Frau war der Fluch seines Lebens. Seit der Heirat hatte er nur noch Pech. Obwohl auch seine erste Ehe kaum von Glück überstrahlt gewesen war. Sie war eine Schwachsinnige gewesen, unfähig außerdem, in ihrem Ofen etwas anderes als Töchter auszubrüten. Ihr Hirn hatte sich schon bald in Matsch verwandelt, und sie war an einem Erstickungsanfall gestorben. Seine zweite Frau Nilya hatte er sich über Heiratsvermittler in der Stadt Khish besorgt. Sie stammte aus einem Haus, das sowohl mit der Stadtregierung als auch mit der Kirche verbunden war. Sie gehörte nicht dem wilden Waldadel an, sondern war etwas Besseres, jedenfalls wollte man ihm dies weismachen. Als er sie zum ersten Mal sah, begehrte er sie. Er war in die Stadt geritten, um sie sich anzusehen. Man hatte ihr eine gute Erziehung angedeihen lassen, sie konnte lesen und schreiben. Auch davon versprach er sich Vorteile. Ein Feuer baute sich in seinen Lenden auf, und das sprach dafür, dass er mit ihr Söhne zeugen würde. Doch im Bett enttäuschte sie ihn. Sie war kaum anwesend. Als sie Jahre später von ihm schwanger wurde, bekam es ihr nicht, und sie verwandelte sich in ein Skelett mit einem großen Sack anstelle ihres ehedem flachen kleinen Bauchs. Das Kind auszutragen hatte sie fast das Leben gekostet. Hatte sie tatsächlich das Leben gekostet, denn seitdem starb sie jeden Tag ein bisschen mehr. Ihre Hände glichen denen seiner Mutter kurz vor ihrem Tod, sie waren durchscheinend und fleischlos, und an manchen Morgen ähnelte ihr Gesicht einem fahlen Kristall; hätte man es aus der Nähe betrachtet, würde man die Knochen gesehen haben.
Er beabsichtigte nicht, sie von den Worten des Wundarztes in Kenntnis zu setzen, die ihn abgestoßen und über die Maßen aufgebracht hatten. Kern seiner Aussage war, der Junge werde keine dauerhaften Schäden davontragen, wenn man ihn nur sorgfältig pflegte. Lügen, ebenso offenkundig wie die kriecherische Feigheit des Lügners.
Was das verfluchte alte Sklavenweib anging, das würde man auf dem Hof erschlagen.
Dem übernatürlichen Aspekt Glauben zu schenken hatte er sich zunächst geweigert und stattdessen tobend und um sich schlagend weitere Soldaten aus den Quartieren holen lassen, die er brüllend losgeschickt hatte, um irgendein Tier oder einen rasenden Unzufriedenen zur Strecke zu bringen. Er weigerte sich zu glauben, dass ein dämonisches Insekt im Blut seines Sohnes gebadet und davon getrunken habe...
Mit solchen Legenden war er, Vre Korhlen, aufgewachsen. Er hatte sämtliche Märchen gehört und sie auch geglaubt. Doch hier, in seinem persönlichen Umfeld, hatten sie nichts verloren.
Die Steine des Hauses und dessen winterlicher Geruch nach Rauch und vermummten Körpern, alten Speisen, Kälte, Feuchte und Geheimnissen lasteten schwer auf dem Fürsten.
Er trank vom Wein und sah mitleidlos seine sterbende Frau wie eine Marmorstatue vor der Mauer der Nacht am Fenster stehen.
Carg Vrost erblickte, wie ihm schien mit geschlossenen Augen, einen Himmel mit nichts darin. Dieser Himmel war sehr hoch und sehr fern, und es musste ein Leichtes sein, zu ihm hinaufzuschweben und darin zu treiben. Doch er verspürte einen Schmerz; er lag in einem Sarg aus Fleisch und Muskeln, die schmerzten und stachen und ihn an die Erde banden.
Allmählich setzte er sich wieder zusammen, so als formte er sich neu aus Schmerz, sich und den aufgehäuften Schnee (der plötzlich kalt war, wenn er sich bewegte, wie zubeißende Fänge) und den zerschmetterten Körper des Pferdes, der seinen Absturz ins Tal abgebremst hatte.
Die vom Pferd ausgehende Wärme hatte verhindert, dass er erfroren war. Dafür musste er dem armen Tier dankbar sein. Es hatte ihm gute Dienste geleistet, und das war nun sein Dank.
Vrost stellte fest, dass er würde stehen können. Er stand auf. Er hatte Gewalt über Rumpf und Glieder, nur nicht über die vier Finger seiner linken Hand, die leider gebrochen waren, wenngleich ihn der Schnee gnädigerweise fühllos gemacht hatte. Nachdem er sich schwankend aufgerichtet hatte, starrte Vrost seine Hand einen Moment lang an. Er wusste bereits, dass er sie verlieren würde, falls er es jemals bis zur Burg schaffte. Er erinnerte sich nur undeutlich an den Sturz. Wie war es dazu gekommen?
Dann fiel es ihm wieder ein. Er legte seine gesunde Hand auf das Schwert und zog es aus der Scheide. Vrost trat über das tote Pferd hinweg und blickte sich um. Nichts deutete darauf hin, dass außer ihm noch jemand überlebt oder mit ihm hier herunter gekommen war. Wie eine Wand ragte der Wald über ihm an der Felskante und in unterschiedlichen Höhen ringsumher auf, und dort, wo die verschneiten Bäume spärlicher verteilt waren, lag das Tal. Der Himmel war nicht mehr schwarz, sondern weitete sich mit dem langanhaltenden bleiernen Zwielicht vor Tagesanbruch.
Wenn die Sonne aufging, mussten die Dämonen weichen.
Carg Vrost, der einhändig mit gezogenem Schwert dastand, kam der Gedanke, der Wahnsinn dieser Nacht könnte absichtlich herbeigeführt worden sein. Denn die Motte, als die der Dämon erschienen war, hätte sicherlich auf hundert verschiedenen Wegen entkommen können. Stattdessen hatte er sie wie ein Irrlicht in Tod und Verderben geführt. Und jetzt war er verschwunden.
Ihm blieb nichts anderes übrig als weiterzugehen. Er konnte nicht über die steile Felswand zum Wald hochklettern. Der dornenreiche, beschwerliche Pfad (wie es in der Heiligen Schrift hieß) war erheblich bequemer. Vrost hätte beinahe gelächelt. Dann fiel ihm seine Hand ein, und ein Stich durchzuckte ihn, kein Schmerz, sondern Hoffnungslosigkeit und hilflose Wut. Und dann verdrängte er auch dies und stapfte bloß noch inmitten der Bäume weiter.
Als sich der Wald vor ihm teilte und ganz unvermittelt den Blick auf das ganze Tal freigab, war es keine Überraschung für ihn, das niedrige, düstere Gebäude zu erblicken, das wie ein steinerner Sarg verlassen am Hang lag, gewissermaßen zu seinen Füßen. Insgeheim hatte er sogar damit gerechnet. Vielleicht war es ihm sogar eines Morgens aufgefallen, als er vorigen Sommer in diesem Teil des Waldes gejagt hatte, und er hatte es so wie jetzt auch als eine der einsamen Kapellen identifiziert, die in der Gegend wie Kieselsteine verstreut waren. Häufig waren sie verfallen, wenngleich sich das von oben nur schwer erkennen ließ. Im Sommer mussten die Mauern in Grün gebettet gewesen sein, bemoost und vielleicht bunt von Blumen. Doch nun war der Schnee darauf gefallen, hatte sie überdeckt und die Umrisse hervorgehoben, weiß über dunkelbraun. Die überwölbte Eingangstür schien verschlossen, doch wahrscheinlicher war, dass nur der Schatten sie verschlossen hatte und dass die Bohlen schon vor Jahren von Banditen oder Bauern, die nichts selbst herstellten, wenn sie es stehlen konnten, in den Wald fortgeschleppt worden waren.
Der Himmel zeigte ein eintöniges Grau. Der Morgenstern war aufgegangen und glitzerte wie ein Eiszapfen über dem Kapellendach. Dort würde die Sonne aufgehen.
Und das, was er gesucht, wonach er gejagt hatte, war ebenfalls dort. Dies wusste er so sicher, als wäre es ihm eingeflüstert worden, als er bewusstlos am Boden gelegen hatte.
Nun war es an ihm, seine Aufgabe zu vollenden.
Carg Vrost schlug bedächtig das Zeichen des Herrn. Als er dies tat, durchzuckte die taube, verletzte Hand ein brennender Schmerz. Der Hauptmann des Burgherrn kniete nieder und steckte die Hand eine Weile in eine Schneewehe, damit die Winterkälte sie wieder betäubte. Nur für einen Augenblick. Er musste die Kapelle vor Sonnenaufgang erreichen. Wenn er sich sputete, würde die Zeit reichen.
»Keine Schmerzen. Er soll nicht leiden. Schmerz ist nutzlos und schrecklich.«
Der nervöse Wundarzt, ein Bauchaufschneider, der sich um Korhlens dreißig Mann starke Truppe zu kümmern hatte, warf Korhlens Frau, die lautlos und unerwartet wie ein Gespenst in der Kammer aufgetaucht war, einen flüchtigen Blick zu. So selten er sie zu Gesicht bekam, wusste er doch schon seit langem, dass sie ebenfalls einen Arzt brauchte. An diesem gottverlassenen Ort, umgeben von Bäumen, Wölfen und endlosen Nächten, hatte man sich jedoch nicht die Mühe gemacht, einen zu holen. Er selbst war es gewohnt, zu flicken und zu nähen, zu schneiden und notfalls auch zu amputieren. Er hatte den gebrochenen Arm des Jungen gerichtet, die Schulter wieder eingerenkt und die Rippen verbunden. Mit dem Rückgrat stimmte etwas nicht. Das zu erkennen, reichte sein Verstand aus, jedoch nicht seine Kenntnisse - oder, Herrgott noch mal, die Mittel, die ihm zu Verfügung standen -, um den Schaden zu beheben. In dem Moment, als man ihn zu dem Jungen brachte, hatte der Wundarzt damit begonnen, seinen Fortgang aus der Burg zu planen. Es gefiel ihm sowieso nicht hier, und den Fürsten fürchtete er wie die Pest.
Er hatte gehört, dass man die alte Sklavin ausgepeitscht hatte. Sie war erledigt. Sklaven, unfruchtbare Ehefrauen und unfähige Ärzte waren entbehrlich.
»Herrin?«, fragte er höflich; in einer kleinen Stadt im Süden hatte er sich wenn schon keine Fachkenntnisse, so doch Höflichkeit angeeignet.
»Ich meine«, sagte sie, »um die Schmerzen meines Sohnes zu lindern - braucht Ihr Arzneien.«
»Ich habe mein Möglichstes getan, Herrin. Die Verletzungen waren ernst.« Er glaubte den verrückten Ammenmärchen nicht, die man sich in der Burg erzählte. War es nicht wahrscheinlicher, dass der brutale Vater das Kind in einem Wutanfall zusammengeschlagen hatte? »Er braucht viel Pflege, aber er ist ein gesunder Junge.«
»Keineswegs«, sagte sie, seinem seichten Trost widersprechend. »Als Säugling war er oft krank. Meine Schuld. Und jetzt dies...« Ihr Gesicht war gewiss niemals schön gewesen, doch nun lugte aus den tiefliegenden Augen und den geöffneten Lippen ihre Totenmaske hervor. »Bitte. Tut, was in Eurer Macht steht. Lasst meinen Sohn nicht leiden.«
Meint sie etwa, ich soll ihn erlösen, bevor er zu sich kommt? Von dem Gedanken überrascht und erschreckt, beschleunigte sich sein Atem. Er nahm sich zusammen und sagte: »Ihm wird die bestmögliche Pflege zuteil, Herrin. Im Moment schläft er. Möchtet Ihr...?«
Sie starrte ihn bloß an und schüttelte den Kopf.
Nahezu tonlos sagte sie: »Ich habe ihm schon genug Schmerzen zugefügt. Ich werde nicht zu ihm gehen.«
Dann wandte sie sich um und schwebte wieder aus der Kammer, die Schleppe ihres Kleides über den Fußboden nachziehend.
Sie war verrückt, wie der ganze Rest. (Es wäre klug gewesen, wegzugehen.) Es hatte sich so angehört, als hätte sie sagen wollen, sie sei für den Zustand des Jungen verantwortlich. Mütterliche Schuldgefühle, weil sie ihn vernachlässigt hatte? (Wenn das Eis schmolz und die Winterszeit zu Ende ging - bis dahin konnte er sich herausreden.)
Im angrenzenden Raum stöhnte das Kind plötzlich laut in seiner Qual. Der Wundarzt war froh, dass sie es nicht gehört hatte. Schmerzen! Wenn der Junge erwachte, würde man ihn vielleicht festschnallen müssen. Genaugenommen wäre es angebracht, das jetzt schon zu tun. Vom Schwarzen Mohn hatten sie nicht genug. Es könnte sogar ein rascher Schlag nötig werden. Das wäre mitfühlender, als ihn schreien zu lassen. Dem dreijährigen Leib des Jungen war bereits so großer Schaden zugefügt worden, dass man deswegen keine
Bedenken zu haben brauchte. Wäre Vre Korhlens Sohn ein Tier gewesen, hätte man ihm die Kehle durchgeschnitten.
Die Tür war eine Schattentür.
Der Soldat näherte sich ihr durch den Schnee, in einem Licht, das ebenfalls aus Schatten bestand. Das Tal umgab ihn wie ein Kelchglas; aber vielleicht bildete er sich das auch bloß ein.
Das Schwert in seiner Hand wog schwer, und ihm schien, als bewege sich sein Körper mit schleppender Schwerfälligkeit, während er selbst ungehindert, gewichtslos und hellwach irgendwo in seinem Kopf hinter den Augen saß.
Als er die Schattentür erreicht hatte, bekreuzigte er sich unwillkürlich und vom Schwert behindert ein weiteres Mal, dann trat er über die Schwelle.
Trotz der entwendeten Tür war das Innere der Kapelle nicht verfallen. Es war nur fürchterlich kalt und stockfinster darin. Vier massige Säulen stützten das Dach, und vor ihm umrahmte ein hoher Wandschirm aus durchbrochenem Obsidian das einzige Fenster, das hinter dem Altar aufragte, und verstellte die Sicht darauf. Der Altar selbst wurde vom Lettner verdeckt, auf dem mehrere Heiligengesichter schimmerten, deren alte Vergoldung im Gegensatz zu den Augen aus Perlmutt, nun leere Höhlen, unversehrt geblieben war. Die Räuber hätten die Zwischenwand wohl mitgenommen, überlegte er, wenn sie nicht so schwer gewesen wäre. Die Religion des Waldes war älter, und die handlichen Augen herauszunehmen verstieß nicht gegen ihre Regeln. Ob der Altar wohl entweiht worden war?
»Wer ist da?«
Der geflüsterte Aufschrei stieg wie dünner Rauch von seinem Urheber hinter dem Schirm auf. Carg Vrost stand wie vom Donner gerührt und wiederholte die Worte im Geiste immer wieder von neuem, wobei er sich fragte, ob er sie wirklich gehört hatte. Eine ängstliche Mädchenstimme oder sprechender Nebel.
Er wartete wie versteinert.
»Wer immer Ihr seid«, flüsterte die Nebelstimme, »helft mir.«
Dann trat sie hinter dem Wandschirm hervor.
Im Wald gab es Schwesternschaften, davon hatte er gehört. Das Mädchen trug das gebleichte Gewand einer Nonne, jedoch keine Kopfbedeckung. Ihr Gesicht ähnelte den Heiligengesichtern auf dem Lettner, es war bleich und leuchtend, die Augen wie Krater, bis ein Lichtstrahl hineinfiel. Sie blitzten auf, geweitet von wahnsinnigem, mühsam beherrschtem Entsetzen. Und mit ihnen auch zwei Rubine in ihrem Haar.
»So furchtbar«, hauchte sie. »Helft mir.«
Carg Vrost lauschte angestrengt auf seine Stimme, die ihr antwortete.
»Hat sie dir etwas getan?«
»Nein, aber ich... kann nicht...«
»Wenn Gott hier zugegen ist«, sagte Vrost, weiterhin lauschend, »dann wird Er über uns wachen. Verhalte dich ganz still. So still wie die Toten.«
Als er auf sie zutrat, zuckte sie zusammen, doch dann zwang sie sich zu der von ihm verordneten Stille. Sie schloss die Augen und biss sich fest auf die Unterlippe. Nicht, dachte er mit wirrer Heftigkeit, zerreiß nicht die Haut. Im Geiste sah er einen Blutstropfen auf ihrer Lippe und wie die schwarze Motte in ihrem schwarzen Haarschopf schwirrte, Haar und Motte an ihrem Mund festgeklebt...
Er näherte sich ihr unendlich langsam und mit hallenden Schritten, das Schwert aus Granit nachziehend und ohne den Blick von der Haarlocke abzuwenden, worin sich die Motte eingesponnen hatte. War sie hierher geflogen, um Zuflucht zu finden, oder war dies Teil eines geheimen, teuflischen Spiels, das im Wald veranstaltet wurde? War es Zufall, dass sie sich verfangen hatte, gleichsam ein makabrer Scherz der Winternacht, ein Märchen, oder ein Traum?
Er durfte sich darüber nicht zu viele Gedanken machen. Die Aufgabe war klar, der Ausgang offen. Seinen eigenen Worten zum Trotz wusste er, dass das Mädchen sehr wohl zum Opfer werden konnte.
Eine Handbreit von ihr entfernt, nah genug, ihren Frauenduft zu riechen, farnartig, kostbar, und darunter das saure Aroma der Angst... nah genug für einen Kuss, blieb er abermals stehen. Tränen rannen wie Seide über ihr Gesicht, jedoch kein Blut.
Auch die Motte verharrte reglos. Er betrachtete ihre fremdartige Erscheinung. Die Flügel waren zusammengefaltet. Sie wiesen keine Zeichnung auf, ihr Schwarz glich verkohltem Papier. Der gekrümmte Leib und die Fühler mit den rubinfarbenen Spitzen waren so zierlich wie ein erlesenes Schmuckstück. Sich der Betrachtung allzu lange zu widmen, war jedoch nicht angebracht.
Er nahm das Haar des Mädchens in die linke Hand - einen unwirklichen Moment lang vergessend...
Carg Vrost schrie vor Schmerzen auf, ein Taumel blutroter Qual. Die gebrochenen Finger, die betäubte Handfläche, zum Leben erwacht, unbenutzbar - irgendwie lösten sich die Haarsträhnen, die sich an einem Hindernis aus Panzer und umhülltem und gesplittertem Knochen verfangen hatten. Geblendet und ohne zu wissen, was er tat, hob Vrost das Schwert aus Granit, welches das Gewicht der ganzen Welt in sich barg, und schlug zu.
Die junge Frau stieß einen schrillen Schrei aus. Sie stürzte wie ein Licht durch sein Gesichtsfeld. Und an seinen gebrochenen Fingern hing die Strähne mitsamt der flatternden Motte.
Er schüttelte sie ab, und mit ihr schien sich seine Hand zu lösen. Wieder und wieder brüllte er vor Schmerz, doch er stampfte auf das Haarbüschel und hob seinen Stiefel - und sah eine schwarze Blume auffliegen und hinter dem Lettner verschwinden.
Er stürzte vor. Der Rand des Lettners traf ihn an der Schulter. Er blieb daran hängen und blickte auf den Altar.
Das Fenster war eine klaffende Öffnung voll weißer Luft, umrahmt von einem eisernen Flechtwerk aus Rosen und Dornen. Der kahle Altar stützte einen eisernen, gekreuzigten Christus, eine Silhouette vor dem hellen Hintergrund. Und darüber schien eine geheimnisvolle gelbe Flamme im Nichts zu schweben. Es war das Ewige Licht der Kapelle. Vielleicht war das Mädchen, das so still hinter ihm lag, hergekommen, um nach dem Lämpchen zu sehen. Nun machte er auch die dünne Kette aus und die flache Schale, in der die Flamme glomm.
Die Motte flog hinein. Die Motte flog ins Feuer und wurde von ihm verzehrt.
Vrost stand da und sah, mit einem unbeteiligten und fernen, noch unverfälschten Teil seiner selbst, wie der Dämon aufloderte, eine schwarze innerhalb einer gelben Flamme. Und dann ergoss sich etwas aus dem Ewigen Licht, etwas wie der Atem der unbesiegbaren Nacht.
Die verkrümmte, unveränderliche Ikone mit ihren zwischen den peinigenden Nägeln ausgebreiteten Armen wurde überlagert vom Bild eines Mannes. Es schwoll an, hüllte das Kreuz und den Christus ein. Die Haltung war jedoch die gleiche. Beine und Rumpf gestreckt, der Kopf zurückgeworfen, die Arme ausgebreitet. Und in der Brust ein einzelner Nagel aus scharlachrotem Licht, der in zahllose Splitter zerbarst.
Carg Vrost schaute losgelöst von seinem schmerzgequälten Körper zu, wie der Schauer feurigen Lichts und die Bruchstücke der zersplitterten Lampe zu Boden fielen. Und die Morgendämmerung lugte durch das Fenster mit seinen Krallen. Und es war Tag.
Zweites Kapitel
Der Winter hatte im Wald eine gewaltige Kathedrale errichtet, mit Mauern aus Eis und einem Orgelspiel aus Wind. Die winzigen Handwerker der Füchse und Hermeline hatten ihre Gänge ausgehöhlt und verziert, den Boden geprägt. Ihre Fenster hatten Scheiben aus kaltem Mauve und Blau und gelblichen Himmeln und den blassen Rottönen eisiger Sonnenuntergänge. Die Kathedrale hatte Bestand. Dann durchstreifte der Frühling, dieser zerstörerische Engel, die Wildnis mit gezogenem Schwert. Der Frühling schleifte die Kathedrale. Ihre Dächer aus Schnee stürzten ein. Nach dem Tauwetter sickerte Grün in die Pulsadern des Waldes, und Speere aus Sonnenlicht trennten die Bäume voneinander.
Ein Wolf trottete durch die grüne Kirche des Waldes, ein Schatten, der sich, von Sonnenstrahlen getroffen, unvermittelt verfestigte. Seine Augen musterten wie die eines grimmigen jungen Mannes das Unterholz und das Blätterdach darüber. Vögel zwitscherten und huschten im Dickicht der Blätter umher. Andere kleine essbare Geschöpfe stöberten im Gras nach Futter.
Dort, wo ein Bach über eine Baumwurzel plätscherte, hielt der Wolf inne, um zu trinken, dann sprang er übers Wasser und trottete weiter.
Am Fuße eines Hanges, inmitten der Findlinge, lag etwas. Es lag dort seit dem Winter vor achtzehn Jahren. Als der Wolf es erreicht hatte, hielt er abermals inne und schnüffelte daran, an einer Ansammlung von Knochen und Metallstücken, die matt geworden und auseinandergefallen waren. Ein menschlicher Totenschädel in einer Hülle aus rostigem braunem Eisen verhöhnte den Wolf: Zu spät gekommen! Das Fleisch war seit fast zwei Dezennien verschwunden. Der Wolf trat mit seinem langen Fuß auf die Rabenspange im Farn.
Eine halbe Meile oberhalb der Stelle, wo einer von Korhlens Soldaten unentdeckt oder unbeachtet seit der nächtlichen Vampirjagd geschlafen hatte, traten die Bäume auseinander. Diesen Weg schlug der Wolf ein und folgte ihm bis zum Rand des Hügels, wo er anhielt und dorthin zu blicken schien, wo ein riesiger schwärzlicher Kamin aus der Erde emporragte. Die Burg, um deren Mauern sich ein Bienenstock lebensnotwendiger Gebäude drängte, das Burgdorf, die holprige Straße und der schmuddelige Gasthof, alles verschönt vom knospenden Grün, den blühenden Bäumen und den schwarzen, von keimendem Getreide getüpfelten Feldern.
All dies überblickte der Wolf. Dann trottete er durch den Zaun der Kiefern davon und wurde wieder zu einem Schatten.
Sein Sterben begann an einem Tag im Frühling, als er einundzwanzig Jahre alt war. Er wusste nichts davon. Als er erwachte, war er auf eine andere Art von Schrecken vorbereitet.
Boroi, der Sklave, klopfte an die Tür. Als er eintrat, hatte er die üblichen Dinge dabei, das Wasser und das Rasiermesser, Wein und Brot.
Mechail sagte: »Glaubst du etwa, für all das hätte ich Zeit, Dummkopf?«
Mechail fiel auf, dass er den Tonfall und die Wortwahl seines Vaters gebraucht hatte. Kurzzeitig wunderte er sich: Wie kommt es, dass ich ihn nachahme, wo ich ihn doch hasse?
Der Sklave hatte seinen Worten jedenfalls keine besondere Beachtung geschenkt. Er setzte die Frühstücksund Rasierutensilien ab, und dann stand er da, bereit, ihn zu bedienen oder sich erneut ausschelten zu lassen.
Boroi war all die vierzig Jahre seines Lebens über Haussklave gewesen, er trug den Halsring mit dem Raben der Korhlen darauf, und sein Gesicht erinnerte an verwelktes, saftloses Gemüse.
»Also, dann mach schon! Rasier mich!«
Während die Klinge emsig über seine Wangen glitt, saß Mechail auf dem mit Schnitzereien verzierten Stuhl, der einmal seiner verstorbenen Mutter gehört hatte. Körper und Geist hielt er still. Als Boroi ihm das Gesicht abwischte, griff Mechail nach dem Wein und trank. Wein hatte ihm auch gestern Abend geholfen. Nach dem fünften Becher hatte er aufgehört, sich Sorgen zu machen. Etwas hatte ihn innehalten lassen, bevor er vollständig betrunken gewesen war. Heute Morgen verspürte er lediglich eine leichte Übelkeit, die angesichts dessen, was vor ihm lag, sowieso unvermeidlich gewesen wäre.
Boroi kleidete ihn an. Vor allem dazu brauchte Mechail den Sklaven. Das Anlegen des Gewands mit dem hässlichen Einsatz, der ungeschickt angenäht worden war, um die unförmige dumme Schulter aufzunehmen, und das Hantieren mit dem steifen Arm und der wohlgeformten, kraftlosen Hand daran bereiteten ihm noch immer gewisse Schwierigkeiten. Boroi streifte Mechail die Stiefel über und band ihm den Gürtel um, der in der Nähe des Kamins gelegen hatte. Im Schild über dem Kamin erblickte Mechail plötzlich sein Spiegelbild, einen mit Haut bedeckten Totenschädel, zwei blasse Augen mit schwarzen Brauenbögen, einen schwarzen Haarschopf.
Wer bin ich? Der Nachkomme eines Burgherrn. Der für dessen Sünden büßen muss. Und für meine eigenen.
Er war von Trübsal erfüllt. Daran hatte er sich gewöhnt. Niemand brauchte es zu bemerken. Sie alle waren seine Feinde, der Vater, der all dies von ihm verlangte, der Halbbruder, der ihm nach dem Mund redete, dessen Freunde und Gefolgsleute. Die Dienstboten und Sklaven, vor denen er sich keine Blöße geben durfte.
Sein Sklave beobachtete ihn. Mechail bemerkte den Blick im Schild und wandte sich zu ihm um. »Was ist?«
»Das Messer meines Herrn.«
»Ach, das. Ja. Ich werde es wohl brauchen, meinst du nicht?«
Der Sklave trat herbei und legte das blankpolierte Messer in Mechails gesunde Hand.
Irgendetwas, Mechail wusste nicht, was es war, ließ ihn plötzlich an seine Mutter denken, die letzte rechtmäßige Ehefrau seines Vaters. Ihr Gesicht hatte er schon vor langer Zeit vergessen, jedoch nicht ihr schwarzes, wallendes Haar mit dem silbernen Schimmer und ihren Geruch, den Geruch einer süßen, vergehenden Blume - er war gerade erst vier Jahre alt gewesen. Jemand hatte ihm gesagt, Gott habe sie zu sich genommen, und er hatte geschrien und Gott gelästert. Und dann hatte ihn der Priester geschlagen. Ja, am Todestag seiner Mutter hatte ihn der Priester mit der Rute gezüchtigt, stets darauf bedacht, nur die gesunde Seite seines Rückens zu treffen. Er erinnerte sich noch an die seltsame Zweiteilung: die gesunde Schulter hatte stärker geschmerzt als die, die ansonsten wehtat.
»Mein Gebieter«, sagte Boroi.
Mechail funkelte ihn an, ohne diese braune Rübe mit ihren Augen aus Feuerstein überhaupt zu sehen.
»Um Himmels willen - du treibst mich an? Ich weiß. Ich habe eine Verabredung mit einem Feind aus dem Hause der Widersacher meines Vaters. Mit einem Esnias.« Unversehens versetzte Mechail dem Sklaven einen Hieb über den Kopf. Das hätten sein Vater, sein Bruder Krau - und alle anderen ihres Schlages - auch getan. So verhielt man sich eben, wenn ein Sklave über die Stränge schlug, und sei es nur ein wenig.
Boroi nahm den Hieb demütig hin.
In der Burg war vom Frühling noch wenig zu spüren, doch als er vom Tafelsaal über die Treppe zum Hof hinunterschritt, zwischen den beiden steinernen Raben hindurch, da merkte er doch, dass der Frühling bereits Einzug gehalten hatte.
Er hatte den Frühling am Abend zuvor gerochen, prickelnd und sanft zugleich. Er hatte etwas mit Mechail angestellt, das weniger leicht fassbar gewesen war als die Wirkung des Weins und keinen schlechten Nachgeschmack hinterlassen hatte.
Der Hof war in Sonnenschein getaucht. Überall dort, wo sie nicht sollten, sprossen Pflanzen, und die Sklaven harkten sie zwischen den Steinen hervor. Ein heller Glanz fiel auf die efeuüberwucherte Mauer zum Frauengarten. Darüber wölbte sich ein fahlblauer Himmel mit strahlendweißen Federwölkchen.
Unten auf dem Hof standen zehn von seines Vaters Soldaten, zusammen mit dem energischen Hauptmann und dem ältlichen Priester mit den wässrigen Augen und den zitternden Händen.
Niemand sprach zu Mechail. Sie kannten ihre Aufgabe und erwarteten, dass er die seine kannte.
Was er auch tat. Er kannte sie seit fünf Jahren. Bis jetzt hatte er nie ganz daran geglaubt.
Die Sklaven auf dem Hof fuhren mit Jäten fort, beobachteten jedoch alles mit ihren hündischen Augen, denen nichts entging, auch wenn sie häufig kalt und leblos wirkten. Der Stallbursche brachte Mechails Pferd, die fügsame Stute, die man ihm gegeben hatte, weil er nicht für allzu viel zu gebrauchen war, so verkrüppelt wie er war. Dennoch fürchtete er sich vor der Stute, und das wusste sie. Sie verdrehte ihr kastanienbraunes Auge nach ihm. Er schwang sich von der untersten Treppenstufe unbeholfen in den Sattel, wobei er sich der verminderten Kraft seines Oberkörpers anvertrauen musste. Wie jeden Morgen und spät abends hatte er Rückenschmerzen. Im Sommer war er manchmal frei von Schmerz, doch nie für lange. Jede Anstrengung brachte ihn zurück, den fordernden Gast, der den Weg zu seiner Türe kannte. Er war jedoch so an den Schmerz gewöhnt, dass dieser ihn nur selten aus der Fassung brachte.
Er gab der Stute die Hacken, und sie setzte sich in Bewegung, ganz steif vor Verachtung. Das Tor hatte man weit geöffnet, und draußen lag die holprige Straße, die vom morgendlichen Regen aufgeweicht war.
Mechail ritt hindurch. Der Hauptmann und die Soldaten schlossen sich ihm an. Der Priester ging zu Fuß, den Rosenkranz in der Hand, ein Geschenk von Vre Korhlens Hurenweib. Bemalte Porzellankügelchen oder kleine farbige Glasperlen, ein Opal, der für Keuschheit, und ein matter, erlesener Smaragd, der für Frömmigkeit stand.
Die Felder lagen ausgebreitet unter dem Himmel, und an ihrem Rand erhob sich der Wald wie die Buckel eines schlafenden Drachen.
Die Sklaven auf den Feldern hielten für einen Augenblick mit der Arbeit inne, um herüberzuschauen und zu glotzen. Länger trauten sie sich nicht, das hätten die Aufseher nicht erlaubt.
Alles in Ordnung, dachte Mechail, ihr stinkendes Geschmeiß. Alles ist so, wie es sein sollte. Der rechtmäßige Nachfolger des Burgherrn zieht aus, um zum Mann zu werden.
Um zum ersten Mal zu töten.
Krau, der uneheliche Sohn, hatte es bereits getan. Im letzten Jahr. Krau, damals fünfzehn Jahre alt, war ins Gehölz gegangen und hatte sein Messer gebraucht. Damals hatten sie mit den Esnias noch in Fehde gelegen. Die Fehde hatte zehn Jahre gedauert. Mechail erinnerte sich noch an den Pferdediebstahl und den Raub weiblicher Feldsklaven, mit dem sie begonnen hatte.
Hier draußen war die Geltung des Gesetzes eingeschränkt, und es wurde selten angerufen. Selbst die Religion wurde missachtet. Die Kirchenväter hatten es Vre Korhlen nach dem Tod der Herrin Nilya untersagt, ein drittes Mal zu heiraten, und dennoch hatte er sich Veksa genommen, sie geschwängert und geheiratet. Der Priester hatte sie getraut. Mechail hatte der Hochzeit ebenso wenig beigewohnt, wie man ihn an der Beerdigung seiner Mutter einige Monate zuvor hatte teilnehmen lassen. Nur die geschlossene Gruft hatte er hinterher gesehen. Als Kind hatte er sie bisweilen besucht. Zu einer Grabmauer zu sprechen, hatte ihm jedoch nicht geholfen. Obwohl sich die Bauern erzählten, der Wind führe die Stimme der Toten mit sich, und obwohl er diese Geschichten geglaubt hatte, war es ihm nicht gelungen, mit Nilya zu reden.
Sie bogen auf den Mühlenweg ein, kamen an der qualvoll knirschenden Mühle vorbei und ritten zum Waldrand hoch.
Eine Frau an einem Brunnen bekreuzigte sich, dann zog sie weiter Wasser herauf, die kräftigen Arme und den Hals über die dunkle Öffnung gebeugt.
Mechail hätte ihre Arbeit einhändig bewältigen müssen.
Man hatte ihn kämpfen gelehrt und gezwungen, den gesunden Arm zu trainieren, darum war er geschmeidig und hart von Muskeln. (Auch ein wenig Lesen hatte man ihm beigebracht und ihn wegen jeder Kleinigkeit geschlagen, wenn er nachlässig war oder sich dumm anstellte.)
Anfangs hatte er gemeint, sein rechter Arm habe teuer für den linken bezahlen müssen. Er hatte seine linke Seite gehasst, von der Hüfte bis zum Hals. Vielleicht hasste er sie noch immer, das arme Ding, eine nutzlose Last, die er mit sich herumschleppte.
Krau, der illegitime Sohn der dritten Frau, hätte der Erbe sein sollen. Dann hätte der Krüppel seine Ruhe gehabt.
Nur ganz selten hatte Mechail als Kind daran gedacht, aber wenn ihn nicht in früher Kindheit der Hund angefallen hätte, wäre er wie andere Männer auch gewesen.
Der Pfad wurde schmaler und hörte ganz auf, als sie in den Wald eindrangen. Vor ihnen lag die Lichtung mit dem Gehölz weißer Birken, die fast nackt wirkten in ihrem frischen Grün.
Natürlich war es ein heidnischer Ort. In früheren Zeiten hatten die Angehörigen des Rabengeschlechts alljährlich scharenweise Sklaven und Feinde auf dem schwarzen Stein geopfert. Herrschte weder Krieg noch Fehde, wurden die Männer mittels Los ausgewählt. Das Ritual sollte den Feldern Fruchtbarkeit schenken.
Mechail ertappte sich dabei, dass er auf die Geräusche lauschte, die aus dem Gehölz drangen. Vielleicht hatte er erwartet, der Esnias werde fluchen oder schreien. Außer dem hellen Gesang der tiefer in den Bäumen verborgenen Vögel war jedoch nichts zu hören.
Die Stute trottete weiter, der Farn streifte ihre Brust, und die schwarzen, verfaulten Kiefernzapfen zerbarsten unter ihren Hufen.
Dann stimmte Gottesbruder Beljunion, der alte Priester, seinen zittrigen Singsang an. Mechail straffte sich, sein Mund war zusammengepresst, seine Augen blickten starr, als wäre er blind; vor diesem bösen Blick hatte Beljunion ihn als Jungen gewarnt und ihn deswegen verdroschen und noch anderweitig bestraft. Beljunion war im Jahr nach Nilyas Tod in Mechails Leben getreten, ein perfektes Gegengewicht, ein hartnäckiges Salz in einer unauslotbaren Wunde.
Im Geiste sah Mechail den Priester mit der Rute in der Hand vor sich stehen, schon damals ein alter Mann. »Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Er möge mit uns verfahren, wie es Ihm gefällt.« Das Kind hatte geschrien, Gott habe ihm seine Mutter geraubt und kein Recht dazu. »Verbanne diese Blasphemie aus deinen Gedanken. Du musst ein für alle Mal begreifen, Gott ist Gott. Füge dich Seinem Willen, du kleiner Teufel.«
Niemals. Das habe ich niemals getan. Allmächtiger Heiland. Der Wille Vre Korhlens ist schwer genug zu ertragen. Höre mich, Gott, ich kämpfe gegen Deine Ungerechtigkeit und Deinen blutrünstigen Willen.
Die schlanken Birkenstämme wichen auseinander, und der Jüngling ritt in das uralte Gehölz hinein, den Kopf voller unsichtbarer Flammen.
Das Gras war hoch gewesen, jedoch kürzlich mit der Sense abgemäht worden. Der schwarze Stein stand schief in der Mitte. Vielleicht war er noch älter als der Wald. Der Vogelgesang erstarb, das Licht veränderte sich, wurde bleich und grell. Der Himmel schien grundlos.
Das Opfer war am Stein festgebunden. Der Mann gehörte zur Besatzung der Burg Esnias. In den letzten Wintertagen hatten ihn Vre Korhlens Männer am Waldrand aufgegriffen. Er gestand, einem Mädchen aus Korhlens Dorf nachgestiegen zu sein und ein Huhn gestohlen zu haben. An einem anderen Tag hätte man ihn wahrscheinlich gegen Lösegeld freigelassen und so zwischen Esnias und Korhlen einen Waffenstillstand begründet und womöglich eine Fehde beendet, die noch nicht offen erklärt war und ständigen Krieg bedeutete. Doch es war der falsche Zeitpunkt. Das hätte er wissen müssen und fernbleiben sollen, denn zahlreiche Burgen des nördlichen Waldes hielten an den alten Bräuchen fest.
Er war in mittleren Jahren und in der Gefangenschaft zu einem menschlichen Wrack geworden. Er hatte einen Siebentagebart, und ein paar Schneidezähne waren abgebrochen, was gut zu erkennen war, da sein Mund offenstand. Seine Augen hingegen waren nahezu geschlossen, obwohl sie sich bewegten und nach Mechail sahen. Der Soldat wirkte wie ein Mensch an der Schwelle des Schlafes, der etwas Ungewöhnliches erblickte oder hörte, das ihm im Grunde gleichgültig war.
Er war nur mit einer Unterhose bekleidet. Ein strenger Geruch ging von ihm aus. Irgendwann hatte er sich vor Angst wohl selbst beschmutzt, doch nun schien er darüber hinaus zu sein.
Mechail saß auf dem Pferd. Er dachte: Ich muss ihn töten.
Zwei von Korhlens Soldaten standen neben dem Stein, und unter einem Baum wartete der zweite Kämmerer des Burgherrn, der außer dem Hauptmann und dem Priester als Zeuge anwesend sein musste. In der Nähe stand der letzte Helfer, der für das morgendliche Ritual vonnöten war, der Burgschlachter, den man abkommandiert hatte, das Werk notfalls zu vollenden.
Die Soldaten nahmen in dem Wäldchen Aufstellung. Der Priester trat zu dem benommenen, schmutzigen Mann und bot ihm mit widerwärtiger und aufreizender Überheblichkeit das silberne Kreuz an der hübschen Perlenkette zum Kuss.
Und mit gleichermaßen widerwärtiger Fügsamkeit wandte der Mann den Kopf und drückte seinen schlaffen Mund auf das Kreuz.
Beljunion trat zurück und senkte seinen inbrünstigen Blick, den Smaragd wieder und wieder in den Fingern wendend.
»Kann ich Euch helfen, Herr?«
Mechail sah überrascht auf den Soldaten hinunter, der die Stute hielt und dem Krüppel unhöflich und frech angeboten hatte, ihm beim Absitzen zu helfen.
Ein sengender Schmerz fuhr durch Mechails Bauch, sein Geschlecht und seine Eingeweide. Es war soweit. Der Moment war gekommen. Es war kein Gerücht und keine Drohung, keine Befürchtung und kein Alptraum mehr. Es war Realität, und es gab kein Entrinnen.
Er stemmte sich hoch und ließ sich vom Pferd gleiten.
Der Esnias hatte den Kopf auf die Schulter sinken lassen und die Pose des sterbenden Christus eingenommen. Das war abstoßend komisch. Er schien jetzt bewusstlos zu sein und atmete wie ein erschöpfter Schläfer.
Mach's richtig. Verpfusche es nicht.
Der Mann bedeutete Mechail nichts, er war nicht einmal sein Feind. Er würde jedoch schreien, und der Todeskampf und die Krämpfe mussten abgekürzt werden.
Wenigstens war Krau nicht da. Bestimmt war er bei einem Mädchen, vielleicht bei einer seiner Halbschwestern, den Töchtern der ersten Frau, die Mechail nie kennengelernt hatte. Die erste Frau war verdorben gewesen, und ihre Nachkommen waren ausschweifend. Sie machten, was sie wollten, genau wie Katzen.
Trödel nicht herum. Tu es endlich.
Er hatte das Messer gezogen, hielt es in der rechten Hand. Er trat vor. Er wollte darum beten, dass der Soldat bewusstlos war und nicht wieder die Augen aufschlug, um zu sehen, wer da kam. Aber Mechail betete nicht. Es hätte nichts genutzt.
Und tatsächlich, bei seinem letzten Schritt hob der Mann die Lider und schaute ihn an.
Ihre Blicke trafen sich.
Mechail hatte gewusst, dass es so kommen würde.
Der Mann grinste. Sein erschlaffter Mund murmelte: »Das erste Blut, wie?«
Mechail brauchte darauf nicht zu antworten.
Er stand jetzt dicht vor dem gefesselten Mann, zwischen ihm und den anderen, der Frühlingssonne, den Bäumen, dem bleichen, sakralen Licht und allen Dingen.
Mechail hörte sich sagen: »Es dauert nicht lange.«
»Es wird trotzdem verflucht wehtun. Und dann die Hölle, wegen all meiner Missetaten.«
»Du Narr, es gibt keine Hölle«, sagte Mechail und trieb sein Messer in den Körper des Mannes, entsetzt und überrascht vom Widerstand des Fleischs und der Muskeln, empfindungslos gegenüber dem hervorschießenden Blut, das ihm ins Gesicht spritzte und das ihm in den Augen brannte, dem langgezogenen Heulen des Mannes und dem schrecklichen Brodem, der seinem Leib entwich. Das Messer drang immer weiter nach oben vor, also war der Magen durchschnitten. Die weißen Rippen traten hässlich hervor, er sah die aufgerissene Bauchhöhle und das Zucken des vergehenden Herzens.
Von der Anstrengung tat ihm die gesunde rechte Schulter weh. Das Messer steckte fest, er bekam es nicht mehr heraus. Der Mann starb. Sein Körper entspannte sich. Die Hülle seines Leichnams, die im Leben verschlossen gewesen war und ihm Schutz gewährt hatte, war nun bis auf die inneren Organe entblößt.
Mechail hatte geglaubt, ihm werde übel werden, doch er fühlte sich bloß matt und schwach, wie bei Einsetzen eines Fiebers.
Langsam wandte er sich um, und der Schlachter seines Vaters kam durchs Gras, um den Tod des Mannes zu bestätigen. Noch ehe er den Leichnam erreicht hatte, hob Vre Korhlens Hauptmann die Hand, und die Soldaten stießen ein heiseres Gebrüll aus. Dies war reine Formsache.
Als Mechail sich das Blut aus den Augen wischte, überlegte er, woraus es wohl bestehen mochte.
Beljunion verstellte ihm den Weg.
»Geht heim und wascht Euch«, sagte der Priester. »Kommt dann ordentlich gekleidet in die Kapelle.«
Nach dem Fruchtbarkeitsritus - dem Ritualmord - eine Buße vor Gott. Vermutlich nur eine leichte Buße.
Die Sklaven würden ihn heimreiten sehen mit all dem Blut - das Blut war es, was so nass war und was klebte und stank -, dem Symbol seines Mutes und seiner Männlichkeit.
Aus der Maske aus Haut, Knochen und Blut fixierten seine Augen, die so klar wie Winterwasser waren, den Priester, der ihm als Kind den Hintern versohlt hatte.
»Mein Messer steckt noch in dem Mann. Jemand muss es mir holen.«
Der Priester fuhr leicht zusammen. »Sagt den Soldaten Bescheid.«
»Ihr sagt es ihnen, Vater.«
Das Gesicht des Priesters zuckte nervös, wurde wieder starr.
»Sehr wohl, Herr. Ihr müsst eilen und das Blut abwaschen, sonst beschmutzt es Eure Seele.«
Ich habe keine Seele. Na los, sag es ihm.
Diese äußerste Unverschämtheit wollte jedoch nicht heraus, nicht nach all den Jahren unter seiner Knute.
Mechail trat zu seinem Pferd. Die Stute schreckte vor dem Aasgestank zurück. Er packte sie bei der Mähne und am Zaumzeug, um sich daran festzuhalten, wobei er so tat, als bereite ihm sein Arm Schwierigkeiten.
Er spürte jetzt, wie die Erschöpfung in Wellen auf ihn eindrang. Was Körperbeherrschung und das Zurückhalten von Tränen und Fragen, von Träumen, Wünschen und Verzweiflung anging, so hatte er viel Übung darin.
Sein Innerstes weinte ständig, wie eine Glocke am Grund eines Sees. Ihr Wehklagen kannte er so gut wie seinen Herzschlag. Jedoch kein Heilmittel, das dagegen geholfen hätte.
Als Mechail zur Kapelle hinüberging, war es früher Nachmittag, und er hatte Beljunion warten lassen. Im Grunde hatte er nicht vorgehabt, Gott und den Priester zu kränken. Nachdem er in seiner Kammer angelangt war, hatte er die Kleider abgestreift, sich gewaschen und die Übelkeit mit dem Wein verscheucht, der auf der Truhe bereitstand. Dann hatte er sich auf das schwankende Bett geworfen und geschlafen. Er war mit einem Schmerz hinter den Augen aufgewacht, mit dem Gefühl, am falschen Ort zu sein, und hatte kurzzeitig geglaubt, alles läge noch vor ihm. Er hatte es jedoch bereits getan. Es war vorbei.
Die Kapelle lag hinter dem Frauengarten, an einem kurzen Weg, der nach den Pfirsichbäumen hinter der Mauer duftete.
Im kühlen Schatten eines Torwegs hatten sich ein paar Frauen versammelt, um sich den frischgebackenen Mann anzuschauen. Beim Näherkommen vernahm er ein dummes, schwereloses Gelächter. Er hatte keine Freundinnen unter den Frauen. Drei der Töchter seiner Stiefmutter trödelten herum, und Veksa selbst saß auf einem Schemel, ohne ihre Neugier zu verhehlen; sie war gekommen, ihn zu sehen.
Mit vierzehn war sie vom Vre geschwängert worden und seitdem niemals mehr, wenngleich sie mit Krau ihren Wert unter Beweis gestellt hatte. Es hieß, ihre wunderliche Art im Bett habe den Burgherrn seitdem bei Laune gehalten. Außerdem hatte sie eine große Mitgift in die Ehe eingebracht. Sie war kein Burgfräulein, sondern die Tochter eines Müllers. Der eifrige Vater hatte sie seinem Herrn eines Abends angeboten, als dieser an der Grenze seines Besitzes gejagt hatte. Sie war ein gutentwickeltes Frauenzimmer, schlank, mit üppigen Brüsten, einem füchsischen Gesicht und blondem Haar, das im Norden selten war. Ein anderes Leben gewohnt, hatte sie auf der Burg abgenommen und war schlanker geworden. Während ein Bauernmädchen mit zwanzig ein altes Weib sein konnte, war Veksa mit über dreißig immer noch jung. Ihr Haar, das sie teils offen trug, teils mit bernsteinfarbenen Nadeln hochgesteckt hatte, war noch voll und safrangelb. Für Mechail, der sie seit seinem fünften Lebensjahr kannte, wurde sie eigentlich nicht älter, nur reifer. Heute trug sie ein verschwenderisch mit Vögeln und Kornblumen besticktes weißes Leinenkleid, und ihre Handgelenke bestanden aus Armreifen. Die schmalen, schräggestellten rauchblauen Augen waren es, die ihr Gesicht so gefährlich machten. Ihrem Blick begegnete er ebenso ungern wie ihr selbst.
Als er auf Höhe der Frauen angelangt war, überlegte er, ob Veksa ihn wohl ansprechen werde. Sie tat es nicht, und er ging vorbei.
Er hatte die Kapellentür erreicht, als sie ihn anrief.
»Keine Artigkeiten? Weder für den Priester noch für die Gemahlin des Burgherrn?«
Mechail blieb stehen. Ohne sich umzusehen, sagte er: »Ich wünsche Euch einen guten Tag, Herrin.«
»Ich wünsche Euch einen guten Tag, Herr.«
Und die Mädchen riefen im Chor: »Guten Tag, Fürst Mechail.«
Er legte die Hand auf die Kapellentür.
»Mechail!«, rief Veksa. »Meinen Glückwunsch zum ersten Blut.«
Die Frauen sollten das Ritual eigentlich nicht erwähnen.
Außerdem wusste er, dass Krau gewettet hatte, der Erbe des Burgherrn werde versagen. Als er sechzehn war, hatte sich der damals elfjährige Krau mit einem vom Blut eines getöteten Schweins besudelten Messer vor ihm aufgebaut und gesagt: »Weißt du, was es mit dem ersten Blut auf sich hat? Du musst jemanden töten. Nicht im Zweikampf, sondern einen wehrlosen Mann, der am Stein festgebunden ist. Und du wirst dir in die Hose machen. Du wirst in Ohnmacht fallen.«
Mechail drückte gegen die Tür. Sie gab nach. Er erblickte das Innere der Kapelle, das helle Fenster und Beljunions Gestalt am Altar.
Plötzlich rief Veksa aus: »Die Hunde meines Vaters hatten bessere Manieren!« Sie brüstete sich immer mit ihrer niederen Herkunft.
Mechail trat in die Kapelle, wo sein nächster Gegner bereits auf ihn wartete.
Gottesbruder Beljunion hatte einige Zeit darauf verwandt, sich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Mechails Verspätung hatte er vorausgeahnt. Dem Geistlichen war ein wenig bang zumute, wie es auch in der Vergangenheit bisweilen vorgekommen war, wenn er mit Mechail Korhlen, dem von Gott Verfluchten, zu tun gehabt hatte.
Der Priester kannte den Aberglauben der Waldbewohner gut, denn er war im nördlichen Wald geboren. Seine Erziehung und die religiöse Ausbildung in Khish hatten ihm die Prinzipien eines strengen Glaubens und eine nüchterne Einstellung gegenüber okkulten und profanen Geschehnissen vermittelt. Er glaubte nicht an die Ereignisse, die man ihm geschildert hatte - ein das geflügelte Wesen am Hals des Kindes, den Sturz, die Flucht, die anschließende Jagd, von der nur Versprengte ohne Nachrichten zurückgekehrt seien und bei der der Hauptmann in der verschneiten Winterwüste verschwunden sei. Das war nichts weiter als eine Anekdote, die solange aufgebauscht worden war, bis man ihr Glauben geschenkt hatte. Vampire, diese Diener der Hölle, gab es an sich nicht, dennoch waren sie als Symbole, als Warnung, in der Welt weit verbreitet. Was tatsächlich in jener Nacht vorgefallen war, wollte Beljunion gar nicht ergründen, aber er war überzeugt davon, die Deutung zu kennen. Das Kind war von einem Dämon besessen. Er konnte jederzeit zum Ausbruch kommen, so wie es der unwissende Burgherr in seiner Angst vorausgesagt hatte. Es war jedoch nicht so, dass sich der Junge in einen Dämon verwandeln würde. Das Böse hatte ihn bereits - vielleicht unwiderruflich - in seiner Gewalt.
Gottesbruder Beljunion hatte sich damals nach Kräften bemüht, das Böse einzudämmen, es mit der Rute aus dem Jungen herauszuprügeln und mit Fasten auszuhungern.
Jetzt wartete der Priester beim Altar, unter dem brennenden Lämpchen, das Gottes Anwesenheit symbolisierte, und aus dem Fenster ergoss sich helles Nachmittagslicht über den jungen Mann, der sich ihm langsam näherte.
Mechail wusste nichts. Ihm hatte man die geheimnisvolle Geschichte nie erzählt, aus Angst, den Ausbruch der Krise zu beschleunigen.
Offenbar wusste er auch in anderer Beziehung nur wenig über sich Bescheid.
Ein unschuldiger, blankpolierter Apfel, der sich nur der Made bewusst war, die an ihm nagte.
Von der verkrüppelten linken Seite einmal abgesehen, war er hochgewachsen, schlank und muskulös, während sich ein flüchtiges Versprechen von Einzigartigkeit, die im Kind angelegt gewesen war, nun erfüllt hatte. Ein Tiergesicht, angesiedelt zwischen Katze und Wolf, mit den Zügen menschlicher Schönheit versehen, mit wilden Augen, halb wahnsinnig, unwiderstehlich. Nicht nur eine stattliche Erscheinung, sondern die Verkörperung irgendeiner Art von Macht, männlich und zügellos.
Auch dagegen hatte Beljunion sich wappnen müssen. Das Bedürfnis, den Jungen zu berühren und ihn zu liebkosen, hatte im Schlagen mit der Rute sein Ventil gefunden.
Auch dafür hatte er natürlich eine Erklärung. Weder schämte er sich deswegen, noch fühlte er sich in Verlegenheit gebracht. Zu fürchten brauchte er einzig und allein den Teufel.
»Habt Ihr Euch gereinigt?«
»Aber sicher, Vater.«
»Habt Ihr gebetet?«
»Nein. Ich habe mich betrunken und musste den Rausch ausschlafen.«
Dies betrachtete Beljunion als kindlichen Trotz, wie ihn der unsichere Junge auch früher schon an den Tag gelegt hatte.
»Dann lasst uns jetzt beten.«
Mechail sah ihn an. Einen Moment lang spürte der Priester bei Mechail einen Drang, sich zu widersetzen, der weit stärker war als je zuvor. Doch das ging vorbei.
»Kniet nieder«, sagte der Priester ernst. Er war erleichtert, als Mechail gehorchte.
Beljunion blickte auf den geneigten Kopf mit dem üppigen Haar hinab, auf die eine gerade Schulter und den verunstalteten Klumpen, der die andere Schulter war. Der stattliche Körper schien sich in diesem Moment verhärtet zu haben, der Arm wirkte wie versteinert - er erinnerte kaum noch an einen Arm.
Der Priester begann sein Gebet für die Vergebung der Sünden, und Mechail antwortete an den richtigen Stellen.
»Ihr habt einen Menschen getötet, Mechail Korhlen. So ist es hier Brauch, doch es wurde Blut vergossen. Gesteht Ihr Euer Vergehen ein?«
»Wenn Ihr es sagt.«
»Gesteht Ihr Euer Vergehen ein?«
»Ich gestehe es.«
»Ihr werdet drei Tage lang kein Fleisch essen. Ihr werdet drei Tage von maßlosem Trinken Abstand nehmen. Fünf Tage lang werdet Ihr jeden Morgen das Bußgebet sprechen, das mit den Worten Vater, in Deiner Schuld stehe ich beginnt. Dies dient dem Schutz Eurer Seele.«
»Habt Ihr auch Kraus Seele auf diese Weise geschützt?«
Der Priester war erschüttert. Er mochte den illegitimen Sohn des Burgherrn nicht und fürchtete ihn, den halben Bastard Krau, auf herkömmliche Weise. Krau war ein Rüpel. Hatte Beljunion ihm für sein erstes Blut eine Buße auferlegt? Wenn ja, dann hatte dieser sie nicht befolgt - oder vielleicht hatte sie sein grässlicher Zwerg (der seit drei Jahren sein Spielzeug war) an seiner Stelle vollzogen.
»Hier geht es um Eure Sünden und Bedürfnisse, Mechail, nicht um die Eures Bruders.«
Beljunion trat vom Altar zurück, ging zum Lettner und trat hinter ihn. An der Wand, flankiert von den vergoldeten Gesichtern zweier Heiliger, stand der mit Schnitzereien verzierte und bemalte Schrank mit dem geweihten Wein.
Der Priester bekreuzigte sich, öffnete den Schrank und nahm den Kelch heraus. Er war aus Eisen, kalt und schwer. Der Bodensatz darin sah schwarz aus, und ein scharfer, saurer Geruch stieg davon auf. Er bedauerte, dass der Wein von so armseliger Qualität war. Andererseits war auch das, was bei Tisch aufgetragen wurde, kaum erlesener.
Als er sich zu Mechail umwandte, um ihm den Versöhnungstrunk zu reichen, wurde der alte Priester von alten Erinnerungen überwältigt. Sie veranlassten ihn stehenzubleiben, den Kelch in Händen.
Wozu daran denken? An dieses absonderliche, betörende, verwirrende und unschickliche Wesen? Es lag nicht am Opferritus - den hatte er längst verdrängt, als etwas, womit er sich abfinden musste, um die Korhlen in anderer Beziehung zu retten. Das war es nicht. Es war der kniende Mann, das Gewicht des Kelches...
Seine Aufnahme in die niederen Ränge der Priesterschaft hatte in Khish stattgefunden. Damals war ihm die Stadt bedeutend vorgekommen. Seltsamerweise hatte er inzwischen, mit der Distanz der Jahre und nachdem man ihn wieder in die Wildnis der Wälder zurückgeschickt hatte, eingesehen, dass Khish nichts Besonderes gewesen war.
Die Kirche war grau, durchlöchert und bröckelig wie frischer Käse. Drei Stunden lang hatte er während der Nachtwache zusammen mit den anderen auf dem eiskalten Boden vor dem düsteren Hochaltar gekniet. Dort mussten sie ausharren, bis die Priesterweihe wie ein goldener Wind über sie kam, mit Kerzen und Gesang.
Dann die Wandlung, in deren Verlauf sich der Wein auf magische Weise in das Blut Christi verwandelte, die Verwandlung von Männern in Priester.
Wochenlang hatte er gefastet und gebetet. Endlosen Prüfungen hatte man ihn unterzogen, seinen Glauben auf die Probe gestellt und ihn gefoppt, bis man sich seiner sicher war.