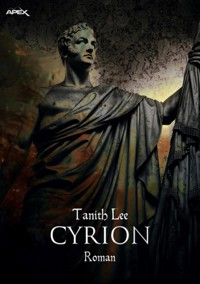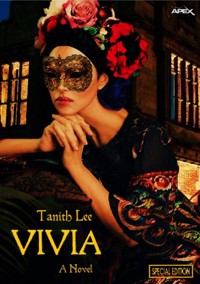6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schwarz wie Tinte, weiß wie Frost – rot wie Blut.
Das Märchen von der guten Stiefmutter und dem bösen Schneewittchen; das Märchen von dem schlafenden Dornröschen, das man besser nicht aufgeweckt hätte; das Märchen vom Roten Tod um Mitternacht, der einfach nicht kommen wollte; und sechs weitere bizarre Geschichten zwischen Fantasy, Horror und Science Fiction – düster-melancholische Märchen, wie sie die Gebrüder Grimm nicht zu erzählen wagten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
TANITH LEE
Rot wie Blut
Die Märchen der Geschwister Grimmig
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Das Buch
Der Rattenfänger von Lindendorf (Asien: Letztes Jahrhundert v. Chr.)
Rot wie Blut (Europa: 14. Jahrhundert)
Dornen (Eurasien: 15. Jahrhundert)
Wenn die Stunde schlägt (Europa: 16. Jahrhundert)
Die goldene Leiter (Europa: 17. Jahrhundert)
Die Prinzessin und ihre Zukunft (Asien: 18. Jahrhundert)
Wolfsland (Skandinavien: 19. Jahrhundert)
Schwarz wie Tinte (Skandinavien: 20. Jahrhundert)
Schönheit (Erde: Zukunft)
Die Autorin
Tanith Lee.
(* 19. September 1947, + 24. Mai 2015).
Tanith Lee war eine britische Horror-, Science Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin und Verfasserin von Drehbüchern. Sie wurde viermal mit dem World Fantasy-Award ausgezeichnet (2013 für ihr Lebenswerk) und darüber hinaus mehrfach für den Nebula- und British Fantasy-Award nominiert.
Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie über 90 Romane und etwa 300 Kurzgeschichten. Sie debütierte 1971 mit dem Kinderbuch The Dragonhoard; 1975 folgte mit The Birthgrave (dt. Im Herzen des Vulkans) ihr erster Roman für Erwachsene, der zugleich auch ihren literarischen Durchbruch markierte.
Tanith Lees Oevre ist gekennzeichnet von unangepassten Interpretationen von Märchen, Vampir-Geschichten und Mythen sowie den Themen Feminismus, Psychosen, Isolation und Sexualität; als wichtigsten literarischen Einfluss nannte sie Virginia Woolf und C.S. Lewis.
Zu ihren herausragendsten Werken zählen die Romane Trinkt den Saphirwein (1978), Sabella oder: Der letzte Vampir (1980), Die Kinder der Wölfe (1981), Die Herrin des Deliriums (1986), Romeo und Julia in der Anderswelt (1986), die Scarabae-Trilogie (1992 bis 1994), Eva Fairdeath (1994), Vivia (1995), Faces Under Water (1998) und White As Snow (2000).
1988 gelang ihr mit Eine Madonna aus der Maschine (OT: A Madonna Of The Machine) ein herausragender Beitrag zum literarischen Cyberpunk; eine Neu-Übersetzung der Erzählung wird in der von Christian Dörge zusammengestellten Anthologie Cortexx Avenue enthalten sein.
Ihre wichtigsten Sammlungen von Kurzgeschichten und Erzählungen sind: Red As Blood/Tales From The Sisters Grimme (1983), The Gorgon And Other Beastly Tales (1985) und Nightshades: Thirteen Journeys Into Shadow.
Tanith Lee war seit 1992 mit dem Künstler John Kaiine verheiratet und lebte und arbeitete in Brighton/England.
Sie verstarb im Jahre 2015 im Alter von 67 Jahren.
Der Apex-Verlag widmet Tanith Lee eine umfangreiche Werkausgabe.
Das Buch
Schwarz wie Tinte, weiß wie Frost – rot wie Blut.
Das Märchen von der guten Stiefmutter und dem bösen Schneewittchen; das Märchen von dem schlafenden Dornröschen, das man besser nicht aufgeweckt hätte; das Märchen vom Roten Tod um Mitternacht, der einfach nicht kommen wollte; und sechs weitere bizarre Geschichten zwischen Fantasy, Horror und Science Fiction – düster-melancholische Märchen, wie sie die Gebrüder Grimm nicht zu erzählen wagten.
Der Rattenfänger von Lindendorf
(Asien: Letztes Jahrhundert v. Chr.)
An dem späten Sommernachmittag lag der Fluss schmal und seicht zwischen den glattgeschliffenen Steinen Ein junges Mädchen kniete dort und wusch ihr langes schwarzes Haar. Sie hieß Cleci und war vierzehn Jahre alt.
Oben auf dem linken Ufer standen dicht beieinander einige Linden. Ihre Blätter bedeckte eine feine Schicht von Sommerstaub, der wie Rauch in der Luft hing. Hinter den Bäumen lag die Siedlung, die man nach ihnen benannt hatte - Lindendorf. Es war ein großes, weitläufiges, wohlhabendes Dorf mit vielen engen Straßen und offenen Plätzen und inmitten der eigenen Weizenfelder gelegen. Auf der rechten Seite des Flusses endeten diese Felder an den zu Lindendorf gehörenden Weingärten, wo die roten Trauben an den Stöcken reiften.
Lindendorf kannte auch den Grund für seinen Wohlstand. Man verehrte dort nämlich Raur, den Rattengott, und dafür hielt Raur sein Volk im Zaume. Mochten andere Ortschaften unter Ungeziefer zu leiden haben, das die Felder heimsuchte und in die Kornspeicher eindrang, nicht aber Lindendorf. In Lindendorf brachte man Raur Geschenke in seinen weißgetünchten Tempel bei der Furt, und nach der Ernte huldigte man ihm dankbar mit Weizengarben, Äpfeln und Wein.
Beim letzten Frühlingsfest war Cleci, zusammen mit dreißig anderen jungen Mädchen, zur Jungfrau Raurs geweiht worden. Das geschah mit all den zahlreichen Töchtern des Dorfes, sobald sie um die vierzehn Jahre alt waren. Es bedeutet, dass sie das Allerheiligste betreten und zum ersten Mal einen Blick auf Raur werfen durften. Cleci fand ihn wunderschön, denn er war recht groß, aus reinweißem Marmor gemeißelt und hatte Augen aus rosafarbenen Opalen. Sein Rattengesicht wirkte klug und wohlwollend. Die reichen Leute des Dorfes hielten sich weiße Pelzratten in vergoldeten Käfigen, und Cleci hatte beschlossen, sich auch eine solche weiße Pelzratte anzuschaffen, mit der sie reden und spielen konnte. Sie begann die Münzen zu sparen, von denen sie selten genug eine bekam. Sie war die Tochter der Waschfrau, und ihr Vater war tot. Sie holte die schmutzige Wäsche ab, half dabei, sie in den Wannen mit kochend heißem Wasser zu waschen, im Hof zum Trocknen aufzuhängen, und trug sie anschließend wieder in die Häuser zurück, aus denen sie sie abgeholt hatte. Schon jetzt waren ihre Hände rau, und sie versteckte sie hinter ihrem Rücken, wenn sie zum Tempel ging, weil sie an Raurs seidenweiche Pfoten denken musste.
Jeder fünfte Tag war der Verehrung des Gottes gewidmet, aber im Winter, im Frühling und im Spätsommer gab es ein großes Fest. Zu diesen Anlässen schmückte Lindendorf sich mit Bändern und Fahnen. Man aß und trank und tanzte in den Straßen. Raurs verschleiertes Bildnis wurde aus dem Tempel geholt - es war den Lindendorfern nur zu bestimmten Gelegenheiten gestattet, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten -, und die Priester trugen ihn auf ihren Schultern die Straßen hinauf und hinunter. Zu guter Letzt bewegte sich die Prozession über die Felder, um ihnen den Segen des Gottes zuteilwerden zu lassen. Wenn dann die Nacht hereinbrach, gab es Freudenfeuer und Gesang. Cleci freute sich auf das Sommerfest, das inzwischen bis auf einen Tag herangerückt war.
Deshalb hatte sie sich auch für diese eine Stunde von der Arbeit davongestohlen, um sich die Haare zu waschen. Ihrer Mutter war Sauberkeit bei der Wäsche zahlender Kunden wichtiger. Aber Cleci hatte ihr Haar jetzt ausgespült, saß am Ufer und kämmte es trocken, bis die dunklen Strähnen in den breitgefächerten Strahlen der untergehenden Sonne schimmerten. Während sie damit beschäftigt war, zählte sie in Gedanken ihre Münzen. Leider waren es nur zehn, und vom Zählen wurden es nicht mehr. Dabei würde sie ungefähr zwanzigmal so viel brauchen, um eine weiße Ratte von den Priestern kaufen zu können.
Plötzlich verstummten all die Vögel in den Linden. Und ein neuer Vogel begann zu singen.
Cleci hob den Kopf und fragte sich erstaunt, was das für ein Vogel sein mochte. Seine Stimme war reicher und volltönender als die jedes anderen Vogels, den sie bisher gehört hatte. Und, wenn möglich, noch lieblicher. Dennoch musste eine Vogelkehle diese Triller und perlenden Wasserfälle aus Musik hervorbringen, denn nur die Stimme eines Lebewesens konnte so natürlich klingen, so fremd und so wundervoll. Dann zerfloss die Melodie in eine doppelte Kaskade makellos harmonierender Töne, verfiel in einen wilden, tänzerischen Rhythmus und kam am rechten Flussufer entlang auf sie zu. Sie erkannte, dass es doch kein Vogel sein konnte. Unwillkürlich stand sie auf, um besser sehen zu können. Und so erblickte sie den Flötenspieler.
Ein- oder zweimal waren in der Vergangenheit Musikanten - Flötenspieler, Lautenschläger - durch Lindendorf gekommen. Aber keiner von ihnen hatte gespielt wie dieser. Oder so ausgesehen wie dieser.
Sein Haar reichte ihm bis auf die Schultern und war von einem eigenartigen dunklen Rot, wie sie es noch bei niemandem gesehen hatte. Auch wogte es bei jedem Schritt voll und geschmeidig um sein Gesicht, wie Gräser, Wolken oder Rauch im Wind... seine Haut war hell, ohne die mindeste Sonnenbräune und seine Augen so blau wie die Feme. Seine Hosen waren gleichfalls blau, aber blau wie ein stürmischer Himmel, und seine ärmellose Jacke hatte die dunkelrote Farbe von altem Wein. Die Flöte war aus hellem, glattem Holz und hing an einer Schnur um seinen Hals. Er war jung, doch irgendwo im Hintergrund seiner Augen wirkte er viel älter. Sein Lächeln aber zählte nicht mehr Jahre als Cleci.
»Wer bist du?«, fragte er Cleci, nachdem er sie angelächelt und durch dieses Lächeln mit einer unbegreiflichen Freude erfüllt hatte.
»Ich bin Cleci. Wer bist du?«
»Wer glaubst du denn, der ich bin?«
»Ich glaubte, ein Vogel würde singen.«
»Ach«, sagte der Flötenspieler. Er legte den Kopf in den jungen, starken Nacken und blickte in die Baumkronen hinauf. Und auf einmal flogen drei oder vier Vögel von den Ästen, schwebten über den Fluss und ließen sich, sacht wie Blütenblätter, auf seinen Schultern nieder.
»Oh«, meinte Cleci. »Oh.«
»Oh, ja«, sagte der Flötenspieler. Die Vögel küssten ihn mit ihren scharfen, spitzen Schnäbeln auf die Lippen. Andere Vögel kamen herbei und hüpften vor seinen Füßen durch das Gras. Eine Schlange wand sich um sein Bein. Ein Schmetterling flatterte in seinem Haar.
»Oh«, seufzte Cleci.
»Ich sah einen Tempel bei der Furt«, bemerkte der Flötenspieler. »Zu wem betet ihr dort?«
Cleci blinzelte.
»Zu Raur«, erwiderte sie mit unwillkürlichem Stolz in der Stimme. »Dem Rattengott.«
»Warum?«, fragte der Flötenspieler.
Eine große Stille breitete sich nach dieser Frage aus, als warte alles ringsum auf ihre Antwort.
»Weil...«, antwortete Cleci. »Weil er seinen Geschöpfen verbietet, uns Schaden zuzufügen. Und weil - er schön ist.«
»Ist er das?«
Der Flötenspieler schaute sie an. Plötzlich schämte sie sich. Sie wusste nicht, weshalb. Sie sah zu Boden und sagte: »Entschuldigt mich bitte. Ich muss nach Hause.« Und dann drehte sie sich um und lief, geradewegs durch den seichten Fluss, über die schlüpfrigen Steine und das Ufer hinauf. Sie lief unter den Linden hindurch zum Dorf. Sie hatte Angst.
Als sie bei dem kleinen Haus ihrer Mutter angelangt war, wurde sie von der Waschfrau gescholten. Weil sie davongelaufen war, weil sie ihr Haar gewaschen hatte. Während der gesamten Strafpredigt dachte Cleci an den Flötenspieler. Während des Abendessens dachte sie an ihn. Und als der Tag durch einen dunkelroten Spalt im Westen verschwand und im Osten das Blau des Abends heraufzog, dachte Cleci immer noch an ihn. Aber inzwischen war ihre Angst verflogen und hatte einer merkwürdigen Enttäuschung Platz gemacht. Sie glaubte jetzt, am Fluss eingeschlafen zu sein und ihn nur geträumt zu haben. Sie wagte nicht, ihrer Mutter davon zu erzählen, denn ihre Mutter würde sie höchstens noch einmal ausschimpfen. Weil sie geträumt hatte, und dann auch noch von einem jungen Mann. Oder war er gar nicht so jung, wie er aussah? Konnte es möglich sein, dass er so alt war wie dieses Etwas in seinen Augen? »Du«, würde ihre Mutter sagen, »hast mit zehn Jahren davon geträumt, eine Prinzessin zu sein. Wenn ich einmal eine Prinzessin bin, hieß es dauernd. Die Arbeit mit der Wäsche hat dich davon kuriert. Dann wolltest du eine Priesterin Raurs werden. Als ob sie dafür jemanden, ob Junge oder Mädchen, nehmen würden, der nicht aus eines reichen Mannes Hause stammt. Dann, als dir an dem Tag deiner Weihe zur Dienerin Raurs im Haus des Müllers eine weiße Ratte zu Gesicht kam, hast du von nichts anderem mehr geredet als davon, eine weiße Ratte anzuschaffen, die wir uns niemals leisten könnten. Und jetzt hast du am Fluss einen wunderschönen jungen Flötenspieler getroffen. Und das soll ich glauben!« Nein. Cleci konnte ihrer Mutter nichts sagen, denn genau das würde ihre Mutter antworten und damit auch noch Recht haben. Der Gedanke, dass er nur ein Traum gewesen war, machte Cleci traurig. Denn es sollte Menschen wie ihn auf der Welt geben.
»Du hast dein Abendbrot nicht gegessen«, schimpfte Clecis Mutter. Die Waschfrau packte das Brot und den Käse ein und legte beides für den nächsten Tag beiseite.
Cleci trat an die offene Tür und blickte auf die enge Straße hinaus. Oben neigten sich die Dächer der gegenüberstehenden Häuser zueinander, und der dunkler werdende Himmel lastete auf dem Zwischenraum.
Plötzlich begannen alle Hunde in Lindendorf, und es war eine ganze Menge, zu bellen, zu winseln und zu heulen.
»Was ist denn los?«, wunderte sich die Waschfrau, als sie die Tonlampe entzündete. »Die Biester hören sich an wie ein Rudel Wölfe.«
Aber die Hunde waren schon wieder still. Denn schmeichelnd wie die kühle Luft strömte Welle auf Welle eine wunderbare Melodie die Straße entlang. Es war ein Abendlied, zart und doch durchdringend wie die ersten Sterne, die am Himmel aufgingen. Die Flöte klang jetzt tiefer, dunkler, so alt wie die Erde oder beinahe so alt.
Licht fiel über Clecis Schulter auf die Straße. Sie bemerkte, dass die Mutter mit der Lampe in der Hand hinter sie getreten war.
»Also -« meinte Clecis Mutter, »wer kann das sein? Auf jeden Fall versteht er sein Handwerk, wer immer er auch ist.« Der Flötenspieler schritt so geschmeidig wie ein Luchs die Straße entlang, doch bei jedem fünften oder siebten Schritt machte er einen kleinen Hüpfer, und die Melodie hüpfte mit ihm. Er hielt die Flöte seitlich an die Lippen, und seine Wangen veränderten kaum die Form, während er blies.
Immer mehr Lichter gingen an, als die Leute an die Fenster und Türen kamen, um nachzusehen, was es gab. Anfangs wurde kein Wort gesprochen, nur geschaut. Aber das änderte sich bald. Denn wie Nebelschwaden folgten dem Flötenspieler fast alle Hunde aus Lindendorf, alle, denen es gelungen war, sich von ihren Leinen zu befreien. Und die Hunde kämpften nicht untereinander, sahen sich nicht einmal an, sondern folgten nur gleitend dem Klang der Flöte - eine buntscheckige, vierbeinige Armee.
Entlang der Straße hörte Cleci die Rufe und Flüche, die den merkwürdigen Zug begleiteten. Dann setzte der Strom. der Musik wieder ein und füllte all die Löcher, die diese Geräusche in der Atmosphäre verursacht hatten. Clecis Mutter sprach kein Wort, aber sie stieß einen lauten Seufzer aus, als hätte sie ihr ganzes Leben lang die Luft angehalten und könnte nun endlich ausatmen. Sie legte die freie Hand auf Clecis Schulter, und zum ersten Mal war es eine bewusste und zärtliche Berührung.
Gerade in diesem Augenblick kam der Flötenspieler an ihrer Tür vorbei. Er legte den Kopf schief und sah sie an, sagte aber nichts. Cleci hätte ihn. gerne berührt, um sich zu überzeugen, dass es ihn wirklich gab. Dann war er vorüber.
Pfoten glitten über Clecis Füße.
Die Leute standen auf der Straße und starrten dorthin, wo die wunderbare Musik wie ein zarter Duft verwehte.
»Wohin geht er?«, hörte sie jemanden fragen. Sie hatten nicht daran gedacht - oder es nicht gewagt -, den Flötenspieler selbst zu fragen.
»Zum Haus des Müllers, wie's scheint.«
Der Müller war einer der bedeutenden Bürger von Lindendorf, da er zu den Reichsten gehörte. Sein ältester Sohn war einer der Priester des Rattengottes.
»Habt ihr die Hunde gesehen?«
»Die Hunde waren hinter etwas Fressbarem her, das er in den Taschen hatte.«
»Was will er hier?«
»Woher soll ich das wissen? Warum fragst du mich?«
»Morgen ist Festtag. Vielleicht will er zum Tanz aufspielen. Und sich eine goldene Nase verdienen.«
»Ja. So wird es sein.«
»Ah.«
Cleci spürte eine seltsame Erregung hinter ihren Rippen, wie Schmerz. Sie wollte schreien oder lachen oder singen. Sie wollte so still sein wie ein Stein.
»Er ist nur ein Vagabund«, sagte ihre Mutter plötzlich, und Cleci drehte sich um und sah ihre Mutter als eine abgearbeitete Fremde mit rissigen Händen, der das fettige Haar in die todmüden Augen hing. »Nur einer von diesen Bettlern.« Und Cleci hasste ihre Mutter mit einem stumpfen und erdrückenden Hass.
Ein letzter Hund huschte lautlos die Straße entlang, auf der Fährte der unsichtbaren Flut aus Musik, die dort entlanggeströmt war.
Cleci nahm ihr weißes Jungfrauengewand aus der Truhe und zog es an. Es war noch nicht hell, deshalb konnte sie einfach übersehen, dass das Weiß verblasst war. Sie legte sich ein rotes Band um die Taille. Die Frau des Bäckers hatte es ihr geschenkt, weil es einen Riss hatte, aber wenn man beim Binden aufpasste, war der Riss nicht zu sehen.
Ihre Mutter brummte ungehalten, weil sie am heutigen Tag nicht arbeiten durfte.
Vielleicht einmal in jeder Stunde, jeweils in dem Augenblick, wenn sie in die nächste Stunde überging, war Cleci in dieser Nacht aufgewacht. Sie hatte darüber nachgedacht, was der Müller, der Bäcker und der Schmied und die anderen wichtigen reichen Männer zu dem Flötenspieler gesagt haben mochten. Sie hatte sich gefragt, ob der Flötenspieler Raurs Prozession anführen würde, was gelegentlich den allerbesten Musikanten gewährt wurde.
Noch bevor die Sonne aufgegangen war, hängte man in Lindendorf Fahnen aus den Fenstern - nur waren die Farben noch nicht zu erkennen - oder auch Bilder von Ereignissen, die mit dem Rattengott zu tun hatten: Raur, der eine Ratten- und Mäuseplage von dem Dorf abwandte, Raur, der gegen eine Riesenkrähe kämpfte, die aussah wie ein schwarzer Drache.
»Ich muss jetzt gehen«, sagte Cleci zu ihrer Mutter.
»Es werden genug Jungfrauen da sein«, rief Clecis Mutter geringschätzig. »Dich werden sie kaum vermissen.« Aber Cleci lief aus der Tür und auf die Straße.
Als sie zum Tempel eilte, stieg die Sonne über das verwinkelte Häusergewirr, und all die Fahnen öffneten sich wie Blumen und strahlten grün und rot und violett im Morgenlicht. Vergoldete Plättchen an langen Bändern sangen in dem leichten Wind, und kleine Abbilder von Raur, die aus Lehm oder Teig geknetet waren, tanzten an ihren Fäden.
Der Fluss hatte die Farbe des Himmels. Selbst die Linden wirkten wie mit kühlem Gold übergossen. Cleci pflückte eine Blütendolde - tötete sie gedankenlos, nur weil sie schön war - und steckte sie sich ins Haar.
Lindendorf war fruchtbar, und so gab es viele Kinder, viele junge Männer und Mädchen. Alles in allem hatte Raur in diesem Jahr ein Gefolge von einhundert Jungfrauen, denn ein Mädchen blieb in dieser Gruppe, bis es heiratete, was bei den meisten mit ungefähr fünfzehn Jahren der Fall war. Dann wurde sie eine Matrone Raurs.
Die Jungfrauen sammelten sich am Ufer über der Furt wie ein Schwarm weißer Enten. Als nächstes kamen die Jungen, mit Rattenmasken aus dünnem Holz, Holzschwertern, pergamentüberzogenen Tamburinen und Geschrei. Gleich würden die Priester Raur in die Morgensonne hinaustragen, die Jungfrauen und Knaben würden Raur ins Dorf zurück folgen, und dort würde sich die gesamte übrige Bevölkerung ihnen anschließen.
Kandierte Pflaumen wurden verteilt. Den Jungen bereitete es einige Schwierigkeiten, sie durch die Mundöffnungen ihrer Rattenmasken zu schieben. Die Jungfrauen aßen mit anmutigem Selbstbewusstsein und wischten ihre klebrigen Finger am Gras sauber. Heute war es nicht so wichtig, dass Cleci die Tochter der Waschfrau war. Einige der Mädchen redeten sogar mit ihr. Eine der Töchter des Bäckers bemerkte laut: »Wie hübsch das Band dich kleidet. Den Riss sieht man gar nicht.«
»Seht! Da ist unser erlauchter Vater!«, rief eine andere Tochter, laut genug, um den allgemeinen Lärm zu übertönen.
Lindendorfs führende Persönlichkeiten traten aus dem Tempel. Zuerst der Bäcker und der Metzger, dann der Müller, der Schmied und der Wagner. Den Schluss machte der Winzer. Cleci hielt angestrengt nach dem Flötenspieler Ausschau. Vielleicht würde er gleich herauskommen, zusammen mit den Priestern.
»Wird er nicht«, sagte die Bäckerstochter, und Cleci merkte, dass sie ihre Gedanken laut ausgesprochen hatte.
»Bestimmt nicht«, fügte die Tochter des Müllers hinzu. »Mein Vater sagt, er könne nicht zulassen, dass eine so unschickliche Musik vor den Ohren des Gottes gespielt werde. Nicht, dass er den Kerl spielen gehört hätte, aber Papa ist so klug, dass er das auch nicht braucht, um zu urteilen.«
Die kandierte Pflaume, die Cleci gegessen hatte, lag ihr wie ein Stein im Magen. Die Enttäuschung war schlimmer als Zahnschmerzen. Dann fühlte sie stattdessen eine überwältigende Freude. Gleichzeitig geriet die Menge in Bewegung.
Die Jungfrauen wirbelten herum wie Schneeflocken im Wind. Die Knaben wandten ihre Köpfe mit den spitzen, niedlichen Rattengesichtern. Die Priester, die sich gerade angeschickt hatten, aus der Tür des Tempels zu strömen, gingen schneller und reckten die Hälse, um besser sehen zu können.
Zwischen den letzten Häusern des Dorfes tauchte ein wunderschöner junger Mann in einer ärmellosen, weinroten Jacke und sturmblauen Hose auf. Seine Finger tanzten über die Flöte, die er seitlich an die Lippen hielt, aber der Tumult der Menge übertönte sein Spiel. Nur - nur fühlen konnte man die Musik, die gleich einer Lanze Luft und Sonnenschein, Blut und Fleisch und schließlich die Mauem um Herz und Seele durchdrang.
Das dunkelrote Haar wehte von seiner klaren, bleichen Stirn, und er lächelte, während er blies. Ihm folgte eine Springflut verschiedenartigster Geschöpfe - Hunde, ein Gewimmel kleiner Eidechsen, ein tieffliegender Vogelschwarm und sogar eine summende Wolke aus Insekten, Libellen, Schmetterlingen und Bienen. Da waren auch die zwanzig Esel, die es im Dorf gab, einer mit dem Sattel auf dem Rücken, die anderen mit durchgekauten Haltestricken. Und da waren Ratten - die kleinen, weißen, hüpfenden Ratten, die irgendwie - wie? - aus ihren Käfigen entkommen waren.
Der Anblick der Ratten, oder vielleicht war es auch die ungehörte, aber gefühlte Lieblichkeit des Flötenspiels, brachte die durcheinanderschwätzenden Stimmen zum Schweigen.
Und nun war die Musik zu hören.
Aber es war nicht mehr einfach Musik. Es war wie der Fluss, der Himmel, das Land. Wie der Pulsschlag der Menge, der Trommelwirbel des Lebens selbst und wie die Sonne, die sich auf den Klingen von Zeit und Raum um die eigene Achse drehte. Es war mehr an Musik, als ein einzelner Flötenspieler dem schlanken Rohr einer einzelnen Flöte entlocken konnte.
Als die Musik verstummte, standen sie alle hilflos da, als hätte ein stilles Meer sie unvermittelt an ein felsiges Ufer geworfen oder als wären sie alle taub geworden.
Erst jetzt bemerkte Cleci, dass die Statue Raurs aus dem Tempel herausgetragen worden war, und schämte sich, weil es ihr nicht früher aufgefallen war. Nun saß Raur da, auf seiner mit Girlanden geschmückten Bahre, die die Priester auf den Schultern trugen, und war so still wie alle anderen. Als hätte auch ihn die Flöte verzaubert.
Langsam senkte der Flötenspieler sein Instrument. Er schaute in die Runde. Cleci konnte nicht anders als ihn bewundern für seine gelassene Haltung, Selbstsicherheit und den Charme angesichts der vielen hundert Augen, die auf ihn gerichtet waren. Dann erhob einer der reichen Männer grollend die Stimme und zog damit alle Blicke auf sich. Es war der Müller.
»Wie«, fragte der Müller, zornrot im Gesicht, ohne eine Spur von Haltung, nicht besonders selbstsicher und ganz bestimmt nicht charmant. »Wie hast du unsere Ratten aus den Käfigen gestohlen?«
Aus der Menge ertönte zustimmendes Gemurmel, und jemand rief aus dem Hintergrund: »Und wie ist das mit dem Reitesel von meinem Vater und so?«
Dann ein Durcheinander von Stimmen. Wie dies? Wie das?
Der Flötenspieler wartete, bis sie schließlich mit dem Geschrei aufhörten.
Dann sagte der Flötenspieler zu den Einwohnern von Lindendorf, und jeder hörte ihn, obwohl er nicht die Stimme erhob: »Ihr versucht alles in einen Käfig zu sperren. Eure Tiere und eure Herzen. Aber Liebe findet immer einen Weg hinaus. Liebe oder Hass. Irgendwie.«
Cleci schloss die Augen. Sie umklammerte die Worte wie einen Edelstein. Sie verstand ihre Bedeutung nicht, aber sie hielt sich an ihnen fest. Dann hörte sie den Flötenspieler sagen: »Also entscheidet euch jetzt. Soll ich euch aufspielen oder nicht?«
Und Cleci schrie mit aller Kraft: »Ja! Ja! Ja!«
Darin zuckten ihre Hände zu den brennenden Wangen, und ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. Aber ihr Schreck war unnötig, denn die ganze Menschenmenge hatte in genau demselben Moment aufgeschrien wie sie, und di selben Worte.
Sogar der Müller hatte sich hinreißen lassen, obwohl er verwirrt aussah und sich sofort zu den Priestern umdrehte, um mit ihnen zu sprechen. Der Priester, der der Sohn des Müllers war, nickte, trat vor und hob Aufmerksamkeit heischend die Hände. Mit sichtlichem Unbehagen sprach er den Flötenspieler an.
»Wir sind willens, dir zu gestatten, zu Ehren des Gottes für uns zu spielen. Aber was verlangst du als Bezahlung?«
»Was immer ihr glaubt, dass ich es verdient habe.«
»Nich doch. Das ist eine Aufforderung zum Feilschen.«
»Habt keine Angst«, sagte der Flötenspieler. »Ich werde nichts fordern, was ihr mir nicht geben könnt.«
Und er lächelte das Lächeln, das nur vierzehn Jahre zählte, und seine Augen waren viele hundert Jahre alt.
Einer der Priester quiekte, und Cleci sah, dass auch die weißen Ratten im Tempel sich aus ihren Käfigen befreit hatten. Es waren ungefähr fünfzig an der Zahl, und sie huschten unter die Gewänder der Priester und über ihre Zehen, um in die Nähe des Flötenspielers zu gelangen.
»Raur selbst, scheint es, hat dich erwählt, Vorauszahlung oder nicht«, sagte einer der älteren Priester, und die Anspannung wich aus seinem Gesicht. Ein langgezogener, freudiger Seufzer stieg aus der Menge auf, und in diesem Augenblick erschien der flammende Rand der Sonne über dem Dach des Tempels.
Sie trugen Raur durch jede Straße, jede Gasse und über jeden Platz. An den Türen und fahnengeschmückten Fenstern vorbei. Unter Torbögen hindurch, wo Bänder und Blumen mit ihnen tanzten. Um die zwei Brunnen herum. Die Treppen hinauf.
Nicht ein Fleckchen in Lindendorf, wo man einen Fuß hinsetzen konnte, wurde ausgelassen. Die Priester schritten würdevoll, die Männer gingen, und die Frauen und Mädchen tanzten. Die Knaben schlugen ihre Tamburine, und die Priesterinnen klingelten mit ihren Glöckchen. Sie alle aber führte der Flötenspieler, nicht gehend, nicht tanzend, nicht schreitend, sondern ein bisschen von allem. Und die Flöte sang wie die Stimme des Tages, wie die Stimme der fruchtbaren Erde.
Es war Mittag, als sie den großen Platz erreichten, wo das Fleisch briet und das frischgebackene Brot knusprig aus den Öfen kam. Niemand war müde. Irgendwie wippten ihre Füße ganz von selbst im Takt der Musik oder machten kleine Tanzschritte. Dann wurden die Krüge mit Wein gebracht. Selbst die Jungfrauen tranken Wein. Eine pelzige Ratte kam und setzte sich auf Clecis Arm, und sie fütterte das Tierchen und ergötzte sich an der Art, wie es die Brotstückchen zwischen den Pfoten hielt und daran knabberte wie ein Eichhörnchen.
Vögel belagerten wie Schneewehen im Sommer jeden Sims und jedes Dach. Hunde spielten Fangen und Verstecken.
Eidechsen sonnten sich furchtlos. Es gab keinen Streit. Der Bäcker wollte dem Metzger das beste Stück Fleisch zuteilen. Der Metzger bestand darauf, dass der Bäcker es bekommen sollte. Die Tochter des Müllers sagte schüchtern zu Cleci: »Du bist viel hübscher als jedes andere Mädchen hier.« Und sie gab Cleci ihre eigene blaue Schärpe, die sechs Zentimeter breit war und keinen Riss hatte.
Dann gingen sie weiter, und das Lied der Flöte, das irgendwie nie verstummt war - oder hatten sie sich das nur eingebildet, denn natürlich musste der Flötenspieler sein Instrument abgesetzt haben, um auch etwas zu essen und zu trinken -, stieg in den Himmel wie ein goldener Vogel, und all die goldenen Vögel schwangen sich mit ihm empor.
Sonnenflecken lagen wie schimmernde Münzen auf der Straße. Cleci tanzte Hand in Hand mit der Tochter des Müllers und der Tochter des Bäckers.
Als die Prozession das Dorf hinter sich gelassen hatte und die Menschen die Felder sahen, die sich gleich gelben Feldern bis in den blauen Himmel hinein erstreckten, lachten sie vor Freude. Es war alles so überwältigend und so neu für sie. Obwohl sie diese Dinge an jedem Tag ihres Lebens vor Augen gehabt hatten, sahen sie sie heute zum ersten Mal.
Sie tanzten über die Felder, eingehüllt in Sonnenschein. Auch die Priester tanzten jetzt, trotz des Gewichtes der marmornen Götterstatue, das auf ihren Schultern lastete. Wilde Blumen leuchteten zwischen den gelben Weizenhalmen. Die Jungfrauen strichen mit den Fingern darüber hin, ohne sie aber abzureißen.
Cleci berührte die Blütendolde in ihrem Haar, und ihre Augen füllten sich mit Tränen, weil sie wusste, dass die Blüte ihr vergab, obwohl sie sie durch ihr unbedachtes Handeln getötet hatte. Und sie schaute sich um, ob sie ihre Mutter entdecken konnte, in der großen, tanzenden, schimmernden Menschenmenge, die wie mit Gold überstäubt schien. Als Cleci die Waschfrau nicht finden konnte, sprach sie mit ihren Gedanken zu ihr: Ich liebe dich. Wirklich. Und sie stellte sich vor, wie sich das müde, reizbare Gesicht der Mutter glättete und wieder so aussah, wie es seit dem Tod des Vaters nie mehr ausgesehen hatte. Aber dann verflogen im Wirbel des Tanzes auch alle Kümmernisse.
Von all den Pfaden durch die Felder, die begangen werden konnten, blieb nicht einer unbenutzt. Sie überquerten den Fluss, und die Musik und ihre Stimmen waren laut unter dem Himmel. Dann stiegen sie zu den Terrassen empor, wo die Reben in weichem Rostrot erglühten, und der Flötenspieler führte sie zwischen den Stöcken hindurch.
Körbe mit Süßigkeiten und Trauben, Lederflaschen mit Wein wanderten die Reihen der Tanzenden entlang. Niemand hatte das Bedürfnis nach einer Rast. Sie waren jetzt weniger müde als am Mittag. Müdigkeit war ihnen fremd. Sie konnten bis in alle Ewigkeit weitertanzen.
Und auch die Priester lachten. Alle lachten. Oder war es die Flöte, die lachte?
Und dann begann der Tag sich zu verabschieden. Es mutete seltsam an, denn es hatte so ausgesehen, als würde auch der Tag ewig dauern. Aber es war ein herrlicher Abschied: Die Sonne barg sich hinter einem rosafarbenen Schleier, ein violetter Schimmer erfüllte den gewaltigen Himmel, und die ersten Sterne hingen wie glitzernde Vögel in der Unendlichkeit.
Dann wurden die Fackeln entzündet. Die Lindendorfer stellten ihren Gott auf den grasbewachsenen Abhang zwischen Weinbergen und Weizenfeldern. Auf die Ellenbogen gestützt lagen sie auf dem duftenden Rücken der Welt und beobachteten den letzten Sonnenstrahl, der noch über dem Fluss und dem Dorf am anderen Ufer des Flusses zögerte. Und das Dorf glomm wie eine brennende Rose, für den einen Augenblick, bevor die Dämmerung die Helligkeit trank.
Lebe ich HIER?, fragte Cleci sich erstaunt. An einem so wunderschönen Ort?
Ein Hund legte sich über ihre Beine, und sie küsste. ihn auf den Kopf.
Und dann dachte sie über die Musik der Flöte nach, wie sie nicht so sehr die Ohren verzauberte, sondern die Menschen dazu brachte, zu sehen, zu fühlen und zu wissen. Und Cleci wusste jetzt so viel: Sie wusste, dass die Welt ihr gehörte und dass sie sie lieben und achten musste, auf dass die Welt auch sie lieben möchte. Und sie wusste, dass sie ewig leben würde, auch wenn ihr Körper starb. Und sie wusste, dass sie und alle Männer und Frauen und alle Tiere und alles das lebte, nur geboren war, um glücklich zu sein.
Dann verstummte die Flöte.
In der alles beherrschenden Stille hörte sie den Abendwind über die Hügel wehen. Sie saß im Gras und lächelte, als wäre sie gerade aus einem herrlichen Traum erwacht, den sie nie vergessen würde. Und da war kein Gesicht in der Menge, wohin sie auch blickte, auf dem nicht dieser Ausdruck lag. Sie fühlte sich jünger als das jüngste Kind und älter als die Berge.
Der Flötenspieler stand ungefähr auf halber Höhe des Abhangs und war deutlich zu sehen. Der Wind hob einzelne Strähnen von seinem Haar hoch und ließ sie sacht wieder fallen. Sein Gesicht war so leuchtend und still wie die Abenddämmerung. Aber seine Augen, die die Farbe der Dämmerung hatten, glühten und funkelten. Sie waren voll unausgesprochener Gefühle. Gefühle, wie sie vielleicht nie ein Mensch gespürt hatte.
Und obwohl er über ihr auf dem Abhang stand, wunderte Cleci sich, dass sie dies alles auf diese Entfernung so genau erkennen konnte.
Einige der Priester und sämtliche bedeutenden Männer von Lindendorf schlenderten zu dem Flötenspieler hinauf. Sie gingen so gemächlich, wie sie sich auch nach einem guten Essen bewegt haben würden: zufrieden, genießerisch.
Cleci hörte ihre Stimmen mit derselben merkwürdigen Klarheit, die ihr die Augen des Flötenspielers gezeigt hatte.
»Nun, Flötenspieler, ich nehme alles zurück. Du bist ein Glücksfall, keine Frage. Ich habe nie jemanden so spielen gehört.«
»Und ich habe mich nach der Prozession noch nie so wohl gefühlt. Wo sind die Blasen, die ich immer kriege?«
»Ja. Und wo die geschwollenen Knöchel meiner Frau?«
»An ihren Füßen?«, meinte der Metzger mit Unschuldsmiene, und die reichen Männer johlten vor Vergnügen wie die Kinder und schlugen sich gegenseitig auf den Rücken.
»Das Fest ist noch nicht vorbei«, sagte der Bäcker. »Es gilt noch die Freudenfeuer zu entzünden und den besten Wein zu trinken. Aber ich bin der Meinung, dass wir dich jetzt schon bezahlen sollten, um dich für diesen wunderschönen Tag zu belohnen.«
»Ist das euer einziger Grund?«, fragte der Flötenspieler. Er hatte den Kopf erhoben, wie in Erwartung eines Schlages. In seinem Gesicht zeigte sich eine plötzliche, seltsame Spannung, als erinnerte er sich an einen lange zurückliegenden, aber nur zu wohlbekannten Schmerz.
»Oh, nur einer von vielen«, antwortete der Müller. »Du weißt, wie man sagt: Hat man den Musikanten bezahlt, kann man die Melodie bestimmen.«
»Nicht«, fügte des Müllers priesterlicher Sohn mit ängstlicher Höflichkeit hinzu, »dass die Melodien, die du bis jetzt für uns gespielt hast, nicht ganz einzigartig und wundervoll gewesen wären.«
»Nenne deinen Preis«, sagte der Winzer. »Was immer es sein mag. Gold, wenn es dir recht ist - ich bin sicher, dass wir da alle übereinstimmen. Ich werde sogar noch einen Krug von meinem besten Roten hinzufügen.«
»Ja, Gold. Und so viel Brot, wie du tragen kannst.«
»Einhundert Goldstücke, würde ich vorschlagen. Und freie Auswahl in meiner Schmiede.«
»Einhundertfünfzig. Und das Beste aus meinem Stall - auf meinem besten weißen Esel sollst du reiten.«
Ihren Worten folgte ein langes, lautloses Nichts. Der Wind erstarb, der Hund sprang von Clecis Knie. Sie hielt den Atem an, und genau wie damals am Fluss, als die Sonne unterging und sie ihn zum ersten Mal sah, verspürte sie eine überwältigende, beschämende Furcht.
Sie konnte kaum den Anblick von des Flötenspielers Gesicht ertragen, so außergewöhnlich, so jung, so alt, den unausweichlichen Schmerz erwartend. Sein ganzer Körper schien sich gegen den Schmerz zu wappnen. Als würde er langsam auseinandergerissen oder geschlagen oder von Dornen oder eisernen Nägeln durchbohrt.
Endlich sagte er leise, doch seine Stimme reichte bis in die Winkel des Himmels:
»Ich will nichts von alledem.«
Das unterdrückte Kichern der reichen Männer klang unbehaglich.
»Du willst doch nicht sagen, dass du umsonst gespielt hast?«
»Nein. Das will ich nicht sagen.«
»Nie gehört, dass einer über Gold die Nase gerümpft hat.«
»Was ich will, ist besser als Gold.«.
Die Priester schienen dichter zusammenzurücken, mit sich verschließenden Gesichtern und wachsamen Augen. Die reichen Männer lärmten immer noch herum.
»Also gut«, sagte der Müller. »Raus mit der Sprache, Bursche. Was willst du?«
Jedermann auf dem Hügel schien den Fehler des Müllers bemerkt zu haben. Sogar er selbst. Er hätte den Flötenspieler nicht mit Bursche anreden dürfen. Aber der Flötenspieler, in den Fesseln seiner langsamen unsichtbaren Qual, sagte nur: »Wisst ihr nicht, was ich will?« Er wandte den Kopf und betrachtete sie ernst. Niemanden in dieser gewaltigen Menge auf dem dunkler werdenden Hügel schien er zu übersehen. Und als er in Clecis Augen blickte, begann sie zu frieren.
»Wisst ihr es wirklich nicht? Seid ihr wirklich so blind? Könnt ihr wahrhaftig nur Handel und Käfige sehen? Nur beten, um eure Besitztümer zu schützen oder eure Bäuche zu füllen? Könntet ihr niemals beten aus der schieren Freude heraus, am Leben zu sein? Das«, sagte er, drehte sich um und deutete auf Raurs verhüllte Statue, die reglos und stumm im Gras stand, »das ist das Symbol eurer Ketten. Wollt ihr nicht frei sein?«
»Aber Raur ist schön«, flüsterte Cleci fast unhörbar. Doch sie wusste jetzt, dass er nicht so schön war wie das Leben, nicht so schön wie der Flötenspieler, noch Musik, noch die lebendige Erde. Raur bedeutete Sicherheit, nicht Freude. Oder nicht die echte Freude, die nur der Flötenspieler ihnen geben konnte.
Eine raschelnde Bewegung ging durch die Menge. Einige standen auf und andere setzten sich. Der Himmel über ihnen war beinahe schwarz.
»Entscheidet euch«, sagte der Flötenspieler. »Der Käfig oder die Welt.«
Der Müller schrie ihn an: »Heute war ein Fest. Du bist ganz brauchbar für Feiertage. Aber das kann doch nicht immer so weitergehen. Wir müssen arbeiten. Geld verdienen.«
»Seht euch die Blumen an«, meinte der Flötenspieler ruhig, »und die Sterne. Wie prächtig sie sind und wie gut sie leben. Und verdienen sie Geld, was meint ihr?«
Seine Stimme lächelte, aber man konnte hören, dass da ein Messer in ihm verborgen war, in seiner tiefsten Seele.
»Verführer!«, plärrte einer der Priester. »Gotteslästerer!«
Andere Priester nahmen den Ruf auf und plötzlich lärmte alles durcheinander. Nur hier und da weinte jemand, gewöhnlich eine Frau.
»Was ich mir als Belohnung wünschte«, sagte der Flötenspieler, und sie hörten seine Stimme sogar durch das Getöse, das sie veranstalteten, »war, dass ihr eure Liebe nicht mehr an dieses Bildnis einer Ratte verschwendet, die ganz bestimmt kein Gott ist, was immer ihr auch sagen mögt.«
Wütende Schreie gellten durch die Luft. Wieder sprach der Flötenspieler, und wieder hörten sie ihn.
»Aber ihr werdet mir meinen Lohn nicht zahlen, habe ich recht? Ihr werdet nicht euren Käfig öffnen und mir folgen.«
Von irgendwoher wirbelte ein Stein durch den Himmel, der auf das Gesicht des Flötenspielers gezielt war, dann noch einer und noch einer. Ein Hagel von Steinen und Erdbrocken ging auf ihn nieder und hörte dann auf, weil keines der Geschosse das Ziel getroffen hatte. Wie furchtsame Jämmerlinge, die einen angeketteten Löwen am Schwanz gezogen haben und dann feststellen, dass die Kette nicht festgemacht ist, fiel die Menge in sich zusammen. Die Priester warfen sich zu Füßen des Rattengottes nieder. Sie nahmen ihm den Schleier ab, und da war er, in all seiner marmornen Pracht, etwas, an dem die Leute sich festhalten konnten. Er bedeutete Vernunft und Sicherheit. Er würde die Ratten vertreiben und dafür sorgen, dass die Kornspeicher voll waren, dass einige reich wurden und alle davon träumen konnten. Er war die Gewähr dafür, dass es immer einen Gewinn geben würde, um darüber zu streiten, immer jemanden, der besser dran war, um ihn zu beneiden, immer jemanden zu betrügen, immer jemanden zu hassen. Und schlug dich einer ins Gesicht, so lehrte Raur die Ratte dich, dass es deine Pflicht war, zurückzuschlagen.
»Rette uns!« Die Priester und die Einwohner von Lindendorf schrien zu Raur und umarmten seinen kalten, glatten Körper.
Cleci erinnerte sich daran, wie sie ihre rauen Hände vor ihm versteckt und sich ihrer Armut geschämt hatte.
Schweigend beobachtete der Flötenspieler die Leute auf dem Hügel. Und wie zuvor breitete sein Schweigen sich bis zu ihnen aus, und ihr Lärmen verging wie das Licht der Fackeln, die aus irgendeinem Grund eine nach der anderen erloschen.
»Ich kann euch nicht zwingen«, sagte er schließlich. Sie hörten ihn alle, und manche von ihnen erschauerten. »Das hätte keinen Sinn.«
»Unser Gott beschützt uns«, kreischte jemand.
»Hebe dich hinweg, du böser Zauberer. Nimm deine Teufelsmusik und geh.«
Der Flötenspieler wandte sich ab. Es war seltsam. Er schien zu hinken. Vielleicht hatte einer der Steine ihn doch getroffen.
Alle die Sterne schienen zu sterben.
Irgendwo in den Tiefen der Menschenmenge keifte eine Frau: »Er ist nichts weiter als ein großes, unartiges Kind. Ein böses Kind, das eine Tracht Prügel braucht.«
Bei diesen Worten drehte der Flötenspieler sich noch einmal um. Sein Gesicht war ein weißer Fleck; in dem keine bestimmten Züge mehr zu erkennen waren.
»Müßte ich euch böse sein?«, fragte er leise. »Ja, vielleicht kann ich das sein. Ich hatte es vergessen. Was die Kinder betrifft... Euch konnte ich nicht dazu bringen, von diesem hässlichen Rattengott abzulassen. Aber es dauert mich, dass auch eure Kinder seine Sklaven sein werden:, wie ihr es schon seid. Ich glaube, ich werde euch eure Kinder nehmen.«
Auf dem Hügel, von dem der Tag, der Wind, die Sterne und alle Freude geflohen waren, zitterte die Menge.
»Ja«, sagte der Flötenspieler. »Mein Lohn. Nicht euer Gold und nicht eure Liebe. Eure Kinder werde ich nehmen.« Irgendjemand wimmerte.
Cleci riss die Augen auf, aber der Flötenspieler war nirgends mehr zu erblicken.
Dann wurde sie fest in den Arm gekniffen. Die Tochter des Müllers zischte sie an: »Du kleine Diebin. Du hast meine Schärpe gestohlen. Gib sie zurück, oder mein Vater wird dich in den Fluss tauchen lassen.«
Cleci riss sich das blaue Band vom Leib und warf es der Müllerstochter ins Gesicht. Cleci sprang auf, ohne zu wissen, was sie eigentlich wollte. Sie lief davon, hinauf in die nachtdunklen Weinberge.
Das einzige Licht in den Weinbergen schien Clecis matt schimmerndes weißes Kleid zu sein. Kein Mond war zu sehen. Und keine Sterne.
Schwarze Wolken mussten sich unter dem schwarzen Himmel gesammelt haben. Die Reben umgaben sie von allen Seiten - ebenfalls schwarz. Einmal hob sie den Fuß und blickte zu Boden und sah einen silbrigen Gegenstand. Eins von den Glöckchen der Priesterinnen, das während der Prozession verloren gegangen war.
Der Tag schien hundert Meilen weit entfernt, und sie wusste, er war näher. Sie musste nur, so kam es ihr vor, sich wünschen, ihn zu finden, und ihr Wunsch würde sich erfüllen. Aber sie fürchtete sich. Sie konnte es nicht ertragen, den Flötenspieler zu finden, obwohl sie gekommen war, um ihn zu suchen. Sie weinte und wischte sich die Augen mit ihrem Haar und ihren Ärmeln, bis der Geruch der Tränen den süßen Duft der Trauben verdrängte.
»Weine nicht«, sprach er endlich zu ihr aus der Dunkelheit.
»Warum denn nicht«, sagte sie. »Du hast alles verdorben.«
Sie hatte so viel Angst vor ihm, dass es einfach nicht möglich war, sich noch mehr zu fürchten. Deshalb sprach sie auf. diese Art zu ihm, obwohl sie inzwischen begriffen hatte, dass er nicht von dieser Welt war, sondern ein Gott.
»Es tut mir leid«, antwortete er aus dem Dunkel heraus, »aber ich würde es wieder tun.«
»Warum sollen wir dich lieben und nicht Raur?«, fragte sie ihn. »Warum?«
»Du weißt, warum. Von ihnen allen weißt du es.«
»Ja... weil er nur ein Stein ist. Aber du bist...«
»Ja. Ich bin.«
»Aber welchen Unterschied macht es dann für dich?«, fragte sie weiter, spürte Allmacht, Feuer, Äonen, und all das war sein.
»Weil - ganz einfach - ich sterben muss, wenn niemand an mich glaubt. Und wenn ich sterbe, Cleci, stirbt ein Stück Menschlichkeit mit mir.«
»Ja«, sagte sie. Sie seufzte und setzte sich in das Gras zwischen den Weinstöcken. Sie konnte die Trauben nicht erkennen und auch nicht sein Haar. Sonst hätte sie gesehen, dass beiden das nämliche Rot zu eigen war. »Könntest du«, fragte sie, »nicht Magie benutzen, um sie zu überzeugen?«
»Die Magie ist überall. Und sind sie überzeugt? Wasser kann in Wein verwandelt werden oder in Blut. Ich werde für sie sterben müssen, bevor sie an mich glauben.«
»Ich glaube an dich«, sagte sie.
»Das weiß ich. Deshalb bin ich hier.«
»Aber die Kinder«, sagte sie. »Du darfst dir nicht die Kinder nehmen.«
»Dich werde ich verschonen«, erwiderte er.
Sie entgegnete hitzig: »Ich bin kein Kind.«
Als er verhalten lachte, wusste sie ganz sicher, wie gefährlich er war. Die anderen waren entschlossen gewesen, nichts zu sehen, sie hatten die Augen verschlossen vor dem, was er wirklich war. Er war wie eine Schlange, die zusammengerollt im Schatten lag, glatt wie Bernstein und mit Tod in dem Mund, der Musik gemacht hatte.
»Du sprichst von Liebe, aber du bist grausam«, warf sie ihm vor.
»Ja. Liebe ist grausam, wenn sie zurückgewiesen wird. Es tut mir leid um euer Dorf, aber auch das würde ich wieder tun, wenn es getan. werden müsste. Man wird sich meiner erinnern. Irgendwie.«
»Sie werden sich falsch erinnern.« Sie schaute weg, über die Weinstöcke und in die Nacht. Sie wusste, dass sie ihn nie wieder in menschlicher Gestalt sehen- würde. »Wie«, fragte sie, »wirst du dir die Kinder holen? Wirst du die Flöte spielen und werden sie dir folgen, wie die Hunde und Ratten dir gefolgt sind? Wirst du sie mit deinem Spiel in das tiefe Wasser unterhalb der Furt locken, damit sie dort ertrinken?«
»Nein, Cleci«, antwortete er. »Es ist viel einfacher und grausamer als das. Aber dennoch, wenn du älter wirst, erinnere dich daran, dass ich versprochen habe, dich zu schonen, und das werde ich auch. Weil du an mich geglaubt hast und ich durch dich leben kann. Eine Zeitlang.«
»Wie lange hast du gelebt?«, murmelte sie, halb betäubt.
»Ich wurde an dem Tag geboren, als der erste Mensch an mich dachte. Ich werde an dem Tag sterben, an dem der letzte Mensch vergisst.«
Da erkannte sie seine Einsamkeit, wie ein bleiches Staubkorn in der Nacht. Sie starrte es an und stellte sich ihn vor, einen Gott, der einen langen und einsamen Tod starb. Und irgendwann in diesem Schauen kam der Schlaf, und die Nacht breitete sich über die Welt.
Als die Sonne aufging, stand Cleci auf und blickte sich um und sah nur die Felder und die Weinstöcke, den seichten Fluss, die staubigen Linden und das Dorf. Und als sie nach dem langen Weg daheim ankam, sah sie das Haus ihrer Mutter in seiner ganzen Ärmlichkeit. Und als ihre Mutter sie stieß und schlug und ihr hässliche Namen gab, weil sie die ganze Nacht ausgeblieben war, sah Cleci auch das. Aber durch das alles erkannte sie, wie durch Rauch oder Wasser, wie die Welt gewesen war und wie sie vielleicht immer noch war, unter ihrem Schleier aus Elend und Lügen.