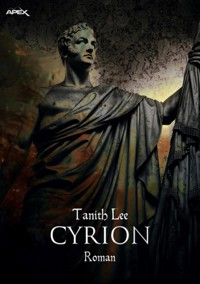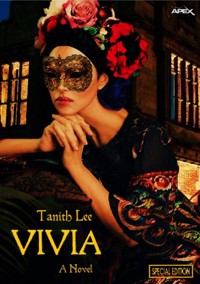6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Tanith Lee ist eine Meisterin phantastischer Stimmungsbilder und romantischer Atmosphären; neben C. J. Cherryh gilt sie als eine der wichtigsten Vertreterinnen der anspruchsvollen modernen Fantasy-Literatur, die an der Grenze zur Science Fiction angesiedelt ist.
Im Mittelpunkt ihrer Romane stehen Frauen, die nicht mehr passive Abenteuerinnen vom Typ einer Angelique darstellen, sondern aktiv ihre Welt gestalten, wobei auch Sex und die Erotik eine wichtige Rolle spielen.
In ihren Kurzgeschichten und Erzählungen tritt Tanith Lees Fähigkeit, den Leser mit lyrischen Stimmungsbildern in ihre Welten zu versetzen, besonders deutlich hervor.
ZEICHEN IM WASSER: dreizehn meisterhafte Erzählungen aus der Feder der legendären britischen SF-/Fantasy-Autorin TANITH LEE (1947 – 2015) – zwischen surrealem Märchen und düsterer Science Fiction.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
TANITH LEE
Zeichen im Wasser
Tanith Lee-Werkausgabe, Band 12
Erzählungen
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Das Buch
Schach des Nordens (Northern Chess)
Blumen als Gesichter, Dornen als Füße (Flowers For Faces, Thorns For Feet)
Der scharlachrote Mantel (The Blood-Mantle)
In der Schwebe (In The Balance)
Die Zeit vergeht (As Time Goes By)
Medra (Medra)
Lichter des Südens (Southern Lights)
Tiger (Tiger!)
Verlauf' dich nicht! (Don't Get Lost)
Waffenstillstand (The Truce)
Wenn die Uhr die zwölfte Stunde schlägt (When The Clock Strikes Twelve)
Weggefährten (Companions On The Road)
Zeichen im Wasser (Written In Water)
Die Autorin
Tanith Lee.
(* 19. September 1947, + 24. Mai 2015).
Tanith Lee war eine britische Horror-, Science Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin und Verfasserin von Drehbüchern. Sie wurde viermal mit dem World Fantasy-Award ausgezeichnet (2013 für ihr Lebenswerk) und darüber hinaus mehrfach für den Nebula- und British Fantasy-Award nominiert.
Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie über 90 Romane und etwa 300 Kurzgeschichten. Sie debütierte 1971 mit dem Kinderbuch The Dragonhoard; 1975 folgte mit The Birthgrave (dt. Im Herzen des Vulkans) ihr erster Roman für Erwachsene, der zugleich auch ihren literarischen Durchbruch markierte.
Tanith Lees Oevre ist gekennzeichnet von unangepassten Interpretationen von Märchen, Vampir-Geschichten und Mythen sowie den Themen Feminismus, Psychosen, Isolation und Sexualität; als wichtigsten literarischen Einfluss nannte sie Virginia Woolf und C.S. Lewis.
Zu ihren herausragendsten Werken zählen die Romane Trinkt den Saphirwein (1978), Sabella oder: Der letzte Vampir (1980), Die Kinder der Wölfe (1981), Die Herrin des Deliriums (1986), Romeo und Julia in der Anderswelt (1986), die Scarabae-Trilogie (1992 bis 1994), Eva Fairdeath (1994), Vivia (1995), Faces Under Water (1998) und White As Snow (2000).
1988 gelang ihr mit Eine Madonna aus der Maschine (OT: A Madonna Of The Machine) ein herausragender Beitrag zum literarischen Cyberpunk; eine Neu-Übersetzung der Erzählung wird in der von Christian Dörge zusammengestellten Anthologie Cortexx Avenue enthalten sein.
Ihre wichtigsten Sammlungen von Kurzgeschichten und Erzählungen sind: Red As Blood/Tales From The Sisters Grimme (1983), The Gorgon And Other Beastly Tales (1985) und Nightshades: Thirteen Journeys Into Shadow.
Tanith Lee war seit 1992 mit dem Künstler John Kaiine verheiratet und lebte und arbeitete in Brighton/England.
Sie verstarb im Jahre 2015 im Alter von 67 Jahren.
Der Apex-Verlag widmet Tanith Lee eine umfangreiche Werkausgabe.
Das Buch
Tanith Lee ist eine Meisterin phantastischer Stimmungsbilder und romantischer Atmosphären; neben C. J. Cherryh gilt sie als eine der wichtigsten Vertreterinnen der anspruchsvollen modernen Fantasy-Literatur, die an der Grenze zur Science Fiction angesiedelt ist.
Im Mittelpunkt ihrer Romane stehen Frauen, die nicht mehr passive Abenteuerinnen vom Typ einer Angelique darstellen, sondern aktiv ihre Welt gestalten, wobei auch Sex und die Erotik eine wichtige Rolle spielen.
In ihren Kurzgeschichten und Erzählungen tritt Tanith Lees Fähigkeit, den Leser mit lyrischen Stimmungsbildern in ihre Welten zu versetzen, besonders deutlich hervor.
ZEICHEN IM WASSER: dreizehn meisterhafte Erzählungen aus der Feder der legendären britischen SF-/Fantasy-Autorin TANITH LEE (1947 – 2015) – zwischen surrealem Märchen und düsterer Science Fiction.
Schach des Nordens (Northern Chess)
Land und Himmel zeigten dieselbe gelblich-blaue Farbe, und eine kalte, verschleierte Sonne hüllte das Land in ihre blassen Strahlen. Es war bereits Spätsommer, aber es hätte genauso gut sein können, dass dieses Land noch nie einen Sommer gesehen hatte. An den spärlichen Bäumen grünte kein Blatt, und nicht ein Vogel hatte sein Nest in den Zweigen gebaut. Einförmig und aschgrau erstreckten sich weit und breit nur kleine Hügel, deren Spitzen matt glänzten, und in den Tälern lag der Nebel. In diesem Land waren traurige Lieder und trübe Erinnerungen zu Hause, und des Nachts geisterten Alpträume darüber hin.
Fünfzehn Meilen zuvor war Jaisels Pferd ohne erkennbaren Grund plötzlich zusammengebrochen und verendet; dabei war es das beste Pferd gewesen, das der Händler im Stall gehabt hatte, gesund und lebhaft, auch wenn er anfangs versucht hatte, sie übers Ohr zu hauen. Sie war im Süden aufgebrochen, und ihr Ziel war eine Stadt an der Küste, hoch oben im Norden, obwohl es keinen besonderen Grund für sie gab, sich dorthin auf den Weg zu machen. Sie war nun einmal der Typ des rastlosen Wanderers, und so war nicht das Ziel jemals Sinn oder Zweck einer Reise.
Denn jedes Mal, wenn sie sah, wie die Frauen an ihren Webstühlen oder in den verräucherten Küchen saßen, wie sie ihre Säuglinge stillten oder sich auf den Feldern abarbeiteten oder wie ihre bemalten Gesichter in dunklen Türeingängen lehnten, wurde der Wunsch davonzulaufen, zu fliehen, dies alles hinter sich zu lassen, in Jaisel immer stärker. Normalerweise gab es für ihr Weitereiehen sowohl einen ganz konkreten wie auch theoretischen Grund. Die letzte Stadt musste sie überstürzt verlassen, weil sie zwei Männer, die auf der Straße über sie hergefallen waren, umgebracht hatte. Es stellte sich heraus, dass einer von beiden ein junger Lord gewesen war, der zum Zeitvertreib Reisende überfiel und ausraubte und sogar junge Frauen vergewaltigte; zu jener Zeit aber war das Recht auf der Seite der Adligen, und es war nebensächlich, was sie verbrochen hatten; wagte man es aber, sie zur Verantwortung zu ziehen, so standen darauf Folter und Tod. So hatte sich Jaisel also auf den Weg nach Norden gemacht. Aber zwischen ihr und ihrem Ziel lag dieses öde, graue Land, in dem ihr Pferd ohne ersichtlichen Grund unter ihr zusammengebrochen war, in dem das Wasser aus den Bächen bitter schmeckte und in dem der Himmel so tief hing, als ob es mitten im Sommer anfangen wollte zu schneien.
Am Wegesrand standen nur Ruinen; und das einzige Leben, dem sie begegnete, war eine Schafherde, die sich plötzlich und unerwartet aus dem Nebel herauslöste, um einen Augenblick später in einem anderen Nebelstreifen wieder zu verschwinden. Einmal hörte sie einen Raben krächzen, und der Ärger über dieses öde Land, über sich selber und über Gott stieg in ihr hoch. Bei jedem Schritt spürte sie das Gewicht des Sattels und des Gepäcks auf ihrem Rücken ein wenig mehr.
Als sie jetzt aber die Kuppe eines Hügels erreicht hatte, sah sie etwas, das sie vor Erstaunen innehalten ließ.
Unten im Tal lag ein Dorf, halb in diesen gelb-blauen Dunst eingehüllt, und obwohl es einfach und trostlos wirkte, so war es doch bewohnt, denn aus den Schornsteinen stiegen kleine Rauchsäulen in den wolkenlosen Himmel empor. Von fern erklang dumpf das klagende Gebrüll der Rinder, und hinter der armseligen Ansammlung von Hütten ragten ein paar nackte Bäume drohend in den Himmel hinauf.
Noch hinter dieser Baumgruppe, kaum zu sehen und halb verschwommen im Dunst, vielleicht eine Meile weit entfernt, ragte ein merkwürdiger Steinhaufen empor; es konnte aber auch ein seltsames und bizarres Gebäude sein. Jaisel ging weiter und besah sich die nähere Umgebung von Dorf und Hügel genauer.
Dies Geräusch hier war unverkennbar: das helle Läuten kleiner Glöckchen am Zaumzeug von Schlachtrössern! Der Anblick war erregend und in dieser Gegend besonders überraschend. Es waren zwei Reiter auf stahlblauen Pferden, deren scharlachrote Decken wie Flammen in dem merkwürdigen Zwielicht des Tages hinter ihnen her wehten; sie sah ihre glänzenden Rüstungen und das Blitzen der Edelsteine, mit denen sie besetzt waren.
»Wer bist du?«, wurde sie von einem der Ritter angerufen.
Sie lächelte, als sie daran dachte, was sie jetzt sahen und was sie nicht erwarteten und wie überrascht sie sein würden.
»Ich heiße Jaisel«, rief sie zurück und hörte sie fluchen.
»Junge, was ist denn das für ein Name?«
Sie lief den Hang hinunter, den Männern entgegen.
Und was sie auf Entfernung für einen Jungen gehalten hatten, verwirrte sie nun völlig. Ihr feines blondes Haar war so kurz wie das eines Jungen, wenn nicht kürzer, und ganz gewiss fehlte ihm die lockige Länge, die die Ritter zu tragen pflegten. Sie wirkte sehr schlank in ihrem abgewetzten Kettenhemd, und um die schmalen Handgelenke lagen einstmals schöne, jetzt aber halbzerfetzte Spitzenborten. Der weiße Spitzenkragen, den sie über dem Kettenhemd trug, wurde mit zwei Bändern gebunden, an deren Ende jeweils eine schwarze Perle baumelte. Am linken Ohr schaukelte ein sichelförmiger goldener Ohrring und schimmerte mit dem silbernen Haar um die Wette. Der Gürtel, den sie trug, bestand aus grauem Leder und war abgewetzt und speckig. An ihrer rechten Hüfte trug sie einen Dolch mit einem zierlichen goldenen Griff, und an der linken einen schmalen, biegsamen Degen, dessen Griff vom häufigen Gebrauch schon ganz blank poliert war. Eine Amazone, stolz und schön und mit der Haltung einer Königin.
Als sie nah genug war und das Erstaunen der beiden Reiter bemerkte, hielt sie an und betrachtete sie. Sie schaute zwar belustigt drein, aber in Wirklichkeit langweilte sie das Spielchen zutiefst; seit zwölf Jahren ging das nun schon so, und es hatte jeglichen Reiz für sie verloren. Außerdem war sie müde und zürnte dem Schicksal, das sie hierher verschlagen hatte, noch immer.
»Hm«, grunzte der eine, »mir ist ja schon manches vorgekommen, aber ob Ihr Euch auf dem richtigen Weg befindet, möchte ich bezweifeln, Lady.«
Die Bemerkung war zweideutig; meinte er nun, dass sie sich verlaufen hatte, oder kritisierte er ihre Art und Weise zu leben?
Jaisel blieb ruhig stehen und wartete ab. Plötzlich wurde sie von dem anderen Ritter in eisigem Tone gefragt: »Wisst Ihr um das Geheimnis dieses Ortes?«
»Nein«, gab sie ihm zur Antwort, »aber es wäre wirklich zu freundlich von Euch, wenn Ihr es mir sagen wolltet.«
Der Ritter, der anfangs mit ihr gesprochen hatte, runzelte die Stirn. »Es dürfte wohl das Beste für Euch sein, wenn wir Euch nach Hause schickten, wo Ihr nämlich hingehört!«
Jaisel sah ihn eindringlich an, und da ihr eines Auge ein wenig kleiner war als das andere, wirkte sie immer etwas ironisch und überheblich.
»Nun, Sir«, sagte sie, »versucht es nur. Ihr seid mir herzlich willkommen!«
Der Ritter wehrte ihren Vorschlag ab.
»Ich bin Renier of Towers, und ich kämpfe nicht mit Frauen.«
»Aber ja«, widersprach sie ihm, »Ihr tut es jetzt doch auch. Ihr habt bloß keinen Erfolg damit bei mir.«
Der andere Ritter grinste, und das hatte sie nicht erwartet.
»Ihr sitzt in der Falle, Renier. Lasst sie in Ruhe. Keine Frau wagt es, allein auf Reisen zu gehen und sich so zu kleiden, wenn sie nicht für sich selber sorgen kann. Hört mir zu, Jaisel. Auf diesem Land hier liegt ein Fluch. Ihr habt ja selbst gesehen, dass es so gut wie kein Leben ringsum gibt. Das Dorf zum Beispiel; Frauen und Tiere gebären wahre Monster. Die Menschen werden ohne Grund krank und sterben. Es gab hier einst einen Alchimisten, der dies Land für sich beanspruchte. Maudras. Ein Zauberer, ein Anhänger der alten Religionen und Götter. Drei Schlösser hat er unter seinen Einfluss gebracht, aber diese drei sind inzwischen vom Erdboden verschwunden; nur die letzte Festung hält sich noch; Ihr findet sie eine Meile nordöstlich von hier. Wenn der Nebel steigen würde, so könntet Ihr sie sehen. Der Prinz von Towers hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede Spur des Zauberer Maudras vom Erdboden zu tilgen. Wir sind seine Ritter und haben den Befehl, mit diesem Schloss so zu verfahren wie mit den anderen drei.«
»Aber wir können die Festung nicht einnehmen«, fügte Renier hinzu. »Seit Monaten sitzen wir nun schon in diesem verfluchten Land, und nichts geschieht.«
»Wer verteidigt denn das Schloss?« fragt Jaisel. »Maudras selber?«
»Maudras ist schon vor einem Jahr in Towers begraben worden«, wurde sie von dem zweiten Ritter unterrichtet. »Seine Anhänger oder sein Fluch verteidigen die Festung gegen die Ritter des Herrn.« Sein Gesicht war bleich und grimmig. Jetzt aber lächelte Renier sie an: »Ihr seht, dies ist kein geeigneter Ort für eine junge Dame, sondern ein Kriegslager. Ein seltsames Schloss in einem verfluchten Land. Ihr kehrt also besser um!«
»Ich habe kein Pferd, aber Geld, um eines zu kaufen«, bemerkte Jaisel gleichmütig.
»Pferde haben wir im Überfluss«, versicherte ihr der andere Ritter. »Tote brauchen nun einmal keine Gäule mehr. Mein Name ist übrigens Cassant. Sitzt hinter mir auf, und ich bring' Euch ins Lager.«
Mühelos schwang sie sich hinter ihm aufs Pferd, obwohl sie Sattel und Gepäck geschultert hatte.
Renier beobachtete sie zwar spöttisch, aber wider Willen fasziniert.
Als sie die Pferde in eine Nebelbank führten, kam er nähergeritten und murmelte: »Seht Euch vor, Lady! Die Frauen des Dorfes sind ziemlich widerwärtig, und auch ein Ritter könnte einmal seine Ehre vergessen. Aber Ihr seid vielleicht sowieso erst vor kurzem das letzte Mal vergewaltigt worden.«
»Einmal«, informierte sie ihn. »Das war vor zehn Jahren, und ich war auch sein letztes Opfer. Das Grab habe ich selber ausgehoben, denn immerhin respektiere ich die Toten.« Ihre Augen trafen sich, und sie fügte sanft hinzu. »Jedes Mal wenn ich in der Gegend bin, gehe ich an sein Grab und spucke darauf.«
Unten im Tal war der Nebel dichter, als Jaisel vom Hügel aus angenommen hatte. Im Dorf sah sie einen Steinhaufen, der wahrscheinlich einmal ein Brunnen gewesen war, und einmal glaubte sie an einer Kreuzung, mitten zwischen den armseligen Hütten, eine verlorene, krumme Frauengestalt zu sehen, die ein schattenhaftes Tier am Zügel führte, das sie für eine Kuh mit zwei Köpfen hielt.
Sie ritten an den Bäumen vorbei, ließen das Dorf hinter sich, und Stück für Stück tauchte jetzt das Lager aus dem Nebel auf. Die blutroten Banner hingen schlaff herunter, und die Zelte wurden so sorgfältig bewacht, dass es schon fast lächerlich war. Der Atem der Pferde wehte um ihre Nüstern; auf einem Geschützstand waren ein paar Kanonen postiert, deren bronzenen Rohre mit unzähligen Nebeltropfen übersät waren, die Wurfspieße steckten untätig daneben, und die Pulverfässer waren zwar in dickes Segeltuch gewickelt, das aber wahrscheinlich längst feucht war.
An dieser Stelle lichtete sich plötzlich der Nebel, und zweihundert Meter nordöstlich des Lagers war nun auf einmal das Schloss des Zauberers Maudras zu erkennen.
Starr und unbewegt ragte es mit seinen bizarren Formen in den fahl-gelben Himmel.
Der untere Teil war direkt aus dem Felsen eines kegelförmigen Hügels geschlagen worden, und oberhalb dieses Felsens ging das Schloss dann in eine verwirrende Fülle von Mauem und Türmen über, die wie die Versteinerung eines riesigen, unnatürlichen Geschwürs wirkten. Ein etwas erhöhter Weg führte den Hügel hinauf zu dem halbrunden Eingang, der einem Maul mit eisernen Fängen glich.
Es waren keinerlei Bewegungen oder Kriegsvorkehrungen zu erkennen, und das Schloss wirkte wie ein gewaltiges Grabmal - aber nicht unbedingt wie ein Grabmal für die Toten.
Es war viel mehr das Lager, über dem eine Atmosphäre des Todes und der Verwesung lag. Aus einem Teil des Lagers, von dem Jaisel nicht wusste, wo er sich befand, waren das Stöhnen und die Schmerzensschreie der Verwundeten zu hören, und dort, wo sich die Männer außerhalb der Zelte aufhielten, hockten sie untätig am Feuer zusammen. Weder ihrer Ausrüstung noch dem Essen schenkten sie irgendwelche Aufmerksamkeit. Vor einem scharlachroten Zelt saßen zwei Ritter und spielten Schach, aber das Spiel ging nur sporadisch und unkonzentriert voran, und sie schienen -jeden Augenblick auf einander losgehen zu wollen.
Cassant zügelte sein Pferd neben einem scharlachroten, großen Zelt; die Plane, die den Eingang verhüllte, zierten drei goldene Türme - das Wahrzeichen von Towers. Ein Junge kam angerannt und nahm sich der Pferde an, bevor die beiden Ritter noch absteigen konnten. Renier blieb neben seinem Tier, neben Jaisel stehen und sah sie an; einen Augenblick später verkündete er im Ton eines Herolds: »Gentlemen, kommt näher und begrüßt unseren neuen Rekruten! Einen tapferen Ritter! Ein Mädchen in Männerhosen!«
Ringsum hoben sich die Köpfe, und ein unerwartetes Interesse erfasste das Lager, aber es war der boshafte Humor kranker, geschlagener Männer, deren Schicksal besiegelt schien. Sie erhoben sich von ihren Plätzen am Feuer und kamen neugierig näher, und sogar die Ritter starrten sie unverhohlen mit gierigen Blicken an. »Lady, Ihr verursacht einen Aufruhr«, sagte Cassant kläglich. »Aber seid fair, er hat Euch gewarnt!«
Jaisel zuckte die Schultern und blickte auf Renier, der lässig auf seinem Pferd saß; das rechte Bein hatte er aus dem Steigbügel gezogen, und seine Arme stützte er auf den Sattelknauf. Boshaft grinsend blinzelte er ihr zu. Jaisel zog den Dolch aus ihrem Gürtel, spielte einen Moment mit ihm herum, damit er ihn aufblitzen sah, und dann warf sie ihn. Die kleine rasiermesserscharfe Klinge schwirrte durch die Luft und versengte die Barthaare an seiner rechten Wange; dann grub sie sich in ihr anvisiertes Ziel, in den Pfosten hinter dem Ritter. Aber Renier, der genau so reagierte, wie sie es gewollt hatte, warf sich heftig zur Seite, um sein hübsches Gesicht zu retten, und verlagerte so sein ganzes Gewicht auf das Bein, das noch im Steigbügel steckte; einen Augenblick lang versuchte er wild gestikulierend sein Gleichgewicht zu halten, dann aber fiel er wenig elegant in den Dreck. Im selben Moment bäumte sich das Pferd auf und versuchte durchzugehen. Mit dem linken Bein hing er noch immer im Steigbügel fest, und so flog Renier von Towers in die heiße Asche eines Lagerfeuers.
Die Männer um ihn herum lachten schadenfroh. Den Soldaten war es egal, ob sie sich über einen hochnäsigen Lord, der jetzt im Dreck lag, oder über ein hilfloses Mädchen lustig machten. Hauptsache, es gab wieder etwas zu lachen.
Aber das hilflose Mädchen war noch nicht ganz fertig. Während Renier noch versuchte, sein Schwert zu ziehen, sprang Jaisel auf ihn zu, traf seine Hand im Sprung und schlug seinen Fuß aus dem Steigbügel heraus. Nachdem sie ihn so befreit hatte, rannte sie zu dem Pfahl zurück, um ihren Dolch herauszuziehen, und als sich Renier endlich wieder aufgerichtet hatte, sah er sie schon auf ihn warten. Ihr Gepäck lag vor ihr auf der Erde, und in ihrer Hand glitzerte die dünne Waffe angriffslustig.
Einen Augenblick zögerte er, während das Lager angeheizt auf ihn einschrie. Dann aber griff seine beringte Hand nach der eigenen Waffe, und er hatte sie schon fast gezogen, als eine Stimme aus dem scharlachroten, mit Gold verzierten Zelt erschallte:
»Wenn du es wagst, gegen eine Frau die Waffe zu ziehen, Renier, so entlasse ich dich augenblicklich aus meinen Diensten!«
Renier schluckte, aber er steckte sein Schwert zurück in die Scheide. Jaisel blickte sich um und sah einen Mann, rot vor Wut, im Zelteingang stehen. Ihre eigene, latente Wut, die sie so oft verspürte, stieg in ihr auf.
»Fürchtet nicht für ihn, Sir«, sagte sie. »Ich werde ihm nur einen kleinen Streich versetzen, es wird ihm nichts Ernsthaftes geschehen.«
Der Hauptmann blickte sie zornig und unheilverkündend an.
»Was bist du? Hure oder Hexe?«
»Sagt mir doch erst einmal Euren Rang«, versetzte sie kühl »Wie lautet der? Feigling oder Schwachkopf?«
In dem nun entstandenen Schweigen hätte man eine Nadel fallen hören können.
»Ich habe mich noch nie an einer Dirne vergriffen sagte er dann leise.
»Bei Gott, und Ihr werdet es auch jetzt nicht tun!«
Der Mund blieb ihm vor Erstaunen offen stehen, aber er beherrschte sich schnell wieder und fragte: »Warum Feigling, und warum soll ich schwachköpfig sein?«
»Wollt Ihr Euch über mich lustig machen?«, fragte sie ihn spitz. Sie ging zu ihm hinüber und ließ die Dolchspitze vor seiner Nase auf- und abtanzen. Er hatte sich glücklicherweise beruhigt, und diese Ruhe verließ ihn auch jetzt nicht.
»Ihr seid deshalb entweder ein Feigling oder ein Schwachsinniger, weil Ihr nicht in der Lage seid, eine Festung einzunehmen, die Euch keinerlei Widerstand entgegenbringt«, antwortete sie ihm, maliziös lächelnd.
Eine muskulöse Hand schoss plötzlich vor und versuchte ihr die Waffe aus der Faust zu schlagen, aber die Klinge war schneller. Einen Augenblick lang lag sie waagerecht in der Luft und ihre Spitze lag an der Kehle des Mannes, aber einen Herzschlag später steckte sie bereits wieder in ihrer Scheide, und dort stand nur noch die schmale Mädchengestalt mit dem verwirrenden Lächeln im Gesicht.
»Ich weiß bereits genug über dich«, sagte der Hauptmann. »Es ist nur allzu deutlich, dass du für die Männer eine Herausforderung darstellst, Gott aber ein Dorn im Auge bist. Trotzdem werde ich deine Anschuldigung beantworten. Maudras' letzte Festung wird von einem Zauber verteidigt, den er zum Schutz über das Schloss geworfen hat. Drei Angriffe sind schon abgeschlagen worden, und jetzt sollst du sehen, was passiert ist. Komm schon mit, du Teufelin.«
Er drehte sich um, und die Meute öffnete sich, um ihn und dies seltsame Mädchen durchzulassen. Keiner wagte es, sie anzurühren, außer einem Narren, der zwar alles gesehen, aber nichts dazugelernt hatte. Ihm drückte sie den Griff ihres Dolches zwischen die Rippen, und sein Annäherungsversuch fand ein schnelles und schmerzhaftes Ende.
»Hier ist es«, blaffte der Hauptmann sie an.
Er schob den Vorhang eines dunklen Zeltes zur Seite, und in dessen Innern sah sie ungefähr zwanzig Männer auf halbverfaulten Matratzen liegen, während zwei Ärzte sich um sie bemühten.
Dies hier waren die Folgen einer mysteriösen Schlacht. Sie sah Dinge, die sie schon oft gesehen hatte, die aber mit der Häufigkeit eher schrecklicher als harmloser wurden. Dicht neben dem Eingang wand sich ein Junge, jünger als sie selber, in Fieberphantasien, und Jaisel schlüpfte in das Zelt, um ihm die Stirn zu kühlen. Sie legte ihre kalte Hand auf seinen Kopf und fühlte die Hitze des Fiebers. Ihre Berührung schien ihn zu besänftigen, und er hörte auf zu schreien.
»Noch einmal«, sagte sie fast sanft. »Feigling oder Irrsinniger. Und dies hier sind unschuldige Opfer, die auf dem Altar der Feigheit oder des Wahnsinns geopfert werden.«
Es ist gut möglich, dass der Hauptmann noch nie in so unbarmherzige und gnadenlose Augen geblickt hatte wie jetzt in die ihren.
»Magie und Zauberei«, gab er kleinlaut zur Antwort. »Wir waren machtlos dagegen. Trinkst du alte Hexe Wein? Ja, zweifellos. Komm und trink ihn mit mir in meinem Zelt; dann werde ich dir die ganze Geschichte erzählen. Nicht, dass du es verdienen würdest. Du bist der letzte Schwerthieb, der einen angeschlagenen Mann ins Grab bringt. Undank ist nun mal der Welt Lohn - aber ausgerechnet von einer Frau!«
Sie lachte ihn unerwartet an, und ihr Zorn war verflogen.
Roter Wein und rotes Fleisch wurden ihr im roten Zelt serviert. Alle sieben Ritter des Lagers nahmen an dem Gastmahl teil, auch Cassant und Renier. Draußen saßen die Männer an den Feuern, und ein trauriges Lied erklang aus ihren Kehlen, wurde wieder und wieder aufgegriffen, während ein eisig-blaues Licht aus einem sommerlichen Himmel auf die Erde niederfiel.
Der Hauptmann hatte die Geschichte wiederholt, die Cassant Jaisel bereits auf dem Hügel erzählt hatte: drei der Schlösser hatten sie dem Erdboden gleichgemacht, aber das letzte erwies sich als uneinnehmbar. Rau und kriegslüstern, wie er war, fand es der Hauptmann schwierig einzugestehen, dass hier eine übernatürliche Macht ihre Hände im Spiel hatte.
»Drei Angriffe sind wir gegen das Schloss geritten. Der erste wurde von Montaube geführt, der dabei, und mit ihm fünfzig seiner besten Männer, ums Leben kam. Woran sie starben? Keiner weiß es, denn wir haben weder Männer auf den Befestigungsanlagen gesehen noch wurde ein einziger Speer oder Pfeil abgefeuert. Trotzdem war der Boden alsbald von blutenden und sterbenden Männern bedeckt, so als ob sie einer zweifachen Übermacht in die Arme gelaufen wären. Den zweiten Angriff befehligte ich selber, und ich entkam der Vernichtung nur wie durch ein Wunder. Neben mir sah ich einen Mann zusammenbrechen, dessen Rüstung völlig zerfetzt worden war und dem Blut aus einer grässlichen Wunde hervorschoss. Keine Menschenseele befand sich in der Nähe, nur ich, sein Hauptmann. Es war kein Schuss gefallen, kein Pfeil abgeschossen worden. Den dritten Angriff hatten wir geplant, aber niemals durchgeführt. Als wir die Böschung erreichten, sanken meine Männer nieder, als wenn der Schnitter durchs Korn ginge, und unser Rückzug war wahrlich keine Schande. Noch etwas: letzten Monat versuchten drei tapfere Narren, die dem toten Montaube unterstanden hatten, bei Nacht und Nebel über die Mauer in das Schloss zu klettern und so den Eintritt zu erzwingen. Ein Wachtposten hat sie noch über die Mauer verschwinden sehen; sie waren noch nicht einmal angegriffen worden, aber sie kamen auch nicht wieder.«
Es war lange ruhig in dem Zelt, und als Jaisel aufblickte, traf sie den hasserfüllten Blick des Feldherrn dieser elenden Truppe.
»Reitet zurück nach Towers«, schlug sie ihm vor. »Was bleibt Euch denn hier noch zu tun?«
»Was kann man auch anders von einer Frau erwarten?«, fuhr Renier dazwischen. »Aber wir sind Männer, Madam! Wir werden diese Festung entweder einnehmen oder sterben. Die Ehre, Lady, die Ehre. Oder habt Ihr davon in dem Freudenhaus, in dem Ihr zur Welt gekommen seid, noch nie etwas gehört?«
»Ihr seid ja betrunken«, sagte Jaisel. »Aber nichtsdestotrotz, nehmt doch noch ein wenig Wein.« Sie füllte ihren Becher bis zum Rand und leerte ihn genüsslich über seinem Kopf aus. Zwei oder drei der andern brachen in schallendes Gelächter aus und schienen die Szene zu genießen. Renier sprang auf, aber er wurde so unsanft vom Hauptmann angefahren, dass er sich wieder setzte.
Der Wein lief in dünnen rosa Rinnsalen über sein hübsches Gesicht.
»Ihr tut ganz recht daran, mich zu tadeln, und ich verdiene auch den Spott dieses Frauenzimmers. Wir sitzen hier wirklich wie die Feiglinge rum, ganz wie sie es gesagt hat. Es gibt einen Weg, diese Festung einzunehmen. Es ist eine einzige Herausforderung. Es ist die Schlacht zwischen Gott und dem Satan. Ist denn Maudras stärker als der Himmel?« Renier stand entschlossen auf.
»Ihr seid wirklich betrunken, Renier«, wurde er vom Hauptmann angefahren.
»Aber nicht zu betrunken, um zu kämpfen!« Renier stand bereits in der Tür. Der Hauptmann brüllte, aber der Ritter verbeugte sich lediglich. »Ich bin ein Ritter, und ich lasse mich von Euch nicht zum Feigling machen.«
»Du Narr...«, rief Cassant.
»Mag sein«, gab Renier trocken zurück, »aber ich bin wenigstens mein eigener Narr.«
Die Ritter standen reglos da und wurden Zeugen seines Aufbruchs. In ihren Augen standen Respekt, Neid, Sorge und Verachtung, und ihre nervösen Finger spielten mit den Juwelen, mit den Weinbechern und den Schachfiguren.
Draußen war der melancholische Gesang verstummt, als Renier nach Pferd und Rüstung rief.
Die Ritter kamen näher und starrten ihn sprachlos an, während er sich ankleidete. Der Hauptmann gesellte sich zu ihnen, und es versuchte niemand mehr, ihn von seinem waghalsigen Unternehmen abzuhalten.
Jaisel trat vor das Zelt in das fahle Licht, das sich immer weiter verdichtete, so als ob es sie darin einhüllen wollte. Lediglich die roten Banner und der rote Schein der Feuerstellen durchdrangen den Dunst. Renier schien mit seinem Pferd verwachsen zu sein und blickte so stolz um sich, als ob er den Kampf mit dem Teufel persönlich wagen wollte.
Das Pferd tänzelte und zitterte. Jaisel strich ihm beruhigend über die Nüstern, aber sie wagte nicht, ihren Blick zu Renier zu erheben, dessen tiefe Angst sie durch all seinen verletzten Stolz hindurch nur zu genau spürte.
»Bitte«, sagte sie leise, »reitet nicht in Eurem sicheren Tod, nur weil Ihr glaubt, dass ich Eure Ehre befleckt hätte. Das wäre ein zu hoher Preis, den Ihr zahlen würdet.«
»Geht aus dem Weg«, fauchte er sie an. »Geht und gebärt Kinder, so wie es Euch von Gott bestimmt worden ist.«
»Gott hat aber auch nicht bestimmt, dass Ihr jetzt sterben sollt, Renier!«
»Es könnte sein, dass Ihr Euch da irrt«, antwortete er wild, warf sein Pferd herum und galoppierte über das Feld dem Schloss entgegen. Ein Herold scherte aus der Reihe aus und folgte ihm, hielt sich aber wohlweislich ein paar Meter zurück. Als die Fanfaren ertönten, scheute des Herolds Pferd, und Renier hetzte allein weiter.
»Er ist verrückt; er reitet in sein sicheres Verderben!«, murmelte Cassant.
»Und es ist alles meine Schuld«, gab Jaisel zerknirscht zu.
Ein Raunen durchlief die gebannt starrenden Reihen der Soldaten. Die Eisengitter des riesigen Tores glitten langsam zur Seite, und es gähnte ihnen ein furchterregendes Maul entgegen. Aber es erschien niemand in diesem Tor - es war eine wortlose Einladung.
Ein Mann schrie Renier hinterher, und hundert andere fielen mit ein, und plötzlich brüllte und schrie das halbe Lager. Sich über einen Adligen lustig zu machen war eine Sache, aber ihn in sein sicheres Verderben reiten zu sehen war eine andere. Sie schrien sich heiser, aber er hörte sie schon längst nicht mehr.
Wortlos drehte sich Jaisel um und ging davon, und als sie Cassant fluchen hörte, wusste sie, dass Renier geradewegs durch das Tor geritten war. Der Aufruhr brach in sich zusammen und machte hilflosen Verwünschungen Platz; dann plötzlich hörte man ein dröhnendes Klirren, als sich nämlich die Gitter über dem Tor zur Hölle wieder schlossen.
Es war unmöglich sich vorzustellen, was für einer Macht Renier sich jetzt gegenüber sehen würde. Vielleicht würde er triumphieren und ruhmvoll wieder auferstehen, vielleicht war aber auch das Böse aus Maudras' Schloss entwichen, oder es hatte es niemals gegeben, war eine Illusion gewesen oder eine Lüge.
Sie warteten alle. Die Soldaten, die Ritter - und auch die Frau. Ein kalter Wind erhob sich und fuhr durch die Federbüsche und die Wimpel, spielte mit den langen Locken der Ritter und tanzte über den goldenen Mond in Jaisels Ohr, über das zerbrechliche Armband an ihrer Hand und die Rüstung der Männer.
Die Sonne zog ihre Bahn in Richtung Westen, wurde blass und versank schließlich am Horizont. Kleine Schäfchenwolken segelten am Abendhimmel dahin.
Die Dunkelheit legte sich rasch über das Land, Nebelschwaden zogen auf und verhüllten das Schloss. Die Feuer leuchteten in der Dunkelheit, und der warme Atem der Pferde stand wie kleine Rauchwolken in der feuchten Luft.
Über all dem lag der Geruch von Fäulnis und Verfall - auch die Hoffnung vermoderte hier.
Der junge Ritter neben Jaisel warf ihr hasserfüllt eine Schachfigur aus rotem Onyx ins Gesicht.
»Die weiße Königin hat sich den roten Ritter untertan gemacht«, beschuldigte er sie. »Dann hat sie ihn in den Kasten gesteckt und den Deckel zugeklappt. Ein feines Schachspiel, das hier ausgetragen wird. Festungen, die uneinnehmbar sind, Hexen, die sich als Königin aufspielen, und Ritter, die in den sicheren Tod reiten.«
Jaisel hielt seinen Blick fest, bis er sich umdrehte und davonging, mit einem Auge nahm sie wahr, wie Cassant still ein paar Tränen vergoss.
Es war zu einfach, an den Wachen vorbeizukommen. Zwar erwarteten sie die Gefahr von außerhalb des Lagers und nicht von innen, trotzdem. Es gab hier zu wenig Disziplin! Die Ehre war zum höchsten Gut erhoben worden, aber das war nicht genug.
Aber war es nicht auch ihr eigenes Ehrgefühl, das sie jetzt zu diesem Unternehmen veranlasste? Sie war doch auch nicht davon unabhängig. Sie fühlte sich sehr schuldbewusst, obwohl dazu keinerlei Veranlassung bestand, und sie war voller Mitgefühl für einen Mann, den sie kaum kannte, mit dem sie nur eine gegenseitige Abneigung verband und mit dem sie sich ein paar Wortgefechte geliefert hatte. Renier war in das Schloss geritten, um ihr seinen Mut zu beweisen und sie zu beschämen. Und sie fühlte sich auch so.
Obendrein fühlte sie sich herausgefordert, das Geheimnis dieser Festung herauszufinden und seinen Zauber zu brechen. Wenn sie konnte, so wollte sie sein Leben retten; war das nicht möglich, so würde sie ihn rächen. Und sterben, wenn es dem Schloss gelingen sollte, sie zu überlisten? Nein! Es war seltsam, aber irgendwie glaubte sie nicht so recht daran, dass es Maudras' Zauber gelingen würde, sie zu vernichten. Ihr ganzes Leben lang hatte immer irgendjemand oder irgendetwas versucht, sie zu besiegen oder sie von ihren eigentlichen Zielen abzuhalten. Es hatte immer wieder Hindernisse auf ihrem Weg gegeben, von dem Tag an, als sie zur Frau geworden war, von ihrem ersten Mann an, dem man sie mit zwölf Jahren zur Frau gegeben hatte, von der ersten (und letzten) Vergewaltigung und von dem ersten Fechtmeister an, der sie anfangs verlacht und später Wetten auf sie abgeschlossen hatte. Sie hatte alle diese Schwierigkeiten überwunden, aber nur, weil sie nicht akzeptierte, nicht akzeptieren wollte, dass ein Schicksal unausweichlich sein sollte.
Maudras' Festung war also nur eine neue Herausforderung für sie, die genommen werden wollte. Und das flaue Gefühl der Angst in ihrem Magen war auch nicht stärker als vor jedem anderen Kampf; so ignorierte sie es einfach.
Lautlos schlich sie durch den Nebel über das Feld; an ihrer linken Hüfte baumelte ein Schwert, und an der rechten trug sie den Dolch. Sattel und Gepäck hatte sie unter ihre Decken geschoben, so dass ihr Verschwinden nur durch Zufall vor morgen früh entdeckt werden konnte.
Zehn Meter vor dem Damm, auf dem der Pfad entlangführte, hörte der Nebel plötzlich auf.
Sie hielt einen Moment inne und betrachtete sich das seltsame Gebäude, das so einsam in den dunklen Nachthimmel ragte. Jetzt musste das Schloss eine Entscheidung treffen. Entweder öffnete es ihr die Tore ebenso bereitwillig wie dem Herausforderer Renier, oder es ließ sie die zwanzig Meter hohe Mauer hinaufklettern.
Das eiserne Tor blieb geschlossen, und so folgte sie dem Pfad.
Als sie hinaufschaute, schienen die gezackten Türme auf einmal zu schwanken und zu taumeln. Das ganze Schloss machte einen hasserfüllten, bösen Eindruck.
Die weiße Königin gegen den schwarzen König!
Die Königin schlägt den Turm, eine merkwürdige Variante eines so alten Spiels.
Der Turm.
Das Mauerwerk war uneben und bot Händen und Füßen genügend Halt. Diese Wand war eine Freude für jeden, der sie erklimmen wollte. Genau wie das einladend geöffnete Tor war sie wie ein böser Scherz und schien zu sagen: »Komm nur! Ich warte schon auf dich. Tritt nur ein - und sei verdammt, sobald du dich innerhalb meiner Mauem befindest.«
Sie sprang, klammerte sich fest und begann zu klettern.
Oft genug hatte sie ihren Weg auf diese Art und Weise finden müssen, und so konnte Jaisel klettern wie ein Affe.
Innerhalb weniger Minuten hatte sie auch schon die äußeren Zinnen erreicht. Dahinter befand sich ein Innenhof - aber pechschwarze Dunkelheit hüllte ihn ein, so dass es schwierig war, irgendetwas zu erkennen. Nur die Zinnen und Türmchen, die bewegungslos in den Himmel ragten, waren zu sehen, und wie schon einmal zuvor hatte sie das Gefühl, dass alles Leben hier versteinert worden war.
Es hörte sich an, als ob ein Stück Stoff knirschend zerriss, aber in Wirklichkeit war es die gespannte Atmosphäre, die zerbarst. Jaisel warf sich flach auf den Boden und spürte irgendetwas über ihren Nacken streichen, das an ihr vorbei in die Dunkelheit verschwand.
Sie kroch vorsichtig über den Rand der Mauer hinweg, hing einen Augenblick lang nur an ihren Fingern fest und ließ sich dann zehn Fuß tief auf einen Mauervorsprung fallen. Wieder war das sirrende Geräusch zu hören, und eine harte Hand packte sie am Arm. Sie blickte an sich herunter und sah ein kaum wahrnehmbares Band in der Dunkelheit, und der Panzer überihrer Brust war heiß geworden.
Irgendein Gegner, der sie in der Finsternis ausmachen konnte, während sie nahezu blind war, griff sie an, aber seine Attacken waren zu ungenau und mehr zufällig. So warf sie sich wieder zu Boden und kroch auf allen vieren zu einem Treppenabsatz.
Hier war sie eine ideale Zielscheibe, aber was machte das schon? Ihr zweiter Fechtmeister war ein wahrer Akrobat gewesen.
Jaisel sprang hoch in die Luft, schätzte, wo sich ungefähr der Stufenrand befinden würde, schlug drei kühne Saltos in der Luft und landete, zusammengerollt wie ein Igel, im Hof.
Als sie sich streckte, nahm sie auf einmal einen schwachen Lichtschein wahr. Sie beschloss sich ihm zu nähern, fasste Schwert und Dolch fester, als sie plötzlich innehielt und ihr vor Angst schwindlig wurde.
Der Schein ging von einem halbverwesten Leichnam aus, der in einer verfallenen Kammer unterhalb der Treppe aufgebahrt lag. Die Überreste strahlten ein phosphoreszierendes Licht aus, und der üble Gestank unterstrich die Wirkung des Unheimlichen noch. Aber da war noch etwas anderes. Im fahlen Licht, das von dem Leichnam ausging, sah sie eine in die Wand gemeißelte Inschrift, und gegen jede Vernunft konnte es Jaisel nicht verhindern, dass sie sie las. Dort war in schönster Zierschrift zu lesen:
MAUDRAS HAT MICH GERICHTET
Es war einer von Montaubes Männern, der hier lag.
Nur der siebte Sinn des Kämpfers hatte Jaisel gewarnt, ließ sie sich ducken und die Waffe hochreißen, die von einem mächtigen Streich getroffen wurde. Ein brennender Schmerz zuckte durch ihren Arm. Ein heftiger, unsichtbarer Hieb war gegen sie geführt worden.
Ein Gedanke brannte in ihr - Wie kann ich denn gegen etwas kämpfen, was ich noch nicht einmal sehe? Und die zweite Überlegung, die sie nicht verhindern konnte, war: Aber ich habe doch schon immer gegen Dinge gefochten, die ich nicht sehen konnte. In diesem kurzen Augenblick, in dem sie sich zur Seite warf, um den vernichtenden Schlägen einer unsichtbaren, tödlichen Gefahr auszuweichen, begriff Jaisel auf einmal, dass, obwohl sie sie nicht sehen konnte, sie doch spürte.
Vielleicht zwanzig weitere Schläge prasselten gegen ihre Klinge und trafen das Mauerwerk um sie herum. Ihr Arm war schon fast taub und gefühllos, aber wie eine gut funktionierende Maschine parierte er noch immer die Angriffe, täuschte den Gegner, konterte und verteilte zahlreiche Schläge. Und dann auf einmal, sie focht mit halb geschlossenen Augen, weil sie den Feind besser fühlte als sah, mit schwindelerregender Sicherheit um ihn herum tanzte, holte sie zu einem vernichtenden Schlag aus und spürte deutlich, wie sie in ein sanftes, schleierartiges Gewebe hineinstieß, und es war ein Schrei zu hören, der einem das Blut in den Adern gerinnen ließ.
Der Weg war offen! Sie konnte auch das fühlen und schoss nach vorne. Da, ein neuer Torweg! Er führte geradewegs in den Innenhof der Festung; das Tor war noch nicht einmal verbarrikadiert, und auf der anderen Seite des Hofes war wieder dieser seltsame Schein zu sehen, auf den sie schon einmal gestoßen war. Ein anderer, stinkender Körper lag dort aufgebahrt, und wieder war auf dem Fußboden vor ihm in Zierschrift zu lesen:
MAUDRAS HAT MICH GERICHTET
»Maudras«, stieß Jaisel hervor, als sie in den Hof sprang.
Sie befand sich jetzt mitten im Herzen der Festung. An den Wänden um sie herum tanzten irisierende Farben und Schatten miteinander und trieben ihr das Wasser in die Augen.
Aus der Finsternis, von irgendwoher, kam ein Schrei, so schrill und schrecklich, wie ihn keine irdische Kreatur ausstoßen konnte. Dazwischen hörte sie ein merkwürdiges Donnern, so als ob das Dach einstürzen wollte. Sie brauchte einen Herzschlag lang, um zu begreifen, dann aber warf sie sich zur Seite, und als herunterfallende Steine sie trafen, brach Reniers Pferd aus seinem Unterschlupf hervor und verschwand in dem Hof hinter dem nächsten Tor.
Sie lag ganz ruhig und versuchte zu Atem zu kommen, als sie einen leisen Luftzug an ihrem Arm spürte. Sie rollte sich zusammen und griff kampfbereit nach ihrer Waffe, aber es war nur der letzte von Montaubes ehemaligen Soldaten, der da in seinem diffusen Licht auf einem Säulensockel aufgebahrt lag. Der Schein erfasste aber noch etwas anderes - Renier von Towers lag keinen halben Meter neben ihr!
Sie kniete sich hin und sah sich aufmerksam um. Es lag noch immer eine gewisse Spannung in der Luft, und sie wollte nicht glauben, dass der Kampf jetzt ausgestanden sein sollte. Es schien ihr viel eher die Ruhe vor dem letzten Sturm zu sein. So als ob ihr das Böse noch einen Augenblick Zeit geben wollte, wieder zu Kräften zu kommen, bevor es sie endgültig vernichtete.
Der Leichnam (wieder war die Inschrift MAUDRAS HAT MICH GERICHTET auf der Säule eingemeißelt) schien plötzlich seinen Schimmer zu vertiefen, als ob er ihr helfen wollte, das Zeichen auf Reniers Stirn zu entdecken, das das Böse dort hinterlassen hatte. Ein paar Blutstropfen liefen über sein Gesicht, dort wo wenige Stunden zuvor auch der Wein entlanggeperlt war, und seine Brust hob und senkte sich kaum merklich.
Sie lehnte sich über ihn und flüsterte: »Dem Himmel sei Dank, Ihr lebt noch. Ihr habt mehr Glück gehabt, als ich zu hoffen wagte. Ihr seid nur betäubt und nicht tot, aber Maudras' Zauber wartet nur darauf, dass Ihr Euch wieder erhebt. Denn es macht ihm keinen Spaß, Euch zu vernichten, wenn Ihr es nicht merkt. Er zieht es vor, daraus ein Fest zu machen, bösartig und hinterhältig wie er ist.«
Plötzlich, ohne das leiseste Anzeichen, fiel das Böse in den säulenumstandenen Innenhof von Maudras' Festung ein.
Hunderte, ja Tausende wirbelnder unsichtbarer Schwerter bahnten sich ihren Weg durch die Finsternis. Hinter jeder Ecke, neben jeder Säule lauerte die tödliche Gefahr und prasselte auf sie nieder. Jaisel war in einem tödlichen See von Blut und Verderben gefangen. Wieder und wieder brach die unsichtbare Macht über sie herein und drohte sie unter sich zu begraben. Sie versuchte eine Säule als Rückendeckung zu benutzen. Hundert Hände zerrten an ihr, und tausend scharfe Schnäbel hackten auf sie ein. Sie schlug wild um sich, traf auf ein weiches, nachgiebiges Material, Stimmen, die nichts mehr mit denen der Menschen gemein hatten, brachen sich an den Wänden, und unsichtbare Schatten zitterten. Aber die Wucht des Angriffs trieb sie von einer Ecke in die andere, ließ sie gegen Säulen taumeln, über Steine stolpern und jagte sie treppauf - treppab. Furcht ergriff sie und verlieh ihr Riesenkräfte. Sie kämpfte zäh und verbissen, von einem eisernen Lebenswillen beseelt, der sie die Zähne zusammenbeißen und nicht aufgeben ließ.
Bis sie auf einmal nicht mehr konnte! Die Knie versagten ihr den Dienst, die Angst übermannte sie, und sie gab ihrer Erschöpfung nach und kapitulierte. Ihr Wille brach zusammen, Degen und Messer fielen ihr aus der Hand, und sie selber sank zu Boden. Noch während sie fiel, dachte sie bei sich: Stirb wenigstens kämpfend! Aber dazu hatte sie einfach nicht mehr die Kraft.
Bis zu diesem Augenblick war es ihr entgangen, dass das Kampfgetümmel um sie herum verstummt war und das Schloss in absoluter Stille dalag.
Sie war über einen Steinblock gefallen, als sie zusammenbrach, und ihr Geist fing jetzt erst langsam wieder an, sich mit einem Gedanken zu beschäftigen, der sie nicht loslassen wollte und den sie auch nicht erklären konnte. Sie hatte mit Schatten gekämpft, die alle anderen vor ihr besiegt hatten, nur sie, Jaisel, nicht. Es war nicht zu leugnen, dass sie viel zu erschöpft war, um sich noch weiter zu wehren, und dass es ein leichtes wäre, sie jetzt zu töten; aber nichts dergleichen geschah! Und staunend musste sie sich fragen, ob sie wohl unter einem schützenden Zauber stände.
Sie sah einen Lichtschimmer, aber es war nicht der phosphoreszierende Schein, der Montaubes tote Soldaten eingehüllt hatte, sondern es war das selbe fahle, bläulich-weiße Licht, in das dies verfluchte Land bei Tag gebettet war und das von überall und nirgendwoher zu kommen schien.
Jaisel starrte in diesen Lichtschein, und plötzlich sah sie ein Gesicht in ihm tanzen. Es war kein Zweifel möglich. Das mussten die letzten Überreste von Maudras sein, den man verbannt hatte. Sein bösartiger Geist hatte offensichtlich Urlaub von der Hölle genommen, um noch weiter sein Unwesen auf der Erde zu treiben. Es war eine schreckliche, abgemagerte Fratze mit tief in den Höhlen liegenden Augen und verzerrtem Mund.
Diese Fratze starrte sie mit unverhohlenem Hass an, aber auch mit Entsetzen und Überraschung, und der grässliche Blick versuchte ihren Willen zu brechen und ihren eigenen Blick zu Boden zu zwingen.
Aber irgendetwas in dieser Fratze amüsierte sie so sehr, dass sie in ein schallendes, übermütiges Gelächter ausbrach, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen - und sie begriff, noch bevor sie es sah.
Das Licht verlosch eine Sekunde später, und das Schloss begann polternd einzustürzen. Sie rannte zu Renier hinüber und warf sich über seinen leblosen Körper, um ihn vor den fallenden Steinen zu schützen.
Jaisel kühlte seine Stirn in dem eisigen Wasser der kleinen Quelle, die sich auf halbem Weg zwischen Schloss und Heerlager befand, aber er war ihr nicht gerade dankbar dafür.
Neben ihnen graste das Pferd ruhig vor sich hin, der Nebel hatte sich verzogen, und eine neue Sonne schoss ihre ersten rosaroten Strahlen über den Horizont. Hundert Meter weiter befand sich das Lager in Aufruhr.
»Soll ich dir etwa glauben, dass es einer kleinen Hure gelungen ist, Maudras' Zauber zu brechen? Bind mir doch keinen Bären auf!«
»Ihr nehmt das alles viel zu schwer - wie üblich«, gab ihm Jaisel zur Antwort, die von den Ereignissen der Nacht noch ein wenig mitgenommen war. »Jede Frau hätte den Zauber brechen können, aber weibliche Krieger sind halt sehr selten.«
»Es gibt so schon zu viele von ihnen.«
Jaisel stand auf und ging davon, als sie plötzlich Reniers heisere Stimme hinter sich sagen hörte:
»Wartet! Sagt mir noch einmal, was auf dem Stein geschrieben stand.«
Ohne sich umzudrehen, blieb sie stehen und antwortete ihm kurz und knapp: »Ich, Maudras, werfe meinen Bann über dieses Schloss, dass sich ihm kein Mann jemals nähern soll, ohne es zu bereuen, oder es betreten wird, ohne des Todes zu sein. Bis ans Ende aller Tage soll es niemals von eines Mannes Hand bezwungen werden!«
Renier murmelte etwas, was sie nicht verstand.
Sie antwortete aber nicht, sondern setzte ihren Weg unbeirrt fort.
Unerwartet tauchte er neben ihr auf, und während er an ihrer Seite einherschritt, sagte er: »Was, glaubt Ihr, Lady Unverschämt, werden sich da noch alles für düstere Prophezeiungen erfüllen, in denen die Frauen so leichtfertig vergessen wurden?«
»Mehr, als es Sterne am Himmel gibt!«, erwiderte sie grinsend.
Er konnte es zwar noch immer nicht lassen, etwas in seinen Bart zu brummen, aber er begleitete sie doch, ohne sich mit ihr zu streiten, zum Lager zurück.
Blumen als Gesichter, Dornen als Füße
(Flowers For Faces, Thorns For Feet)
In einem Dorf nahe beim Dach der Welt, das von gewaltigen Bergen, deren Gipfel Schwerter aus Schnee waren, gehalten wurde, lebten zwei junge Frauen. Eines Morgens kam die jüngere Frau zu der älteren.
»Annasin«, sagte die jüngere Frau, »ich bin hier, um dich zu warnen.«
»Mich wovor zu warnen?«
»Sie sagen, der Schnee auf dem Pass ist geschmolzen, und ein Mann kommt.«
»Was für ein Mann? Wieso sollte mich das interessieren? Glaubst du, ich suche einen Ehemann?«
»Nein, er ist ein Hexenjäger.«
Da setzte sich die ältere Frau, die gerade mal dreiundzwanzig war, auf ihren Hocker. Sie sagte: »Ich bin keine Hexe.«
»Nicht? Andere behaupten etwas anderes. Und außerdem war ich überall im Dorf und habe diese Neuigkeit verbreitet, und viele Frauen, denen ich es erzählt habe, wurden leichenblass und haben gesagt: Ich bin keine Hexe.«
»Mariset, geh' weg«, sagte Annasin. »Das ist alles Unsinn.«
Mariset nickte und verließ das Haus.
Annasin setzte sich auf ihren Hocker und dachte nach. Sie dachte an den Winter, als sie nur durch ein Fingerschnippen das Feuer zum Brennen brachte. Sie dachte an die Sommernächte, in denen sie auf der Hochwiese getanzt hatte, und wie sie später scheinbar zum Mond hinaufgeschwebt war. Und sie hatte Zahnschmerzen und Husten geheilt. Und bei einem
Mann, der versucht hatte, im Wald Hand an sie zu legen, hatte sie dafür gesorgt, dass er sich vor Bauchgrimmen krümmte.
Annasin schob ihre Kekse zum Backen in den Herd, aber ihr Herz war schwer wie Blei. Eine Stunde später stolzierte eine schlanke, graue Katze, fahl wie der erste Morgenschimmer, durch die offene Tür in ihr Haus.
»Komm mit mir, Annasin«, sagte die Katze. »Komm mit mir, das musst du.« Die Katze redete in der Menschensprache, und als Annasin das hörte, spürte sie, wie sie schrumpfte, und dann stand sie auf vier Pfoten auf dem Boden, hatte die spitzen Ohren am Kopf aufgestellt, den Schwanz im Mehl und den Geruch backender Kekse in der dunkelgrauen Nase.
»Ein Eimer Wasser für dich, Mariset«, sagte Annasin.
»Komm mit«, sagte Mariset.
Gemeinsam stolzierten sie aus dem Haus und die Straße entlang.
Niemand schenkte zwei Katzen Beachtung. Sie liefen hinter den Holzhandlungen und unter den Schatten von Ziegenpferchen hindurch, und nicht einmal die Ziegen, deren gelbe Augen nicht gelber waren als die Augen von Annasin und Mariset, versuchten sie aufzuhalten.
Annasin und Mariset kamen zu einem Hügel über dem Dorf. Sie liefen den Hügel hinauf und dann einen anderen Hügel, durch die Kiefernwälder, bis sie zu den Hochwiesen gelangten, wohin im Sommer die Ziegen zum Weiden gebracht wurden. Hier wuchsen bereits erste Grassprossen, und ringsum erhoben sich die Schwertberge und dann der Himmel.
»Gehen wir zum Wasserfall«, sagte Mariset.
Und so liefen sie auf dem feuchten Boden des Hügels entlang zum Fuß der Berge, wo ein weißer Schwall Wasser entsprang. Und hinter dem Wasserfall setzten sie sich in einer Höhle blauer Blumen auf einen moosbewachsenen Stein, die beiden Katzen.
»Jetzt sind wir verloren«, sagte Annasin.
»Nein, wir sind in Sicherheit«, antwortete Mariset.
Aber Annasin erinnerte sich überdeutlich, wie sie ihren jungen Körper im Haus vor dem Herd hatte sitzen lassen, und sie wusste, auch Mariset hatte ihren jüngeren Körper in ihrem Haus nahe der Kirche gelassen.
»Was werden sie von uns denken?«, fragte Annasin.
»Sie werden sagen, unsere Seelen sind aus uns gewichen«, sagte Mariset, »und uns in Ruhe lassen.«
»Das glaube ich nicht.«
Mariset wälzte sich in den Blumen auf dem Rücken. »Es gibt schlimmere Schicksale, als eine Katze zu sein.«
Annasin stimmte zu. »Zum Beispiel den Tod.«
»Wer weiß«, sagte eine Stimme, »ob es schlimmer ist, tot oder lebendig zu sein.«
Und vor der Höhle stand eine dritte Katze. Ein Kater, wie sie alle deutlich sehen konnten, denn seine Hoden, fest wie Walnüsse in einem Futteral glänzenden, schwarzen Fells, zeigte er ihnen, immer höflich, als Erstes. Dann ließ er den seidigen schwarzen Schwanz sinken, kam näher und stupste höflich ihre beiden Nasen mit seiner an. Er war vollkommen schwarz, sogar seine Zunge, mit Ausnahme einer einzigen Stelle, gelb wie eine Butterblume, zwischen seinen pechschwarzen Augen.
»Nun«, sagte der schwarze Kater, »werden wir in der Katzensprache sprechen.«
»Bedaure, Sir, aber die kennen wir nicht«, sagte Mariset. »Wir sind keine echten Katzen.«
»Oh, dann wird es aber Zeit, dass ihr sie lernt«, sagte der Kater, »denn mir kommt ihr echt genug vor. Als Erstes«, sagte er, »will ich euch meinen Namen sagen. Man nennt mich Pfeil.« Annasin und Mariset sahen einander mit ihren Butterblumenaugen an. Tatsache war, der Kater hatte in einer anderen Sprache gesprochen, aber beide Frauen verstanden sie sofort perfekt. Und als sie die Sprache ausprobierten, stellten sie beide fest, dass sie sie auch fließend sprachen.
»Pfeil ist ein schöner Name«, sagte Mariset. »Aber wer hat dich so genannt?«
»Ich selbst, denn einst hatte ich einen anderen Namen. Ich habe mich so nach meinem schnurgeraden Fall getauft.«
»Deinem Fall«, sagte Annasin. »Demnach bist du irgendwo heruntergefallen.«
Der schwarze Kater sah sie fragend an. »So ist es in der Tat. Und muss ich euch sagen, wo?«
Mariset gab ein nervöses Maunzen von sich, während Annasin nach einem imaginären Floh suchte. Beide begriffen, dass sie ein Gespräch mit einem gefallenen Engel führten.
Pfeil hingegen blieb vollkommen entspannt und legte sich zwischen den Blumen nieder. Er sagte gelassen: »Es war ein großer Streit um eine Kleinigkeit. Könnt ihr es erraten?«
»Du wolltest König sein«, sagte Mariset risikofreudig.
Der schwarze Kater lachte nach Art der Katzen. Er sagte: »Warum sollte ich, oder irgendjemand von uns, das wollen? Der König hat die ganze Arbeit. Wir waren recht glücklich. Nein, es verhält sich folgendermaßen. Wisst ihr, wir hatten sie im Garten gesehen, die Frau und den Mann. Und wir sagten unter uns: Seht her, er hat sie verschieden geschaffen. Der Mann ist fast so weise wie die Frau, aber nicht ganz. Das ist sicher ungerecht. Und so redeten wir mit Ihm, denn in jenen Tagen war Er recht umgänglich. Er schien überrascht und sagte uns, wir würden uns irren, denn es sei sein Plan gewesen, sie, den Mann und die Frau, anders herum zu erschaffen - sie geringer als ihn. Und unser Prinz - ihr werdet seinen Namen kennen - der lachte, lachte so sehr, bis er ohnmächtig wurde. Wie hübsch er aussah, als er Ihm so zu Füßen lag, mit seinen ausgebreiteten Schwingen und dem goldenen Haar. Aber dann wurde Er wütend. Er hat uns verstoßen. Wir fielen. Aber wir waren zuerst aus den Kristallfenstern gesprungen.«
Annasin putzte sich hinter dem Ohr. Sie gab keinen Kommentar ab. Aber Mariset, die Jüngere, lief los und spielte mit Pfeil, der ein gefallener Engel war. Sie wälzten sich und strampelten, bissen einander und lachten schrill miauend.
Schließlich sagte Annasin: »Also sind wir echte Hexen.«
»Und beinahe echte Katzen«, sagte Pfeil und sprang auf einen Stein, ehe Mariset an seinem Schwanz knabbern konnte. »Aber auch Katzen werden manchmal verkannt. Sie haben hübsche Gesichter, wie die Blumen, aber spitze Zähne im Mund und scharfe Krallen an den Füßen, genau wie Dornen, nur schneller.«
»Unsere beiden Körper«, sagte Annasin, »sitzen in unseren Häusern.«
»Vielleicht wird niemand sie finden«, sagte Mariset.
Dann liefen sie zu dem Bach, der unter dem Wasserfall begann, und dort fischten sie ihr Essen und verzehrten es. Sie aßen es natürlich roh, und Fisch hatte niemals so köstlich geschmeckt, kalt und frisch aus dem Bergbach.
Als sie fertig waren, gingen sie wieder die Hügel hinab und sahen in der Dämmerung unten das Dorf, wo trübe rote Lichter brannten und Rauch aus den meisten Kaminen aufstieg. Zwei Pferde standen vor dem Gasthaus, wo Reisende abstiegen, und dort stand eine helle Lampe im Fenster.
»Er ist da, der Hexenjäger«, sagte Annasin.
»Ein Glück, dass wir Katzen sind«, meinte Mariset.
»Ich werde euch eine Geschichte erzählen«, sagte Pfeil. Und das machte er.
Die erste Geschichte - Die Herdkatze
Es war einmal eine Frau, die hatte in ihrem Leben nie etwas Schönes gesehen, außer vielleicht den Himmel, aber sie hatte kaum Zeit, ihn zu bewundern. Seit ihrer Geburt lebte sie in einem kahlen und öden Land, und mit dreizehn wurde sie mit einem grausamen Dummkopf verheiratet, der sie wie eine Sklavin behandelte und häufig schlug. Sie hatte Todesangst vor ihm. Er für seinen Teil hasste sie, wie überhaupt alles, außer essen und schlafen und trinken. Er wohnte seiner Frau nicht einmal bei, nachdem er sie einige Male im Bett gehabt hatte, weil er zu träge dazu war. Sie war froh, diesbezüglich in Ruhe gelassen zu werden, und schlief auf dem Boden, auf den kahlen Brettern neben seinem Sofa, mit dem Kopf auf einem Bündel Stroh und einer alten Decke, die sie über sich zog.
Es kam ein grässlicher Winter, der einem langen Atemzug aus der Eiseshölle gleichkam. In dieser Gegend fiel der Schnee dicht und gefror wie Glas. Auch auf das hässliche Haus des Mannes fiel er und überzog es, bis es aussah wie ein schmutziger Zuckerwürfel. Jeden Morgen bahnte sich die Frau unter Mühen einen Weg zum Brunnen und schlug mit einem Stock Eis lose. Den ganzen Tag kümmerte sie sich um das Feuer im Herd. Im Sommer war sie zum Markt gegangen und hatte auf den Schultern einen Sack Scheite nach Hause getragen, denn es gab keine Bäume in der Nähe. Nun unterhielt sie mit den Scheiten das Winterfeuer, damit der Mann bequem in seinem Sessel sitzen konnte. Und auf dem Herdfeuer kochte sie ihm sein Essen und wärmte mit einem heißen Eisenstab das Bier, das er trank. Sie aber trank das eiskalte Wasser aus dem Brunnen und aß die Krumen, die er übrig ließ. Den Rest des Tages ging die Frau ihrer Arbeit nach, putzte das Haus, schrubbte die Töpfe und wusch die Kleidung, aber die beiden letzten Aufgaben erledigte sie in der Waschküche in bitterer Kälte, weil er nicht mochte, wenn sie ihn störte.
Am Abend zündete sie für ihn die Lampe an und bereitete sein Essen zu. Dann stieg er die Leiter zu seinem Bett hinauf, und wenn sie ihn den ganzen Tag nicht erzürnt hatte, schlug er sie nicht. Aber häufig schlug er sie doch, und manchmal tropfte ihr rotes Blut auf den Boden des Hauses.
Wenn er ins Bett gegangen war, saß die Frau allein am Herdfeuer, das langsam niederbrannte, denn ihr war nicht gestattet, es brennen zu lassen, wenn der Mann sich zurückgezogen hatte. Nichtsdestotrotz schaute sie in die goldene Glut, und manchmal träumte sie ein wenig, aber nie von angemessenen Dingen, denn man hatte ihr nie etwas erzählt, das der Träume wert gewesen wäre, und sie hatte auch nie etwas gesehen. Und auch wenn die Glut auf ihre Weise wunderschön war, bedeutete sie für die Frau, dass die kalte Nacht kam, ihr unruhiger Schlaf auf den harten Dielen und der freudlose Morgen.
Eines Morgens in diesem Winter wachte die Frau wie immer auf, als das erste, kalte Licht der Dämmerung zu sehen war. Sie erhob sich steif und wund von ihrem elenden Lager, und der Mann räkelte sich in seinen Fellen und Laken und sagte: »Mach nicht solchen Lärm, du verfluchte Kuh.«
Dann schlich sie nach unten, ging zum Herd, schichtete Scheite auf und entfachte das Feuer mit Anfeuerholz; wenn sie das alles erledigt hatte, wärmte sie sich ein paar Minuten. Wenn sie die Haustür aufmachte, begrüßte sie wie immer der Winter, als wäre der Sommer gestorben und würde nie mehr wiederkehren. Kahl wie der Tod erstreckte sich die weiße Ebene des Landes und vereinigte sich irgendwann mit dem niederen, weißen Himmel. Die Frau nahm ihren Eimer und ging hinaus, wo die Kälte ihr so brutal zusetzte wie der Mann manchmal, plötzlich und tückisch, und da stand sie mit ihrem Elend mitten in der Wildnis, als plötzlich ein kalter Sonnenstrahl durch die Wolken brach. Da sah die Frau, dass sich auf dem toten Antlitz der Welt außer ihr noch etwas bewegte.
Erstaunt sah sie hin und stellte schließlich fest, dass es eine Katze war. Sie hatte vorher noch nie eine gesehen, nur von ihnen gehört, aber niemals, dachte sie, von so einer. Denn es war eine Katze von der Farbe einer Orange, schlank und seidig, mit zwei bernsteinfarbenen Juwelen als Augen im Kopf. Als die orangefarbene Katze die Frau in ihren Lumpen an der Tür stehen sah, kam sie zu ihr gelaufen und gab dabei leise musikalische Töne von sich.
Sofort ging der Frau das einsame Herz über. Sie bückte sich und streichelte die Katze. Sie fühlte sich angenehmer als Seide an und war warm wie ein frischer Kuchen.
»Oh, meine Schönheit«, sagte die Frau.
Aber in diesem Moment hörte sie die lauten Schritte des Mannes, der die Treppe im Haus herunterkam, und einen weiteren Moment später stand er hinter ihr an der Haustür.
»Was stehst du hier herum, dumme Kuh?«, sagte er und gab ihr einen Schlag auf den Kopf. »Geh Wasser holen. Wo ist mein Bier? Wofür habe ich dich, du dumme Schlampe.«
Und da sah er die Katze, die so hell im weißen Schnee leuchtete wie ein Stückchen der Sommersonne.
»Und was ist das für ein dreckiges Vieh? He, du Mähre, hast du die ganze Zeit heimlich ein Schoßkätzchen gehalten? Ihm mein Essen gegeben?« Und er belohnte die Frau mit einem Stoß, sodass sie umfiel, und holte zu einem kräftigen Tritt gegen die Katze aus, aber die Katze schoss wie ein Blitz durch den Schnee davon. Da hob der Mann einen Stein neben der Tür auf und warf ihn nach der Katze, verfehlte sie aber, da sie um die Waschküche verschwand. »Denk daran«, sagte der Mann. »Wenn ich das Vieh erwische, ziehe ich ihm die Haut ab. Ich mache mir einen Kragen daraus.« Mit diesen Worten ging er ins Haus zurück, denn es war zu kalt, um im Freien eine Tracht Prügel zu verabreichen.
Es war der Frau nie eingefallen zu weinen, aber als sie jetzt zum Brunnen stolperte, da weinte sie, und die Tränen gefroren ihr auf dem Gesicht. Sie dachte: Was soll draußen, in der bitteren Kälte nur aus der Katze werden? Doch dann stand sie vor dem Brunnen, hackte Eis los und lief hastig zurück, um dem Mann sein Essen zu machen.
Die Frau dachte den ganzen Tag an die Katze. Sie dachte voll Staunen und Furcht an sie, denn wie sollte das Tier im dichten Schnee überleben? Als sie die Töpfe schrubben ging, ließ sie die Tür der Waschküche offen stehen, falls die Katze kommen und dort Schutz suchen würde, aber sie konnte das Tier nicht sehen.
Was den Mann angeht, er verlor kein Wort mehr über die Katze, aber er hatte seine Schlinge und das Messer hervorgeholt und schärfte die Klinge, bis blaue Funken flogen. Während der Tag von Grau zu Dunkelheit wechselte, stand er sogar einmal auf und ging zur Tür, setzte aber keinen Schritt davor. Der Schnee war so hart, dass man keine Fußspuren darauf erkennen konnte, nicht einmal die der Frau von ihren zahlreichen Besorgungen, geschweige denn von den leichten Pfoten einer Katze.
Die Frau wärmte das Bier und brachte es dem Mann, der trank und trank und sich dann in seinen Sessel setzte, und sie dachte: Vielleicht vergisst er es.
Aber sie vergaß es nicht. Sie fragte sich, wie es der Katze ergehen mochte.